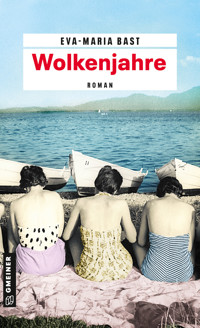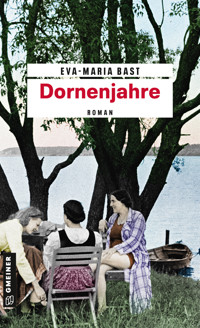10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Juwelier-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Magie der Edelsteine.
Antoinette und Louis-François Cartier erfüllen sich einen Traum: Sie eröffnen ihr Juweliergeschäft in der Nähe des prestigeträchtigen Palais Royal. Nach unruhigen Zeiten bricht unter Kaiser Napoleon III. eine neue Ära für die Pariser Juweliere an, und der Laden der Cartiers wird schon bald zu einer exquisiten Adresse. Dann wird Louis-François mit der Umarbeitung der Kronjuwelen betraut, und Antoinette entwirft fieberhaft Schmuckstücke für die Kollektion Cartier. Kann sie mit ihren außergewöhnlichen Kreationen die Kaiserin Eugénie überzeugen?
Inspiriert von der Erfolgsgeschichte der Schmuckdynastie Cartier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Der wissbegierigen und klugen Antoinette ist ein einfaches Leben als Marktverkäuferin vorbestimmt. Dann lernt sie Louis-François Cartier kennen und lieben, und gemeinsam träumen sie von einem besseren Leben. Antoinette kämpft dafür, sich ihre Eigenständigkeit zu bewahren und prägt mit ihren Entwürfen und ihrem Wissen über die Besonderheiten der Edelsteine die Kollektion Cartier. Völlig unerwartet kommt sie dabei der Wahrheit um den Diebstahl des äußerst wertvollen Bleu de France, der zu den Kronjuwelen gehörte, nahe – näher als ihr lieb ist …
Über Eva-Maria Bast
Eva-Maria Bast ist Journalistin und Autorin mehrerer Sachbücher, Krimis und zeitgeschichtlicher Romane. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Als eine Hälfte des Autorenduos Charlotte Jacobi schrieb sie u. a. den Spiegel-Bestseller »Die Douglas-Schwestern«. Die Autorin lebt am Bodensee.
Im Aufbau Taschenbuch sind von ihr bisher die Bände der Saga »Die Frauen der Backmanufaktur« sowie der Roman »Die Frauen von Notre Dame« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Eva-Maria Bast
Der Schmuckpalast – Antoinette und das Funkeln der Edelsteine
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil 1 — 1834
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil 2 — 1840 und 1846–1853
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Teil 3 — 1850–1859
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Epilog
Wie es weiterging und Spuren der Realität
Danksagung
Literatur und Quellen
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Prolog
Geduckt schlich die kleine, zierliche Frau hinter den beiden Männern durch die engen Gassen von Paris. Kein Mond war am Himmel zu sehen – und auch die Sterne leuchteten nicht. Es gab eine Dunkelheit, die weich und samtig war, die einen einhüllte, die der schützenden Umarmung einer liebenden Mutter glich. Die Dunkelheit, die sich heute über die schlafende Stadt gelegt hatte, war jedoch hart, kalt und bedrohlich. Wahrscheinlich, dachte Manon bitter, verschloss der Himmel seine Augen vor all dem Schrecklichen, das da gerade unten auf der Welt vor sich ging.
Doch wenn ihr die Dunkelheit auch einiges Unbehagen bereitete, war es ihr eigentlich sehr recht, dass kaum Licht in die Straßen drang. Denn wo es kein Licht gab, war auch die Gefahr geringer, entdeckt zu werden. Es war der 11. September 1792 und Frankreichs König war kein König mehr. Einen Monat zuvor, am 10. August, hatten die Revolutionäre die Tuilerien gestürmt und Ludwig XVI. abgesetzt, mitsamt seiner Gemahlin Marie Antoinette, der ungeliebten, verschwendungssüchtigen Autrichienne. Der König hatte keine Macht mehr – und Frankreich versank im Chaos. Um die Kronjuwelen und deren Schutz sorgte sich in jenen Tagen, wo jeder um sein Leben bangte, kaum einer. Außer der Frau und den beiden Männern, die nun auf dem Weg zum Hôtel du Garde-Meuble an der Place Louis-François XV. waren, wo sich die Kronjuwelen befanden.
Das Hôtel du Garde-Meuble war eine Institution. Gegründet worden war es im Jahr 1663 von Ludwig XIV. und Colbert, seinem Finanzminister, mit dem Ziel, von hier aus die königlichen Residenzen einzurichten und Möbel zu restaurieren. Und nun wurden hier eben nicht nur Inventar, sondern auch die Kronjuwelen aufbewahrt. Sie konnten jeden ersten Dienstag im Monat besichtigt werden. Manon war jedes Mal gekommen und hatte sich in diese wunderbaren Schmuckstücke hineingeträumt, sich nach und nach ein tiefes und umfassendes Wissen über die Kronjuwelen erschlossen. Dieser Schatz bestand aus nicht weniger als neuntausend Diamanten, fünfhundert Perlen und fünfhundert weiteren Edelsteinen. Besonders angetan hatte es ihr der Bleu de France, bei dem es sich, wie Manon erfahren hatte, um einen der schönsten Diamanten handelte, der jemals gefunden worden war. Manons Herz hatte immer ein wenig höher geschlagen, wenn sie die Kronjuwelen betrachtet und sich bewusst gemacht hatte, wie alt diese Steine schon waren, die da so wunderbar funkelnd und verheißungsvoll vor ihr lagen. Und einige von ihnen waren schon viele, viele Jahrhunderte beisammen: Immerhin war die Sammlung bereits 1530 von Franz I. begründet und inventarisiert worden, bevor der Sonnenkönig sie erheblich erweitert hatte. Die Steine dieser Sammlung waren auf teils sehr abenteuerliche Weise in den Besitz der französischen Krone gelangt, waren von den bedeutendsten Herrschern getragen worden und nun, heute Abend, sollte sie, Manon Plisset aus einem ärmlichen Faubourg, sie bekommen. Eine ungeheure Vorstellung, die ihr Herz sogleich schneller schlagen ließ. Frankreich stand Kopf, keiner achtete auf diese Schätze: Welcher Zeitpunkt könnte besser sein als dieser, um die Juwelen zu stehlen?
Manon war derart in ihre Träume versunken gewesen, dass sie nicht auf den Weg geachtet und vergessen hatte, dass der Platz, auf dem das Hôtel du Garde-Meuble stand, von einem Graben umgeben war. Sie trat halb hinein, knickte um, ein stechender Schmerz fuhr ihr in den Knöchel und breitete sich in rasender Geschwindigkeit nach oben bis zu ihrem Knie aus. In letzter Sekunde konnte sie den lauten Aufschrei, der sich ihrer Kehle entringen wollte, in ein leises Fluchen umwandeln. Doch selbst das war zu viel. Sofort fuhr Paul, der Anführer ihrer kleinen Gruppe, zu ihr herum. »Wirst du wohl still sein!«, fauchte er. »Ich wusste doch, dass es keine gute Idee sein würde, eine Frau mitzunehmen.«
»Halt die Klappe!«, erwiderte Manon, die den 35-Jährigen ganz und gar nicht leiden mochte. Paul Miette hatte gemeinsam mit ihrem derzeitigen Liebhaber Pierre Deslandes im Gefängnis La Force eingesessen – wegen Betrugs. Im Zuge der Wirren um die jüngst erfolgten Septembermorde, bei denen die Revolutionäre brutal gegen inhaftierte politische Widersacher und andere Gefängnisinsassen vorgingen, war den beiden die Flucht gelungen – und Paul hatte wertvolle Informationen aus dem Gefängnis mitgebracht: Dass die Kronjuwelen kaum bewacht wurden! In den folgenden Wochen waren sie oft dort gewesen und hatten sich davon überzeugt, was sie im Gefängnis gehört hatten. Tatsächlich: Paul und Pierre waren sicher, dass es denkbar einfach wäre, hier einzubrechen und die Kronjuwelen zu stehlen.
»Ich hatte nur vergessen, dass die Place Louis-François XV. von einem Graben umgeben ist. Das hätte dir auch passieren können«, zischte Manon nun in Richtung ihres Begleiters.
Paul knurrte etwas Unverständliches, während Pierre mahnte: »Still jetzt. Sonst entdeckt uns die Nationalgarde doch noch. Wir haben nun wirklich keine Zeit für Streitereien.«
Manon blickte zum Torhaus hinüber, wo die Nationalgarde stationiert war. Sie sah die Männer im Schein einer Lampe am Tisch sitzen und sich unterhalten. Gut so. Sie war sich ziemlich sicher, dass sie keinerlei Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden: Bis auf zwei düstere Funzeln, die an den Seiten des Hôtel du Garde-Meuble angebracht waren, gab es hier keine Beleuchtung. Wenn sie diesen Lichtkegel umgingen, hatten die Nationalgardisten gar keine Möglichkeit, sie zu entdecken.
Ohnehin, da war sie sich eigentlich sicher, war die Nationalgarde ziemlich desorganisiert und desorientiert. Der langjährige Intendant der Garde-Meuble war erst vor zwölf Tagen umgebracht worden. Jetzt stand ein Maler dem so bedeutenden Ort vor. Ein gewisser Jean-Bernard Restout, der im Vorjahr eine Bestandsaufnahme über die Kronjuwelen gemacht und einen Wert von vierundzwanzig Millionen Livres ermittelt hatte. Eine enorme Summe. Manon spürte ihr Herz schneller schlagen, wenn sie an diese Schätze dachte, die dort, im ersten Stock des Gebäudes, das sie nun erreicht hatten, in einer verriegelten Kammer in Schränken und Kisten aufbewahrt wurden. Bald würden sie ihr gehören.
*
Jean-Bernard Restout fand keinen Schlaf. Die Aufgabe, die der neue Innenminister Jean-Marie Roland ihm zugedacht hatte, mochte zwar ehrenvoll sein, aber sie war ihm zu groß. Vor allem, weil er sich alleingelassen fühlte. Sträflich alleingelassen! Seine Aufgabe war nicht weniger als die Bewachung der Kronjuwelen – und diese sollte er mit gerade mal einem Dutzend Männern bewerkstelligen! Er hätte mindestens fünfmal so viele gebraucht! Als er heute Morgen ins Hôtel du Garde-Meuble gekommen war, hatte er den Wachmann zu seinem Entsetzen schlafend angetroffen. Restout hatte ihn angebrüllt und dem armen Mann, der sofort hochfuhr und sich kerzengerade hinsetzte, als könne er den Schlaf durch eine gerade Körperhaltung ungeschehen machen, Fahrlässigkeit vorgeworfen – dabei wusste er doch sehr gut, dass diesen ganz und gar keine Schuld traf! Der Wachmann war sechzig Stunden lang am Stück im Dienst gewesen, weil seine Ablöse erkrankt war und Restout niemanden gehabt hatte, der ihn hätte ersetzen können. Wenn sich erst einmal herumspräche, wie schlecht die Juwelen bewacht waren, dann würde sich eine Katastrophe ereignen.
Mit einem Schnauben schlug er die Bettdecke zurück und erhob sich. Es ließ ihm einfach keine Ruhe. Er würde selbst nachsehen, ob alles in Ordnung war. Und anschließend würde er sich an seinen Sekretär setzen und den Dutzendsten Beschwerdebrief an Monsieur Santerre schreiben – bei ihm handelte es sich um den Oberbefehlshaber der Nationalgarde. Und auch an Generaladjutant Doucet wollte er – wieder einmal – schreiben und auf den Missstand hinweisen, bevor es zu spät war. Mehr konnte er nicht tun.
Restout küsste seine schlafende Gattin, die von seiner Schlaflosigkeit und seiner Unruhe nicht das Mindeste mitbekommen hatte, auf die Wange und stand dann leise auf, um seinen Schlafrock abzulegen und sich für den nächtlichen Spaziergang anzukleiden. Zehn Minuten später trat er aus dem Haus. Er blickte nach oben. Kein Stern war am Himmel zu sehen.
*
»Hier. Wir klettern an diesen Laternen nach oben«, entschied Paul, als sie gleich darauf am Gebäude angekommen waren.
»Ist das nicht viel zu gefährlich?«, wandte Manon ein. »Der, der dort hinaufklettert, wird regelrecht beleuchtet.«
»Aber die Nationalgarde macht nur einmal in der Stunde eine Patrouille, das haben wir doch in den letzten Nächten beobachtet«, sagte Pierre. »Und in der Zwischenzeit sitzen sie drinnen am Tisch und spielen Karten.« Er deutete mit dem Kinn in Richtung Torhaus, wo die Wache, wie durch die erleuchteten Fenster deutlich zu erkennen war, tatsächlich immer noch fröhlich beisammensaß.
»Und wenn doch einmal einer zum Fenster hinausblickt?«, war Manon noch nicht überzeugt.
»Was kann er dann sehen? Einen dunklen Innenhof, da die Laternen zum Glück auf der anderen Seite des Gebäudes angebracht sind.«
»Also schön«, gab Manon nach.
»Wie gnädig, dass Madame ihre Einwilligung erteilt«, funkelte Paul sie an.
Manon funkelte zurück.
»Ich erteile nicht nur meine Einwilligung, ich klettere auch hoch.«
»Kommt nicht infrage«, versetzte Paul. »Du versaust uns noch das ganze Geschäft. Hast uns ja vorhin durch deine Schreierei fast verraten.«
Ich habe nicht geschrien, wollte Manon einwenden, doch stattdessen hielt sie den Mund. Es hatte keinen Sinn, sich jetzt zu verteidigen. Da bekam sie unerwarteterweise Hilfe von Pierre. »Lass sie klettern«, sagte er. »Sie kann das besser als wir alle zusammen.«
»Also schön«, knurrte Paul und fügte noch eine Drohung hinzu: »Aber wenn es schiefgeht, seid ihr beide dran.« Dann sagte er: »Ich klettere ebenfalls hinauf und du, Pierre, stehst Schmiere.«
Manon nickte. Mit der Hand tastete sie nach dem Glasschneider, um sich zu vergewissern, dass dieser sicher verwahrt in ihrer Tasche steckte, dann band sie sich den Rock mit geschickten Bewegungen hoch, so dass er sie nicht beim Klettern behinderte. Ob das nun schicklich war oder nicht, war ihr in diesem Moment egal. Sodann machte sie sich an den Aufstieg und stellte fest, wie mühelos ihr das gelang. Sie war stolz auf ihren Körper: klein, drahtig und stark. Sie konnte sich immer auf ihn verlassen und vermochte ihre Kräfte perfekt einzuschätzen. Sekunden später war sie oben angekommen und stellte sich auf den winzigen, schmalen Vorsprung. Dann zog sie den Glasschneider aus der Rocktasche und setzte ihn an die Scheibe an. Es ging ganz einfach, und Manon schnitt so sorgsam, dass sie die Scheibe herausnehmen konnte, bevor sie zur Seite kippte. Sie schob erst die Scheibe ins Innere des Gebäudes – ganz langsam und vorsichtig, damit sie nicht zu Bruch ging und Lärm verursachte – und lehnte sie innen an die Wand. Dann kroch sie hinein, öffnete das Fenster durch Drehen des Griffs und winkte Paul, der unten stand und nach oben blickte, zu sich. Mit flinken Bewegungen stieg er zu ihr hinauf, während Manon sich bereits in dem dunklen Raum umsah. Ihr Herz raste und ihr Blick flog in dem Zimmer umher. Das dort hinten an der Wand, das musste die Tür zur Schatzkammer sein. Sie war versiegelt, aber das spielte keine Rolle.
Inzwischen war Paul bei ihr angelangt.
Sie nickten einander zu, brachen das Siegel und öffneten die Tür. Und dann standen sie in einem kleinen Raum voller Truhen und Vitrinen.
»Da sind sie ja, die Schätzchen«, murmelte Paul. »Schließ die Tür wieder, dann kann ich eine Öllampe entzünden.«
Er zog ein Werkzeug aus seiner Tasche, das er geschickt an einer der Truhen ansetzte. Mit einer raschen Bewegung brach er das Schloss. Es knackte.
Dann klappte er den Truhendeckel nach oben – und Manon schnappte nach Luft. Die Truhe war bis zum Rand gefüllt mit den kostbarsten Juwelen. Paul begann bereits, mit vollen Händen hineinzugreifen und sie sich in die Taschen zu stopfen. »Nun mach schon«, fuhr er sie an. »Wir haben keine Zeit zu verlieren.«
Da erwachte Manon aus ihrer Trance und auch sie griff zu. Zaghafter und ehrfürchtiger vielleicht als Paul, aber dennoch voller Entschlossenheit. Sie konnte es kaum glauben. Das waren tatsächlich die Kronjuwelen, in die sie da soeben ihre Finger tauchte!
*
Restout hatte das Hôtel du Garde-Meuble inzwischen erreicht. Mit einer gewissen Verärgerung bemerkte er, dass die Garde im Torhaus Karten spielte, anstatt zu patrouillieren. Andererseits wusste er, dass er keine Handhabe hatte, den Männern Vorwürfe zu machen. Sie alle arbeiteten viel mehr als sie mussten, da sollte er ihnen diese Pausen gönnen. Er beschloss, sie nicht aufzuschrecken, sondern sich selbst zu vergewissern, dass alles in Ordnung war. Inzwischen hatte er diesbezüglich auch ein viel besseres Gefühl. Es war nur einfach die Last der Verantwortung, die ihn nachts aus dem Bett trieb. Und wenn er nachher zu Hause eintraf, würde er seinen Vorsatz in die Tat umsetzen, sich an seinen Sekretär begeben und mit Nachdruck mehr Unterstützung einfordern.
Er zog seinen Schlüssel aus der Tasche, sperrte die Eingangstür auf und stieg über das Treppenhaus nach oben.
*
Manon, die sich gerade ein besonders prachtvolles Stück in die Tasche geschoben hatte, erstarrte in der Bewegung. »Das hörte sich so an, als sei unten eine Tür ins Schloss gefallen.«
Paul hob den Kopf und lauschte. »Ja«, erwiderte er. »Da sind Schritte auf der Treppe. Das Treppenhaus endet im ersten Raum, wir sind durch den letzten eingestiegen. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir das.« Hastig löschte er die Öllampe und schlüpfte dann aus der Tür, während Manon reflexartig noch schnell sowohl den Truhendeckel als auch die Tür zur Schatzkammer schloss. Wenn der Eintreffende das gebrochene Siegel, das aufgebrochene Schloss und das herausgeschnittene Fenster nicht bemerkte, gab es nichts, was auf den Einbruch hindeutete. Lautlos eilte sie hinter Paul in Richtung Fenster.
*
Das merkwürdige Gefühl war wieder da, als Restout den ersten Stock erreicht hatte. Lauschend blieb er stehen. War dort, in einem der hinteren Räume, nicht ein Geräusch gewesen? Und lag nicht der Duft einer eben erloschenen Öllampe in der Luft? So leise er konnte, eilte er weiter, von Raum zu Raum und sah sich überall akribisch um. Er konnte nichts feststellen. Die Räume waren eindeutig leer. Um ganz sicherzugehen, entzündete er noch jeweils die Öllampen in den Zimmern. Er hatte sich wohl getäuscht. Hier war niemand. Auch die Tür zur Schatzkammer fand er geschlossen vor. Um ganz sicherzugehen, dass dort alles in Ordnung war, wollte er gerade darauf zusteuern, als er auf der Treppe lautes Poltern hörte. »Keine Bewegung!«, brüllte eine Stimme, und im nächsten Moment sah er sich seinen Kollegen der Nationalgarde gegenüber. Als sie ihn erkannten, ließen sie verblüfft die Waffen sinken.
*
Unten auf der Straße verbargen sich Manon, Pierre und Paul hinter einem Mauervorsprung. Außer Atem beobachteten sie, wie die Nationalgarde aufgeregt aus dem Torhaus und in Richtung Hôtel du Garde-Meuble stürmte. Etwa zehn Minuten später kehrten die Männer zurück. Bei ihnen war ein weiterer Mann in Zivil. »Tut mir leid, dass ich Sie so aufgeschreckt habe, indem ich das Licht entzündet habe«, hörten sie ihn sagen. »Aber ich hatte plötzlich ein ganz komisches Gefühl und wollte mich persönlich überzeugen, dass alles in Ordnung ist.«
»Das ist doch kein Problem, Monsieur Restout«, sagte einer der Gardisten ehrerbietig. »Besser man sieht einmal zu viel nach. Und uns ist auch gar nichts Verdächtiges aufgefallen.«
»Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht«, sagte der Mann in Zivil.
»Gute Nacht, Monsieur Restout.«
Manon unterdrückte ein Kichern. Das war tatsächlich kein Geringerer als der Oberaufseher persönlich, dem sie da gerade entkommen waren.
Als Monsieur Restout im Dunkel der Nacht verschwunden war und die Garde sich wieder in ihr Torhaus zurückgezogen hatte, schlichen Manon, Pierre und Paul fort, so leise, wie sie gekommen waren. Nach einer Weile aber begannen sie, getragen von Übermut und Glück, zu rennen. Sie rannten und rannten so schnell sie ihre Beine tragen konnten. Vorbei an den Gärten und der Statue von Ludwig XV., der einst diesen Platz erschaffen ließ, hielten sie sich südlich, bogen dann längs zur Seine ab und folgten dem Fluss für wenige Minuten. In Pauls Wohnung angekommen, leerten sie ihre Schätze auf dessen ungemachtem Bett aus und teilten sie brüderlich untereinander auf. Nur den Stein, nach dem Manon zuletzt gegriffen hatte, den legte sie nicht zu den Schätzen, sondern verbarg ihn tief in ihrer Rocktasche. Es war ein blauer Diamant von ungeheurer Größe. Sie war sich noch nicht ganz sicher – aber sie vermutete, dass es ihr tatsächlich gelungen war, den Bleu de France zu stehlen!
Teil 1
1834
Kapitel 1
Der Himmel war wolkenverhangen. Aber als Louis-François in der Rue de la Paix angekommen war, setzte sich für einen kurzen Moment die Sonne durch. Ihre Strahlen fielen direkt auf das Schaufenster, auf das der 15-Jährige zusteuerte, und ließen die Auslagen des renommierten Juweliergeschäfts Mellerio glänzen. Er hatte es schon als kleiner Junge auf einem Spaziergang mit seinem Vater entdeckt. Auch damals war ein Sonnenstrahl auf den dort ausgestellten Schmuck gefallen und hatte die Edelsteine derart zum Funkeln gebracht, dass Louis-François Angst bekommen und zu weinen begonnen hatte. Weil ihm die Intensität der Strahlen in den Augen wehgetan hatte, vor allem aber, weil die Sonne auch einen roten Stein zum Funkeln gebracht und Louis-François für einen Moment das Gefühl gehabt hatte, der Stein hätte Feuer gefangen. Lachend hatte sein Vater ihn auf den Arm genommen und ihn ermutigt, noch einmal genau hinzusehen. »Das sind Edelsteine, Louis-François«, hatte er gesagt. »Sie haben eine ungemeine Macht und Kraft, aber sie sind nicht gefährlich. Zumindest«, hatte er hinzugefügt, »nicht für die guten Menschen.«
»Für die bösen also schon?« Misstrauisch hatte der Kleine die Steine beobachtet und fieberhaft überlegt, ob er sich irgendetwas hatte zuschulden kommen lassen. Aber ihm fiel nichts ein. Weder hatte er sein Abendgebet ausfallen lassen noch seine jüngeren Geschwister geärgert.
»Für die ganz bösen, ja«, hatte sein Vater erwidert, der zu ahnen schien, was in seinem Sohn vor sich ging. »Für all jene, die die Steine stehlen wollen.«
»Ach so«, hatte Louis-François erleichtert gesagt. »Dann schützen die Steine sich also selbst.«
»Ja, mein Junge«, hatte Pierre Cartier erwidert. »So könnte man es sagen. Die Steine schützen sich selbst.«
Louis-François hatte diesen Ausflug mit seinem Vater nie vergessen und täglich an die wundervollen Steine gedacht. Leider hatte er den Vater nicht überreden können, ihn noch einmal dorthin zu begleiten. Pierre Cartier hatte schlicht keine Zeit mehr gehabt. In den Folgejahren hatte Louis-François noch weitere Geschwister bekommen, und der Vater hatte immer mehr arbeiten müssen, um sie alle zu ernähren. Aber als er alt genug war, sich ohne Begleitung in der Stadt zu bewegen, war er allein gegangen und hatte sich das Näschen an den Schaufensterscheiben platt gedrückt. Der Türsteher war anfangs misstrauisch gewesen, hatte dann aber begriffen, dass der Junge nichts Böses wollte und sich nach und nach mit ihm angefreundet. Auch jetzt lächelte er ihm freundlich zu.
»Na, Louis-François?«, sagte er. »Auf dem Weg nach Hause?«
»Ja.«
»Und weshalb schaust du so grimmig drein?«
»Weil es für mich nun vorbei ist mit der Schule«, sagte Louis-François. »Nun heißt es arbeiten. Dabei würde ich so gern noch weiter lernen.«
»Sprich doch noch mal mit deinem Vater«, ermutigte der Türsteher. »Immerhin bist du der älteste Sohn.«
»Meinen Sie wirklich?« Leise Hoffnung stieg in Louis-François auf.
»Wenn du es nicht versuchst, dann wirst du es nie erfahren.«
»Da haben Sie recht!«
Louis-François warf noch einen letzten Blick auf die funkelnde Auslage. Inzwischen war er sich sicher, dass die Steine ihm, der er sie so liebte, Glück bringen würden. Dann eilte er so schnell es ging nach Hause und stand kurz darauf keuchend vor seinem Vater. Erstaunt sah Pierre Cartier ihn an.
»Du lieber Himmel, Louis-François! Was ist denn mit dir? Du bist ja ganz außer Atem.«
»Bitte, Vater«, stieß Louis-François hervor. »Ich möchte lernen! Ich muss lernen! Lass mich weiter zur Schule, zur Écoles Centrales, gehen. Es würde mich so viel weiterbringen.«
Doch Pierre Cartier schüttelte betrübt den Kopf. »Es tut mir leid, mein Junge. Aber du weißt, dass das nicht möglich ist«, lehnte er ab. »Ich muss auch deine Geschwister ernähren, und ich verdiene einfach nicht genug, um dir den Wunsch nach weiterer Bildung zu ermöglichen. Du bist nun alt genug, Louis-François, du musst dein eigenes Geld verdienen und damit zum Familieneinkommen beitragen.«
Betrübt senkte Louis-François den Kopf, betrübt und dennoch einsichtig, denn der Vater hatte ja recht. Er, als Ältester, hatte eine große Verantwortung auch seinen jüngeren Geschwistern gegenüber. Wenn er Bildung wollte, wenn er lernen wollte, dann musste er selbst dafür Sorge tragen, dass er sich das auch leisten konnte.
Er hob den Blick wieder und sah seinem Vater in die Augen. »Natürlich«, sagte er. »Welcher Weg schwebt dir für mich vor? Soll ich bei dir im Metallgewerbe anfangen? Da gibt es immer genug zu tun.«
Doch Pierre Cartier schüttelte, beinahe empört, den Kopf. »Aber nein!«, rief er. »Ich habe dich nicht neun Jahre die Schule besuchen lassen, damit du nun Metallverarbeiter wirst. Du sollst es doch mal weiterbringen und besser haben als ich. Ich habe etwas Besseres für dich gefunden: Du kannst in einem Juweliergeschäft anfangen. Eine Lehrstelle habe ich dir dort bereits besorgt. Erst gestern habe ich mit meinem alten Bekannten Adolphe Picard darüber gesprochen. Er ist gern bereit, dich bei sich aufzunehmen, zumal ich ihm erzählt habe, wie gut du zeichnen kannst und wie groß deine Faszination für Schmuck und Juwelen schon von jeher ist.«
Louis-François spürte, dass sein Herz zu rasen begann. Die Steine hatten ihm tatsächlich Glück gebracht – sie waren wirklich magisch. Er konnte es kaum glauben! Statt mit hässlichem, kaltem Metall sollte er nun mit dessen edelster Form und mit kostbaren Steinen arbeiten und auch noch seine in der Tat recht passablen Zeichenkünste einsetzen? So sehr er den Schmuck immer bewundert hatte – das hätte er nie zu träumen gewagt. Das war eine echte Alternative zur Schule –, ach was, es war viel besser als die Schule!
Pierre hatte das Leuchten in den Augen seines Sohnes sehr wohl bemerkt. »Hör mir zu, Louis-François«, sagte er. »Du darfst dir keine falschen Vorstellungen machen. Es ist nicht so, als würdest du die feinen Damen bedienen. Das Goldschmiedehandwerk ist harte Arbeit und gut bezahlt ist sie am Anfang auch nicht. Aber wenn du dich anstrengst, kannst du es durchaus zu etwas bringen. Immerhin gehören die Juwelenhändler zu den sechs Corps de Marchands de Paris.«
Louis-François nickte. »Ich werde meine Chance zu nutzen wissen, Vater«, sagte er, und es klang beinah feierlich. Er musste nicht fragen, was der Corps de Marchands de Paris war. Dieses Wissen hatte er sich längst angeeignet, und ihm war klar, dass es sich dabei um die angesehensten Händler- und Handwerksgruppen Frankreichs handelte.
Sein Vater lächelte ihm erstmals zu. »So gefällst du mir, mein Junge«, sagte er. »Gleich morgen früh um sechs Uhr wirst du erwartet.«
*
Es war zappenduster, als Louis-François sich um 5 Uhr am nächsten Morgen von seiner schmalen, bescheidenen Bettstatt erhob. Die Familie Cartier lebte in einem kleinen, zugigen Haus im Marais, und Louis-François musste sich das Zimmer im ersten Stock mit seinen fünf jüngeren Geschwistern teilen, nur das Allerkleinste schlief noch bei den Eltern. Leise, um die anderen nicht zu wecken, schlüpfte er in seine Pantoffeln, griff nach seinen Kleidern, die er wie jeden Abend ordentlich auf den kleinen Schemel neben seinem Bett gelegt hatte – wenn man wenig hatte, galt es, die Dinge, die man sein Eigen nennen konnte, sorgsam zu behandeln –, und ging nach unten in die Stube, wo er sich aus Rücksicht auf die anderen ankleiden wollte. Gerührt sah er durch die angelehnte Tür zur Küche, dass die Mutter bereits aufgestanden war, um ihm ein Frühstück zuzubereiten. Auf dem alten, aber stabilen und stets blank gescheuerten Holztisch lag ein Butterbrot mit der selbstgekochten Marmelade, die er so liebte und die es eigentlich nur sonntags gab, und im Ofen flackerte ein munteres Feuer. Dazu hatte die Mutter ihm eine Tasse heiße Milch zubereitet.
»Danke, Maman«, sagte er, als er zu ihr in die Küche trat, und küsste sie auf die Wange.
Ein Lächeln zog sich über das stets so müde und etwas verhärmte Gesicht seiner Mutter. Élizabeth Cartier, geborene Gerardin, war in diesem Jahr vierzig geworden, sah jedoch wesentlich älter aus. Durch ihr einst tiefschwarzes Haar zogen sich dicke graue Strähnen, und sie trug es stets am Hinterkopf zu einem straffen Knoten geschlungen, was ihr hageres Gesicht betonte. Unter ihren Augen lagen tiefe Schatten, und ihr zarter Körper wurde von einem zähen Husten geplagt. Kein Wunder: In den letzten zwanzig Jahren hatte Élizabeth Cartier sechs Kinder zur Welt gebracht und sich mit Hingabe um sie alle gekümmert. Das kostete auch eine Frau viel Kraft, die, wie das bei Élizabeth Cartier der Fall war, in ihrer Mutterrolle voll aufging. Vor allem deshalb, weil sie ja auch noch die Wäsche waschen, das Essen kochen, das Haus putzen und den Abwasch machen musste. Seine Frau, dachte Louis mit plötzlicher Entschlossenheit, sollte es eines Tages besser haben. Sie würden in einem großen Haus leben und über genügend Dienstboten verfügen, damit sich seine Gattin ein schönes Leben machen konnte. Und um die Mutter würde er sich dann auch kümmern. Liebevoll lächelte er seiner Maman zu, die jetzt halb scherzhaft, halb im Ernst den Finger hob und sagte: »Glaub nur ja nicht, dass du jetzt jeden Morgen ein derartiges Festmenü bekommst. Aber an deinem ersten Tag sollst du das Beste vom Besten haben und gestärkt auf deinen Weg gehen.«
Louis-François grinste und setzte sich an seinen Platz, um einen großen Bissen seines Marmeladenbrots zu nehmen. Wie himmlisch das schmeckte!
Er kaute mit vollen Backen – schlang das Marmeladenbrot regelrecht herunter und stürzte die Milch hinterher, kopfschüttelnd beobachtet von seiner Mutter. »Dass ihr Kinder immer so schlingen müsst«, schalt sie.
Weil wir nie ganz satt werden, und wenn wir zu langsam essen, besteht die Gefahr, dass jemand anderes uns das Essen wegschnappt, lag es Louis-François auf der Zunge, doch er sprach die Worte nicht aus. Seine Eltern bemühten sich wirklich, sie alle sattzubekommen. Und wenn er sich nicht allzu dumm anstellte, würde er ja bald auch etwas zum Familieneinkommen beitragen.
»Bitte entschuldige, Maman«, griff er daher zu einer Ausrede. »Aber ich möchte einfach nicht zu spät kommen.«
Seine Mutter nickte anerkennend. »So lob ich mir das«, sagte sie und warf einen Blick auf die große Wanduhr, die über der Tür hing, und deren lautes Ticken das Leben der Cartiers Tag für Tag dirigierte. »Gleich ist es schon halb sechs – und bis zur Werkstatt brauchst du zwanzig Minuten. Du solltest dich wirklich auf den Weg machen.«
Louis-François wischte sich die Krümel vom Mund, erhob sich rasch, dankte seiner Mutter noch einmal für das Frühstück und ging zur Tür. Er griff nach der kleinen Öllampe, die für Spaziergänge in der Dunkelheit stets bereitstand und empfand tiefe Dankbarkeit, dass sie ihm den Weg leuchten würde, denn draußen umfing ihn schwarze Dunkelheit. Die Häuser hier im ärmlichen Marais standen so dicht beieinander, dass nicht einmal der Mond oder die Sterne, wenn sie denn am wolkenverhangenen Himmel zu sehen gewesen wären, seinen Weg etwas hätten erleuchten können. Wie einsam es hier war. Und wie unheimlich. Louis schauderte. Er hatte das Gefühl, dass die Dunkelheit mit bedrohlichen Fingern nach ihm griff.
Der Schein seiner Öllampe mochte ihm den Weg leuchten, aber zugleich machte dieses Licht die Dunkelheit, die ihn umgab, noch undurchdringlicher, und Louis-François war sich auch sehr bewusst, dass er durch seine Öllampe wunderbar sichtbar war – auch für Gauner und Ganoven. Sein Herz raste.
Doch je näher er dem Quartier Les Halles kam, desto belebter wurden die Straßen zu seiner großen Erleichterung, und sein Herzschlag beruhigte sich etwas. Die Händler, die den Marché des Innocents belieferten, karrten ihre Fracht laut klappernd und rufend durch die Straßen, außerdem erkannte Louis-François zahlreiche andere junge Männer, die allesamt, so wie er, Öllampen in den Händen hielten und auf die zahlreichen Werkstätten zusteuerten, die hier, zwischen Austernständen und Kornbörse, angesiedelt waren.
Exakt zwanzig Minuten nachdem er das elterliche Haus verlassen hatte, erreichte Louis-François die Werkstatt seines neuen Lehrmeisters Adolphe Picard in der Rue Montorgueil Nº 31. Ehrfürchtig blickte er an dem Gebäude empor, das sechs Stockwerke weit in die Höhe ragte. In diesem Moment begannen die Glocken der Pfarrkirche Saint-Eustache, die direkt neben Louis-François’ neuem Arbeitsplatz stand, laut und vernehmlich zu läuten. Er fuhr erschrocken zusammen. Es war fast sechs Uhr – er musste sich beeilen.
Hastig stieß er die Tür zur Werkstatt auf.
Mehrere Buben, die mit dem Rücken zu ihm gestanden hatten, wandten sich zu ihm um, und er meinte, in ihren Gesichtern so etwas wie Ablehnung zu lesen, aber wirklich sicher konnte er sich da nicht sein, schließlich war es in der Werkstatt relativ dunkel. Auf jeden Fall, daran gab es nicht den geringsten Zweifel, war die Stimmung angespannt. Bevor Louis-François noch weiter darüber nachdenken konnte, wurde die Tür aufgestoßen und ein grobschlächtiger, streng aussehender Mann trat ein. Die Jungen standen stramm. In kurzen Worten wies der Mann jedem der Jungen eine Aufgabe zu, dann wandte er sich an Louis-François. »Du bist der Neue!«, stellte er fest, und es klang wie ein Vorwurf. So, als nehme der Mann ihm übel, dass er, Louis-François sich nicht schon vor Monaten in der Werkstatt gemeldet hatte.
»Richtig, Monsieur.«
»Name?«, bellte der Mann.
»Cartier. Louis-François Cartier«, erwiderte Louis-François hastig und wunderte sich, dass der Mann das nicht wusste.
Der nickte. »Komm mit!«, wies er ihn an, und Louis folgte ihm in eine der hintersten Ecken der Werkstatt, in der es noch dunkler war als im vorderen Teil. Konnte man bei derart trübem Licht überhaupt filigrane Arbeiten verrichten?, fragte sich Louis-François verwundert.
Doch im nächsten Moment sollte er erkennen, dass zumindest seine Arbeit alles andere als filigran sein würde: Der Mann deutete auf einen Haufen schmutziger Lappen, die in einer Ecke lagen. »Hier«, sagte er. »Du bist heute dafür zuständig, die Schmuckstücke zu polieren. So, dass man sich darin spiegeln kann, verstanden?«
»Jawohl, Monsieur.«
»Und dass du mir ja vorsichtig bist mit den Stücken.« Der Mann sah ihn so böse an, dass Louis-François es mit der Angst zu tun bekam. Sonderlich freundlich war sein neuer Lehrmeister wirklich nicht.
Dieser schickte sich an davonzutrotten, und Louis-François wollte gerade aufatmen, da wandte der Mann sich nochmals um. »Ach so«, sagte er, »sollte irgendwas sein, musst du dich immer an mich wenden. Monsieur Picard«, nun klang erstmals so etwas wie Ehrerbietung in seiner Stimme, »möchte mit solch einfachen Angelegenheiten nicht belästigt werden, hörst du?«
»Natürlich«, sagte Louis-François rasch, während er insgeheim erleichtert aufatmete. Bei diesem unangenehmen Zeitgenossen handelte es sich also nicht um den Inhaber. Das war zumindest eine kleine Erleichterung.
Kapitel 2
»So, meine Lieben«, sagte Jeanne Deroin und klappte das große Buch zu, das auf dem Pult lag. »Nun ist unsere gemeinsame Zeit also zu Ende. Die meisten von euch werde ich nach dem Sommer nicht wiedersehen.«
Die zwölfjährige Antoinette, die, wie immer, in der zweiten Reihe am Gang saß, spürte einen heftigen Stich im Magen und gleichzeitig begann ihr Herz unangenehm hart gegen ihre Brust zu schlagen. Wie hatte sie sich vor diesem Tag gefürchtet! Seit Wochen, ach was, seit Monaten schon, hatte der Gedanke an diesen Moment wie ein dunkler Schatten über ihrem Gemüt gelegen: der Gedanke an den Abschied von ihrer wunderbaren Lehrerin. Und der Gedanke an den Abschied vom Lernen. Das war es nun also, dachte sie bitter. Das, was sie bisher gelernt hatte, war alles, über was sie künftig an Wissen verfügen würde. Sehr viel Neues würde nicht hinzukommen, mit Ausnahme vielleicht einer noch tieferen Kenntnis über Obst und Gemüse, als sie es ohnehin schon hatte. Denn fortan würde sie tagein, tagaus mit ihrer Mutter auf dem Markt stehen und Ware verkaufen. Irgendwann würde sie heiraten und Kinder bekommen. Und das würde dann alles sein. Das wäre ihr Leben! Wie langweilig und eintönig sich das anfühlte! Und wie ungemein deprimierend das war, da sie doch in den sechs Jahren, in denen sie die Schule hatte besuchen dürfen, eine leise Ahnung davon bekommen hatte, wie großartig und wie wundervoll die Welt des Wissens war und wie viel es dort zu entdecken gab! Antoinette hatte das Gefühl, dass sie gerade erst an der Oberfläche gekratzt hatte und dass darunter noch so viel mehr verborgen lag. Antoinette verspürte eine tiefe, drängende Sehnsucht nach dieser wunderbaren, magischen und faszinierenden Welt. Doch diese würde nun wohl für immer für sie verschlossen sein. Der Gedanke daran war so schrecklich, dass sie trocken aufschluchzte. »Bitte entschuldigen Sie!«, stieß sie noch hervor, stürzte dann zur Tür, riss sie auf und eilte nach draußen in den Schulhof, der um diese Stunde, wo alle Kinder in ihren Klassenzimmern saßen, verlassen dalag. Sie schlang ihre Arme Halt suchend um die dicke Eiche mit der Bank herum, auf der sie in der Pause stets gesessen und ihr Brot verzehrt hatten. Manchmal hatte Madame Deroin sie hier draußen auch unterrichtet, das waren besonders schöne Stunden gewesen. Ach, Madame! Wie wichtig sie ihr geworden war! Und nun mussten sie Abschied nehmen! Ob sie einander wohl jemals wiedersehen würden?
»Antoinette«, ertönte da eine Stimme hinter ihr. »Liebes!«
Sie fuhr herum und starrte in das wache und gütige Gesicht ihrer Lehrerin. Nicht zum ersten Mal dachte Antoinette, wie wunderschön Madame Deroin doch war. Sie sah aus wie eine dieser Madonnen auf den Gemälden der italienischen Künstler, die sie ihnen gezeigt und die Antoinette tief in ihrem Innersten berührt hatten. Madame Deroin strahlte die gleiche Güte aus – und die gleiche freundliche Wachheit. Es war, als könne die Lehrerin ganz unmittelbar ins Herz ihrer Schüler hineinblicken, dachte Antoinette. Rührung stieg in ihr auf. Madame hatte die Klasse allein gelassen, um nach ihr zu sehen!
»Komm.« Jeanne Deroin hatte auf der kleinen Bank Platz genommen und klopfte auffordernd neben sich auf das grau verwitterte Holz. Antoinette setzte sich, und Madame Deroin legte den Arm um ihre Schülerin.
»Mir fällt es doch auch schwer, dich gehen zu lassen, und der Gedanke daran, dass wir uns nicht mehr sehen werden, schneidet mir ins Herz. Ich habe dich sehr liebgewonnen, Antoinette«, sagte Madame Deroin ernst.
»Das ist es nicht oder zumindest nicht nur«, schluchzte Antoinette. »Natürlich werde ich Sie furchtbar vermissen, aber …«
»Aber?«, kam es freundlich von der Lehrerin.
»Aber ich werde auch die Bücher furchtbar vermissen. Und das Lernen. Ich soll meiner Mutter jetzt jeden Tag auf dem Markt helfen. Gemüse verkaufen. Ich …« Antoinette machte eine unbestimmte Bewegung mit der Hand, »ich habe einfach das Gefühl, dass es noch so unglaublich viel zu erfahren und zu lernen gibt, und es macht mich … es treibt mich in tiefste Verzweiflung, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Wissen nun für immer vor mir verschlossen bleibt. Ich glaube, dass ich mein Leben verschenke, wenn ich nun nichts anderes tun soll, als Gemüse zu verkaufen. Jeden Tag!«
»Sieh mich an!«, forderte Madame Deroin Antoinette auf und strich ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht, die ganz feucht war von Tränen. »Was ich dir jetzt sage, ist sehr wichtig, hörst du?«
»Ja«, flüsterte Antoinette und starrte ihre Lehrerin wie gebannt an, die nun fortfuhr: »Erstens, das ist eine ganz wichtige Lektion im Leben: Du musst stets versuchen, an dem Ort, an den das Leben dich stellt, großartig zu sein.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun, wenn es jetzt deine Aufgabe ist, Gemüseverkäuferin zu werden, dann werde Gemüseverkäuferin, aber eine ganz besondere.«
Ratlos sah Antoinette ihre Lehrerin an. »Wie wird man eine ganz besondere Gemüseverkäuferin?«
»Jeder kann in jedem Bereich etwas ganz Besonderes werden, wenn er seine Sache nur ganz hervorragend macht«, sagte die Lehrerin. »Selbst die Straßenkehrer in den Faubourgs. Sie haben die Möglichkeit, die Straßen so zu säubern, dass man von ihnen essen kann und allen Menschen, die an Ihnen vorbeieilen noch ein Lächeln zu schenken.«
»Ich verstehe«, sagte Antoinette. »Ich soll also immer freundlich zu den Menschen sein. Das will ich gerne tun. Aber sonst gibt es nicht viel, was man am Gemüseverkaufen gut oder schlecht machen kann.«
»Oh, da täuscht du dich aber«, rief Madame Deroin. »Ebenso wie mit deiner Sorge, das Lernen sei nun vorbei. Ich habe an dir immer deine Gabe geschätzt, den Dingen auf den Grund zu gehen. Nicht zu ruhen, bis du weißt, was dahintersteckt. Finde es auch beim Gemüse heraus.«
»Aber was steckt denn schon hinter Gemüse?«, wandte Antoinette ein.
»Jede Menge!«, rief ihre Lehrerin. »Im Gemüse, wie auch in den Blumen, offenbart sich uns die Kraft der Natur.«
Kopfschüttend sah sie ihre Schülerin an. »Habe ich dir das nicht beigebracht in den letzten Jahren?«
»Doch«, sagte Antoinette, die langsam zu verstehen begann, worauf ihre Lehrerin hinauswollte und feststellte, dass sich wieder so etwas wie Hoffnung in ihr Herz schlich.
»Gemüse und Blumen – das sind Wunderwerke der Natur, die man ewig betrachten könnte«, fuhr die Lehrerin fort. »Du solltest nie aufhören, alles, was dir begegnet, in aller Tiefe zu erforschen.«
»Ich soll also die Kraft der Natur im Obst und im Gemüse suchen.«
Madame Deroin lachte. »Wenn du es so sagst, klingt es wirklich ein wenig merkwürdig. Aber ich glaube, du weißt sehr genau, worauf ich hinauswill. Und außerdem gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, deine Zeit am Marktstand zu nutzen. Sieh dir die Leute, die zu dir an den Stand kommen, genau an. Mach dir deine Gedanken über sie. Schenke Ihnen deine ungeteilte Aufmerksamkeit und viel Freundlichkeit. Mach den Moment, in dem sie bei dir einkaufen, zu einem glücklichen Moment.«
»Aber sie gehen doch nur Gemüse einkaufen«, wandte Antoinette ein.
»Richtig«, bekräftigte Jeanne. »Sie gehen nur Gemüse einkaufen. Und nun überleg dir mal, wie gut und glücklich unsere Welt wäre, wenn uns alltägliche Dinge wie das Gemüseeinkaufen, glücklich machen würden.«
»Da haben Sie recht!« Antoinette war mit einem Mal ganz aufgeregt.
»Siehst du!«, erwiderte Madame Deroin. »Und das Schönste ist: Du hast es in der Hand. Du hast es in der Hand, so viele Menschen glücklich zu machen.«
»Das kann ich wirklich!«, flüsterte das Mädchen.
»O ja, das kannst du, Antoinette«, sagte Madame Deroin zärtlich. »Und ich will dir noch etwas sagen, was du tun kannst, um das Gemüseverkaufen zu etwas ganz Besonderem zu machen.«
»Und was?«
»Nun, davon ausgehend, dass man den Dingen immer auf den Grund gehen sollte, empfehle ich dir, das Gemüse zu zeichnen«, sagte Madame Deroin. »Du hast ein ganz außerordentliches Talent dafür, Antoinette, und ich habe sehr wohl gesehen, wie sehr dich die Werke der großen Meister berührt haben. Erinnerst du dich daran, was ich euch sagte, als wir uns im Salon de Paris diese großen Meister angesehen haben?«
»Dass die Maler nicht nur das Äußere abgebildet haben.«
»Ganz genau«, bestätigte Madame Deroin. »Die großen Meister verstehen es, uns über ihre Kunst das Wesen der Dinge zu vermitteln. Dieses Wesen aber müssen sie zunächst finden, erspüren und ertasten. Und das gelingt durch genaue Betrachtung.«
»Es ist mein großer Traum, einmal Künstlerin zu werden«, gestand Antoinette. Dann fuhr sie fort: »Wenn ich also das Gemüse male, dann soll ich versuchen, das Wesen des Gemüses zu erkunden? Auch das klingt etwas seltsam.«
Madame Deroin lachte. »Wie ich vorhin schon sagte: Es geht mehr darum, dir beim Zeichnen über die Vielfalt der Natur bewusst zu werden: Es ist wirklich unglaublich, was die Natur alles schafft.«
»Das stimmt«, bestätigte Antoinette. Sie dachte einen Moment nach und sagte dann: »Ich habe das Gefühl, dass Sie das auch können, Madame Deroin. Also, dass Sie … wenn Sie mit mir sprechen, dann habe ich genau dieses Gefühl. Dass Sie mich ganz verstehen.«
»Ach, mein liebes Mädchen.« Die Lehrerin drückte Antoinette an sich. »Das ist das Schönste, was du mir sagen kannst.«
»Außerdem …« Sie zögerte.
»Ja?« Fragend sah Antoinette sie von der Seite an.
»Ich finde es wundervoll und unterstützenswert, wenn ein junger Mensch derart wissensdurstig ist. Und Mädchen haben da noch ein wenig mehr Unterstützung nötig als Jungen, weil Jungen mehr Recht auf Wissen zuerkannt wird als Mädchen. Deshalb möchte ich dir helfen.«
»Danke!«, sagte Antoinette. »Aber wie wollen Sie das tun?«
»Ganz einfach«, erwiderte ihre Lehrerin. »Ich werde dir Bücher leihen und dich weiter unterrichten.«
»Aber das können meine Eltern nicht bezahlen«, flüsterte Antoinette und spürte, wie die Hoffnung, die zaghaft in ihr aufgekeimt war, gleich wieder in sich zusammenfiel.
»Aber, Liebes!«, rief Jeanne Deroin und strich ihrer Schülerin erneut eine verirrte Haarsträhne hinters Ohr. »Deine Eltern müssen mich doch nicht dafür bezahlen! Es ist mir eine Freude, wenn ich so ein kluges, wissbegieriges Mädchen wie dich weiterhin auf seinem Weg begleiten darf.«
»Wirklich?«, flüsterte Antoinette gerührt. Doch dann fiel ihr der nächste Einwand ein: »Aber ich soll doch ab nächster Woche auf dem Markt arbeiten. Mit Mutter. Da wird gar keine Zeit bleiben, weiterhin zum Unterricht zu gehen.«
»Es gibt Mittagspausen, Abende und Sonntage«, erwiderte die Lehrerin. »Natürlich kannst du nicht mehr so viel lernen wie jetzt. Aber selbst, wenn du jeden Tag nur ein bisschen Zeit dem Studium widmest, wirst du nach einigen Jahren über einen enormen Wissensschatz verfügen. Und außerdem habe ich dir ja schon erzählt, wie du die Zeit am Gemüsestand nutzen kannst. Das ist auch eine Art Lernen, vielleicht sogar die wichtigere.«
Antoinette nickte, griff nach der Hand ihrer Lehrerin und drückte sie. »Danke«, flüsterte sie. »Danke, dass Sie das für mich tun.«
»Dann müssen wir jetzt nur noch deine Eltern überzeugen«, sagte Jeanne. »Ich würde vorschlagen, dass ich heute Abend bei euch vorbeikomme. Wann wäre denn eine gute Zeit?« Antoinette überlegte: »Ich denke, gegen sieben. Da sind wir gerade mit dem Abendessen fertig.«
»Gut«, versprach Madame Deroin. »Ich werde da sein.«
Als sie am Abend ihre Mahlzeit einnahmen – obwohl die Familie nicht viel Geld hatte und ein windschiefes Häuschen im Faubourg Saint-Antoine bewohnte, hatten sie dank ihrer Tätigkeit als Obst- und Gemüsebauern immer genug auf dem Tisch –, bekam Antoinette vor Aufregung kaum etwas herunter. Die ganze Zeit über stocherte sie derart lustlos in ihrem Essen herum, dass ihre Mutter ihr besorgt die Stirn fühlte. »Also Fieber hast du keins«, stellte sie fest. »Aber ich bin mir sicher, du brütest etwas aus.«
Zu Antoinettes großer Erleichterung – und zugleich auch Beunruhigung – klopfte es in diesem Moment an der Tür.
»Wie unangenehm um diese Uhrzeit«, schimpfte ihr Vater sogleich los, während er sich von dem schlichten Holztisch erhob, an dem sie stets die Mahlzeiten einzunehmen pflegten, und zur Tür schlurfte. »Kann man denn nie seine Ruhe haben?«
Antoinettes Herzschlag beschleunigte sich noch mehr. Das waren keine guten Vorzeichen!
»Guten Abend!«, hörte sie eine vertraute Stimme von der Tür her. »Ich bin Antoinettes Lehrerin, Madame Deroin. Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?«
»Natürlich!«, hörte Antoinette ihren Vater zu ihrer Erleichterung sagen, »bitte, kommen Sie doch herein!«
»Hast du etwas angestellt?«, flüsterte Antoinettes Bruder Claude ihr in diesem Moment zu, während ihre Mutter kombinierte: »Wusstest du, dass sie kommt? Warst du deshalb so eigenartig?«
Antoinette wurde einer Antwort enthoben. Ihr Vater trat, gefolgt von Madame Deroin, bereits ins Zimmer, und ihre Mutter erhob sich hastig. »Madame Deroin«, sagte sie, und in ihrer Stimme klang eine Frage. »Was für eine Überraschung! Nehmen Sie doch Platz! Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Oder vielleicht einen Teller Gemüsesuppe? Natürlich aus eigenem Anbau.«
»Danke. Ich habe schon mit meinem Mann und den Kindern zu Abend gegessen. Aber ein Glas Wasser nehme ich gerne, wenn es keine Umstände macht«, sagte Madame Deroin, während sie erst Antoinettes Mutter, dann Antoinette und schließlich ihrem Bruder die Hand schüttelte und sich dann setzte. Als alle wieder Platz genommen hatten, sagte sie rundheraus: »Wie Sie sich schon denken können, bin ich wegen Ihrer Tochter hier.«
»Hat Antoinette etwas angestellt?«, kam es von ihrem Vater, und sie sandte ihm einen gekränkten Blick. Wieso glaubten nur alle, dass sie sich danebenbenommen hatte! Im Gegensatz zu ihrem zwei Jahre älteren Bruder, der dem Vater auf dem Feld half, hatte sie sich noch nie etwas zuschulden kommen lassen! Doch da sagte Madame auch schon: »Ganz im Gegenteil, Monsieur! Antoinette ist eine außerordentlich begabte Schülerin, und offen gestanden, ist es ein Jammer, dass das Lernen für sie nun vorbei sein soll.«
Antoinettes Vater war offensichtlich ein wenig stolz ob der lobenden Worte der Lehrerin. »Ja, sie ist schon ein schlaues Mädel, meine Adèle«, nannte er sie bei ihrem Spitznamen. »Aber so ist es nun mal. Sechs Jahre durfte sie lernen, jetzt soll sie ihre Mutter auf den Markt begleiten. Mit zwölf Jahren beginnt der Ernst des Lebens.« Er stieß ein leises Lachen aus und nahm einen großen Schluck Bier. Antoinette merkte ihrem Vater an, dass er ziemlich verlegen war. Joseph Guermonprez war ein einfacher, aber herzensguter Mann, der in seiner Familie zwar den Ton angab, aber im Umgang mit Menschen, die er nicht kannte, schnell verlegen wurde. Das galt vor allem für Personen, die über ein deutlich größeres Wissen verfügten als er. Antoinette wusste, dass ihr Vater im Gegensatz zu ihr nie die Schule besucht hatte und dass ihm seine mangelnde Bildung manchmal peinlich war.
»Ja«, pflichtete Madame ihm bei. »Ihre Tochter hat nun eine neue Verantwortung, und ich bin mir sicher, dass sie ihre Sache sehr gut machen wird. Aber ich bin hier, um Ihnen einen Vorschlag zu machen: Antoinette ist ein derart begabtes Mädchen – ich würde sie gerne in den Mittagspausen und an den Wochenenden weiter unterrichten.«
Antoinette, die ein feines Gespür für Stimmungen hatte, bemerkte sofort, dass ihr Vater eine ablehnende Haltung einnahm.
»Kommt nicht infrage!«, polterte er auch gleich darauf los. »Wir sind arme Gemüsebauern. Wir können uns das nicht leisten.«
»Der Unterricht wäre kostenfrei«, erwiderte Madame Deroin in freundlicher Gelassenheit. »Antoinette ist so klug, da ist so was schon mal möglich.«
Antoinette war beinahe schlecht vor Aufregung, als sie ungeduldig zwischen ihrem Vater und ihrer Mutter hin und her sah. Letztere verzog keine Miene und ließ nicht den geringsten Zweifel daran, dass sie in dieser Sache keine Meinung und schon gar keine Entscheidungsgewalt hatte. Joseph Guermonprez hingegen lehnte rundweg ab. »Nichts da!«, bellte er. »Wir mögen zwar arme Bauern sein, aber wir haben auch unseren Stolz. Wir brauchen keine Almosen.«
Antoinette schossen die Tränen in die Augen, während ihre letzte Hoffnung zerbarst. »Aber …«, wagte sie krächzend einen Einwand, doch ihr Vater beachtete sie gar nicht. »Es tut mir leid, dass Sie sich umsonst herbemüht haben, Madame«, sagte er, »aber der Weg unserer Tochter ist vorgezeichnet. Sie wird Gemüsehändlerin, und irgendwann wird sie heiraten und Mutter werden.«
Er nickte der Lehrerin noch einmal zu und sagte dann: »Ich danke Ihnen wirklich sehr für Ihren Besuch, Madame, aber dennoch muss ich Sie nun bitten zu gehen. Wir müssen morgen in aller Frühe auf die Felder.«
Nun warf ihr Vater ihre geliebte Madame Deroin auch noch hinaus! Antoinette konnte es nicht glauben!
Doch die ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Natürlich!«, sagte Madame Deroin höflich, aber eisig, während sie sich erhob, und Antoinette kannte sie gut genug, um zu wissen, wie wütend sie war. So hatte sie stets dreingeblickt, wenn Claire, das Mädchen aus der letzten Reihe, wieder einmal nicht aufgepasst oder seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie hasste Missstimmungen.
»Ich bringe Sie noch zur Tür!«, rief Antoinette hastig und sprang auf.
»Antoinette«, kam es protestierend von ihrem Vater, doch sie sah aus dem Augenwinkel, dass die Mutter dem Vater beschwichtigend die Hand auf den Arm legte. Lass sie gehen, sollte das bedeuten. Zu ihrer unendlichen Erleichterung gab der Vater nach.
Draußen in dem engen Flur, der so schmal war, dass man nicht hindurchgehen konnte, ohne an den stets etwas schmuddeligen Jacken entlangzustreifen, die neben der Haustür an einem Haken hingen, funkelte Antoinette ihre Lehrerin an. Ihre Niedergeschlagenheit hatte sich inzwischen in Entschlossenheit verwandelt. »Ich lasse mir das nicht gefallen«, zischte sie. »Vater hat kein Recht darüber zu entscheiden, ob ich weiterhin Bildung genießen darf oder nicht.«
Madame Deroin seufzte und strich Antoinette liebevoll über die Wange. »Leider doch«, korrigierte sie. »Leider hat er das Recht dazu. Aber Recht heißt in diesem Fall noch lange nicht, dass es richtig ist.«
Antoinette nickte wie gebannt, während Madame Deroin flüsterte: »Wenn es mit deinem Vater nicht möglich ist, dir die Bildung zu verschaffen, die du verdient hast, dann hast du jedes Recht, dich gegen ihn aufzulehnen. Jedes, hörst du?«
»Ja.«
»Ich habe ein Buch für dich. Für den Anfang!«, raunte Madame Deroin, zog es aus ihrer Rocktasche und reichte es Antoinette. »Ich habe es für den Fall mitgebracht, dass dein Vater genauso reagieren würde, wie er es dann auch getan hat. Steck es ein, rasch.«
Antoinette ließ das ledergebundene Werk hastig in ihre Rocktasche gleiten, als ihr Vater auch schon rief: »Wo bleibst du denn, Adèle?«
»Ich komme!«, rief sie.
»Ich bin jeden Mittag um ein Uhr in meiner Wohnung in der Rue Saint-Denis«, flüsterte Mademoiselle noch. »Das ist während der offiziellen Mittagspause. Du kannst kommen, wann immer du willst – und wenn es auch ein halbes Jahr lang dauert.«
»In Ordnung«, flüsterte Antoinette zurück. »Und danke. Danke, dass Sie mich nicht aufgeben.«
Dann hastete sie in die Küche zurück. Das Buch in ihrer Rocktasche schlug bei jeder Bewegung verheißungsvoll gegen ihr Bein.
Kapitel 3
Wie schmal diese Gassen waren, dachte Antoinette bekümmert, als sie hinter ihrem Vater und ihrem Bruder und gefolgt von ihrer Mutter durch die schmalen Sträßchen trottete, durch die er die Handkarre mit ihrem Gemüse schob. Die Faubourg, in dem das Haus der Familie stand, war einfach furchtbar eng, und es stank entsetzlich. Wie so oft, wenn sie durch diese Straßen ging, blickte Antoinette nach oben, auf der Suche nach einem Stückchen Himmel, nur um dann festzustellen, was sie ohnehin schon wusste: Wenn überhaupt, war nur ein schmaler Streifen zu sehen. Die Häuser standen so dicht beisammen, dass sie sich an den Traufen beinahe oder tatsächlich berührten und kaum Licht zwischen den Dächern hindurchdringen konnte. Wobei es jetzt, zu dieser frühen Stunde natürlich ohnehin dunkel war. Antoinette hatte lediglich auf einige Sterne oder ein Stück der Mondsichel gehofft. Doch auch bei Tag hielten die Dächer das Licht und die Luft draußen und den Gestank und die Dunkelheit drinnen, dachte Antoinette, während sie die Nase rümpfte. Es roch wirklich entsetzlich! Am liebsten hätte sie einen Schal oder ein Tuch auf ihre Ware gelegt, um sie zu schützen. Würde sich der Geruch nicht wie ein schmutziger Schleier über ihr Obst und ihr Gemüse legen?
Plötzlich erregte eine Bewegung neben ihr ihre Aufmerksamkeit. Aus einer der Seitengassen näherte sich ein Junge. Er hielt eine Öllampe in der Hand und schien derart in seine Gedanken versunken zu sein, dass er sie nicht bemerkte. Er wäre wohl mit dem Gemüsewagen Joseph Guermonprez’ zusammengeprallt, wenn nicht Antoinettes Vater im letzten Moment ruckartig zum Stehen gekommen wäre, wodurch allerdings einiges an Ware auf den Boden kullerte.
»Kannst du nicht aufpassen?«, schnauzte Joseph Guermonprez den erschrockenen Burschen an. »Deinetwegen liegt nun die ganze Ladung auf der Straße.«
»Es … es tut mir sehr leid, Monsieur!«, stammelte der Bursche, den Antoinette nun im Schein der Öllampe etwas genauer betrachtete. Er mochte in ihrem Alter sein, ein paar Jahre älter vielleicht, war groß und schmal, aber dennoch kräftig. Mehr konnte sie nicht erkennen, nur, dass er ziemlich verzweifelt dreinblickte. »Ich würde Ihnen gern helfen, alles wieder aufzusammeln«, sagte er. »Aber heute ist mein zweiter Tag in der Werkstatt, und wenn ich zu spät komme, dann ist das sicher auch mein letzter Tag.«
»Das interessiert mich nicht, Bürschchen«, blaffte Antoinettes Vater und packte den Jungen am Arm. »Du wirst schön hierbleiben und mithelfen.«
»Aber …«, setzte der Junge an, der Antoinette immer mehr leidtat.