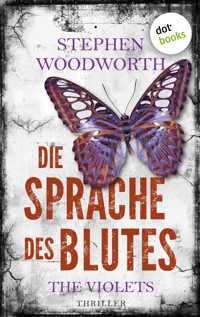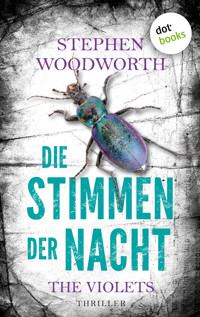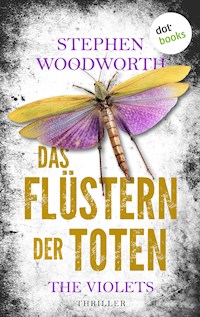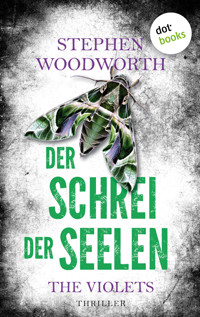
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Violet Eyes
- Sprache: Deutsch
Wer mit den Toten spricht, darf niemandem trauen: Der Mystery-Thriller »Der Schrei der Seelen« von Stephen Woodworth als eBook bei dotbooks. Wenn dein Verfolger jeden deiner Schritte erahnt, gibt es keinen Ort, an den du fliehen kannst … Natalie Lindstrom weiß, dass ihre besondere Gabe alles andere ist als ein Geschenk: Sie kann mit den Seelen der Toten sprechen und gerät so immer wieder in Gefahr. Niemand, da ist sie sicher, würde sich diesem Fluch freiwillig unterwerfen – oder vielleicht doch? Als Natalie erfährt, dass ein Wissenschaftler kurz davor zu stehen scheint, sein verbotenes Experiment zu vollenden, weiß sie, dass sie handeln muss. Doch dieser Kampf entscheidet nicht nur, ob sie in Frieden leben darf – sondern auch über das Schicksal ihrer Tochter … Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Schrei der Seelen« von Stephen Woodworth ist der abschließende Band der Urban-Fantasy-Tetralogie »Violet Eyes«. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn dein Verfolger jeden deiner Schritte erahnt, gibt es keinen Ort, an den du fliehen kannst … Natalie Lindstrom weiß, dass ihre besondere Gabe alles andere ist als ein Geschenk: Sie kann mit den Seelen der Toten sprechen und gerät so immer wieder in Gefahr. Niemand, da ist sie sicher, würde sich diesem Fluch freiwillig unterwerfen – oder vielleicht doch? Als Natalie erfährt, dass ein Wissenschaftler kurz davor zu stehen scheint, sein verbotenes Experiment zu vollenden, weiß sie, dass sie handeln muss. Doch dieser Kampf entscheidet nicht nur, ob sie in Frieden leben darf – sondern auch über das Schicksal ihrer Tochter …
Über den Autor:
Stephen Woodworth, geboren 1967 in Kalifornien, veröffentlichte zahlreiche Kurzgeschichten und Novellen, für die er unter anderem für den renommierten Locus-Award nominiert wurde, bevor er mit seinem übernatürlichen Thriller »Das Flüstern der Toten« international bekannt wurde.
Bei dotbooks veröffentlichte Stephen Woodworth die vier Bände seiner Violet-Eyes-Tetralogie: »Das Flüstern der Toten«, »Die Stimmen der Nacht«, »Die Sprache des Blutes« und »Der Schrei der Seelen«.
***
eBook-Erstausgabe April 2023
Die amerikanische Originalausgabe dieses Romans erschien 2006 unter dem Titel »From black rooms« bei Bantam Dell, a division of Random House, Inc., New York.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2006 by Stephen Woodworth
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-341-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Schrei der Seelen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stephen Woodworth
Der Schrei der Seelen
THE VIOLETS 4 – Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helmut Gerstberger
dotbooks.
Krankheit, geistige Verwirrtheit und Tod waren die Engel, die an meiner Wiege wachten und mir seither durch mein ganzes Leben gefolgt sind. Ich habe früh die Leiden und die Gefahren des Lebens kennengelernt und war mir auch des Lebens nach dem Tod bewusst und der ewigen Strafe, die auf die Kinder der Sünde in der Hölle wartet.
Edvard Munch
***
An den Leser
Alle in diesem Buch beschriebenen Gemälde sind tatsächlich existierende Kunstwerke, die aus den erwähnten Örtlichkeiten und auf die beschriebene Weise gestohlen wurden. Bisher wurde keines von ihnen zurückgegeben oder wiedergefunden, und niemand weiß, wer sie hat oder wo sie sind ...
Dieses Buch ist den vielen guten Freunden gewidmet, deren unentwegte Ermutigung und Unterstützung mir während meiner Karriere als Schriftsteller stets Antrieb und unverzichtbarer Rückhalt waren: David und Diana Whiting, Amy und David Trotti, David Rickel und Edward Wheat, Jason Yee und so viele andere. Den meisten Dank für dieses Buch schulde ich jedoch dem besten Freund, den ich haben kann: meiner Frau und Kollegin Kelly Dunn.
Kapitel 1Die Kinder des Dr. Wax
An dem Tag, den Dr. Bartholomew Wax gewählt hatte, sich umzubringen, meldete er sich bei seinem Arbeitgeber krank und verbrachte den ganzen Tag damit, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Er würde ihre Gesellschaft genießen, während er seine letzte Mahlzeit zu sich nahm.
Zu den Klängen eines Violinkonzerts von Vivaldi, die aus den Boxen seines sämtliche Räume des Hauses beschallenden Hightech-Soundsystems drangen, entkorkte Wax seine beste Flasche Burgunder und richtete sich eine Platte mit Brie, Gänseleberpastete, geschroteten Weizenkörnern, Roggen-Crackern und frischen Weintrauben an. Nachdem er dem Wein ausreichend Zeit zum Atmen gegeben hatte, stellte er die Flasche zusammen mit dem Essen und einem Kelchglas aus geschliffenem Kristall auf ein Silbertablett und trug es aus der Küche zu einer Tür in der Diele. Er stellte das Tablett auf den Beistelltisch aus Mahagoni neben der Tür, tippte eine siebenstellige Zahlenkombination in das digitale Tastenfeld über dem Türschloss, und die Karbonstahlriegel glitten mit dem metallischen Klicken von Patronen, die in den Lauf einer Schrotflinte gehebelt werden, in die Türfassung.
Wax zog die Tür auf, und hinter dem hölzernen Türblatt wurde eine dreißig Zentimeter dicke, mit Metall verstärkte Isolierung sichtbar. Die Wände des Kellers waren auf ähnliche Weise befestigt. Unter dem Verputz der Trockenwand verbargen sich Tungsten-Karbid-Platten und mehrere Schichten von Zement, Stahl und Rigipsplatten, die die Wände des Schutzraums für Feuer, Bohrgeräte und Sprengstoffe undurchdringbar machten. Der Bau des Kellergewölbes hatte seine Arbeitgeber bei der Nordamerikanischen Gesellschaft für Jenseitskommunikation ein paar Millionen Dollar gekostet, doch für die Sicherheit seiner Kinder war kein Preis zu hoch.
Im Licht erstrahlend, das durch die Türöffnung fiel, hießen sie ihn willkommen, als er mit dem Silbertablett in Händen die Kellertreppe hinabstieg. Sensoren registrierten seine Hitzesignatur und schalteten die Lampen an, die seine Familie in Licht tauchten. Warme, gelbe Lichtbahnen blühten in der Dunkelheit zwischen den schwarzgestrichenen Wänden des Raums auf. Sich in ihren jeweiligen Spotlights sonnend, lächelten ihm seine Kinder zu – jedes so kostbar für ihn, als hätte er sie selbst erschaffen. Wax hatte die Spotlights dergestalt positioniert, dass sie jedes der Gemälde optimal zur Geltung brachten, wobei er die Lichtintensität sorgfältig so bemessen hatte, dass die Farben nicht ausbleichten. Obwohl draußen die sengende Hitze New Mexicos über dem Haus brütete, sorgten die perfekt funktionierenden Klimatisierungssysteme dafür, dass im Keller konstante einundzwanzig Grad Celsius und eine ausreichende Luftfeuchtigkeit herrschten, um zu verhindern, dass die Gemälde Risse bekamen.
Ein Bürostuhl und ein kleiner Tisch in der Mitte des Raums waren die einzigen Möbel in dem Kellergewölbe. Als sich die Tür automatisch hinter ihm schloss, stellte Wax das Tablett auf dem Tisch ab, zog das Gummiband aus seinem Haar, mit dem er es zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, und schüttelte die graue Mähne, die über seine Schultern herabfiel. Er steckte sich eine Weintraube in den Mund und ließ sich auf den Stuhl sinken, den er nach Belieben drehen konnte, um die Bilder, die an den Wänden des Kellers hingen, in Muße betrachten zu können. Dort verbrachte er, mit angestrengter Miene den getragenen Klängen von Vivaldis Violinen lauschend, seine letzten Stunden mit der einzigen wirklichen Familie, die er je gekannt hatte.
Da er ein Einzelkind war, hatte Bartholomew Wax einen Großteil seiner Kindheit im wahrsten Sinn des Wortes zwischen Gemälden verbracht. Seine geschiedene Mutter konnte sich während der Sommerferien keinen Babysitter leisten, und deshalb brachte sie ihn jeden Morgen auf dem Weg zu ihrer Arbeit in einem Dunkin‘ Donuts-Laden in Downtown Boston zum Isabella Stewart Gardner Museum. Damals in den Siebzigerjahren, als die Eltern, was Pädophilie anging, noch naiv waren und Kindertagesstätten als Luxus betrachtet wurden, tröstete sich Bartholomews Mutter damit, dass es für den Jungen nur gut sein konnte, seine Tage inmitten von erlesenen Kunstwerken zu verbringen, anstatt zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen.
Der kleine Barty, ein introvertierter und zarter Junge mit einer beinahe autistischen Liebe für den gewohnheitsmäßigen Gang der Dinge, fand bald Gefallen an den düsteren, kühlen Säulenhallen des im italienischen Stil errichteten Palazzos. Die Museumswärter kannten ihn alle beim Namen, und mittags aß er sein in einem Beutel mitgebrachtes Pausenbrot immer – von weißen Lilien und griechischen und römischen Statuen umgeben – im stillen, friedvollen Innenhof des Museums, allein mit seinen Gedanken. Doch am besten gefielen ihm die Gemälde, von denen jedes einzelne genau an dem Platz bleiben musste, den Mrs. Gardner dafür bestimmt hatte. An manchen Wänden hingen Meisterwerke unterschiedlicher Größe und Thematik so dicht aneinander, dass sich ihre Rahmen berührten, was so ähnlich aussah wie ein riesiges, mit bunten Briefmarken vollgepflastertes Briefkuvert. Jedes der Bilder erzählte flüsternd seine Geschichte, und wenn niemand sonst im Raum war, redete auch Bartholomew mit jedem der Bilder, vertraute ihnen seine Geheimnisse an und seine großen Pläne für die Zukunft. Sie waren schließlich seine Familie.
Mehrere Mitglieder dieser Familie hingen nun vor ihm in seinem Gewölbe. Während er einen mit Brie bestrichenen Cracker aß, erwärmte er sich an der zarten Glut, die Das Konzert – einer von nur fünfunddreißig existierenden Vermeers – verströmte. Die zurückhaltende Verwendung von Licht, die den Maler auszeichnete, erfüllte die dargestellte Szene – eine auf alten Instrumenten musizierende holländische Familie aus dem siebzehnten Jahrhundert – mit beinahe übernatürlicher Heiterkeit und ruhigem Ernst. Wax konnte die getragenen Harmonien des Klavichords und der Gitarre tatsächlich hören; sie beruhigten die durch seinen Kopf schwirrenden Gedanken.
Neben dem Vermeer schäumten die aufgewühlten Fluten des Sturms auf dem See Genezareth in einem immerwährenden, im Augenblick der Betrachtung erstarrten Orkan. Das einzige von Rembrandt gemalte Seestück, das die Jünger Jesu darstellt, die sich an ein Segelboot klammern, das in den weiß schäumenden Wellen zu kentern droht. Goldenes Sonnenlicht fällt auf das von den Wogen hin und her geworfene Boot, als sich in den rauchgrauen Wolken ein blaues Loch öffnet – die Verheißung Gottes auf Errettung der Gläubigen. Nun war es jedoch Bartholomew Wax, der Frieden und Erlösung mehr denn je ersehnte.
Als er seine Mahlzeit beendet hatte, stand er auf und schlenderte, hin und wieder an seinem Kelch nippend, an den übrigen Gemälden seiner Sammlung vorüber. Hier hingen die anderen Kinder aus dem Gardner Museum – ein winziges Selbstporträt von Rembrandt, Chez Tortoni von Manet, La Sortie de Pesage von Degas und andere mehr. Diese Barbaren von der NAGJK hatten die Bilder einfach aus den Rahmen geschnitten, und Wax selbst musste die Leinwände auf neue Keilrahmen spannen und passenden Ersatz für die Rahmen besorgen. Außerdem hatte er dafür gesorgt, dass die NAGJK mit mehr Sorgfalt vorging, wenn sie das nächste Mal Kinder herbeischaffte, die er adoptierten würde.
Er hatte immer davon geträumt, eine Familie wie diese zu haben. Reproduktionen waren nicht gut genug, denn selbst die besten Lithographien konnten das Spiel des Lichts auf den wirklichen Pinselstrichen, die Tiefe und die Struktur ihrer Wirbel und Streifen nicht wiedergeben. Als er noch ein Junge war, hatte er beschlossen, einmal sehr reich zu werden, damit auch er sich ein Haus voller Gemälde kaufen konnte wie Mrs. Gardner. Die Notwendigkeit, viel Geld, sehr viel Geld zu verdienen, ließ in ihm den Gedanken reifen, Medizin zu studieren, denn waren nicht alle Ärzte reich? Doch als er älter wurde und mehr über die exquisite Welt der Kunstauktionen lernte, entdeckte Wax, dass selbst die Werke, die von den Künstlern nach ihrem Tod gemalt wurden – die posthum »in Zusammenarbeit« mit den im Auftrag der Regierung arbeitenden violettäugigen Medien unter dem Namen dieser Toten entstanden –, für Millionen von Dollars pro Exemplar verkauft wurden. Doch das waren nicht die Bilder, die er wollte. Er spielte mit dem Gedanken, seine eigene Biotech-Firma zu gründen, um reich zu werden, doch sehr bald wurde ihm klar, dass ihm selbst der Reichtum von Bill Gates nicht die Bilder kaufen konnte, die er wirklich haben wollte – die unbezahlbaren Schätze, die im Gardner Museum und anderen Museen überall auf der Welt hingen. Als er das begriff, ließ er sich auf den Handel mit der Nordamerikanischen Gesellschaft für Jenseitskommunikation ein und bot ihr seine Dienste an, als Gegenleistung für deren Versprechen, die unerreichbare Sammlung zusammenzutragen, nach der er sich sehnte.
Vor jedem der Bilder in seiner Galerie blieb Wax auf seinem Rundgang durch das Gewölbe eine Weile stehen und versuchte, das Unvermeidliche hinauszuschieben. Nach mehr als fünfzehn Jahren Mühen und Anstrengungen näherte sich seine Arbeit für die Gesellschaft ihrem Ende, was bedeutete, dass auch er seinem Ende nah war. Ironischerweise hatte der Erfolg und nicht ein Misserfolg sein Schicksal besiegelt. Sobald die NAGJK erreicht hatte, was sie wollte, würde sie ihm seine Familie wegnehmen und ihn, um ihre Geheimnisse zu wahren, eliminieren.
Er blieb vor da Vincis Madonna mit der Spindel stehen, hob den Kelch an seine Lippen und stellte fest, dass nur noch ein Tropfen Wein im Glas war. Erneut spielte er mit dem Gedanken, sich wie ein Pharao mit seinen Schätzen in seinem Grab einzuschließen. Doch Wax wusste besser als irgendein anderer, dass man in das Leben nach dem Tod nichts mitnehmen konnte. Die Gesellschaft würde früher oder später das Kellergewölbe sicherlich aufbrechen, und Wax konnte den Gedanken nicht ertragen, dass seine Kinder in die Hände eines Banausen und Scheusals wie Carl Pancrit geraten würden.
In Gedanken versunken betrachtete er Leonardos Darstellung der Maria mit dem Jesuskind, die einmal das Heim des Duke of Buccleuch in Schottland verschönert hatte. Auf dem Gemälde blickte der Säugling die wie ein T geformte hölzerne Spindel in seiner Hand an, ein Symbol für das Kreuz, das ihn erwartete – sein Ende bereits im Anfang bildhaft dargestellt. Marias rechte Hand schwebte unsicher über dem Kind, als wollte sie ihren Sohn vor seinem Schicksal bewahren, obgleich sie wusste, dass sie dies nicht konnte. Bestimmte Opfer mussten gebracht werden.
Wax näherte sich der letzten und jüngsten Bereicherung seiner Sammlung mit Widerstreben. Seine Zeit war fast um, doch das war nicht der Grund, weshalb er zögerte. Das jüngste Bild machte ihm Angst. Obwohl er zahllose Kopien und Imitationen des Schreis gesehen hatte, konnte ihn keine auf das Grauen vorbereiten, das im Original zum Ausdruck kommt, das direkt aus dem Munch Museum in Oslo hierher gebracht worden war. Unter einem Himmel so rot und flüssig wie eine arterielle Blutung fror eine androgyne Gestalt auf einem kahlen Steg am Meer, Augen und Mund aufgerissen, die grotesk verformten Hände gegen die Schläfen gepresst.
Die meisten Menschen, die das Gemälde sahen, begriffen nicht, dass dies keine menschliche Gestalt war, die schrie. Nein, sinnierte Wax, das mutantenhafte Wesen war stumm vor Angst, während es vergeblich seine Ohren bedeckte, um das ewige, kosmische Geheul des Universums nicht hören zu müssen – »ein lauter, nicht endender Schrei durchdringender Natur«, wie Edvard Munch es genannt hatte.
Mit ihren indigofarbenen Augen und dem kahlen, totenkopfähnlichen Schädel konnte die Gestalt durchaus auch ein Violetter sein, mit kahlgeschorenem Schädel, um die Elektroden eines Seelenscanners anschließen zu können.
Die Ähnlichkeit erfüllte Wax mit Ekel und dem neuerlichen Gefühl der Dringlichkeit. Wie würde es wohl sein, dieses entsetzliche Geheul transzendentaler Qualen zu hören ... ohne eine Möglichkeit, es aussperren zu können? Was, wenn alle es hören könnten? Würde die menschliche Rasse fähig sein, dem permanenten Schrei ihrer eigenen unentrinnbaren Sterblichkeit zu widerstehen?
Die Frage nagte an Dr. Wax, drängte ihn zu größerer Eile. Ohne sich die Mühe zu machen, die Reste seiner letzten Mahlzeit wegzuräumen, raffte er sein Haar mit dem Gummiband zu einem Pferdeschwanz zusammen und ließ den Käse und die Pastete auf der Silberplatte liegen, wo sie verschimmeln würden. Die ihm verbleibende Zeit war zu kostbar, und er würde ohnehin nie mehr hierher zurückkehren.
Stattdessen begann er, die Gemälde eines nach dem anderen von der Wand abzunehmen, sie in extra verstärkte Kisten zu packen, die er zu diesem Zweck im Keller gesammelt hatte. Speziell geschnittene Styroporhalterungen fixierten jeden Rahmen fest und unverrückbar in seiner Kiste und gewährleisteten, dass nichts die Oberfläche der Leinwand berührte, während zusätzlich eingefügte Holzrahmen verhinderten, dass die Seiten aus Pappkarton eingedrückt oder durchbohrt wurden. Die Kisten trugen alle bereits Versandaufkleber, auf denen der Namen »Arthur Maven« und eine falsche Absenderadresse zu lesen war sowie der jeweilige Empfänger der Pakete: das Munch Museum in Norwegen, Drumlanrig Castle in Schottland und, neben vielen anderen, natürlich auch das Gardner Museum.
Wax lächelte sogar, als er sich die grenzenlose Verblüffung auf den Gesichtern der Empfänger beim Öffnen der Kisten vorstellte, wenn sie in ihnen ihre seit langem verschwundenen Bilder entdeckten. Der Gedanke machte ihn glücklich. Anders als für Menschen gab es für Gemälde kein Leben nach dem Tod, in dem sie ihre Existenz fortsetzen konnten. Ein Gemälde, das niemand sah, hörte auf zu existieren, und seine Kinder verdienten es zu leben.
Der CD-Player seiner Stereoanlage wechselte von Vivaldi zu Mahlers Neunten. Wax öffnete die Tür des Gewölbes und machte sich an die mühsame Arbeit, die unhandlichen Kisten die Stufen hinauf und zu seinem Ford Explorer hinaus zu tragen. Er ließ den Motor und die Klimaanlage auf vollen Touren laufen, während er den Geländewagen belud, der kaum ausreichend Platz für seine Sammlung bot. Als er schließlich bereit war loszufahren, schnappte er sich die alte schwarze Arzttasche, in der er normalerweise nur sein Mittagessen aufbewahrte.
Die tiefstehende Nachmittagssonne übergoss die fast senkrechten Felswände der Organ Mountains mit goldenem Licht, das die bizarren Konturen der steilen Flanken noch deutlicher herausschälte und die zerklüftete graue Bergkette – wie ihr Name besagte – tatsächlich wie die Pfeifen einer gigantischen Kirchenorgel aussehen ließ. Dr. Wax lebte in einer Wohnsiedlung in der Wüste, ein paar Meilen außerhalb von Las Cruces, und musste sich beeilen, wenn er es vor Ende der Annahmefrist für Nachtauslieferungen zur Filiale des Paketdiensts schaffen wollte.
»Möchten Sie irgendeines davon für mehr als fünfzig Dollar versichern?«, erkundigte sich die Frau hinter dem Schalter und spreizte erwartungsvoll ihre Wurstfinger, als sie die Pakete wog.
Wax lächelte angesichts des Irrsinns, den Wert eines unersetzlichen Kunstwerks in Dollar zu bemessen. »Nein, das ist ausreichend so.«
Nachdem er die Mitglieder seiner adoptierten Familie sicher auf dem Weg zurück zu ihren ursprünglichen Besitzern wusste, lenkte Dr. Wax seinen Geländewagen wieder auf die U.S. Route 70 zurück und folgte ihr in östlicher Richtung. Er musste sich jetzt um seine anderen Schutzbefohlenen kümmern – die missratenen.
Die Dämmerung tauchte das Gebüsch am Straßenrand in ein schmutziges Orange, und die verstreut liegenden Häuser am Stadtrand wurden allmählich weniger. Wax steuerte den Ford durch die tiefer werdenden Schatten einer engen, durch die Berge schneidenden Schlucht, bis er die Abzweigung der Route 213 South erreichte, deren braun-weiße Hinweisschilder ankündigten, dass sie zum White Sands National Monument führte. Doch statt ihr bis zum Ende zu folgen, bog er auf die für den Normalverkehr gesperrte Straße, die als Zufahrt zum Raketentestgelände diente, stoppte am Wachhaus und zeigte dem Soldaten, der dort Dienst tat, seine ID-Card. Der GI, eine kahlgeschorene Bohnenstange von einem Grünschnabel, dessen Gesicht noch von Aknepickeln übersät war, winkte ihn ohne einen Blick auf seinen Ausweis durch. Er kannte Dr. Wax. Jeder kannte ihn.
Am Rand der tiefer in die Militärbasis hineinführenden Straße graste eine Herde Oryx-Antilopen, die der ohnehin seltsam fremd wirkenden Landschaft einen surrealen Touch verliehen. Die afrikanischen Antilopen, an der schwarz-weißen Musterung ihrer Köpfe und ihren langen, geraden Hörnern zu erkennen, waren im Rahmen eines Programms, exotische Wildtiere in der Region ansässig zu machen, importiert worden und entwickelten sich in der Wüste von New Mexico prächtig. Die Tiere stoben auseinander, als Wax auf eine nicht gekennzeichnete Abzweigung von der Hauptstraße bog und ihr mit gedrosseltem Tempo folgte.
Bald machte die Wüste einem noch trostloseren Ort Platz: nackte, kahle Dünen aus granulärem Gips rechts und links der Straße, so weiß und grobkörnig wie gemahlene Knochen. An manchen Stellen waren die vom Wind angehäuften Ausläufer der Sanddünen über den Rand des Asphalts gekrochen und versuchten, verlorenes Terrain wieder zurückzuerobern und unter sich zu begraben. Die Räder des Geländewagens rollten knirschend durch die Sandverwehungen, die die Army regelmäßig zur Seite pflügte wie Schneewehen im Winter. Schließlich gelangte Wax zu einem weitläufigen, fensterlosen Gebäude, das wie ein Komplex aus Militärbaracken aussah. Kein Schild verriet, was für ein Gebäude dies war, und nur für die, die seinen Zweck bereits kannten, war der Zutritt erlaubt.
Wax parkte seinen Wagen auf dem angrenzenden, geteerten Parkplatz zwischen den wenigen zivilen PKWs und Militärfahrzeugen, und strebte mit seiner Arzttasche in der Hand auf die einzige Tür des Gebäudes zu, wo er zwecks Zutrittsgenehmigung seine ID-Card in einen Schlitz schob und den Daumen auf einen kleinen Sensorbildschirm presste.
»Dr. Wax!« Die diensthabende Unteroffizierin am Schalter neben dem Eingang lächelte, als der Wissenschaftler das Foyer betrat. »Wir haben Sie heute gar nicht erwartet. Wie geht es Ihnen?«
»Viel besser, danke.« Er erwiderte ihr Lächeln ein wenig verlegen, weil er sich, obwohl er sie praktisch jeden Tag sah, nie die Mühe gemacht hatte, ihren Namen zu merken. »Ich komme nur kurz vorbei, um nach den Patienten zu sehen.«
»Klar. Soll ich einen Wärter rufen?« Sie nickte in Richtung des Seitenflügels des Gebäudes, wo der Aufenthaltsraum für das Personal, die Büros und die Labore untergebracht waren.
»Nein, das ist nicht nötig«, erwiderte er, obwohl er Hilfe hätte gebrauchen können. Er hatte noch nie zuvor allein mit den Patienten zurechtkommen müssen.
»Wie Sie meinen.« Die Unteroffizierin tippte einen Code in die Tastatur ihres Computers, und die Tür hinter ihr summte. Wax stieß sie auf und trat in einen Korridor, der von identischen grauen Türen gesäumt war, die alle in Augenhöhe mit einem runden Spion versehen waren.
Der Arzt schlüpfte in den weißen Labormantel, der an dem Kleiderständer links von ihm hing, wartete jedoch, bis die Sicherheitstür hinter ihm wieder zuschwang und das Summen verstummte, ehe er seine schwarze Tasche aufschnappen ließ. Statt wie üblich einen Bagel, geräucherten Lachs und Schmelzkäse enthielt die Tasche eine Gasdruck-Injektionsspritze und Dutzende von mit einer klaren Flüssigkeit gefüllte Glasfläschchen.
Wax holte tief Luft und stellte die Tasche auf den Boden. Füge keinem einen Schaden zu, dachte er. Doch jetzt war es viel zu spät für den Eid des Hippokrates. Er nahm das erste Glasfläschchen und steckte es mit der Öffnung nach unten auf den runden Kolben der Injektionspistole. Es war dieselbe Spritze, die er benutzt hatte, den Patienten zu Beginn ihrer Gentherapie das Trägervirus zu injizieren. Da sie die Injektionsspritze bei dieser Gelegenheit schon einmal gesehen hatten, hoffte Dr. Wax, würden sie bei ihrem Anblick nicht in Panik geraten. Seine Kraft würde nicht ausreichen, allein mit ihnen fertig zu werden.
Mit der geladenen Spritze in der Hand ging Wax zu einem Audio-Panel in der Wand neben der Korridortür und legte einen Schalter um, mit dem er die vorprogrammierte klassische Musik anschaltete, die er benutzte, um die Patienten während seiner Visiten zu beruhigen. Der Gang füllte sich mit den balsamischen Klängen von Pachelbels Kanon in D. Obwohl Wax das Stück persönlich nicht mochte, hatte er festgestellt, dass es auf die Versuchspatienten dieselbe beruhigende Wirkung hatte wie die Musik, mit der man Aufzüge beschallte.
Die Injektionspistole hinter seinem Rücken versteckend, näherte sich Dr. Wax dem ersten Zimmer und spähte durch den Spion. Als er sich vergewissert hatte, dass der Bewohner des Zimmers nicht bereits lauerte, um sich auf ihn zu stürzen, tippte Wax den Sicherheitscode in das Tastenfeld neben der Tür, der sie öffnete. Die Musik war nicht laut genug, um das gellende Kreischen zu übertönen, das aus dem Raum drang, als sich die Tür öffnete.
»Geht weg! Lasst mich in Ruhe!«
Dr. Wax wusste, dass das Brüllen des Patienten nicht ihm galt. Der dicke Mann lag in der hinteren Ecke des Raums, zwischen Matratze und Toilette zusammengekrümmt, auf dem Fußboden und schien gar nicht registriert zu haben, dass der Arzt das Zimmer betreten hatte. Doch Wax konnte sich des mulmigen Gefühls nicht erwehren, dass der Patient genau wusste, weshalb er in sein Zimmer gekommen war und was er vorhatte
»Hallo, Harold. Wie geht es Ihnen heute?« Obwohl er ganz genau wusste, wie es Harold ging, bediente sich Wax der gewohnten Floskeln, mit denen er sonst immer seine Visiten begann, um den Patienten nicht aufzuregen, während er sich ihm mit der hinter dem Rücken versteckten Spritze vorsichtig näherte.
Harold schlug sich mit seinen in gepolsterten Wollfäustlingen steckenden Fäusten gegen den Kopf. Gerötete Narben und Schorf bedeckten sein Gesicht und seinen kahlrasierten Schädel, wo er sich mit den Fingernägeln die Haut aufgekratzt hatte. »GEHT WEG! IHR ALLE!«
Wimmernd versuchte Harold sich in der Vinylpolsterung zu verkriechen, die den Boden und die Wände des Raums bedeckte, und Wax registrierte, dass verschmierter Kot den hinteren Saum seines weiten Krankenhaushemds bedeckte. Anders als ein echter Violetter war es Harold weder möglich, die Seele eines Verstorbenen von seinem Körper Besitz ergreifen zu lassen, noch konnte er die Seelen ganz aussperren, die es versuchten. Deshalb lebte er in einer Grauzone zwischen diesem und dem nächsten Leben, während er ständig von Seelen bestürmt wurde, die klopften und klopften und klopften.
»Ruhig, Harold.« Wax ließ sich neben ihm auf ein Knie sinken und brachte die Hand mit der Spritze hinter seinem Rücken hervor. »Ich kann sie verschwinden lassen.«
Er rammte die Mündung der Injektionspistole in Harolds Oberarm und drückte den Abzug durch. Mit einem spuckenden Geräusch schoss die Nadel die Flüssigkeit unter die Haut, und Harolds Augen flogen auf und starrten Wax mit irr flackerndem Blick an.
»Sie.« Die violetten und blassblauen Flecken seiner Iriden flossen zu einem elektrisiert schillernden Lavendelblau zusammen. »Sie haben mir das angetan. Ich werde ...«
Wax taumelte zurück, als Harold Anstalten machte, sich auf ihn zu stürzen. Doch die Krämpfe warfen Harold zu Boden, wo er zuckend und schnalzend wie ein gestrandeter Wal auf dem Bauch liegen blieb. Da Bartholomew Wax keiner war, der sich unnötig auf ein Risiko einließ, hatte er fast die zehnfache tödliche Dosis Procain in die mit der Injektionspistole verabreichte Lösung gemischt.
Der Arzt ging zu seiner Tasche zurück und ersetzte das leere Giftfläschchen durch ein frisches, ehe er sich der nächsten Tür näherte. Durch den Türspion beobachtete er eine Weile ein Latino-Mädchen, das mit um die Schultern geschlungenen Armen in der winzigen Zelle auf und ab tigerte. Ihr Schädel war wie der Harolds kahlgeschoren, und die zwanzig tätowierten Kontaktpunkte waren zu erkennen, wo die Elektroden des Seelenscanners befestigt wurden.
Die Ähnlichkeit des Mädchens mit der Gestalt auf Munchs Schrei beruhigte seine Gewissensbisse, wegen dem, was er zu tun im Begriff war. Es war das Beste für sie – für sie und für die ganze Welt.
Als Wax in den Raum trat, ruckten die Augen des Mädchens zu ihm herum. Eines war violett, das andere braun wie nicht zusammenpassende Murmeln. »Hallo? Wer sind Sie? Wo bin ich?«
»Machen Sie sich keine Sorgen. Alles wird wieder gut.« Mit der hinter seinem Rücken verborgenen Injektionspistole, schob sich Wax näher, während er auf irgendein Anzeichen wartete, wie gefährlich die Seele war, die sie in Besitz genommen hatte.
Das Mädchen drehte den Kopf und musterte seine Umgebung. »Ist das hier ein Krankenhaus? Ich weiß nur noch, dass ich einen Unfall hatte.« Sie sah auf die glatte, braune Haut ihrer Arme hinab. »Was ist mit mir passiert?«
»Sie werden sich bald besser fühlen«, versicherte Wax ihr. »Ich bin Arzt.«
Das Problem im Umgang mit Marisa war, dass die Person, die sie gewesen war, nicht mehr existierte. Die Quantenverbindung in Marisas Gehirn, die früher die elektromagnetische Essenz ihrer Seele in ihrem Körper festgehalten hatte, war erodiert und hatte sie als ein leeres Gefäß zurückgelassen, von dem jede tote Seele Besitz ergreifen konnte. Jeden Augenblick konnte eine andere Seele diejenige verdrängen, die gerade in ihr war, doch wenn Wax die gegenwärtige Seele lange genug in Schach halten konnte, um Marisa die Injektion zu geben ...
»Sie müssen meinen Mann anrufen«, flehte sie ihn an. »Sie müssen ihm sagen, wo ich bin.«
»Selbstverständlich. Aber zuerst werde ich Ihnen etwas geben, das helfen wird, Sie zu beruhigen.«
Ehe er ihr das Gift verabreichen konnte, richtete sie sich, wie von einem unsichtbaren Marionettenspieler hochgerissen, mit einem Ruck auf. Sie wackelte mit dem Kopf, ihr Gesicht verzerrte sich zuckend in einer Serie von Ticks, und als der Anfall vorbei war, stand sie mit gespreizten Beinen vor ihm, die Fäuste geballt, und starrte ihn unter finster gerunzelten Brauen hervor an. »Na schön, helfen Sie mir, ich bringe Sie um, Wax!«
Marisa stürzte sich auf ihn und krallte ihre Hände um seinen Hals. Er sah tanzende Lichter vor seinen Augen, stieß ihr die Nadel der Spritze blind in den Leib und drückte den Abzug durch. Erst als ihre Hände von seiner Kehle abließen und sie zu Boden sackte, blickte er auf sie hinab und sah, dass die Injektionsnadel den dünnen Stoff ihres Krankenhaushemds direkt über dem Herzen durchstochen hatte.
Harold, dachte er und rang krächzend nach Atem. Wax hatte nicht damit gerechnet, dass das Gift so schnell wirkte, obwohl er wusste, dass Procain in ausreichender Dosis Herzstillstand herbeiführen konnte. Er durfte nicht riskieren, dass die Patienten, die er getötet hatte, von den anderen Insassen der Station Besitz ergriffen. Er musste schneller arbeiten.
Wax eilte zu seiner Arzttasche zurück, nahm die restlichen Giftfläschchen heraus und steckte sie in die tiefen Taschen seines weißen Mantels. Er hielt zwischen den Räumen nur so lange inne, wie es dauerte, eine neue Ampulle in seine Injektionspistole zu schieben. Jedes seiner Opfer fügte neue Bisse, blaue Flecken oder blutende Kratzer zu seinen Wunden hinzu, doch er machte unbeirrt weiter. In jedem der totenkopfähnlichen Gesichter sah er das bedauernswerte, gequälte Geschöpf Edvard Munchs, und er war entschlossen, den Schrei, den sie hörten, ein für allemal zum Verstummen zu bringen.
Der Letzte, ein magerer Schwarzer namens Ezra, lebte noch lange genug, um Wax bis in den Korridor hinaus zu verfolgen. Der Arzt stolperte und kroch hyperventilierend durch den Gang, während der vorwärts taumelnde sterbende Mann über ihm zusammenzubrechen drohte. Als Ezra zur Seite kippte und durch eine der offenstehenden Türen fiel, sprang Bartholomew Wax auf und lud, die Ampullen wechselnd, als seien sie das Magazin einer Automatik, die Injektionspistole nach. Dann warf er einen verdutzten Blick nach rechts.
Die Unteroffizierin vom Empfangsschalter stand nur ein paar Meter von ihm entfernt; die 45er Pistole in ihrer Hand war auf seinen Kopf gerichtet. Sie lächelte nicht.
Neben ihr stand ein großgewachsener, kräftiger Mann in einem marineblauen Anzug. Silberne Fäden durchzogen sein dunkles Haar; die buschigen, schwarzen Augenbrauen und die Falten in seinem Gesicht verliehen ihm den Anschein väterlicher Güte.
Er neigte grüßend den Kopf. »Dr. Wax.«
»Mr. Pancrit.« Die Geringschätzung, mit der Wax dies sagte, war beabsichtigt. Er wusste natürlich, dass Carl Pancrit Doktor war – allerdings nur im technischen, nicht im ethischen Sinn. »Ich habe nicht erwartet, Sie um die Zeit hier zu sehen.«
»Offensichtlich nicht«, bemerkte sein Kollege und nickte auf den Mann hinab, der in der offenstehenden Tür lag. »Aber ich habe Sie erwartet. Seit geraumer Zeit habe ich den Verdacht, dass Sie nicht wirklich mit dem Herzen bei diesem Projekt sind.«
Wax spannte den Finger um den Abzug der Injektionspistole. »Sehen Sie sich um, Carl. Das Experiment ist gescheitert.«
»Nicht, wenn weitere Forschungen daran anschließen. Sie haben seit Monaten keine Vorschläge mehr eingebracht, und das weckt in mir den Verdacht, dass Sie uns etwas verheimlichen. Das würden Sie doch nicht tun, Barty, oder?«
Pancrit machte ein paar Schritte auf ihn zu, die Arme ausgebreitet, als wolle er ihn in einer väterlichen Umarmung an seine Brust ziehen, doch Wax schwenkte die Mündung der Injektionspistole zu ihm herum. »Ich bin hier fertig, Carl.«
Die Unteroffizierin hob warnend die Pistole.
Pancrit spreizte die Hände zur Seite, um beide zu beschwichtigen. »Bitte. Lassen Sie uns vernünftig miteinander reden.« Mit einer Handbewegung bedeutete er der Soldatin, ihre Waffe sinken zu lassen, und bedachte Wax mit einem mitfühlenden, verständnisinnigen Blick. »Ich kann Ihnen nicht einmal einen Vorwurf daraus machen, dass Sie diese armen Teufel aus ihrem Elend befreit haben. Ich hätte dasselbe getan ...«
»Sicherlich hätten Sie das.« Wax hielt die Injektionspistole auf Pancrits Brust gerichtet.
»... aber Sie sind uns noch etwas schuldig für Ihre Bilder. Es hat uns eine Menge Mühen gekostet, sie für Sie zu beschaffen. Wollen Sie, dass wir sie wieder dorthin zurückschicken, wo sie herstammen?«
Wax lächelte traurig. »Das wird nicht nötig sein.«
Er stieß die Nadel der Injektionspistole in seine Halsschlagader und drückte den Abzug durch.
Als er zu Boden sackte, stürzte die Unteroffizierin mit schussbereit erhobener Pistole auf ihn zu für den Fall, dass Wax irgendeinen Trick versuchte.
Doch das tat er nicht.
Mit einem Seufzen beobachtete Carl Pancrit, wie Wax sich mit zuckenden Gliedern im Todeskampf wand. »Glaub nur nicht, dass du mir so leicht entkommen kannst«, murmelte er.
Kapitel 2Ein Sklave der Meister
Natalie Lindstrom konnte sich eines Anflugs von Neid nicht erwehren, als sie vor Hector Espinosas Haus in Laguna Beach parkte. Die Arbeit bei der Abteilung für Bildende Künste der NAGJK hatte ihn so reich gemacht, dass er sich diesen weißen Art-Deco-Palast am Meer kaufen konnte, während sie, ihre Tochter und ihr Vater sich in einer kleinen Eigentumswohnung mit zwei Schlafzimmern in Fullerton wie Sardinen zusammenquetschen mussten.
Sei lieber froh, dass er überhaupt bereit ist, dich zu sehen, mahnte sie sich, als ihr Blick auf das Schild neben der Türklingel fiel. NICHT STÖREN!, schrie es. TERMINE NUR NACH VEREINBARUNG.
Natalie hatte diesen Termin vor einer Woche telefonisch abgemacht, doch nachdem sie jetzt dreimal ohne Erfolg den Klingelknopf gedrückt hatte, fragte sie sich, ob Hector es sich anders überlegt hatte.
Endlich öffnete ein schwergewichtiger Latino in einem ausgebeulten Muscleshirt und Segelshorts die Tür. Sein tätowierter Schädel war sauberer rasiert als das Gesicht, seine violetten Augen verquollen und gerötet, als er sich den Schlaf aus ihnen rieb. »Ja?«
Er war offenkundig noch nicht wach genug, sie in ihrer schwarzen Pagenkopfperücke und den grünen Kontaktlinsen zu erkennen, die sie trug, wenn sie die Agenten des Sicherheitsdienstes der NAGJK abschütteln wollte. Natalie rasierte ihren Kopf ebenfalls, weil einige ihrer etwas heikleren Klienten darauf bestanden, von einem SoulScan-Gerät bestätigt zu sehen, dass sie tatsächlich die Seelen der toten Maler herbeigerufen hatte, mit denen zu arbeiten sie behauptete.
»Ich bin‘s, Hector«, sagte sie.
»Boo? Heiliger Strohsack! Ist es schon Mittag?«
»Viertel nach zwölf, um genau zu sein. Ich bin eh schon ‘ne Viertelstunde zu spät.«
»Tut mir leid ... Ich bin ziemlich neben der Mütze.« Er trat zur Seite und winkte sie nach drinnen. »Komm rein. Und entschuldige das leidige Durcheinander.«
Er führte sie durch eine Reihe von Räumen, die es alle irgendwie schafften, vollgestopft und leer zugleich auszusehen. Im Esszimmer standen ein Kartentisch, der mit ungeöffneter Post überhäuft war, und ein Klappstuhl aus Metall. Im Wohnzimmer gab es einen Flachbild-Plasmafernseher, eine schwarze Ledercouch und ein Regal, das von Kunstbüchern, Skizzenmappen und Stapeln loser Blätter und Zeichnungen überquoll. Die Holzdielen des Fußbodens waren mit Stapeln von Pizza-Schachteln und zusammengeknüllten Hamburger-Verpackungen übersät; leere Bierflaschen lagen wie umgeworfene Bowling-Kegel herum. Das war auch schon alles an Möbeln, wofür Hector Verwendung hatte – wofür er Platz hatte. Das übrige Haus war den Gemälden vorbehalten.
Grundierte Leinwände lehnten an den Wänden und den Armlehnen der Couch, manchmal vier oder fünf davon aneinander gelehnt mit Pappkartonstreifen dazwischen. Bilder, an denen er arbeitete, standen auf Staffeleien, so willkürlich und kunterbunt durcheinander aufgestellt wie Straßenschilder bei Arbeiten auf dem Highway: Hier ein Monet, das leuchtende Rot und Violett seiner Wasserlilien noch klebrig und glänzend von feuchter Farbe; dort eine Kreuzigung Christi von Raffael, die auf ihre fünfte Lasur wartete. Die verschiedenen Stile der Bilder reichten von der dunklen, barocken Farbenpalette von Velázquez bis zu den Drippings und Farbspritzern von Jackson Pollocks abstraktem Expressionismus. Das Haus hätte auch ein Lagerhaus der großen Museen der Welt sein können, doch hier hingen ausschließlich die Werke eines Künstlers an den weißen Wänden – die Hectors.
»Sind das welche von deinen neuesten?« Natalie erkannte den für ihn kennzeichnenden Stil: gesprayte Szenen aus dem urbanen Leben von L.A., mit den übertrieben grell dargestellten Cartoonfiguren der Graffitimalerei. »Sie gefallen mir.«
Er zuckte mit den Achseln. »Eh! Ich hab gedacht, wenn niemand sonst sie will, dann hänge ich sie eben bei mir auf.«
Der beiläufige Tonfall, in dem er dies sagte, konnte seine Verbitterung nicht verbergen. Natalie wusste, als Violetter in der Abteilung für Bildende Künste der Gesellschaft zu arbeiten, war ungefähr vergleichbar damit, der Leadsänger einer Coverband zu sein: Das Publikum interessierte sich nicht für deine eigenen Werke, nur für die Hits anderer Leute.
»Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich mir ‘n Frühstück genehmige«, brummte Hector und steuerte auf die Küche zu. Schiefe, sich bedenklich neigende Stapel schmutzigen Geschirrs türmten sich auf der Anrichte neben Gläsern, in denen Malpinsel in einer trüben, schwarzbraunen Flüssigkeit standen und darauf warteten, gereinigt zu werden. Der schwere, fettige Geruch von aufgewärmten Bohnen – in der Mikrowelle gebackene Burritos vermutlich – milderte den stechenden Geruch von Terpentin und schalem Heineken-Bier, der in der Luft hing. Hector kramte einen Flaschenöffner aus dem Chaos und fischte sich ein Bier aus dem Kühlschrank. »Wie wär‘s, Boo? Auch eines?«
»Nein, danke. Und ich hab dir schon hundert Mal gesagt, nenn mich nicht so«, blaffte sie. Sie mochte ihren alten Spitznamen nicht. Als sie ein Kind gewesen war, hatten alle Violetten, die zusammen mit ihr in die Iris Semple Akademie für Mediale Vermittler gegangen waren, sie »Boo« genannt, weil alles und jeder ihr Angst einzujagen schien. Auch heute noch war sie von einer fast schon hypochondrischen Sorge um ihre Gesundheit erfüllt, weshalb sie auch keinen Alkohol trank – eine Tatsache, die Hector sehr wohl bekannt war.
»Wie du meinst.« Mit einem Grinsen hebelte er den Kronkorken von der Flasche und schlürfte den Schaum, der aus der Flasche quoll.
»Ich dachte, du trinkst nicht mehr.«
»Tu ich auch nicht.«
Er leerte die halbe Flasche, während sie die Stufen zu seinem Atelier hinaufstiegen. Natalie unterdrückte ein Seufzen wie jedes Mal, wenn sie die Größe des Raums mit seinen riesigen Panoramafenstern sah, die auf die weiß getupften Wellen des Pazifiks hinausblickten. Sie musste gewöhnlich auf dem schmalen Balkon oder manchmal auch in der Küche ihrer kleinen Wohnung malen.
Noch mehr Gemälde standen im Atelier, die meisten von ihnen nicht viel weiter gediehen als bis zum Stadium der Bleistiftskizze. Neben einer der Staffeleien lag auf einem hohen Barhocker aus Holz eine von bunten Flecken bedeckte Palette und ein Sortiment von – wie es aussah – verschiedenfarbigen Zahnpastatuben, die verdreht, flachgedrückt und aufgerollt worden waren, um den letzten Tropfen Ölfarbe aus ihren herauszupressen. Eine Seelenleine baumelte von einem in ein Bein des Hockers geschlagenen Nagel. Seelenleinen wurden wie Kopfhörer getragen und erfüllten im Notfall dieselbe Funktion wie der Panikknopf eines SoulScan-Geräts. Falls die das Medium bewohnende Seele versuchte, den Körper des Violetten aus dem Raum zu steuern, würde die Seelenleine dem Gehirn einen Elektroschock versetzen, dadurch die elektromagnetische Essenz der Seele vertreiben und dem Violetten wieder die Gewalt über seinen Körper zurückgeben. Ein Medium wie Hector, der völlig allein mit unberechenbaren Seelen arbeitete, konnte sich nicht leisten, solche Risiken einzugehen.
Auf der Ablage der Staffelei lehnte eine Brille mit runden, dicken Gläsern an der leeren Leinwand. Sie hatte einmal Claude Monet gehört, der sie gegen Ende seines Lebens tragen musste, weil der Graue Star in zunehmendem Maß sein Sehvermögen beeinträchtigte, das für die Entstehung des Impressionismus von so großer Bedeutung gewesen war.
Ein Glasschrank an der Wand gegenüber den Panoramafenstern enthielt eine erlesene Sammlung solcher Erinnerungstücke: Kontaktobjekte – persönliche Gebrauchsgegenstände der Verstorbenen, in denen noch immer eine Quantenverbindung mit der elektromagnetischen Essenz ihrer Seele enthalten war. Sie waren die Schlüssel, die das Tor zum Leben nach dem Tod öffnen und die Toten aus den Schwarzen Räumen, in denen sie eingeschlossen waren, herbeirufen konnten. Natalie kannte einige dieser Gegenstände. Ein pathetischer, vergilbter Brief von Van Gogh an seinen Bruder Theo, in dem er ihn um mehr Geld bat. Eine Gipsbüste von Caligula aus dem persönlichen Besitz von Rembrandt van Rijn, der sie zusammen mit dem Großteil seiner übrigen Besitztümer verkaufen musste, als er 1656 Konkurs anmeldete. Die Gesellschaft hatte dreihundertfünfzig Jahre alte Auktionsaufzeichnungen benutzt, um die Skulptur ausfindig zu machen und in ihren Besitz zu bringen. Mindestens zwei Dutzend andere Antiquitäten wurden in der Vitrine aufbewahrt, doch Natalie konnte nur raten, welchen Malern sie einmal gehört hatten.
Obgleich die NAGJK für einen Violetten der Gesellschaft wie Hector ohne weiteres ein Originalgemälde eines toten Malers als Kontaktobjekt zur Verfügung hätte stellen können, zog es die Regierung in der Regel vor, eher profane Objekte aus dem Alltag der Maler zu benutzen. Picassos Rasierpinsel war viel leichter zu beschaffen und zu transportieren als Guernica. Da Natalie nicht das Privileg genoss, Zugang zu den Meisterwerken der Künstler oder zu ihren Toilettensachen zu haben, war sie auf ihre Beziehung zu Hector angewiesen. Er war zehn Jahre älter als sie und seit ihrer gemeinsamen Schulzeit immer so etwas wie ein älterer Bruder gewesen.
Hector kauerte sich vor dem Glasschrank nieder und beäugte die Gegenstände prüfend, als würde er sich im Schaufenster einer Bäckerei einen Doughnut aussuchen. »Du willst dich also wirklich mit dem verrückten Norweger einlassen?«
»Der Klient wünscht es so.« Natalie verschränkte die Arme in einer Weise, die eher lässig als abwehrend wirken sollte. »Seit Der Schrei verschwunden ist, liegt Munch voll im Trend.«
Hector lachte glucksend. »Ja, so ist der Lauf der Dinge. Jeder Maler, der es wert ist, gestohlen zu werden, ist es auch wert, gekauft zu werden. Du und ich, wir beide könnten nicht einmal die Diebe bezahlen, damit sie unsere Bilder klauen.«
Die Bemerkung ärgerte sie, vor allem, weil sie der Wahrheit entsprach. Sie bot ihre Originalbilder in mehreren Cafés der Stadt zum Kauf an, zu Preisen, die unter dem lagen, was manche Sammler für Drucke bezahlten. Fast umsonst.
Hector nahm noch einen Schluck Bier. »Ich hoffe bloß, du weißt, worauf du dich einlässt.«
»Ich habe Vincent herbeigerufen, ohne mir in einem Weizenfeld eine Kugel in die Brust zu schießen«, erwiderte sie spitz.
»Munch ist anders. Er hatte ... Probleme mit Frauen.«
Natalie stieß ein ärgerliches Lachen hervor. »Unpassendes Geschlecht« war einer der Hauptgründe gewesen, mit denen die Gesellschaft ihre Bewerbung bei der Abteilung für Bildende Künste abgelehnt hatte. Nach Ansicht einiger Psychologen der Gesellschaft empfanden es manche verstorbene Künstler möglicherweise als unangenehm, den Körper eines Violetten anderen Geschlechts zu bewohnen, was unter Umständen die Zusammenarbeit erschweren konnte. Da die meisten der gefragten Maler zufällig männliche Weiße seien, hatte die Gesellschaft Natalie zu verstehen gegeben, seien männliche Violette für den Job besser geeignet. Sie hatten allerdings keine Probleme damit gehabt, zuzulassen, dass Natalies ermordete Freundin Lucy Kamei mit Mozart und Beethoven arbeitete, weshalb Natalie den Verdacht hegte, diese an den Haaren herbeigezogene Begründung war nur eine Ausrede dafür, dass sie sie in die Abteilung für Verbrechensbekämpfung abgeschoben hatten, in der es zu wenige Violette gab.
»Ich komm mit Munch schon zurecht«, murmelte sie.
»Ja ... das denke ich auch.« Hectors Lippen bewegten sich, als er eine Tür der Glasvitrine öffnete, und Natalie wusste, dass er sein Schutzmantra sprach. Auf diese Weise konnte die Seele nicht bei ihm klopfen, wenn er das Kontaktobjekt berührte.
»Ich muss es machen«, sagte sie, als habe er von ihr eine Antwort verlangt. »Ich hab eine Familie, für die ich sorgen muss.«
»Ich weiß. Ich hätte dich nicht kommen lassen, wenn es nicht so wäre.« Vorsichtig schob er ein paar der Gegenstände zur Seite und nahm eine abgenutzte, weißgesprenkelte Zahnbürste mit groben, sich nach allen Seiten sträubenden Borsten aus dem Schrank. Hector ließ die Zahnbürste ein paarmal durch seine Finger wirbeln wie ein Schlagzeuger seine Stöcke, ehe er sie ihr mit dem Griff voran reichte. »Bring sie zurück, wenn du fertig bist.«
Natalie zögerte. Bevor sie die Zahnbürste in die Hand nahm, begann sie in Gedanken ihr eigenes Schutzmantra zu rezitieren: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln ...
»Bist du sicher, dass du kein Bier willst, Boo? Wenn du dich auf Munch einlässt, wirst du es vielleicht brauchen.« Er leerte glucksend den Rest seiner Flasche. »So ist es mir zumindest ergangen.«
Sie wich dem eindringlichen Ernst in seinem Blick aus.
»Danke. Lieber nicht.«
... Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser, fuhr sie unbeirrt fort, bis sie die Zahnbürste tief in ihrer Einkaufstasche aus Segeltuch verstaut hatte.
Während sie nach Fullerton zurückfuhr, machte Natalies Selbstbewusstsein mehr und mehr Unsicherheit Platz. Obwohl sie es vor Hector nicht hatte zugeben wollen, teilte sie seine Bedenken, was die Arbeit mit Edvard Munch anging. Der Norweger war wirklich verrückt – ein von Platzangst, lähmenden Panikattacken und Nervenzusammenbrüchen heimgesuchter Mensch, der in der Tat Probleme mit Frauen hatte. Sehr gutaussehend, doch schüchtern und vor allem in seinen jungen Jahren hyperempfindsam, durchlebte er eine Reihe von unglücklichen Affären, bei denen schöne Frauen, die ihn verführten und manipulierten, eine zentrale Rolle einnahmen. Eine seiner Geliebten, Tulla Larsen, drohte sich zu erschießen, um Munch davon abzuhalten, sie zu verlassen. Als er versuchte, ihr die Pistole aus der Hand zu winden, löste sich ein Schuss, der ihm die Spitze seines linken Mittelfingers abriss.
Eine andere seiner Geliebten, Eva Mudocci, malte er als Salome, die mit einem zufriedenen Lächeln einen abgeschlagenen Kopf präsentiert, der große Ähnlichkeit mit dem des Malers hat. In Anbetracht einer solchen Lebensgeschichte war es nicht überraschend, dass Munch in dem Bild Vampir einen Mann malte, der hilflos zusammengekauert wie ein Fötus auf dem Schoß einer Frau liegt, die ihren Mund auf seinen Nacken presst, entweder weil sie ihn küsst oder weil sie sein Blut trinkt, während ihr langes rotes Haar über ihn fließt wie Fäden seines geraubtes Bluts.
Wie würde ein Mann, der Frauen als lüsterne, kastrierende Wesen – als Furien und Mörderinnen – malte, sich fühlen, wenn er von einem dieser gefürchteten Wesen, denen er misstraute, Besitz ergreifen sollte? Natalie hatte nicht die geringste Ahnung. Sie würde sich auf ihr psychologisches Gespür verlassen müssen, das sie im Lauf der Jahre, in denen sie für die NAGJK Mordopfer herbeirief, entwickelt hatte, wenn sie Edvard Munch ruhig und beherrscht und konzentriert haben wollte. Im Gegensatz zu Hector besaß Natalie keine Seelenleine, die die Seele des Malers aus ihrem Körper vertreiben konnte, wenn etwas schieflief.
»Hi, Kiddo«, rief Wade Lindstrom in dem Augenblick, in dem sie durch die Verbindungstür zur Garage die Wohnung betrat. »Hast du sie gekriegt?«
Natalie verzog das Gesicht. Sie hatte im Augenblick wirklich keine Lust, mit irgendjemandem über das Munch-Projekt zu sprechen, doch ihr Dad wollte immer alle Einzelheiten ihrer sämtlichen Jobs als Violette wissen, als sei das eine Familienangelegenheit. »Ja. Hector war zwar nicht glücklich darüber, aber er hat mir das Kontaktobjekt trotzdem gegeben.«
»Super! Komm mal kurz her – ich möchte dir was zeigen.«
Sie machte einen Umweg durch die Küche, wo Wade vor einem Stapel aufgeschlagener Wörterbücher und einem CD-Player am Frühstückstisch saß. Obwohl er gezwungen gewesen war, in den Ruhestand zu gehen, kleidete er sich nach wie vor, als würde er noch immer durch das Land reisen und Klimaanlagen verkaufen. Ohne die Pfunde, die er seit seiner Bypass-Operation verloren hatte, hingen das Sportsakko und seine weite, sorgfältig gebügelte Hose wie eine nicht richtig gespannte Zeltleinwand an den Zeltstangen seiner Gestalt, aber er weigerte sich hartnäckig, auf ihre wiederholten Angebote einzugehen, ihm neue Klamotten zu kaufen. Nach seiner schweren Operation hatte ihm Natalie angeboten, bei ihr und Callie einzuziehen, weil er nicht mehr in seinem alten Zuhause in New Hampshire leben wollte und konnte, in dem der Serienkiller Vincent Thresher Wades zweite Frau, Sheila Lindstrom, auf bestialische Weise umgebracht hatte.
Ein Hautlappen faltete sich über dem offenen Kragen von Wades weißem Hemd, als er den Kopf über eines der Bücher beugte. Er hob eine Hand, als Natalie näherkam. »Lass mir ‘ne Sekunde Zeit ...«
Aus Gewohnheit warf Natalie einen Blick auf seine in Tagesrationen unterteilte Pillenschachtel und sah, dass die Schale für DI noch nicht geöffnet war. »Dad, du hast deine Tabletten nicht genommen.«
Er tat ihre Mahnung mit einem Wedeln der Hand ab. »Ich weiß, mein Schatz – gleich. Hör dir das zuerst mal an.« Er erhob sich von seinem Stuhl, zog das Revers seines Sakkos straff und räusperte sich. »Hei. Mitt navn er Wade Lindstrom.« Er grinste und verneigte sich. »Det er en fornøyelse mote De.«
Natalies Mund klappte auf, noch bevor sie wusste, was sie sagen sollte. »Was war das?«
»Es ist Norwegisch! ›Hallo. Mein Name ist Wade Lindstrom. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen.‹« Er breitete die Arme aus, als würde er tosenden Applaus entgegennehmen.
Obwohl sie bereits ahnte, was in seinem Kopf vor sich ging, hoffte Natalie, dass sie sich täuschte. »Ah ... Hast du vor, eine Reise nach Skandinavien zu machen?«
»Nein, du Dummkopf. Ich will dir mit Munch helfen.«
Ihr erstarrtes Lächeln zerfiel. »Mir helfen?«
»Klar. Etwa so: Herr Munch, hva vil De liker male ... o verdammt ...« Er machte kurz die Augen zu und spähte dann unter gesenkten Lidern auf eines der Wörterbücher auf dem Küchentisch hinab. »Ah, richtig. Herr Munch, hva vil De liker male i dag?«
»Und das heißt?«
»‘Herr Munch, was möchten Sie heute malen?‘« Wade strahlte wie ein kleiner Junge, der soeben das Radfahren gelernt hatte. »Ich dachte, du könntest das Herbeirufen übernehmen und ich das Reden.«
Natalie rieb sich die Stirn und überlegte fieberhaft, wie sie ihn von dieser Idee abbringen konnte, ohne ihn zu verletzen. »Hm ... Das ist wirklich süß von dir, Dad, aber ich hatte eigentlich vor, französisch mit Munch zu reden.«
Das Strahlen auf Wades Gesicht erlosch. »Er spricht französisch?«
»Ja. Er hat, als er jung war, einige Jahre in Paris gelebt, und weil ich für Monet und van Gogh mein Französisch aufpoliert habe ...« Sie beendete den Gedanken mit einem Achselzucken.
Ihr Vater warf einen niedergeschlagenen Blick auf die Bücher und Sprach-CDs, die er vor sich aufgetürmt hatte. »Aber würde es dir nicht helfen, jemanden bei dir zu haben, während du ... du weißt schon ... beschäftigt bist?«
Der enthusiastische Eifer auf seinem Gesicht schnürte Natalie die Kehle zu, und einen Moment lang brachte sie kein Wort hervor. Seit ihre Mutter Nora wegen ihrer Arbeit als Medium für die Gesellschaft dem Wahnsinn verfallen war, hatte Wade Lindstrom nichts mehr mit Violetten zu tun haben wollen. Er hatte Natalie während der Jahre ihrer Ausbildung an der Akademie für Medien fast nie besucht und sich von Nora scheiden lassen, um mit Sheila, einer Frau von geradezu exemplarischer Normalität, ein neues Leben zu beginnen. Für ihn war der Vorschlag, Natalie bei ihrer Arbeit zu helfen, so etwas wie ein Beweis, wie weit er bei der Bewältigung seiner früheren Ängste bereits fortgeschritten war – und wie sehr er sie und Callie liebte.
Trotzdem, der Gedanke, dass Wade zusah, wie die Seele eines anderen Menschen von ihr Besitz ergriff, war für sie beinahe so, als würde sie ihrem Vater erlauben, sie mit einer Videokamera beim Sex zu filmen. Natalie wollte nicht, dass er sie so sah.
»Ich wünschte, du könntest mir helfen«, sagte sie wahrheitsgemäß. »Aber Tote können sehr reizbar sein und ziemlich unangenehm werden; ich muss sehr behutsam mit ihnen umgehen.«
Wade schüttelte enttäuscht den Kopf, und in seinen blauen Augen sammelten sich Tränen. »Irgendwas muss es doch geben, das ich tun kann. Ich fühle mich wie ein Schmarotzer, der auf deine Kosten lebt.«
»Dad! Du bist kein Schmarotzer.«
»Wie kannst du das sagen? Ich mache mich in deinem Haus breit, esse dein Essen, werfe dich aus deinem warmen Bett ...«
»Es war meine Idee, auf der Couch zu schlafen. Das ist vollkommen in Ordnung für mich, wirklich.« Sie fand, Wade das Schlafzimmer anzubieten, war das Wenigste, das sie für ihn tun konnte, denn schließlich hatte er wegen ihr seine Firma verkaufen müssen. Weil sie nicht mehr bereit gewesen war, für die NAGJK zu arbeiten, hatte die Regierung ihn auf die schwarze Liste gesetzt und er bekam keine Aufträge mehr.
Wie jedes Mal wollte Wade ihre tröstenden Worte nicht hören. »Ich möchte dir helfen, unseren Lebensunterhalt zu verdienen.«
»Glaub mir, Dad, was ich durch dich an Geld für den Kinderhort spare, ist mehr, als Wohnen und Essen für dich kostet.«
Der Anflug eines Lächelns kehrte in sein Gesicht zurück. »Das ist keine Arbeit, und das weißt du auch.«
»Ich weiß. Aber ich weiß auch, dass es für Callie sehr viel bedeutet, dass du hier bist.« Sie durchquerte die Küche und legte ihre Arme um ihn. »Und für mich auch.«
»Danke, mein Schatz.« Er machte Anstalten, sie ebenfalls zu umarmen, doch dann entzog er sich ihr abrupt und sah auf seine Uhr. »O du lieber Himmel! Wo wir von Callie sprechen: Sie muss mit ihrem Termin bei Dr. Steinmetz jetzt ungefähr fertig sein. Ich mach mich besser auf den Weg.«
Natalie versuchte, ihn aufzuhalten, als er aus der Küche eilte. »Langsam, Dad. Ich kann sie holen.«
»Nein, nein – kein Problem. Bis gleich.« Er huschte an ihr vorbei und winkte im Gehen fröhlich zum Abschied.
Natalie griff nach der Pillenschachtel auf der Anrichte und lief ihm nach. »Nimm wenigstens deine Tabletten ...«
Die Haustür fiel ins Schloss.
Natalie seufzte, die Hand mit der Pillenschachtel fiel an ihrer Seite herab. Sie war bereits im Begriff, die Pillen auf die Anrichte zurückzulegen, als die Haustür wieder aufging und Wade den Kopf hereinsteckte.
»Hey, Kiddo! Hier draußen ist ein Typ, der dich sprechen will.« Er wölbte die Hand um den Mund und flüsterte: »Sieht wie ein neuer Klient aus.«
Wade zwinkerte ihr zu und streckte einen Daumen in die Höhe, dann war er schon wieder weg.
»Warte! Deine Tabletten!« Die Pillenschachtel in der Hand, riss Natalie die Tür auf, um ihn noch zu erwischen, fand sich jedoch unvermittelt einem großgewachsenen Mann mit graumeliertem Haar gegenüber, der auf der Haustreppe stand.
Er verharrte wie er war, sein dicker Zeigefinger zwei Zentimeter über der Türklingel schwebend, dann lachte er auf und streckte ihr die Hand entgegen. »Musste nicht mal klingeln! Ms. Lindstrom, nehme ich an?«
Er trug einen schwarzen Zweireiher und war gut einen Kopf größer als sie. Sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um über seine breiten Schultern hinweg Wade sehen zu können, der den Gartenweg hinab zu seinem Camry spazierte. Dem Mann auf der Haustreppe entging ihr Blick nicht, und er deutete mit dem Daumen auf ihren Vater. »Ihr Mitarbeiter sagte, Sie seien zu sprechen. Hab ich die falsche Zeit erwischt?«
Als ihr Dad in seinen Wagen stieg, gab es Natalie auf, ihm wegen seiner Medikamente ins Gewissen zu reden. Wenn er nach Hause kam, würde sie ihm die Tabletten mit Gewalt einflößen. Sie wandte sich dem Fremden vor ihrer Haustür zu. »Entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun, Mr. ...?«
»Amis. Carleton Amis. Mir ist zu Ohren gekommen, Sie wurden beauftragt, mit Edvard Munch zu arbeiten.«
»Ich habe den Auftrag erhalten, ein Bild im Stil von Edvard Munch zu malen«, korrigierte sie ihn. Da sie nicht mehr als Mitglied der NAGJK registriert war, durfte Natalie auch nicht mehr behaupten, ihre Bilder seien die Werke verstorbener Maler. Deshalb bekam sie für ihre Gemälde nur ein paar tausend Dollar, während die von den Malern der Gesellschaft, wie zum Beispiel Hector, angefertigten Werke bei Auktionen mehrere Millionen einbrachten.
Amis hob eine Hand, wie um sie davon abzuhalten, ein Statement von sich zu geben, das er bereits gehört hatte. »Sie brauchen mir gegenüber kein Blatt vor den Mund zu nehmen, Ms. Lindstrom. Die Sammler, die Ihre Arbeiten kaufen, wissen, dass sie ein Produkt bekommen, das echt ist. Und ich bin bereit, eine Menge mehr für das zu zahlen, was bisher für wenig Geld zu haben war.«
Sie musterte Amis von seinem eleganten Haarschnitt bis hinab zu seinen italienischen Lederschuhen, um zu entscheiden, ob er ein Kunde war oder ein Spitzel des Sicherheitsdienstes der Gesellschaft, den sie geschickt hatten, um ihr eine Falle zu stellen. »Oh? Sie wollen ein Original von Munch?«
»Nicht wirklich. Meine Wünsche sind viel spezieller als das.« Er lächelte. »Ich möchte, dass Sie Mr. Munch überreden, eine exakte Replik des Schreis zu malen.«
Kapitel 3Der verrückte Norweger
O Gott, nicht schon wieder einer!, dachte Natalie. Ich wette, er will auch ‘ne Mona Lisa. Dennoch bemühte sie sich, etwas professionelle Höflichkeit aufzubringen. Es zahlte sich immer aus, zu reichen Leuten – zu denen Carleton Amis zu zählen schien – höflich zu sein, egal wie beschränkt sie auch sein mochten.
»Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich würde Ihnen ja gerne helfen, aber ich bin im Augenblick völlig ausgebucht.« Das stimmte zwar nicht, doch sie hoffte, Amis würde ihr die Ausrede abkaufen und ihr die Mühe ersparen, die wahren Gründe erklären zu müssen, warum sie den Auftrag ablehnte.
Doch so viel Glück hatte sie nicht. Amis rührte sich nicht von der Stelle.
»Ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr beschäftigt sein müssen, aber ich versichere Ihnen, es wird sich für Sie lohnen.« Er deutete in Richtung der offenstehenden Wohnungstür. »Darf ich reinkommen und Ihnen das Projekt näher erläutern?«
Natalie trat aufs andere Bein, um ihm den Blick ins Wohnzimmer zu versperren, wo sie ihr Bett auf der Couch an diesem Morgen nicht gemacht hatte. »Ich fürchte, es ist im Augenblick ein bisschen unordentlich bei mir. Ich bin eben erst nach Hause gekommen ...«
Amis lachte. »Ich verstehe. Ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Ich wollte nur eine Gelegenheit haben, Ihnen die Größenordnung meines Angebots zu veranschaulichen.« Er zog ein Stück Papier aus der Innentasche seines Blazers und faltete es auf. »Wie Sie hier sehen, ist Der Schrei nur eines von vielen Gemälden, die Sie für uns anfertigen sollen.«
Auf dem Blatt Papier, das er ihr reichte, waren die Titel und Maler von mehr als einem Dutzend Meisterwerke in Maschinenschrift aufgelistet. Das Konzert von Vermeer, Sturm auf dem See Genezareth von Rembrandt, die Madonna mit der Spindel von da Vinci, Chez Tortoni von Manet ...
Natalie zog die Stirn in Falten und gab ihm das Papier zurück. »Das sind sämtliche Maven-Bilder.«
Sein Lächeln wurde breiter. »Genau. Ich bin Produzent bei Persephone Productions, und wir wollen einen Film über Kunstdiebstahl und das rätselhafte Wiederauftauchen von Gemälden machen.«
»Aaah! Ich verstehe.« Natalie konnte sich lebhaft vorstellen, wie Hollywood die jüngste Sensation in der Kunstwelt auszubeuten gedachte. Vor einem Monat waren die über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren gestohlenen Gemälde völlig überraschend wieder in den Museen aufgetaucht, aus denen sie geraubt wurden. Die weltweit ermittelnde Polizei hatte noch immer keine Hinweise auf die Identität des Diebs, der sich ironischerweise »Arthur Maven« nannte, oder auf seine Motive, die ihn bewogen hatten, die unersetzlichen Bilder zurückzugeben, ohne ein Lösegeld oder eine Belohnung zu fordern.
»Wir waren sehr beeindruckt von der Arbeit, die Sie für das Remake von Thomas Crown ist nicht zu fassen geleistet haben«, sagte Amis und bezog sich auf ein paar impressionistische Bilder, die Natalie als Drehortdekoration für die Museumsszenen des Films gemalt hatte. »Wir wären bereit, Ihnen eine sehr großzügig bemessene Summe für eine solche Authentizität zu zahlen.«
Natalie schüttelte den Kopf. »Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich fürchte ...«
»Eine halbe Million.«
Die Summe verschlug ihr die Sprache; sie blinzelte erschreckt wie von entgegenkommenden Scheinwerfern geblendet. Natalie hatte sich in letzter Zeit auf dem Underground-Kunstmarkt betätigt, um von der NAGJK unabhängig zu bleiben und um nicht mehr auf die illegalen und oft gefährlichen Jobs als freiberufliches Medium angewiesen zu sein, mit denen sie ihren Lebensunterhalt bestritten hatte. Obwohl sie froh war, von ihren Fähigkeiten und ihrem Talent als Malerin leben zu können, waren diese Geschäfte ein ständiger Stress und nicht sehr lukrativ gewesen. Tausend hier, zweitausend dort. Sie hatte keine Zahl mit mehr als vier Nullen mehr gehört seit ...
Seit dich Nathan Azure, dieser verrückte Engländer, in die gottverlassenen Anden gelockt hat, erinnerte sie sich. Der Industriemagnat hatte ihr für ihre Hilfe bei einer archäologischen Grabung in Peru vierhunderttausend Dollar versprochen, doch dann hatte er sie bedroht und hungern lassen, um sie zu zwingen, für ihn einen Inka-Schatz zu finden.
»Das ist ein sehr großzügiges Angebot«, sagte Natalie zu Carleton Amis. »Aber ich kann Ihnen leider nicht behilflich sein.«
Die unnachgiebige Härte in Amis‘ Blick strafte die Wärme seines Lächelns Lügen. »Ohne die Gemälde als Requisiten haben wir keinen Film, Ms. Lindstrom.«
»Ich verstehe das, aber ich glaube, Sie wären besser bedient, wenn Sie einen gewöhnlichen Reproduktionsmaler engagieren ...«
»Ganz sicher nicht. Wir haben vor, Nahaufnahmen von all diesen Gemälden zu machen. Wenn sie einer akribischen Prüfung nicht standhalten, geht der ganze Film den Bach runter. Diese Art von Detailgenauigkeit erfordert den Pinselstrich, den nur die Maler beherrschen, von denen die Originale stammen.«