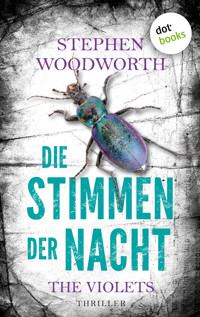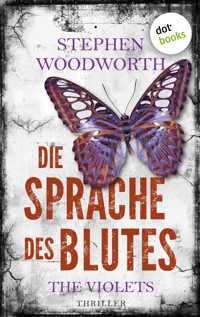
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Violet Eyes
- Sprache: Deutsch
Wenn die Toten deine Begleiter sind: Der Mystery-Thriller »Die Sprache des Blutes« von Stephen Woodworth als eBook bei dotbooks. Sie will nicht davonlaufen müssen – doch ihre besondere Gabe bringt sie immer wieder in Gefahr … Weil sie mit den Seelen der Toten sprechen kann, muss Natalie Lindstrom immer wieder um ihr Leben fürchten. Da die Polizei und die »Nordamerikanische Gesellschaft für Jenseitskommunikation« immer wieder versuchen, sie unter ihre Kontrolle zu bringen, nimmt Natalie ein ungewöhnliches Angebot an: Sie soll ein archäologisches Forschungsprojekt in Peru unterstützen. Zu spät erkennt sie, dass ihr Auftraggeber in Wahrheit düstere Pläne verfolgt – und Natalie für ihn nichts anderes ist als ein Werkzeug, das er nach Belieben einsetzen kann … und zerstören kann! Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Sprache des Blutes« von Stephen Woodworth ist der dritte Band der Urban-Fantasy-Tetralogie »Violet Eyes«. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie will nicht davonlaufen müssen – doch ihre besondere Gabe bringt sie immer wieder in Gefahr … Weil sie mit den Seelen der Toten sprechen kann, muss Natalie Lindstrom immer wieder um ihr Leben fürchten. Da die Polizei und die »Nordamerikanische Gesellschaft für Jenseitskommunikation« immer wieder versuchen, sie unter ihre Kontrolle zu bringen, nimmt Natalie ein ungewöhnliches Angebot an: Sie soll ein archäologisches Forschungsprojekt in Peru unterstützen. Zu spät erkennt sie, dass ihr Auftraggeber in Wahrheit düstere Pläne verfolgt – und Natalie für ihn nichts anderes ist als ein Werkzeug, das er nach Belieben einsetzen kann … und zerstören kann!
Über den Autor:
Stephen Woodworth, geboren 1967 in Kalifornien, veröffentlichte zahlreiche Kurzgeschichten und Novellen, für die er unter anderem für den renommierten Locus-Award nominiert wurde, bevor er mit seinem übernatürlichen Thriller »Das Flüstern der Toten« international bekannt wurde.
Bei dotbooks veröffentlichte Stephen Woodworth die vier Bände seiner Violet-Eyes-Tetralogie: »Das Flüstern der Toten«, »Die Stimmen der Nacht«, »Die Sprache des Blutes« und »Der Schrei der Seelen«.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Die amerikanische Originalausgabe dieses Romans erschien 2005 unter dem Titel »In golden blood« bei Bantam Dell, a division of Random House, Inc., New York.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Stephen Woodworth
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-340-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sprache des Blutes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stephen Woodworth
Die Sprache des Blutes
THE VIOLETS 3 – Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helmut Gerstberger
dotbooks.
Hier lag Duncan,
die Silberhaut mit seinem goldenen Blut verbrämt;
die offenen Wunden wie ein Riss in der Natur,
durch den das Verderben einbricht
Macbeth, 2. Akt, 3. Szene
Ich widme dieses Buch meiner gesamten Familie, ganz besonders meiner geliebten Frau und Partnerin Kelly Dunn und der wundervollen Familie, die wir zusammen gegründet haben.
Kapitel 1Tod in den Anden
Wie jeden Tag stand Nathan Azure im ersten Morgengrauen auf, kleidete sich an und rasierte sich in der muffigen Enge seines Zelts. Als er damit fertig war, betrachtete er mit prüfenden Blicken sein aristokratisch strenges Gesicht in dem kleinen Reisespiegel, um sich zu vergewissern, dass keine einzige Bartstoppel stehen geblieben war und jede Strähne seines blonden Haars am richtigen Platz lag. Dann öffnete er die hölzerne Truhe neben dem Feldbett und wählte unter Dutzenden von Handschuhpaaren, die in der Truhe lagen, ein Paar lederne Autohandschuhe aus. Obwohl es ihm zur Gewohnheit geworden war, Handschuhe zu tragen, zog er sie heute mit der konzentrierten Sorgfalt eines Chirurgen an, der Infektionen vermeiden will.
Seit mehr als zehn Jahren hatte er nicht mehr die Haut eines anderen Menschen berührt oder zugelassen, dass jemand seine berührte.
Auf dem Rand des Feldbetts sitzend, verbrachte Azure eine halbe Stunde damit, Prescotts Geschichte der Eroberung Perus zu überfliegen, wobei er länger bei Passagen verweilte, die er sich schon vor langer Zeit ins Gedächtnis eingeprägt hatte – Abschnitte, welche die Unmengen von Gold beschrieben, die der spanische Entdecker Francisco Pizarro und seine Konquistadoren im sechzehnten Jahrhundert dem Volk der Inka abgepresst hatten, die damit vergeblich die Freilassung ihres Führers Atahualpa hatten erkaufen wollen. Ein wahrlich königliches Lösegeld.
Azures Handschuhe machten das Umblättern der Seiten jedoch schwierig, und bald warf er das Buch auf das Feldbett. Nachdem er die 45 er Automatik unter seinem Kopfkissen hervorgezogen hatte, lud er eine Patrone in die Kammer und schob die Pistole auf seinem Rücken mit dem Lauf nach unten zwischen den Bund seiner Hose und sein Oxford-Hemd. Er schlüpfte in ein cremefarbenes Leinenjackett, um den Griff der Pistole zu verbergen, und trat aus dem Zelt.
Draußen stach die Andenluft, dünn und kalt, in Azures Lungen, als hätte er eine Handvoll Asbest eingeatmet. Die Sonne versteckte sich noch hinter einem Gipfel im Osten und tauchte die Berge in graues Dämmerlicht. Dennoch herrschte bereits hektisches Treiben im Lager. Peruanische Arbeiter hasteten mit Spaten und Sieben durcheinander, auf behelfsmäßig zusammengezimmerten Tischen bürsteten Männer Staub von Steinen und verbogenem Metall. Azure hatte diese Grabung bis ins letzte Detail geplant und inszeniert. Exakt genug, um jeden Experten zu täuschen. Einen Experten, um genau zu sein.
Es war alles nur ein einziger Schwindel. Azure hatte die Artefakte bei verschiedenen Auktionen erstanden und sie dann an diesem Berghang in den Anden vergraben. Die Peruaner, die er engagiert hatte, um als seine Assistenten zu figurieren, waren in Wirklichkeit Söldner – einige von ihnen ehemalige Mitglieder der Terrororganisation Leuchtender Pfad, andere waren Drogenschmuggler in Diensten der Kokainmafia aus dem Huallagatal gewesen. Männer, deren Loyalität Azure kaufen und auf deren Schweigen er sich verlassen konnte. Männer, für die jede Arbeit – ob Tagelöhnerjob oder Mord – dasselbe war, solange sie gut bezahlt wurde. Ganz ähnlich wie die echten Konquistadoren.
Die Vorstellung lief wie geplant, doch das Publikum – der Experte, für den Azure diese ganze Scheinexpedition veranstaltete – fehlte. Wie es schien, hatte Dr. Wilcox, der einzige echte Archäologe am Grabungsort, beschlossen, heute etwas länger zu schlafen.
Je näher Azure seiner Beute kam, umso ungeduldiger machte ihn jede Verzögerung. Entschlossen, die Dramaturgie des heutigen Tages ohne Umschweife ihrem Höhepunkt entgegenzutreiben, stapfte er den steilen Pfad hinab, den seine Arbeiter in das dornige Gestrüpp geschlagen hatten, das den Berghang bedeckte. Überall, wo der Hang ein paar Schritte annähernd ebenes Terrain bot, klammerten sich Zelte an die steile, staubtrockene Bergflanke, während Azures Unterkunft auf dem Kamm des Hügels stand. Das Ganze sah aus wie ein provisorisches Terrassendorf aus Zeltplanen und Plastik. Am Fuß des Abhangs stand ein Zelt mittlerer Größe dicht am Rand einer jäh abstürzenden Klippe, über die die Bergflanke senkrecht in das Tal darunter abfiel. Wolken verdeckten den Talgrund tief unten, verbargen tröstlich den gähnenden Abgrund.
Ein bärtiger Mann in den Dreißigern in einem zerknitterten weißen Hemd und Drillichhosen saß in einem Regisseur-Stuhl vor diesem letzten Zelt, den Kopf über ein Buch gebeugt, die Beine übereinandergeschlagen, als säße er in einem Straßencafé in Paris. Er musste Azures Kommen gespürt haben, denn er schlug das Buch zu und sprang auf die Beine, noch bevor der Engländer am Eingang des Zelts auftauchte. Auch er war ein Gringo wie sein Boss, doch davon abgesehen, gab es zwischen ihm und Azure nicht viele Ähnlichkeiten: sein Haar und der Teint seiner Haut waren dunkel, nicht blond und hell, sein Gesicht eher breit als schmal, und die Art, wie er sich gab, war überschwänglich, nicht kalkuliert.
»Sieht so aus, als wäre ich heute vor Ihnen aus den Federn gekommen.« Mit einem Lächeln drehte er das Buch in seiner Hand so, dass Azure den Titel sehen konnte. Er lächelte viel und oft – ein Affe, der ein Alpha-Männchen beschwichtigt. »Hab meine Rolle studiert. Sehen Sie?«
Eroberer und Eroberte: Pizarro und Peru lautete der Titel des Buchs. Darunter, von einem Maler kunstvoll gestaltet, ein aus zwei Hälften zusammengesetztes Gesicht – die eine Hälfte Pizarro, die andere Atahualpa, der Inkaherrscher, den er besiegt und hingerichtet hatte. Unter dem doppelgesichtigen Porträt stand der Name des Verfassers: Dr. Abel Wilcox.
Nathan Azure lächelte nicht. Er lächelte nie. »Dafür ist im Flugzeug noch Zeit genug, Trent«, bemerkte er mit seinem knappen, abgehackt klingenden Cambridge-Akzent. »Haben Sie den Brustharnisch?«
Mit einem aufgesetzt weltmännisch wirkenden Schnippen der Finger rief Trent einen der Arbeiter zu sich, der mit einem lehmverkrusteten, von Rost bedeckten Brustpanzer in den Händen herbeieilte. Die Männer hatten eine erstaunliche Arbeit geleistet, und der Harnisch sah jetzt ganz so aus, als sei er jahrhundertelang den Elementen ausgesetzt gewesen. Der Brustpanzer war museumsfertig auf Hochglanz poliert gewesen, als Azure ihn in Lima von einem »Antiquitätenhändler« gekauft hatte – eine beschönigende Bezeichnung für einen Hehler, der seine Waren von Grabräubern und Artefaktdieben erhielt.
Azure registrierte, dass in der Mitte des Brustharnischs, wo der festgebackene Schmutz abgeschabt worden war, die schnörkelige Gravur eines Familienwappens zu erkennen war. Der Umstand, dass er keine Kritik äußerte, verriet, dass er zufrieden war. »Was ist mit Wilcox?«
Trent streifte das Zelt hinter ihm mit einem Blick und zuckte mit den Achseln. »Schläft noch.«
»Wecken Sie ihn.«
Trent lächelte erneut und fischte aus der Gesäßtasche seiner Hose sein eigenes Paar Lederhandschuhe. Er zog sie an und duckte sich unter der schwarzen Plastikplane hindurch, die als Zelttür diente. Ein schläfriges Brummen war von drinnen zu hören, gefolgt von schlurfenden Schritten und Geräuschen hastiger Aktivität.
Ein paar Minuten später tauchte Trent mit einem Mann aus dem Zelt auf, der ohne Weiteres sein Bruder hätte sein können. Der Mann war etwa zwei Fingerbreit größer als Trent, besaß aber nicht dessen muskulösen Körperbau, doch davon abgesehen hatten sie die gleichen mandelförmigen Augen, die gleiche hohe Stirn und den gleichen dunklen, spitz zulaufenden Haaransatz in der Stirnmitte. Trent hatte sich den schwarzen Vollbart wachsen lassen, um die Ähnlichkeit zu kaschieren, doch sie war alles andere als ein Zufall. Azure hatte Trent wegen seiner schauspielerischen Fähigkeiten und wegen seines Aussehens ausgewählt und hatte sogar auf bestimmten … Korrekturen der Physiognomie des Schwindlers bestanden. Trent hatte eine außergewöhnliche Hingabe an seine Kunst an den Tag gelegt und sich in den Monaten, die es dauerte, bis sein Gesicht von den Eingriffen des plastischen Chirurgen geheilt war, verbissen in seine Rolle vertieft. Selbst jetzt beobachtete er den Professor mit begieriger Aufmerksamkeit und nutzte seine letzte Gelegenheit, sein Sujet zu studieren.
»Guten Morgen, Dr. Wilcox«, begrüßte Azure den Mann an Trents Seite. »Ich nehme an, Sie haben gut geschlafen.«
»Bis gerade eben schon.« Der dunkle Schatten eines Zweitagebarts bedeckte das Gesicht des Archäologen, der Schlitz seiner Jeans war nur halb zugeknöpft und seine offenen Schuhbänder schleiften im Staub. Er setzte seine ovale Brille auf und bedachte Azure mit einem mürrischen Blick. »Ich hoffe, Sie haben einen triftigen Grund, so früh aufzustehen.«
»Vielleicht.« Azure dachte an die lange Reihe wertloser Dolche, Schwerter, Münzen und anderer »Ausgrabungsfunde«, die er Wilcox während der letzten Monate wie eine Spur aus Brotkrümeln vorgeworfen und mit denen er ihn nach und nach zu diesem entlegenen Berg in den Anden gelockt hatte. »Wir haben soeben dieses Teil hier gefunden, und es sieht vielversprechend – sehr vielversprechend aus. Ich konnte es natürlich nicht abwarten, Ihre fachliche Meinung zu hören.«
Er deutete mit einer behandschuhten Hand auf den Brustpanzer, den der reglos dastehende Arbeiter noch immer in Händen hielt. Wilcox schniefte skeptisch und ließ den Blick über den Brustharnisch wandern, als überfliege er die Schlagzeilen der Morgenzeitung. Als er sich näher beugte und das eingravierte Wappen sah, flackerte unterdrückte Erregung über sein Gesicht – wie bei einem Goldsucher, der Angst hat, die Goldader, die er gerade entdeckt hat, könnte nur Narrengold sein. Sein Blick huschte zu Azure. »Wo haben Sie das gefunden?«
Azures Miene blieb so unbewegt wie aus Stein gehauen. Er war hier derjenige, der Fragen stellte, nicht beantwortete. »Ist er echt?«
Wilcox schob seine Brille auf seiner Nase höher, beugte sich vor und betrachtete das Wappen auf dem Brustpanzer mit zusammengekniffenen Augen.
»Und? Ist es seiner?« Das Schweigen des Archäologen zerrte an Azures Nerven. Er wusste mindestens so viel über peruanische Geschichte wie dieser schmalbrüstige Schreiberling aus dem Elfenbeinturm der archäologischen Wissenschaften, und dennoch … Hatte er sich bei dem Brustpanzer geirrt? Hatte er eine Million Pfund für eine gut gemachte Fälschung aus dem Fenster geworfen? Hätte er sich wegen der Echtheit des Panzers nicht absolute Sicherheit verschaffen wollen, er hätte sich niemals so lange mit Wilcox abgegeben. Obwohl Nathan Azure dies nie zugeben würde, er brauchte das Wissen des Mannes ebenso sehr wie seinen Namen und seine Identität.
Der Archäologe antwortete nicht direkt auf Azures Fragen. Stattdessen deutete er auf die Gravur in der Mitte des Brustharnischs und murmelte so leise, als würde er mit sich selbst sprechen: »Das Familienwappen … aber mit dem schwarzen Adler und den zwei Säulen des königlichen Wappens. Und hier: eine indianische Stadt und ein Lama. Das Siegel Karls des Fünften, mit dem er die Eroberung von Peru genehmigte.«
»Aber ist es seiner?«, drängte Azure. »Könnte auch einer seiner Männer ihn getragen haben?«
Wilcox schüttelte den Kopf und sagte mit bebender Stimme: »Pizarro hätte keinem anderen erlaubt, ihn zu tragen.«
»Dann können wir den Panzer benutzen, um ihn herbeizurufen?«
»Ja.« Der Archäologe straffte die Schultern. »Haben Sie einen Violetten?«
Auf Azures Gesicht machte sich so etwas wie Gleichmut breit, der Ausdruck in seinem mimischen Repertoire, der Freude am nächsten kam. »Wir haben eine im Sinn, ja.«
»Aber ich dachte, alle amerikanischen Medien stehen unter der Kontrolle der NAGJK«, sagte Wilcox, wobei er das allgemein gebräuchliche Akronym für die Nordamerikanische Gesellschaft für Jenseitskommunikation benutzte.
»Ganz und gar nicht.« Azure ließ vor seinem inneren Auge die Fotos von Natalie Lindstrom Revue passieren, die er gesammelt hatte, die klassischen Konturen ihres Gesichts, das wegen ihres kahl rasierten Schädels wie ein Totenkopf wirkte. Wie alle Violetten rasierte sie ihr Haupthaar, damit die auf ihrer Kopfhaut angebrachten Elektroden die Anwesenheit einer Seele, die von ihrem Gehirn Besitz ergriffen hatte, registrieren konnten. Wie alle Medien, die Kontakt mit den Toten aufnehmen konnten, hatte sie violette Augen, müde und doch intensiv und strahlend.
Sie war die einzige Violette, die er hatte finden können, die nicht in den Diensten der einen oder anderen Regierung stand, und Nathan Azure war sehr darum bemüht, nicht die Aufmerksamkeit irgendeiner Regierung oder Behörde zu erwecken. Sogar Natalie Lindstrom wurde, wie er wusste, von der NAGJK überwacht, doch die Nordamerikanische Gesellschaft für Jenseitskommunikation würde nach ihrem Verschwinden eine ganze Weile brauchen, um herauszufinden, wohin sie verschwunden war – lange genug für das, was Azure vorhatte. Um jede Zeitverschwendung zu vermeiden, hatte er sich entschlossen, sie nicht nach Peru zu bringen, solange er kein echtes Kontaktobjekt besaß, mit dem sie Pizarro herbeirufen konnte. Nun, da er eines hatte, wusste er, dass sie bereit sein würde, ihm zu helfen. Vor allem, nachdem der gute Dr. Wilcox geholfen hatte, sie in diese peruanische Bergwildnis zu locken. Nur zu schade, dass der Archäologe die Violette nie kennen lernen würde. Zumindest nicht, bis Azure mit ihr fertig war.
»Wenn Sie mit Pizarros Gold Recht haben, könnte das der bedeutendste Fund seit König Tut sein.« In Wilcox’ Stimme schwang ein Beben, das nur einer Spielart der Lust entstammen konnte. Er schien die beiden peruanischen Arbeiter nicht zu bemerken, die hinter ihm standen, die behandschuhten Hände zu Fäusten geballt. »Alle werden ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen. Der Zoll, die peruanische Regierung – alle.«
»Das sehe ich auch so. Deshalb dürfen sie nichts davon erfahren.« Mit einer ruckenden Bewegung seiner Augen gab Azure den beiden Männern das Signal, den Archäologen bei den Armen zu packen.
Wilcox wand sich in ihrem Griff, mehr vor Verblüffung als vor Angst. Dann lachte er auf.
»Das kann nicht Ihr Ernst sein.« Als Azure sein Lachen nicht erwiderte, erstarb das Grinsen auf Wilcox’ Gesicht. »Es wird auffallen, wenn ich nicht zurückkomme. Und wenn ich sterbe, bringen sie mich zurück. Ich sage ihnen alles über Sie.«
Azure stieß verächtlich die Luft durch die Nase, um anzudeuten, wie kalt ihn das ließ. »Sie sind schief gewickelt, Doktor, wenn Sie glauben, dass mich das in irgendeiner Weise bekümmert.«
Er zog die 45 er hinter seinem Rücken hervor und leerte das Magazin in Wilcox’ Brust.
Die Wucht der Kugeln warf den Archäologen nach hinten, doch die Männer, die seine Arme umklammerten, hielten ihn aufrecht. Wilcox hob mühsam den Kopf, gurgelnd und keuchend, als kämpfte er darum, eine letzte Verwünschung hervorzustoßen.
»Madre Maria«, murmelte einer der beiden abergläubischen Peruaner.
Einen Augenblick bevor sie ihn fallen ließen, spuckte Wilcox Nathan Azure ins Gesicht.
»Bastard!« Azure machte einen Satz zurück, ließ die Pistole fallen und wischte angewidert mit der Hand über den klebrigen Speichel auf seiner Wange. Ein rötlicher Schleimfilm zog sich zäh über die Handfläche seines Autohandschuhs und er riss ihn sich, vor Ekel würgend, von der Hand und warf ihn in den Staub zu seinen Füßen. Er hatte peinlichst darauf geachtet, jeden Körperkontakt mit Wilcox zu vermeiden, doch nun würde die Seele des Mannes so hartnäckig wie eine Flechte an ihm kleben. Er würde verhindern müssen, dass diese mit den Toten redende Lindstrom ihn berührte, oder Wilcox’ Geist könnte alles verderben.
Als die beiden Peruaner den blutüberströmten Leichnam zu Boden sinken ließen, eilte Trent mit ein paar schnellen Schritten an Azures Seite und legte die behandschuhte Rechte auf seine Schulter. »Alles in Ordnung mit Ihnen, Boss?«
Azure schlug seine Hand beiseite. »Fassen Sie mich nicht an!« Er deutete auf den toten Archäologen. »Suchen Sie seinen Pass. Und dann lassen Sie alles verschwinden, was er sonst noch angefasst hat oder womit er irgendwie in Kontakt gekommen ist. Wenn es dunkel wird, brechen wir das Lager ab.«
Trent versuchte ein Grinsen, das jedoch sein Unbehagen nicht verbergen konnte. Azure schwankte davon, zwanghaft immer wieder über seine besudelte Wange wischend.
Wie befohlen, trugen Trent und die anderen Männer die Dinge zusammen, die Abel Wilcox berührt hatte – sein Zelt, seinen Schlafsack, seine Bücher und Notizen, sein Kochgeschirr –, und warfen alles über den Rand der Klippe in die Tiefe. Als Letztes warfen sie die Leiche in den Abgrund. Bevor sie in der tief hängenden Wolkendecke über dem Tal verschwand, spreizten sich Arme und Beine des Toten wie die Schwingen eines großen Vogels, als wollte der Archäologe davonfliegen.
Sie hörten nicht einmal, wie der Körper im Tal aufschlug.
Kapitel 2Wölfe an der Tür
Natalie Lindstrom kannte den Mann vom Sicherheitsdienst der Gesellschaft nicht, der ihr an diesem Nachmittag im Mai ins Kino folgte: Ein Mann, nicht viel größer als sie, von südostasiatischer Herkunft, mit glatt nach hinten gekämmtem schwarzem Haar und schmalen Koteletten. Sein grauer Anzug schien wie die Haut eines Chamäleons mit jedem Hintergrund zu verschmelzen, an dem er vorüberging.
Sie seufzte und tat so, als würde sie ihn nicht bemerken, während sie ihre Kinokarte kaufte. Sie zahlte mit einer der wenigen Kreditkarten, die sie noch nicht bis zum Limit erschöpft hatte. Bei der NAGJK herrscht zur Zeit anscheinend ein reger Wechsel, dachte sie. Außerdem hatten sie ihre Leute offenbar angewiesen, nicht auf zu vertrautem Fuß mit den Violetten zu verkehren, die sie einschüchtern und mit denen sie sich auf keinen Fall anfreunden sollten, denn die neuen Agenten des Sicherheitsdiensts wechselten nie auch nur ein Wort mit ihr. Sie wurde richtiggehend nostalgisch, wenn sie an die Zeit dachte, als sie wenigstens noch die Namen der Agenten kannte, die auf sie angesetzt waren: George Langtree, Arabella Madison und Horace Rendell. George hatte während seiner Schicht der Rund-um-die-Uhr-Beschattung Natalies oft mit ihr eine Pizza geteilt und mit ihr über das Buch, an dem er schrieb, oder den neuesten Klatsch in der NAGJK geplaudert. Er hatte sogar geholfen, ihre Tochter Callie aus den Händen des Serienmörders Vincent Thresher zu befreien. George hatte inzwischen beim Sicherheitsdienst der Gesellschaft gekündigt, und Rendell war von Thresher getötet worden, als der Mörder Callie entführt hatte. Es blieb nur noch Arabella Madison, die gehässige Modediva, als einzige Agentin des Sicherheitsdiensts, die Natalie persönlich kannte.
Doch von diesen namenlosen Anfängern beschattet zu werden, hatte auch einen Vorteil: Sie kannten ihre Tricks nicht so gut wie die altgedienten Agenten und waren deshalb leichter abzuschütteln, wenn es nötig war.
Der Chamäleonmann war keine Ausnahme. Natalie wartete, bis im Kino die Lichter ausgingen, und erst dann – während einer Szene, bei der die Leinwand dunkel wurde – setzte sie sich auf ihren Platz. Sie wollte es dem Agenten möglichst schwer machen, zu sehen, wo sie saß. Der Film war ein über drei Stunden langes Epos von der Machart, die sich in Hollywood anscheinend immer größerer Beliebtheit erfreute, und etwa zwanzig Minuten nachdem der Hauptfilm begonnen hatte, stand sie auf, um zur Toilette zu gehen, den Leinenbeutel, in den sie ihren Hosenanzug und eine zweite Perücke gepackt hatte, über die Schulter geschlungen.
Zufrieden stellte Natalie fest, dass ihr der Agent nicht in die Vorhalle gefolgt war, schlüpfte in eine der Kabinen im Waschraum und zog den Hosenanzug an. Da sie kein eigenes Haar hatte, fiel es ihr nicht schwer, ihre blonde Perücke gegen die kastanienbraune zu tauschen. Weil ihre Klienten verlangten, auf dem Seelenscanner den Ausschlag von Natalies Hirnstromwellen beobachten zu können, als Beweis dafür, dass ihre Inbesitznahme durch die herbeigerufene Seele echt war, achtete sie darauf, dass ihr Schädel stets kahl rasiert war.
Dies ermöglichte ihren Klienten, die Elektroden des Geräts direkt auf ihrer Kopfhaut zu befestigen und auf dem Monitor des Seelenscanners die Präsenz der herbeigerufenen Seele ablesen zu können. Da Natalie nicht wollte, dass Callie sich schämte, eine Violette zu sein, verbarg sie im normalen Alltagsleben ihre violetten Iriden nicht mehr. Doch heute musste sie inkognito sein, deshalb vervollständigte sie ihre Verkleidung mit Kontaktlinsen, die ihren Augen eine unauffällige braune Farbe verliehen.
Wie vereinbart, erwartete sie auf dem Parkplatz des Kinos bereits der Wagen von Daedalus Aeronautics, ein schwarzer Cadillac ohne Firmenaufschrift. Im selben Augenblick, in dem Natalie aus dem Kino trat, startete der Chauffeur den Motor.
Fünfzehn Minuten später erreichten sie den Büroturm aus Stahl und verspiegeltem Glas, in dem die renommierte Anwaltskanzlei residierte, die die Interessen der Firma von Natalies Klienten vertrat. Nachdem sie den Wagen in der Tiefgarage geparkt hatten, fuhren sie mit einem Hochgeschwindigkeitsaufzug ins oberste Stockwerk des Gebäudes. Früher wäre Natalie bei einer solchen Fahrt vor Angst, was passieren würde, wenn die Aufzugkabine zwanzig Stockwerke tief abstürzte, mehr tot als lebendig gewesen. Doch heute bereitete ihr eine andere Angst Magenkrämpfe.
Ich sollte das nicht tun, dachte sie nicht zum ersten Mal. Die Nordamerikanische Gesellschaft für Jenseitskommunikation hatte es Natalie nie verziehen, dass sie den Dienst in ihren Reihen quittiert hatte. Sie können es vergessen, je wieder einen anderen Job zu kriegen, hatte Delbert Sinclair, der Direktor des Sicherheitsdiensts der Gesellschaft, damals zu ihr gesagt. Und er hatte seine Drohung wahr gemacht. Die Gesellschaft hatte sie auf die schwarze Liste gesetzt und es ihr damit unmöglich gemacht, einen ganz normalen Job zu finden. Sie hatte erleben müssen, dass selbst Zeitarbeitsagenturen sie ablehnten, als sie in ihrer Verzweiflung sogar bereit gewesen war, Büroarbeit anzunehmen. Außerdem tat die Gesellschaft alles in ihrer Macht Stehende, um zu verhindern, dass Natalie als in eigener Regie tätige Violette Arbeit auf dem privaten Sektor fand, und wenn die NAGJK herausfand, dass ihr augenblicklicher Job nicht nur nicht genehmigt, sondern auch illegal war, würde sie im Gefängnis enden. Oder, was noch schlimmer wäre, die Gesellschaft könnte Callie in Schutzgewahrsam nehmen, wie sie es nannten, und ihre kleine Tochter zwingen, Mitglied der NAGJK zu werden.
Sich selbst und ihre Tochter von der Gesellschaft fernzuhalten, forderte einen immer höheren Preis. Mit einer privaten Sitzung hier und dort, bei der sie in der Regel die Seele eines verstorbenen Familienmitglieds herbeirief, verdiente sie ein paar hundert Dollar, doch das reichte nicht, um eine alleinstehende Mutter und ihr Kind zu ernähren und ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben. Natalie hatte auf ihre Eigentumswohnung bereits eine zweite Hypothek in Form eines Schuldenkonsolidierungsdarlehens aufgenommen, mit der Folge, dass sie weiterhin mit Kreditkarte bezahlte und ihre Konten mit immer neuen Abbuchungen belastete, um einigermaßen über die Runden zu kommen, wenn sie keine halblegalen Engagements als Violette auftreiben konnte.
Sie sah zu, wie die digitale Stockwerkanzeige des Aufzugs auf die Zwanzig sprang, und reflexartig suchte ihr Gehirn nach jemandem, dem sie die Schuld für ihre augenblickliche Misere geben konnte. Sid Preston, dieser schleimige Reporter von der New York Post, hatte ihr eine sechsstellige Summe für ein posthumes Interview mit den Opfern des Hyland-Mordfalls versprochen. Wenn er zahlen würde, müsste sie ihre Fähigkeiten nicht an Klienten wie die Daedalus Aeronautics verkaufen. Leider war der Journalist mit den schlagzeilenträchtigen Enthüllungen, die sie ihm geliefert hatte, nicht zufrieden gewesen. Als sie es ablehnte, mit ihm zusammen ein Enthüllungsbuch über die Gesellschaft zu schreiben, weigerte er sich, ihr das versprochene Honorar zu zahlen. Der magere Vorschuss, den er ihr gegeben hatte, war bald verbraucht gewesen, und sie hatte jede Arbeit annehmen müssen, die sie kriegen konnte. Das Angebot von Daedalus brachte so viel Geld in die Familienkasse wie hundert Sitzungen mit kleinen alten Damen, die mit ihren verstorbenen Männern sprechen wollten. Deshalb hatte sie angenommen und betete nur, dass niemand von der NAGJK sie in ihrer Verkleidung erkennen würde.
Daedalus Aeronautics wussten ihre Diskretion zu schätzen. Auch der Flugzeughersteller konnte eine Menge verlieren, falls jemand herausfand, dass Natalie Lindstrom für ihn arbeitete.
Der Chauffeur der Firma brachte Natalie zu einem großen, spärlich erhellten Eckbüro und machte hinter ihr die Tür zu. Durch die getönten Fenster, die zwei Seiten des Büros einnahmen, schimmerte zwanzig Stockwerke unter ihnen matt das sonnenüberflutete Panorama der Stadt. Drei Personen saßen an einem langen Tisch, ihre Silhouetten dunkel vor der hellen Front der Fenster; eine vierte hatte sich soeben erhoben und eilte auf Natalie zu.
»Ms. Lindstrom! Arnold Jarvis, Daedalus Aeronautics. Wir haben am Telefon miteinander gesprochen.« Der Mann hob eine Hand, schreckte dann jedoch vor der Berührung mit ihr zurück und strich sich stattdessen verlegen über sein schütteres Haar. »Hatten Sie irgendwelche… Probleme?«
»Nein.«
»Gut. Sehr gut.« Er stellte die drei Personen am Tisch nicht vor – eine blonde Frau in einer Kostümjacke mit gepolsterten Schultern und zwei Männer in dunklen Anzügen. »Nun, wir wissen, dass Ihre Zeit knapp bemessen ist. Wir sind bereit anzufangen.«
»Das sehe ich.« Natalie ging um Jarvis herum, um den Stuhl, auf den er deutete, genauer in Augenschein zu nehmen. Er stand gegenüber dem langen Tisch und hatte eine gewisse Ähnlichkeit mit den Stühlen, die man in Friseursalons sieht, nur dass dieser Stuhl für die Zwecke von Sweeney Todd, dem mordenden Barbier von London, geeignet gewesen wäre. Breite Ledergurte mit Metallschnallen hingen von der Rückenlehne, den Armlehnen und der Fußstütze, die dazu dienten, das in dem Stuhl sitzende Medium festzuschnallen. Auf einem fahrbaren Tischchen neben dem Stuhl stand ein elektronisches Gerät, ungefähr von der Größe eines Mikrowellenherds, auf dessen grünem Bildschirm sechs flache, leuchtende Nulllinien zu erkennen waren.
Ein SoulScan-Gerät.
Jarvis nahm ein zusammengerolltes Kabel von dem Tischchen, schob den Stecker in die entsprechende Öffnung an der Seite des Seelenscanners und hantierte hektisch, um die zwanzig miteinander verschlungenen Elektroden am anderen Ende des Kabels zu entwirren. »Wenn Sie es sich bitte bequem machen wollen …«
Natalie setzte sich auf den Stuhl und nahm ihre Perücke ab. Doch es war für sie alles andere als bequem, vor allem als deutlich wurde, dass Jarvis noch nie zuvor mit einer Violetten oder einem Seelenscanner zu tun gehabt hatte.
»Ah! Entschuldigen Sie.« Er riss die erste Elektrode, die er an ihrer kahl rasierten Kopfhaut befestigt hatte, wieder ab, um sie genauer auf dem eintätowierten Kontaktpunkt anzubringen.
Sie zuckte zusammen, als er das Heftpflaster von ihrer Haut abzog. »Warten Sie, lassen Sie mich das machen.«
Mit einem dankbaren Aufatmen reichte Jarvis ihr das Elektrodenbündel. Sie kramte einen kleinen Schminkspiegel aus ihrer Handtasche, mit dessen Hilfe sie die Elektroden auf ihrem Kopf befestigte, bis sie schließlich aussah wie eine vor Zünddrähten starrende Bombe kurz vor der Explosion. Die drei schwarzen Silhouetten am Tisch beobachteten das Prozedere ohne Kommentar. Sie blieben auch stumm und reglos, als Jarvis Natalie mit ungeschickten, vor Nervosität flatternden Händen an den Stuhl gurtete.
Als er damit fertig war, wandte sich Jarvis dem SoulScan-Gerät zu und strich mit einem ratlosen Ausdruck im Gesicht erneut sein Haar glatt. Die oberen drei Linien auf dem Monitor des Geräts zeigten jetzt die leichten Zickzackschwankungen von Natalies Hirnstromwellen, während die unteren drei in Abwesenheit des Bewusstseins der herbeigerufenen Seele keinen Ausschlag erkennen ließen. »Aaah… das Handbuch sagt etwas über einen Knopf. Sie wissen schon, für den Notfall.«
Natalie streckte einen Finger ihrer gefesselten linken Hand aus und deutete in Richtung des rot leuchtenden Knopfs auf der Schalterkonsole des Seelenscanners. Er wurde allgemein als Panikknopf bezeichnet, und wenn er gedrückt wurde, konnte er die elektromagnetische Energie der Seele, die von ihr Besitz ergriffen hatte, mit einem starken Elektroschock aus ihrem Gehirn vertreiben.
»Drücken Sie ihn nur, wenn es aussieht, als würde ich die nächste Minute nicht überleben«, instruierte Natalie Jarvis.
Er wurde bleich und nickte dann.
»Haben Sie ein Kontaktobjekt?«
»Wie? Oh… ja ...« Er griff mit Daumen und Zeigefinger in die Brusttasche seines Hemds und zog einen kleinen Plastikbeutel hervor. »Damit haben sie die Leiche identifiziert. Die Experten vom National Travel Savety Board, die den Absturz untersuchten, haben ihn mit genau so einem herbeigerufen.«
Ehe sie protestieren konnte, drehte er ihre rechte Hand nach oben und kippte den Gegenstand auf ihre Handfläche. Er war klein und hart wie ein Kieselstein und glitzerte metallisch gelb wie Gold.
Doch dieses Gold war nichts anderes als eine Zahnfüllung und der Kieselstein der Backenzahn eines Menschen, dessen Wurzeln abgebrochen waren, der Zahnschmelz von Ruß geschwärzt.
Natalie wollte das Ding fallen lassen und schreien, dass sie noch nicht bereit sei und noch nicht einmal mit dem Rezitieren ihres Betrachtermantras begonnen habe, doch es war zu spät. Ihre Faust schloss sich um den Zahn, als hätte sie eine Hochspannungsleitung angefasst, und die unteren drei Linien auf dem Monitor des Seelenscanners schossen zu zackigen Spitzen der Panik empor.
Die Seele klopfte bereits.
Im nächsten Augenblick vergaß Natalie Jarvis, vergaß das Büro mit seinen drei schweigenden Beobachtern und sich selbst. Sie saß jetzt an den Steuerknüppeln eines großen Passagierflugzeugs, in Schweiß gebadet; ihr Atem ging heiß und schnell unter dem Plastiknapf der Sauerstoffmaske, der ihre Nase und ihren Mund bedeckte. Durch den Staub, der gegen die Cockpitscheibe vor ihr prasselte, sah sie, wie sich die Nase des Flugzeugs abwärts senkte, während sich die Wolkenlandschaft draußen nach rechts verschob.
Neben ihr brüllte der Kopilot zwischen langen Atemzügen aus seiner Sauerstoffmaske einen Notruf an die Flugverkehrsüberwachung nach dem anderen in sein Mikro. Aus dem Passagierraum hinter ihnen war das Kreischen von Männern und Frauen und das Schreien eines Babys zu hören.
Mit ihren kräftigen, behaarten Händen zog Natalie den Steuerknüppel zurück, drehte das Steuerhorn nach links und trat dann das linke Seitenruderpedal durch. Die Maschine stieg wieder in waagrechte Position, kam jedoch weiter nach rechts vom Kurs ab.
Das Seitenruder ist ausgefallen, dachte sie. Kann ich sie auf geraden Kurs bringen, wenn ich den Schub der Turbinen im linken Flügel drossle? Augenblick … das hab ich schon mal versucht.
Natalie löste sich lange genug aus der Verzweiflung des toten Piloten, um zu begreifen, was geschah. Der Pilot spielte seine letzten Versuche, die Maschine zu retten, in endlosen Variationen immer wieder aufs Neue durch, eingeschlossen in einem ewig währenden Flugsimulator, in dem er wieder und wieder versuchte, ein Passagierflugzeug zu retten, das bereits abgestürzt war.
Nun, nachdem Natalie ihre Objektivität wiedergewonnen hatte, begann sie, ihr Betrachtermantra zu zitieren:
Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily!
Life is but a dream …
Die ständige Wiederholung des Verses ermöglichte es ihr, während die Seele des Piloten Besitz von ihr ergriff, ihr eigenes Bewusstsein aufrechtzuerhalten und – wenn nötig – die Kontrolle über ihren Körper wiederzuerlangen, falls die Seele sich weigerte zu gehen.
Während sie ihr Betrachtermantra rezitierte, konnte sie die Gedanken und die Wahrnehmungen des Toten teilen. Er machte ihre Augen auf und erblickte Jarvis, dessen Hand über dem Panikknopf des Seelenscanners schwebte. Der ratlose Ausdruck seines Gesichts verriet, dass er nicht wusste, was er tun sollte. »Ms. Lindstrom?«
»Lindstrom? Ich heiße Newcomb.« Der Pilot richtete Natalies Körper in dem Stuhl zu voller Größe auf, und sie stöhnte leise, als ein stechender Schmerz durch ihren Nacken zuckte – ein Muskel, den sie sich bei der unerwarteten Bewegung gezerrt hatte.
Das wird schmerzhaft, dachte sie. Die epileptischen Verkrampfungen, die mit der Inbesitznahme einhergingen, mussten dieses Mal besonders heftig gewesen sein.
»Ah! Captain Newcomb!« Jarvis strahlte. »Wir hoffen, Sie können uns ein paar Fragen beantworten.«
»Vergessen Sie den ›Captain‹. Nennen Sie mich bitte Bill ...« Newcomb blickte auf den weiblichen Körper hinab, in dem er sich befand, auf die Ledergurte, die seine Arme und Beine an den Stuhl fesselten, dann huschte sein Blick zu den drei Gestalten hinüber, die aus dem Halbdunkel jenseits des Tischs zusahen. »Könnt ihr mich, um Christi willen, nicht endlich in Ruhe lassen? Hab ich euch nicht schon alles gesagt, was ich weiß?«
»Genau das wollen wir herausfinden, Bill.« Jarvis war jetzt ganz in seinem Element, angelte mit einer raschen Bewegung ein Klemmbrett mitsamt Stift aus dem unteren Fach des Tischchens und hakte die erste von einer ganzen Reihe von Fragen ab. »Können Sie uns genau beschreiben, wie sich das Unglück ereignete?«
Natalie konnte spüren, wie Newcombs Präsenz in ihr schwächer wurde. Sie hatten ihn von den Toten nur zurückgeholt, um ihn zu zwingen, dasselbe Grauen und Schuldgefühl noch einmal zu erleben, das ihn auch in seinem persönlichen Fegefeuer quälte.
Er sog tief die Luft in Natalies Lungen, als herrschte plötzlich ein Unterdruck in dem Raum, und als er sprach, war ihre Stimme von seiner Trauer ganz rau und heiser. »Wie ich Ihnen schon erzählt habe, hatten wir gerade eine Höhe von elftausend Fuß erreicht, als wir ein lautes, dumpfes Krachen hörten, das die ganze Maschine erschütterte, als hätte uns etwas getroffen.«
Einer der Männer am Tisch nahm ein Blatt Papier in die Hand und beugte sich, mit dem Finger auf das Papier tippend, zu der blonden Frau. »Kollaps des hinteren Passagierraums.«
Sie nickte.
»Als ich versuchte, wieder die Kontrolle über die Maschine zu bekommen«, fuhr Newcomb fort, »klemmten die Ruderpedale und reagierten nicht mehr.«
»Und was haben Sie unternommen, um die Maschine trotzdem sicher zu landen?«, fragte Jarvis und hakte die nächste Frage auf seinem Klemmbrett ab.
»Alles.« Newcomb ließ Natalies Kopf gegen die Kopfstütze des Stuhls sinken. »Wir haben Detroit gerufen, um die Freigabe für den Sinkflug und die Notlandung zu bekommen. Wir hätten es auch fast geschafft. Wenn ich uns nach dem Aufsetzen stärker hätte abbremsen können …« Er brachte es nicht fertig, den Satz zu Ende zu sprechen.
Die blonde Frau zog eines der Papiere zu Rate, die ihr der Mann links von ihr reichte. »Captain Newcomb, erinnern Sie sich an die Besprechung vor dem Flug, die Sie mit dem leitenden Wartungsingenieur hatten, der für die Inspektion Ihrer Maschine verantwortlich war?«
»Vage.« Der Pilot blieb auf Distanz, als sehnte er sich danach, wieder in die große Leere zurückzukehren.
»Und hat der Wartungsingenieur mit Ihnen über ein Problem gesprochen, das einer seiner Techniker vom Bodenpersonal damit hatte, eine der Türen des Frachtraums zu schließen?«
Newcomb setzte sich mit einem Ruck auf. »Eine Tür?«
»Ja.« Die blonde Frau las von dem Papier auf dem Tisch vor ihr. »Die Ermittler sind zu dem Schluss gekommen, dass die Frachttür im Flug weggerissen wurde. Der daraus resultierende rapide Druckverlust führte dazu, dass der hintere Passagierraum kollabierte, wodurch die hydraulischen Leitungen zum Heck der Maschine zerstört wurden, was den Ausfall der Steuerflächen zur Folge hatte.«
Der Pilot schüttelte Natalies Kopf. »Er hat mir gesagt, sie hätten die Frachttür geschlossen.«
»Die Frachttür selbst schon. Aber eine kleine Belüftungsklappe in der Tür blieb einen Spalt offen, auch nachdem der Techniker die Belüftungsklappe mit Gewalt verschlossen hatte.«
Newcomb schüttelte noch heftiger den Kopf, doch Natalie konnte fühlen, wie sich seine Angst wie eine kalte Faust um ihr Herz legte. »Die Warnanzeige für die Frachttür hat nicht aufgeleuchtet. Ich habe sie vor und während des Flugs überprüft.«
»Dennoch, der Wartungsingenieur machte Sie auf ein Problem aufmerksam und Sie ließen zu, dass er mit seiner Unterschrift im Logbuch das Flugzeug zum Flug freigab, um eine Verspätung zu vermeiden. Ist das richtig?«
»Ja.« Natalie hörte die Schreie der Passagiere in Newcombs Erinnerung gellen.
Die blonde Frau faltete die Hände, und ihre Augen blitzten triumphierend auf. »Captain Newcomb, ist Ihnen klar, dass die bewusste Schönung von Sicherheitsinspektionsberichten einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften darstellt?«
Er sackte nach vorn, so weit es die Ledergurte des Stuhls erlaubten. »Warum können Sie mich nicht in Frieden lassen?«
Natalie hatte Mitleid mit ihm. Es war nicht Ihr Fehler, erklärte sie ihm in dem Bewusstsein, das sie teilten. Sie versuchen, Ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben, aber es war deren Flugzeug, das fehlerhaft war.
Doch sie wusste, dass Newcomb so leicht nicht zu trösten sein würde. Dank Daedalus Aeronautics gab er sich nicht nur daran die Schuld, dass er das Flugzeug nicht hatte retten können, sondern nun auch noch daran, das Unglück verursacht zu haben.
»Ich denke, wir haben, was wir brauchen«, sagte die blonde Frau zu Jarvis.
Sein Blick huschte von dem verzweifelten Gesichtsausdruck Newcombs zum Panikknopf des Seelenscanners, als sei er sich unschlüssig, was er tun sollte. Natalie wusste, sie musste die Seele des Piloten fortschicken, ehe Jarvis sie beide wegzappte.
Sie haben Ihr Bestes getan, um diese Leute zu retten, beschwor sie Newcomb in der Hoffnung, dies würde ihn ein wenig trösten. Sie sind für ihren Tod nicht verantwortlich.
Dann wechselte sie von ihrem Betrachtermantra zu ihrem Schutzmantra, dem 23. Psalm, und beförderte Newcombs Seele sanft aus ihrem Bewusstsein:
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln …
Natalie gewann beinahe sofort die Kontrolle zurück; der Pilot schien nur allzu bereit, in die große Leere zurückzusinken und vergessen zu werden. Als sie die Augen aufschlug, lächelte Jarvis sie mit offenkundiger Erleichterung an.
»Ms. Lindstrom? Hervorragende Arbeit! Und nun werde ich Sie aus diesem Stuhl befreien …«
Sie bemerkte kaum, wie er unsanft die Elektroden von ihrer Kopfhaut riss und die Gurte löste. Stattdessen lauschte sie dem Gespräch der drei anonymen Gestalten am Tisch, die sie ignorierten, als sei sie ein Präsentationsbildschirm, der abgeschaltet worden war.
»Glauben Sie wirklich, wir sind damit raus aus der Haftbarkeit?«, fragte der Mann links von der blonden Frau.
»Absolut. Falls die Sache vor Gericht kommt, schieben wir es auf die Wartungscrew und machen es damit zu einem Problem der Fluggesellschaft.«
Der Mann rechts von ihr, der bisher noch kein Wort gesagt hatte, schob die Brille auf seinem Nasenrücken nach oben. »Was ist mit dem Schließmechanismus der Belüftungsklappe? Sollten wir nicht.?«
»Wir geben eine der üblichen Servicemitteilungen heraus«, erwiderte die Frau. »Wenn die Fluggesellschaften das Problem beheben wollen, sollen sie es. Ob so oder so, für den Fall, dass sich ein weiterer Vorfall ereignet, sollten wir juristisch abgesichert sein.«
»Ein Vorfall!« Bezeichneten sie so den Tod von mehr als einhundert Menschen?
Falls sich ein weiterer Absturz aus den gleichen Gründen ereignet, bin ich genauso schuldig wie die drei, dachte Natalie, und einen Augenblick lang fühlte sie die ganze Last von Newcombs Schuld. Doch sie konnte es niemandem anvertrauen, ohne sich damit selbst zu belasten und unter Umständen einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen, und Daedalus Aeronautics wussten dies.
»Wir können Ihnen gar nicht genug für Ihre Unterstützung danken.« Jams half ihr auf die Beine und drückte ihr ein zusammengefaltetes Stück Papier in die Hand. »Für Ihre geleisteten Dienste.«
Sie warf erst einen Blick auf das Papier, als sie wieder auf dem Rücksitz des schwarzen Cadillacs saß und der Fahrer sie zum Kino zurückchauffierte. Ein Bankscheck, der nicht direkt mit Daedalus Aeronautics oder ihrer Anwaltskanzlei in Verbindung gebracht werden konnte. Fünfzehntausend. Nicht schlecht für einen Tag Arbeit. Aber nicht genug, um dafür ihre Seele zu verkaufen.
Natalie nahm ihre Kontaktlinsen heraus, wechselte im Waschraum des Kinos ihre Kleidung und setzte sich für den Rest des Films wieder auf ihren Platz, ohne wirklich zuzusehen. Gleich nach der Vorstellung ließ sie zu, dass der Chamäleon-Mann sie zu ihrer Bank verfolgte, wo sie den Scheck trotz eines unguten Gefühls im Magen einreichte. Wenigstens waren damit die Schecks, die sie bereits ausgestellt hatte, gedeckt.
***
Normalerweise brachte Natalie, wenn sie ein Engagement als Violette hatte, Callie in eine Kindertagesstätte, doch heute war Dienstag – der »Ms.-Tabby-Tag« –, und deshalb fuhr sie von der Bank direkt zu dem Ärztehaus in Orange. Inständig hoffte sie, dass heute – im Gegensatz zu allen Dienstagen des vergangenen Jahres – ein wundersamer Fortschritt erreicht worden war, denn Ms. Tabby entwickelte sich allmählich zu einem Luxus, den sie und Callie sich nicht mehr länger leisten konnten.
Nur, dass die Therapeutin alles andere als ein Luxus war. Natalie fürchtete, ohne psychotherapeutische Hilfe würde Callie möglicherweise so enden wie Nora Lindstrom, Natalies verstorbene Mutter. Eine Violette, die früher für das FBI gearbeitet und die zweite Hälfte ihres Lebens in einer Irrenanstalt verbrachte hatte, geistig und psychisch vollkommen zerrüttet wegen der Heimsuchung durch die Seele Vincent Threshers, an dessen Verhaftung und Hinrichtung sie großen Anteil gehabt hatte. Seither hatte Thresher auch einmal von Callie Besitz ergriffen und sie mit demselben Grauen erfüllt, das ihre Großmutter in den Wahnsinn getrieben hatte.
Natalie parkte ihren altersschwachen Volvo auf dem Parkplatz des Ärztehauses und stieg die Betonstufen in den ersten Stock des Gebäudekomplexes hinauf. Sie ging den Außengang entlang, vorbei an einer Zahnarztpraxis, der Praxis eines Dermatologen und der Kanzlei eines Steueranwalts, und gelangte zu einer Tür mit einem kleinen Schild, auf dem in schlichten weißen Lettern die Worte eingraviert waren:
Carolyn Steinmetz, Dr. phil. Kinderpsychologin
Das Zimmer hinter der Tür war ebenso unaufdringlich wie das Namensschild: An den in neutralen, ruhigen Farben gestrichenen Wänden hingen gerahmte Drucke von flauschigen, anthropomorphen Kätzchen in pastellfarbenen Kleidern. Auf dem Velourssofa des Wartezimmers lagen zwei echte Katzen – eine Perserkatze mit blauen Augen und langem Fell und ein getigerter Kater, der Ms. Tabby ihren Spitznamen eingebracht hatte. Eine dritte, schwarz-weiß gescheckte Katze warf in einer Ecke des Zimmers eine Stoffmaus durch die Luft. Außerdem hatte das Wartezimmer jede Menge Spiele, Spielzeuge und Märchenbücher zu bieten, um die kleinen Patienten der Psychotherapeutin bei Laune zu halten, was heute besonders günstig war, da Natalie Callie fast drei Stunden vor ihrem Termin in der Praxis abgegeben hatte.
Jon, Dr. Steinmetz’ Sprechstundenhelfer, saß an seinem Schreibtisch und trug ein Exemplar aus seiner scheinbar unerschöpflichen Sammlung von Krawatten mit Zeichentrickfiguren. Er begrüßte Natalie mit einem Lächeln, als sie die Praxis betrat. »Callie ist noch bei Frau Doktor, aber sie müssten jeden Augenblick fertig sein.«
Er warf einen Blick zur Tür von Dr. Steinmetz’ Behandlungszimmer, die immer offen stand. Offenbar wollte Ms. Tabby verhindern, dass sie verklagt wurde, und achtete deshalb stets darauf, niemals allein mit ihren minderjährigen Patienten zu sein.
Durch die offene Tür konnte Natalie die Psychologin in der Mitte des Zimmers mit untergeschlagenen Beinen auf dem Boden sitzen sehen, das lange schwarze Haar mit sich überkreuzenden Holzstäbchen hochgesteckt. Sie neigte den Kopf nach rechts, als sie eine leise gemurmelte Frage an Callie richtete, die lustlos mit den Plastiktieren eines Arche-Noah-Sets spielte. Ohne aufzuschauen, murmelte sie eine Antwort, die Dr. Steinmetz mit einem Nicken quittierte. Dann bemerkte die Psychologin, dass Natalie zusah, und sie nahm Callie bei der Hand und führte sie aus dem Sitzungszimmer, damit sie ihre Mutter begrüßte.
Natalie zwang ein strahlendes Lächeln auf ihr Gesicht und ließ sich auf die Knie sinken, um eine flüchtige Umarmung ihrer Tochter zu erhaschen. »Hallo, mein kleines Mädchen! Hattest du heute Spaß bei Ms. Tabby?«
»Nein.« Callie bohrte ihre Hände noch tiefer in die Taschen ihrer Jeans, ihre violetten Augen auf die Tür gerichtet, die nach draußen ging. Sie war erst sieben, aber sie hatte sich bereits die Widerborstigkeit eines Teenagers angewöhnt. Ihre Mutter erkannte dieses Benehmen als das, was es war – ein Schutz gegen die Angst.
Natalie verzog entschuldigend das Gesicht in Richtung Dr. Steinmetz. »Das ist aber nicht sehr nett, so was zu sagen, mein Schatz.«
»Das ist schon okay«, sagte die Psychologin mit professionell gleichmütiger Miene. »Callie, möchtest du Delilah ein bisschen streicheln, während ich mich mit deiner Mom unterhalte?«
»Na schön.«
Normalerweise hätte sich Callie mit Begeisterung und hingebungsvoller Zärtlichkeit um Delilah, ihren Liebling unter Ms. Tabbys Katzen, gekümmert. Doch heute trottete sie zu dem Sofa, ließ sich darauf niederplumpsen und streichelte die Perserkatze mit mechanischen Bewegungen, als würde sie eine missliebige Hausaufgabe erledigen.
Sie ist genau wie ich, dachte Natalie, und ihr Lächeln verlor rasch an Überzeugungskraft. Sie war selbst ein störrisches, verängstigtes Kind gewesen, und ihr war ein Stein vom Herzen gefallen, als es schien, als sei ihre Tochter mit einem fröhlichen, unbekümmerten Wesen gesegnet – mit demselben sonnigen Gemüt, das der Grund gewesen war, warum sich Natalie in Dan Atwater, Callies Vater, verliebt hatte.
Doch das war, bevor Vincent Threshers schwarze Seele von Callie Besitz ergriffen hatte.
Dr. Steinmetz bat Natalie mit einer einladenden Handbewegung in den Behandlungsraum und machte dann hinter ihnen die Tür zu. Der Raum hatte große Ähnlichkeit mit dem Spielzimmer eines Kindergartens, über den Fußboden lagen Spielsachen verstreut, und ein langer Tisch und einige Plastikstühle waren die einzigen Möbel. Die Psychologin zog zwei der Stühle unter dem Tisch hervor und forderte Natalie auf, sich zu setzen.
»Es tut mir leid, dass Callie so patzig war«, begann Natalie, doch die Psychologin unterbrach sie.
»Kein Grund zur Sorge. Eigentlich ist die Feindseligkeit, die sie an den Tag legt, ein Zeichen, dass sie Fortschritte macht.«
»Tatsächlich?« Natalie hoffte, nicht zu sarkastisch zu klingen. Offenbar unterschied sich Dr. Steinmetz’ Definition von »Fortschritt« von der ihren.
»Ja. Wut ist eine defensive Reaktion – eine Vereinfachung der Gefühle, die sie nicht verstehen oder noch nicht artikulieren kann. Aber sie beginnt, sich zu erinnern.«
Ein kalter Schauder lief Natalie über den Rücken, als sie sich an die Visionen perverser Scheußlichkeiten erinnerte, die ihren Geist überschwemmten, als Thresher damals von ihr Besitz ergriffen hatte: Bilder seiner Opfer, deren Körper er mit blutigen, in das lebende Fleisch gestochenen Nadeln bestickt hatte. Der Gedanke, dass er Callies Unschuld mit solch krankem Schmutz besudelt hatte, machte Natalie ganz krank vor Zorn. »Was hat sie Ihnen erzählt?«, fragte sie.
Dr. Steinmetz schien niemals zu zwinkern, und in ihrer Stimme lag stets eine kontrollierte Gelassenheit, was ihr den unerschütterlichen Gleichmut einer Grundschulbibliothekarin verlieh. »Es ist alles ein bisschen bruchstückhaft. Callie kann die psychopathische Denkweise, der sie ausgesetzt war, noch immer nicht begreifen. Sie weiß nur, dass sie falsch war. Aber die Seele, die von ihr Besitz ergriffen hatte, zwang sie, Dinge zu sehen – Dinge zu tun, die ihr instinktives Moralempfinden verabscheut. Deshalb fühlt sie sich schuldig wegen dessen, was sie getan und gedacht hat, obwohl sie keine Kontrolle darüber hatte.«
Erzählen Sie mir etwas, was ich nicht schon weiß, dachte Natalie. »Was kann ich tun?«
»Ermutigen Sie sie, über das zu reden, was sie bedrückt, auch wenn Sie es ihr aus der Nase ziehen müssen. Vor allem über diese Träume, die sie hat.«
»Albträume«, verbesserte Natalie sie. »Was kann ich noch tun?«
In den Mundwinkeln der Psychologin erschienen winzige Falten. »Außerdem hegt Callie einen ziemlich starken, unreflektierten Groll, weil sie ihren Vater verloren hat.«
Natalie atmete seufzend aus. »Ich weiß.«
»Und wie geht es Ihnen?«
Dr. Steinmetz wartete geduldig auf eine Antwort. Doch Natalie gab ihr keine. Sie mochte es genauso wenig wie Callie, psychoanalysiert zu werden.
»Ich … ich weiß nicht, ob wir den Termin nächste Woche wahrnehmen können«, sagte sie, um das Gespräch zu beenden, aber auch, weil es der Wahrheit entsprach. »Ich rufe Sie wegen eines neuen Termins an, sobald ich kann.«
Doch sie wusste nicht, ob sie das tun würde. Nicht bei so vielen anderen Ausgaben und Belastungen für ihre mageren Finanzen. Wenn sie nur die psychotherapeutischen Sitzungen für Callie selbst übernehmen könnte, so wie sie ihrer Tochter zu Hause auch Unterricht gab und sich um ihre Ausbildung als Violette kümmerte. Doch das war nicht möglich. Natalie konnte Callie mit ihren Problemen schwerlich helfen, wenn sie nicht einmal ihre eigenen lösen konnte.
***
Und wie geht es Ihnen?
Die Frage hallte in Natalies Kopf, während sie mit Callie nach Hause in ihre Eigentumswohnung fuhr. Sie wusste, dass ihre Tochter Dan vermisste. Er war vor ihrer Geburt gestorben, niedergeschossen bei dem Versuch, Natalie vor dem Violettenkiller zu retten. Doch Callies Fähigkeiten als Violette hatten es ihr ermöglicht, ihren Vater besser kennenzulernen als die meisten normalen Kinder ihre Väter. Während der ersten sechs Jahre ihres Lebens hatte sie die Liebe, die Zuwendung und den Schutz ihres Vaters herbeirufen können, wann immer sie wollte.
Dann war Dan an den Ort jenseits der großen Leere gelangt – in ein Reich, aus dem nicht einmal Violette Seelen zurückrufen konnten.
So oft Natalie Dans Gründe, sie auf diese Weise zu verlassen, auch erklärte – dass Daddy an einen Ort gegangen war, an dem er glücklich sein konnte, dass sie und Callie lernen mussten, ohne ihn zurechtzukommen –, es war ihr nie gelungen, ihrer Tochter gegenüber die sich plötzlich auftuende Leere in ihrem Leben zu rechtfertigen. Um die Wahrheit zu sagen, hatte sie mit diesen Erklärungen auch sich selbst nie wirklich überzeugen können. Noch nie zuvor hatte Natalie einen solchen Verlust erfahren, denn nicht einmal der Tod zerriss eine Beziehung so endgültig, wie der Ort jenseits der großen Leere sie von Dan getrennt hatte. Erst jetzt begann sie allmählich zu verstehen, welch schmerzlichen Verlust der Tod eines geliebten Menschen für normale Menschen bedeutete.
Da sie sich nach wie vor unsicher fühlte, wenn sie am Steuer eines Autos saß, wartete Natalie, bis sie eine rote Ampel erwischte, bevor sie einen Blick in den Rückspiegel wagte. Seit sie in der L.A. Times einen Artikel gelesen hatte, der darüber berichtete, dass Kinder durch explodierende Airbags verletzt und sogar getötet werden können, bestand sie darauf, dass Callie immer auf dem Rücksitz saß. Im Spiegel sah Natalie, dass ihre Tochter aus dem Fenster starrte, das Gesicht unter den wirren Strähnen ihrer schulterlangen braunen Locken versteckt. Callies Plüschbär, Mr. Teddy, lag unbeachtet neben ihr auf dem Sitz, sein Fell vor Alter zottelig und an manchen Stellen dünn und abgewetzt vom vielen An-sich-Drücken und Umarmen.
»Worüber hast du heute mit Ms. Tabby geredet?«, fragte Natalie und bemühte sich, so beiläufig wie möglich zu klingen.
»Über nichts.«
»Ach, komm. Du hast gesagt, du besuchst Ms. Tabby gern.«
»Nicht mehr. Sie geht mir auf die Nerven.«
»Das ist aber nicht sehr nett, mein Schatz.«
»Na und? Ms. Tabby ist auch nicht nett.«
»Callie!« Der Verkehr setzte sich wieder in Bewegung, doch Natalie starrte das kleine Mädchen mit schockiertem Blick an. »Sie versucht nur, dir zu helfen.«
»Wenn sie mir helfen will, soll sie mich in Ruhe lassen.«
»Das reicht jetzt.« Zum ersten Mal empfand Natalie so etwas wie Mitgefühl für ihren Vater, weil sie als Kind genauso widerborstig und eigensinnig gewesen war wie Callie jetzt.
»Gehst du wirklich zu einer Verabredung heute Abend?« Callie verzog das Gesicht, als hätte ihre Mutter gedroht, ihr zum Abendessen Leber mit Zwiebeln vorzusetzen.
Natalies Mund zuckte amüsiert. Offen gestanden, hatte sie auch keine große Lust, sich mit ihrer anstehenden Verabredung abzugeben, aber wahrscheinlich war es bereits zu spät, das Ganze abzusagen. »Du solltest Alan eine Chance geben«, sagte sie und meinte damit nicht nur ihre Tochter, sondern auch sich selbst. »Er ist ein netter Kerl.«
»Das hast du über Phil auch gesagt.« Callie sprach den Namen mit Abscheu aus.