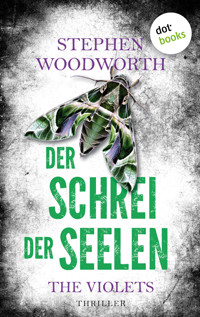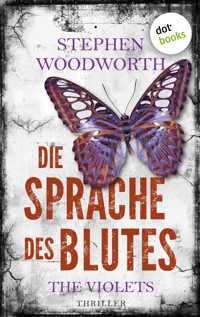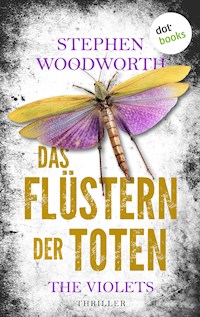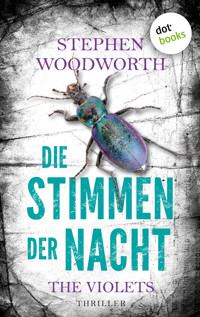
5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Violet Eyes
- Sprache: Deutsch
Denn manche Toten dürfen niemals ruhen: Der Mystery-Thriller »Die Stimmen der Nacht« von Stephen Woodworth als eBook bei dotbooks. Wenn die Schatten der Vergangenheit dich einholen … Sie hat sich von allem losgesagt: Von der Polizei, die sie rücksichtslos für ihre Zwecke, und von der »Nordamerikanischen Gesellschaft für Jenseitskommunikation«, die sie unter strenger Kontrolle halten wollte. Nun arbeitet Natalie Lindstrom, die mit den Geistern der Verstorbenen sprechen kann, nur noch nach ihren eigenen Regeln. Doch während sie versucht, die Lügen eines Mörders und seiner Verteidiger zu widerlegen, gerät sie selbst in tödliche Gefahr – denn neben den Toten, die ihre Hilfe suchen, gibt es auch jene, die alles daran setzen, Natalies Seele zu zerreißen … »Stephen Woodworth versteht sich darauf, uns zu schockieren – und das in Frage zu stellen, an was wir glauben.« Bestsellerautor Greg Bear Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Stimmen der Nacht« von Stephen Woodworth ist der zweite Band der Urban-Fantasy-Tetralogie »Violet Eyes«. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wenn die Schatten der Vergangenheit dich einholen … Sie hat sich von allem losgesagt: Von der Polizei, die sie rücksichtslos für ihre Zwecke, und von der »Nordamerikanischen Gesellschaft für Jenseitskommunikation«, die sie unter strenger Kontrolle halten wollte. Nun arbeitet Natalie Lindstrom, die mit den Geistern der Verstorbenen sprechen kann, nur noch nach ihren eigenen Regeln. Doch während sie versucht, die Lügen eines Mörders und seiner Verteidiger zu widerlegen, gerät sie selbst in tödliche Gefahr – denn neben den Toten, die ihre Hilfe suchen, gibt es auch jene, die alles daran setzen, Natalies Seele zu zerreißen …
»Stephen Woodworth versteht sich darauf, uns zu schockieren – und das in Frage zu stellen, an was wir glauben.« Bestsellerautor Greg Bear
Über den Autor:
Stephen Woodworth, geboren 1967 in Kalifornien, veröffentlichte zahlreiche Kurzgeschichten und Novellen, für die er unter anderem für den renommierten Locus-Award nominiert wurde, bevor er mit seinem übernatürlichen Thriller »Das Flüstern der Toten« international bekannt wurde.
Bei dotbooks veröffentlichte Stephen Woodworth die vier Bände seiner Violet-Eyes-Tetralogie: »Das Flüstern der Toten«, »Die Stimmen der Nacht«, »Die Sprache des Blutes« und »Der Schrei der Seelen«.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Die amerikanische Originalausgabe dieses Romans erschien 2005 unter dem Titel »White red hands« bei Bantam Dell, Random House, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Stephen Woodworth
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-339-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Stimmen der Nacht« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Stephen Woodworth
Die Stimmen der Nacht
THE VIOLETS 2 – Thriller
Aus dem Amerikanischen von Helmut Gerstberger
dotbooks.
Ich fühle mich doppelt gesegnet,
weil meine erste Leserin zufällig auch
meine Lieblingsschriftstellerin ist:
meine liebe Frau und liebste Kollegin
KELLY DUNN.
Der magische Touch, den sie diesem
Roman gegeben hat, ist nur ein Abglanz
der unglaublichen Freude, mit der sie mein Leben
verändert hat.
Dafür und für so Vieles mehr
widme ich dieses Buch dir,
meine geliebte Partnerin in allen Dingen.
Kapitel 1Die Konsultation
Prescott »Scott« Hyland jun. rutschte unbehaglich auf seinem Stuhl herum; er fühlte sich alles andere als wohl in dem Oxford-Hemd und den Bügelfaltenhosen. Hätte er sich seine Klamotten selber aussuchen können, wäre er in einem T-Shirt gekommen, wie es Typen tragen, die ihre Frauen prügeln, und in Shorts, aber Lathrop hatte darauf bestanden, dass er sich in diese Kluft warf, in der er aussah wie irgendein Schnösel von einem Privatgymnasium.
»Und lassen Sie sich die Ringe rausmachen«, hatte der Anwalt befohlen, womit er die silbernen Piercing-Ringe meinte, die Scotts Ohren und Augenbrauen zierten. »Die Presse wird Ihnen Tag und Nacht auf den Fersen sein, bis die Sache vorbei ist.«
Scott strich über seine linke Augenbraue. Die Löcher begannen bereits, sich zu schließen. Lathrop hatte in fünf Minuten erreicht, was seine Eltern in drei Jahren nicht geschafft hatten.
Wenn Dad mich jetzt sehen könnte …
Der Gedanke ging Scott an die Nieren, und er stemmte sich in dem Stuhl hoch und konzentrierte sich auf das, was der Anwalt sagte, als hinge sein Leben davon ab, was es auch tat. Obwohl Scott mit siebzehn noch minderjährig war, hatte die Staatsanwaltschaft von Anfang an darauf gedrängt, ihm nach dem Erwachsenen-Strafrecht den Prozess zu machen, damit sie die Todesstrafe fordern konnten.
»Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass eine Menge Punkte gegen uns sprechen.« Malcolm Lathrop beugte sich auf seinem gepolsterten Lederthron nach vorn und zog, als werfe er einen prüfenden Blick auf die Einkaufsliste für den Supermarkt, irgendwelche Papiere auf dem Schreibtisch vor ihm zu Rate. »Obwohl das Schlafzimmer Ihrer Eltern offenbar durchsucht wurde, wurde nichts Wertvolles gestohlen, und alle anderen Zimmer des Hauses blieben unangetastet ‒ einschließlich Ihrem.«
Scott verlagerte das Gewicht auf seinem Stuhl und sagte nichts.
Nicht ein einziges zerzaustes Haar derangierte die perfekten sanften Wellen von Lathrops sorgfältig nach hinten gekämmter Frisur. »Dann ist da noch das eingeschlagene Fenster, durch das der ›Einbrecher‹ angeblich ins Haus eingestiegen ist. Leider hat die Polizei Glassplitter außerhalb des Fensters gefunden und nicht innerhalb. Und was die kleinen ›Fehler‹ in der Buchführung angeht, die Sie im Geschäft Ihres Vaters hinterlassen haben … Nun, je weniger davon die Rede ist, umso besser.«
Scott zupfte an einem Hornstückchen am Wulst seines Fingernagels und schwieg. Lathrop hatte ihm strikt verboten, irgendwas zu dem Fall zu sagen, auch privat.
Der Anwalt erhob sich und ging um den riesigen, wie ein Walnussaltar wirkenden Schreibtisch herum. »Die gute Nachricht ist, wir haben jetzt Ihre Eltern auf unserer Seite.«
»Meine Eltern?« Scotts Kopfhaut kribbelte. Vor seinem inneren Auge sah er seinen Dad nach hinten gegen das Kopfbrett des Betts gesackt, in seiner Brust ein roter Einschusskrater, und seine Mutter lag auf dem Boden neben dem Bett.
Die linke Hälfte ihres Gesichts war weggerissen, und aus ihrem Schädel sickerte Gehirnmasse …
Lathrop betrachtete den Jungen, als sei er soeben erst aus einer Eiszeithöhle gekrochen. »Ist Ihnen die Nordamerikanische Gesellschaft für Jenseitskommunikation ein Begriff?«
»Ja.« Vor einem Jahr hatte sein Dad ’ne Menge Kohle für ein brandneues Gemälde von Picasso oder irgendeinem anderen toten Maler auf den Tisch der Gesellschaft geblättert. Es sah aus wie etwas, das man mit Magneten an die Kühlschranktür heftet.
Er hatte natürlich wie jeder andere auch die Typen von der NAGJK in Polizeiserien und Filmen mit den Toten reden sehen. Violettäugige Freaks, von allen nur Violette genannt, die Mordopfern erlaubten, ihren Körper in Besitz zu nehmen und mit ihren Stimmen zu sprechen. Aber wenn der Mörder eine Maske trug, brachte die Zeugenaussage des Opfers auch nichts … oder doch?
»Das Medium der Gesellschaft, das für die Crime Division von Los Angeles arbeitet, hat mich kürzlich angerufen«, klärte ihn Lathrop auf. »Er hat freundlicherweise angeboten, Elizabeth Hyland und Prescott Hyland sen. herbeizurufen, damit sie im Prozess als Zeugen aussagen können.«
Scotts Gesicht wurde ganz taub, als alles Blut aus ihm wich. »Aber …«
Lathrop hob beschwichtigend die Hand. »Keine Sorge. Sie werden uns die Wahrheit über das sagen, was in dieser Nacht passiert ist.« Er lehnte sich gegen den Schreibtisch, verschränkte die Arme und setzte ein mitfühlendes Gesicht auf. Seine Augen blieben jedoch forschend und kalt. »Wir wissen, dass Sie reingelegt wurden, Scott. Fällt Ihnen jemand ein, der vielleicht ein Motiv haben könnte, Ihre Eltern umzubringen und Ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben?«
Mit einem Mal fühlte sich Scott wie ein Schauspieler, der seinen Text vergessen hat. »Sir?«
»Vielleicht jemand von den Geschäftspartnern Ihres Dads?« Lathrop warf einen Blick auf eines der Papiere auf seinem Schreibtisch. »Avery Park, zum Beispiel. Unsere Privatdetektive haben herausgefunden, dass er kein glaubwürdiges Alibi für die Mordnacht hat. Und es ist kein Geheimnis, dass er durch den Tod Ihres Vaters profitiert, oder?«
»Ja. Ich glaube schon.« Die Anspielungen des Anwalts bereiteten Scott das flaue, unangenehme Gefühl, hypnotisiert zu werden: Lathrop sagte ihm, was er glauben sollte.
»Keine Angst, Scott. Wir sorgen dafür, dass er damit nicht davonkommt.« Lathrop drückte einen Knopf auf der Gegensprechanlage neben ihm. »Jan, würden Sie jetzt Mr Pearsall reinbitten?«
Einen Augenblick später schwang die Bürotür auf. Mit der majestätischen Haltung einer Spielshow-Assistentin komplimentierte Lathrops Vorzimmerdame einen kleinen, schwammigen, koboldähnlichen Mann, der wie ein dem Alkohol verfallener Bestattungsunternehmer aussah, in den Raum und zog dann hinter ihm die Tür wieder zu. Scott stand auf, um ihn zu begrüßen, doch der Mann überquerte ohne erkennbare Eile, die Hände in den Hosentaschen, den schier endlos breiten Teppich. Wegen seines birnenförmigen Körpers wirkte das Jackett seines billigen Anzugs um die Brust zu weit und um die Hüften zu eng, und sein Toupet sah aus wie das Fell eines toten Pudels. Die dauergewellten Locken waren drei Schattierungen heller als das dichte Gestrüpp seines Schnauzbarts. Eine Oakland-Sonnenbrille verbarg seine Augen.
»Ich möchte Ihnen Lyman Pearsall vorstellen, Scott, das Medium, von dem ich Ihnen erzählt habe.«
Auf Lathrops Nicken hin schüttelte Scott dem kleinen Mann die Hand. Er bemerkte, wie Pearsall bei der Berührung das Gesicht verzog, und die Lippen des Mannes bewegten sich, als würde er leise immer wieder einen Satz vor sich hin sagen, den er nicht vergessen wollte. Scott lief ein kalter Schauder über den Rücken, als er sich erinnerte, dass die Violetten in den Filmen immer irgendwelche geheimnisvollen Beschwörungsformeln vor sich hin murmelten, wenn irgendwelche Toten in der Nähe waren.
»Mr Pearsall verlangt zwei Millionen Dollar als Honorar für seine Dienste«, sagte Lathrop. »Mit Ihrer Erlaubnis gebe ich ihm jetzt das Geld, und Sie können es mir zurückzahlen, wenn Sie in ein paar Monaten das Vermögen Ihrer Eltern erben.«
»Klar.« Scott starrte in Pearsalls schwammiges Gesicht und glaubte, die drohende Gefahr zu spüren, die von seinen hinter der Sonnenbrille versteckten Augen ausging. »Danke.«
Lathrop deutete auf die beiden Stühle vor seinem Schreibtisch. »Lassen Sie uns Platz nehmen und uns ein wenig besser kennen lernen.«
Er ging wieder hinter seinen Schreibtisch zurück, während sich die anderen beiden, einander noch immer anstarrend, setzten. Beiläufig nahm Pearsall seine Sonnenbrille ab.
Der Blick aus seinen violetten Augen brannte auf Scotts Gesicht wie ein unsichtbares Feuer.
»Nun denn, Mr Hyland«, sagte er mit einer Stimme, die wie das Zischeln einer Kobra klang. »Erzählen Sie mir alles über Ihre Mom und Ihren Dad, woran Sie sich erinnern.«
Kapitel 2Zwei im Sandkasten
Natalie wusste, dass die Sitzung nicht gut verlaufen würde, schon bevor Corinne Harris das schwarze, in Leder gebundene Etui öffnete, das die Pfeife ihres Vaters enthielt. Sie wusste es von dem Augenblick an, in dem sie den Fuß in Corinnes makellos sauberes Wohnzimmer gesetzt hatte, wo jeder Gegenstand mit geradezu fanatischer Akribie an seinem Platz stand, und dessen weißer Teppich so sorgfältig gebürstet war, dass alle Wollfäden wie Kompassnadeln nach Norden zeigten. Sie konnte es am Blick ihrer Gastgeberin erkennen, der Natalies violetten Augen auswich, und an der Art und Weise, wie Corinne mit Smalltalk und übertriebener Gastfreundlichkeit Zeit zu gewinnen versuchte.
»Ich habe Limonade gemacht.« Gleichzeitig stellte sie ein Tablett mit kleinen, rechteckig geschnittenen Sandwiches auf die Glasplatte des Couchtischs. »Oder soll ich lieber Kaffee aufbrühen? Oder Tee?«
»Nein, danke. Frisches Wasser ist bestens.« Natalie warf lächelnd einen Blick auf den beschlagenen Krug, der vor ihr auf dem Untersetzer stand.
»Oh … na schön.« Wie ein Papagei, der sich plusternd auf seiner Sitzstange niederlässt, ließ sich die Frau am anderen Ende des Sofas in die Polster sinken, die Knie fest zusammengepresst, und verschränkte nervös ihre dünnen Finger.
»Sie sagten, Sie haben eine Tochter?«
»Ja. Callie. Sie wird nächsten Juni sechs.«
»Das ist ein so süßes Alter!«, seufzte Corinne gefühlvoll.
»Und Ihre Kinder?«, erkundigte sich Natalie mehr aus Höflichkeit denn aus Interesse.
»Zwei Jungs, die beide leider schon im Teenageralter sind. Tom ist siebzehn und Josh fünfzehn. Sie waren so lieb und süß, bevor sie Skateboards und Rap-Musik entdeckten. Jetzt wird Darryl kaum mehr mit ihnen fertig.« Sie lächelte, wie um sich für ihren Sinn für Humor zu entschuldigen. »Sie und Ihr Mann müssen glücklich sein, ein kleines Mädchen zu haben.«
Natalies Lächeln erlosch. »Callies Vater ist vor ihrer Geburt gestorben.«
Corinne presste erschrocken die Hände auf ihren Mund. »Entschuldigen Sie. Ich wusste ja nicht …«
Der Fauxpas stach wie ein Stilett in Natalies Brust. »Es ist schon in Ordnung«, sagte sie, obwohl es das nicht war. Dan hätte nicht sterben dürfen, kaum eine Woche, nachdem sie sich ineinander verliebt hatten. Es war nicht fair.
»Das muss schlimm für Sie gewesen sein.« Über Corinnes Lippen huschte das Beben einer Frage, die sie nicht zu stellen wagte. Zweifellos war es dieselbe Frage, die allen auf der Zunge brannte, wenn Natalie ihnen von Dan erzählte. Reden Sie noch immer mit ihm? Eine bessere Frage wäre gewesen: Macht es einen Unterschied? Ebenso gut hätte sie versuchen können, eine Ehe aufrecht zu erhalten, deren einzige Verbindung mit ihrem Geliebten eine Flatrate für Ferngespräche war.
Die noch immer schmerzende Wunde, die ihr das Schicksal zugefügt hatte, drohte wieder aufzubrechen, und sie wusste, es würde ihr ins Gesicht geschrieben stehen ‒ etwas, das sie jetzt absolut nicht gebrauchen konnte. Um das Thema zu wechseln, nahm Natalie einen Schluck von ihrem Wasser und ließ die Eiswürfel im Glas kreisen. »Wann ist Ihr Vater gestorben?«
Corinne verzog den Mund. Sie hatte peinlichst vermieden, Conrad Eagleton auch nur mit einem Wort zu erwähnen, seit Natalie hier war, doch nun konnte sie nicht mehr länger so tun, als säße sie mit einer Freundin nur zu einem netten Nachmittagsplausch bei einer Tasse Tee zusammen.
»Vor sechzehn Jahren.«
Natalies Magen krampfte sich zusammen. Als Corinne angerufen hatte, um eine Sitzung zu vereinbaren, hatte sie in den Hörer geschluchzt, als würde sie von Trauer überwältigt vor dem Leichnam ihres Vaters auf den Knien liegen. »Wie alt war er?«
»Sechsundfünfzig.« Corinne strich ihren Rock glatt. »Er hatte ein schwaches Herz.«
»Und warum haben Sie so lange gewartet, mit ihm in Kontakt zu treten?«, fragte Natalie, obwohl sie die Antwort erraten konnte.
Corinne zuckte mit den Achseln und ließ ein nervöses Kichern hören. »Ich weiß auch nicht. Ich hatte Darryl und die Kinder, um die ich mich kümmern musste. Darryl… er würde das alles nur für eine unnötige Geldverschwendung halten.«
»Ihr Mann weiß nichts davon?«
»Er braucht es nicht zu wissen.« Sie verschränkte die Arme trotzig vor ihrer Brust. »Es ist mein Geld. Ich hab es von meinem Haushaltsgeld gespart.«
Haushaltsgeld?, dachte Natalie. Der gute Darryl scheint ja ein richtiges Prachtexemplar von Ehemann zu sein. »Sind Sie sich sicher, dass Sie bereit dafür sind? Eine Versöhnung mit einem toten Angehörigen ist nie einfach.«
»Ich will ihm nur zeigen, dass ich mich geändert habe. Dass sich alles zum Guten gewendet hat.«
Natalie nickte. »Haben Sie ein Kontaktobjekt gefunden?«
»Ich glaube schon.« Mit der Behutsamkeit eines Museumskonservators nahm sie ein kleines, längliches Etui vom Couchtisch und klappte den Deckel auf. »Glauben Sie, dass es damit funktioniert?«
Die Pfeife lag auf einem fleckigen, grünen Samtkissen mit dem dunkel gemaserten Kopf nach unten, wie der Griff einer Duellpistole. Tiefe Bissmale hatten das Mundstück des schwarzen Kunststoffstiels zernarbt, und Natalie konnte den süßlichen, aber muffig gewordenen würzigen Duft von Tabak riechen, der aus dem Etui aufstieg. Obwohl sie schon unzählige Male die Seelen Verstorbener herbeigerufen hatte, fühlte sie noch immer den vertrauten Schauder der Furcht.
»Ja, das wird genügen.«
Eigentlich hätte sie Corinne selbst als Kontaktobjekt benutzen können, denn jeder Mensch und jeder Gegenstand, den eine verstorbene Person während seines oder ihres Lebens berührt hatte, bewahrte ein winziges Quantum der Verbindung mit der elektromagnetischen Energie der Seele des Toten in sich. Natalie war jedoch ein persönlicher Gegenstand, der dem Toten gehört hatte, lieber, weil der körperliche Kontakt mit einer Violetten den meisten ihrer Klienten ein unbehagliches Gefühl bereitete.
Mit einem tiefen Atemzug rollte Natalie ihr langes, sandblondes Haar zu einem Knoten zusammen, den sie mit einer Haarklammer aus buntem Plastik feststeckte. Echtes Haar zu haben, war eine der angenehmen Seiten daran, auf dem privaten Sektor und in eigener Regie zu arbeiten. Als sie noch Mitglied der Abteilung für Verbrechensbekämpfung der NAGJK gewesen war, hatte sie ihren Schädel rasieren müssen, damit die Elektroden eines SoulScan-Elektro-Enzephalographen an den zwanzig Kontaktpunkten in ihrer Kopfhaut angeschlossen werden konnten. Auf dem Monitor des Geräts war dann abzulesen, wenn die Seele einer toten Person von ihrem Gehirn Besitz ergriff. Gott sei Dank musste sie sich jetzt nicht damit abquälen; außerdem würde eine Klientin wie Corinne Harris vermutlich laut kreischend aus dem Zimmer rennen, wenn sie Natalie mit einem Bündel an ihrem Kopf angebrachter Drähte erblickte.
Natalie nahm die Pfeife aus dem Etui und begann, leise die Worte ihres Betrachtermantras zu sprechen. Das ständige Wiederholen des Reims würde ihr Bewusstsein in einem Zustand der Spannung halten und ihr gleichzeitig ermöglichen, den Gedanken der von ihr Besitz ergreifenden Seele zu lauschen:
Row, row, row your boat,
Gently down the stream.
Merrily! Merrily! Merrily! Merrily!
Life is but a dream …
Eine zunehmende Taubheit kribbelte in ihren Fingern und Zehen, als seien sie eingeschlafen. Erinnerungen, die nicht ihr gehörten, geisterten durch ihr Gehirn. Natalie presste die Pfeife fester zwischen ihren Handflächen und erschauderte.
Conrad Eagleton klopfte.
Ein alter Cadillac Fleetwood Brougham stand mit offener Motorhaube vor ihr, und aus seinem geplatzten Kühlwasserschlauch quoll weißer Dampf. Die Sommersonne brannte heiß auf ihrem bereits kahl werdenden Schädel, und die Achseln ihres Anzugshemds waren nass von Schweiß.
Sie war spät dran. Sie hatte das Treffen verpasst, und Clarksonwürde den Vertrag kriegen. Zwanzig Jahre bei derselben Firma, und so weit hab ich’s gebracht! Scheißwagen, lausiger Job, beschissenes Leben! Sie versetzte dem Wagen mit ihrem Lackschuh einen Tritt und noch einen und noch einen, bis ihr die Zehen wehtaten und ihr Herz stotterte und blubberte wie der geplatzte Kühlwasserschlauch …
Natalies Puls flatterte mitempfindend, und hinter ihren Schläfen hämmerte Conrad Eagletons Verbitterung, als er einen tödlichen Herzinfarkt erlitt, und sie beeilte sich, ihre eigenen Körperfunktionen zu beruhigen, bevor ihr Herz versagte.
Row, row, row your boat…
Mit ruhiger, tiefer Yoga-Atmung besänftigte Natalie ihren rasenden Herzschlag, bis er wieder seinen normalen Rhythmus fand. Durch ihre flatternden Wimpern sah sie, wie Corinne aufgeregt mit den Händen gestikulierte und auf die Beine sprang.
»Augenblick! Warten Sie! Ich habe was vergessen.«
Sie rannte aus dem Wohnzimmer und ließ Natalie, die sich halb bewusstlos auf dem Sofa krümmte, allein zurück. Mit einem gerahmten Familienfoto von ihr, Darryl und ihren beiden Söhnen in der Hand kam Corinne zurück.
Sie schwenkte es wie ein Zeugnis mit lauter Einsen. »Er wird das sehen wollen.«
Natalie antwortete nicht darauf. Ihre Zunge fühlte sich an wie eine tote Schnecke, und ihre Hände krampften sich so fest um die Pfeife, dass ihr Stiel brach. Sie ließ die Trümmer auf ihren Schoß fallen.
Life is but a dream …
Mit der klinischen Distanziertheit eines Psychiaters, der die Albträume eines Patienten analysiert, beobachtete Natalie, wie Conrad Eagleton ihre Augen öffnete und in das makellos weiße Ambiente des Wohnzimmers blickte und dann verdutzt die alternde Frau anstarrte, die er nicht als seine Tochter erkannte. »Was zum Teufel… Wo bin ich?«
Die schroffe Kasernenhofstimme bebte vor Angst. Ganz ruhig, Conrad, beruhigte Natalie ihn in dem Gehirn, das sie jetzt teilten. Sie brauchen keine Angst zu haben.
Eagleton presste Natalies Hände auf ihre Ohren, um die innere Stimme zum Schweigen zu bringen. Dabei berührte er die weiche Haut ihrer Wangen und sah die grazile Anmut ihrer glatthäutigen Elfenbeinarme. Ihre feingliedrigen Hände zitterten, als er auf sie hinabstarrte. »Was ist mit mir passiert?«
Corinne beugte sich mit großen Augen vor, ihr Mund ein ehrfürchtig staunendes O. »Daddy?«
Conrad schreckte vor ihr zurück. »Wer sind Sie?«
Ihre Lippen kräuselten sich in einem unsicheren Lächeln. »Ich bin’s, Daddy. Cory!«
Aus zusammengekniffenen Augen spähte er in ihr teigiges, flehendes Gesicht. Farbe sorgte dafür, dass ihr Haar noch braun war, und Botox glättete die Krähenfüße um ihre Augen, doch das allmähliche Erschlaffen ihrer Wangen und ihres Kinns und die ständige Abgespanntheit in ihren Augen konnte sie nicht verbergen.
»Cory? Du warst erst vierundzwanzig, als ich.« Seine Worte erstarben zu einem tonlosen Flüstern. »Ist es schon so lange her?«
In der sich ausdehnenden Stille griff Corinne mit nervös flatternden Händen nach ihrem Familienfoto, als würde sie einen Feuerlöscher packen. »Tommy ist inzwischen fast schon erwachsen«, sagte sie und deutete auf den älteren Jungen. »Darryl war ihm ein wundervoller Vater. Und das hier ist Josh. Ich glaube, er sieht dir ähnlich.«
Conrad schnaubte verächtlich. »Hast du einen Dummkopf gefunden, der für dich sorgt, wie?«
Corinnes Lächeln flackerte wie die Flamme einer Kerze, in die der Wind fährt. »Aber du würdest Darryl mögen, Daddy. Er ist Stadtrat und … nun ja …« Sie breitete die Arme aus, um ihn einzuladen, die makellose Einrichtung ihres schönen Stadthauses zu bewundern.
Conrad stand auf, stemmte die Hände in die Hüften und ließ den Blick gleichgültig durch den Raum schweifen. »Es überrascht mich, dass er dich überhaupt genommen hat. Vor allem weil du schon ein Kind von diesem Verlierer hattest … wie hieß er noch mal?«
»Ronnie.« Corinne drückte das gerahmte Foto an ihre Brust. »Das war vor langer Zeit.«
»Manche Dinge ändern sich nie. Wie lange, glaubst du, wird es dauern, bis du auch deinen Jetzigen vertreibst?«
» Daddy!«
Seien Sie nicht so streng mit ihr, Conrad, ermahnte Natalie ihn.
»Sei still!« Er hämmerte mit Natalies Fäusten gegen ihre Schläfen. »Du hast keine Ahnung, was sie mir angetan hat!«
An diesem Punkt überlegte Natalie, ob sie den Rest der Sitzung fingieren sollte. Sie konnte Conrad mit ihrem Schutzmantra aus ihrem Kopf drängen, seine Rolle für Corinne zu Ende spielen und ihr die Versöhnung vorgaukeln, nach der sie sich so sehr sehnte. Erzähl ihnen, was sie hören wollen, hatte Arthur McCord, ihr zynischer Lehrer und Mentor bei den Violetten einmal gesagt. Das gefällt den Leuten besser als die Wahrheit. Doch Natalie hatte vor langer Zeit das feierliche Versprechen gegeben, ihre Klienten niemals anzulügen wie Arthur die seinen, deshalb ließ sie zu, dass sich Conrad Eagletons zornige Tiraden aus ihrem Mund ergossen.
Corinne schien in ihre Ecke der Couch zu versinken. »Was hast du nur, Daddy? Wovon redest du?«
»Du weißt verdammt gut, wovon ich rede!« Natalies Körper bebte vor seinem Zorn. »Du bist eine nichtsnutzige Schmarotzerin, Cory, und das warst du schon immer.«
»Das ist nicht wahr!«
»Natürlich ist es wahr! Warum, glaubst du, hat dich deine Mutter mir aufgehalst? Sie wusste es. Wahrscheinlich hat dir auch Ronnie aus dem Grund den Laufpass gegeben. Und dieser Schwachkopf…« Er machte eine wegwerfende Handbewegung in Richtung des Fotos, das sie an ihre Brust presste. ». Wie heißt er noch mal? Darren? Er tut mir leid.«
»Aber ich hab mich geändert!«
»Ja. So wie du dich geändert hast, als du damals aus Seattle mit Tommy in deinem Bauch angekrochen kamst.«
»Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich bin vernünftig geworden und hab einen Platz gefunden, wo ich zu Hause bin …«
»Vernünftig geworden oder nur wieder einen anderen gefunden, den du ausnutzen kannst?« Er deutete auf die harte, graue Welt draußen vor dem Wohnzimmerfenster. »Glaubst du, ich wäre auf der I-5 bei vierzig Grad Hitze malochen gegangen, wenn ich nicht dich und deinen blöden Bankert durchzufüttern gehabt hätte? Ich hab mich für dich zu Tode geschuftet.«
»Es tut mir leid! Es tut mir so leid!«, schluchzte sie mit verquollenem Gesicht. »Ich wollte dir nicht wehtun.«
Sein Lachen klang wie das Knistern eines unlöschbaren Feuers in einer Kohlenmine. »Mir wehtun? Cory, du hast mich umgebracht!« Erbost baute er sich vor ihr auf. »Hast du gehört? Du hast mich umgebracht, und wenn du glaubst, du kannst mit deiner armseligen Entschuldigung alles ungeschehen machen, dann bist du ein noch hoffnungsloserer Fall, als ich dachte!«
Sie sind nicht fair, mischte sich Natalie ein.
»Fair? Woher weißt du, was fair ist?«, brüllte Conrad, das Gesicht zur Decke emporgewandt, als rufe er Gott zu seinem Zeugen an. »Ist es fair, dass ich nach dreizehn Stunden Arbeit nach Hause kommen musste, um zu kochen und hinter ihr herzuputzen? Ist es fair, dass Frauen mich fallen ließen wie ’ne heiße Kartoffel, sobald sie mitkriegten, dass ich ein Balg am Hals hatte?«
Corinne schluchzte schniefend wie ein löchriges Akkordeon.
Jetzt ist es genug, warnte Natalie Eagleton. Wenn Sie sich nicht auf der Stelle entschuldigen, schicke ich Sie zurück.
Einen Augenblick lang erstickte Angst seinen Zorn. Wie die meisten Seelen fürchtete er die schwarze Leere des Lebens nach dem Tod.
Dann ließ er den Blick über das sterile Weiß des Wohnzimmers, die graue, öde Welt draußen vor dem Fenster schweifen. Die Rosenbüsche, die das Blumenbeet im Vorgarten säumten, waren zu dornigen Skeletten gestutzt, der Rasen militärisch kurz wie ein Stiftenkopf. Sein Blick kehrte zu seiner Tochter zurück, und er knirschte mit Natalies Zähnen.
»Schick mich zurück, wenn du willst. Für mich gibt es hier so und so nichts.«
Corinne zuckte zusammen, als habe sie eine Ohrfeige bekommen, und heulte wimmernd auf wie ein jähzorniges Kind.
»Der Herr ist mein Hirte«, rezitierte Natalie stumm, »mir wird nichts mangeln …«
Mit den Worten des dreiundzwanzigsten Psalms, ihrem Schutzmantra, die in ihrem Kopf kreisten, beförderte sie Conrad Eagletons Bewusstsein aus ihrem Kopf. Er wehrte sich nicht, doch sein Hass hinterließ in ihrem Mund den bitteren Nachgeschmack von Galle. Während allmählich das Gefühl wieder in Natalies Glieder zurückkehrte, ließ sie sich, noch immer am ganzen Leib vor fiebriger Wut zitternd, schwer auf das Sofa fallen.
Corinne hob nicht einmal den Kopf aus ihren Händen. Zwischen ihren Fingern sickerten Tränen hervor. »Ich hab ihm nicht einmal gesagt, dass ich ihn liebe.«
Natalie massierte ihre Schläfen. »Er hat Ihnen keine Gelegenheit dazu gegeben.«
»Kein Wunder, dass er mich hasst.« Die Tochter krümmte sich wie ein Gürteltier zusammen.
Plärrender kleiner Balg, dachte Natalie und schüttelte dann die Worte aus ihrem Kopf. Conrads Verächtlichkeit stob noch immer durch ihre Neuronen wie ungelöschter Kalk, doch sie ignorierte sie und legte einen Arm um Corinnes Schultern. »Es ist nicht Ihre Schuld.«
»Doch!« Corinne krallte die Finger in ihr Haar. »Ich hab nie auf ihn gehört und ihn nie wirklich geschätzt.« In ihrer Stimme war so viel Gift, als habe ihr Vater auch von ihr Besitz ergriffen.
»Sie haben vielleicht ein paar Fehler gemacht«, sagte Natalie besänftigend, »aber das bedeutet nicht, dass Sie ihn nicht geliebt haben. Und es bedeutet auch nicht, dass er Sie nicht liebt.«
Corinne wischte sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen. »Ich dachte, wenn ich noch einmal mit ihm reden und ihm sagen könnte, dass es mir leidtut, würde alles gut werden.«
»Manchmal ist es nicht möglich, dass alles wieder gut wird.« Vor ihrem inneren Auge sah Natalie ihren eigenen Vater lächelnd über die Schulter zurückschauen und ihr noch einmal zuwinken, als er sie allein und weinend auf den Stufen der Schule zurückließ und sie damit für ein Vierteljahrhundert in die Sklaverei der NAGJK schickte. Ihre Stimme wurde hart und schneidend wie ein geschliffener Diamant. »Sie müssen nur weitermachen und Ihr eigenes Leben richtig leben.«
Die Worte trösteten Corinne Harris, geborene Eagleton, nicht. Vielleicht konnte nichts sie trösten. Sie weinte, bis sie keine Tränen mehr hatte, immer wieder Selbstvorwürfe vor sich hin murmelnd.
»Es ist gut«, murmelte Natalie wieder und wieder, während sie die Frau in ihren Armen wiegte. »Es ist nicht Ihre Schuld.«
Schließlich verstummte Corinne und starrte blicklos vor sich hin, ihre Augen so leer wie der Himmel über der Wüste. Als mehrere Minuten verstrichen waren, befreite sich Natalie behutsam aus der Umarmung ihrer Klientin und erhob sich von der Couch.
»Ich muss jetzt leider gehen. Sie wissen, wo Sie mich erreichen können, falls Sie mich brauchen.«
Corinne antwortete nicht darauf. Natalie wandte sich um und verließ das Haus von Corinne und Darryl Harris.
Die Sitzung hatte so lange gedauert, dass sie es nicht mehr schaffen würde, Callie rechtzeitig vom Kindergarten abzuholen. Vornüber gebeugt und beide Hände so fest um das Lenkrad gekrampft, als wollte sie es erdrosseln, fuhr Natalie zum ersten Mal in ihrem Leben bei Gelb durch eine Ampel. Der braune Chrysler LeBaron, der sie bereits den ganzen Tag verfolgte, beschleunigte und brauste bei Rot durch, um an ihr dranzubleiben. In ihrem Rückspiegel sah Natalie, wie der Fahrer, ein Schwarzer mit Panorama-Sonnenbrille, den Kopf schüttelte.
»Tut mir leid«, entschuldigte sie sich, als könnte George sie tatsächlich hören.
Sie nahm den Fuß vom Gas, drosselte ihren Volvo auf einige Meilen unter dem Tempolimit und versuchte, sich in Geduld zu wappnen, während sie durch die Nebenstraßen von der Tustin hoch zur Fullerton kroch. Auf dem 55 wäre sie vielleicht schneller gewesen, doch der Verkehr auf den Freeways machte sie nach wie vor nervös und hektisch. Natalie hatte so entsetzliche Angst vor Verkehrsunfällen gehabt, dass sie sich erst mit siebenundzwanzig zum ersten Mal ans Steuer eines Autos gesetzt hatte, doch die Pflichten einer Mutter hatten sie schließlich gezwungen, fahren zu lernen. Sie spreizte und schloss einige Male ihre verkrampften Hände und fragte sich, ob sie sich jemals daran gewöhnen würde, diese Todesmaschinen zu steuern.
Sie stierte verdrossen auf den Verkehr vor ihr, doch sie wusste, er war nicht der einzige Grund für den Missmut, der sie bedrückte. Die Sitzung mit Corinne war eine Katastrophe gewesen, und zum tausendsten Mal fragte sich Natalie, ob sie eine gute Familienberaterin war. Vor allem weil sie kaum mit ihrem eigenen Dad redete. Sogar jetzt noch schwelte in ihr die Erinnerung an den Tag, an dem er sie verließ …
Für die Fantasie einer Fünfjährigen sah die Schule mit ihrer düsteren, hoch aufragenden viktorianischen Fassade inmitten des von Granitmauern umgebenen Geländes wie ein Schloss aus einem Märchen aus ‒ aber keines von diesen Und-sie-lebten-glücklich-bis-an-ihr-Ende-Märchen. Sie sah eher aus wie die Art von Schlössern, in denen eine böse Hexe dich gefangen hielt, bis ein Prinz kam und dich rettete.
»Es gefällt mir hier nicht, Daddy.« Die Sohlen ihrer Tennisschuhe rutschten über die Steinplatten, als er sie hinter sich her zu den halbrunden steinernen Stufen zerrte, die zum Eingang hinaufführten. »Ich will nach Hause.«
»Sei nicht albern, Natalie. Wir sind doch gerade erst angekommen.« Statt sie weiter an der Hand hinter sich herzuschleppen, nahm Wade Lindstrom sie einfach auf den Arm und trug sie die Stufen zu der massiven, zweiflügeligen Eichentür hinauf. »Du wirst sehen. Es wird dir hier gefallen, wenn du erst mal Freunde gefunden hast.«
Er strahlte sie mit seinem Vertreterlächeln an und drückte den Knopf auf der Gegensprechanlage in der Wand neben ihnen. Ein Summer schnarrte, gefolgt von einer Stimme, die genauso ungeduldig klang. »Ja?«
»Hier Wade Lindstrom, ich bringe meine Tochter Natalie zur Einschreibung«, sagte ihr Vater in das runde Sprechfeld.
»Ah, ja. Wir haben Sie schon erwartet. Einen Augenblick, bitte.«
Nur dass sie nicht glauben konnte, was mit ihr geschah, hielt Natalie davon ab, in Tränen auszubrechen. Daddy konnte sie doch nicht an diesem Furcht erregenden Ort allein lassen.
»Kommst du mich besuchen?«, fragte sie leise.
Er umarmte sie und gab ihr mit dem gekrümmten Finger einen Stups unters Kinn. »Aber ja, mein Engel.«
»Bald?«
Sein Lächeln erlosch. »So bald ich kann. Sie möchten dich für eine Weile ganz für sich haben. Bis du dich eingewöhnt hast.«
»Und Mommy?«
Die letzte Spur der angestrengten Fröhlichkeit in Wades Gesicht versickerte wie zerfließende Theaterschminke, und er setzte sie ab. »Ich hab es dir doch schon gesagt, mein Schatz. Deine Mutter ist… krank. Sie muss für lange Zeit im Hospital bleiben.«
»Hat der Thresher sie erwischt?«
Er sah sie mit einem strengen Blick an. »Wo hast du diesen Namen aufgeschnappt?«
»Du hast mit Großvater am Telefon darüber geredet. Du hast gesagt, Mommy wäre jetzt nicht im Krankenhaus, wenn sie sich nicht auf den Thresher-Fall eingelassen hätte. Wer ist der Thresher?«
»Mach dir darüber keine Gedanken. Vergiss, dass du den Namen je gehört hast. Es ist nichts, worüber du dir Sorgen zu machen brauchst.«
Ein Flügel der massiven Tür schwang knarrend auf. Wade drehte sich um, und Erleichterung glättete seine Züge, als er nicht mehr in ihre fragenden Augen blicken musste.
Der Mann, der unter der Tür erschien, war etwa so alt wie ihr Vater und hatte einen kahlen Schädel und lustig aussehende Ohren, die fast gerade von seinem Kopf abstanden wie die Ohren eines Elefanten. Er trug ein weißes, wallendes Gewand und hatte für Wade nur einen flüchtigen Blick übrig, bevor er seine violetten Augen auf Natalie richtete.
»Ms Lindstrom! Es ist mir eine Freude, Sie in unserer Akademie begrüßen zu dürfen.« Er beugte sich in der Hüfte zu ihr herab und streckte ihr seine Hand entgegen. »Ich bin Simon McCord, einer der Lehrer hier.«
Natalie nahm ihre Finger gerade lange genug aus dem Mund, um dem Lehrer die Hand zu geben.
Er runzelte leicht die Stirn, als er ihre vom Speichel glitschigen Finger berührte, und wischte sich die Hand an seiner Robe trocken. »Ich weiß, wir werden gute Freunde werden.«
Sie sagte nichts, denn sie war wie erstarrt und sprachlos vor Angst, Ehrfurcht und einer wachsenden Neugier. Simon war der erste Violette, den sie außerhalb ihrer Familie sah.
In der Absicht, die Aufmerksamkeit des Professors zu erheischen,streckte Wade ebenfalls die Hand aus. »Erfreut, Sie wiederzusehen, Simon …«
»Professor McCord.«
»Ja, natürlich. Wir sind sehr froh, dass Sie Natalie unterrichten werden.« Wade gab es auf, dem Professor die Hand schütteln zu wollen, und ließ seine Hand wieder sinken. »Nora hat immer in höchsten Tönen von Ihnen gesprochen.«
»Die gute Frau … Ich hoffe, sie muss nicht leiden.« Professor McCord faltete mit frommer Distanziertheit die Hände. »Sie haben die nötigen Anmeldungspapiere eingereicht, nehme ich an?«
»Sicher.«
»Dann können wir unsere kleine Ms Lindstrom ja in ihrem neuen Zuhause aufnehmen, denke ich.« Er nahm Natalies Hand und hielt sie fest.
Wade sah aus, als hätte ihm jemand die Faust in den Magen gerammt, doch er blickte mit seinem Schluss-Punkt-Ende-Lächeln ‒ das eine Abmachung besiegelte ‒ auf Natalie hinab, ging vor ihr in die Hocke und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Du wirst sehen, mein Schatz, es wird ganz toll hier.«
Sie rieb sich die Nase, die zu laufen anfing. »Komm mich bald besuchen, okay?«
Er wechselte einen Blick mit Professor McCord, und seine Lippen waren dabei ganz weiß. »Wir werden sehen. Ich hab dich lieb, mein Schatz.«
»Ich dich auch, Daddy.«
Er umarmte sie noch einmal und ging die Stufen hinab. Sie weinte jedoch nicht, bis er ungefähr bei der Hälfte des Gehwegs stehen blieb und ihr über die Schulter zuwinkte.
»Na, na ‒ wer wird denn weinen«, tadelte Simon Natalie und zog sie in den offenen Rachen der Schule. »Du solltest dich freuen. Du bist jetzt unter deinesgleichen, in deiner neuen Familie.«
Bremslichter leuchteten in einem grellen Rot vor Natalie auf und brachten sie mit einem Schlag wieder in die Gegenwart zurück. Sie trat erschrocken auf die Bremse, und hinter ihr quietschte Gummi auf dem Asphalt, als der LeBaron eine Handbreit von ihrer hinteren Stoßstange entfernt zum Stehen kam.
Natalie warf einen Blick in den Rückspiegel, in dem sie Georges vor Schreck verzerrtes Gesicht sah, und ließ seufzend die angehaltene Luft aus ihrer Lunge weichen. O Gott, ich fange schon selber an, wie ein typischer L.A.-Fahrer unterwegs zu sein. Ich muss mich entspannen, bevor ich uns beide umbringe.
Nicht zum ersten Mal spielte sie mit dem Gedanken, ganz mit der Arbeit als Violette aufzuhören. Alle hatten normale Jobs. Warum sie nicht?
Aber was konnte sie schon anderes machen? Medium zu sein war der einzige Beruf, in dem sie ausgebildet war. Als unabhängiges Medium, das in eigener Regie arbeitete, konnte sie bei einer einzigen Sitzung einige Tausend Dollar verdienen und trotzdem einen Großteil ihrer Zeit zu Hause bei Callie sein. Wenn sie sich dazu entschließen würde, ihr Geld nicht mehr mit ihren einzigartigen Fähigkeiten zu verdienen, müsste sie wahrscheinlich einen Ganztagsjob als Verkäuferin oder etwas in der Art annehmen.
Sie hatte natürlich noch immer ihre Malerei ‒ aber nur wenige Maler verdienten genug, um damit eine Familie ernähren zu können.
Vielleicht sollte sie wieder für die Gesellschaft arbeiten, dachte sie. Sie würden sie zweifellos mit offenen Armen und einem regelmäßigen Gehaltsscheck willkommen heißen. Aber sie würden auch Callie wollen, und das würde Natalie nicht zulassen. Noch nicht, zumindest.
Es war kurz vor halb fünf, als sie auf den Parkplatz des Tiny Tykes TLC Center bog, eine ehemalige Vorschule, die in eine Kindertagesstätte umgewandelt worden war. George parkte den LeBaron draußen auf der Straße.
Natalie machte den Motor aus und kramte aus Gewohnheit die Kontaktlinsen aus ihrer Handtasche. Doch als sie die erste eingelegt hatte, hielt sie inne und warf einen beschämten Blick auf ihre Augen im Rückspiegel ‒ eines blau, das andere violett.
Was für ein perfektes Rollenvorbild du doch bist, dachte sie, ihr Spiegelbild mit einem spöttischen Grinsen musternd. Ich wette, Callie kann es kaum erwarten, bis sie ihre ersten Kontaktlinsen bekommt. Dessen ungeachtet fuhr sie mit ihrem Tun fort und setzte die zweite Kontaktlinse ein, bevor sie aus dem Wagen stieg.
Eine Wandmalerei ‒ drei riesige Bauklötze mit den Buchstaben »TLC« für »Tender Loving Care« drauf ‒ bedeckte die gesamte Vorderfront des Kinderhorts, dessen Fenster mit Mustern in fröhlichen, kräftigen Farben bemalt waren. Um diese Zeit waren die Innenaktivitäten des Tages schon zu Ende und die meisten Kinder von ihren Eltern abgeholt, deshalb ging Natalie gleich weiter zu dem kleinen Spielplatz, der sich rechts vom Schulgebäude befand. Der bedeckte Himmel und das bereits schwindende Tageslicht ließen das Gras grau aussehen, und die wenigen Knirpse, die noch da waren, saßen von winterlicher Lethargie erfasst auf dem Karussell oder wippten lustlos auf der Schaukel.
Auf einem orangefarbenen Plastikstuhl, der viel zu klein für sie war, saß eine rundliche Frau, die verschränkten Arme auf ihrem Bauch ruhend, während ihr Blick von den Kindern zu ihrer Armbanduhr und wieder zurück huschte. Als sie Natalie erblickte, wuchtete sie sich nach vorn, um auf die Beine zu kommen, und eilte ihr entgegen. »Ms Lindstrom! Ms Lindstrom!«
»Hi, Ms Bushnell. Tut mir leid, dass ich zu spät komme.«
»Kein Problem.« Zwischen ihren Worten heftig keuchend, zog Ms Bushnell eine zusammengefaltete Glanzpapierbroschüre aus der Gesäßtasche ihrer Jeans in Übergröße und streckte sie Natalie entgegen. »Ich hab Informationen über die Schule, von der ich Ihnen erzählt habe.«
»Oh. Danke.« Natalie verzog das Gesicht zu einer Grimasse, als sie das Foto von dem düsteren viktorianischen Gebäude auf der Titelseite sah. Darunter stand in kursiver Schrift: »Iris Semple Akademie für Mediale Vermittler ‒ Eine Einführung.« Sie kannte die Akademie natürlich besser und wusste, dass sie von allen nur »die Schule« genannt wurde.
»Sie haben dort gute Leute.« Ms Bushnell tippte mit einem Finger auf das Foto. »Experten. Ich bin mir sicher, sie könnten Callie helfen. Bei ihrer Ausbildung, meine ich.«
»Hm-hm.«
»Und es ist alles umsonst! Sie würden alles bezahlen.«
»Sicherlich würden sie das.«
»Ich glaube wirklich, dass es das Beste für sie wäre.« Auf Ms Bushnells gutmütigem Gesicht spiegelte sich mütterliche Sorge. »Ihre Anwandlungen von Geistesabwesenheit, die Art, wie sie mit sich selbst spricht oder sich vollkommen ausklinkt ‒ gewöhnliche Schulen sind einfach nicht in der Lage, mit solchen Dingen umzugehen. Und es kann für die anderen Kinder sehr irritierend sein.«
Natalie nickte. Ihr Kinn straffte sich.
»In der Akademie hätte sie die Möglichkeit, andere Kinder kennen zu lernen, die wie sie sind. Bestimmt wäre es für sie dort auch leichter, Freunde zu finden.«
»Hmm. Sie haben wahrscheinlich Recht.« Natalie faltete die Broschüre vierfach zusammen und steckte sie in ihre Handtasche. »Ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen.«
Ms Bushnell strahlte. »Ich möchte nur helfen, wo immer ich kann. Sie ist so ein liebes Mädchen.«
»Danke.« Natalie schenkte ihr ein Plastiklächeln und ging zu dem viereckigen, aus Baumstämmen gebauten Sandkasten in der hintersten Ecke des Spielplatzes hinüber.
Ein kleines Mädchen mit braunem, zu zwei Zöpfen geflochtenem Haar kauerte im Sand. Sein Overall war mit weißem Staub bedeckt. Es schob mit beiden Händen ein blaues Plastikeimerchen wie einen Bulldozer durch den Sand und häufte ihn vor sich zu einem kleinen Berg auf. Nachdem es den Sand zu einem igluförmigen Hügel glatt geklopft hatte, machte es mit einem Stock kleine Löcher in die Kuppel aus Sand, während es etwas vor sich hin murmelte, das wie ein Singsang aus fernen mythischen Zeiten klang.
»… ich mache ein Zimmer für dich, eines für Mommy und eines für mich …«
Natalie runzelte besorgt die Stirn, als sie näher kam und die Worte verstehen konnte. Callie fühlte offenbar ihr Missfallen, denn sie unterbrach ihr Gemurmel und setzte einen versonnenen Gesichtsausdruck auf, als denke sie sich einen Wunsch aus, nachdem sie die Geburtstagskerzen ausgeblasen hat. Aus ihren großen violetten Augen sah sie mit der übertrieben gespielten Unschuld eines Kindes, das beim Spielen mit Streichhölzern ertappte wurde, zu ihrer Mutter empor.
»Hallo, mein kleines Mädchen.« Natalie ließ sich neben dem Sandkasten in die Hocke sinken. »Was baust du denn da?«
Callie stach mit ihrem Stock in den Sandhügel. »Ein Haus.«
»Ahh. Und werden wir in dem Haus wohnen?«
»Ja.«
»Nur du und ich?«
Die Lippen ihrer Tochter kräuselten sich zu einem Schmollmund. »Ja.«
Natalie holte tief Luft. »Mit wem hast du gerade gesprochen?«
Callie stach weiter mit dem Stock in den Sand. »Mit niemandem.«
»War es Daddy?«
Ihre Tochter hielt die Augen auf den Boden gesenkt.
Natalie seufzte. Sie hatte Dan gebeten, ihre Tochter in Ruhe zu lassen. Sie muss ihr eigenes Leben leben, hatte sie zu ihm gesagt, und er war einverstanden gewesen. Zumindest hatte er das gesagt.
»Ich hab dir gesagt, Schatz, du sollst in der Schule nicht mit Daddy reden. Wenn er klopft, brauchst du ihm nur zu sagen, dass er weggehen soll.«
»Er klopft nicht. Ich rufe ihn.«
Natalie starrte sie verblüfft und beunruhigt zugleich an. Sie wusste, dass Dan hin und wieder von Callies Geist Besitz ergriffen hatte, seit sie ein Baby gewesen war. Callies erstes Wort, das sie sprach, war »Da-Da« gewesen. Aber jetzt hatte sie offenbar herausgefunden, wie sie sich selbst als Kontaktobjekt benutzen und Dan herbeirufen konnte, wann immer sie wollte.
Sie muss eine angemessene Ausbildung bekommen, dachte Natalie. Die Toten herbeirufen zu können, ohne zu wissen, wie man sie wieder loskriegt, war gefährlich. Callie konnte für Stunden oder sogar für Tage die Kontrolle über ihren Körper verlieren, falls die sie bewohnende Seele sich weigerte, aus freien Stücken wieder zu gehen. Während dessen konnte diese Seele sie dazu bringen, alles zu tun, was sie von ihr verlangte. Natalie hatte dies auf die harte Art und Weise herausfinden müssen.
Sie krallte mit den Fingern einer Sechsjährigen nach den Krankenschwestern der Schule, als die sie in die Krankenstation und dort auf einen gepolsterten Tisch schleppten. »Nein! Ich gehe nicht wieder zurück!«, kreischte die Seele in ihr so gellend laut, dass Natalies Kehle von ihrem Schreien schon ganz wund war. »Ihr könnt mich nicht zwingen, zurückzugehen!«
A-B-C-D-E-F-G… A-B-C-D-E-F-G, wiederholte Natalie verzweifelt, doch das Alphabetmantra half nicht. In ihrem eigenen Kopf eingesperrt, konnte sie die Buchstaben nicht einmal laut aussprechen. Der Wille der Seele, die von ihr Besitz ergriffen hatte, war stärker als ihrer.
Unfähig, sich selbst Einhalt zu gebieten, sah sie zu, wie ihr Fuß einer der Schwestern in den Bauch trat. Sie ächzte auf, presste mit Gewalt eines von Natalies Beinen auf den Tisch und zurrte es mit einem Ledergurt fest. Gemeinsam gelang es den beiden, auch ihr anderes Bein und ihre Arme zu fixieren, dann stülpten sie ihr ein mit Elektroden besetztes Band um den Kopf. Isolierte Drähte schlängelten sich von dem Stirnband zu einer Schaltkonsole auf einem Karren neben dem Tisch, und auf dem Schalterfeld leuchtete ein großer roter Knopf auf.
»NEIN!«, hörte Natalie sich erneut kreischen. Ihr Körper bäumte sich in ihren Fesseln auf und zuckte wie eine Maus in einer Falle.
Eine der Krankenschwestern drückte den roten Knopf, als würde sie einen Wäschetrockner in Gang setzen, und Natalies Gedanken zerstoben in einem weißen Blitz …
»Wir reden später darüber«, sagte sie zu ihrer Tochter. Mit einem leisen Ächzen hob Natalie Callie aus dem Sandkasten und trug sie auf dem Arm zum Parkplatz. »Im Augenblick sterbe ich vor Hunger. Was hältst du von einer Pizza?«
Der schuldbewusste Ausdruck auf dem Gesicht des Mädchens verschwand. »Mit Oliven und Peperoni?«
»Versprochen.«
»Jaaa!« Triumphierend streckte Callie ihre kleinen Fäuste in die Luft, als hätte sie gerade einen Touchdown geschafft.
Natalie lachte leise. Sie hat sein Lächeln.
Trauer überflutete ihr Herz bei dem Gedanken, denn diese Ähnlichkeit war süß und bitter zugleich. Einerseits konnte Dan seinem Kind näher sein als jeder andere Vater auf der Welt, andererseits war es für sie schlimmer, als wäre er nur tot, denn seine Anwesenheit erinnerte sie nur umso schmerzlicher daran, dass er nicht mehr in Fleisch und Blut existierte.
Natalie drückte Callie fester an ihre Brust. Wir werden von einem Gespenst besucht, mein kleines Mädchen, aber wir lieben dieses Gespenst. Was sollen wir nur tun?
Eine ältere Frau in einem grauen Kostüm trat ihr in den Weg. »Ich habe gehofft, dass ich dich hier antreffe«, sagte sie. »Mutter zu sein bekommt dir ganz offensichtlich gut.«
Natalie blickte aus zusammengekniffenen Augen in das bronzefarbene Gesicht, das von allmählich grau werdendem, zu einem Zopf geflochtenem Haar umrahmt war. »Inez? Wie um alles in der Welt…«
»Ich brauche deine Hilfe.« Inez griff nach einem dicken, wattierten Umschlag, den sie unter ihren Arm geklemmt hatte, und hielt ihn hoch. »Scott Hyland versucht, ungestraft mit einem Mord davonzukommen.«
Kapitel 3Ein Hu zu hören
Natalie setzte Callie ab. »Ich arbeite nicht mehr für die NAGJK, Inez.«
Ihre alte Freundin, inzwischen stellvertretende Bezirksstaatsanwältin in Los Angeles, nickte. »Ich weiß. Deshalb brauche ich dich. Ich will nicht, dass die Gesellschaft davon weiß.«
Callie umklammerte ein Bein ihrer Mutter und sah schüchtern zu der Fremden empor. Natalie streichelte ihr Haar. »Wenn es keine Angelegenheit für die Gesellschaft ist, weshalb dann für mich?«
Inez Mendoza wedelte mit dem Umschlag. »Bist du mit dem Hyland-Fall vertraut?«
»Nur so weit, wie ich darüber in den Zeitungen gelesen habe. Klingt für mich eigentlich ziemlich unproblematisch.«
»Für mich auch. Die Beweise, die wir gegen Scott Hyland haben, sind so erdrückend, dass wir nicht einmal in Erwägung zogen, uns auf die zur Zeit drei Monate lange Warteliste für einen Violetten setzen zu lassen. Dann hat Hyland Malcolm Lathrop engagiert.«
»Verständlich, in seiner Situation«, bemerkte Natalie.
»Letzte Woche hat Lathrop die Zeugenliste der Verteidigung für den Prozess vorgelegt. Ganz oben auf der Liste stand Lyman Pearsalls Name.«
»Lyman?« Sie runzelte unangenehm berührt die Brauen. Natalie war Pearsall nur wenige Male begegnet und fand, dass er ein schmieriger kleiner Mann war, der sich ständig über irgendwas beklagte. »Wie ist er an den Fall geraten?«
»Offenbar hat Lathrop die Zeugenaussage eines Mediums verlangt. Und zwar explizit eine Zeugenaussage mit Lyman als Medium.«
»Aber was verspricht er sich davon, die Opfer im Prozess aussagen zu lassen? Man würde denken, das ist das Letzte, was er möchte.«
»Würde man, ja. Vielleicht will Lathrop die Opfer vor den Geschworenen verunsichern, sie mit Fragen überraschen, durch die sie sich in Widersprüche verwickeln, und auf diese Weise ernsthafte Zweifel säen. Aus diesem Grund möchte ich herausfinden, was Scott Hylands Eltern zu sagen haben, bevor wir vor Gericht gehen ‒ ohne dass der gute Malcolm davon weiß.« Sie sah Natalie erwartungsvoll an.
»Ich bin raus aus dem Job.«
»Ich weiß. Deshalb bist du die Einzige, die mir helfen kann. Die Gesellschaft hat es abgelehnt, mich mit jemand anderem als mit Pearsall Kontakt aufnehmen zu lassen.«
Natalie schüttelte den Kopf. »Ich habe genug Probleme mit der NAGJK. Für mich klingt es ohnehin so, dass du absolut keinen Grund hast, dir Sorgen zu machen. Wenn du überzeugt bist, dass Hyland es getan hat, wird es deine Beweisführung nur erleichtern, wenn du seine Eltern ins Kreuzverhör nimmst.«
»Ich weiß, aber … da ist noch etwas anderes, das mir Kopfzerbrechen macht.« Mendoza griff in den wattierten Umschlag und zog einen zusammengefalteten Zeitungsartikel hervor. »Ich hab schon bei einigen Fällen mit Lyman Pearsall zusammengearbeitet; seit du ausgestiegen bist, war er für die Crime Division von L. A. der wichtigste Violette. Wir haben uns nie sonderlich gemocht, aber er hat seinen Job gemacht. Dann, im letzten Jahr, passierte das.« Sie schüttelte den Zeitungsausschnitt auf und reichte ihn Natalie.
RIES FREIGESPROCHEN, titelte die Schlagzeile. »Der Mörder war Latino, sagt das Opfer.« Darunter war ein Foto, das den gut aussehenden blonden Angeklagten Avram Ries zeigte, wie er nach dem Freispruch durch die Geschworenen seinen Verteidiger umarmt.
»Warum gehst du nicht ein bisschen spielen, Schatz?« Natalie gab Callie einen sanften Schubs, und das Mädchen trottete widerstrebend in Richtung des Spielplatzes davon.
»Wir hatten einen ganzen Berg von Beweisen gegen Ries«, sagte Mendoza, während Natalie den Artikel überflog. »Sogar eine Übereinstimmung seiner DNS mit den Spermaproben, die von Samantha Winslows Leiche genommen wurden. Dann tauchte plötzlich Lyman Pearsall als Medium für die Verteidigung auf. Er rief Winslow als Zeugin der Verteidigung herbei, und sie erzählte der Jury, dass sie von einem Mexikaner erdrosselt worden sei. Ries’ Anwalt bestritt nicht, dass sein Mandant Sex mit Winslow hatte ‒ schließlich sei sie Prostituierte gewesen ‒, überzeugte aber die Geschworenen davon, dass die Übereinstimmung der Spermaproben allein nicht bewies, dass Ries irgendetwas mit ihrem Tod zu tun hatte.
Drei Monate nachdem er auf freien Fuß gesetzt worden war, hielt ein Streifenwagen der Polizei im Griffith Park hinter einem Auto, in dem es, wie die Cops glaubten, ein Teenagerpärchen miteinander trieb. Auf dem Rücksitz entdeckten sie Ries über einem nackten Frauenkörper. Er hatte die Frau mit ihrem BH erdrosselt und sogar den gleichen Knoten benutzt, den wir in dem BH um Samantha Winslows Hals entdeckten.«
Natalie gab ihr den Zeitungsausschnitt zurück und bemühte sich, ihre Betroffenheit vor Inez zu verbergen. »Und der Seelenscanner hat zweifelsfrei bestätigt, dass die Seele in Lyman anwesend war, nicht?«
Inez bestätigte dies mit einem Nicken.
»Dann hat das erste Opfer vielleicht die Wahrheit gesagt. Vielleicht hat Ries nur die zweite Frau ermordet.«
»Glaubst du das?«
Natalie hatte nur ein Schulterzucken als Antwort. Eine derart auffallende Übereinstimmung der Vorgehensweise des Killers als schieren Zufall zu bezeichnen, erschien auch ihr ziemlich weit hergeholt. »Hast du eine bessere Erklärung?«
»Noch nicht. Aber ich bin mir ebenso sicher, dass Avram Ries beide Morde begangen hat, wie ich mir sicher bin, dass Scott Hyland seine Eltern erschossen hat. Und ich will verdammt sein, wenn ich tatenlos hinnehme, dass Pearsall Scottie-Boy davonkommen lässt.«
Wenn Inez, wie jetzt, ihr kräftiges Kinn in wilder Entschlossenheit reckte, hatte sie eine gewisse Ähnlichkeit mit General Patton an der Front. Natalie unterdrückte ein Lächeln. Die Jahre, die vergangen waren, hatten die Staatsanwältin offensichtlich nicht duldsamer gemacht. »Wenn du glaubst, dass Lyman hinter alldem steckt, warum bittest du dann die Gesellschaft nicht, ihn zu überprüfen?«
»Das habe ich. Sie ließen mich wissen, dass er hohes Ansehen und einen makellosen Leumund habe, und das war es auch schon. Sie mögen es offenbar nicht, wenn jemand die Glaubwürdigkeit von Violetten der Gesellschaft in Frage stellt.
Deshalb bin ich hierhergekommen, anstatt dich zu Hause zu besuchen.« Inez warf einen Blick über ihre Schulter, als zweifle sie nicht daran, dass sie von Sicherheitsagenten der Gesellschaft beobachtet wurden. Einen nicht für die Gesellschaft arbeitenden Violetten bei polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen einzusetzen, war ein Verbrechen, und sowohl Inez wie auch Natalie konnten dafür ins Gefängnis kommen.
Gott sei Dank hat sie George nicht gesehen, dachte Natalie erleichtert.
»Ich vertraue dir«, sagte Inez. »Wenn du die Hylands herbeizitieren könntest…« Sie ließ ihre Augen den Satz zu Ende sprechen.
Natalie sah ihre alte Freundin an, dann hinüber zu Callie, die jetzt gelangweilt und schmollend auf dem Sockel des Karussells saß und sie besorgt beobachtete. »Tut mir leid.«
»Ich dachte mir, dass du das sagen würdest.« Inez schob ihre Hand erneut in den Umschlag und zog einen kleinen, durchsichtigen Plastikbeutel hervor. »Darum hab ich das hier mitgebracht.«
Natalie nahm den Beutel mit zwei Fingern an einer Ecke, als würde sie eine tote Ratte anfassen. In dem Beutel lag ein billiges, zu einem Knoten verheddertes Armkettchen mit Glücksbringer-Anhängern.
»Es gehörte Marcy Owens, Ries’ zweitem Opfer. Sie hätte nicht sterben müssen, wenn es uns gelungen wäre, ihn hinter Schloss und Riegel zu bringen. Vielleicht kann sie dich überzeugen.« Die Staatsanwältin deutete auf einen Aufkleber an der Plastiktüte, auf dem eine Telefonnummer stand. »Wenn du es dir anders überlegst, ruf an und sage, dass du auf unser spezielles Angebot eingehst. Ich weiß dann schon, was du meinst.«
Sie drehte sich um und ging, bevor Natalie protestieren konnte. Mit einem unterdrückten Murren schob Natalie den Plastikbeutel in ihre Handtasche, wo er zwischen die Seiten der zusammengefalteten Broschüre der Schule geriet. »Inez!«
Die Staatsanwältin blickte zurück.
»Viel Glück …«
Inez legte eine Hand an ihren Mund, um ihre Antwort vernehmlicher zu machen. »Darauf möchte ich mich nicht verlassen!«
Sie ging zu ihrem blauen Subaru Legacy ‒ zweifellos derselbe Wagen, den sie vor sechs Jahren schon gefahren hatte, und brauste davon.
Callie kam zu ihrer Mutter zurückgetrottet. »Wer war das, Mommy?«
Natalie bückte sich und hob sie auf ihren Arm. »Nur eine Freundin. Jemand, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe.«
»Hat sie einen Job für dich?«
»Nein.« Sie trug ihre Tochter zum Volvo. »Es war nichts Wichtiges.«
Als sie mit ihrer Pizza zu Hause anlangten, brachte Natalie Callie nach drinnen, legte dann ein paar Stücke von der Pizza mit Peperoni und schwarzen Oliven auf einen Pappteller, griff sich eine Dose Coke aus dem Kühlschrank und ging damit zu dem immer gegenwärtigen LeBaron hinaus, der vor der Wohnanlage mit Eigentumswohnungen am Bordstein parkte. George drehte den Kopf zu ihr herum, die Augenbrauen über den oberen Rand seiner Panorama-Brille gewölbt, und ließ das Seitenfenster herunter.
»Hi, Nat. Was ist das?«
»Ein kleiner Happen gegen den Hunger, weil die Sie wieder während der Essenszeit arbeiten lassen.« Sie reichte ihm die Pizza und das Getränk durchs Fenster.
»Danke. Ich glaube, ohne Sie wäre ich inzwischen längst verhungert.« Über sein Osterinseln-Gesicht huschte ein Lächeln. Vor vier Jahren hatte Natalie auch einen kleinen Happen wie diesen benutzt, um das Eis zwischen ihr und dem Mann zu brechen, den die Gesellschaft auf sie angesetzt hatte, um sie einzuschüchtern und unter Druck zu setzen, und seitdem waren sie so etwas wie gute Freunde geworden.
Sie stützte sich auf den Türholm und spähte in den Wagen. »Was für ein Buch hören Sie zur Zeit? Wieder eines von Clive Cussler?«
»Nee. Ich brauch mal ’ne Pause von ihm.« Er nahm eine der weißen Kassetten vom Sitz neben ihm. »Zur Zeit lerne ich ›Fließend Französisch in vierzig Tagen‹.« Er räusperte sich. »Bonjour, madame! Je suis heureux de faire votre connaissance. Ou est la salle de bain?« Er betonte jede einzelne Silbe sorgfältig und grinste dabei stolz.
»Wäre Spanisch in L. A. nicht praktischer?«, fragte Natalie trocken.
»Ja schon, aber dann hätte ich keinen Grund mehr, mit Monica nach Paris zu fahren, oder?«