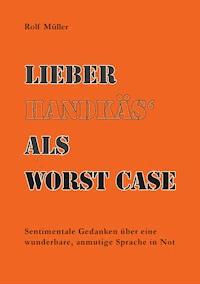Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Fabian ist neun Jahre alt und ein aufgeweckter Junge. Aber etwas beunruhigt ihn: Warum ist sein Vater für ihn emotional nicht erreichbar? Warum streiten sich seine Eltern immer? Wie viele Kinder, die in einer solchen Situation sind, sucht er die Schuld bei sich. Doch dann treten zwei Ereignisse in sein Leben: Er begegnet im Traum einem weisen Raben, der viel über ihn und das Leben weiß und ihm geheimnisvolle Ratschläge gibt - und er erhält ein Spielzeugauto, einen roten Mustang, der im Leben seines Vaters und seines Großvaters eine fatale Rolle als ‚Fluchtauto‘ vor familiären Problemen gespielt hat. Es beginnt für Fabian ein harter, aber heilsamer Weg der Erkenntnis und der Heilung. In dieser spannenden Geschichte mit vielen überraschenden Wendungen muss sich nicht nur Fabian seiner Vergangenheit stellen. Auch Elias, sein Onkel und bald sein Vertrauter, wird mit dem konfrontiert, was ihn zu dem gemacht hat, was er ist. Wie sie es schaffen, ihre familiären Belastungen zu bewältigen und damit das Leben anzunehmen, erzählt dieser Roman, indem er Fabian und Elias in Träumen und Erinnerungen, aber auch in Szenen, in denen ihre Familienmitglieder ihnen symbolisch gegenübergestellt werden, mit den Quellen ihrer Leiden konfrontiert. Mit den Mitteln der Literatur werden hier auf erhellende Weise wirksame heilende Wege zur Erkenntnis und Verarbeitung der eigenen (Familien-)Proble¬matik vor Augen geführt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 556
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über den Autor:
Rolf Müller wurde 1939 in Zürich in der Schweiz geboren. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Lehre als Matrose auf dem Rhein und fuhr drei Jahre lang zur See. Danach besuchte er für zwei Jahre die Militär-Instruktoren-Schule und war zwanzig Jahre als Instruktor in der Schweizer Armee tätig. Darauf absolvierte er eine dreijährige Ausbildung zum Naturheilpraktiker und eröffnete eine eigene Praxis, das Institut für ganzheitliche Therapie (IGT). Zusätzlich ließ er sich zum Systemtherapeuten für Systemaufstellungen und Organisationsaufstellungen ausbilden. Die Leitung der Seminare erfolgt zusammen mit seiner Partnerin Gabrielle Biétry.
Weitere Titel des Autors:
Zwischen den Zeilen (2013)
Aller Anfang ist JA (2015
Inhalt
Der schwarze Rabe und der rote Mustang
Abschied
Theres
Fabian und seine Mutter
Mason Connor
Roberto wird zurückerwartet
Robertos Rückkehr
Ungewissheit
Gewissheit
Trauerfeier
Elias Raban
Krise
Fabian, Alina und Noemi
Fabian und Elias
Rückreise in die Zukunft
Wiedersehen
Der schwarze Rabe und der rote Mustang
Fabian begegnet dem schwarzen Raben und Roberto dem roten Mustang
»Kinder haben Augen, die sehen,
wofür wir längst schon blind sind.
Kinder haben Ohren, die hören,
wofür wir längst schon taub sind.
Kinder sind Seelen, die spüren,
wofür wir längst schon stumpf sind.
Kinder sind Spiegel, die zeigen,
was wir gerne verbergen.«
Unbekannter Autor
Ein Ohren-zerreißender Schrei gefolgt vom lauten Knall eines Aufpralls mitten in der Nacht.
Margrit schießt auf, »was war das? … Fabian!«, kommt aus ihrem Mund geschossen. Sie knipst die Lampe an, springt aus dem Bett und rennt ins Zimmer von Fabian. Roberto, ihr Ehemann, stürmt hinterher.
Schreiend, mit Schreck-erstarrtem Gesicht liegt Fabian, ihr neunjähriger Sohn, auf dem Boden. Eine Hand senkrecht nach oben gestreckt, starrt er die beiden mit weit aufgerissenen Augen an.
»Papa, bist du das, wieso bist du abgehauen?«, stöhnt er und versucht den Kopf zu heben.
Die Mutter kniet sich neben Fabian. »Hast du dir wehgetan?«, ruft sie erschrocken.
Der Vater steht hilflos daneben. »Wieso bist du aus dem Bett gefallen? Was ist passiert?«
Die Mutter legt behutsam Fabians Kopf auf ihre Oberschenkel. »Hast du geträumt?«
»Nein«, wimmert Fabian unter Tränen, »wir sind abgestürzt. Wo ist mein Papa?«
»Du bist hier in deinem Zimmer, Papa und ich sind auch da. Es war nur ein Traum«, versucht sie ihn zu beruhigen. »Hast du Schmerzen?« Und streicht ihm dabei zärtlich über das Gesicht.
Roberto kniet ebenfalls nieder, ergreift Fabians nach oben gestreckter Hand. »Ich bin da. Du bist aus dem Bett gestürzt. Komm, wir helfen dir zurück.«
Fabian schüttelt schluchzend den Kopf: »Nein, nein, nein, nicht noch mal abstürzen. Ich will bei euch bleiben.«
»Ja, du kannst bei uns bleiben und bei uns im Bett weiterschlafen«, beruhigt ihn die Mutter. »Wo tut es dir weh? Komm, wir helfen dir, aufzustehen.« Und zum Vater gewendet: »Versuche, ihn aufzusetzen, ich hole ein Glas Wasser.«
Roberto fasst Fabian unter den Achseln. »Wir probieren jetzt, ganz sorgfältig aufzusitzen« und zieht ihn sanft nach oben.
Fabian beruhigt sich langsam und lehnt sich an den hinter ihm sitzenden Vater. »Hier habe ich Schmerzen«, dabei legt er seine linke Hand auf die Brust, »auch der Arm tut mir weh.«
Die Mutter kommt mit einem Glas Wasser: »Versuche zu trinken, das wird dir guttun.«
»Auaaahhh, das tut so weh!«, schreit Fabian, als er das Glas ergreifen will. Sie legt ihm den Glasrand direkt an den Mund. Fabian trinkt und lehnt sich wieder erschöpft an seinen Papa, was ihn entspannt und beruhigt.
»Ich helfe dir, aufzustehen. Kannst du selbst zu unserem Bett laufen oder soll ich dich tragen?« Roberto zieht ihn dabei sanft auf die Beine.
Fabian schweigt. Er geht mit wackligen Schritten an der Hand seines Vaters ins Schlafzimmer der Eltern.
»Wo sind wir abgestürzt?«, erkundigt sich Fabian und legt sich im Bett auf den Rücken.
Margrit setzt sich, auf den Bettrand: »Was hast du denn geträumt?«
»Ich habe nicht geträumt, wir sind abgestürzt«, beteuert Fabian und schaut mit verzerrtem Gesicht seinen Vater an.
»Wer war denn dabei?«, erkundigt sich die Mutter geduldig.
»Niemand, ich war allein. Aber der Papa ist mir davongefahren.« Fabians Stimme ist kaum hörbar. »Wo ist Papa?«
»Du siehst doch, dass ich da bin. Keiner ist dir davongefahren, du bist nur aus deinem Bett gefallen. Aber jetzt bist du da, in unserem Bett, und ich bin auch da.« Nach kurzer Pause fährt er fort: »Wenn du noch etwas zur Mitte rückst, haben wir beide genug Platz. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, versuchen wir noch ein wenig zu schlafen. Morgen gehe ich mit dir auf das Dorffest, wenn du magst«, versucht er seinen Sohn abzulenken.
Margrit schaut Roberto an: »Ja, es ist wirklich zehn vor zwölf.« Sie zerrt ihn lautlos ins Kinderzimmer: »Hast du erneut im Sinn zu verschwinden?«
»Spinnst du?«
»Ich höre, was Fabian sagt. Kinder nehmen wahr, was wir verbergen und sie tun es uns kund, auf ihre kindliche Weise.«
Roberto läuft davon und legt sich wortlos neben Fabian ins Bett.
Margrit bringt Fabian seine Bettdecke: »Hier hast du deine eigene Decke. Versuche zu schlafen und rufe mich, wenn du etwas brauchst.« Dabei küsst sie ihn auf die Stirn. Sie nimmt erneut eine Schlaftablette, legt sich auf ihre Bettseite, löscht das Licht und dreht den beiden den Rücken zu.
Mit halbgeöffneten Augen liegt Fabian auf dem Rücken. Er legt eine Hand auf die schmerzende Brust und sucht mit der anderen den Kontakt zum Vater, als wolle er sich an ihm festhalten, um nicht erneut abzustürzen. So sieht es zumindest aus.
Oder versucht er im Gegenteil, den Vater festzuhalten?
Fabian bemerkt, wie sein Herz unter der Hand pocht. Die Angst ist noch da, obwohl er jetzt zwischen den Eltern liegt. Mit der Verbindung zum Papa entspannt sich sein Körper jedoch.
Kaum ist Fabian eingeschlafen, verraten seine zuckenden Bewegungen, dass er erneut zu träumen beginnt:
Meine Stirn klatscht auf den Boden, ich liege flach, wie unter einer Fliegenklatsche. Der Fuß hängt noch immer in dieser blöden Wurzel, die mich vornüber stürzen ließ. Die Stirne hat ein Leck, es blutet. Doch die Angst ist stärker, reißt mich hoch und zwingt mich weiter. Mein Angst-Motor hat tausend PS und dreht voll durch. Wenn es nur nicht so dunkel wäre und der Wald nicht so dicht. Ein Stein liegt mir im Wege und ich stolpere erneut kopfüber.
Wo bin ich eigentlich? Was ist vorne und was hinten? Wo geht es von zu Hause fort? Die Stirn blutet und der Fuß schmerzt. Der Stein, auf den ich mich setze, ist kalt und ich wische Blut von der Stirn. Allein und Dunkel wohin ich schaue. Wenn nur die Mama da wäre.
Urplötzlich Geräusch und Bewegung auf dem Baum vor mir, mein Angst-Motor heult auf und ringt nach Luft. Ein gespenstischer Vogel hebt ab und fliegt auf mich zu. Nichts wie weg hier, kann nicht, »Mama«, doch die hört mich nicht. Er landet wenige Meter vor mir … ein schwarzer Rabe mit glänzenden Federn.
»Hast du mich erschreckt«, schreie ich ihn an um die Angst zu verstecken. Der Rabe bleibt stehen und schaut hoch.
Ich bekomme wieder Luft was mich erleichtert. »Wo bin ich hier?«
Der Rabe legt die kräftigen Flügel auf seinem Rücken zurecht und streckt den langen Hals nach vorne. Aus seinem spitzen Schnabel kommt ein Geräusch, das wie ein Lachen klingt. Dabei schaut er mit seinen hervorstechenden grün-schwarzen Augen eindringlich zu Fabian auf und eröffnet ihm: »Fabian, du hast dich verlaufen im Urwald, im Dschungel deiner Gefühle.«
»Wieso weißt du, wer ich bin?« Doch irgendwie kommt mir der Vogel gar nicht so fremd vor. »Wo ist dieser Dschungel und wo ist mein Papa?« Ich wische dabei Tränen von den Wangen. »Ich will zurück zu Papa und Mama.«
Der Rabe hüpft näher heran und sagt beruhigend: »Der Dschungel ist in dir drin!« Er hüpft noch näher heran: »Auch dein Papa ist in dir drin, aber er ist in seinem eigenen Dschungel, darum vermagst du ihn nicht zu sehen. Deswegen kann er auch dich nicht sehen.«
Der Rabe kommt jetzt ganz dicht heran, streckt den langen Hals noch mehr nach vorne und schaut mir mit seinem durchdringenden Blick direkt in die Augen: »Auch dein Papa sitzt auf einem eiskalten Stein und sehnt sich nach Hause zu seinen Eltern, wie du.«
»Nein, mein Papa schläft in seinem Bett, geht morgen mit mir zum Dorffest und übermorgen nach Amerika. Übrigens: Woher willst du das wissen? Wer bist du eigentlich?«
»Ich heiße Raban und bin ein Teil von dir.« Dabei neigt er sein schwarzes Köpfchen behutsam und würdevoll. »Ich bin der Teil von dir, der das weiß, was du auch weißt, aber nicht wissen willst, und erinnere dich an das, was du schon weißt. Ich bin hier, um dir zu helfen, weil du dich im Urwald deiner Gefühle verlaufen hast. Ich kenne die Wege zurück und kann dir ein Wegweiser sein.«
Meine Stirn schmerzt, ich betaste sie: »Aber wenn der Dschungel in mir ist, dann bist du ja auch in mir. Ich habe doch keinen Vogel.«
Raban öffnet kurz seinen Schnabel und gibt erneut diesen komischen Ton von sich, als würde er lachen. Eindringlich sagt er: »Du siehst mich jetzt, weil du in der Traumwelt bist, deine Kopfaugen geschlossen sind und du mit dem Herzauge siehst. Wenn du am Tag nur mit den Kopfaugen schaust, erblickst du etwas anderes, dann kannst du mich nicht mehr sehen, obwohl ich da bin. Aber auch das, was du am Tag entdeckst, stimmt.«
Meine Augen machen sich groß und größer, ich taste nach den Ohren, um ja kein Wort zu verpassen. Bin völlig fixiert auf seinen Schnabel, höre ihn weitersprechen: »Wenn es dir gelingt, dein Herzauge offen zu halten, während du mit den Kopfaugen siehst, so siehst du mit dem Herzauge durch die Kopfaugen hindurch. Damit erkennst du das, was du anschaust, gesamtheitlich, weil du beides zu sehen vermagst, auch mich und den Dschungel in dir. Ebenso Papa und den Urwald in ihm. Mit den Kopfaugen kannst du nur das erblicken, was außen ist, was sich dir sichtbar zeigt. Mit dem Herzauge siehst du, was die Kopfaugen nicht zu sehen vermögen. So erkennst du die Zusammenhänge. So verstehst du, was du siehst. Dadurch vermagst du jederzeit den Weg auszuloten, der für dich der richtige ist, auch den Heimweg zu deinen Eltern.«
Etwas fasziniert mich an ihm und was er sagt, das trifft mich, interessiert mich, macht mich neugierig, beruhigt mich. Der Wald bleibt rabenschwarz, doch es scheint Licht hindurch.
Ich merke wie es mich entspannt, hocke jetzt gelassen auf dem Stein und lasse lässig die Beine baumeln.
Raban unterbricht das kurze Schweigen: »Deine Mama macht sich Sorgen, komm, wir begeben uns nach Hause. Ich zeige dir den Weg.«
Kaum hat er dies gesagt, breitet er seine Flügel aus und fliegt gemächlich voraus. Verdutzt schaue ich hinterher, stehe auf und folge ihm vertrauensvoll.
Als Fabian am nächsten Morgen aufwacht, stutzt er zunächst, dann setzt er sich auf, reibt seine Augen und schaut sich erstaunt und suchend um – doch Raban ist nirgendwo zu sehen. »Danke!«, kommt aus seinem Mund.
»Danke für was?«, hört er Papa neben sich. Erst jetzt realisiert Fabian, dass er bei den Eltern im Bett liegt.
»Es war nur ein Traum«, weicht Fabian aus. »Wann gehst du mit mir zum Dorffest?«
»Jetzt stehen wir erst einmal auf und nach dem Frühstück packe ich meinen Koffer für die Reise morgen. Danach besuchen wir das Dorffest.«
Margrit hat trotz der Tablette kaum geschlafen. Es war noch stockdunkle Nacht, als sie aufgestanden ist.
Beim Frühstück herrscht eine bedrückende Stimmung. Mutter und Vater reden kaum miteinander, nur das Allernotwendigste. Fabian schaut verunsichert drein, rutscht zappelig auf seinem Stuhl herum und würde sich lieber irgendwohin verkriechen.
Margrit unterbricht dieses erdrückende Schweigen:
»Weißt du noch, was du geträumt hast, Fabian, bevor du aus dem Bett gefallen bist?«
»Nein, ich erinnere mich nur, dass wir abgestürzt sind. Aber ich war ganz allein. Der Papa war schneller als ich.«
Margrit schaut in gedankenversunken zu Roberto, ohne ihn zu sehen.
An Papa gewendet, erkundigt sich Fabian: »Warst du auch schon mal im Dschungel, Papa?«
»Ich war einmal in Südamerika, wo es noch Dschungel gibt, aber da drin war ich nicht.«
»Ich meine den Dschungel in dir.«
Die Mutter verschluckt sich beim Kaffeetrinken, stellt hustend und klirrend die Tasse ab und schaut Roberto mit fragendem Blick an. Dieser starrt verunsichert vor sich auf den Teller und sucht nach Worten. Wie jedes Mal, wenn er sich bei einem Thema unwohl fühlt, weicht er auch jetzt aus, indem er sein Wissen ausbreitet.
»Der Dschungel ist ein naturbelassener Regenwald«, antwortet er, »der größte ist in Südamerika, rund um den Amazonas herum. Der Amazonas ist der längste Fluss der Welt. Wenn du in den Dschungel willst, musst du nach Südamerika, Afrika oder Asien reisen.« Dabei steht er auf und beendet das Thema ganz: »So, nun packe ich meinen Koffer, nicht für den Dschungel, aber für Amerika, danach brechen wir auf zum Dorffest.«
Noch bevor Fabian etwas sagen kann, ist der Vater aufgestanden und hat den Tisch verlassen.
Fabian senkt den Kopf, erinnert sich an Raban und den Traum von letzter Nacht. Er würde so gerne seinem Papa erzählen, was er vom Dschungel und dem schwarzen Raben geträumt hat, doch er traut sich nicht. Er bemerkt, wie sein Papa ihm genauso ausweicht wie der Mama. Obwohl seine Augen den Vater sehen, die Hände ihn berühren können, ist er für Fabians Herz in unerreichbarer Entfernung. Fabian nimmt sich vor, mit Raban darüber zu reden, wenn er ihn wieder mal sieht.
Fabian sitzt gedankenverloren da, mit einer Hand das Kinn stützend. Das in der letzten Nacht im Traum Erlebte lässt ihm keine Ruhe. Immer wieder zieht es ihn in Gedanken zurück in den Dschungel zu Raban. Er schiebt mit der freien Hand den leergetrunkenen Kunststoffbecher auf dem Holztisch hin und her. Den Lärm und das Leben um ihn herum scheint er gar nicht wahrzunehmen. Das Gekreische der Kinder, wenn die Achterbahn den höchsten Punkt erreicht und steil nach unten rast, klingt für ihn wie weit entfernt. Selbst das Gehupe der Autoskooter direkt nebenan vermag sein Interesse nicht zu wecken.
Noch andere Festbesucher sitzen an diesem langen Holztisch. Sein Vater neben ihm auf der Holzbank redet mit einem Kollegen. Die Mutter ist nicht da. Viele Eltern sind mit ihren Kindern gekommen an diesem sommerlichen Nachmittag. Es ist Jahrmarkt und Flohmarkt im Dorf, wie jedes Jahr um diese Zeit. Seine Mama wollte nicht mitkommen, sie meinte, dies sei eine günstige Gelegenheit für einen ›Männernachmittag‹, da der Vater ja morgen für drei Wochen nach Amerika reise.
»Papa, darf ich auf die …«
Roberto unterbricht ihn: »Du siehst doch, dass ich im Gespräch bin, also warte gefälligst, bis ich fertig bin«, und wendet sich wieder dem Gesprächspartner zu.
»Für andere hat er Zeit, nur für mich nicht«, murmelt Fabian tonlos in sich hinein und schaut trübsinnig vor sich hin.
»Hey, Fabian«, hört er unverhofft hinter ihm. »Schau mal, was ich bekommen habe.« Fabian blickt auf.
»Weißt du, was das für eine Automarke ist?«
Fabian dreht sich um und erkennt Ricardo, seinen Schulfreund aus der vierten Klasse, der ihm ein gelbes Spielzeugauto entgegenstreckt.
»Hat mir mein Papa soeben gekauft, dort vorne, am Spielzeug-Stand. Das ist der erste VW, den es gab, und der heißt Käfer, sieht ja auch aus wie ein Käfer, wie ein Maikäfer. Ich habe ihn selbst ausgewählt«, meint er mit stolzem Unterton.
Fabian ergreift das Auto und fährt mit ihm auf dem Holztisch um seinen Wasserbecher herum. »Das ist ja schon ein komischer Käfer, aber ich hätte lieber ein rotes Auto«, dabei gibt er ihm den VW zurück.
Ricardo nimmt den gelben Käfer wieder an sich und meint ganz aufgeregt: »Zu Hause habe ich noch ein blaues, ganz aus Holz, mit knallgelbem Dach.« Zu seinem Vater gedreht, der sich hinter ihn gestellt hat, fragt er mit bittenden Augen: »Papa, Papa, darf Fabian heute bei mir schlafen, wir möchten noch mit dem Auto spielen, bitte, bitte«, dabei zupft er den Vater an der Hand vor Aufregung.
Ricardos Vater schaut zu Roberto, der sich nun Fabian zugewendet hat: »Ja, ich bin einverstanden. Mama hat sicher nichts dagegen.«
Fabian ist wieder ganz gegenwärtig und neugierig.
Roberto wendet sich an den Vater von Ricardo: »Von mir aus ja.«
Dieser nickt und ergänzt: »Ich frage aber noch meine Frau, sie ist mit der Tochter dort vorne beim Flohmarkt, aber sie hat sicher nichts dagegen.«
Fabian lehnt sich an seinen Vater und fragt mit schmollendem Gesichtsausdruck: »Kaufst du mir auch ein Auto, ein rotes, damit wir heute damit spielen können?« Ricardo unterstützt ihn und meint: »Dort vorne am Spielzeug-Stand gibt es noch viele, auch rote sind dabei.«
»Wir schauen mal, was es dort gibt.«
Roberto kommt es gelegen, dass sein Sohn Fabian heute bei Ricardo schläft, denn er befürchtet, dass der heutige Abend mit seiner Frau Margrit schwierig und unerfreulich sein wird. Diese Streitereien und die weiteren Eheprobleme belasten ja auch Fabian immer mehr. Dazu kommt, dass er morgen beruflich für drei Wochen nach Amerika fliegen wird, was Margrit gar nicht gerne sieht.
Ricardo, mit dem gelben Käfer in der Hand, stupft Fabian in den Rücken: »Komm, Fabian, ich zeige dir, wo es ist«, und zieht ihn an der Hand hoch.
Roberto steht auf: »Geht schon mal voraus, ich muss noch bezahlen, dann komme ich nach.«
Vor dem Spielzeug-Stand werden Fabians Augen groß und immer größer und sein Mund öffnet sich staunend. Er starrt auf ein rotes Auto: Dieses Auto muss ich haben, nur dieses. Er schaut sich aufgeregt um, ob Papa nicht bald kommt. Die Frau hinter dem Stand hört er fragen: »Welches möchtest du denn haben?«
Als er sieht, dass Papa sich nähert, schaut er die Frau hinter dem Stand auffordernd an: »Das große, rote dort«, und streckt ihr verlangend die zitternde Hand entgegen. Dabei hüpft er aufgewühlt hin und her, steht auf den Zehenspitzen und beugt sich über den Tisch der Verkäuferin zu. Diese drückt ihm das rote Auto in die Hand. Fabian dreht sich sofort um und springt seinem Papa entgegen: »Ich habe es schon, schau mal, ich darf es doch haben?«, und streckt ihm mit beiden Händen das Auto entgegen.
Roberto bleibt verdutzt stehen, er ergreift das rote Auto und starrt es fassungslos an. Dabei wird er todernst. Wie zur Salzsäule erstarrt, fixiert er das Auto, regungslos, eine ganze Weile lang. Langsam dreht er sein Gesicht Fabian zu, blass und mit geröteten Augen, als blicke er durch ihn hindurch in eine weite Leere.
Fabian erschreckt, machtlos der gleichen Angst ausgeliefert wie letzte Nacht im Dschungel, als er auf dem kalten Stein saß.
Roberto geht ein paar Schritte zurück und hockt sich auf den Stein am Wegesrand. Er betrachtet das rote Auto von vorne, schaut es danach von beiden Seiten an. Mit Stielaugen starrt er es von hinten an und flüstert dann mit gepresster Stimme: »Ein roter Ford Mustang … und sogar Candy Apple Red.«
Er schließt die Augen und presst die Lippen aufeinander, sein kreidebleiches Gesicht ist schmerzverzerrt. Verdrängte Erinnerungen rollen wie eine Dampfwalze über ihn. Er parkiert den roten Mustang auf seinen Oberschenkeln und drückt mit beiden Händen die Ohren zu, während er von seiner Vergangeheit vergewaltigt wird …
»Wenn dir etwas nicht passt, dann verschwindest du einfach, hör endlich auf mit diesem Machtspiel. Unser Sohn Roberto ist schon sieben, er braucht einen Vater, den er spüren kann, der für ihn seelisch erreichbar ist, aber du siehst ihn nicht einmal. Auch mich siehst du nicht.«
»Schluss damit. Du wirst mich jetzt tatsächlich nicht mehr sehen …, ich komme nicht mehr zurück!«, brüllt der Vater. Darauf die Explosion der knallenden Türe.
Ich krieche unter dem Bett hervor, öffne zitternd die Zimmertür und sehe, wie Mama sich schluchzend ins Schlafzimmer verkriecht. Barfuß renne ich dem Papa nach und sehe gerade noch, wie der rote Mustang vom Parkplatz rollt und davonfährt. Ich hetze hinterher, »Papa, Papa«, starre auf die zweimal drei Striche der Stopplichter in der Hoffnung, dass sie aufleuchten … doch das tun sie nicht. Hinter mir höre ich Mama rufen: »Roberto, Roberto«, bis das Heck des roten Mustangs in der Straßenkurve verschwindet.
Ich stolpere, falle hin, schlage mit dem Kopf auf den Asphalt mitten auf der Straße. Das Herz heult schmerzvoll auf …, es wurde soeben gebrandmarkt. Endlich schließt mich Mama in ihre Arme.
Von diesem verdammten Tag an habe ich meinen Papa nie mehr gesehen. Seit diesem Tag habe ich keinen Vater mehr. Das Heck des wegfahrenden roten Mustangs hat sich tief in mein Herz gebrannt und eine Wunde hinterlassen, die nie mehr zu heilen vermochte.
»Papa!«, hört er sich rufen … und erschaudert … »Papa« –erschreckt reißt er die Augen auf und erkennt Fabian, der vor ihm steht. Er schaut um sich, sieht den roten Mustang und realisiert, wo er ist.
Die Wut in Robertos Gesicht zeigt die schmerzende Wunde in seinem Herzen. Einen Moment lang sieht es so aus, als ob er das Auto am Boden zerschmettern oder weit wegwerfen wolle. Doch er beherrscht sich.
Fabian ist vor Schreck erstarrt. Einmal mehr wähnt er sich schuldig, dass sein Vater jetzt so wutschnaubend ist. Die aufsteigende Angst lähmt ihn, er befürchtet, Papa könnte erneut davonlaufen, die ganze Nacht wegbleiben, wie so oft in letzter Zeit. In diesem Moment bemerkt er, wie sich eine Hand auf seine Schulter legt. Er sieht Ricardo neben sich. Beide schauen sie verunsichert zu Fabians Papa, der inzwischen aufgestanden ist. Impulsiv überwindet sich Fabian und fragt aus purer Verlegenheit mit angstvollem Unterton:
»Papa, was ist das: Kändi Äppel Räd?« Er schaut dabei auf den Boden, in den er sich am liebsten verkriechen würde.
Fabian hat öfters erlebt, was kommt, wenn Papa seine Lippen so zusammendrückt und die Mundwinkel nach unten zieht: Wutausbrüche, verletzende Worte, Herumschreien und dann Abhauen, bevor jemand etwas sagen kann. Er glaubt sich schuldig, weil er dieses Auto haben wollte.
Er streckt dem Papa die Hand entgegen: »Ich habe ja schon ein Auto, ich brauche das nicht«, schaut zu ihm auf: »Wenn es dir nicht gefällt, möchte ich es sowieso nicht.«
In diesem Moment kommt Ricardos Vater hinzu. »Mama ist einverstanden« und zu Fabian gewendet: »Du darfst gerne kommen und heute bei uns schlafen. Ich warte am Tisch bei der Scooter-Bahn auf euch.«
Die Worte von Ricardos Vater haben die Spannung etwas gelöst, sodass sich Robertos Gesicht ein bisschen aufhellt, als er Fabian die Hand hinstreckt: »Komm, wir kaufen das Auto, dann kannst du heute bei Ricardo damit spielen.«
»Gefällt es dir denn auch, Papa?« Fabian schaut dabei auf die Hand seines Vaters, die verkrampft das Auto umklammert, als wolle er es zerquetschen. Fabian greift mit der Hand an seine ballernde Brust.
Roberto dreht das Auto dreimal um und meint: »Jein. Von vorne gefällt es mir«, er wendet es nochmals: »Von hinten finde ich es unerträglich, obwohl es sehr speziell ist, mit diesen drei roten Strichen als Stopplichter auf beiden Seiten des bulligen Hecks.«
Roberto hat inzwischen am Stand das Auto bezahlt. Nun drückt er es Fabian genau dort an die Brust, wo es diesen schmerzt: »Es gehört dir. Pass darauf auf, es ist ein ganz spezielles Auto, mit einer eigenartig zuckersüßen Farbe.«
Sein Gesicht verzieht sich dabei, als ob er in eine saure Zitrone beißen würde. Er ergreift Fabians Hand und sagt zu Ricardo gewendet: »Kommt, ich zeige euch etwas.« Er führt sie drei Stände weiter, wo Süßwaren angeboten werden.
»Fabian, schau hier, diese farbigen kandierten Früchte, die du ja so gerne hast.« Roberto stutzt einen Moment, als er sieht, dass Fabian das Auto immer noch an seine Brust drückt. Gleichzeitig bemerkt er, wie sein eigenes Herz pocht.
»Das Auto, der rote Mustang, wurde in Amerika gebaut. In Amerika essen alle gerne Süßigkeiten, da gibt es viele kandierte Früchte, auch kandierte Äpfel.«
Er schaut zuerst auf den roten Mustang, danach zu Fabian: »Kändi Äppel Räd. Kändi sind Süßigkeiten, wie hier der zuckersüße Überzug der Früchte. Dieser zuckersüße Überzug heißt hier ›kandiert‹. Äppel Räd ist die Farbe eines roten Apfels. Kändi Äppel Räd ist die Farbe, die genauso süßlich aussieht wie ein kandierter roter Apfel.«
Fabian schaut das Auto an, dann wünscht er von Papa zu hören: »Und was ist ein Mustang?«
»Ein Mustang ist ein kräftiges Pferd, das in der freien Natur lebt.« Dabei versucht er, die aufsteigende Wut zu unterdrücken. »Das einem auch davongaloppieren kann!«
Zu Fabian gewendet: »Mustang heißt das Auto, weil es kraftvoll ist, wie die freilebenden Pferde, die Mustangs. Das ist der Mythos von der Freiheit und Unabhängigkeit in Amerika. Die Indianer benutzten die Mustangs im Kampf gegen die Weißen, die ihnen ihr Land wegnehmen wollten. Das Auto heißt aber auch darum Mustang, weil es einen Motor mit spezieller Leistungskraft hat, einen V8-Motor.«
»Und was ist V8?«
»V8 ist ein Benzinmotor, der acht Zylinder hat, die V-förmig angeordnet sind, vier rechts und vier links«, dabei bildet er mit seinen beiden Händen ein V.
»Woher weißt du das alles, du hast doch gar keinen Mustang?« Fabian schaut neugierig seinen Papa an.
»Nein, ich habe keinen Mustang, aber mein Vater hatte ein solches Kändi-Äppel-Räd-süßes Auto, der lebte viel lieber in der freien Wildnis als bei uns zu Hause. Darum kenne ich das.« In seiner Stimme klingt ein Unterton mit, der zwischen Verachtung und Begeisterung, Ablehnung und Zuneigung schwankt.
»Ja, was denn?« Robertos Stimme klingt mürrisch, als er jetzt Fabian »Papa?« fragen hört.
Fabian drückt sich sachte an seinen Vater: »Papa, spielst du mit mir und dem roten Mustang, wenn du aus Amerika zurückkommst? Du hast so lange nicht mehr mit mir gespielt.«
»Ja, wenn ich zurückkomme« – ein Hustenreiz unterbricht ihn – »werde ich dir viel über den roten Mustang anvertrauen. Und ich bringe dir einen kandierten roten Apfel aus Amerika mit. Einen in echtem Kändiäppelräd.«
Fabian lehnt sich noch stärker an ihn an und drückt gleichzeitig den roten Mustang an seine Brust. Dieses Versprechen scheint ihn zu beruhigen, er schaut zufrieden das Auto an.
Mittlerweile sind sie bei der Scooter-Bahn angekommen, wo Ricardos Vater bereits auf sie wartet. Fabian hat schon des Öfteren bei Ricardo geschlafen, wie auch Ricardo bei Fabian.
»Du brauchst ja noch deine Schulsachen für morgen.« Roberto streckt Fabian seine Hand hin. »Komm, wir holen sie, dann bringe ich dich zu Ricardo«.
»Ja, bis bald bei uns zu Hause. Wir essen um sechs Uhr, schaffst du es bis dann?«, erkundigt sich Ricardos Vater.
»Ja, bis sechs werden wir da sein«, bestätigt Roberto.
Zu Hause angelangt, springt Fabian sofort zur Mutter: »Schau, Mama, was mir Papa geschenkt hat«, dabei streckt er ihr den roten Mustang hin.
Die Mutter nimmt das Auto entgegen, erbleicht und schaut mit Falten auf der Stirn fragend Roberto an. Dieser zieht kurz die Schultern hoch und sagt ausweichend: »Fabian darf heute bei Ricardo schlafen. Sie wollen noch mit den Autos spielen. Er muss seine Schulsachen mitnehmen.« Darauf verzieht er sich ins Badezimmer.
Schweigend hilft die Mutter Fabian, seine Schulsachen einzupacken und auch gleich die Schulkleider für morgen anzuziehen. Roberto fährt ihn danach zu Ricardo.
»Du weißt ja, dass ich morgen für drei Wochen nach Amerika fliege. Ich werde abends mal anrufen, um zu hören, wie es dir geht.« Er öffnet die Autotür, steigt aus, läuft ums Auto herum und umarmt Fabian flüchtig.
»Wieso bist du so kalt, Papa?«, fragte Fabian nach der kurzen Umarmung und schaut dabei auf den Boden.
»Das meinst du nur. Ich friere nicht, es ist doch echt warm heute.« Dabei streckt er ihm den roten Mustang entgegen: »Pass auf ihn auf beim Spielen, es ist ein mega spezielles Auto.« Bei diesen Worten kneift er seine geröteten Augen zusammen. »Jetzt geh hinein, damit du rechtzeitig beim Essen bist. Tschüss.«
Fabian schaut noch mal zurück und winkt mit dem roten Mustang in der Hand. Eine dumpfe Angst überkommt ihn, als er seinen Papa ins Auto steigen sieht. Er möchte zu ihm springen, mit nach Hause fahren, doch er kommt nicht vom Fleck. Angsterfüllt bleibt er stehen und sieht zu, wie das Auto wegfährt, dann sieht er es nur noch von hinten, bis es in der Kurve verschwindet.
»Ich denke, es geht Papa und Mama besser, wenn wir zwei heute nicht zu Hause sind«, sagt er zum roten Mustang. Seitdem er im Traum aus dem Bett gestürzt ist, belastet ihn eine stetig heftiger werdende Furcht, es könnte ein Unheil geschehen. Irgendetwas, gegen das er sich nicht wehren kann.
Roberto und Margrit sitzen nach dem Abendessen noch am Tisch. Obwohl Margrit ihr Beruhigungsmittel geschluckt hat, ist sie aufgewühlt, rutscht verstört auf dem Stuhl herum. Sie hat sich einen Kaffee zubereitet und er nippt am dritten Glas Bier. Bedrückende Stimmung. Roberto ist angespannt und gereizt, wie so oft in den letzten Jahren. Margrit getraut sich kaum, etwas zu sagen oder zu fragen, denn sie kennt seine launischen und oft verletzenden Reaktionen. Schweigend sitzen sie am Tisch. Morgen wird er im Auftrag seines Arbeitgebers für drei Wochen nach Amerika reisen, wie schon im letzten Jahr.
Margrit versucht Roberto anzuschauen. Sorgenfalten auf der Stirn, beide Ellenbogen auf den Tisch gestützt, die Kaffeetasse mit den Händen umfassend, flüstert sie kummervoll: »Fabian vermisst dich sehr.«
Roberto trinkt sein Bierglas aus, schaut auf und fragt mit empörtem Unterton: »Hat er das gesagt?«
»Nein, aber das sieht doch jeder.«
»Ach, was du alles siehst! Hör endlich auf damit. Ich bin doch so gut wie jeden Tag hier. Dass ich jetzt drei Wochen beruflich wegmuss, ist doch nicht tragisch, da kann ich ja nichts dafür. Meine Berufskollegen sind viel häufiger weg als ich.«
»Er vermisst dich auch dann, wenn du da bist«, und mit vorwurfsvollem Klang in der Stimme fährt sie fort: »Auch wenn du nach Hause kommst, bist du nicht da. Wenn ein neunjähriger Sohn seinen Vater fragt, ob er schon mal in seinem inneren Dschungel gewesen sei, dann ist das alarmierend. Hörst du nicht die Glocken? Warum willst du das nicht sehen? Genügen wir dir nicht mehr? Es scheint, dass wir dir nur noch zur Last fallen.«
»Ich habe weder eine Krankheit, noch brauche ich eine Psychotherapie. Und wenn, dann sicher nicht von einem Neunjährigen, der vom Dschungel träumt und dabei aus dem Bett fällt.«
In diesem Moment läutet das Telefon. Margrit springt auf und läuft hin.
»Nein, nein, wir kommen ihn holen. Ja, wir fahren sofort los«, hört Roberto seine Frau sagen, bevor sie auflegt.
»Das war die Mutter von Ricardo. Fabian sei sehr niedergedrückt, er hat Heimweh und will unbedingt nach Hause. Willst du ihn abholen?«
Robert steht auf. »Ich bin schon unterwegs.«
Die Ablenkung scheint ihm gelegen zu kommen, um sich nicht weiterhin diesem Gespräch und den Fragen stellen zu müssen.
Margrit hat soeben die Küche fertig aufgeräumt, da kommt Roberto mit Fabian zurück. »Fabian hat Heimweh, er möchte lieber zu Hause schlafen«, meldet Roberto, als sie eintreten.
Fabian, mit dem roten Mustang in der Hand, rennt zur Mutter und wehrt sich trotzig: »Nein, ich habe kein Heimweh.« Er klammert sich an seine Mama und schaut hinüber zu seinem Papa: »Ich habe Angst, dass ich wieder abstürze, darum will ich bei euch schlafen. Bitte, Mama, darf ich?«
»Aber das war doch nur ein Traum«, beschwichtigt der Vater, »in Träumen kann alles passieren.«
»Nein, ich bin abgestürzt, es tut mir jetzt noch weh.«
»Du bist nicht abgestürzt, sondern nur aus deinem Bett gefallen«, widerspricht sein Vater und schüttelt dabei den Kopf.
Fabian schweigt, obwohl er gerne noch von seinem Urwald Erlebnis berichtet hätte, doch er traut sich nicht mehr. Er kennt es aus Erfahrung: Bei dieser Stimmlage seines Vaters darf niemand ihm widersprechen, sonst explodiert er.
Margrit versucht abzulenken: »Komm, wir suchen in deinem Zimmer einen Platz für das rote Auto.«
Fabian platziert das Auto auf seinem Schreibtisch. »Da gefällt es mir.«
Der Vater, an den Türrahmen gelehnt, die Hände in den Hosentaschen, belehrt ihn: »Das Auto gehört auf den Boden, da kann es nicht abstürzen. Auf den Tisch gehören deine Schulsachen, um zu lernen. Überwinde dich endlich, mehr zu lernen, statt immer nur zu spielen, sonst bringst du es nie zu etwas.«
Margrit schaut Roberto vorwurfsvoll an: »Warum hilfst du ihm denn nie beim Lernen?«
Roberto schüttelt herablassend den Kopf und verschwindet wortlos im Badezimmer.
Fabian steht mit gesenktem Kopf an seinem Schreibtisch, holt mit der Hand aus, doch kann er den Impuls, das Auto mit aller Kraft vom Tisch zu wischen, im letzten Moment noch unterdrücken.
Die Mutter besänftigt ihn: »Du kannst das Auto hinstellen, wo es dir gefällt. Die Schulsachen finden auch noch ihren Platz.«
»Bitte, Mama, darf ich bei dir schlafen? Ich habe Angst, wieder abzustürzen.«
»Ja, das darfst du. Morgen musst du ja früh um halb acht in der Schule sein, ich bringe dich mit dem Auto hin. Es ist schon spät, beeile dich mit dem Zubettgehen.«
Abschied
Robertos Reise nach Amerika
»Leben bedingt Austausch;
Austausch bedingt Beziehung;
Beziehung bedingt zwei eigenständige Menschen,
die bereit sind, im Austausch zu wachsen.
Austausch ist Geben und Nehmen an einer Grenze,
die sowohl trennt, als auch verbindet.«
Fabian ist schon in der Schule, die Mutter hat ihn hingebracht. Margrit und Roberto sitzen schweigend beim Frühstück. Die Stimmung ist angespannt.
»Wenn nach der Rückkehr dein egoistisches Verhalten immer noch so ist, werde ich nicht mehr mitmachen. Dann verlasse ich dich, Fabian und mir zuliebe.« Margrit sagt das unmissverständlich beim Abräumen des Frühstückstisches mit beherrschter und klarer Stimme, ohne Roberto dabei anzuschauen.
»Bist du so sauertöpfisch, weil ich drei Wochen weg bin?« Robertos Frage klingt zutiefst verletzt.
»Du bist seit Ewigkeiten weg, das weißt du ganz genau«.
»Warum fängst du jetzt damit an, so kurz vor meiner Abreise?« Er schaut sie vorwurfsvoll an und steht dabei auf.
»Seit Jahren versuche ich, mit dir darüber zu reden, aber du weichst ja stets und ständig nur aus.«
»Sorry, aber ich muss jetzt wirklich los, das Flugzeug wartet nicht. Es freut mich, dass du mich zum Flughafen fährst. Können wir das wieder aufnehmen, wenn ich zurückgekommen bin?«
»Du wirst auch dann deine Ausreden finden!« Margrit schaut ihn direkt an und stichelt vorwurfsvoll: »Du scheinst ja erleichtert zu sein, dass du wegfliegen kannst.«
Roberto ist die Situation mehr als peinlich. Er ist sich bewusst, dass sie recht hat, er findet sich durchschaut, was er aber niemals zugeben würde. Auf den Boden blickend, sagt er stattdessen: »Ach, hör doch endlich auf damit, das gehört zu meinem Beruf. Dafür verdiene ich viel und bringe genug Geld nach Hause.«
Roberto greift nach der am Vorabend gepackten Reisetasche und verlässt murrend das Haus. Sein Reisekoffer ist schon im Auto. Margrit nimmt ihre Handtasche, schließt die Haustür und setzt sich ohne Worte ans Steuer.
Stillschweigen. Auch hier im Auto eine angespannte Stimmung. Die Fahrt von Horgen am Zürichsee zum Flughafen dauert etwa vierzig Minuten. Roberto, auf dem Beifahrersitz, schaut aus dem Fenster und versucht die Spannung zu lindern. »Zumindest ist heute schönes Flugwetter«, meint er und dreht gleichzeitig das Radio auf.
»Ja, das Flugwetter ist besser als das Ehewetter.«
Roberto schüttelt mit einer Grimasse mürrisch den Kopf und schweigt.
»Ja, du bringst Geld nach Hause. Aber ich vermisse mehr die Familie und unsere Beziehung als Haus und Geld. Vor allem sorge ich mich um Fabian. Auch in der Schule geht es ihm katastrophal. Doch das scheint dir ja egal zu sein.«
»Bitte hör endlich auf damit. Wenn er zu faul ist zum Lernen, gibt es nun mal ungenügende Noten. Statt dauernd nur mit Autos zu spielen, wäre es besser, er würde seine Hausaufgaben machen.«
»Warum redest du nicht mit ihm darüber? Selbst etwas Negatives von dir zu hören wäre besser, als gar nichts zu hören. Er hat sich schon mehrmals darüber beklagt, von dir weder gesehen noch gehört zu werden.«
Roberto rutscht mal nach links, mal nach rechts auf seinem Sitz. Vorwürfe kann er gar nicht ertragen oder vielleicht weil ihm klar ist, dass sie stimmen. »Das habe ich ihm schon tausendmal gesagt, doch er will ja nicht hören.«
»Wie sein Vater, nur, dass er noch ein Kind ist«, stichelt Margrit weiter.
»Wie sein Vater«, wiederholt Roberto schnippisch mit energischem Kopfschütteln. »Wie sein Vater. Ja, ja, alles Schlechte kommt immer vom Vater und alles Gute von der Mutter.«
»Das habe ich nicht gesagt. Aber siehst du denn nicht, wie er sich krampfhaft anstrengt, von dir gesehen zu werden? Wie er sich um deine Aufmerksamkeit bemüht? Was muss er denn noch tun, damit es gelingt? Drogen konsumieren oder vom Balkon springen?«
»Er sieht mich doch jeden Abend. Was soll das?«
»Auch wenn du hier bist, bist du doch nicht da. Auch wenn er dich sieht, bist du für ihn meilenweit entfernt. Da oder nicht da macht keinen Unterschied. Fabian merkt genauso wie ich, dass du lieber an einem anderen Ort wärst als hier bei uns. Da sein, aber doch nicht anwesend sein ist viel grässlicher, als gar nicht da zu sein.«
Roberto schweigt, wie immer, wenn es ihm zu ungemütlich wird. Das ist sein Mittel, die Macht zu behalten. Auch Margrit schweigt.
In Sichtweite des Flughafens bricht Roberto das Schweigen, doch nur um zu sagen: »Bitte fahre da vorne rechts direkt zur Abflughalle, ich bin spät dran, der Flug ist um zehn vor zehn und wartet nicht.«
»In unserer Ehe ist es nicht zehn vor zehn, sondern zehn vor zwölf und ich warte auch nicht!« Margrit hält vor der Abflughalle und drückt den Knopf für den Kofferraum, dann schaut sie Roberto schweigend und fragend an. Resignation, Angst und Wut stehen ihr ins Gesicht geschrieben, dazu fliegen Fragezeichen aus ihren Augen. Roberto versucht, der entstandenen Spannung schnellstens zu entkommen, die aufgekommenen Schuldgefühle zu verdrängen.
»Danke, dass du mich hergefahren hast. Ich melde mich, wenn ich über den Teich bin.«
»Kann ich Fabian noch etwas von dir ausrichten?«
»Nein … doch, sag ihm Adieu von mir.«
Roberto drückt Margrit ein erzwungenes Küsschen auf die Backe, steigt aus, holt seinen Koffer aus dem Kofferraum und winkt, bevor er zügigen Schrittes auf die Abflughalle zu hastet. Kurz blickt er zurück und winkt noch einmal. Margrit schaut ihm lange hinten nach. Tränen rollen über ihre Wangen, ohne dass sie wirklich weint. Ein ungutes Gefühl hat sie überkommen, welches sie bis jetzt nicht gekannt hat.
Roberto atmet erleichtert durch. Endlich habe ich das hinter mir. Das Check-in geht schnell, muss noch auf die Toilette. Beim Händewaschen sehe ich im Spiegel meine Augen, aus denen meine Gedanken plaudern: »Ja, ich freue mich, über den Teich zu fliegen, so bekomme ich Distanz zu all den privaten Erwartungen und Verpflichtungen, aber vor allem freue ich mich auf die Woche mit Theres. Ob sie wie vereinbart kommen wird? Andrerseits sorge ich mich um Margrit, ich sehe, wie sie leidet, ihren kummervollen Gesichtsausdruck, ich höre ihre vorwurfsvollen Worte, die nach Hilfe schreien. Es ist mir auch bewusst, dass sie nur mithilfe von Beruhigungsmitteln den Alltag übersteht. Wenn ich zurück bin, werde ich nochmals versuchen, auf sie zuzugehen. Jedoch irgendetwas steht unsichtbar dazwischen, warum gelingt es mir nicht, das zu überwinden? Wieso wende ich mich dauernd anderen Frauen zu? Um nicht mehr daran denken zu müssen? Was will ich denn vergessen?«
Margrit hockt da im Auto und zittert am ganzen Leib, sie hat Schweißausbrüche und getraut sich kaum, den Motor zu starten. So entschließt sie sich, nicht nach Hause, sondern zu ihrer Schwester Helene zu fahren in der Hoffnung, dass diese zu Hause ist. Sie dreht den Zündschlüssel und fährt los.
Helene, die in Zürich-Höngg wohnt, öffnet Margrit die Tür.
»Mein Gott, wie siehst du denn aus, was ist passiert?«, begrüßt sie Margrit. Margrit umarmt ihre Schwester und lässt in diesem Moment ihren Tränen freien Lauf. Sie weint, ohne ein Wort zu sagen. Helene lässt es schweigend zu, umarmt Margrit ebenfalls, noch vor der Wohnungstüre. Sie kennt Margrits Eheprobleme seit Fabians Geburt.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, klagt Margrit schluchzend, »er ist so eiskalt zu mir und auch zu Fabian.« Sie löst sich aus der Umarmung. Helene nimmt sie an der Hand: »Komm erst mal rein.«
In der Stube setzt sie sich aufs Sofa. Helene hockt sich daneben und schaut sie teilnahmsvoll an.
»Vielleicht solltet ihr euch mal eine Weile trennen«, meint sie.
»Das sind wir ja zurzeit. Er ist heute für drei Wochen nach Amerika abgereist, wie schon im letzten Jahr. Aber auch wenn er hier ist, sind wir getrennt, er behandelt uns wie Luft.«
»Ich meine, für eine längere Zeit trennen, um euch klar darüber zu werden, wie es weitergehen soll. Warum besucht ihr nicht mal eine Paarberatung? Es gibt da heute vielversprechende Therapieformen.«
Margrit hat sich etwas beruhigt und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. »Das haben wir einmal versucht. Roberto würde nie in eine Therapie einwilligen. Als ich ihn vor Kurzem darauf ansprach, meinte er abschätzig, ich könne ja eine machen, er brauche das nicht, er sei schließlich kein Psychopath. Er kann und will nicht über Probleme reden, weder mit mir noch mit einem Therapeuten.« Margrit atmet tief durch und meint nach kurzer Pause: »Er hat auch keine Freunde, nur Geschäftskollegen. Er tut nur, was er will, und das rücksichtslos. Oft habe ich das Gefühl, er leidet unter etwas, das er verdrängt. Er handelt oft wie unter einem Zwang, dem er unterworfen ist.«
»Das klingt aber sehr egoistisch. Er scheint narzisstisch veranlagt zu sein. Hat er eine Freundin?«
»Das befürchte ich, aber ich weiß es nicht. Es gibt viele Anzeichen, die dafürsprechen. Ich habe vor Jahren eine Therapeutin aufgesucht, als es mir seelisch hundsmiserabel ging. Roberto begleitete mich dreimal dorthin. Sie stellte ihm dabei viele Fragen und meinte, wie du jetzt auch, dass er dringend seine narzisstische Veranlagung therapieren müsse. Sie empfahl ihm einen Psychologen, der darauf spezialisiert sei. Aber er weigerte sich. Er ist nie hingegangen, zumindest weiß ich nichts davon. Was heißt narzisstisch eigentlich?«
»Selbstsüchtig. Das sind Menschen, die nur auf sich selbst bezogen sind und nur auf ihre eigenen Gelüste und Bedürfnisse ausgerichtet. Narzissten sind Menschen, die andere vernachlässigen, die egoistische und egozentrische Wesensmerkmale zeigen.«
Helene rückt noch näher an Margrit heran, legt ihren Arm um ihre Schultern und erklärt: »Das ist eine Krankheit, eine Persönlichkeitsstörung. Ich werde oft in der Praxis damit konfrontiert. Der Eigennutz geht ihnen vor jedes Gemeinwohl und wenn sie lieben, dann nur, um selbst geliebt zu werden. Ein Narzisst liebt nicht dich, sondern er missbraucht dich, um sich selbst zu lieben. Er kann auch sehr arrogant und rücksichtslos sein. Er holt sich zwanghaft überall das, was er möchte und zu brauchen glaubt, ohne Rücksicht auf dadurch entstehende zwischenmenschliche Schäden. Was ihn daran hindert, stößt er weg.«
Beide schweigen einen Moment lang.
Schließlich bestätigt Margrit mit einem Kopfnicken: »Da kommt mir einiges bekannt vor, aber das kann ich nicht ändern.«
»Nein, du kannst ihn und sein Verhalten nicht umändern. Was aber in deinen Möglichkeiten liegt, ist, wie du darauf reagierst, was du damit machst. Wenn er nicht bereit ist, einen Beitrag zu leisten, kannst nur du eine Änderung anstreben, indem du ihn verlässt. Da ist aber auch noch Fabian und darum ist das Ganze gar nicht so einfach, wie es sich anhört.«
Nach kurzer Pause ergänzt sie: »In meiner Ausbildung zur Arztgehilfin haben wir einige Einblicke in solche Themen erhalten, weil sie auch der Hintergrund vieler körperlicher Krankheiten sind. Mein Chef in der Hausarztpraxis ist oft damit konfrontiert, also mit den Folgen davon. Er arbeitet mit einem Psychiater zusammen. Roberto müsste bereit sein, eine längere Psychotherapie zu beginnen, sonst wird er sein Verhalten erst unter dem Zwang von schweren Schicksalsschlägen ändern können. Wenn er das aber nicht will, bleibt alles beim Alten. Narzissten haben eine enorme Fähigkeit, sich mit emotionaler Kälte aus allen ihnen unangenehmen Situationen geschickt herauszumanövrieren. Häufig ist erst ein zwingendes Leiden nötig, um eine Veränderung herbeizuführen.«
Margrit hat sich entspannt. Es scheint sie zu beruhigen, jetzt einen Grund für Robertos Verhalten zu erkennen. Zumindest gibt es jetzt ein Wort dafür: »Narzissmus«, hinter dem sie die Leiden der vergangenen neun Jahre verstecken kann. Sachte lehnte sie ihren Kopf an Helenes Schulter.
»Woher kommt denn ein solch narzisstisches Gebaren? Bevor Fabian auf die Welt gekommen ist, war das nicht so.«
»Der Psychologe, mit dem mein Chef zusammenarbeitet, hat viel Erfahrung damit, er hat ein Buch darüber geschrieben. Ich gebe es dir gerne zum Lesen. Du kannst sicher besser damit umgehen, wenn du die Zusammenhänge kennst.«
»Aber das wird ihn auch nicht umwandeln.«
»Nein, da müsste er schon selber etwas tun. Aber es kann dir helfen, ihn besser zu verstehen. Es scheint, dass euer Kind Fabian ihn unbewusst konfrontiert mit etwas, das er vermutlich selbst als Kleinkind erlebt hat. Wenn er stinkig auf Fabian reagiert, so meint er unbewusst nicht Fabian, sondern das, was er selber erlebt hat, oft sogar im gleichen Alter. Narzissmus entsteht zumeist in der frühen Kindheit. Es kann sein – das ist die Meinung der Psychologie –, dass er im Kindesalter nicht genügend Einfühlungsvermögen und Bestätigung erfahren hat. Dies kann dahin führen, dass er als Erwachsener vorwiegend sich selbst zugewandt ist. Eine Beziehung mit einem Narzissten ist geprägt durch ein gestörtes Austauschverhältnis, vom Geben des Partners und vom Nehmen des Narzissten. Ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen zu finden ist hier nicht möglich, weil das notwendige Mitgefühl aufseiten des Narzissten fehlt. Sein fehlendes Selbstwertgefühl führt dazu, dass er ständig auf Bestätigung von außen angewiesen ist. So ist er immer auf der Suche nach Bestätigung. Männer suchen diese Bestätigung dann oft bei anderen Frauen, immer wieder aufs Neue.«
Margrit schnäuzt sich mit zitternden Händen die Nase, trocknet ihre Augen und steht dabei auf.
»Danke, Helene, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Die aufklärenden Worte haben mir gutgetan. Ich möchte zu Hause sein, bevor Fabian aus der Schule kommt. Er leidet schon genug darunter und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm das alles erklären kann.«
»Ja, vielleicht können wir in den nächsten Tagen mal etwas zusammen unternehmen. Melde dich, wenn du Lust und Zeit hast.«
»Danke für dein Angebot. Du bist die Einzige, mit der ich darüber reden kann. Ich melde mich gerne.«
Roberto schaut gedankenverloren aus dem Flugzeugfenster. Vor dem Hintergrund der weißen Wolken sieht er das Gesicht von Theres, die er vor sechs Monaten in einer Bar kennengelernt hat. Die intimen Stunden, die er mit ihr verbrachte, habe ihn seitdem nicht mehr losgelassen und die Erinnerung daran erweckt auch jetzt seine Begierde. In diesem Zustand rücken alle Probleme weit von ihm weg und es ist ihm dann all das ihn aktuell belastende egal. Wie ein Süchtiger alles tut, um an die Droge heranzukommen, ist auch Roberto von seiner Sucht getrieben, der Sucht nach Anerkennung, Sinnlichkeit und Sex. »Ob Theres wirklich wie verabredet für eine Woche nach New York kommen wird?«, kreisen die Gedanken erneut in seinem Kopf herum. »Das Flugticket habe ich ihr geschenkt, also wird sie sicher kommen.«
Seit der Geburt von Fabian vor neun Jahren hat sich Roberto immer wieder in attraktive Frauen verliebt, doch interessiert ihn dabei nur die von ihren Körpern ausgehende sexuelle Sinnlichkeit, denn diese lässt ihn seine Probleme für kurze Zeit vergessen. Die Distanz zu seiner Frau Margrit hat sich dagegen immer mehr vergrößert. Wenn die Sucht ihn treibt, setzt er diese rücksichtslos um, wie auch jetzt mit Theres. In diesem Zustand empfindet er seine Familie nur noch als Hindernis. Ein Hemmnis dafür, seine Sucht stillen zu können.
Roberto ist nach neun Stunden Flugzeit planmäßig um zwei Uhr nachmittags Ortszeit in New York gelandet. Ein Taxi fährt ihn zu seiner Unterkunft, dem Country Klub Hotel, das im Rahmen der Traditionen eines privaten Klubs mit viel Gastfreundschaft ausgestattet ist. Sein Zimmer mit Sicht auf die Gartenanlage ist sehr geräumig und hat einen separaten Eingang auf der Rückseite des Hotels. Vom Straßenlärm ist hier nicht viel zu hören und zu seinem Arbeitsort sind es nur fünfzehn Minuten zu Fuß. Das Hotel hat seine Firma gebucht, wie schon im letzten Jahr.
Nachdem er sich eingerichtet hat, setzt er sich aufs Sofa und sendet Margrit eine kurze Nachricht über die Ankunft. Als er ihr Bild auf dem Display sieht, fesseln ihn Erinnerungen.
»Wie mag es ihr und Fabian gehen?«, murmelt er vor sich hin. Dabei plagen ihn erneut sein Gewissen und Schuldgefühle. Er entschließt sich, Margrit einen Brief zu schreiben, holt dazu Schreibpapier und Stift.
»Liebe Margrit, aus dieser riesengroßen Distanz realisiere ich deutlich, wie sehr Ihr unter meinem egoistischen und rücksichtslosen Verhalten leidet. Es tut auch mir weh und doch kann ich nicht anders. Viele Male hatte ich mir vorgenommen, mein egoistisches Verhalten in den Griff zu bekommen, in der Hoffnung, dass alles wieder gut wird, wie vor neun Jahren. Doch es ist mir nie gelungen. Oft kam ich mit dem Vorsatz nach Hause, mir Zeit zu nehmen, für Fabian sowie auch für Dich und unsere Ehe. Aber jedes Mal, wenn ich nach Hause kam und die Haustür öffnete, flogen all diese Vorsätze davon. Die gleiche Unzufriedenheit, die gleiche Distanz holten mich immer wieder ein. Nichts mehr ist dann positiv zu Hause. Ich fühle mich eingesperrt und will nur noch ausbrechen. Ich hoffe, es gelingt mir, wenn ich wieder zurück bin.«
Den Brief verstaue ich im Koffer, hole ein Bier aus dem Kühlschrank und lehne mich zurück. In einem Ohr widerhallen Margrits Worte am Flughafen: »In unserer Ehe ist es nicht zehn vor zehn, sondern zehn vor zwölf und ich warte auch nicht!« Wenn sie mich loswerden will, dann kann ich beruhigter zu Theres gehen.
Die Bierflasche ist halb leer. Da dröhnt in meinem anderen Ohr Thereses Stimme beim letzten Treffen: »Es bleibt das Gefühl zurück, dass du nur an meinem Körper interessiert bist, dass dein Herz verschlossen ist, was mich ausschließt. Es fehlt mir etwas Wichtiges!«
Verunsichert stehe ich auf, mag nicht mehr sitzen, was meint sie nur damit? Ob sie wirklich kommen wird? Ich leere die Flasche und schaue aus dem Fenster. Viele Gedanken und Bilder drehen sich im Kreis und tanzen mal frostig mal hitzig, ein Wechselbad der Gefühle. Um diesen zermürbenden Gedankenkreislauf zu durchbrechen, werde ich jetzt nach draußen gehen und durch die Straßen schlendern. Aus dem Hotel bin ich schon auf der Straße und mittendrin in der New Yorker Hektik, dem Lärm, dem Chaos, der überbordenden Energie. Der lärmende Fluss der Gedanken strömt durch mein Hirn, wie der chaotische Fluss der Autos durch die Straßen.
Genauso waren meine ersten Eindrücke in New York vor einem Jahr: faszinierend, überwältigend, aber auch bedrohlich. Das ist auch jetzt noch so, obwohl ich mich doch schon ein bisschen auskenne in diesem Dschungel. Aber die Gedanken verfolgen mich auch hier. Die sinnliche Sehnsucht nach Theres zwingt mich, die Schuldgefühle meiner Familie gegenüber foltern mich. Dieses Pingpong der Gefühle ist so zermürbend. Das Ja von gestern wechselt sich dauernd ab mit dem Nein von morgen. Gestern war ich davon überzeugt und entschlossen, die Scheidung einzureichen und zu Theres zu stehen. Morgen bin ich davon überzeugt und entschlossen, mit Theres Schluss zu machen und ganz bei meiner Familie zu bleiben.
Da ist es ja immer noch, das Schaufenster mit erotischer Damenwäsche, das mich zum Stehenbleiben zwingt. Das Betrachten der Auslage lenkt mich ab und öffnet ein Fenster in meine Fantasie-Welt. Da ist aber auch mein Spiegelbild im Fenster, das mich anstarrt. »Schau nur nicht so grimmig-blöd. Gestern hü und morgen hott, nimm endlich die Zügel in die Hand, du Glaskopie. Jetzt verschwinde, ich will was anderes sehen.«
Sie verschwindet nicht. Es rumort in mir. Kämpft von mir aus, wo ihr wollt, aber nicht mehr in mir drin. Ihr habt mich genug auseinandergerissen, pausenlos, schon neun Jahre lang, jeden Tag. Ein Polizeiauto fräst hupend und mit Blaulicht durch die Scheibe und die Glaskopie. Wie lange machen wir zwei diese Zerrissenheit noch mit? Ich blinzle mir zu.
»Roberto, du suchst da, wo es nicht ist, das ist Sucht.« »Sucht? Ich bin nicht süchtig. Ich suche Ablenkung, die werde ich nächste Woche finden, wenn Theres da ist. Und wenn sie nicht kommt, dann finde ich hier eine andere.«
»Du suchst, ohne zu wissen was, so geht die Sucht weiter.«
»Das geht dich nichts an, lass mich gefälligst in Ruh’!« Verärgert drehe ich mich um und schlendere weiter.
Theres
Theres besucht Roberto in New York
»Wer nur nimmt, ohne zu geben,
schließt andere aus, aus seinem Leben.
Irgendwann merkt man betroffen,
man hat sich selbst eingeschlossen.«
Dieses steife Leinentuch gehört nicht mir und es deckt sogar meinen Kopf zu, eklig. Wieso kann ich es nicht entfernen, wieso kann ich mich nicht bewegen, keinen Millimeter? Wie lange liege ich schon hier, ist es Tag oder Nacht? Liege ich im Wachsfiguren Kabinett? Da sind doch Stimmen, die werden mich sicher sehen und fragen …, aber wenn sie nicht unter das Tuch schauen? Wieso kann ich meinen Arm nicht heben, nicht laut schreien? Die müssen mich doch sehen. Da sind eine Männerstimme und eine Frauenstimme, doch die Reden eine andere Sprache. Endlich sehen sie mich. Sie ziehen mir das fremde Leinentuch vom Kopf … aber ich sehe niemanden, nur zwei große schwammige Wolken und eine kleine. Ich verstehe die Sprache nicht und sie hören die meine nicht. Mein Versuch zu Schreien scheitert, sowie der Versuch mich zu bewegen. Jemand berührt meine Hand, ergreift sie, drückt sie. Das ist eine kleine Hand, eine Kinderhand. Ich drücke zurück, aber das geht nicht. Höre eine fremde Kindersprache, deren Ton ich doch kenne. Die Stimmen verstummen, die kleine Hand lässt los … Nein, nicht weggehen. Wieder ziehen sie das fremde Leinentuch über den Kopf. Schritte entfernen sich, eine Tür springt ins Schloss … Totenstille im ganzen Universum!
Ein Ruck schießt durch den Oberkörper, er schnellt empor, reißt sich das Leinentuch vom Kopf und schnappt nach Luft mit weit aufgerissenem Mund und starrenden Augen. »Gott sei Dank ist das nicht wahr!«, ruft er befreit aus, als er realisiert, dass er im Bett in seinem Hotelzimmer liegt. Erleichtert atmet er aus und lässt sich auf den Rücken fallen. Er bewegt die Beine, hebt beide Arme über den Kopf, kreist mit den Händen. »Verdammt noch mal, was habe ich denn da geträumt?«, hört er sich sagen. Noch verwirrt von dem erlebten Traum, holt er sich ein Glas Wasser und leert es gierig in einem Zug. Als er sich daraufhin erneut hinlegt, schläft er sofort ein.
Roberto ist nervlich angespannt und aufgeregt an diesem schwülen Samstagmorgen. Nach dem Traum hat er noch lange geschlafen. Die Uhr zeigt jetzt zehn Uhr. Das im Traum Erlebte lässt ihm aber weiterhin keine Ruhe, er kann es nicht verdrängen, so sehr er es auch versucht.
Heute ist der Tag, an dem Theres kommt. Ankunft kurz nach achtzehn Uhr am John F. Kennedy Airport. Er sitzt im Hotelrestaurant am Frühstückstisch und genießt das reichhaltige Buffet. In seiner Vorfreude auf ihr Kommen stellt er sich lebhaft vor, wie er ihr am Flughafen begegnen wird. Welchen sexy Sommerrock wird sie wohl tragen? Mit etwas darunter? Er liebt es, wenn sie ihren sinnlichen Körper so bekleidet, dass er ihn erahnen muss. Von dieser erotischen Anziehung ist er gefangen. Wenn solche Bilder von ihm Besitz ergreifen, vergisst er alles um sich herum, sowohl die aktuellen Probleme als auch einen Traum wie den von vergangener Nacht. Die Sucht hat ihn dann fest im Griff. Diese Gedanken und Bilder, wenn sie erst einmal erweckt sind, lassen ihn dann nicht mehr los. Sie steigern noch sein unstillbares Verlangen, bis er es kaum noch zügeln kann.
Landung mit fünfzehn Minuten Verspätung liest er in der Ankunftshalle des Airports.
Endlich, da kommt sie. Sie trägt dieselbe weiße Bluse, welche sie anhatte, als sie sich kennenlernten. Die rauchgraue Farbe ihres BHs ist unter dem leicht durchsichtigen Stoff deutlich zu erkennen und der gelbe Sommerrock betont ihren reizvollen Körper. Ihre dezent geschminkten Lippen lächeln und ihre leuchtenden großen Augen schauen ihn erwartungsfroh an.
»Endlich«, haucht er, »ich habe dich vermisst. Wie war der Flug?«.
Theres stellt den Koffer ab und umarmt ihn zur Begrüßung.
»Es war ein langer Flug, jedoch problemlos. Ich habe sogar ein wenig geschlafen. Doch nun bin ich erleichtert, dass ich stehe und mich bewegen kann, vor allem aber, dass du mich abholst. Ich bin ja so gespannt auf diese Woche.«
Roberto umarmt sie schweigend. Er ergreift den Koffer, legt einen Arm um ihre Hüfte und schlendert mit ihr auf den Ausgang zu.
Im Taxi spricht Roberto kaum ein Wort. Seine Augen bleiben gebannt auf ihren Körper gerichtet. Er kann es kaum erwarten, mit ihr allein zu sein.
Etwas verunsichert sagt Theres: »Ich war noch nie in New York, bin gespannt, was du mir alles zeigen wirst«. Sie legte dabei ihre Hand auf seinen Oberschenkel.
Im Hotel angekommen, bereitet Roberto sofort ein Willkommensgetränk, er kennt ihre Vorlieben: ein Gläschen Champagner demi-sec. Das hat er in seiner Zimmerbar schon vorbereitet. Mit zwei Gläsern in den Händen bewegt er sich auf Theres zu, reicht ihr eines davon und prostet ihr zu: »supertoll, dass du mich besuchst, ich vermochte es kaum zu erwarten.« Theres streckt ihm ihr Glas entgegen: »Ich habe bis jetzt nicht ernsthaft angenommen, dass es funktionieren wird.« Sie kommt zwei Schritte auf ihn zu, küsst ihn flüchtig auf den Mund und setzt sich dann gemächlich auf das Sofa. Roberto platziert sich ihr gegenüber im Lehnsessel. Zwischen ihnen steht ein niedriger Salontisch. Genauso saßen sie vis-à-vis, als sie sich in einer Bar kennenlernten, realisiert er.
Das Prickeln ist jetzt nicht mehr nur im Champagnerglas, sondern auch in der Atmosphäre. Einen Moment lang betrachten sie sich wortlos und verunsichert, bis Roberto das Schweigen bricht: »Diese betörende Bluse hast du getragen, als wir uns kennenlernten. Sie betont deine Schönheit und lässt erahnen, was sich Magisches darunter verbirgt.« Er guckt dabei nicht in ihre Augen, nicht auf die Bluse, sondern auf das, was die geöffneten obersten zwei Knöpfe freilegen. Die wundersame Wirkung, die von dort ausgeht, lässt seine Augen glänzen.
Theres hatte schon beim ersten Treffen herausgefunden, auf was Roberto reagiert. Schweigend genießt sie diese Wirkung und beobachtet ihn. Langsam hebt sie ihr rechtes Bein, um es über dem linken abzulegen, wobei sie etwas mehr ausholt als nötig. Ihre Oberschenkel öffnen sich einen Moment lang und lassen einen kurzen Einblick zu. Roberto schaut gebannt hin und sagt mit flüsternder Stimme: »Es ist aufregend, dich zu sehen.« Nach kurzer Pause ergänzt er: »Wenn du nicht da bist, sehe ich dich oft in meinen Träumen. Die Bilder aus der Erinnerung wecken die Sehnsucht nach dir und lassen mich nicht mehr schlafen. Am liebsten möchte ich dann mit einem Düsenjet zu dir fliegen.« Er nippt an seinem Champagner.
Theres beugt sich vor und streckt ihm ihr Glas entgegen. »Auf uns«, flüstert sie ihm zu und lehnt sich gelassen zurück, wobei sie verführerisch lächelt. Sie genießt es, zu sehen, wie Robertos Augen hypnotisiert auf die Bewegung ihrer Beine starren, um das zu erhaschen, was vielleicht einen Moment lang freigelegt sein könnte: ein kurzer Einblick in das Geheimnis des Dazwischen. Es scheint ihr Vergnügen zu bereiten, sein entstehendes Verlangen und die Begierde wahrzunehmen. Roberto bemerkt die in seinen Lenden aufkommende Wärme, reagiert aber gleichzeitig verunsichert bei dem Gedanken, diesem sinnlichen Rausch ausgeliefert zu sein.
»Möchtest du noch einen Drink?«, fragt Theres.
»Nein danke, ich bin schon betrunken von deinem Anblick.«
»Ein wohliger Rausch«, haucht Theres und streicht mit der Zunge über die Lippen. »Wie viele Promille sind erlaubt?«
»Ja, der schönste, den es gibt. Promille unbeschränkt.«
Theres schlüpft aus ihren Sommerschuhen mit den halbhohen Absätzen.
»Ein behagliches Zimmer hast du hier.« Sie lehnt sich ganz zurück, stellt ihre beiden Füße auf den Sofa-Rand, wobei ihr Rock etwas nach oben rutscht. »Wie gefällt dir deine Arbeit hier?«, fragte sie und beobachtet ihn.
Robertos Augen quellen fast über bei diesem Anblick. Verunsichert stammelt er: »Mit der Arbeit hier bin ich zufrieden. Ich kann mir auch vorstellen, länger hierzubleiben … mit dir zusammen!«
Theres lächelt schelmisch, stellt ihre Füße zurück auf den Boden, deponiert ihr Glas auf dem Salontisch und steht auf. Mit fragendem Blick schaut sie ihn an. Roberto steht ebenfalls auf, stellt sein Glas ab, bewegt sich auf sie zu. Er legt seine Hände an ihre Hüften und zieht sie resolut zu sich heran. Auch Theres reagiert auf ihr brennendes Lendenfeuer, schmiegt sich noch enger an ihn. In dieser wollüstigen Umarmung finden sich ihre Lippen. So stehen sie eine Zeit lang mit tastenden Händen da und genießen die erregende Berührung. Roberto löst sich schließlich aus der Umarmung und sucht ihre Haut unter der Bluse. Theres‘ Hände schieben sich unter sein Hemd.
Robertos sexueller Drang hat ihn völlig im Griff. Er strebt vorwärts, dem Lustempfinden ausgeliefert. Begierig öffnet er ihre Bluse und den Reißverschluss ihres Rockes, dreht die Musik etwas auf, entkleidet sich, zieht sie zum Sofa.