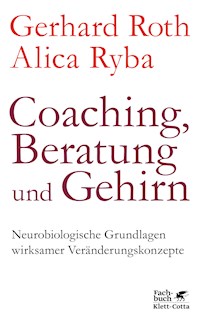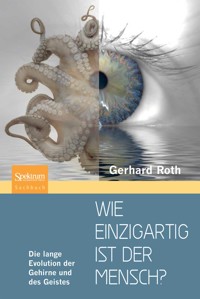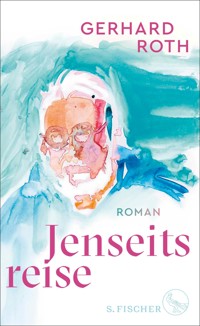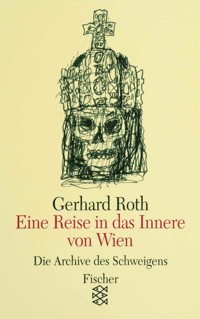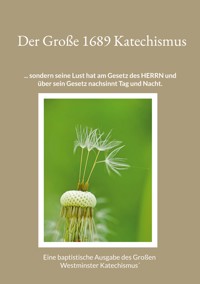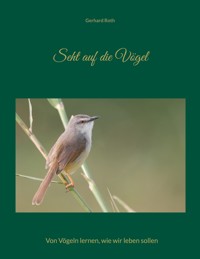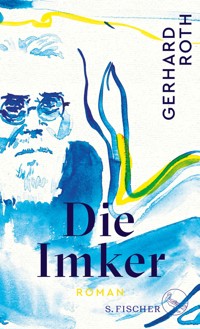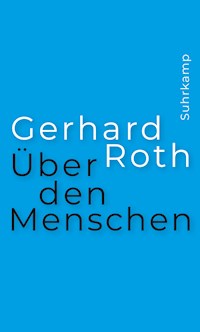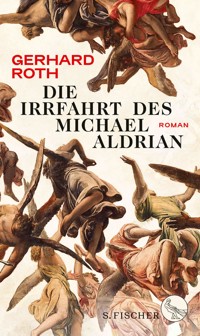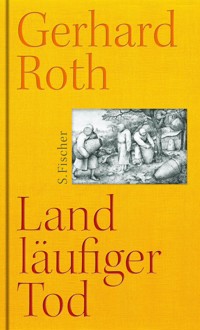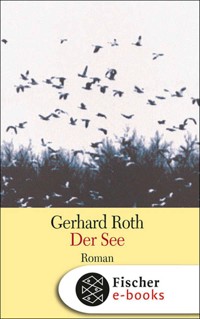
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Paul Eck ist Vertreter für pharmazeutische Produkte. Überraschend erhält er einen Brief von seinem Vater, den er seit der Scheidung seiner Eltern nicht gesehen hat, den er nie wirklich kennengelernt hat. Der Vater lädt ihn ein zu einem Besuch am Neusiedler See. Trotz großer Vorbehalte macht sich der Sohn auf die Reise. Doch am Tag seines Eintreffens verschwindet der Vater spurlos, bevor die beiden sich begegnen. Es wird ein Bootsunfall auf dem See vermutet, dessen eigentümliche meteorologische und geographische Gegebenheiten berüchtigt sind. Der Sohn spürt seinem Vater nach und versucht, ihn – oder wenigstens seinen Leichnam – ausfindig zu machen. Er muß erkennen, daß sein Vater in allerlei dunkle Geschäfte und windige Vorhaben rund um den See verstrickt war. Bei den Anwohnern des Sees macht der Sohn sich mit den falschen Fragen zum falschen Zeitpunkt rasch unbeliebt, seine Suche wird keineswegs unterstützt, sondern nachdrücklich behindert. Gerhard Roths handlungsreicher und suggestiv erzählter Roman nimmt Elemente der klassischen Detektivgeschichte auf. Sein angeschlagener Held – Eck ist tablettensüchtig – gerät in Verdacht, seinen Vater beseitigt zu haben. Als schließlich eine einzelne Hand aus dem See geborgen wird und die Polizei ihn ständig observiert, wird die Situation immer bedrohlicher. Alles steuert auf ein dramatisches Finale zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 246
Ähnliche
Gerhard Roth
Der See
Roman
Fischer e-books
»Sie lebten wie blinde Männer in einem großen Raum, nur das erfassend, was mit ihnen in Berührung kam (und selbst das nur unvollkommen), doch unfähig, die allgemeine Gestalt der Dinge zu begreifen. Der Fluß, der Wald, das ganze große Land, das vor Leben bebte, war wie eine große Leere. Sogar der strahlende Sonnenschein enthüllte nichts Faßliches. Dinge tauchten vor ihren Augen auf und verschwanden in zusammenhangloser und zielloser Weise. Der Fluß schien von nirgendsher zu kommen und nirgendshin zu fließen. Er floß durch eine Leere.«
(Joseph Conrad, »Ein Vorposten des Fortschritts«)
Allem war das Gefährliche genommen, oder besser, das Gefährliche war versteckt unter einer verlogenen Unschuld. Es lag an uns, sich entweder dem Außenwerk anzupassen und nützliche Staatsbürger zu werden, oder nach dem Gefährlichen zu graben und sich dabei zu verbrennen.
(Peter Weiss, »Gegen die Gesetze der Normalität«)
»Und um die Richtigkeit seiner Beobachtungen zu verifizieren, benutzte er sich selbst als psychologisches Präparat, schnitt sich bei lebendigem Leibe auf, experimentierte mit sich, legte Fisteln und Fontanellen an, unterwarf sich unnatürlicher, oft widerlicher geistiger Diät, dabei aber genau die persönlichen Observationsfehler beachtend und so vermeidend, sich selbst oder sein Leben für die anderen zur Norm zu erheben.«
(August Strindberg, »Am offenen Meer«)
1.Der Brief
Am 10. August, es war der Todestag seiner Mutter, die Selbstmord begangen hatte, fand Paul Eck, als er von einem Spaziergang durch die Triester Innenstadt in sein Hotel zurückkehrte, im Abholfach einen Brief, aus dem hervorging, daß sein Vater ihn zum Segeln einlud. Eck hatte seinen Vater zum letzten Mal vor dreißig Jahren bei der Scheidung seiner Eltern gesehen. Wie aus dem Poststempel ersichtlich, war der Brief schon vor zwei Wochen an seine Wiener Adresse geschickt worden, aber dann auf dem Nachsendeweg in irgendeinem italienischen Postamt liegengeblieben. Was Eck abstieß, war weniger die flüchtige Handschrift als der Umstand, daß der Brief auf dem Geschäftspapier der Firma für Jagdwaffen- und Anglerausrüstung, die seinem Vater gehörte, geschrieben war. Zuletzt hatte sich sein Vater nach dem Begräbnis von Pauls Mutter an ihn gewandt, um ihm mitzuteilen, daß er weiterhin sein Medizinstudium bezahlen werde.
Da der Brief also vor einiger Zeit abgeschickt worden war, erschien es Eck, als habe er schon lange über den Inhalt nachgedacht, und die Abneigung, die er empfand, kam ihm wie das Ergebnis gründlicher Überlegungen vor. Insgeheim hatte er immer auf einen Brief seines Vaters gewartet, um sich mit Verachtung für die Gleichgültigkeit zu rächen, die ihm dieser entgegengebracht hatte. Kurz nach dem Tod seiner Mutter brach Eck, der gerade die Anatomieprüfung bestanden hatte, das Medizinstudium ab und übernahm die Vertretung einer pharmazeutischen Firma. Seither war er ein Reisender. Er erinnerte sich jetzt an eine Bootsfahrt mit dem Vater, bei der sie im Schilf umgestürzt waren. Eck sah sich auf dem Grund des Sees im braunen, undurchsichtigen Wasser liegen, und er erlebte mit unendlicher Langsamkeit wieder, wie sich das Boot über ihn wälzte und sein Unterarm, der im Schlamm steckte, mit einem bis dahin unbekannten Schmerz aus der Gelenkpfanne des Ellbogens sprang. Er war damals sechs Jahre alt gewesen. Jetzt, in der Hotelhalle, erschien es ihm, als sei dieser Schmerz nie vergangen. Jedenfalls blieb sein Gelenk halb steif, ohne daß es ihn behinderte. Eck steckte den Brief ein und trat in den Lift. Von seinem Hotelzimmer aus sah er den Hafen und die Fischhalle mit der großen runden Uhr, den Hügel im Osten, den Leuchtturm, und im Westen die langgestreckten und hohen Gebäude der Anstalt für Geisteskranke des berühmten Professors Basaglia.
Er nahm gewohnheitsmäßig zwei Tabletten Nootropil ein, um, wie er sich sagte, »besser denken zu können«. Insgeheim hatte er gehofft, der Brief käme von Doris, die verschwunden war, seit sie ihm vorgeworfen hatte, daß er ihr mit seinen Dienstreisen »ihre Jugend stehlen« würde. Er wollte jedoch nicht an Doris denken, da er sich dann noch einsamer fühlte.
2.Triest
Er empfand Triest als eng und bedrückend. Die Cafés waren für ihn wie die übrige Stadt aus Karton herausgeschnittene Geschichtskulissen. Von Anfang an hatte er die drohende Nähe der Langeweile gespürt, die er besonders fürchtete, weil sie sich als Lähmung in seinem Körper bemerkbar machte. Um nicht schwermütig zu werden, mußte er immer etwas unternehmen oder sich mit den Pharmamustern aus seinem Koffer Abhilfe schaffen.
Er war mit dem Bus zum Schloß Miramare gefahren. Obwohl er Busfahrten verabscheute, war es ihm diesmal angenehm gewesen, zwischen Menschen eingepfercht auf der Fahrt durchgeschüttelt zu werden, kurz das Gleichgewicht zu verlieren, an einen Frauenkörper anzustoßen oder fremden Schweiß durch ein Sommerhemd zu spüren. Als er ausstieg, nahm er aus Gewohnheit eine Schmerztablette ein. Im Park von Miramare war er lustlos herumflaniert, hatte über eine Mauer auf das Meerwasser hinuntergeblickt und war schließlich durch das kindische Schloß des Kaisers von Mexico spaziert. Dabei kam ihm der Gedanke, daß die Menschen auf die Macht und die Politik hineinfielen, weil sie immer hofften und hofften und weiterhofften und das Beste erwarteten, auch wenn fast immer das Schlimmste eintraf, und daß sie sich, hatten sie wieder einmal verloren, mit ihren Hoffnungen entschuldigten. Die Menschen waren nach Hoffnung süchtig und vor Hoffnung blind, das war ihr Verhängnis.
Die dicken Katzen, die sich im Schloßpark herumtrieben, begleiteten ihn ein Stück, während er gereizt seinen Gedanken nachhing. Er besichtigte den Leuchtturm, das enge Judenviertel, den Frachthafen. Dabei stieß er auf ein merkwürdiges, fabrikähnliches Gebäude. Er wußte anfangs nicht, wovor er stand. Neben dem Eingang sprach ein Alter mit einem vor Schmutz starrenden Hund. Der Mann war auf einen Stock gestützt und trug trotz der Hitze einen Mantel. Neugierig ging Eck durch einen langen hohen Betongang und betrat ein Büro, in dem eine gerahmte Stadtkarte aus der Zeit der Monarchie hing. Ein betrunkener Beamter lag auf dem Sofa. Unwillig wies er ihm den Weg »zum Krematorium«. In diesem Augenblick wurde Eck erst klar, daß er sich in der sogenannten Reisfabrik, der Risiera di San Sabba, dem ehemaligen Konzentrationslager der Stadt, befand, von dem er schon gehört hatte. Ein Eingang öffnete sich in einen abgedunkelten Raum. Er sah fotokopierte Dokumente und unscharfe, vergrößerte Schwarzweißfotografien. Er las, daß man die Opfer in einem Bus vergast und dabei über die Lautsprecher Walzermusik gespielt hatte, damit die Menschen in den umliegenden Häusern nicht argwöhnisch wurden. Als er in das Magazin der Reisfabrik trat, kam ihm der betrunkene Beamte nach und erklärte ihm, daß es nicht erlaubt sei zu fotografieren. Er blieb so lange in der Tür stehen und starrte Eck an, bis Eck, der gar keinen Fotoapparat bei sich hatte, ihm, um sein Mißtrauen zu überwinden, ein Trinkgeld gab. Ecks Blick fiel auf die spitzen Holzpfosten der Dachkonstruktion. Die Wände waren von verschiedenen Schichten Verputz bedeckt, auf denen man Wörter, Namen und, wie es Eck schien, auch braune Blutspritzer entdecken konnte. Einige große, urinfarbene Flecken kamen unter dem Verputz zum Vorschein. Er bemühte sich, eine der Inschriften zu entziffern, er verstand sie jedoch nicht. Dann erst entdeckte er die winzigen Gefängniszellen. Sie waren nur mit einer handgroßen Öffnung versehen. Eck wehrte sich dagegen, aber er mußte an Schweinekoben denken.
Das Krematorium selbst existierte nicht mehr, nur eine in den Boden eingelassene Metallplatte zeigte an, wo es sich befunden hatte. Erst beim Hinausgehen bemerkte er die Eisenbahnschienen. Darauf waren, so erfuhr er später, die Gefangenen von den Schiffen in die Reisfabrik und die Waggons mit der Asche der Ermordeten zum Meer geschafft worden.
3.Die Klinik
Wie alle Tage ging Eck später zum unbenutzt daliegenden großen Hafen vor dem Hotel. Er bildete sich immer ein, die Fischhalle auf dem leeren Platz habe etwas Geheimnisvolles. Jedesmal fielen ihm die Bilder von De Chirico ein, bevor er sie betrat, Möbelwagen und Gebäude, Bahnhofsuhren und Schatten, die eine Leere beschrieben. In der Halle kippte das Bild um. Das Licht fiel trüb durch das Glasdach und ließ ihn an das Novembergrau im Seziersaal denken. Er betrachtete die toten Fische auf dem glitzernden Eis. Menschen zogen an ihm vorbei, rempelten ihn, beachteten ihn nicht. Er erinnerte sich wieder an den Bootsunfall mit seinem Vater. Er glaubte damals, so seltsam es klingt, aufzuwachen. Gleichzeitig fand er sich in einer Welt wieder, die schmutzig und tödlich war, wie wenn plötzlich das Meer austrocknete oder die Erde Risse bekam und zeigte, daß alles Bedrohung war. Die Gewißheit, die sich in ihm später bei seinem Medizinstudium und auf seinen Reisen als Pharmavertreter gebildet hatte, war die Gewißheit der Bedrohung gewesen. Er wußte seit dem Bootsunfall, daß die Käfer- und Moderwelt des Todes gleichzeitig und unverändert existierte, selbst während er liebte. Wenn er an die Ordinationen dachte, die er besucht hatte, die Ärzte, war in seinem Kopf nur Nüchternheit und Mißtrauen. Die Ärzte waren fast immer von Vorurteilen und Geltungsdrang bestimmt. Sie belehrten ihn oder behandelten ihn von oben herab, wenn er sie nicht mit Geschenken beeindruckte. Die Patienten in den Wartezimmern zeigten Ergebenheit; manchmal saß er unter ihnen, bis er vorgelassen wurde. Er setzte sich der Trostlosigkeit des Wartens aus, weil er sich sagte, sie sei ein Teil der Wirklichkeit, wie auch die endlos langen Fahrten in seinem Auto, das vollgestopft war mit Geschenken und Medikamenten.
Bevor er sich zur Klinik des berühmten Professors Basaglia begeben mußte, hatte er einen Rundgang zum Hafen und zur Fischhalle gemacht und in der kleinen Bar auf dem Platz einen Martini getrunken.
Die Anstalt war zu seiner Enttäuschung bedrückend gewesen. Sie wurde mit beamtenhafter Einfalt geführt, wie alle anderen auch. Blaugestrichene Gänge, Wasserpfützen auf den Steinböden, die von den Putzfrauen herrührten. Kritzeleien an den Gebäuden riefen zur Revolution auf. Als der Pfleger, der Eck führte, von einer Krankenschwester aufgehalten wurde, fand Eck sich plötzlich allein in einem Abstellraum, in dem Betten aufgestapelt waren. Vom Fenster aus konnte er das Meer sehen. Hinter einer Tür stieß er auf eine Patientin. Die glatzköpfige Frau starrte Eck an. Rasch griff sie in ihre Jacke, holte eine Orange heraus und hielt sie Eck hin. Sie sagte, sie sei eine Freundin des Duce. Die Hand, die die Orange hielt, zitterte. Nach dem Tod Basaglias, erfuhr Eck später vom Pfleger, war es mit der Anstalt bergab gegangen. Übriggeblieben waren nur Basaglias Ideen von einer Auflösung der Klinik und der Befreiung der Patienten, denen man Wohnungen außerhalb der Anstalt zur Verfügung gestellt hatte. Die Stadtverwaltung brachte aber kein Geld mehr auf, sagte der Pfleger. Er zeigte ihm die Bilder an den Wänden, die von Patienten stammten. Aus ihnen sprachen Einsamkeit und Trauer, wie schon aus der aufgeregten Sprechweise der Patientin, die sich für die Freundin des Duce hielt.
Vom Berg aus, wo die Alten untergebracht waren, hatte die Klinik das Aussehen eines Filmkulissendorfes. Das Altenheim war eine verfallene große Villa. Die greisen Patienten schliefen in ihren Betten, im Fernsehraum saß der Zimmerälteste mit dem Hausschlüssel in der Hand. Der Pfleger tat so, als ob er sich entschuldigte. Üblicherweise herrschte in der Klinik mehr Leben als heute. Zuletzt zeigte er ihm nicht ohne Stolz die Tischlerwerkstatt. Er fügte hinzu, daß die Entwürfe für die Möbelstücke von einem Architekten stammten, der sich von der Anstaltsatmosphäre inspirieren ließ und die Ausführung einer Handvoll geschickter Patienten übergab.
Der Architekt saß in einem Nebenraum und brütete vor sich hin inmitten bizarrer, korkenzieherförmiger Blumentischchen, Stühle und Schreibtische. Sie schienen für Eck die Überbleibsel von aus den Fenstern geworfenen Kindermöbeln zu sein. Draußen verabschiedete sich der Pfleger eilig von Eck, im Anstaltscafé warteten schon die nächsten Besucher.
Eck beschloß, nachdem er den Brief seines Vaters ein zweites Mal gelesen hatte, abzureisen, obwohl das Hotel noch bis zum nächsten Tag bezahlt war. Morgen war der 11. August, an dem sein Vater ihn erwartete.
4.Der Überfall
In Udine war es noch hell. Er setzte sich am Hauptplatz in ein Café und blätterte lustlos in der Zeitung. Zuerst trank er ein Glas Weißwein, dann nahm er das gewohnte Schmerzmittel. Während er durch die Fensterscheibe nach draußen blickte, setzten sich zwei Frauen an seinen Tisch. Eck blickte einer von ihnen neugierig in das Gesicht. Daraufhin lachten die Frauen und fragten ihn nach seinem Namen: Sie waren hübsch; Carla war rothaarig, die andere, Giovanna, dunkel und auf eine anziehende Weise verlegen; sie gaben sich als Schwestern aus. Carla, der Eck anfangs in die Augen geschaut hatte, trug ein schwarzes Kleid und eine Bluse mit schwarzen Punkten. Die silbernen Ringe an ihren Fingern suggerierten ihm, »daß sie es nicht so genau nahm«.
Das Café war altmodisch, mit Stukkaturen an der Decke, Spiegeln und Marmortischchen. Carla wollte wissen, woher er kam und was er weiter vorhätte. Giovanna wurde schweigsamer. Eck zweifelte daran, daß sie wirklich Schwestern waren. Giovanna war nachlässiger gekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einem khakifarbenen Rock, ihr Gesicht war breit und vermittelte Wärme. Kurz darauf begrüßten Carla und Giovanna zwei junge Männer. Nachdem sie Höflichkeiten ausgetauscht hatten, nahm Carla an ihrem Tisch Platz. Bis jetzt hatte Eck sich mit den beiden Frauen auf englisch unterhalten, nun stellte sich heraus, daß Giovanna – wenn auch nur mühsam – Deutsch sprach. Sie arbeitete im Büro einer Handelsgesellschaft und hatte einen Verlobten in Padua, sagte sie. Eck bestellte eine Flasche Wein, lehnte sich zurück und ließ einen Blick auf ihre Füße unter dem Tisch fallen. Sie trug Sommerschuhe mit einer kleinen Öffnung, durch die man den lackierten Nagel der großen Zehe sah. Giovanna, die seinen Blick bemerkte, wollte daraufhin wissen, ob er Schuhvertreter sei. Die Frage war Eck unangenehm. Er hatte die Vorstellung, daß man ihn schon auf den ersten Blick als Vertreter taxierte, deshalb nahm er ihre Frage auf und antwortete, er sei Reisender für orthopädische Schuhe und Prothesen. Giovanna war plötzlich erheitert. Soldaten hatten inzwischen das Café betreten. Da sie keinen freien Platz mehr fanden, fragten sie, ob sie sich zu ihnen setzen dürften. Bevor Eck antworten konnte, stand Giovanna auf und erklärte ihnen, daß sie gerade gehen wollten.
Auf der Straße war es dunkel geworden – Eck war überrascht. Giovanna schob ihr Fahrrad, das sie vor dem Café abgestellt hatte, neben ihm her. Er wußte auf einmal nicht, worüber er sich mit ihr unterhalten sollte. Er bot ihr eine Zigarette an, aber sie lehnte ab, und so rauchte er allein.
»Haben Sie einen Wagen?« fragte sie unvermittelt.
Eck antwortete erstaunt: »Vor dem Café.«
»Weshalb fahren wir dann nicht?« fragte sie weiter. Sie machten kehrt und gingen zum Café zurück. Giovanna sperrte ihr Fahrrad ab, bevor sie im Wagen Platz nahm.
»Und jetzt?« fragte Eck.
»Ich zeige Ihnen den Weg«, gab Giovanna zurück.
Sie begegneten nur wenigen Fahrzeugen. Im Rückspiegel sah er die Scheinwerfer eines Autos.
Sie bogen – wie Giovanna es wollte – auf einen Parkplatz mit Bäumen und Sträuchern ein, dazwischen konnte man den silbernen Streifen eines Kanals sehen.
In der Dunkelheit hörte Eck Giovannas Kleider rascheln, er spürte ihre nackten Arme, im nächsten Augenblick küßte sie ihn. Ein anderes Auto fuhr wie ein Schatten auf den Parkplatz. Eck glaubte, ein Liebespaar in seinem Inneren zu erkennen. Sie befänden sich auf der Piazza amore, beruhigte ihn Giovanna, bevor er etwas sagen konnte.
Er hatte wenig Erfahrung mit Parkplätzen und Autositzen, aber vielleicht gefiel es ihm gerade deshalb. Giovannas Brüste berührten seinen Mund, er kam mit den Beinen auf dem Nebensitz zu liegen und sah und spürte, wie sie sich auf ihn setzte; nachdem sie seine Hose geöffnet hatte, bewegte sie sich gewandt, beugte sich nach vorn und streichelte mit ihren Brüsten sein Gesicht. Auf dem Autositz konnte er sich kaum bewegen. Sein Denken schien von einem Augenblick auf den anderen an etwas zerschellt zu sein. Er sah die Decke seines Wagens, schloß die Augen und leckte die süße bewegliche Zunge. Sie breitete sich in seinem Mund aus wie fleischiger Speichel. Es war ihm, als sei ein unbekanntes Wesen über ihn hergefallen, das ihn auf eine seltsame Weise ermorden wollte. Als er wieder zu sich kam, hörte er Giovannas Stöhnen. Allmählich konnte er sie in ihrer Nacktheit betrachten mit einem Gefühl aus Gier und Vorsicht, das ihm gut bekannt war.
»Fertig?« fragte sie plötzlich. Sie richtete sich auf und glitt von ihm weg. Eck knöpfte seine Hose zu, sah dabei ohne Absicht auf seine Uhr und beobachtete die junge Frau, wie sie sich ankleidete. Sie fragte ihn, ob er ihr Geld gäbe …
Eck suchte nach einigen Scheinen. Es störte ihn nicht, daß sie Geld verlangte, nur ihre Eile irritierte ihn. Das Auto unter dem Baum löste sich aus der Dunkelheit, rollte vor den Kühler seines Wagens, und zwei Männer stiegen aus. Einer von ihnen riß die Tür auf und zog Eck hinter dem Lenkrad heraus ins Freie. Er verspürte einen heftigen Schlag im Gesicht. Gleichzeitig packte ihn jemand von hinten, und Faustschläge trafen ihn auf der Nase und im Gesicht, daß er zu Boden stürzte.
Als nächstes begannen die Männer auf ihn einzutreten. Er empfand die Tritte wie Hammerschläge, aber mit jedem neuen Schmerz verlor er – zu seinem eigenen Erstaunen – etwas von seiner Angst.
5.Die Erinnerung
Eine Zeitlang lag er auf dem Boden. Er hörte, wie ein Auto in der Dunkelheit verschwand. Der Gedanke, daß Doris erfahren könnte, was mit ihm geschehen war, bedrückte ihn.
Mühsam stand er auf und griff in die Taschen seiner Jacke, dabei stellte er fest, daß man ihm die Armbanduhr und das Geld geraubt hatte, dazu die Zigaretten, das Feuerzeug und seinen Paß. Der Kofferraum stand weit offen, das Handy-Telefon und sein Koffer mit dem Adreßbuch und den Ärztemustern fehlten. Eck warf den Deckel zu. Er taumelte zur Vordertür. Sie war noch immer aufgerissen – wie nach einem Mord: Er hatte sein Lederetui mit den Scheckkarten und dem Führerschein bei der Abfahrt in das Handschuhfach gelegt und fand sie zu seiner Überraschung unberührt wieder. Er konnte also wenigstens mit seinem Führerschein über die Grenze kommen und mit der Scheckkarte Geld besorgen. Der Wagenschlüssel lag auf dem Asphalt. Unten, vom Kanal, war das Glucksen von Wasser zu hören. Sein Kopf schmerzte. Er taumelte zum Kanal hinunter, kühlte das Gesicht mit Wasser und suchte in der Jacke die Folie mit den Schmerztabletten. Er schluckte zwei davon. Als er wieder im Auto saß, stieg Übelkeit in ihm auf. Er schloß die Augen und versank in die Bilder, die hinter den Lidern auftauchten und von neuen abgelöst wurden. Die letzten zehn Jahre waren noch nicht vergangen … Er starrte im Vorzimmer seiner Wohnung auf den Spalt unter der Badezimmertür. Eine Blutlache hatte sich dort gebildet. Langsam kroch sie auf ihn zu. Er drückte den Türgriff und sah seine Mutter auf dem Küchenstuhl. Ein zerbrochener Rasierspiegel lag im Waschbecken. Eck hatte dieses Geschehen oft und oft vor seinem inneren Auge gesehen. Das Kleid der Mutter war mit Blut besudelt, Blutspritzer bedeckten die Fliesen. Eck stürzte auf sie zu und rüttelte an ihren Schultern; er rief: »Wach auf!« Aber ihr Kopf fiel nur auf die andere Seite.
Bei den Worten: Wach auf, öffnete Eck die Augen. Es war noch immer dunkel. Ein saurer Geschmack hatte sich in seinem Mund gebildet. Er saß einige Minuten benommen da. Ihm fiel die Lust ein, die er mit Giovanna empfunden hatte. Aber es war ein Gefühl, das von einem höhnischen, stummen Lachen begleitet war. Er war ein Idiot. Er dachte kurz, daß die beiden Männer jetzt mit Giovanna schliefen. Sie genossen es wahrscheinlich, ein Verbrechen begangen zu haben.
Bei Dunkelheit überquerte er die Grenze. Er besorgte sich an einem Bankomaten Geld. Wenn er an seinen gestohlenen Paß und das Adreßbuch dachte, kam er sich verloren vor. Endlich fand er eine beleuchtete Tankstelle, der Tankwart schlief in der unversperrten, gläsernen Kabine. Ein Speichelfaden lief über das Kinn des Mannes. Nachdem er aufgetankt hatte, kaufte Eck ein Plastikfeuerzeug, Zigaretten und eine Flasche Mineralwasser. Er schluckte eine weitere Schmerztablette. Nur wenige Autos waren auf der Straße.
Nach einer Weile kam es ihm nicht richtig vor, daß er an den See fuhr. War nicht der Brief ein schlechtes Omen gewesen? Eck war davon überzeugt, daß sein Vater seine Mutter umgebracht hatte, wenn auch nicht mit Absicht. Nachdem die Polizei ihre Arbeit verrichtet hatte, mußte er das Blut mit einem Putzlappen aufwischen, erinnerte er sich. Alles lebte in seinem Kopf weiter, der Haß und die Übelkeit, die er damals empfunden hatte, die Umarmung der Frau aus dem Café in Udine, die Ereignisse auf dem Parkplatz und die Einsamkeit in Triest. Er stellte das Radio an und bemühte sich, dem englischen Text eines Schlagers zu folgen, um nicht einzuschlafen.
6.Wildenten
Am Morgen begann es heftig zu regnen. Eck fuhr über eine sanfte Anhöhe, und plötzlich lag der Neusiedler See vor ihm. Die Wolken schienen eine düstere Prophezeiung zu sein, Nebelschwaden lagen am Ufer. Das letzte Stück hatte Eck gegen die Müdigkeit angekämpft, und es war ihm jetzt, als ob der See und die Landschaft noch schliefen. Er hielt an, um eine Schmerztablette zu suchen, die er ohne Wasser schluckte. Ein Rudel japsender Jagdhunde ließ ihn aufschrecken. Die Hunde umrundeten seinen Wagen, bevor sie weiterhasteten. Unten, vor dem Schilfgürtel, hatte das Wasser die Wiesen überschwemmt, in denen Eck jetzt Jäger in Parkajacken stehen sah. Er parkte den Wagen unter einem Nußbaum, da er eine Zigarette rauchen wollte. Von den Zweigen fielen schwere Wassertropfen auf seinen Kopf, daher trat er gleich wieder unter der Baumkrone heraus. Jetzt sah er ein mit Schilf getarntes Güllefaß. Durch die ausgesägten Öffnungen hielten Jäger die Gewehrläufe zum See hin. Die übrigen hatten sich hinter Schildern aufgestellt, und die Hunde warteten zitternd und still in den Pfützen. Nur das Rauschen des Regens war zu hören. Einmal fuhr ein Lastwagen vorüber. Das Wasser war durch die fallenden Tropfen in Punkte zersplittert, und die Gestalten der Jäger spiegelten sich in ihm als zerrissene, schwarze Gebilde. Aus dem Schilf verbreitete sich ein fauliger Geruch. Plötzlich, mit dem Geräusch eines fernen – Eck dachte »flachen« – Donners, erhoben sich Schwärme von großen Vögeln aus dem Schilf. Eck erkannte, daß es Hunderte und Aberhunderte, wenn nicht Tausende Enten waren, die am Morgenstrich zum Freßplatz flogen und nun wie ein endloser Teppich aus Federn den Himmel bedeckten. Im nächsten Moment ertönten Schüsse, die Löcher in den fliegenden Vogelteppich rissen, während weiter Scharen von Enten, ohne einen Laut von sich zu geben, über die Köpfe der Jäger und den Nußbaum in die Luft stiegen, vergleichbar riesigen Schwärmen von Heuschrecken – nur waren sie viel größer, schwerer und dunkler. Es rauschte und knatterte in einem fort. Wie Erdbrocken fielen die getroffenen Tiere zu Boden, klatschten auf das Wasser und wurden von den Hunden apportiert. Da es noch dämmrig war, sah Eck das Mündungsfeuer der Schrotflinten. Die Jäger standen aufrecht, bis zu den Knien im Wasser und schossen ohne Unterbrechung in den Entenschwarm, der sich weiter aus dem Schilf erhob, als seien der Erde selbst Flügel gewachsen. Manche Enten stürzten (von den Schüssen zuerst ein kleines Stück hochgeschleudert) in das Schilf zurück oder in den Weingarten. Andere schienen – von Schrotkugeln getroffen – in einzelne Federn zu zerplatzen. Das Wasser unter den Pfoten der Hunde und den Stiefeln der Jäger war aufgewühlt und färbte sich gelb, als strömte eine schmutzige Flüssigkeit aus einem unterirdischen Abfluß.
Mit einem Mal waren die Enten verschwunden. Stille breitete sich aus. Um so deutlicher waren die Rufe der Jäger und die Wassergeräusche zu hören, die durch die laufenden Hunde hervorgerufen wurden. Verendende Tiere flatterten im lehmigen Wasser, wurden von den Jägern aufgehoben, geschüttelt und mit einer Feder in das Genick gestochen, bevor sie an kleinen Haken, die mit Lederschlaufen am Gürtel befestigt waren, aufgehängt wurden. Andere Jäger trugen die toten Enten an deren Hälsen in der Hand. Federn taumelten vom Himmel.
Die meisten Jäger standen am Schilfrand und hörten nicht auf, ihren Hunden Befehle zu erteilen. Wenn sie ihrem Herrn eine Ente zu Füßen legten, schüttelten sie sich, Wassertropfen stoben, und die Erkennungsmarken am Halsband klirrten.
Eine einzelne Ente flog auf die Jäger zu, bis einer von ihnen auf sie anlegte und abdrückte. Sie stürzte, sich in der Luft überschlagend, vor einen Hund, der sofort mit seinem Maul zupackte.
An einer Stelle war das Schilf von einem Bootssteg durchbrochen, dort begannen die Jäger die geschossenen Tiere abzulegen. Es war heller geworden. Die Hunde im Schilf stöberten zwei Bleßhühner auf. Sie versuchten, sich in die Luft zu retten, ein Jäger erlegte sie jedoch mit zwei schnellen Schüssen. Die meisten hatten jetzt Büschel mit toten Enten an ihren Hüften baumeln.
Aus dem Weingarten flog eine Elster auf. Gerade hatte Eck sich zurück in seinen Wagen setzen wollen, als ein Schuß die Elster verfehlte und Schrotkugeln neben ihm in das Laub des Nußbaums prasselten. Ein zweiter Schuß dröhnte in seinem Kopf, und ein dumpfes Geräusch hinter seinem Rücken sagte ihm, daß der Vogel zu Boden gefallen war. Erschrocken blickte er in die Schußrichtung. Der Jäger, ein junger Bursche, hielt das Gewehr noch im Anschlag. Er trug eine Sportkappe, einen Gummimantel und Gummistiefel.
»Wollen Sie mich erschießen?« rief Eck wütend.
Der Jäger bewegte sich langsam auf ihn zu, ohne seinen Blick von ihm abzuwenden.
»Verschwinden Sie«, zischte er. Die Wasserflecken auf seinem Mantel sahen aus wie dunkle, alte Blutspuren.
Während des kurzen Wortwechsels näherte sich ein bellender Hund.
»Was ist los?« rief ein anderer Jäger, der bis zu den Knöcheln im lehmigen Wasser stand und alles beobachtet hatte.
Die übrigen waren stehengeblieben. Sie starrten jetzt zu Eck hinauf. Der junge Jäger bückte sich inzwischen nach der Elster, dabei musterte er Eck. Dann hielt er den Vogel an den Läufen in der Hand, während sein Hund bellte und winselte. Der Jäger, der gefragt hatte, was los sei, eilte herbei, packte den Jungen am Arm und fuhr ihn an: »Was machst du? Was fällt dir ein?« Sein Parka und sein Hut trieften vor Nässe. Er war groß, blaß und stämmig.
»Er hat auf mich geschossen!« empörte sich Eck.
Als der junge Jäger schwieg, schüttelte der andere seinen Arm. »Entschuldige dich!« rief er aufgebracht.
Der Junge murmelte etwas Unverständliches, dann machte er kehrt und ging auf die Gruppe zu, die noch immer hinaufstarrte.
»Ich hoffe, es ist Ihnen nichts passiert«, wandte sich der Mann an Eck.
Die Jäger auf der Wiese und vor dem Steg legten die Strecke auf. Es mußten mehr als zweihundert tote Enten sein.
»Nein«, antwortete Eck.
»Kann ich etwas für Sie tun?« fragte der Mann.
Eck schüttelte den Kopf und setzte sich in den Wagen.
»Tut mir leid«, verabschiedete sich der Jäger.
Es regnete nicht mehr. Die Wolken hatten eine tiefblaue Farbe angenommen. Dort, wo sie den Himmel freigaben, leuchtete er gelb hinter den Hügeln auf. Der Tag, an dem sein Vater ihn zum Segeln eingeladen hatte, dämmerte herauf.
7.Der Traum
Der Hotelbesitzer saß gähnend hinter einem Pult. Er wollte wissen, wie lange Eck bleiben würde.
»Das wird sich ergeben.« An einer Wand hinter einer großen Glasscheibe zierten ausgestopfte Vögel eine künstliche Schilflandschaft. Als der Hotelbesitzer Ecks Blick bemerkte, schaltete er vom Pult aus die Neonbeleuchtung ein.
»Haben Sie Gepäck?«
»Nein.«
»Kein Gepäck?«
»Nein«, wiederholte Eck.
»Aha«, er dachte nach. »Ich glaube, heute gibt es einen schönen Badetag«, sagte er dann und schob ihm das Anmeldeformular hin. »Soll ich Ihnen den Weg zum Strand zeigen?«
An einem der gedeckten Frühstückstische saß ein großer Mann mit nackenlangen grauen Haaren, einem grauen kurzgeschnittenen Bart und einer Hornbrille. Er las in einer Zeitung, dem Standard, wie Eck aus der rosa Farbe des Papiers schloß. Langsam – um keinen Lärm zu machen – riß der Mann eine Seite heraus.
»Ich bin die Nacht durchgefahren«, sagte Eck.
»Ich verstehe … Hatten Sie einen Unfall?«
Eck fiel ein, daß sein Gesicht Spuren vom Überfall in Udine aufwies.
»Nicht der Rede wert.«
Der Hotelbesitzer nickte, ohne daß das Mißtrauen aus seinem Gesicht verschwand.
Der Mann am Frühstückstisch hatte inzwischen die Zeitungsseite in die Tasche seiner hellen Jacke gesteckt. Gerade hauchte er seine Hornbrille an und begann, sie mit einem Taschentuch zu reinigen, während er Eck mit kurzsichtigen, blauen Augen musterte.
Müde wankte Eck in das erste Stockwerk.
Vor seinem Zimmer stand eine Vase mit Schilfpflanzen. Er schlief unruhig. Unbekannte Menschen tauchten in seinem Kopf auf, zuletzt ein Bub, den er als einen Freund aus seiner Kindheit zu erkennen glaubte. Er sah Robert nicht ähnlich, aber er war es. Robert hielt ein Modellsegelflugzeug mit durchsichtigen Tragflächen in der Hand und ein Gummiband, mit dem er es in die Luft schoß. Das Flugzeug zog Kreise über ihren Köpfen, stieg im Wind höher und höher und stürzte dann plötzlich vor ihre Füße. Es sah aus wie ein riesiger Netzflügler. Gleich darauf war Robert verschwunden. Eck sah nur den abgebrochenen, durchsichtigen Flügel, das Leitwerk und den Rumpf des Modellflugzeugs, bis der Wind die Teile vollends mit Staub bedeckte.
8.Der Sturm
»Sie haben nichts bemerkt?« Der Hotelbesitzer schüttelte den Kopf. Die Vitrine mit den ausgestopften Vögeln war noch immer beleuchtet.
Eck hatte den Nachmittag verschlafen und versuchte, mit einer Tasse Kaffee auf die Beine zu kommen.
»Es hat einen fürchterlichen Sturm gegeben«, sagte der Hotelbesitzer. »Haben Sie das Typhon nicht gehört?«
»Das Typhon?«
»Die Sturmsirene.«
Vom gegenüberliegenden Restaurant – sah Eck jetzt durch ein Fenster – hing das blauweißgestreifte Sonnendach in Fetzen herunter, ein Stück Stoff, das durch eine Windböe aufgewirbelt wurde, wehte wie eine zerschlissene Fahne. Eck ließ den Kaffee stehen und ging hinaus. Draußen wehte noch immer ein heftiger Wind. Von weitem sah er die umgestürzten Tretboote am Ufer, die der Sturm an Land geschleudert hatte. Das Wasser war von Wellen mit weißen Schaumkronen bedeckt. Der Strand wimmelte von Feuerwehrleuten, Helfern und Urlaubern in Gummistiefeln, die Bänke aufstellten, Holztrümmer zusammensammelten oder herumstanden und auf den See blickten.