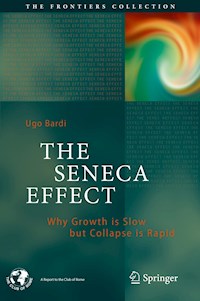Ugo Bardi
DerSeneca-Effekt
Warum Systeme kollabierenund wie wirdamit umgehen können
Aus dem Englischen vonGabriele Gockel & Sonja Schumacher
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© der Originalausgabe 2017: Ugo Bardi© der deutschen Ausgabe 2017: oekom verlag MünchenGesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Übersetzungslektorat: Christoph Hirsch, oekom verlagKorrektorat: Petra KienleSatz: Ines Swoboda, oekom verlag
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96006-218-9
Dieses Buch istmeiner Tochter Donata gewidmet,in der Hoffnung,dass sie und ihre Generationvon einem größeren Seneca-Kollapsverschont bleiben.
Inhalt
Dank
Vorwort
Einführung
Kollaps ist kein Defizit, er ist eine Eigenschaft
Teil I
Die Mutter aller Zusammenbrüche: Der Untergang des Römischen Reichs
Kapitel 1
Seneca und seine Zeit
Kapitel 2
Wieso gibt es eigentlich Weltreiche?
Kapitel 3
Ein geradzu »klassischer« Kollaps
Teil II
Von großen und kleinen Zusammenbrüchen
Kapitel 4
Das Zerbrechen alltäglicher Dinge
Warum Flugzeuge keine rechteckigen Fenster haben
Über Entropie
Warum Ballons platzen
Kapitel 5
Lawinen
Der Einsturz der großen Türme
Die Physik der Sanduhr
Netze und Netzwerke
Kapitel 6
Finanzlawinen
Wiedersehen mit Babylon
Was ist »Geld« überhaupt?
Warum kommt es zum Finanzkollaps?
Kapitel 7
Hungersnöte
Malthus war ein Optimist
Japan: Ein resilientes Land
Bevorstehende Hungersnöte
Kapitel 8
Verknappung
Das kurzlebigste Imperium der Geschichte
Tiffany’s Trugschluss
Thanathia und die mineralische Eschatologie
Kapitel 9
Overshoot
Gib einem Mann einen Fisch …
Was gut für die Biene ist, ist auch gut für den Stock
Der Untergang des galaktischen Imperiums
Kapitel 10
Gaias Tod: Das Ende des Ökosystems Erde
Woran starben die Dinosaurier?
Gaia oder die Homöostase des Erdsystems
Die Hölle auf Erden
Teil III
Den Kollaps bewältigen
Kapitel 11
Zusammenbrüche verhindern
Privatisierung vs. Schutz der Allmende
Resilienz entwickeln
Die Erholung nach einem Kollaps
Den wirtschaftlichen Zusammenbruch verhindern
Kapitel 12
Den Kollaps nutzen
Zusammenbruch des Feindes
Kreativ kollabieren
Die Hebel richtig umlegen
Anhang
Gesetze und Verteilungen
Lotka-Volterra-Modell
Abbildungen A1 bis A12
Anmerkungen
Dank
Die erste Person, der ich für dieses Buch danken möchte, ist Lucius Annaeus Seneca, der den Titel und das Hauptthema dieses Buchs lieferte. Der Gedanke, den Ausdruck »Seneca-Effekt« zu verwenden, entstand, als mich mein Kollege und Freund Luca Mercalli an diesen Mann erinnerte, mit dem ich vor langer Zeit auf dem Gymnasium Bekanntschaft gemacht hatte. Danken möchte ich auch Dmitry Orlov, der mich darauf brachte, Modelle für die Systemdynamik des Seneca-Effekts zu entwickeln.
Ferner möchte ich mich bei David Packer und Christoph Hirsch für ihre Unterstützung bedanken sowie beim Club of Rome, der meine vorherige Arbeit gefördert hat. Charlie Hall danke ich dafür, dass er allen, die sich mit biophysikalischen Systemen befassen, immer wieder neue Anregungen gibt, sowie auch Jay Forrester, der von uns gegangen ist, während dieses Buch geschrieben wurde.
Meiner Tochter Donata – sie ist Psychologin – verdanke ich viele der in dieses Buch eingeflossenen Erkenntnisse über die menschliche Neigung, Raubbau an Ressourcen zu treiben.
Äußerst hilfreich waren außerdem die Kommentare und kritischen Bemerkungen von Toufic El Asmar, Sara Falsini, Nate Hagens, Günter Klein, Marcus Kracht, Graeme Maxton, George Mobus, Silvano Molfese, Ilaria Perissi, Aldo Piombino, Sandra Ristori, Sonja Schuhmacher, Luigi Sertorio, Sgouris Sgouridis, Wouter Van Dieren, Anders Wijkman und Antonio Zecca. Ihnen allen möchte ich meinen Dank aussprechen, weise aber zugleich darauf hin, dass alle Fehler, die im Buch auftauchen, auf mich selbst zurückgehen und nicht auf sie.
Vorwort
geschrieben von den Co-Präsidenten des Club of Rome Ernst Ulrich von Weizsäcker und Anders Wijkman
Ugo Bardis »Der Seneca-Effekt. Warum Systeme kollabieren und wie wir damit umgehen können« ist der 42. Bericht an den Club of Rome und somit Teil jener Serie an Berichten, die im Jahr 1972 mit den »Grenzen des Wachstums« begann.
Die Hauptaussage der »Grenzen des Wachstums« war, dass »die Ausbeutung der wichtigsten Rohstoffe und die wachsende Belastung durch Umwelt- und Luftverschmutzung zunehmend steigende Risiken für die Weltwirtschaft in der Zukunft verursachen« würde. Viele verstanden den Bericht so, als würde die Weltwirtschaft innerhalb weniger Jahrzehnte zum Stillstand kommen. Dies war allerdings nicht die Aussage der »Grenzen des Wachstums«. Der Bericht stützte sich auf eine Perspektive von 50 bis 100 Jahren und legte darüber hinaus seinen Fokus auf die steigenden, physischen Auswirkungen des Wirtschaftswachstums – den ökologischen Fußabdruck – nicht auf Wachstum an sich. Tatsächlich ging es in diesem Buch in erster Linie darum, wie man Kollaps vermeiden und die Menschheit einen besseren, nachhaltigeren Weg für ihre Zukunft und die ihres Planeten einschlagen könnte. Der Club of Rome setzt sich bis heute genau dafür ein.
45 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Berichtes allerdings stellt sich die Frage danach, wie ökologische Krisen in der Zukunft verhindert werden können, leider nicht mehr. Heute geht es um die Frage, wie die Menschheit ihre Auswirkungen abschwächen und bewältigen kann. Die Vision der Mitglieder des Club of Rome bleibt nichtsdestotrotz dieselbe: eine bessere Zukunft für die Menschheit und den Planeten.
»Den Feind zu kennen ist der beste Weg, ihn zu besiegen«, heißt es. Gleichermaßen gilt: Um die Auswirkungen eines Kollapses zu bewältigen, muss man verstehen wie er entsteht, sich entwickelt und auswirkt. Probleme, die uns in der Zukunft erwarten, einfach zu ignorieren ist hingegen kein vielversprechender Lösungsansatz, um sie zu vermeiden.
Das vorliegende Buch untersucht die Natur und Ursachen von Kollapsen, und zwar nicht, indem es Untergangszenarien heraufbeschwört – allerdings auch nicht durch die rosarote Brille exzessiven Optimismus. Dieses Buch macht keine Zugeständnisse an Ideologien, Politik oder falsche Hoffnungen. Es bedient sich vielmehr der modernen Wissenschaft, um aufzuzeigen, dass Kollapse natürliche Phänomene sind, die vielfältige Ursachen haben und viele Formen annehmen können. Wir können dies in unserem Alltag beobachten, zum Beispiel wenn Gegenstände kaputt gehen, oder sogar bei Ereignissen großer Tragweite, etwa wenn ganze Zivilisationen zusammenbrechen.
Dieser Bericht bietet den Leserinnen und Lesern eine Fülle an Anekdoten, Einsichten und Fakten, mit einer bemerkenswerten, ganzheitlichen, analytischen Denkweise. Sie werden entdecken, dass Kollaps ein Kollektivphänomen ist, welches in (wie wir sie heute bezeichnen) »komplexen Systemen« auftritt; ein neues und faszinierendes Forschungsfeld, welches uns ermöglicht, die Welt um uns herum besser zu verstehen. »Der Seneca-Effekt« beschreibt praxisgerechte Wege und Lösungen, wie man Kollapse in komplexen Systemen vermeiden oder zumindest bewältigen kann. In bestimmten Fällen kann dies geschehen, indem die Bindeglieder, die ein System zusammenhalten, verstärkt werden. In anderen Fällen, indem man das System externe Schocks absorbieren lässt – und dabei innere Parameter verändert, anstatt sie zu erhalten. Und für den Fall, dass ein Kollaps unvermeidlich ist, zeigt dieses Buch auf, wie man ihn nutzen kann, anstatt sich ihm zu widersetzen, wenn der einzige Weg, um das Alte loszuwerden, das Schaffen von Raum für das Neue ist.
In einer Welt wie der unseren, die sich mit einer Vielzahl an sozialen und ökologischen Herausforderungen konfrontiert sieht, ist es notwendig Kollaps zu verstehen. Während die Menschheit noch immer weiter wächst, wächst gleichzeitig die Notwendigkeit, bessere und effizientere Wege zu finden, die knappen Ressourcen unseres Planeten zu nutzen. Diese Herausforderungen sind schwierig zu bewältigen, weshalb ein besseres Verständnis davon, wie komplexe Systeme funktionieren, durch das wissenschaftliche Forschungsfeld der »Systemdynamik« dringend notwendig ist; auch hierzu leistet das Buch einen wichtigen Beitrag.
Ugo Bardis Buch ist aber nicht nur »praktisch« im Sinne von »nahe an der Realität und ihren Herausforderungen«. Es hat außerdem eine tiefere, philosophische Bedeutung, was ein weiterer Grund dafür ist, dass der Club of Rome es als Bericht akzeptiert hat. Der Titel, »Der Seneca-Effekt«, ist eine Hommage an den antiken Philosophen Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.), der die Theorie moderner Netzwerke und die Studien der »Systemdynamik« für sich entdeckte, obwohl er diese noch nicht als solche benannte. Seneca verstand die Notwendigkeit Veränderung und Wandel zu akzeptieren – anstatt sich in einem aussichtslosen Kampf gegen sie zu wehren. Dies ist der Grundsatz der stoischen Philosophie, frei nach Epiktet: »Was also ist zu tun? Das Beste machen aus dem, was in deiner Macht steht und den Rest so nehmen, wie er natürlich passiert.« (Discourses, 1. Januar 2017)
Dies ist der Hauptgedanke dieses faszinierenden Berichts.
Aus dem Englischen übersetzt von Alexander Stefes
Einführung
Kollaps ist kein Defizit, er ist eine Eigenschaft
»Esset aliquod inbecillitatis nostrae solacium rerumque nostrarum si tam tarde perirent cuncta quam funt:nunc incrementa lente exeunt, festinatur in damnum.«
»Es wäre ein Trost für unsere schwachen Seelen und unsere Werke, wenn alle Dinge so langsam vergehen würden, wie sie entstehen; aber wie dem so ist, das Wachstum schreitet langsam voran, während der Weg zum Ruin schnell verläuft.«
Lucius Anneaus Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Ch.), Epistolarum Moralium ad Lucilius (Briefe an Lucilius, 91, 6)1
Dieses Buch ist einem Phänomen gewidmet, das wir »Kollaps« oder »Zusammenbruch« nennen. Normalerweise denken wir unwillkürlich an Katastrophen, Desaster, Versagen und alle möglichen negativen Auswirkungen. Doch dieses Buch ist kein »Katastrophenbuch«, von denen es heute so viele gibt, und es schildert auch nicht den bevorstehenden, vielleicht unvermeidlichen Untergang. Hier geht es um die Erforschung von Zusammenbrüchen, darum, zu erklären, warum und wie es zu einem Kollaps kommt. Wenn man weiß, was Zusammenbrüche sind, werden sie nicht mehr überraschen und können verhindert werden. Man kann sie möglicherweise bewältigen und sogar zum eigenen Vorteil wenden. Im Universum ist ein Kollaps kein Defizit, sondern eine Eigenschaft.
Abbildung 1Der »Seneca-Effekt«, dargestellt mit der Methode der »Systemdynamik«. Diese Kurve ist ein allgemeines Modell und beschreibt viele physikalische Phänomene, die langsam anwachsen und schnell wieder zurückgehen.
Wie sich zeigt, können Zusammenbrüche in unterschiedlichster Gestalt und überall auftreten, sie haben die verschiedensten Ursachen und entwickeln sich auf unterschiedliche Weise. Zusammenbrüche können vermeidbar sein oder auch nicht, gefährlich oder nicht, katastrophal oder nicht. Offenbar manifestiert sich in ihnen die Tendenz des Universums, seine Entropie zu erhöhen und zwar so schnell wie möglich – ein Phänomen, das als »maximale Entropieproduktion« (MEP) bezeichnet wird.2
Demnach sind allen Zusammenbrüchen bestimmte Eigenschaften gemeinsam. Es sind stets kollektive Phänomene, das heißt, sie treten nur in sogenannten komplexen Systemen auf, also in Netzstrukturen aus »Knoten«, die durch Verknüpfungen miteinander verbunden sind. Ein Kollaps ist die rasche Umstrukturierung einer großen Zahl solcher Verknüpfungen, unter Umständen auch ihr Zusammenbruch und Verschwinden. Bei allem, was zusammenbricht (Alltagsgegenstände, Türme, Flugzeuge, Ökosysteme, Unternehmen, Imperien und Ähnliches), handelt es sich stets um Netzwerke. Die Knoten können Atome sein und die Verknüpfungen zwischen ihnen chemische Verbindungen. So ist es etwa bei Festkörpern. In manchen Fällen sind die physikalischen Verbindungen zwischen den Elementen künstliche Strukturen und somit ein Studienobjekt für Ingenieure. Und manchmal sind die Knoten Menschen oder gesellschaftliche Gruppen, deren Verbindungen im Internet zu finden sind oder sich in persönlicher Kommunikation manifestieren, vielleicht auch in Wechselkursen. Dies ist das Forschungsgebiet der Sozialwissenschaften, der Ökonomie und der Geschichte.
All diese Systeme haben vieles gemeinsam, vor allem ein nichtlineares Verhalten, das heißt, sie reagieren nicht proportional zur Stärke einer Störung von außen (eines »Antriebs« oder »forcing«, wie es in der Fachsprache heißt). In einem komplexen System besteht keine einfache Beziehung zwischen Ursache und Wirkung. Vielmehr kann ein komplexes System die Folge einer Störung mehrfach vervielfältigen, wie es der Fall ist, wenn man ein Streichholz an einer rauen Fläche reibt. Umgekehrt kann die Störung auch so gedämpft werden, dass das System kaum davon berührt wird. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn man ein brennendes Streichholz in ein Glas Wasser fallen lässt.
Dieses Phänomen der Nichtlinearität einer Reaktion wird oft als »Rückkopplung« bezeichnet, ein sehr wichtiges Charakteristikum komplexer Systeme. Wenn ein System eine Störung von außen verstärkt, spricht man von einer »sich selbst verstärkenden« oder »positiven« Rückkopplung, hingegen von einer »dämpfenden«, »stabilisierenden« oder »negativen« Rückkopplung, wenn das System die Störung eindämmt und größtenteils ignoriert. Wie es heißt, ist bei einem komplexen System immer mit einem »Rückschlag« (»Kick back«) zu rechnen3, manchmal erfolgt so ein Rückschlag überraschend heftig und gelegentlich erscheint er einfach chaotisch.
Die Tendenz komplexer Systeme zum Zusammenbruch lässt sich unter anderem unter dem Aspekt der »Kipppunkte« betrachten. Der Begriff verweist darauf, dass ein Kollaps kein sanfter Übergang ist, sondern eine drastische Veränderung, die das System von einem Zustand in einen anderen überführt, wobei es kurzzeitig einen instabilen Zustand durchläuft. Der Begriff wurde vor allem von Malcolm Gladwell in seinem gleichnamigen Buch (The Tipping Point) von 2009 dargelegt.4
Bei der wissenschaftlichen Untersuchung komplexer Systeme geht der Begriff des Kipppunkts mit dem des »Attraktors« einher. Manchmal ist auch von einem »seltsamen« (»strange«) Attraktor die Rede, ein Begriff, der durch den ersten Teil der Jurassic-Park-Serie Verbreitung fand. Unter einem Attraktor versteht man eine Reihe von Parametern, auf die sich ein System zubewegt. Der Kipppunkt ist systemisch betrachtet das Gegenteil: Der Attraktor zieht das System an, der Kipppunkt stößt es ab. Ein System im Zustand der sogenannten Homöostase »tanzt« gewissermaßen um einen Attraktor, bleibt in seiner Nähe, erreicht ihn aber nicht. Wenn sich das System jedoch vom Attraktor entfernt, etwa aufgrund einer äußeren Störung, kann es den Kipppunkt erreichen und auf die andere Seite, in den Einflussbereich eines anderen Attraktors kippen. In der Physik wird diese drastische Veränderung als »Phasenübergang« bezeichnet; dieser ist der entscheidende Mechanismus des Phänomens, das wir »Kollaps/Zusammenbruch« nennen.
Die Fähigkeit eines Systems, sich auch bei einer starken Störung in der Nähe eines Attraktors und vom Kipppunkt fernzuhalten, bezeichnen wir als Resilienz. Dieser Begriff wird in den verschiedensten Bereichen verwendet, von der Materialwissenschaft bis hin zur Untersuchung sozialer Systeme. Bei näherer Betrachtung stellt man rasch fest, dass es nicht immer positiv ist, so nah wie möglich am Attraktor zu bleiben. Ein starres, unelastisches System kann plötzlich und auf katastrophale Weise zusammenbrechen, beispielsweise ein Glasgefäß, das in Stücke zerbirst.
An dieser Stelle möchte ich an eine alte Weisheit erinnern, die von einem anderen Philosophen stammt, nämlich Laotse. In seinem Buch Taoteking heißt es: »Das Harte und Starre begleitet den Tod. Das Weiche und Schwache begleitet das Leben.« Tatsächlich ist der Seneca-Effekt meist die Folge des Versuchs, sich einer Veränderung zu widersetzen, statt sie anzunehmen. Je mehr Widerstand man gegen eine Veränderung leistet, desto mehr schlägt diese Veränderung zurück und überwindet schließlich diesen Widerstand. Und oft geschieht dies plötzlich. Letztlich ist dies das Ergebnis des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik: Die Entropie nimmt zu.
Es ist kein Zufall, dass Philosophen häufig dazu raten, sich nicht an materielle Dinge zu klammern, die Teil dieser schwierigen und unbeständigen Welt sind. Das ist durchaus ein guter Rat. In der Philosophiegeschichte vertrat die Schule der sogenannten Stoiker als eine der ersten diese Haltung und versuchte, sie in die Praxis umzusetzen. Auch Seneca gehörte zu den Stoikern und sein ganzes Denken ist von dieser Haltung durchdrungen. Der Satz »Das Wachstum schreitet langsam voran, während der Weg zum Ruin schnell verläuft« ist Bestandteil dieser Sichtweise. Im Umgang mit einem Kollaps sollten wir uns deshalb an den Rat Epiktets, eines anderen Lehrers der stoischen Schule, erinnern: »Wir müssen die Dinge, die in unserer Macht stehen, möglichst gut einrichten, alles andere aber so nehmen, wie es kommt.«
Daraus folgt, dass man die »Seneca-Klippe« umgehen oder zumindest die Folgen eines Kollaps abmildern kann, sofern man die Veränderung akzeptiert, statt gegen sie anzugehen. Es bedeutet, dass man niemals versuchen sollte, das System zu etwas zu zwingen, was es nicht tun will. Obwohl eigentlich klar sein müsste, dass man Entropie nicht bekämpfen kann, versuchen es Menschen immer wieder.
Jay Forrester, der Begründer der wissenschaftlichen Disziplin der »Systemdynamik«, brachte diese Neigung schon vor langer Zeit auf den Punkt, als er schrieb: »Jeder ist bemüht, ›das System‹ in die falsche Richtung zu lenken.«5 Die Politik beispielsweise scheint jeden Versuch aufgegeben zu haben, sich Veränderungen anzupassen, und greift stattdessen zu groben, schlagkräftigen Parolen, die eine unmögliche Rückkehr in die frühere Zeit der Prosperität versprechen (etwa »Amerika wieder groß zu machen«). Menschen unternehmen oft enorme Anstrengungen, um Beziehungen zusammenzuhalten, die man lieber ausklingen lassen sollte. In der Technik investiert man viel Energie in die Entwicklung von Methoden, um alte Erfindungen weiter nutzen zu können – zum Beispiel (Privat-)Automobile –, die wir wahrscheinlich besser abschaffen sollten. Auch klammern wir uns hartnäckig an unseren Arbeitsplatz, obwohl wir ihn vielleicht hassen und sogar erkannt haben, dass wir uns einen neuen suchen sollten.
Ganze Zivilisationen erlebten einen Niedergang und verschwanden, weil sie sich nicht an Veränderungen anpassten, ein Schicksal, das uns ebenfalls blühen könnte, wenn wir nicht lernen, die Veränderungen anzunehmen und uns von der hartnäckigen Sucht nach fossilen Brennstoffen zu befreien, die unseren Planeten ruinieren. Wenn wir zerstören, was die Grundlage unseres Lebens ist, bewegen wir uns wirklich in rasantem Tempo auf den Ruin zu. Haben wir noch Zeit, eine Katastrophe zu verhindern?
Vielleicht reicht sie nicht mehr ganz, aber zumindest können wir die bevorstehenden Auswirkungen abmildern, wenn wir uns vor Augen führen, was genau wir zu erwarten haben und wie wir uns den kommenden raschen Veränderungen anpassen können. Dabei darf man nicht vergessen, dass man zwar ein Problem beheben kann, nicht aber eine Veränderung. Veränderungen kann man sich nur anpassen.
Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine Reise durch die facettenreiche Wissenschaft komplexer Systeme. Dabei sind die einzelnen Kapitel relativ unabhängig voneinander und man muss sie nicht hintereinander lesen, sondern kann auch mit denen beginnen, die am meisten interessieren. Die Reise beginnt mit einem Buchteil, den ich mit der Überschrift »Die Mutter aller Zusammenbrüche« versehen habe. Es ist dem Niedergang des Römischen Reichs gewidmet, das allerdings nicht die erste Zivilisation war, die zusammenbrach. Weiter geht es mit dem Zusammenbruch einfacher (und dennoch komplexer) Systeme. Hier wird erklärt, warum Alltagsgegenstände, etwa Schiffe oder Flugzeuge, bersten – und zwar unter dem Aspekt der universellen Tendenz zur Zerstreuung thermodynamischer Potenziale in der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Der nächste Teil des Buchs widmet sich dem Zusammenbruch großer Strukturen, von den ägyptischen Pyramiden bis zu den Twin Towers des World Trade Center in New York. Diese Ereignisse geben uns Gelegenheit, das Verhalten von Netzwerken zu untersuchen, einem grundlegenden Element der Systemwissenschaft. Dieser Abschnitt erklärt im Einzelnen Aspekte der Thermodynamik in realen Systemen, aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das zu »speziell« finden. Gehen Sie einfach darüber hinweg und wechseln Sie zum nächsten Kapitel, in dem weitere Fälle systemischer Zusammenbrüche behandelt werden, etwa des Finanz- und des Ernährungssystems (Hungersnöte). Hierzu gehören auch die Themen Erschöpfung und Raubbau an Ressourcen. Und schließlich geht es um den größten möglichen Zusammenbruch in den Grenzen unseres Planeten, den »Tod Gaias«, die Auslöschung der Biosphäre.
Im zweiten Teil des Buchs schildere ich Möglichkeiten des Umgangs mit »Kollaps«. Können wir Zusammenbrüche verhindern? Welche Rolle spielt »Resilienz« bei komplexen Systemen? Ist es nicht besser, einen Zusammenbruch zuzulassen und danach etwas Neues und Besseres aufzubauen?
Im Schlusskapitel kehre ich schließlich noch einmal zum Denken Senecas und seiner stoischen Zeitgenossen zurück, deren Weisheit uns in diesen schwierigen Zeiten vielleicht hilfreich sein kann.
Nichts in diesem Buch soll das letzte Wort zu etwas sein, alles ist als Ausgangspunkt für die Reise zur Wissenschaft komplexer Systeme gedacht. Das Thema ist so umfassend, dass kein einzelnes Buch und keine Einzelperson alle Details dieses großen Feldes abzudecken in der Lage ist. Daher habe ich auf den Versuch verzichtet, eine ausführliche Abhandlung über Systemwissenschaft zu verfassen (hierfür empfehle ich die Lektüre des Buchs Principles of System Science von George Mobus und Michael Kalton6).
Ich möchte jedoch hervorheben, dass die Systemwissenschaft einen faszinierenden Blick auf die Welt um uns ermöglicht. So nahm diese Wissenschaft mit den ersten Studien von Ökosystemen ihren Anfang, wie sie Alexander von Humboldts 1845 veröffentlichtes Werk Kosmos darstellt7 und vor allem Darwins große Zusammenschau Über die Entstehung der Arten (1859). Weder Humboldt noch Darwin verwendeten Formeln und beim Studium komplexer Systeme stellt man schnell fest, dass es keine Gleichung gibt, die man so auflösen kann wie diejenige für die Bewegung eines Körpers in einem Gravitationsfeld. Das heißt jedoch nicht, dass man keine Erkenntnisse über komplexe Systeme gewinnen kann. Es gibt schließlich auch keine »Gleichung für die Katze« und doch existieren sie und man kann – mit erheblicher Sicherheit – voraussagen, dass sich eine Katze wie eine Katze verhält, also Vögel im Garten verfolgt und Katzenleckerli liebt. Man kann daher komplexe Systeme untersuchen und verstehen, auch wenn einem als Instrumente nur der gesunde Menschenverstand, Wissen und Ausdauer zur Verfügung stehen.
Ich möchte diese Einleitung mit einer Entschuldigung abschließen – dafür, dass ich aus Platzgründen und Mangel an Kenntnissen vieles ausklammern musste, aber auch für die Ungenauigkeiten und Fehler, die unvermeidlich sind, wenn man ein breites interdisziplinäres Feld in Angriff nimmt. Ich hoffe jedoch, dass das, was Sie in diesem Buch finden, ausreicht, um Ihnen zumindest einen Teil des Interesses und der Faszination zu vermitteln, die bei mir durch die Beschäftigung mit diesen Themen geweckt wurden.
Teil I
Die Mutter allerZusammenbrüche:Der Untergangdes Römischen Reichs
… und anstelle der Frage nachzugehen, warum das Römische Reich unterging, sollten wir uns vielmehr wundern, dass es so lange überdauert hat.
Die siegreichen Truppen, die in ihren Kriegen in fernen Ländern die Untugenden von Fremden und Söldnern angenommen hatten, raubten zuerst der Republik ihre Freiheit und beleidigten später die kaiserliche Majestät. Die Herrscher, die um ihre persönliche Sicherheit und den öffentlichen Frieden besorgt waren, mussten schließlich die Disziplin schleifen lassen, wodurch die Truppen beiden furchtbar wurden, ihren Herrschern und ihren Feinden; die Strenge der militärischen Führung wurde lasch und durch Constantins willkürliche Verfügungen schließlich außer Kraft gesetzt; und eine Sintflut von Barbaren überschwemmte das Römische Reich.
Edward Gibbon,The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, 1776/898
Kapitel 1
Seneca und seine Zeit
Da der Titel dieses Buchs auf einer Bemerkung des römischen Philosophen Seneca beruht, scheint es angemessen, mit dem Untergang des Römischen Reichs zu beginnen, einem Kollaps, den wir als die »Mutter aller Zusammenbrüche« bezeichnen könnten.
Ich behaupte in diesem Buch nicht, für jedes Detail dieses komplexen Themas endgültige Antworten zu haben; ich widme mich vielmehr der Frage, wie es unter Systemaspekten behandelt werden kann, das heißt unter Berücksichtigung der inneren Rückkopplungseffekte, die das Funktionieren des jeweiligen Systems steuern.
Seneca war in jeder Hinsicht das, was man gemeinhin als einen erfolgreichen Mann bezeichnet: Er war reich und einflussreich, zunächst Lehrer, dann sogar Berater Kaiser Neros. Durch allmählich wachsenden Wohlstand wurde Seneca zu einem der wohlhabendsten Männer seiner Zeit. Doch dann riss sein Glücksfaden, plötzlich und unerwartet: Erst fiel Seneca bei Nero in Ungnade, dann musste er aus der Politik ausscheiden und sich ins Privatleben zurückziehen. Bald darauf wurde er beschuldigt, an einer Verschwörung beteiligt zu sein, die angeblich darauf zielte, Nero zu töten und Seneca selbst an seiner statt zum Kaiser zu machen. Wir wissen nicht, ob er tatsächlich etwas Derartiges plante, aber allein der Verdacht veranlasste Nero, ihm die Selbsttötung zu befehlen. Seneca fügte sich seinem Kaiser und schnitt sich die Pulsadern auf, eine damals übliche Methode, sich das Leben zu nehmen. Es war ein schnelles Ende nach einem langen, von Erfolgen gekrönten Leben und wir können diese Geschichte als hervorragende Illustration dessen sehen, was Seneca an seinen Freund Lucilius geschrieben hatte: »Wachstum schreitet langsam voran, der Ruin aber kommt rasch.«
Betrachtet man die Menschheitsgeschichte oder auch nur manch’ individuelle Entwicklung, so kommt man nicht umhin, diesem Satz eine gewisse »Gesetzmäßigkeit« zuzuschreiben; ich bezeichne Ereignisse, die diesem Muster folgen, in diesem Buch daher als »Seneca-Effekt«.
Abbildung 2 Lucius Annaeus Seneca, 4 v. Chr. bis 65 n. Chr.9
Senecas rascher Weg in den Ruin spiegelt gleichsam den Untergang Roms. Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, zur Zeit Senecas, war das Römische Reich noch ein machtvolles und majestätisches Gebilde. Aber es wies bereits Risse auf, die den künftigen Kollaps ankündigten. Der erste düstere Hinweis auf die schlechten Zeiten, die bevorstanden, war womöglich die Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr., als drei römische Legionen in einen Hinterhalt gerieten und von einem Bündnis germanischer Stämme aufgerieben wurden. Für die Römer war dies mutmaßlich ein ähnlich großer Schock wie für die moderne westliche Welt der Anschlag auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001. Aus Sicht der alten Römer stand eine Niederlage durch die Hand einer Bande behaarter, ungewaschener Barbaren im Widerspruch zu den Regeln des Universums; sie war schlicht unmöglich. Aber sie war real und Kaiser Augustus, ein genialer Politiker, nutzte die Niederlage mit einer beispiellosen propagandistischen Meisterleistung für sich. Er ließ das Gerücht verbreiten, die Niederlage habe ihn so getroffen, dass er nachts durch den Palast wandere und vor sich hin murmle: »Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder!« Damit war die Rolle der Kaiser als Verteidiger der Römer für die restliche Lebenszeit des Römischen Reichs besiegelt, die sich noch über ein halbes Jahrtausend erstrecken sollte.
Der Fall Roms vollzog sich indes so langsam und allmählich, dass einige moderne Historiker nicht von einem Zusammenbruch sprechen mögen, sondern von einem kulturellen Wandel. Dennoch: Der Kollaps war real und weitaus mehr als ein Wandel der politischen Struktur des Reichs oder der kulturellen Gewohnheiten der Römer. Wie viele wirtschaftliche Parameter den Abwärtstrend anzeigten, kann man in Werken wie The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World in allen Details nachlesen.10 So ging etwa der Seehandel deutlich zurück, wie die abnehmende Zahl der Schiffswracks zeigt. Der Handel insgesamt verfiel. Dass sich die Ernährung der Römer veränderte, lässt sich an der geringeren Zahl von Tierknochen in den Müllhalden ablesen, was darauf schließen lässt, dass die Römer weniger tierisches Eiweiß zu sich nahmen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass das Ausmaß der Blei- und Kupferkontamination zurückging,11 was den Schluss zulässt, dass sich auch die metallverarbeitende Industrie auf einem absteigenden Ast befand.
Die Römer selbst hinterließen ergreifende Schilderungen des Niedergangs. Nicht dass sie die Vorgänge wirklich verstanden hätten; der einzige Autor der Antike, der eine Vorahnung in diesem Sinne hatte, war wohl Tertullian (ca. 150 bis 230 n. Chr.), dessen Werk De Anima wir die vielleicht erste Schilderung des Phänomens der »Überbevölkerung« verdanken. Die Autoren der spätrömischen Zeit beklagten die schlechte Lage, schrieben sie aber durchweg Zufallsfaktoren zu. Ferner findet man keinerlei Hinweis darauf, dass an und mit der Verwaltung des Reichs grundsätzlich etwas nicht in Ordnung war. In der Zeit um 420 bis 430 n. Chr. verfasste der römische Patrizier Rutilius Claudius Namatianus ein Gedicht mit dem Titel De Reditu Suo (Von seiner Rückkehr), eine schaurige Schilderung seiner Reise entlang der italienischen Küste, nachdem er aus Rom geflohen war, um auf seinen Besitzungen in Gallien Zuflucht zu suchen. Wir lesen darin von verlassenen Städten, zerstörten Straßen, heruntergekommenen Befestigungsanlagen – kurz: allgegenwärtigem Verfall. Leider fehlt dem überlieferten Textfragment der Schluss, sodass wir nicht erfahren, was Namatianus bei seiner Ankunft in Gallien vorfand. Wir können es uns aber vorstellen, wenn wir einen etwas späteren Autor, Paulinus von Pella, einen wohlhabenden römischen Großgrundbesitzer, heranziehen. In seinem Werk Eucharisticos (Danksagung), wahrscheinlich um das Jahr 420 verfasst, berichtet Paulinus, wie er verzweifelt versucht, seine riesigen Besitzungen in Europa zusammenzuhalten, und wie der Niedergang von Recht und Ordnung dazu führte, dass er praktisch sein ganzes Hab und Gut an plündernde Barbaren verlor.
Trotz des wirtschaftlichen Verfalls, der vermutlich mit einem Bevölkerungsrückgang verbunden war, konnte das Römische Reich seine politische Struktur bis in die Mitte des 5. Jahrhunderts, wenn auch unter wachsenden Schwierigkeiten, am Leben erhalten. In den ersten Jahren des 5. Jahrhunderts, vielleicht auch schon früher, wurden die Mauern und Befestigungsanlagen an den Grenzen des Reichs (teilweise als »Limes« bezeichnet, obwohl die Römer selbst diesen Begriff nicht verwendeten) größtenteils aufgegeben. Im Jahr 410 wurde Rom von den Goten geplündert, ein Ereignis, das die (damals bekannte) Welt erschütterte und Augustinus, Bischof der nordafrikanischen Stadt Hippo, veranlasste, sein Werk Über den Gottesstaat zu verfassen, das heute noch Leser findet. Während sich Rom davon noch erholen konnte, wurde die Stadt im Jahre 455 erneut geplündert, diesmal von den Vandalen, die sich dabei große Mengen an Gold und Silber und ihren schlechten Ruf sicherten, der ihnen bis in die Gegenwart anhaftet. Von da an war das Weströmische Reich nur noch ein Schatten seiner selbst und trat innerhalb weniger Jahrzehnte als politisches Gebilde von der Weltbühne ab. Ostrom hielt sich wesentlich länger und konnte sogar für kurze Zeit Italien zurückerobern, aber der Wiederaufbau des Weströmischen Reichs sollte ihm nicht gelingen.
Rom wurde der Sage nach im Jahr 753 v. Chr. gegründet; bedenkt man, dass das Reich irgendwann im 2. Jahrhundert n. Chr. seinen Höhepunkt der Machtentfaltung erreichte, kann man dem Römischen Reich einen rund tausend Jahre langen Aufstieg attestieren, dem ein nur zwei bis drei Jahrhunderte währender Verfall gegenübersteht – ein gutes Beispiel für den »Seneca-Effekt«. Um aber zu verstehen, wie ein Imperium kollabiert, müssen wir uns klar machen, worauf seine Existenz gründet.
Kapitel 2
Wieso gibt es eigentlich Weltreiche?
In der Geschichte der Menschheit ist das Phänomen des Weltreichs vergleichsweise neu. Mit dem Beginn des Holozän vor rund 12.000 Jahren entwickelte sich die Landwirtschaft, unsere Vorfahren begannen, Städte zu gründen, bearbeiteten Metall, lernten schreiben, schufen Kunstwerke und vieles mehr. Aber es dauerte Jahrtausende, bis Gebilde entstanden, die wir als Weltreiche oder Imperien bezeichnen. Das erste politische Konstrukt, das der modernen Idee des Imperiums nahekommt, wurde um 2300 v. Chr. von einem Warlord namens Sargon in Mesopotamien begründet, der die meisten der unabhängigen Stadtstaaten der Region eroberte und schließlich beherrschte. Über dieses uralte Reich wissen wir wenig, außer dass, wie bei den meisten späteren Imperien, auf eine ruhmreiche Serie von Siegen und Eroberungen ein Niedergang folgte, der zu seinem Zusammenbruch und Verschwinden führte; abgelöst durch ein Kommen und Gehen anderer großer Reiche in der Region. Imperien hinterlassen jedoch ein kulturelles Erbe, das ihre Lebensspanne als politisches Gebilde bei Weitem überdauern kann. Dem ersten Imperium der Menschheitsgeschichte verdanken wir beispielsweise die geistigen Hinterlassenschaft von Sargons Tochter En-hedu-anna, Prinzessin, Priesterin und Dichterin. En-hedu-anna war wohl die erste, namentlich bekannte Autorin der Geschichte; ihre Gedichte wurden auf Tontafeln festgehalten, die bei modernen archäologischen Ausgrabungen zutage kamen und wundersamerweise noch heute zu entziffern sind.12
Was also ermöglichte Imperien und machte sie letztlich zu einem verbreiteten Phänomen? Warum bestanden menschliche Gesellschaften fortan nicht mehr aus einander bekämpfenden, unabhängigen und räumlich begrenzten Stadtstaaten, sondern aus zentral verwalteten Staaten mit großen Armeen?
Zunächst einmal sind Imperien teure soziale Gebilde, die ohne einen stetigen Zustrom von Ressourcen nicht existieren können. In der Antike bildete die Landwirtschaft die Grundlage aller komplexen menschlichen Gesellschaften, aber es ging nicht nur darum, die Bürger zu ernähren, sondern auch Lebensmittel zu konservieren und zu lagern. Wir alle kennen die biblische Geschichte von den sieben fetten und den sieben mageren Kühen, von denen der ägyptische Pharao träumte, und von Moses’ Rat, Getreide für die bevorstehenden mageren Jahre aufzubewahren. Darin lag der Keim für die Wirtschaftsform des Kapitalismus – und für Begehrlichkeiten und Diebstahl im großen Maßstab: Sobald sich irgendwo Kapital akkumulierte, war damit zu rechnen, dass anderswo jemand plante, es zu stehlen. Was spätestens damit auch in der Welt war, war die Idee des »Krieges«, in der Antike (und in weiten Teilen Europas auch danach) ein wohl allgegenwärtiges Phänomen. Aber Kriege führen nicht unbedingt zu Imperien, es sei denn, jemandem gelingt es, eine Streitmacht aufzustellen, die nicht an einen einzelnen Stadtstaat gebunden ist. Im heutigen Sprachgebrauch heißt es, Krieg sei eine Frage der Führung, und die Basis der Führung ist Kommunikation bzw. Nachrichtenaustausch. Damit kennen wir die fundamentalen Elemente, die Imperien möglich mach(t)en.
Die einfachste antike Kommunikationstechnik wurde durch den Einsatz von Boten ermöglicht. Diese waren zunächst am effektivsten, wenn sie hoch zu Ross unterwegs waren. Berittene Boten gab es seit dem dritten, vorchristlichen Jahrtausend, und zwar zuerst in Mesopotamien. Unabhängig von der Art, sich fortzubewegen, mussten Informationen aber auch in materieller Form existieren und »transportierbar« sein, denn das Gedächtnis der Boten erreichte irgendwann natürlich seine Grenzen. Mutmaßlich war dies einer der Gründe für die Entwicklung der Schrift: eine Kommunikationstechnik, die unabhängig voneinander in verschiedenen Weltregionen ebenfalls im 3. vorchristlichen Jahrtausend auftauchte. So konnten schriftliche Botschaften des Königs oder Herrschers von einem Boten in ferne Regionen des Reichs getragen werden, um dort laut verlesen zu werden, was den Eindruck erweckte, als wäre der Herrscher persönlich anwesend.
Natürlich unterwarf sich niemand freiwillig oder gerne einer fremden Macht, ohne vorher nach besten Kräften gegen sie zu kämpfen, ganz gleich welch wohlklingende Worte ein berittener Bote auch verlesen mochte. Deshalb benötigten Großreiche wirksamere Methoden, um der Bevölkerung ihre Wünsche mitzuteilen. So gesehen ist Krieg eine Form der Kommunikation – zweifellos brutal, aber mit einer klaren Botschaft: Unterwerft euch oder ihr werdet getötet! Durch eine schlagkräftige Armee vermittelt, wurde diese Botschaft auch gehört – und wohl oder übel verstanden. Eine erfolgreiche Armee aufzustellen und sie zur Eroberung ferner Gebiete zu entsenden, erforderte Ressourcen – Waffen und Proviant –, aber der springende Punkt war ihre Führung: Wie konnte ein Herrscher Soldaten davon überzeugen, den Feind zu bekämpfen und, vielleicht noch schwieriger, einander nicht um der Beute willen an den Kragen zu gehen? Das Problem der Führung war zur Zeit der ersten Imperien bereits wohlbekannt. Führung hat viel mit Autorität zu tun und die antiken Könige und Herrscher eigneten sich zweifellos den entsprechenden Duktus an, indem sie auf Insignien von Macht und Größe wie prachtvolle Gewänder, Kronen und Edelsteine setzten; Zepter und weitere Requisiten machten sie sicherlich zu beeindruckenden Gestalten. Aber unabhängig davon, wie majestätisch ein Lokalfürst auftrat, seine äußere Erscheinung allein hätte wohl kaum gereicht, um Menschen zu überzeugen, ihre Heimat zu verlassen und an fernen Orten zu kämpfen, wo sie Gefahr liefen, in Stücke gehackt zu werden. Führung ist nicht nur eine Frage der Autorität, ein Anführer muss auch motivieren. Für diese Herausforderung fand sich schon in frühester Zeit ein wirkungsvolles Mittel: Um Männer für den Kampf zu gewinnen, musste man sie nur entsprechend bezahlen. Und damit war eine weitere Technik notwendig, die wir heute »Geld« nennen und die sich zum entscheidenden Element entwickeln sollte, das Imperien möglich machte.
Mit dem 3. vorchristlichen Jahrtausend erscheint Geld im Nahen Osten und in China in Gestalt von Edelmetallen, die fortan nicht mehr nur wegen ihres Werts als Dekorationsmaterial gehandelt wurden, sondern als Tauschmittel dienten. Im Laufe der Zeit bildete sich dank all dieser neuen Techniken und Errungenschaften ein weiträumiges Netz von Handelswegen heraus. Gleichzeitig wurden Metalle zur bevorzugten Beute von militärischen Raubzügen und ihre Umverteilung schuf und erhielt die großen Heere, die ehrgeizige Warlords um sich scharten. Ab dem 7. vorchristlichen Jahrhundert sehen wir die zarten Anfänge des Münzwesens. Auch aus militärtechnischer Sicht war dies ein großer Fortschritt, weil es von nun an möglich war, jeden einzelnen Kämpfer mit dem ihm zustehenden Sold zu bezahlen. Am Verhaltensmuster der Imperien änderte dies indes wenig: Sie blieben Raubtiere, dazu da, die Ressourcen ihrer Feinde zu verschlingen, allen voran deren Edelmetalle.
Um die Mitte des 3. vorchristlichen Jahrtausends waren alle nötigen Techniken vorhanden und die Bühne für den Auftritt der Imperien bereitet. Sie bildeten sich überall auf der Welt: im Mittelmeerraum, in China, Indien, Südamerika und Mexiko. In dieser Epoche sehen wir größere Armeen als je zuvor, die sich, ausgerüstet mit bis dato beispiellosen Waffen, nie dagewesener Taktiken und Strategien bedienten. Die Armeen eroberten Städte, brannten Gebäude nieder, töteten Menschen, stahlen Güter und versklavten Gefangene. Vor allem aber schufen sie Imperien: große, zentral verwaltete soziale Gebilde, zumeist regiert von jemandem, der auf einem Thron sitzt, sich mit Edelsteinen schmückt, aufwendig verzierte Waffen trägt und behauptet, der Sohn eines übernatürlichen Wesens und daher selbst etwas Besonderes zu sein. Diese überlebensgroßen Gestalten hielten sich zahlreiche Frauen, forderten bedingungslosen Gehorsam, wenn nicht sogar Anbetung, und waren häufig grausam, rachsüchtig und nicht selten auch in sexueller Hinsicht abnormal veranlagt. Aber daran hat sich auf dem Weg in die Neuzeit nicht viel geändert.
Imperien kommen und gehen in Zyklen, wobei jedes neue Reich behauptet, das größte, beste und von Gott am meisten begünstigte zu sein, das in alle Ewigkeit bestehen wird; nur um nach einer Weile zu Staub zu verfallen, nachdem die glorreiche Armee geschlagen ist, die unbesiegbaren Herrscher entthront und die ewigen Städte geplündert und niedergebrannt sind. Dann taucht ein anderes Reich auf, um den Zyklus fortzusetzen. In der modernen Welt haben wir es weiterhin mit Imperien zu tun, obwohl wir uns seltsamerweise scheuen, diese Bezeichnung auf das gewaltige Militär- und Handelsimperium anzuwenden, das wir »Globalisierung« nennen. Vielleicht liegt es daran, dass der Weltherrscher, der in Washington residiert, weder Purpur trägt noch als Halbgott firmiert oder (bisher jedenfalls) ihm zu Ehren Opfer fordert. In der langen Reihe der Imperien und Königreiche, die wie Ebbe und Flut das Gebiet des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens beherrschten, hielten sich manche länger als andere, aber keinem gelang es, mehr als nur einen kleinen Teil desjenigen Gebiets zu kontrollieren, das in Reichweite lag. Das änderte sich erst mit dem Aufstieg Roms.
Um die Mitte des 1. vorchristlichen Jahrtausends war Rom noch eine kleine Stadt in einer abgelegenen Region, die hauptsächlich für ihre rauen, ungehobelten Kämpfer bekannt war, die es zufrieden waren, sich für Kupferklumpen (sogenannte aes rude – Rohbronze) in die Schlacht zu stürzen, während ihre anspruchsvolleren Kollegen im Osten bereits Silbermünzen forderten. Aber bald schluckte Rom seine Nachbarn, einen nach dem anderen. Es wurde größer, mächtiger, reicher und aggressiver und eroberte schließlich den Großteil der Landstriche rund ums Mittelmeer. Rom wurde zum ersten Weltreich und dehnte sich bis zu einer Größe aus, die für eine Zentralverwaltung mit der damals verfügbaren Transportinfrastruktur zu regieren war.
Mehrere Ursachen trugen zur Machtfülle Roms bei, aber die wichtigste war wohl, dass die Römer in der Lage waren, die Versorgung mit Ressourcen mittels eines Logistiksystems zu steuern, das bis in die Neuzeit seinesgleichen suchte. Antike Städte waren weitgehend auf lokal erzeugte Lebensmittel angewiesen, um ihre Bevölkerung zu ernähren, und das war der wichtigste Faktor, der ihrem Wachstum Grenzen setzte.13 Die Städte hatten zudem mit den unvermeidlichen Unwägbarkeiten der landwirtschaftlichen Produktion zu kämpfen, etwa Dürren oder Schädlinge. Die Größe antiker Städte hing also sehr stark davon ab, ob es ihnen gelang, Nahrungsmittel aus fernen Regionen und nicht nur von den umliegenden Feldern einzuführen. Hierfür war der Seeweg das beste Mittel der Wahl. Der Transport auf Schiffen war sehr viel kostengünstiger als der Einsatz von Packtieren und Karren. Die Kosten für Weizen erhöhten sich pro 100 Meilen Transportweg auf der Straße um 40 Prozent, während Getreide pro 100 Meilen nur um 1,3 Prozent teurer wurde, wenn es per Schiff transportiert wurde.14 Tainter berichtet in seinem Buch The Collapse of Complex Societies15 vom Höchstpreisedikt Diokletians aus dem Jahr 301 n. Chr., demzufolge der Transport auf der Straße 28- bis 56-mal teurer war als auf dem Seeweg.
Antike Städte, die sich über den Seeweg versorgten, erreichten oft eine Bevölkerungszahl von mehr als 100.000 Einwohnern; Rom aber übertraf sie mit einer Einwohnerzahl von über einer Million alle.16 Mit ihrem Seefrachtsystem konnten die Römer ihre Hauptstadt und andere Küstenstädte mit Getreide beliefern, das in Nordafrika oder dem Nahen Osten angebaut wurde. Es unterschied sich nicht wesentlich von den durch frühere Imperien entwickelten Systemen, aber es war größer angelegt und besser organisiert als alle vorherigen. Für die Römer war das System so wichtig, dass es als göttliches Wesen betrachtet wurde – »Annona«, eine Art Fruchtbarkeitsgöttin, die Lebensmittel für die Bürger Roms bereitstellte, und das Jahr für Jahr, wie das lateinische Wort annum, Jahr, unschwer erkennen lässt. Zweifellos waren die Römer tapfere und tüchtige Krieger, aber das allein hätte nicht gereicht. Sie waren zudem einfach zahlreicher als ihre Gegner und dank des zuverlässigen Annona-Systems konnten sie eine derart große Bevölkerung (mit einer entsprechend großen Armee) auch ernähren.
Die Macht Roms beruhte jedoch auf einer weiteren erfolgreichen Technik: Geld als Werkzeug militärischer Führung. Wenn auch das Geld nicht von den Römern erfunden wurde, waren sie doch diejenigen, die es in einem bis dato beispiellosen Maßstab einsetzten. Im römischen Militärsystem gab es zwei Arten von Einheiten: die Legionen und die Hilfstruppen, die sogenannten auxilia. Die Legionen, in denen nur römische Bürger dienten, waren das Rückgrat der kaiserlichen Truppen. Bis zu einem gewissen Grad fochten die Legionäre aus Patriotismus, dennoch mussten auch sie bezahlt werden. Die auxilia hingegen bestanden aus Nichtrömern und kämpften nur des Geldes wegen. Damit war die römische Streitmacht nicht durch die Größe der römischen Bevölkerung begrenzt; mit dem Einsatz der auxilia konnte sie in dem Maße ausgeweitet werden, wie es die staatlichen Finanzmittel erlaubten.
Wie wir gesehen haben, wurden die Kämpfer mit Geld bezahlt und dafür benötigte man wiederum Metall. Schon bald waren die aes rude für die Größe und die Ambitionen der römischen Armee nicht mehr ausreichend, doch schon im 3. Jahrhundert v. Chr. kontrollierten die Römer die Goldminen der Alpen in der heutigen Schweiz und verfügten damit über hinreichende monetäre Mittel, um sich die Vormachtstellung im westlichen Mittelmeerraum zu sichern. Mit dem Sieg über das nordafrikanische Karthago, die einzige Macht, die ihnen Widerstand leisten konnte, gewannen sie Spanien und damit Zugang zu dessen reichen Goldminen. Mit diesem Gold bauten sie ihre Macht noch weiter aus – ein klassisches Phänomen der positiven Rückkopplung. Innerhalb weniger Jahrhunderte überzogen römische Armeen Europa, Nordafrika und den Nahen Osten wie ein militärischer Tsunami, der Königreiche und Republiken hinwegspülte und sie in römische Provinzen verwandelte. Im 1. nachchristlichen Jahrhundert war das Imperium Romanum, wie es nun offiziell hieß, das größte, wohlhabendste und mächtigste Reich, das es bisher im westlichen Teil Eurasiens gegeben hatte.
Wir können uns nun in etwa ausmalen, was für ein Geschöpf das Römische Reich war: ein typisches komplexes System, strukturiert und hierarchisch; ein ausgeklügeltes Gewebe von Interaktionen, ermöglicht durch ein Verkehrsnetz aus Straßen, Häfen und Seewegen, über das sich Menschen, Güter und Armeen bewegten. Gesteuert wurde es vom Kaiserhof zu Rom mittels eines Finanzsystems, das den Verkehr von Gütern, Dienstleistungen und Armeen durch Gesetze, Bürokratie und Geld lenkte. Das Römische Reich wies wie alle Imperien einige Charakteristika eines Lebewesens auf: Es konnte sein Netzwerk aus Knoten und Verknüpfungen neu arrangieren, um auf Störungen und Einflüsse von außen in verschiedenster Art und Weise zu reagieren, unter anderem durch Abwehr, Rückzug, Anpassung, Ausweitung und noch einige Strategien mehr.
Die moderne Gesellschaft hat viel von den Römern geerbt: Gesetze, Philosophie, Kunst und ein allgemeines Verständnis davon, was Zivilisation unserer Meinung nach sein sollte. Auch ihre Sprache – Latein – haben wir übernommen und adaptiert, und noch heute halten wir es für vornehm und gebildet, ihr, wenn auch selten, den Vorzug vor unserer modernen Alltagssprache zu geben. Bis vor hundert Jahren war das Römische Reich immer noch so populär, dass sich die russischen Herrscher den Titel »Zar« gaben, abgeleitet vom Namen des ersten römischen Kaisers, und sie nannten Moskau das »Dritte Rom«. Auch war es in den 1930er-Jahren in Italien Mode, eine römische Toga und eine seltsame römische Axt namens fasces zu tragen. Dahinter stand der Gedanke, dass das kleine italienische Reich von damals den Ruhm und die Macht des Römischen Reichs der Antike wieder aufleben lassen würde. Die Geschichte macht mit solchen Träumen kurzen Prozess, und alles, was dieses italienische Reich auszeichnete, war und ist, dass es womöglich das kurzlebigste Imperium der Geschichte gewesen ist.
Heute sind diese Vorstellungen weitgehend vergessen, nachdem die Globalisierung viele Kulturen einander nähergebracht hat, die sich nicht auf römische Ahnen berufen. Aber die Vorstellung, das Römische Reich sei etwas Großes und Wichtiges gewesen, begleitet uns bis in die Gegenwart. Wenn das aber zutrifft, warum ist dann ein so gewaltiges Gebilde kollabiert und verschwunden? Und (und das führt uns zu einer weitaus beunruhigenderen Frage): Könnte der modernen Zivilisation ein ähnlicher Kollaps drohen?