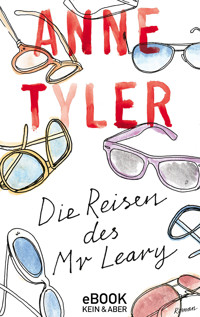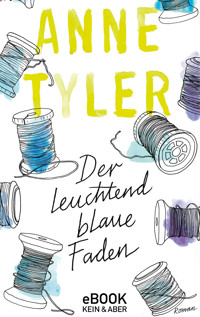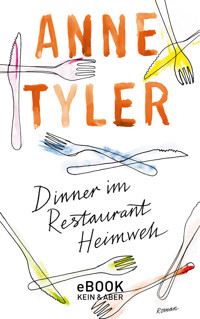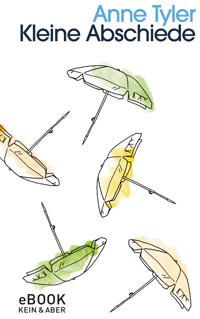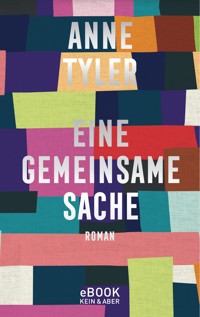12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Micah Mortimer liebt Gewohnheiten, Selbstgespräche und eine ordentliche Wohnung. Jeden Tag beginnt er mit einem Morgenlauf um 7.15 Uhr, duscht, frühstückt und widmet sich anschließend geduldig den Computerproblemen seiner Kunden aus der Nachbarschaft. Nachmittags ist er im Nebenjob Hausmeister und kümmert sich um das Mietshaus, in dem er wohnt; ein paar Abende die Woche verbringt er auf der Couch seiner unkomplizierten Freundin Cass. Doch dann droht Cass die Wohnungskündigung, und sie möchte bei ihm einziehen. Und ein Teenager taucht auf, der behauptet, sein Sohn zu sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anne Tyler, geboren 1941 in Minneapolis, Minnesota, ist die Autorin von 22 Romanen. Sie erhielt den Sunday Times Award für ihr Lebenswerk sowie den Pulitzerpreis. Sie ist Mitglied der American Academy und des Institute of Arts and Letters. Bei Kein & Aber erschienen mehrere Romane von Anne Tyler, zuletzt Die Launen der Zeit. Mit ihrem Roman Der leuchtend blaue Faden stand sie auf der Shortlist des Man Booker Prize und des Women’s Prize for Fiction. Anne Tyler lebt in Baltimore.
ÜBER DAS BUCH
Micah Mortimer liebt Gewohnheiten, Selbstgespräche und eine ordentliche Wohnung. Jeden Tag beginnt er mit einem Morgenlauf um 7.15 Uhr, duscht, frühstückt und widmet sich anschließend geduldig den Computerproblemen seiner Kunden aus der Nachbarschaft. Nachmittags ist er im Nebenjob Hausmeister und kümmert sich um das Mietshaus, in dem er wohnt; ein paar Abende die Woche verbringt er auf der Couch seiner unkomplizierten Freundin Cass. Doch dann droht Cass die Wohnungskündigung und sie möchte bei ihm einziehen. Und ein Teenager taucht auf, der behauptet, sein Sohn zu sein.
Feinfühlig und mit Witz gibt Anne Tyler Einblick in das Herz und den Kopf eines Mannes, der meint, alles unter Kontrolle zu haben, bis ihn das Leben überrollt.
1.
Man wüsste wirklich gern, was im Kopf eines Mannes wie Micah Mortimer vor sich geht. Er lebt allein, ein Einzelgänger mit unumstößlichen Gewohnheiten. Jeden Morgen um Viertel nach sieben sieht man ihn zu seiner Joggingrunde aufbrechen. Um zehn, halb elf klatscht er das TECH EREMIT-Magnetschild aufs Dach seines Kia. Er besucht die Kunden zu unterschiedlichen Zeiten, doch es vergeht kein Tag, an dem nicht mehrere seiner Dienste bedürfen. Nachmittags trifft man ihn bei der Arbeit rings um das Mietshaus an, denn im Nebenjob betätigt er sich dort als Hausmeister. Er fegt die Gehwegplatten, schüttelt die Fußmatte aus oder bespricht sich mit einem Klempner. Weil am nächsten Tag der Müll abgeholt wird, zieht er montagabends die Restmülltonnen in die schmale Durchfahrt neben dem Gebäude, mittwochabends die Wertstofftonnen. Gegen zweiundzwanzig Uhr erlischt das Licht in den drei kleinen, geduckten Fenstern hinter der Sockelbepflanzung. (Seine Wohnung liegt im Souterrain und dürfte wenig Freundliches haben.)
Ein großer, knochiger Mann Anfang vierzig, mit ziemlich schlechter Körperhaltung. Sein Kopf ragt leicht nach vorn, der Rücken ist ein wenig rund. Pechschwarz das Haar, doch lässt er das Rasieren einen Tag lang bleiben, wachsen in letzter Zeit graue Stoppeln. Blaue Augen, mächtige Brauen, Hohlwangen. Ein verkniffen wirkender Mund. Immer in Jeans und, je nach Jahreszeit, in einem T-Shirt oder Sweatshirt und bei großer Kälte mit einer stellenweise abgewetzten braunen Lederjacke bekleidet. Verschrammte braune Schuhe mit abgerundeter Kappe, dürftig wie die Schuhe eines Schuljungen. Auch beim Joggen trägt er nur einfache, alte schmutzig weiße Sneakers – ohne fluoreszierende Streifen und Gelsohle oder anderem bei Läufern beliebtem Firlefanz – und eine auf Kniehöhe abgeschnittene Jeans.
Er hat eine Freundin, doch offenbar leben beide eher für sich. Hin und wieder sieht man sie mit einer Take-away-Tüte durch seine Hintertür gehen oder sie brechen am Wochenende morgens mit dem Kia auf, ohne das TECH EREMIT-Schild. Männliche Freunde scheint es nicht zu geben. Zu den Mietern ist er nett, mehr nicht. Sie begrüßen ihn, wenn sie ihm begegnen. Dann nickt er freundlich und hebt die Hand, oft ohne etwas zu sagen. Niemand weiß, ob er Verwandtschaft hat.
Das Mietshaus steht in Govans. Ein kleiner, dreigeschossiger Backsteinkasten östlich der York Road im Norden Baltimores, rechts eine Forellenräucherei, links ein Secondhandladen. Hinter dem Gebäude befindet sich ein winziger Parkplatz, davor eine winzige Rasenfläche. Eine deplatziert wirkende Veranda, genau genommen nichts weiter als ein Vorplatz aus Betonplatten mit einer Hollywoodschaukel aus splittrigem Holz, in der nie ein Mensch sitzt, und einem Klingelschild mit senkrecht angeordneten Knöpfen neben der schäbigen Tür.
Geht er jemals in sich und denkt über sein Leben nach, über den Sinn, den Witz des Ganzen? Bedrückt es ihn, dass er wahrscheinlich die nächsten dreißig, vierzig Jahre so leben wird? Keiner weiß es. Und so gut wie sicher hat ihm diese Fragen noch nie jemand gestellt.
An einem Montag Ende Oktober saß er noch beim Frühstück, als der erste Anruf kam. Normalerweise verlief sein Vormittag folgendermaßen: joggen, duschen, frühstücken, ein bisschen aufräumen. Er hasste es, wenn der übliche Ablauf eine Störung erfuhr. Er zog das Handy aus der Hosentasche und warf einen Blick auf das Display. EMILY PRESCOTT. Eine alte Dame, mit der er schon so oft zu tun gehabt hatte, dass sie in seinen Kontakten gespeichert war. Alte Damen hatten die einfachsten Reparaturen, aber die quengeligsten Fragen. Sie wollten immer den Grund erfahren. »Warum ist das passiert?«, hieß es dann. »Als ich gestern Abend ins Bett ging, war mit dem Computer noch alles in Ordnung, und heute Morgen ist er komplett hinüber, obwohl ich ihn gar nicht angefasst habe. Ich lag ja die ganze Zeit im Bett und habe geschlafen!«
»Na ja, egal. Jetzt ist er jedenfalls repariert«, sagte er dann.
»Aber warum musste er repariert werden? Wodurch ist er kaputtgegangen?«
»Diese Frage sollte man im Zusammenhang mit einem Computer nie stellen.«
»Warum nicht?«
Andererseits lebte er von den alten Damen, und diese hier wohnte noch dazu ganz in der Nähe, in Homeland. Er drückte auf Annehmen und meldete sich mit »Tech-Eremit«.
»Mr Mortimer?«
»Ja.«
»Hier spricht Emily Prescott, erinnern Sie sich an mich? Es handelt sich um einen schlimmen Notfall.«
»Was ist los?«
»Mein Computer hat den Geist aufgegeben! Er streikt einfach! Er geht auf keine Website mehr, obwohl das WLAN-Signal noch da ist!«
»Haben Sie es schon mit einem Reboot versucht?«
»Was ist das?«
»Das Gerät aus- und wieder einschalten, so wie ich es Ihnen gezeigt habe.«
»Ach so, ja, ja. ›Ihm eine kleine Auszeit gönnen‹, nenne ich das immer.« Sie lachte fahrig auf. »Ja, habe ich versucht, aber es hat nicht geholfen.«
»Okay. Ich könnte gegen elf kommen.«
»Gegen elf Uhr?«
»Genau.«
»Aber meine Enkelin hat am Mittwoch Geburtstag, und ich muss das Geschenk rechtzeitig bestellen, damit genug Zeit für die Gratis-Standardlieferung bleibt.«
Er schwieg.
»Tja also«, sagte sie und seufzte. »Gut, dann um elf. Ich warte. Wissen Sie noch, wo ich wohne?
»Ja, weiß ich noch.«
Er legte auf und biss in seinen Toast.
Seine Wohnung war größer, als man es bei einem im Souterrain gelegenen Apartment erwartet hätte. Neben einem langen, offenen Raum, der als Wohnzimmer und Küche diente, gab es zwei weitere Zimmer und ein Bad. Die Decke hatte eine annehmbare Höhe, und der Boden bestand aus gar nicht einmal unansehnlichen zart gestreiften Vinylfliesen in Elfenbeinweiß. Vor der Couch lag ein kleiner beiger Teppich. Die schmalen, kurz unterhalb der Decke befindlichen Fenster boten zwar kaum Ausblick, aber ob die Sonne schien, so wie heute, ließ sich immer erkennen, und jetzt, in der Zeit des verfärbten Laubs, waren rings um die Wurzeln der Azaleensträucher ein paar vertrocknete Blätter zu sehen. Vielleicht würde er ihnen später mit dem Rechen zu Leibe rücken.
Er leerte die Kaffeetasse, schob den Stuhl zurück, stand auf und trug das Geschirr zur Spüle. Er hatte ein ganz bestimmtes System: Während Teller, Tasse und Besteck einweichten, wischte er Tisch und Arbeitsfläche ab, stellte die Butter in den Kühlschrank und säuberte mit dem Stielstaubsauger den Bereich unter dem Stuhl von etwaigen herabgefallenen Krümeln. Der eigentliche Staubsaugtag war zwar Freitag, doch er blieb gern auch zwischendurch am Ball.
Montag war der Bodenwischtag für Küche und Bad. »Das gefurrrchtete Feudeln«, murmelte er, während er einen Eimer mit heißem Wasser volllaufen ließ. Bei der Arbeit führte er oft Selbstgespräche mit fremdländischem Akzent. Im Augenblick war es ein deutscher, eventuell auch russischer. »Das lastige Wischen derr Boden.« Zuvor mit dem Staubsauger durchs Bad zu gehen konnte er sich sparen, denn der Boden war noch von letzter Woche her makellos sauber. Sah man nach dem Putzen einen Unterschied – glänzte der Couchtisch plötzlich und war der Teppich mit einem Mal flusenfrei –, hatte man Micahs persönlicher Theorie zufolge mit dem Putzen zu lange gewartet.
Auf seine Fähigkeiten im Haushalt bildete er sich eine Menge ein.
Nach dem Wischen leerte er den Eimer in das Becken in der Waschküche und lehnte den Mopp an den Boiler. Dann ging er zurück und nahm den Wohnbereich in Angriff. Er faltete die Couchdecke zusammen, entfernte mehrere Bierdosen und klopfte die Kissen in Form. Das Mobiliar war sehr überschaubar – die Couch, ein Couchtisch und ein hässlicher brauner Liegesessel aus Kunstleder. Alles war bei seinem Einzug schon da gewesen; nur das metallene Kellerregal für seine Technikzeitschriften und Handbücher stammte von ihm. Alles, was er sonst noch las – hauptsächlich Krimis und Biografien –, holte er sich aus dem öffentlichen Bücherschrank und stellte es nach erfolgter Lektüre zurück, damit er sich keine weiteren Regale anschaffen musste.
Nachdem der Küchenboden in der Zwischenzeit getrocknet war, kehrte Micah an die Spüle zurück, wusch das Frühstücksgeschirr, trocknete es ab und räumte es ein. (Manche ließen es an der Luft trocknen, doch er hasste den Anblick eines überladenen Abtropfgestells.) Dann setzte er seine Brille auf – randlose Fernsichtgläser zum Autofahren –, nahm das magnetische Dachschild und seine Umhängetasche und verließ die Wohnung durch die Hintertür.
Die Hintertür befand sich im rückwärtigen Teil des Gebäudes, am Fuß einer Treppe aus Betonstufen, die zum Parkplatz hinaufführte. Nach dem Aufstieg blieb er kurz stehen, um eine Einschätzung des Wetters vorzunehmen. Es war jetzt wärmer als während seines Morgenlaufs, und der Wind hatte sich gelegt. Gut, dass er die Jacke nicht mitgenommen hatte. Er befestigte das Schild auf dem Wagendach, stieg ein, ließ den Motor an und winkte Ed Allen zu, der mit einer Lunchbox zu seinem Pick-up trottete.
Am Steuer tat Micah gerne so, als stünde er unter Beobachtung eines alles registrierenden Überwachungssystems, des von ihm so bezeichneten Verkehrsgotts. Der Verkehrsgott bestand aus einem Trupp Männer, die in Hemdsärmeln und mit grünen Stirnschirmen Micahs perfekten Fahrstil kommentierten. »Achtet mal darauf, dass er auch dann blinkt, wenn keiner hinter ihm ist«, sagten sie beispielsweise. Micah blinkte ausnahmslos immer, sogar auf seinem eigenen Parkplatz. Beim Beschleunigen stellte er sich, ganz wie es sich gehörte, ein Ei unter dem Gaspedal vor; beim Bremsen glitt er fast unmerklich in den Stillstand. Und wenn ein anderer Fahrer glaubte, in letzter Sekunde auf Micahs Spur wechseln zu müssen, drosselte Micah verlässlich sein Tempo und ließ ihm mit einer leichten Aufwärtsbewegung der linken Hand höflich den Vortritt. »Habt ihr das gesehen?«, sagten die Verkehrsgott-Männer. »Der Bursche hat einwandfreie Manieren.«
Das machte das Fahren ein bisschen weniger dröge.
Er bog in die Tenleydale Road ein und parkte am Straßenrand. Als er nach der Tasche greifen wollte, klingelte sein Handy. Er zog es hervor, schob die Brille auf die Stirn und las, was auf dem Display stand. CASSIA SLADE. Das war ungewöhnlich. Cass war seine Partnerin (er weigerte sich, eine Frau Ende dreißig als seine »Freundin« zu bezeichnen), aber um diese Zeit telefonierten sie normalerweise nicht. Um diese Zeit war sie in der Arbeit, steckte knietief in Viertklässlern. Er tippte auf Annehmen und fragte: »Was gibts?«
»Ich werde rausgeschmissen.«
»Was?«
»Ja, ich soll ausziehen.« Micah schätzte ihre tiefe, monotone Stimme, in der jetzt allerdings eine gewisse Anspannung mitschwang.
»Wie kannst du rausgeschmissen werden, wenn es nicht deine Wohnung ist?«
»Heute Morgen ist Nan aufgetaucht. Unangekündigt.« Nan war die offizielle Mieterin. Sie war zu ihrem Verlobten in dessen Eigentumswohnung in der Nähe des Hafens gezogen, ohne ihr Apartment gekündigt zu haben, was Micah verstand, Cass nicht. (Ein Hintertürchen sollte man sich immer offen lassen.) »Sie hat ohne Vorwarnung geklingelt«, berichtete Cass. »Ich hatte keine Zeit, den Kater zu verstecken.«
»Ach so, der Kater«, sagte Micah.
»Ich habe gebetet, dass er nicht zur Tür kommt, und mich so gut es ging in Nans Blickfeld gestellt. Ich dachte, hoffentlich will sie nicht rein, aber sie sagte ›Ich muss nur kurz etwas holen, bin gleich wieder – Was ist das?‹ und starrte an mir vorbei auf Whiskers, der natürlich genau in diesem Moment den Kopf durch die Küchentür steckte, obwohl er sonst, du kennst ihn ja, Fremde nicht ausstehen kann. Ich habe ihr zu erklären versucht, dass ich mir nicht bewusst eine Katze angeschafft hatte, sondern Whiskers im Lichtschacht vorn am Haus gefunden habe, aber sie sagte: ›Darum geht es nicht. Du weißt, dass ich eine lebensbedrohliche Allergie gegen Katzen habe. Ein kleiner Luftzug in einem Raum, den vor einem Monat eine Katze durchquert hat, ein einziges kleines Katzenhaar auf einem Teppich, und ich – o mein Gott, mir schnürt es schon die Kehle zusammen!‹ Dann ist sie Richtung Treppe zurückgewichen und hat abgewunken, als ich ihr nachgehen wollte. ›Warte doch!‹, habe ich noch gesagt, aber sie meinte nur: ›Ich melde mich.‹ Und was das bedeutet, kannst du dir denken.«
»Nein, keine Ahnung«, erwiderte Micah. »Sie wird dich heute Abend anrufen und dich zusammenstauchen, und du wirst dich entschuldigen und fertig. Whiskers wirst du allerdings abschaffen müssen.«
»Ich kann Whiskers nicht abschaffen, jetzt wo er sich hier endlich zu Hause fühlt!«
Weil Micah sie im Großen und Ganzen für eine vernünftige Frau hielt, verblüffte ihn das Getue um die Katze immer wieder. »Warum malst du den Teufel an die Wand? Bisher hat sie nur gesagt, dass sie sich meldet.«
»Und wohin soll ich ziehen?«, fragte Cass.
»Kein Mensch hat etwas von Ausziehen gesagt.«
»Noch nicht.«
»Bevor du zu packen beginnst, wartest du bitte ab, ob sie das überhaupt will, hörst du?«
»Man findet nicht so leicht eine Wohnung, in der Haustiere erlaubt sind«, fuhr Cass fort, als hätte sie ihn nicht gehört. »Was, wenn ich auf der Straße lande?«
»Cass. In Baltimore leben Hunderte Menschen mit Haustieren. Glaub mir, du findest sicher eine andere Wohnung.«
Cass schwieg. Am anderen Ende der Leitung hörte er Kinderstimmen. Offenbar war gerade Pause und sie stand auf dem Schulhof.
»Cass?«
»Na ja, dann danke fürs Zuhören«, sagte sie brüsk und ging aus der Leitung.
Sein Blick verharrte kurz auf dem Display. Dann schob er die Brille auf die Nase und verstaute das Handy in der Hosentasche.
»Ich bin die dümmste Pute von allen Ihren Kunden, nicht wahr?«, sagte Mrs Prescott.
»Ach was, Sie sind nicht mal unter den ersten zehn«, erwiderte er wahrheitsgemäß.
Ihre Wortwahl amüsierte ihn, denn mit ihrem kleinen runden Kopf und der kissenartigen, aus Busen und Bauch bestehenden kompakten Wölbung über den dünnen Beinchen erinnerte sie tatsächlich ein wenig an eine Truthenne. Selbst bei sich zu Hause trug sie Schuhe mit kleinen Absätzen, die ihrem Gang etwas Ruckartiges gaben.
Micah saß auf dem Boden unter Mrs Prescotts Schreibtisch, einem massiven antiken Rollladen-Sekretär mit verblüffend kleiner Arbeitsfläche. (Die Leute platzierten ihre Computer an den absurdesten Stellen, weil ihnen offenbar nicht bewusst war, dass sie nicht mehr mit Füllfederhaltern schrieben.) Aus dem Wirrwarr, das der spannungsgeschützten Steckerleiste entsprang, hatte er zwei in seiner eigenen gleichmäßigen Handschrift mit MODEM beziehungsweise ROUTER gekennzeichnete Kabel entfernt. Nun blickte er konzentriert auf den Sekundenzeiger seiner Armbanduhr, sagte nach einer Weile »Okay«, steckte das Modemkabel wieder ein und starrte erneut auf den Sekundenzeiger.
»Meine Freundin Glynda – Sie kennen sie nicht, aber ich liege ihr ständig in den Ohren, dass sie sich mit Ihnen in Verbindung setzen soll«, sagte Mrs Prescott. Sie hat nämlich Angst vor ihrem Computer! Sie schreibt damit nur E-Mails, weil sie ihm keine Informationen geben will, sagt sie. Ich habe ihr von Ihrem Büchlein erzählt.«
»Mm-hmm.« Micahs Buch mit dem Titel Erst mal Stecker rein! zählte zu den besser verkäuflichen Titeln von Woolcott Publishings. Doch Woolcott war ein rein lokales Unternehmen, sodass Micah mit dem Buch nie Reichtümer erwerben würde.
Er steckte das Routerkabel ein und wand sich unter dem Schreibtisch hervor. »Das ist das Schwierigste an meinem Job«, erklärte er Mrs Prescott, während er sich mühsam auf die Knie stemmte und am Schreibtisch hochzog.
»Was reden Sie da! Sie sind doch noch jung!«
»Jung? Ich werde vierundvierzig.«
»Eben«, sagte Mrs Prescott und fügte übergangslos hinzu: »Ich habe Glynda erzählt, dass Sie auch Schulungen geben, aber sie meint, sobald Sie weg wären, hätte sie bestimmt alles wieder vergessen.«
»Da hat sie recht«, erwiderte Micah. »Sie soll einfach mein Buch kaufen.«
»Aber eine Schulung ist so viel – oh! Sehen Sie sich das an!«
Die Hände unter dem Kinn verschränkt blickte sie auf den Monitor und rief mit vor Begeisterung bebender Stimme »Amazon!«.
»Ja. Haben Sie gesehen, was ich gemacht habe?«
»Also, ich … nein, nicht so richtig.«
»Ich habe das Gerät ausgeschaltet, den Modemstecker ausgesteckt und den Routerstecker ausgesteckt. Die Kabel sind gekennzeichnet, sehen Sie?«
»Ach, Mr Mortimer, das kann ich mir im Leben nicht merken!«
»Wie Sie meinen.« Er griff nach dem Klemmbrett, das er auf dem Schreibtisch abgelegt hatte, und begann die Rechnung zu schreiben.
»Ich möchte meiner Enkeltochter eine afroamerikanische Babypuppe schenken. Was halten Sie davon?«
»Ist Ihre Enkeltochter Afroamerikanerin?«
»Nein. Wie kommen Sie darauf?«
»Dann würde es wohl eher komisch aussehen.«
»Oje, das will ich nicht hoffen!«
Er riss das Originalblatt vom Quittungsblock und gab es ihr. »Es ist mir unangenehm, Ihnen für das bisschen Arbeit überhaupt etwas zu berechnen.«
»Aber ich bitte Sie – Sie haben mir das Leben gerettet! Eigentlich müsste ich Ihnen das Dreifache zahlen«, erwiderte Mrs Prescott und holte ihr Scheckbuch.
Das Problem war, dachte er auf der Heimfahrt, dass sein Job ihn auch dann kaum ernähren würde, wenn sie ihm das Dreifache gezahlt hätte. Andererseits machte ihm die Arbeit Spaß, und er war sein eigener Chef. Er ließ sich nicht gern herumkommandieren.
Einst hatte man größere Erwartungen in ihn gesetzt. Er war als Erster in seiner Familie aufs College gegangen. Sein Vater hatte für Baltimore Gas & Electric Bäume beschnitten, seine Mutter war Kellnerin gewesen, ein Beruf, den seine vier Schwestern bis zum heutigen Tag ausübten. Micah hatten sie als die große Verheißung betrachtet, die sich letztlich jedoch nie erfüllte. Zum einen hatte er sein Teilstipendium mit einer Reihe von Gelegenheitsjobs aufbessern müssen, was das Lernen erschwerte. Noch stärker aber war ins Gewicht gefallen, dass er sich das College anders vorgestellt hatte: als einen Ort, an dem er alle Antworten erhalten, eine Universalformel an die Hand bekommen würde, mit deren Hilfe er sein Leben organisieren könnte. Stattdessen war ihm das College wie die verlängerte Highschool erschienen. Vorn standen die gleichen alles immer und immer wiederholenden Lehrer, auf den Stühlen saßen die gleichen gähnenden, zappelnden, schwätzenden Schüler. Seine Begeisterung verflog. Er begann zu bummeln, wechselte zwei Mal das Hauptfach und landete in Informatik, wo es wenigstens konkret zuging – ja oder nein, schwarz oder weiß, logisch und systematisch wie Domino. Mitten in seinem Abschlussjahr (das er erst nach fünf statt vier Jahren erreicht hatte) brach er das Studium ab und gründete mit seinem Kommilitonen Deuce Baldwin ein Software-Unternehmen. Deuce brachte sein Geld ein, Micah sein Wissen, genauer gesagt ein selbst entwickeltes Programm zum Sortieren und Archivieren von E-Mails, das mittlerweile natürlich völlig veraltet war. Die Welt hatte sich weitergedreht. Damals aber war er damit in eine echte Marktlücke gestoßen, was es umso bedauerlicher machte, dass Deuce sich als ein Mensch erwies, mit dem man nicht auskommen konnte. Reiche Söhnchen – alle die gleichen anmaßenden Wichtigtuer! Es war immer schlimmer geworden, bis Micah eines Tages kurzerhand ging. Weil er es versäumt hatte, sich die Rechte zu sichern, konnte er nicht einmal sein Programm mitnehmen.
Er bog auf seinen Stellplatz ein und schaltete den Motor ab. 11:47 zeigte die Armbanduhr an. »Tadellos«, murmelte der Verkehrsgott. Micah hatte die gesamte Fahrt ohne einen einzigen Fehler, Patzer oder Korrekturbedarf absolviert.
Eigentlich war sein Leben schön. Es gab keinen Grund zum Unglücklichsein.
Ein Mann wollte seine Computerviren loswerden und ein kleiner Lebensmittelladen, ein Familienbetrieb, elektronische Rechnungen einführen. Zwischen den beiden Terminen sah sich Micah einen defekten Wandschalter in 1B an. 1B war Yolanda Palma, eine theatralisch wirkende Frau, schätzungsweise Anfang fünfzig, mit wallender dunkler Mähne und einem traurigen, schlaffen Gesicht. »Und was tut sich in Ihrem Leben?«, fragte sie, während er die Spannung prüfte. Sie verhielt sich immer so, als wären sie alte Freunde, was nicht der Fall war. »Ach, nicht viel«, erwiderte er, hätte sich die Antwort aber auch sparen können, denn Yolanda verkündete bereits: »Also, ich bin wieder voll dabei. Ich habe mir ein neues Datingportal gesucht und ganz von vorn angefangen. Manche lernens eben nie.«
»Und – wie läuft es?« Der Schalter war mausetot.
»Gestern Abend habe ich mich mit einem Mann auf einen Drink im Swallow at the Hollow getroffen. Immobilieninspektor. Eins fünfundachtzig wäre er groß, hat er behauptet, aber das kennt man ja. Und ein paar Pfund weniger hätten auch nicht geschadet – andererseits kann ich mir da am allerwenigsten ein Urteil erlauben. Jedenfalls kam raus, dass er seit dreieinhalb Wochen geschieden ist. Seit dreieinhalb – als hätte er die Tage gezählt, aber nicht im positiven Sinn, sondern so, als wäre seine Scheidung eine persönliche Tragödie! Und prompt fängt er sofort damit an, seine Frau hätte umwerfend ausgesehen, wie ein Model, und Kleidergröße vierunddreißig getragen. Und weil sie ohne jede Ausnahme nur Stilettos besaß, wären die Sehnen in den Fersen verkürzt und ihre Füße immer durchgestreckt gewesen. Wenn sie nachts barfuß ins Bad wollte, musste sie auf den Zehenspitzen gehen. Er hat es erzählt, als würde das eine Frau unglaublich attraktiv machen, aber ich habe die ganze Zeit eine Frau mit Hufen vor mir gesehen, wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Ich muss einen neuen Schalter besorgen«, erklärte Micah.
Sie zündete sich eine Zigarette an und stieß den Rauch hastig aus, um weitersprechen zu können. »Okay«, erwiderte sie beiläufig, während sie das Feuerzeug in ihre Tasche fallen ließ. »Nach dem ersten Drink habe ich gesagt, dass ich jetzt besser nach Hause gehe. ›Nach Hause?‹, fragt er, und dann sagt er doch glatt ›Ich dachte, wir könnten vielleicht zu mir‹, legt seine Hand auf mein Knie und schaut mir vielsagend in die Augen. Ich erwidere den Blick und erstarre. Sage kein Wort. Da nimmt er endlich die Hand weg und meint: ›Na ja, dann wohl eher nicht.‹«
»Ha!«, rief Micah.
Er montierte die Schalterabdeckung. Yolanda sah ihm nachdenklich zu. Jedes Mal, wenn sie Rauch ausstieß, fuchtelte sie ihn von Micah weg. »Heute Abend ist es ein Zahnarzt.«
»Sie versuchen es tatsächlich noch mal?«
»Er war nie verheiratet. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist.«
Micah bückte sich, um den Schraubenzieher in die Werkzeugtasche zurückzustecken. »Zum Baumarkt schaffe ich es wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen.«
»Ich bin zu Hause«, erwiderte sie.
Sie war offenbar immer zu Hause. Micah wusste nicht, womit sie ihr Geld verdiente.
Auf dem Weg zur Tür fragte sie plötzlich »Na, was denken Sie?« und verzog das Gesicht abrupt zu einer gruseligen Fratze, um ihr Gebiss zu zeigen. Ihre Zähne waren ungewöhnlich groß und hatten so extrem gerade Kanten, dass sie wie eine Doppelreihe Klaviertasten aussahen.
»Worüber?«, fragte er.
»Könnten die einem Zahnarzt gefallen?«
»Klar.«
Ihre Raucherei allerdings weniger, dachte er insgeheim.
»Er hat wirklich nett geklungen, als wir uns geschrieben haben.«
Plötzlich strahlte sie, und ihr Gesicht war nicht mehr schlaff.
Montagabends sahen Cass und er sich normalerweise nicht. Doch als er nach dem letzten Auftrag des Tages von einer Fußpflegepraxis außerhalb des Autobahnrings nach Hause fuhr, stach ihm auf der linken Straßenseite das weiße Schild mit dem fast unleserlichen roten Schriftzug seines Lieblings-Barbecuelokals ins Auge. Er fuhr spontan auf den Parkplatz und schrieb Cass eine Nachricht. Was dagegen, wenn ich zum Abendessen komme und etwas von Andy Nelson mitbringe? Offenbar war sie schon von der Arbeit zurück, denn sie meldete sich sofort. Gute Idee! Micah stellte den Motor ab und ging in das Lokal.
Es war fünf geworden. Er musste inmitten eines dichten Pulks von Arbeitern in ausgebeulten Overalls, knutschenden Pärchen und gestresst wirkenden Frauen mit schreienden Kindern warten. Der Geruch nach Rauch und Essig machte ihn hungrig; er hatte mittags nur eine Scheibe Rosinenbrot mit Erdnussbutter gegessen. Schließlich kaufte er doppelt so viel, wie nötig gewesen wäre – nicht nur Spare Ribs, sondern auch Grünkohl, Kartoffelecken und Maisbrot –, und brauchte zwei Plastiktüten. Während der gesamten Fahrt auf der Schnellstraße quälte ihn der von der Rückbank nach vorn wabernde Duft.
Er geriet mitten in die Rushhour, ließ sich jedoch von den Radiowarnungen vor stockendem Verkehr nicht nervös machen, sondern schloss die Hände locker ums Lenkrad und betrachtete die Berge in der Ferne, die verrostet wirkten. Über Nacht hatten sich die Bäume matt orange verfärbt.
Cass wohnte in der Nähe der Harford Road. Das mit weißen, bereits leicht ergrauten Schindeln verkleidete und vorn mit einer Veranda ausgestattete Haus konnte man von außen für ein Einfamilienhaus halten, doch innen führte im Eingangsbereich rechter Hand eine Treppe zu ihrer Wohnung im ersten Stock. Oben nahm Micah beide Tüten in eine Hand, um anklopfen zu können. »Das riecht himmlisch«, sagte Cass, als sie ihn hereinließ. Sie nahm ihm eine Tüte ab und ging voraus in die Küche.
»Ich war in Cockeysville, und plötzlich ist mein Wagen praktisch von allein auf den Parkplatz abgebogen«, erzählte er. »Kann allerdings sein, dass ich es mit der Menge ein bisschen übertrieben habe.« Er stellte seine Tüte auf die Arbeitsfläche und gab Cass einen flüchtigen Kuss.
Sie trug noch ihre Lehrerinnensachen – irgendeinen Rock, irgendeinen Pullover, nichts Besonderes in gedeckten Farben. Er fand ihre Kleidung in Ordnung, ohne sie richtig wahrzunehmen. Eigentlich fand er ihre ganze Erscheinung in Ordnung. Sie war groß, eine Frau mit beträchtlicher Oberweite, breiten Hüften und langsamen Bewegungen. Aus ihren matronenhaften schwarzen Pumps ragten stämmige Waden. Sie hatte überhaupt etwas Matronenhaftes, was Micah anziehend fand. Sein Interesse an grazilen jungen Frauen war vollständig erloschen. Cass hatte ein breites Gesicht mit unaufgeregten Zügen, graugrüne Augen und machte nur wenig Aufhebens um ihre Frisur. Das glatte, hellblonde Haar hing achtlos gescheitelt fast bis auf die Schultern herab.
Sie hatte den Tisch bereits gedeckt und eine Rolle Küchenpapier in die Mitte gestellt, denn für Spare Ribs genügten normale Servietten nicht. Während sie das Essen auspackte und auf dem Tisch verteilte, holte Micah zwei Dosen Bier aus dem Kühlschrank. Eine gab er Cass, mit der anderen setzte er sich auf den Stuhl gegenüber.
»Wie war dein Tag?«, fragte sie.
»Ganz okay. Und deiner?«
»Na ja, abgesehen davon, dass Nan Whiskers entdeckt hat …«
»Ach ja, stimmt.« Das hatte er ganz vergessen.
»Als ich nach Hause kam, hatte sie eine Nachricht aufs Band gesprochen. Ich soll sie anrufen.«
Micah wartete. Cass nahm sich von dem Grünkohl und reichte ihm den Behälter.
»Und was wollte sie?«, fragte er schließlich.
»Das weiß ich noch nicht.«
»Du hast sie noch nicht angerufen?«
Cass beugte sich über den Styroporbehälter und suchte drei Rippchen aus. In der Art, wie sie dabei den Mund verzog, lag etwas Bockiges. Plötzlich ahnte Micah, wie sie als Kind gewirkt hatte.