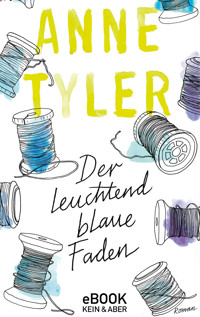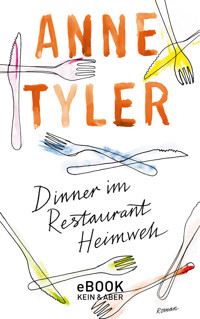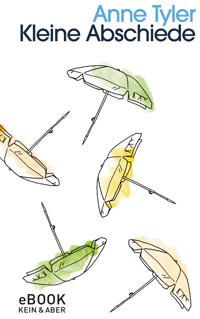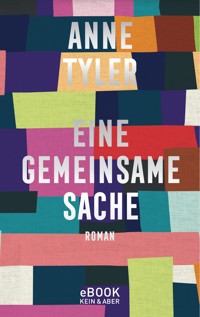
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie bei der Familie Tull in "Dinner im Restaurant Heimweh" und den Whitshanks in "Der leuchtend blaue Faden" begleitet Anne Tyler in "Eine gemeinsame Sache" die
unvergessliche Familie Garrett im Laufe mehrerer Jahrzehnte. Dabei deckt sie nicht nur Geheimnisse auf, sondern zeigt, wie wir all die subtilen Äußerungen von
Liebe, Enttäuschung, Stolz und Ablehnung unserer Nächsten verinnerlichen. Denn schon das Verhalten eines einzelnen Familienmitglieds kann die familiären Beziehungen über Generationen hinweg prägen. Anne Tyler zeichnet ihre Figuren mit feinem Witz, voller Empathie und so nahe am Leben, dass sich jede und jeder im geschilderten Familienleben wiedererkennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anne Tyler, geboren 1941 in Minneapolis, Minnesota, ist die Autorin von zahlreichen Romanen. Sie erhielt den Pulitzerpreis sowie den Sunday Times Award für ihr Lebenswerk. Bei Kein & Aber erschienen von ihr die Bestseller Der leuchtend blaue Faden, Launen der Zeit und Der Sinn des Ganzen, mit dem sie für den Booker Prize nominiert war. Anne Tyler lebt in Baltimore.
ÜBER DAS BUCH
Anne Tyler lässt uns eintauchen in das Gefüge der Familie Garrett: ein mitreißender, warmer und humorvoller Roman, der uns aufzeigt, wie nah und gleichzeitig fern sich einzelne Familienmitglieder sein können und wie sie sich gegenseitig über Generationen hinweg prägen. Ein Familienporträt so dicht am Leben erzählt, dass sich jede und jeder darin wiedererkennt.
1
Dies trug sich im März 2010 zu, als der Bahnhof von Philadelphia noch eine Anzeigetafel hatte, deren Plättchen bei jeder neuen Gate-Information laut ratterten. Serena Drew stand davor und starrte auf die Zeile, die den nächsten Zug nach Baltimore ankündigte. Warum dauerte es hier so lange, bis sie das Gate bekanntgaben? In Baltimore erfuhr man das viel früher.
Ihr Freund, der neben ihr stand, war entspannter. Nach einem kurzen Blick auf die Tafel hatte er sich in sein Handy vertieft. Jetzt schüttelte er angesichts einer Nachricht den Kopf und scrollte zur nächsten.
Serena und James kamen gerade vom Sonntagsbesuch bei James’ Eltern, Serenas erstem Treffen mit den beiden. Zwei Wochen lang hatte sie sich mit der Frage beschäftigt, was sie anziehen sollte, und sich letztlich für Jeans und Rollkragenpulli entschieden (das Standardoutfit der Master-Studentinnen, das nicht übertrieben bemüht wirkte). Außerdem hatte sie sich überlegt, welche Gesprächsthemen infrage kämen. Es war ziemlich gut gelaufen, fand sie. Seine Eltern hatten sie herzlich begrüßt und ihr sofort das Du angeboten (»George«, »Dora«), und weil Dora wie ein Wasserfall geredet hatte, war der Smalltalk kein Problem gewesen. »Beim nächsten Mal musst du unbedingt die Schwestern von James und ihre Männer und Kinder kennenlernen«, hatte Dora nach dem Essen gesagt. »Wir wollten dich bei deinem ersten Besuch nicht gleich überfordern.«
Beim nächsten Mal. Bei deinem ersten Besuch. Es hatte viel versprechend geklungen.
Doch jetzt war Serena zu schlapp vor Erleichterung, um auch nur das leiseste Triumphgefühl aufzubringen. Sie fühlte sich völlig ausgelaugt.
James und sie hatten sich zu Beginn des neuen Studienjahrs kennengelernt. Er sah so gut aus, dass sie es kaum glauben konnte, als er sie nach dem Seminar auf einen Kaffee einlud. Er war groß und schlank, hatte einen braunen Wuschelkopf und einen kurzen Bart. (Während Serena fast pummelig war und sich ihr sandheller Pferdeschwanz kaum von ihrer blassen Haut abhob.) In den Seminaren saß er lässig zurückgelehnt da, machte sich nie Notizen und schien gar nicht zuzuhören, meldete sich aber plötzlich mit erstaunlich klugen Bemerkungen. Sie hatte befürchtet, er würde sie vergleichsweise dröge finden, doch außerhalb der Uni war er von Anfang an nett gewesen. Sie gingen oft ins Kino und in günstige Lokale, und Serenas Eltern, die in der Stadt wohnten, mochten ihn sehr und hatten James und sie schon mehrmals zum Abendessen eingeladen.
Der Bahnhof von Philadelphia machte mehr her als der von Baltimore. Er war riesig, und an der hohen Kassettendecke hingen längliche Lampen, die an umgedrehte Wolkenkratzer erinnerten. Auch die Reisenden wirkten einen Tick vornehmer als die in Baltimore. Serena sah sogar eine Frau mit einem eigenen Gepäckträger, der ihr das Kofferset hinterherschob. Während sie das Gepäck bewunderte (dunkelbraunes, glänzendes Leder mit Messingbeschlägen), fiel ihr Blick auf einen jungen Mann im Anzug, der stehengeblieben war, um den Wagen vorbeizulassen. »Oh«, sagte sie.
James blickte von seinem Handy auf. »Hm?«
»Ich glaube, das ist mein Cousin«, sagte Serena kleinlaut.
»Wo?«
»Da drüben. Der im Anzug.«
»Du glaubst, er ist dein Cousin?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher.«
Sie betrachteten den Mann. Er wirkte älter als James und Serena, wenn auch nicht wesentlich (vielleicht lag es am Anzug), und hatte Serenas helles Haar und ihren spitzen Amorbogen. Doch während ihre Augen das in der Familie Garrett typische Blau aufwiesen, waren seine von einem fast durchsichtigen Grau, das auch aus mehreren Metern Distanz auffiel. Der Gepäckwagen war inzwischen vorbeigerollt, doch der Mann ging nicht weiter, sondern hob den Blick zur Anzeigetafel.
»Ja, das könnte Nicholas sein«, sagte Serena.
»Vielleicht sieht er ihm nur ähnlich«, meinte James. »Wenn er es wirklich wäre, würdest du ihn mit Sicherheit erkennen.«
»Wir haben uns länger nicht gesehen. Er ist der Sohn von David, dem Bruder meiner Mutter. Sie wohnen hier in Philly.«
»Geh hin und frag ihn. Was ist schon dabei?«
»Und wenn ich mich geirrt habe, stehe ich blöd da.«
James kniff die Augen zusammen und sah sie verständnislos an.
»Jetzt ist es sowieso zu spät«, sagte Serena, denn der Mann, wer immer er war, hatte die benötigte Information offenbar gefunden. Er drehte sich um, zog den Tragegurt seiner Reisetasche ein Stück höher auf die Schulter und schlug den Weg zur anderen Seite des Bahnhofs ein. Serena sah noch einmal auf die Anzeigetafel. »An welchem Gate fährt der Zug normalerweise ab? Vielleicht riskieren wir es einfach und gehen schon mal hin.«
»Er fährt nicht gleich los, sobald das Gate bekannt ist«, erklärte James. »Man muss sich oben an der Treppe anstellen und warten.«
»Aber dann finden wir vielleicht keine Plätze nebeneinander.«
Er grinste auf die verschmitzte Art, die sie so liebte. »Typisch du«, sollte das heißen.
»Schon gut, ich mache mir mal wieder zu viele Gedanken.«
James wechselte das Thema. »Den eigenen Cousin erkennt man doch auch, wenn man ihn länger nicht gesehen hat!«
»Erkennst du alle deine Cousins und Cousinen, wenn sie unerwartet vor dir stehen?«
»Ja.«
»Sicher?«
»Na klar!«
Sie bemerkte, dass er das Interesse an der Sache schon wieder verloren hatte. Er sah zum Imbissbereich auf der anderen Seite und sagte: »Ich könnte eine Limo vertragen.«
»Kannst du dir im Zug kaufen.«
»Willst du auch was?«
»Ich warte, bis wir im Zug sind.«
James verstand nicht, worum es ihr ging, denn er sagte »Wenn sie das Gate bekanntgeben, bevor ich zurück bin, stellst du dich schon mal an« und zog unbeschwert los.
Sie waren noch nie zusammen weggefahren, nicht mal für einen kleinen Tagesausflug wie diesen. Serena war etwas enttäuscht, dass er ihre Reiseangst nicht teilte.
Kaum war sie allein, holte sie ihre Puderdose aus dem Rucksack und überprüfte ihre Zähne im Spiegel. Zum Nachtisch hatte es eine Art Obstcrumble mit gehackten Walnüssen gegeben, die sie noch immer im Mund spürte. Normalerweise wäre sie kurz in die Gästetoilette verschwunden, doch die Zeit war knapp geworden – »Oh, oh, euer Zug!«, hatte Dora gerufen –, und sie waren Hals über Kopf zum Bahnhof aufgebrochen. James’ Vater hatte am Steuer gesessen, James daneben, Dora und Serena hinten. »Damit wir Frauen uns in Ruhe unterhalten können«, wie sich Dora ausgedrückt hatte. In dem Gespräch hatte Dora erwähnt, dass Serena unbedingt James’ Schwestern kennenlernen müsse, und dann gefragt: »Wie viele Geschwister hast du eigentlich, meine Liebe?«
»Nur einen Bruder, aber der war bei meiner Geburt fast erwachsen. Ich habe mir immer Schwestern gewünscht.« Serena war rot geworden, weil es möglicherweise so geklungen hatte, als wäre sie darauf aus, in James’ Familie einzuheiraten.
Dora hatte sie halbherzig angelächelt und ihr die Hand getätschelt.
Doch Serena hatte es wörtlich gemeint. In dem gemütlichen kleinen Zuhause bei ihren Eltern hatte sie ihre Schulfreundinnen immer um deren große, lebhafte Verwandtschaft beneidet, die aus dem Lachen nicht herauskam und um Raum und Aufmerksamkeit rivalisierte. Einige hatten sogar Halbgeschwister und Stiefmütter oder Stiefväter, die sie in Anspruch nahmen, solange es ihnen passte, und mit denen sie nichts mehr zu tun haben wollten, sobald es schlecht lief – so wie Kinder reicher Leute völlig annehmbares Essen wegwarfen, während die Hungerleidenden sehnsüchtig zusahen.
Warts ab, sagte sie sich. Wer weiß, wie deine zukünftige Familie mal aussieht!
Der Anzeigetafel zufolge hatte der Zug nach Baltimore fünf Minuten Verspätung, was wahrscheinlich eher fünfzehn bedeutete. Und das Gate fehlte noch immer. Serena drehte sich um und hielt Ausschau nach James. Da war er auch schon, Gott sei Dank. Er kam mit einem Trinkbecher in der Hand auf sie zu. Und neben ihm, einen halben Schritt hinterher, ging der Mann, von dem sie dachte, er könnte ihr Cousin sein. Sie blinzelte verwundert.
»Schau, wen ich mitgebracht habe!«, sagte James, als er bei ihr angekommen war.
»Serena?«, fragte der Mann.
»Nicholas?«
»Hey!« Er streckte ihr die Hand entgegen, überlegte es sich anders, beugte sich vor und schlang unbeholfen einen Arm um ihre Schulter. Er roch nach frisch gebügelter Baumwolle.
»Was machst du hier?«, fragte sie.
»Ich bin auf dem Weg nach New York.«
»Ach so.«
»Zu einem Meeting morgen früh.«
»Aha.« Wahrscheinlich ein Geschäftstermin. Sie hatte keine Ahnung, was er beruflich tat. »Wie gehts deinen Eltern?«
»Gut. Aber sie werden natürlich nicht jünger. Mein Dad braucht wahrscheinlich ein neues Hüftgelenk.«
»Mist.«
»Ich habe ihn am Zeitungskiosk entdeckt«, sagte James auf den Zehen wippend. »Ich bin einen Meter hinter ihm stehen geblieben und habe ganz leise ›Nicholas?‹ gesagt.« Er wirkte höchst zufrieden mit sich.
»Ich dachte zuerst, ich hätte es mir eingebildet, und habe zur Seite geschielt, ohne den Kopf zu bewegen –«
»Den eigenen Namen nimmt man eher wahr«, erklärte James. »Hätte ich beispielsweise ›Richard‹ gesagt, hättest du es wahrscheinlich gar nicht gehört.«
»Meine Mom hat auch Probleme mit der Hüfte«, sagte Serena zu Nicholas. »Ist vielleicht genetisch bedingt.«
»Deine Mutter ist … Alice?«
»Nein, Lily.«
»Ach ja, stimmt, entschuldige. Aber bei Großvater Garretts Begräbnis hab ich neben dir gesessen, oder?«
»Nein, neben Candle.«
»Ich habe eine Cousine, die Candle heißt?«
»Ihr seid wirklich unglaublich«, sagte James fassungslos.
»Sie heißt eigentlich Kendall«, fuhr Serena fort, ohne ihn zu beachten. »Aber als sie klein war, konnte sie ihren Namen nicht richtig aussprechen.«
»Du warst aber auch da, oder?«, fragte Nicholas.
»Beim Begräbnis? Ja klar.«
Sie war erst zwölf gewesen. Und er? Fünfzehn, sechzehn, damals ein Riesenunterschied. Sie hatte sich nicht getraut, mit ihm zu reden, sondern ihn nur von Weitem betrachtet, als hinterher alle vor dem Bestattungsunternehmen herumstanden – seine verschlossene Miene und seine blassgrauen Augen. Die hatte er von seiner Mutter Greta, an ihre Augen konnte sich Serena gut erinnern.
»Eigentlich sollten wir nach der Trauerfeier beim Mittagessen dabei sein«, sagte Nicholas, »aber Dad musste wegen einer Schulaufführung zurückfahren.«
»Apropos zurückfahren …« James unterbrach das Gespräch und deutete mit dem Daumen auf die Anzeigetafel über ihnen. »Wir müssen zu Gate fünf.«
»Ach ja, stimmt. Gut, dann lass uns gehen«, sagte Serena, und zu Nicholas: »Das war wirklich ein schöner Zufall.«
»Finde ich auch.« Er lächelte sie an, hob die Hand in James’ Richtung und wandte sich zum Gehen.
»Sag deiner Familie schöne Grüße!«, rief Serena.
»Mach ich.«
Sie blickten ihm eine Weile nach, obwohl sich neben dem Schild vor Gate fünf bereits eine Schlange bildete.
»Eines muss man euch lassen«, sagte James. »Der Ausdruck ›entfernte Verwandte‹ erhält durch euch eine ganz neue Bedeutung.«
*
Der Zug war weniger voll als erwartet, und sie fanden problemlos zwei Plätze nebeneinander. Serena setzte sich ans Fenster, James auf den Sitz am Gang. Er klappte das Tablett herunter und stellte seinen Becher ab. »Willst du jetzt was trinken?«, fragte er. »Ich glaube, das Bordrestaurant ist geöffnet.«
»Nein, passt schon.«
Sie beobachtete die anderen Passagiere, die im Gang an ihnen vorbeikamen. Eine Frau schob zwei trödelnde Kleinkinder vor sich her, eine andere versuchte vergeblich, ihren Koffer auf die Ablage zu stemmen, bis James aufstand und ihr half.
»Ihr seid euch vom Typ her ähnlich, aber für einen Verwandten hätte ich ihn nie gehalten«, sagte er, als er wieder saß.
»Wie bitte? Ach so, Nicholas.«
»Hast du so wahnsinnig viele Cousins?«
»Nein, nur, äh … fünf Cousins und Cousinen«, antwortete sie, nachdem sie in Gedanken nachgezählt hatte. »Alles Garretts, mein Vater war Einzelkind.«
»Ich habe elf.«
»Du Glücklicher«, sagte sie frotzelnd.
»Trotzdem würde ich jeden von ihnen überall erkennen.«
»Gut, aber wir leben alle so weit verstreut. Onkel David wohnt hier in Philly, Tante Alice in Baltimore County …«
»Uuh, im County, gaanz weit weg!«, sagte James und stieß sie in die Rippen.
»Wir sehen uns eben nur auf Hochzeiten und Begräbnissen und so.« Serena dachte kurz nach. »Und nicht mal da sind alle dabei. Ich weiß auch nicht, warum.«
»Vielleicht hat deine Familie ein tiefes, dunkles Geheimnis.«
»Ja klar.«
»Vielleicht ist dein Onkel Republikaner. Oder deine Tante in einer Sekte.«
»Ach, hör auf!«, sagte Serena lachend.
Sie mochte es, so nah bei ihm zu sein. Die Armlehne zwischen ihnen war nach oben geklappt, sodass sie sich berührten. Obwohl sie schon acht Monate zusammenwaren, empfand sie ihn noch immer als wunderbar neu und überhaupt nicht selbstverständlich.
Der Zug machte einen Ruck nach vorn und die letzten Fahrgäste nahmen hastig ihre Plätze ein. »Guten Tag, meine Damen und Herren«, begrüßte der Schaffner über Lautsprecher. »Sie befinden sich in Zug Nummer …« Serena holte ihr Ticket aus dem Rucksack. Vor dem Fenster glitt der dunkle Bahnsteig vorbei; sie fuhren ins Tageslicht und nahmen an Geschwindigkeit auf. Rechts und links verfallende Betonbauten, über und über mit Graffitis in schrillen Farben besprüht.
»Und? Was sagst du zu meinen Eltern?«, fragte James.
»Sie sind sehr, sehr nett.« Nach einer kleinen Pause fragte sie: »Glaubst du, sie finden mich nett?«
»Natürlich. Warum sollten sie dich nicht nett finden?«
Die Antwort stellte sie nicht ganz zufrieden. Nach kurzem Zögern fragte sie: »Was mochten sie an mir?«
»Hm?«
»Haben sie was gesagt?«
»Dazu hatten wir keine Gelegenheit. Aber ich habe es ihnen angesehen.«
Wieder blieb Serena eine Weile still.
»In Philly zugestiegen?« Der Schaffner war neben ihnen aufgetaucht.
»Ja, Sir.« James griff nach Serenas Ticket und reichte es ihm zusammen mit seinem.
»Meine Mom hat sich wahnsinnige Mühe mit dem Essen gegeben«, sagte er, als der Schaffner weitergegangen war. »Dieses Hähnchengericht ist ihr ganzer Stolz, das kocht sie nur für besondere Gäste.«
»Es hat toll geschmeckt.«
»Und im Auto hat Dad mich gefragt, ob ich glaube, dass du mir noch länger erhalten bleibst.«
»Erhalten … Ach so!«
»›Warten wirs ab‹, habe ich gesagt.«
Ein weiterer Rippenstoß und ein neckischer Seitenblick.
Beim Dessert hatte seine Mutter das Familienalbum geholt und Serena Kinderfotos von James gezeigt. (Er war ein richtig süßes Kerlchen gewesen.) James hatte sich mit einer Grimasse bei Serena entschuldigt, sich dann aber ebenfalls in das Album vertieft und alle Kommentare über ihn begierig aufgesogen. »Bis er zwölf oder dreizehn war, hat er nur weiße Sachen gegessen«, sagte seine Mutter.
»Du übertreibst!«, widersprach James.
»Ein Wunder, dass er nicht an Skorbut erkrankt ist.«
»Jetzt sieht er jedenfalls ziemlich gesund aus«, hatte Serena erwidert.
Und Dora und sie hatten ihn lächelnd betrachtet.
Der Zug flog durch Brachland voller struppiger gelber Sträucher. Überall lagen rostige Küchenspülen herum, Traktorreifen und unendlich viele blaue Plastiktüten. »Ein Ausländer, der gerade angekommen ist und mit dem Zug Richtung Süden fährt, würde garantiert denken ›Was, das ist Amerika? Das ist das Gelobte Land?‹«, bemerkte Serena.
»Das sagst ausgerechnet du! Als läge Baltimore mitten in einer paradiesischen Landschaft.«
»Nein, ich meine die ganze Amtrak-Strecke. Den ganzen Nordostkorridor.«
»Ah ja.«
»Mir war nicht bewusst, dass es da einen Wettbewerb gibt«, sagte sie scherzhaft.
»Ich weiß eben, wie arrogant ihr in Baltimore seid. Ihr stuft die Leute nach der Highschool ein, auf die sie gegangen sind, und später heiratet ihr sogar jemanden aus eurer Highschool.«
Serena drehte den Kopf übertrieben langsam nach links und rechts. »Sitzt hier neben mir irgendwer aus meiner Highschool?«
»Im Augenblick nicht«, gab er zu.
»Na also.«
Sie wartete gespannt auf die nächste Bemerkung, doch er verfolgte das Thema nicht weiter, und eine Zeit lang schwiegen sie. Eine Frau hinter ihnen telefonierte. »Aber wie geht es dir wirklich?«, fragte sie mit sanfter, einschmeichelnder Stimme, und nach einer Pause: »Bitte, Süßer, sag schon, was los ist. Ich spüre doch, dass irgendwas ist.«
»Der arme Nicholas«, sagte James unvermittelt. »Sein Dad zieht mit seiner Familie aus Baltimore weg, und schon redet die restliche Sippe nicht mehr mit ihnen.«
»Das geht nicht von uns aus, sondern von ihnen. Genauer gesagt von Onkel David. Meine Mom versteht es bis heute nicht, als kleines Kind war er total extrovertiert. Tante Alice war eher eine Spaßbremse, aber Onkel David war ein richtiger Sonnenschein, immer gut drauf. Und als Erwachsener haut er vorzeitig vom Begräbnis seines eigenen Vaters ab.«
Großvaters Begräbnis, hatte Nicholas gesagt. »Großvater Garretts Begräbnis.« Niemand hatte Pop-Pop je »Großvater« genannt. Warum wusste Nicholas das nicht?
»Und deine Tante«, sagte James. »Die ist nie weiter weggezogen als nach Baltimore County, aber nein, oh nein! Mit der reden wir nie wieder ein Wort!«
»So ein Quatsch. Wir reden ständig mit ihr«, erwiderte Serena. Es war nur leicht übertrieben.
Warum rechtfertigte sie sich andauernd? Wahrscheinlich weil sie gestresst war. Gestresst von der der ersten Begegnung mit seinen Eltern.
Ursprünglich hatten sie ein ganzes Wochenende bleiben wollen. James hatte ihr schon erzählt, wo man die besten Philly Cheesesteaks bekam, und gefragt, ob sie ins Museum of Art gehen wolle. »Das Gruselkabinett wird dir gefallen.«
»Welches Gruselkabinett?«
»So bezeichnen meine Eltern mein Zimmer.«
»Ach so. Ha, ha.«
»Die Wände zugepflastert mit Eagles-Postern und unterm Bett Sandwich-Rinden von 1998.«
»Aber nicht zum Übernachten, oder?«, hatte sie gefragt.
»Wie, nicht zum Übernachten?«
»Wir schlafen nicht im Gruselkabinett, oder?«
»Hey, das war nur Spaß. Zumindest das mit den Sandwich-Rinden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mom seit meinem Auszug mindestens ein Mal durchgesaugt hat.«
»Aber ich übernachte im Gästezimmer«, hatte sie gesagt. Es war als Frage gemeint gewesen.
»Du willst im Gästezimmer übernachten?«
»Ja, schon.«
»Du willst nicht mit mir in meinem Zimmer übernachten?«
»Nicht bei deinen Eltern.«
»Bei meinen …« Er war sich selbst ins Wort gefallen. »Meine Eltern gehen hundertprozentig davon aus, dass wir miteinander schlafen. Glaubst du, sie würden sich deswegen aufregen?«
»Ist mir egal, ob sie davon ausgehen oder nicht. Ich will einfach nicht, dass es so offensichtlich ist, wenn ich zum ersten Mal dort bin.«
James hatte sie kurz gemustert.
»Es gibt doch auch ein Gästezimmer, oder?«, hatte Serena gefragt.
»Ja.«
»Wo ist dann das Problem?«
»Ich finde es irgendwie … affig, sich oben an der Treppe Gute Nacht zu sagen und dann in verschiedene Zimmer zu gehen.«
»Tja, das tut mir leid«, hatte Serena pikiert erwidert.
»Außerdem würde ich dich vermissen. Und meine Eltern wären total verwirrt. ›Das darf nicht wahr sein‹, würden sie sagen. »Haben die jungen Leute noch nie was von Sex gehört?« »Sch!«, hatte Serena gemacht, denn sie saßen in der Bibliothek, wo jeder mithören konnte. Nach einem Blick durch den Raum hatte sie sich über den Tisch gebeugt und geflüstert: »Lass uns an einem Sonntag fahren.«
»Was würde das ändern?«
»Wir sagen, dass es samstags nicht geht und wir deshalb an einem Sonntag kommen, und weil ich am Montagmorgen ein Seminar habe, entfällt die Übernachtung.«
»Mensch, Serena! Sollen wir ernsthaft wegen ein paar lausiger Stunden die weite Strecke fahren, nur damit wir so tun können, als wären wir doch kein richtiges Paar?«
Genau so war es gekommen. Serena hatte sich durchgesetzt.
Sie hatte ihn enttäuscht. Wahrscheinlich hielt er sie für eine Heuchlerin. Trotzdem war sie zufrieden mit ihrer Entscheidung.
Sie näherten sich Wilmington. Vereinzelte, unbewohnt wirkende Häuser wichen nach und nach strahlend weißen Bürogebäuden. Der Schaffner schritt durch den Gang und zog die Reservierungskärtchen aus den Schlitzen über bestimmten Sitzplätzen.
»Zum Beispiel das, was deine Mutter über meinen Schwager gesagt hat«, brach es aus James heraus.
»Was? Wovon redest du?«
»Als ich zum ersten Mal zum Essen bei euch war, habe ich deiner Mutter erzählt, dass ein Schwager von mir aus Baltimore stammt, und sie sagte ›Ach, wirklich? Wie heißt er?‹, und als ich ›Jacob Rosenbaum, aber alle nennen ihn Jay‹ geantwortet habe, hat sie erwidert: ›Rosenbaum … Dann kommt er wahrscheinlich aus Pikesville. Da leben die meisten Juden.‹«
»Meine Mutter ist eben ein bisschen von gestern«, sagte Serena.
James warf ihr einen Blick zu.
»Was ist? Hältst du sie für eine Antisemitin?«
»Ich sage nur, dass viele Leute in Baltimore dieses Wir-und-die-anderen-Denken haben.«
»Reitest du noch immer auf Baltimore rum?«
»Ich wollte es nur erwähnt haben.«
»Warum sollte die Familie deines Schwagers nicht in Pikesville wohnen?«, sagte Serena. »Und genauso gut könnte sie in Cedarcroft wohnen, als Nachbarn meiner Eltern. Schließlich sind unsere Viertel nicht nur bestimmten Gruppen vorbehalten.«
»Schon klar«, erwiderte James hastig. »Ich wollte nur sagen, dass die Leute in Baltimore meiner Meinung nach andere gern in Schubladen stecken.«
»Das tun alle Menschen.«
»Stimmt …«
»Und was ist mit dem Spruch, den deine Mutter bei der Verabschiedung gebracht hat?«
»Hä?«
»›Beim nächsten Mal bleibt ihr übers Wochenende‹, hat sie gesagt. ›Am besten über Ostern. Da treffen wir uns alle, und du kannst miterleben, wie es in einer großen Familie zugeht.‹«
Serena hatte unbeabsichtigt einen schnippischen, schwatzhaften Ton angeschlagen, obwohl Dora überhaupt nicht so klang. James war das nicht entgangen, er sah sie scharf an. »Was ist daran so schlimm?«
»Ich fand das abschätzig – so nach dem Motto ›Du Arme! Wir sind eine echte Familie, während ihr nur eine kleine Möchtegern-Familie seid.‹«
»›Echte Familie‹ hat sie nicht gesagt, gerade hast du sie mit ›große Familie‹ zitiert.«
Serena bestritt das zwar nicht, zog die Mundwinkel aber trotzdem nach unten.
Wir sind die große, offene Familie, ihr seid die arme kleine, beschränkte Familie. Nichts anderes hatte Dora gesagt, aber darüber wollte Serena mit James nicht streiten.
Das Problem mit großen, offenen Familien war ihre Beschränktheit in Bezug auf weniger offene Familien.
Der Zug fuhr jetzt langsamer. »Wilmington!«, tönte es aus dem Lautsprecher. »Sehr geehrte Fahrgäste, bitte achten Sie beim Aussteigen auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante und lassen Sie keine Gepäckstücke oder Wertgegenstände …« Vor dem Fenster glitt der sonnenhelle Bahnsteig in Serenas Blickfeld. Die Leute, die dort standen, strahlten eine solche Heiterkeit und Vorfreude aus, als bedeutete das Besteigen dieses Zugs die Erfüllung all ihrer Hoffnungen.
Serena dachte an das Weihnachtsgeschenk, das James von ihren Eltern bekommen hatte. Einen Tag bevor er über die Feiertage heimgefahren war, hatte er bei ihnen gegessen, und auf seinem leeren Teller hatte eine schmale, flache, in Geschenkpapier verpackte Schachtel gelegen. Serena war vor Scham innerlich zusammengezuckt. Bitte mach, dass es nichts allzu Persönliches ist, keine … Andeutung! Auch James hatte sich erkennbar unwohl gefühlt. »Für mich?«, fragte er. Doch als er die Schachtel ausgepackt hatte, war Serena erleichtert. Sie enthielt ein Paar Socken in leuchtendem Orange, jeweils mit einem schwarzen Bund, auf dem BALTIMORE ORIOLES stand. In der Mitte prangte das Orioles-Maskottchen.
»Du wohnst jetzt in Baltimore, und wir fanden, du solltest dich entsprechend kleiden«, erklärte Serenas Vater. »Und damit du keine Probleme mit deinen Leuten in Philly bekommst, haben wir ein Modell ausgesucht, das nichts verrät, solange du die Hosenbeine nicht hochkrempelst.«
»Gut durchdacht«, sagte James. Er bestand darauf, sie sofort anzuziehen, und stolzierte strumpfsockig durchs Zimmer, bis sie sich zum Essen setzten.
Dass Serenas Eltern beide keine Sportfans waren, hatte er natürlich nicht gewusst. Sie hätten vermutlich keinen einzigen Spieler der Orioles nennen können – übrigens auch keinen der Ravens. Allein die Mühe, die es sie gekostet haben musste, sich dieses Geschenk für ihn auszudenken, rührte Serena fast zu Tränen.
Neben ihr ertönte ein »Hey«.
Sie schwieg.
»Hey, Reenie.«
»Was?«
»Streiten wir uns jetzt wegen unserer Verwandten?«
»Ich streite mich nicht.«
Der Zug fuhr mit einem Ruck weiter. Ein verloren wirkender Mann mit Aktentasche kam den Gang herunter. Hinter ihnen sagte die Frau mit der schmeichlerischen Stimme: »Das besprechen wir am Dienstag mit dem Management, mein Schatz. Hörst du, Süßer?«
»Nicht zu fassen, jetzt telefoniert die noch immer«, murmelte Serena.
Nach ein paar Sekunden erwiderte James, ebenfalls im Flüsterton: »Nicht zu fassen, dass das Gespräch geschäftlich ist. Hättest du das gedacht?«
»Niemals.«
»Da soll nochmal einer behaupten, Frauen verhalten sich im Beruf genauso wie Männer.«
»Na, na – nicht sexistisch werden!«, sagte Serena lachend.
James nahm ihre Hand und verschränkte seine Finger mit ihren. »Ganz ehrlich: Wir waren beide gestresst. Eltern können wahnsinnig anstrengend sein.«
»Wem sagst du das.«
Eine Zeit lang herrschte friedliches Schweigen.
»Apropos abschätzig – hast du mitgekriegt, was meine Mom über meinen Bart gesagt hat?«, fragte James plötzlich.
»Nein, was hat sie gesagt?«
»Als sie dir das Album gezeigt hat. Bei den Fotos aus der Highschool-Zeit hat sie gesagt ›Das ist James bei der Abschlussfeier. Sieht er nicht gut aus? Da hatte er noch keinen Bart.‹ Ständig zieht sie über meinen Bart her, sie hasst ihn.«
»Sie ist eine Mutter. Alle Mütter hassen Bärte.«
»Als ich im ersten Collegejahr damit nach Hause kam, hat mir Dad zwanzig Dollar angeboten, damit ich ihn abrasiere. ›Du jetzt auch?‹, habe ich gesagt. ›Was soll das?‹ Und er: ›Ich persönlich habe nichts gegen Bärte, aber deiner Mutter tut es weh, dass sie dein hübsches Gesicht nicht mehr sieht.‹ ›Soll sie sich die alten Fotos von mir vornehmen, wenn sie unbedingt mein Gesicht sehen will‹, habe ich geantwortet.«
»Auf dem Abschlussfoto siehst du allerdings wirklich sehr gut aus«, sagte Serena.
»Du findest doch nicht etwa auch, dass ich ihn abrasieren soll?«
»Nein, mir gefällt dein Bart.« Sie drückte seine Hand. »Trotzdem bin ich froh, dich auch mal ohne gesehen zu haben.«
»Warum?«
»Weil ich jetzt weiß, wie dein Gesicht aussieht.«
»Du hattest Bedenken wegen meines Gesichts?«
»Bedenken nicht, aber … Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich meinen späteren Mann, falls er Bartträger ist, bitten würde, sich vor der Hochzeit ein einziges Mal für mich zu rasieren.«
»Sich zu rasieren?«
»Nur ein einziges Mal, nur damit ich ganz kurz sein Gesicht sehen könnte. Danach dürfte er ihn wieder wachsen lassen.«
James ließ ihre Hand los, lehnte sich von ihr weg und musterte sie.
»Was?«, sagte Serena.
»Und wenn er sich weigert? Wenn er sagt: ›Ich trage nun mal einen Bart. Nimm mich so, wie ich bin, oder lass es bleiben.‹«
»Aber wenn er …«
Sie verstummte.
»Wenn er was?«
»Wenn er … Wenn sich rausstellt, dass er beispielsweise ein fliehendes Kinn hat …«
James musterte sie noch immer.
»Was weiß ich denn!«, sagte Serena. »Ich wüsste nur einfach gern, worauf ich mich einlasse.«
»Und wenn er ein fliehendes Kinn hat, sagst du ›Tut mir echt leid, ich kann dich doch nicht heiraten‹?«
»Ich sage nicht, dass ich ihn dann nicht heiraten würde. Ich würde die Ehe nur gern informiert eingehen. Ich würde wissen wollen, womit ich es zu tun habe.«
James starrte düster auf die Sitzlehne vor ihm und machte keine Anstalten, Serenas Hand wieder in seine zu nehmen.
»Ach, Ja-a-ames«, gurrte sie.
Keine Reaktion.
»James?«
Er wandte sich ihr so abrupt zu, als hätte er gerade eine Entscheidung getroffen. »Seit der Besuch bei meinen Eltern geplant war, hast du … hast du kleine Mauern hochgezogen, Grenzen gesetzt. Nicht zusammen im selben Zimmer schlafen, nur an einem Sonntag … Vier mickrige Stunden waren wir da! Wir haben fast mehr Zeit im Zug verbracht als dort. Ich sehe meine Eltern nicht so wahnsinnig oft! Im Gegensatz zu dir wohne ich nämlich nicht in derselben Stadt und praktisch im selben Viertel und kann nicht einfach mal so mit einer Ladung Schmutzwäsche vorbeischauen.«
»Das ist doch nicht meine Schuld.«
Er sprach weiter, als hätte sie nichts gesagt. »Weißt du, was ich auf der Fahrt nach Philly gedacht habe? Dass du bestimmt doch mit einer Übernachtung einverstanden sein wirst, wenn du meine Eltern erst kennengelernt hast. Dass du sagen würdest, James, deine Eltern sind wirklich in Ordnung – nehmen wir am Montag einen frühen Zug, dann schaffe ich es immer noch pünktlich ins Seminar.«
»Dass sie in Ordnung sind, wusste ich längst. Ich fand nur – außerdem hatte ich keine Zahnbürste dabei. Und kein Nachthemd.«
James verzog keine Miene.
»Das nächste Mal, ja?«, versprach sie nach einer kurzen Pause.
»Gut«, sagte er, zog sein Handy aus der Tasche und senkte den Blick auf das Display.
Sie fuhren durch einen Teil der Chesapeake Bay – eine weite, trotz des Sonnenscheins matt graue Wasserfläche mit da und dort herausragenden Pfählen, auf denen vereinzelt reglose Vögel saßen. Der Anblick stimmte Serena melancholisch. Sie bekam beinahe Heimweh.
Daran war einzig und allein ihr Cousin schuld. Die zufällige Begegnung war ihr wie ein Stich mitten in die Brust gefahren, wie ein Riss zwischen beide Teile ihrer Welt. Auf der einen Seite James’ Mutter, nahbar und vertrauensvoll, auf der anderen Nicholas allein im Bahnhof. Als würde man eine Glasschüssel aus dem heißen Ofen holen und in Eiswasser tauchen: das Knacken, wenn das Glas birst.
»Gibt es bei uns nie ein Familientreffen?«, hatte Serena als Kind einmal gefragt.
»Hm? Ein Familientreffen?«, hatte ihre Mutter gesagt. »Ja, könnten wir machen. Aber es wäre kein besonders großes Treffen.«
»Würde Onkel Davids Familie kommen?«
»Onkel David? Ja, schon möglich.«
Die Antwort hatte alles andere als vielversprechend geklungen.
Ach, warum funktionieren manche Familien nicht?
Vielleicht war Onkel David adoptiert und wütend, weil es ihm niemand gesagt hatte. Oder man hatte ihn aus einem Testament gestrichen, in dem seine beiden Schwestern standen. (Serena hatte schon als Kind viele Romane gelesen.) Oder ein Familienstreit war außer Kontrolle geraten und hatte sich so hochgeschaukelt, dass schlimme, unverzeihliche Worte gefallen waren. Diese Möglichkeit erschien ihr am wahrscheinlichsten. An den Anlass des Streits erinnert sich später niemand mehr, und doch hat er alles für immer verändert.
»Na gut, aber wenigstens Tante Alice würde kommen, oder?«, hatte Serena ihre Mutter gefragt.
»Kann sein. Aber du weißt, wie Tante Alice ist. Wie sie mich immer zurechtweist, wenn wir uns sehen.«
Serena hatte aufgegeben.
Selbst wenn die Garretts zusammenkamen – der Funke sprang gewissermaßen nie über.
Ohne sich zu bewegen, schielte sie zu James. Er las einen Text, der das gesamte Display füllte. (James besaß die seltene Fähigkeit, ganze Bücher auf dem Handy lesen zu können.) Dabei kaute er geistesabwesend auf seiner Unterlippe.
In der Highschool hatte Serena einen besten Freund gehabt, Marcellus Avery. Es war keine Liebesbeziehung gewesen, eher eine Notgemeinschaft. Marcellus hatte eine absurd weiße Haut und tiefschwarzes Haar, und alle machten sich über seinen Namen lustig. Serena wiederum wog ungefähr fünf Kilo zu viel und konnte beim besten Willen nicht mit Bällen umgehen, egal ob mit einem Baseball, Tennisball oder Fußball. Und das in einer Schule, in der Sport großgeschrieben wurde. In der Mittagspause saßen sie zusammen und unterhielten sich darüber, wie oberflächlich die anderen waren, und am Wochenende kam er zu ihr, und sie sahen sich im Fernsehzimmer ihrer Eltern ausländische Filme an. Einmal legte er seine Hand ganz beiläufig neben ihre auf die Couch, und als sie ihre nicht wegnahm, rutschte er ein winziges Stück näher und drückte ihr einen sanften, scheuen Kuss auf die Wange. Sie erinnerte sich bis heute daran, wie samtig sich sein Oberlippenflaum angefühlt hatte. Mehr war nicht passiert. Gleich darauf rückten sie wieder ein Stück auseinander und starrten weiter gebannt auf den Bildschirm, und damit war gut.
Seltsamerweise wurde ihr jetzt erst bewusst, wie unglaublich schön er gewesen war. Sein Kopf war perfekt geformt, wie der einer Marmorstatue. Und jedes Mal, wenn sie ihn sah, dachte sie aus irgendeinem Grund, wie sehr ihn seine Mutter lieben musste. Sie fragte sich, was wohl aus ihm geworden war. Wahrscheinlich hatte ihn sich irgendeine Frau geschnappt und geheiratet – eine, die klug genug war, um seinen Wert zu erkennen. Während Serena hier im Zug neben einem Jungen saß, der genau so war wie alle anderen in der Highschool.
Sie dachte nur noch daran, wann die Fahrt endlich zu Ende wäre und sie wieder allein sein könnte.
2
Bis 1959 hatte die Familie Garrett nie gemeinsam Urlaub gemacht. Robin Garrett, Alice’ Vater, hatte immer behauptet, sie könnten sich keinen leisten. Außerdem weigerte er sich in den Anfangsjahren, das Geschäft in die Obhut einer Vertretung zu übergeben. Es war nämlich das Geschäft von Großvater Wellington – Sanitärhandel Wellington –, das dieser nach seinem ersten Herzinfarkt nur widerwillig und ohne großes Vertrauen an Robin übergeben hatte. Da musste Robin sich natürlich beweisen, arbeitete sechs Tage die Woche und nahm jeden Samstag die Bücher mit nach Hause, damit Alice’ Mutter sie auf Fehler hin überprüfen konnte. Denn um ehrlich zu sein: Robin war nicht der geborene Geschäftsmann. Als ausgebildeter Klempner hatte er seine Teile immer bei Wellington gekauft, aber nur, um einen Blick auf die junge Mercy Wellington hinter der Theke werfen zu können. Mercy Wellington sei das hübscheste junge Ding gewesen, das er je gesehen habe, erzählte er seinen Kindern, alle Klempner in Baltimore seien verrückt nach ihr gewesen. Robin hatte nicht die geringste Chance gehabt. Doch Wunder geschehen, zumindest hin und wieder. Mercy erzählte den Kindern, er sei ein Gentleman gewesen, das habe ihr gefallen.
Als das Geschäft nach Großvater Wellingtons Tod Robins Geschäft geworden war – rechtlich betrachtet eigentlich Mercys Geschäft –, steckte er noch mehr Herzblut hinein und fühlte sich noch noch mehr in der Pflicht, alles bis zur letzten Schraube und Mutter im Blick zu behalten, weshalb sie immer noch keinen Urlaub machten. Dazu kam es erst, nachdem Robin einen stellvertretenden Geschäftsführer eingestellt hatte, den »jungen Pickford«, wie er ihn nannte, einen gutmütigen Kerl, nicht besonders hell im Kopf, aber die Zuverlässigkeit in Person. Da sagte Mercy: »Jetzt muss ich ein Machtwort sprechen, Robin! Wir fahren alle zusammen in den Urlaub!«
Sommer 1959. Eine Woche am Deep Creek Lake. Eine schlichte kleine Hütte in einer Reihe weiterer Hütten fußläufig zum See. Nicht direkt am Ufer, weil das laut Robin zu teuer gewesen wäre, aber nah genug; nah genug.
1959 war Alice siebzehn und damit weit über die Phase hinaus, in der ein Urlaub mit der Familie Begeisterung ausgelöst hätte. Ihre Schwester Lily war fünfzehn und unsterblich in Jump Watkins verliebt, ein Basketball-Ass, mit dem sie im folgenden Schuljahr die Highschool abschließen würde. Lily erklärte, sie könne unmöglich eine ganze Woche ohne Jump sein, und fragte, ob er zum See mitkommen dürfe, aber Robin sagte Nein. Er nannte nicht einmal einen Grund. Er sagte nur »Was? Nein«, und damit war der Fall erledigt.
Die beiden Mädchen freuten sich also nicht besonders auf den Urlaub, für sie kam er zu spät. Für ihren Bruder sah die Sache anders aus. David war erst sieben und damit im perfekten Alter für eine Woche am See. Er war überhaupt ein fröhliches Kind, das sich mit Wonne auf alles Neue, Ungewöhnliche stürzte. Sobald er von dem Urlaub erfahren hatte, zählte er die Tage am Kalender ab und überlegte, was er mitnehmen würde. Offenbar stellte er sich den See als eine überdimensionale Badewanne vor, denn er verkündete, er werde seine Plastikboote, das Holz-Segelboot und den kleinen Aufzieh-Taucher einpacken. Mercy musste ihm erklären, dass die Sachen in dem vielen Wasser wegtreiben würden. »Ich kaufe dir im Billigladen Eimer und Schaufel«, versprach sie. Daraufhin übertrieb er es in eine andere Richtung und sang Lieder über das Meer. »My Bonnie lies over the ocean …«, sang er mit seiner klaren kleinen Stimme und taufte seine Cowboypuppe in Bobby Shafto um. (Die Puppe, die er abends noch mit ins Bett nahm, bei Besuch von Freunden aber im Schrank versteckte, wurde ständig umgetauft.) »Bobby Shafto’s gone to sea«, sang er und ließ die Puppe wie einen Schwimmer horizontal über seinem Kopf schweben. »Silver buckles at his knee …«
An einem Samstagmorgen ging es los, nachdem sie ihren Hund Cap in die Tierpension gebracht hatten. Alice saß am Steuer. Sie hatte den Führerschein noch nicht lange und wollte so oft wie möglich fahren, was Robin ihr mit der Begründung, sie sei zu »ungestüm«, fast immer verwehrte. Doch heute erlaubte er es. Er saß neben ihr und wies sie auf Stoppschilder, Kurven und entgegenkommende Autos hin, die sie sehr gut selbst sah, also bitte! Mercy, David und Lily saßen hinten – David in der Mitte, weil er noch so klein war, dass ihn der Höcker im Boden nicht störte.
Blond waren sie alle, aber Mercy und David strahlend goldblond, mit heller, rosiger Haut (was für eine unglaubliche Verschwendung in Hinblick auf David), Robin und die Mädchen eine Nuance dunkler. Alle hatten blaue Augen, und alle waren eher klein, auch Robin. Alice wusste, dass ihn das störte, weil sie hin und wieder beobachtete, wie er die Schultern straffte und den Kopf höher hielt, wenn er im Laden mit größeren Männern sprach. Er stand dann praktisch auf den Zehenspitzen. Das machte sie jedes Mal traurig, obwohl sie nicht glaubte, dass er es bewusst tat.
Als die Stadt hinter ihnen lag, hatten sie eine halbe Tagesreise durch überwiegend ländliche Gegenden vor sich. David ließ sich noch durch den flüchtigen Anblick von Pferden und Kühen, Fohlen und Kälbern ablenken und spielte mit seiner Mutter Traktorzählen, doch Lily fläzte auf ihrem Sitz, starrte stur geradeaus und schmollte still vor sich hin. Kurz vor dem Ziel standen erste ZIMMERFREI-Schilder vor manchen Privathäusern. Einfache Verkaufsbuden für Fischköder tauchten auf und Kiesflächen mit Motorbooten, deren Preise mit Kreide an die Frontscheiben geschrieben waren. Da und dort standen Cafés, im Grunde bessere Schuppen, in denen man Backhähnchen, Hackbraten und Lunchtüten bekam. Obwohl die Garretts für das Mittagessen nach der Ankunft etwas von zu Hause mitgenommen hatten, hielten sie bei einem Obst- und Gemüsestand am Straßenrand an und kurz darauf vor einem Betonklotz, über dem ein zwei Etagen hohes Neonschild mit der Aufschrift FATHARRY’SGROCERIES thronte. Lily weigerte sich hineinzugehen und blieb mit trotzig über der Brust verschränkten Armen im Wagen sitzen. »Pech gehabt«, sagte Alice, als sie zurückkamen. »Wir durften Eis kaufen und haben uns das mit Toffeestücken ausgesucht.« Lily hasste Toffee; sie fand, die Stückchen fühlten sich wie etwas an, das nicht in Eis gehörte. Doch sie verzog keine Miene, sondern starrte weiterhin geradeaus.
Mit dem Obst und Gemüse vom Stand und den Lebensmitteln aus dem Supermarkt wurde es auf den letzten acht Kilometern ziemlich unbequem im Auto. Weil der Kofferraum mit Gepäck, Bettwäsche und Mercys Mal-Utensilien vollgestopft war, mussten die Einkäufe im Wageninneren rings um die Insassen verteilt werden. Mercy und Lily verschwanden fast hinter den Tüten von Fat Harry’s, und auf Davids Schoß lag eine gigantische Wassermelone, während die Papiertüten vom Straßenstand in den Fußraum vor Robins Sitz gepfercht worden waren, wo sie kaum Platz für seine Beine ließen.
Den Weg zu ihrer Hütte mussten sie mit Hilfe einer hektografierten Anweisung finden, die ihnen der Eigentümer per Post zugeschickt hatte. »Rechts in die Buck Smith Road einbiegen«, las Robin vor. »Dreieinhalb Kilometer geradeaus und beim Schild SLEEPYWOODS nach links.« Sleepy Woods entpuppte sich als eine Anlage aus sechs parallel zum Highway stehenden Holzhütten. Neben einigen parkten Anhänger mit Booten. Die Garretts waren in Nummer vier untergebracht. Der Bungalow bot zwar nicht viel Platz, aber die Räume waren geschickt aufgeteilt. Es gab ein Zimmer für die Mädchen und eines für die Eltern, in dem ein Klappbett für David aufgestellt war. Im Wohnraum mit Kochnische roch es nach Kaminfeuer, doch in den beiden Schlafzimmern stank es modrig, und Mercy riss die Fenster auf. Draußen duftete es nach Kiefern und Sonne. Die Bäume ragten über den Hütten auf, und die vielen braunen Nadeln machten den Boden weich und rutschig. Alice wurde klar, warum die Anlage Sleepy Woods hieß. Sie würde hier sehr gut schlafen.
Weil alle wahnsinnig hungrig waren, setzten sie sich gleich an den Holztisch in der Küche und aßen zu Mittag. Es gab Thunfisch-Sandwiches und Karottenstifte und als Nachspeise Pfirsiche vom Straßenstand. Dann lud Robin die Sachen aus dem Kofferraum, Mercy schickte die Mädchen zum Bettenbeziehen und verstaute die Lebensmittel. David, der als Einziger nichts tun musste, ging raus und ließ Bobby Shafto Bäume hochklettern. Er schob ihn die Stämme hinauf, setzte ihn rittlings auf niedrige Äste und sang dabei »He’ll come back and marry me-ee …«
Kaum war der Kofferraum geleert, zogen sich Robin und David um und gingen den See erkunden – Robin in schlabbriger roter Badehose, T-Shirt und seinen normalen Arbeitsschuhen mit schwarzen Socken, David in einem kurzen weißen, eigens für den Urlaub angeschafften Frottee-Bademantel und kleinen braunen Fischersandalen. Zum See gelangte man über eine Art Forstweg durch den Wald, zwei sandige Spurrillen, dazwischen ein Grasstreifen. Nachdem sie aufgebrochen waren, konnte man sie noch einige Minuten zwischen Sonnen- und Schattenflecken dahingehen sehen. Robin mit den Badetüchern um den Nacken und David mit seinem Eimer, den er hin und her schwenkte, sodass die Schaufel darin klapperte, was noch bis zur Hütte zu hören war.
Alice versuchte sich mit Lily zu unterhalten, während sie die Betten bezogen – »Also, ich will das am Fenster« und »Hoffentlich ist das Ding bequemer, als es aussieht« –, doch Lily reagierte nicht und blieb bei ihrem mürrischen Gesichtsausdruck. Als sie fertig waren, packte Alice ihre Sachen aus und legte sie in die Kommode (»Die beiden oberen Schubladen sind meine«), während Lily einen Schreibblock und einen Kugelschreiber aus ihrem Koffer holte, sich das Kissen auf ihrem Bett unter den Kopf schob und zu schreiben begann. Vermutlich an Jump, aber dazu äußerte sie sich nicht.