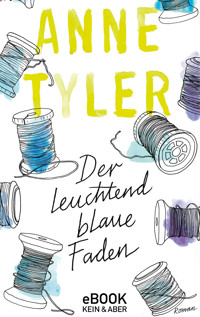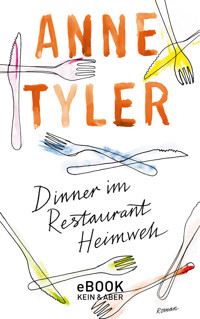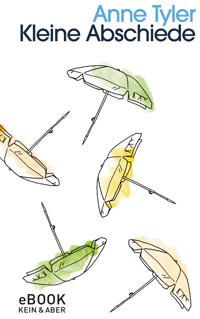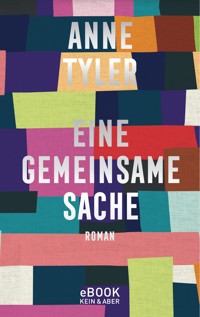12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Willa Drake führt nach außen hin das Leben einer durchschnittlichen amerikanischen Frau. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Als sie eines Tages einen überraschenden Anruf erhält, stellen eine neue Familie, spleenige Nachbarn und ein Hund namens Airplane ihr Leben gründlich auf den Kopf.
Anne Tyler erzählt mit Geist, Witz und Herz die Geschichte einer so stillen wie mutigen Frau, die nach Jahrzehnten sich selbst näherkommt und schließlich, aus einer impulsiven Entscheidung heraus, zu einem selbstbestimmten Leben findet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Anne Tyler, geboren 1941 in Minneapolis, Minnesota, ist die Autorin von 22 Romanen. Sie erhielt den Sunday Times Award für ihr Lebenswerk sowie 1988 den Pulitzer Preis. Sie ist Mitglied der American Academy und des Institute of Arts and Letters. Bei Kein & Aber erschienen bislang ihre Romane Verlorene Stunden, Abschied für Anfänger, Dinner im Restaurant Heimweh, Die Reisen des Mr. Leary, Im Krieg und in der Liebe, Kleine Abschiede, Atemübungen sowie zuletzt Der leuchtend blaue Faden, mit dem sie auf der Shortlist des Man Booker Prize und des Baileys Women’s Prize for Fiction stand. Anne Tyler lebt in Baltimore.
ÜBER DAS BUCH
Wie normal ist ein scheinbar normales Leben? Willa Drake wächst in einer nach außen hin intakten amerikanischen Durchschnittsfamilie auf. Doch unter der Oberfläche brodelt es bereits in ihrer Kindheit – immer wieder verlässt die Mutter kurzzeitig Mann und Töchter. Nachdem Willa sich befreit hat, heiratet und Kinder kriegt, muss sie, als ihr Mann tödlich verunglückt, ihr Leben plötzlich ganz neu ordnen. Wieder verheiratet und mit längst erwachsenen Söhnen, erhält sie eines Tages einen überraschenden Anruf, und ehe sie sichs versieht, stellen eine neue Familie, spleenige Nachbarn und ein Hund namens Airplane ihr Leben gründlich auf den Kopf.
In ihrem neusten Roman erzählt Anne Tyler mit Geist, Witz und Herz die Geschichte einer so stillen wie mutigen Frau, die sich selbst näherkommt und schließlich, aus einer impulsiven Entscheidung heraus, zu einem selbstbestimmten Leben findet.
»Die größte lebende Romanautorin? Ganz einfach: Anne Tyler.«
The Guardian
»Auf der Suche nach Inspiration lese ich Anne Tyler immer wieder.«
Ayelet Waldmann
»Niemand bereitet einen auf das Leben so gut vor wie Anne Tyler.«
Olga Grjasnowa
Erster Teil
1967
Willa Drake und Sonya Bailey waren losgezogen, um von Haus zu Haus zu gehen und Schokoriegel zu verkaufen. Der Ertrag sollte dem Orchester der Herbert Malone School zugutekommen. Bei entsprechendem Absatz war die Teilnahme des Orchesters am Regionalwettbewerb in Harrisburg gesichert. Willa war noch nie in Harrisburg gewesen, aber ihr gefiel der schroffe, raue Klang des Namens. Sonya war schon mal dort gewesen, aber als Baby, weshalb ihr jede Erinnerung daran fehlte. Sie hatten einander geschworen, lieber zu sterben, als nicht hinzufahren.
Willa spielte Klarinette, Sonya Flöte. Sie waren elf und wohnten zwei Straßen voneinander entfernt in Lark City, Pennsylvania – alles andere als eine Großstadt, eigentlich kaum eine Kleinstadt. Gehsteige gab es nur in der einzigen Straße mit Geschäften. Willa fand Gehsteige toll. Als Erwachsene würde sie nirgendwo leben, wo es keine Gehsteige gab.
Weil sie wegen der fehlenden Gehsteige nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf der Straße sein durften, waren sie nachmittags aufgebrochen. Willa schleppte den Karton mit den Schokoriegeln vor sich her, während Sonya den großen braunen Briefumschlag für die erhofften Einnahmen trug. Sie machten sich von Sonya aus auf den Weg, wo sie zunächst ihre Hausaufgaben erledigt hatten. Sonyas Mutter nahm ihnen das Versprechen ab, sofort nach Hause zu kommen, sobald die Sonne – jetzt, im Februar, ohnehin milchig bleich – hinter den kahlen Bäumen auf dem Bert Kane Ridge unterging. Sonyas Mutter war ziemlich ängstlich, viel ängstlicher als die von Willa.
Geplant war, weit weg, in der Harper Road, anzufangen und sich von dort in die eigene Straße zurückzuarbeiten. Da in der Harper Road kein einziges Orchestermitglied wohnte, glaubten sie richtig abkassieren zu können, wenn sie den anderen dort zuvorkamen. Es war Montag, der erste Tag der Verkaufsaktion, und die meisten Mitschüler würden wahrscheinlich erst am Wochenende loslegen.
Als Preis winkte den drei besten Verkäufern ein dreigängiges Menü mit ihrem Musiklehrer Mr. Budd in einem Restaurant im Zentrum von Harrisburg, komplett umsonst.
Die Häuser in der Harper Road waren ziemlich neu, einstöckig und aus Ziegelsteinen. Ranch-Stil nannte man das. Die Bewohner waren auch ziemlich neu. Die meisten arbeiteten in der Möbelfabrik, die es seit ein paar Jahren drüben in Garrettville gab. Dass Willa und Sonya niemanden in der Straße kannten, war gut; das machte es weniger peinlich, Vertreter zu spielen.
Vor dem ersten Haus, bei dem sie es versuchen wollten, blieben sie hinter einem großen immergrünen Strauch stehen, um sich vorzubereiten. Sie hatten sich bei Sonya noch Hände und Gesicht gewaschen, und Sonya hatte sich das glatte, dünne dunkle Haar gekämmt, durch das der Kamm problemlos durchkam. Willa hätte für ihre gelbblonden Wuschellocken eine Bürste gebraucht, konnte aber, weil Sonya keine hatte, ihre Krause nur mit den Händen notdürftig flach drücken. Sie trugen fast gleich aussehende Wolljacken – die Kapuzen mit Kunstfellbesatz – und Jeans, die sie ein Stück hochgekrempelt hatten, damit man das karierte Flanellfutter sah. Sonya hatte Turnschuhe an, Willa noch die geschnürten braunen Lederhalbschuhe aus der Schule. Wäre sie zuvor nach Hause gegangen, hätte ihre kleine Schwester sie garantiert abgefangen und gebettelt, mitkommen zu dürfen.
»Du musst den ganzen Karton hinhalten, wenn die Tür aufgeht, nicht nur einen Schokoriegel«, sagte Sonya. »Und dann sagst du: ›Möchten Sie ein paar Schokoriegel kaufen?‹ Mehrzahl!«
»Warum soll ich fragen?«, entgegnete Willa. »Ich dachte, du fragst.«
»Ich würde mir blöd vorkommen.«
»Und ich komme mir nicht blöd vor?«
»Du kannst viel besser mit Erwachsenen umgehen.«
»Und was machst du?«
»Ich bin fürs Geld zuständig.« Sonya wedelte mit dem Umschlag.
»Okay, aber dann musst du beim nächsten Haus fragen!«
»Gut«, sagte Sonya.
Klar war es gut, weil es beim nächsten Haus schon viel leichter sein würde. Trotzdem drückte Willa den Karton fester an sich und folgte Sonya auf dem gepflasterten Weg durch den Vorgarten.
Neben dem Eingang stand eine hohe, bogenförmig geschwungene Metallskulptur, sehr modern. Der Klingelknopf war sogar tagsüber beleuchtet. Als Sonya drückte, hallten zwei sonore Töne durch das Haus, gefolgt von einer Stille, die so tief war, dass sie fast schon hofften, niemanden anzutreffen. Doch plötzlich ertönten Schritte, die Tür wurde geöffnet, und eine lächelnde Frau stand vor ihnen. Sie war jünger als ihre Mütter, auch modischer, mit kurzen braunen Haaren und hellem Lippenstift; außerdem trug sie einen Minirock. »Na so was, hallo«, sagte sie, während hinter ihr ein kleiner Junge mit einem Ziehtier herantappte und »Wer ist das, Mama? Wer ist das, Mama?« fragte.
Willa sah zu Sonya hinüber. Sonya sah zu Willa hinüber. Sonyas treuherziger, angespannter Gesichtsausdruck, ihre feuchten Lippen, die so weit geöffnet waren, als wollte sie nun doch gemeinsam mit Willa sprechen, erschienen Willa plötzlich wahnsinnig komisch. Wie ein kleiner Rülpser stieg der Drang zu lachen die Brust hinauf, und in ihrer Kehle begann es zu glucksen. Auch den plötzlichen Quietschlaut, der ihr entfuhr, fand sie komisch, zum Brüllen komisch, und das Glucksen wurde zur Lachsalve, zu einem Riesengewieher. Sonya prustete ebenfalls los und kringelte sich vor Lachen, während die Frau fragend schmunzelte. »Möchten Sie –? Möchten Sie –?«, sagte Willa japsend. Weiter kam sie nicht. Sie konnte nicht mehr, sie schnappte nach Luft.
»Wollt ihr mir etwas verkaufen?«, fragte die Frau freundlich. Wahrscheinlich hatte sie in diesem Alter selbst oft kichern müssen, aber garantiert nicht so hysterisch, so hilflos, so ausgeliefert. Das Kichern schwemmte durch Willa wie eine Flüssigkeit. Die Tränen schossen ihr in die Augen, und sie musste sich über den Karton beugen und die Beine zusammenpressen, um nicht draufloszupinkeln. Sie schämte sich in Grund und Boden, und Sonya auch – man sah es an ihrem verzweifelten Gesicht, an ihrem irren Blick –, aber gleichzeitig war es das schönste, befreiendste, entspannendste Gefühl überhaupt. Willa taten die Wangen weh, und ihre Bauchmuskeln waren so schlaff, als würde sie zu einer Wasserlache dahinschmelzen.
Sonya gab als Erste auf. Nach einer matten Handbewegung zu der Frau hin drehte sie sich um und ging den Plattenweg zurück, und Willa drehte sich auch um und folgte ihr wortlos. Kurz darauf fiel die Haustür leise ins Schloss.
Sie lachten jetzt nicht mehr. Willa fühlte sich ausgelaugt und leer und ein bisschen traurig. Sonya wohl auch, denn obwohl die Sonne noch immer wie ein dünnes weißes Zehn-Cent-Stück über dem Bert Kane Ridge hing, sagte sie: »Vielleicht warten wir doch besser bis zum Wochenende, sonst wird es zu anstrengend, bei den vielen Hausaufgaben, die wir aufhaben.« Willa erhob keinen Einspruch.
Ihr Vater wirkte bekümmert, als er ihr die Tür öffnete. Die blauen Augen hinter den kleinen randlosen Gläsern waren heller als sonst und funkelten nicht wie sonst, und obendrein strich er sich mit einer langsamen, zögerlichen Bewegung über die Glatze, was immer bedeutete, dass er von irgendetwas enttäuscht war. Zuerst vermutete Willa, er hätte das mit dem Lachanfall herausgefunden. Sie wusste zwar, dass es eigentlich nicht sein konnte – abgesehen davon, dass er nicht der Typ war, der etwas gegen Lachanfälle hatte –, aber wie sollte sie sich seine Miene sonst erklären? »Hi, mein Schatz«, sagte er kraftlos.
»Hi, Pop.«
Er drehte sich um, trottete ins Wohnzimmer und überließ es ihr, die Tür zu schließen. Er trug noch das weiße Hemd und die graue Hose aus der Schule, musste aber schon vor einiger Zeit nach Hause gekommen sein, weil er schon in seine Cordsamt-Pantoffeln geschlüpft war. (Er war Werklehrer in der Highschool von Garrettville und kam viel früher heim als andere Väter.)
Ihre Schwester saß auf dem Teppich und las die Comicstrips in der Zeitung. Sie war sechs und hatte sich mit ihren abgekauten Nägeln, der Zahnlücke ganz vorn und den mickrigen braunen Zöpfen über Nacht von einem süßen Kind in etwas richtig Hässliches verwandelt. »Wie viele habt ihr verkauft?«, fragte sie Willa. »Habt ihr alle verkauft?« Denn Willa hatte den Karton mit den Schokoriegeln bei Sonya gelassen und nur ihre Schultasche dabei. Sie warf die Schultasche auf die Couch und zog die Jacke aus, ohne den Blick von ihrem Vater zu wenden, der durchs Wohnzimmer und weiter in die Küche geschlurft war. Sie ging ihm nach. In der Küche nahm er eine Pfanne vom Haken neben dem Herd und verkündete in gekünstelt fröhlichem Ton: »Heute Abend Käsetoast!«
»Wo ist Mom?«
»Deine Mutter isst nicht mit.«
Sie wartete, aber es kam nichts mehr. Er hantierte am Herd herum, gab ein Stück Butter in die Pfanne und regulierte die Hitze, als die Butter zu brutzeln begann. Dazu pfiff er leise vor sich hin, irgendeine im Nichts endende Melodie.
Willa ging ins Wohnzimmer zurück. Elaine hatte die Comics zu Ende gelesen und faltete die Zeitung zusammen. Auch so ein schlechtes Zeichen, dass sie sich ausnahmsweise diese Mühe machte und brav zu sein versuchte. »Ist Mom oben?«, flüsterte Willa.
Elaine schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Ist sie weggegangen?«
»Mhm.«
»Was ist passiert?«
Elaine zuckte mit den Schultern.
»War sie wütend?«
»Mhm.«
»Warum?«
Wieder nur ein Schulterzucken.
Ja, warum eigentlich? Ihre Mutter war zwar die hübscheste Mutter der ganzen Schule und die flotteste und klügste, doch plötzlich passierte etwas und sie bekam diese Anfälle. Oft wegen Willas und Elaines Vater. Oft auch wegen Willa oder Elaine, aber meistens wegen ihres Vaters. Eigentlich hätte er es längst wissen müssen. Nur was genau? Willa fand ihn perfekt und liebte ihn mehr als jeden anderen Menschen. Er war witzig und lieb und gutmütig und wurde nie muffelig wie Sonyas Vater oder rülpste beim Essen wie der von Madeline. Aber ihre Mutter sagte: »Ich kenne dich! Ich durchschaue dich! Immer ›Ja, meine Liebe, nein, meine Liebe‹ und dabei so tun, als könntest du kein Wässerchen trüben!«
Kein Wässerchen trüben. Willa wusste nicht genau, was das bedeutete. Aber irgendetwas musste er ja falsch gemacht haben. Sie ließ sich auf die Couch fallen und sah zu, wie Elaine die Zeitung säuberlich auf einen Stapel Zeitschriften legte. »Sie hat gesagt, es reicht ihr«, berichtete Elaine kurze Zeit später leise und bewegte dabei kaum die Lippen, fast so, als wollte sie es nicht wirklich erzählen. »Sie hat gesagt, soll er doch den Haushalt führen, wenn er alles besser weiß. Und dass er selbstgerecht ist. Und ›heiliger Melvin‹ hat sie ihn genannt.«
»Heiliger Melvin?«, fragte Willa stirnrunzelnd. Für sie klang das eher nach einem Kompliment. »Und was hat er dann gesagt?«
»Zuerst gar nichts. Und dann, dass er es schade findet, dass sie das so sieht.«
Elaine setzte sich neben Willa auf die Couch. Ganz außen, auf die Kante.
Das Wohnzimmer war kürzlich renoviert worden und wirkte moderner als zuvor. Ihre Mutter hatte sich in der Bibliothek in Garrettville Bücher über Inneneinrichtung ausgeliehen, und eine ihrer Theaterfreundinnen war mit Stoffmustern gekommen, die sie an verschiedenen Stellen auf die Couch und auf die Rückenlehnen der beiden zusammengehörenden Sessel legten. Gleich aussehende Möbel seien passé, hatte ihre Mutter gesagt. Jetzt war ein Sessel mit einem blaugrauen, der andere mit einem grün und blau gestreiften Tweedstoff bezogen. Den Spannteppich hatte sie herausreißen und durch einen elfenbeinfarbenen Teppich mit Fransen ersetzen lassen, der ringsum ein Stück des dunklen Holzbodens frei ließ. Willa vermisste den Spannteppich. Das weiße Holzhaus war alt und wackelte bei starkem Wind; mit dem Spannteppich hatte es sich solider und wärmer angefühlt. Sie vermisste auch das Gemälde über dem Kamin, das Schiff mit den vollen Segeln auf einem verblassten Meer. (Jetzt hing dort so etwas Ähnliches wie ein Bild, ein verschwommener Kreis.) Aber alles andere machte sie stolz. Sonya sagte immer, Willas Mutter solle doch auch mal ihr mickriges altes Wohnzimmer aufmöbeln.
Willas Vater tauchte mit einem Pfannenwender in der Hand aus der Küche auf und fragte: »Erbsen oder grüne Bohnen?«
»Können wir zu Bing’s Drive-in fahren, Pop? Bitte!«, bettelte Elaine.
»Was?« Er spielte den Beleidigten. »Drive-in-Essen ist dir lieber als mein berühmter Käsetoast à la maison?«
Er konnte nichts anderes als Käsetoasts. Wenn er sie bei großer Hitze in der Pfanne briet, verströmten sie einen beißenden, salzigen Geruch, den Willa immer mit der Abwesenheit ihrer Mutter in Verbindung brachte – mit ihrer Migräne, ihren Theaterproben und all den Situationen, in denen sie türenknallend aus dem Haus lief.
»Tammy Denton fährt jeden Freitagabend mit ihrer Familie zu Bing’s«, maulte Elaine.
Ihr Vater verdrehte die Augen. »Hat Tammy Denton kürzlich beim Pferderennen gewonnen?«
»Was?«
»Ist eine reiche Tante von ihr gestorben und hat ihr ein Vermögen hinterlassen? Hat sie in ihrem Garten einen vergrabenen Schatz entdeckt?«
Er ging auf Elaine zu und wackelte mit den Fingern der freien Hand albern vor ihr herum, als würde er sie gleich kitzeln, und Elaine kreischte und wich lachend zurück und versteckte sich hinter Willa. Willa hielt sich heraus. Sie blieb reglos sitzen, zog nur die Ellbogen an. »Wann kommt Mom wieder?«, fragte sie.
Ihr Vater richtete sich auf und sagte: »Ach, bestimmt bald.«
»Hat sie gesagt, wo sie hinwill?«
»Nein, aber wisst ihr was? Wir trinken heute Cola zum Abendessen.«
»Super!«, rief Elaine und sprang hinter Willa hervor.
»Ist sie mit dem Auto weg?«, fragte Willa.
Er strich sich mit der Hand über die Glatze. »Ja.«
Also war es schlimm. Sie war nicht einfach kurz um die Ecke zu ihrer Freundin Mimi Prentice gegangen, sondern wer weiß wohin gefahren.
»Dann können wir ja gar nicht zu Bing’s Drive-in«, sagte Elaine traurig.
»Halt endlich die Klappe mit deinem ewigen Bing’s Drive-in!«, brüllte Willa.
Elaine riss erschrocken den Mund auf. Ihr Vater sagte: »Ach, du lieber Himmel.«
Plötzlich drang Rauch aus der Küche. Ihr Vater rief »Oh, oh«, lief in die Küche und verschob mit einem Riesenlärm die Töpfe und Pfannen auf dem Herd.
Das Auto war alt. Es hatte einen andersfarbigen Kotflügel, weil ihre Mutter einmal auf dem East-West-Parkway in die Leitplanke gefahren war, und immer lag Müll von ihrem Vater darin herum, Pappbecher, zerfledderte Zeitschriften, Bonbonpapier und Post mit Kaffeeringen. Ihre Mutter wollte seit Jahren einen eigenen Wagen, aber dafür waren sie zu arm. Sie sagte, dass sie dafür zu arm wären. Ihr Vater sagte, sie kämen doch wunderbar zurecht. »Oder haben wir etwa nicht genug zu essen?«, fragte er seine Töchter. Ja, sie hatten genug zu essen und sogar ein schickes neues Wohnzimmer, dachte Willa verächtlich und verbittert und fühlte sich grässlich erwachsen.
An den Stellen, an denen ihr Vater das Verkohlte abgekratzt hatte, waren die Käsetoasts rissig, aber sie schmeckten okay. Vor allem mit der Cola. Die Gemüsebeilage bestand aus grünen Tiefkühlbohnen, die er nicht lang genug gekocht hatte. Sie fühlten sich feucht an und quietschten beim Kauen. Willa ließ die meisten unter der Toastrinde verschwinden.
Wenn ihr Vater kochte, machte er sich gar nicht erst die Mühe, den Tisch vor dem Aufdecken leer zu räumen oder dreieckig gefaltete Papierservietten unter das Besteck zu legen oder die Rollläden zu schließen, um die kalt gegen die Fensterscheiben drückende Dunkelheit auszusperren. Willa wurde davon ganz elend zumute. Außerdem hatte er offenbar keine Lust mehr zu reden. Er sagte nur wenig und rührte sein Essen kaum an.
Danach ging er ins Wohnzimmer und schaltete wie immer die Nachrichten ein. Elaine kam normalerweise mit, doch heute blieb sie bei Willa in der Küche. Willa musste abräumen. Sie stapelte das schmutzige Geschirr neben der Spüle, nahm den Topf vom Herd, ging ins Wohnzimmer und fragte ihren Vater: »Was soll ich mit den Bohnen machen?«
»Hmm?« Es lief gerade etwas über Vietnam.
»Soll ich sie aufheben?«
»Was? Nein. Ich weiß auch nicht.«
Sie wartete. Elaine war ihr wie ein Hündchen gefolgt. Sie spürte sie hinter sich. Schließlich sagte sie: »Vielleicht kommt Mom ja später zurück und will sie essen …«
»Wirf sie weg«, sagte er nach kurzem Zögern.
Als sie kehrtmachte, um in die Küche zurückzugehen, stieß sie gegen Elaine; so dicht war ihre Schwester ihr gefolgt.
Sie warf die Bohnen in den Müll, stellte den Topf auf den Herd, wischte den Tisch mit einem feuchten Tuch ab, breitete das Tuch über den Wasserhahn, knipste die Küchenlampe aus, ging mit Elaine ins Wohnzimmer und sah sich die restlichen Nachrichten an, obwohl es sie langweilte. Sie saßen eng an ihren Vater geschmiegt, die eine rechts, die andere links, und er hatte jeder von ihnen einen Arm um die Schulter gelegt und drückte sie von Zeit zu Zeit. Aber er blieb still.
Nach den Nachrichten beschloss er offenbar, sich zusammenzureißen. »Lust auf Parcheesi?«, fragte er und rieb sich schwungvoll die Hände. Obwohl Willa Parcheesi eigentlich satthatte, sagte sie im gleichen begeisterten Ton »Au ja!«, und Elaine holte das Brett.
Sie spielten am Couchtisch. Die Mädchen hockten auf dem Boden, ihr Vater saß auf der Couch, weil er zu alt und zu steif für den Boden war, wie er immer betonte. Parcheesi sollte Elaine beim Rechnenlernen helfen, weil sie noch immer mit den Fingern zählte, doch an diesem Abend versuchte sie es gar nicht erst. Wenn sie eine Vier und eine Zwei gewürfelt hatte, rief sie: »Eins-zwei-drei-vier, eins-zwei« und knallte ihre Figur auf die Felder, dass alles wackelte. »Sechs«, korrigierte ihr Vater. »Du sollst zusammenzählen, Schätzchen.« Aber Elaine ließ sich auf die Fersen zurückfallen und zählte, als sie wieder an die Reihe kam, erst bis fünf und dann bis drei. Diesmal sagte ihr Vater nichts.
Elaine musste um acht ins Bett, Willa um neun, doch als ihr Vater Elaine an diesem Abend zum Umziehen nach oben schickte, ging Willa mit und zog auch ihren Pyjama an. Sie teilten sich ein Zimmer mit zwei gleichen Betten an gegenüberliegenden Wänden. Als sich Elaine hingelegt hatte, fragte sie: »Wer liest vor?«, weil das meistens ihre Mutter tat. »Ich«, sagte Willa, legte sich neben ihre Schwester und nahm Laura im großen Wald vom Nachtschränkchen.
Den Pa in diesem Buch stellte sie sich immer wie ihren Vater vor. Das war Unsinn, weil Pa auf dem Umschlag volles Haar hatte und einen Bart trug. Aber er besaß die ruhige, lehrerhafte Art ihres Vaters, und wenn er in der Geschichte etwas sagte, versuchte Willa es mit der sanften Stimme ihres Vaters vorzulesen.
Als das Kapitel zu Ende war, sagte Elaine »Noch eins«, aber Willa schlug das Buch entschlossen zu. »Nein, erst morgen.«
»Ist Mom morgen wieder da?«
»Klar, was denkst du denn«, sagte Willa. »Bestimmt wahrscheinlich schon heute Abend.«
Sie stieg aus Elaines Bett und ging zur Tür. Sie wollte die Treppe hinunterrufen, damit ihr Vater ihnen Gute Nacht sagte, doch er telefonierte gerade. Sie merkte es daran, dass er sehr laut sprach und zwischen den Sätzen Pausen einlegte. »Prima!«, sagte er fröhlich und dann, nach kurzem Schweigen: »Viertel nach sieben ist völlig in Ordnung, ich muss auch früh da sein.« Er telefonierte wahrscheinlich mit Mr. Law, der in der Highschool Algebra unterrichtete, oder vielleicht mit Mrs. Bellows, der Konrektorin. Beide wohnten beide in Lark City und nahmen ihn manchmal mit, wenn Willas Mutter das Auto brauchte.
Also würde sie morgen wohl doch nicht zu Hause sein. Eine ganze Nacht war sie noch nie weggeblieben.
Willa knipste das Licht aus, ging zu ihrem Bett und schlüpfte unter die Decke. Mit weit geöffneten Augen lag sie auf dem Rücken. Sie war kein bisschen müde.
Und wenn ihre Mutter nun nie mehr zurückkam?
Sie war ja nicht immer wütend. Sie hatte auch viele gute Tage. An guten Tagen unternahm sie richtig tolle Sachen mit ihnen; sie malten zu dritt oder bastelten etwas Hübsches zum Aufstellen im Haus oder studierten ein Weihnachtsspiel ein. Und sie hatte eine wunderschöne, klare, weiche Gesangsstimme. Wenn Willa und Elaine hartnäckig genug quengelten, setzte sie sich nach dem Zubettgehen manchmal noch ins Zimmer und sang ihnen etwas vor. Und während sie langsam einschliefen, stand sie auf und ging hinaus, sang dabei aber weiter, nur ein bisschen leiser, sodass sie den ganzen Weg die Treppe hinunter zu hören war, bis ihre Stimme schließlich verklang. Am liebsten hörte Willa das Lied Down in the Valley, vor allem die Stelle, an der ihre Mutter jemanden bat, ihr einen Brief zu schreiben und ihn mit der Post ins Gefängnis von Birmingham zu schicken. Das Lied klang so einsam, dass Willa schon wehmütig wurde, wenn sie es wie jetzt nur in Gedanken hörte. Aber es war eine wohlig schwere, schöne Wehmut.
Am nächsten Morgen öffnete ihr Vater die Zimmertür und pfiff seinen kuckucksartigen Aufweckpfiff. Wie die ersten beiden Töne von Dixie, dachte Willa immer. Obwohl sie schon seit Ewigkeiten wach war, tat sie so, als würde sie gerade erst die Augen aufschlagen, streckte sich und gähnte übertrieben. Ihre Mutter war noch nicht wieder da. Das wusste sie, weil das Haus so leer hallte und so schutzlos wirkte im fahlen weißen Licht der Fenster.
»Na, mein Schatz?«, sagte ihr Vater. »Ich habe dich so lang wie möglich schlafen lassen, aber ich muss los, bevor euer Bus kommt. Schaffst du es, euch beide für die Schule fertig zu machen?«
Willa sagte »Okay«, setzte sich auf und sah zu Elaine hinüber, die mit dem Gesicht zu ihr auf der Seite lag und in diesem Moment blinzelnd die Augen öffnete. Willa hatte den Verdacht, dass auch sie längst wach gewesen war.
»Ich lege den Schlüssel auf den Küchentisch«, sagte ihr Vater. »Am besten hängst du ihn dir um den Hals, falls ihr aufsperren müsst, wenn ihr nachmittags nach Hause kommt.«
»Okay.«
Er wartete, bis Willa aufgestanden war, winkte beiden kurz zu und ging hinunter. Wenig später hupte es draußen. Die Haustür wurde geöffnet und wieder geschlossen.
Sie zogen dasselbe an wie am Tag zuvor, weil Willa keine Lust hatte, etwas anderes auszusuchen. Dann zerrte sie die Bürste durch ihr Haar. Elaine hatte noch die beiden dünnen Zöpfe und behauptete, sie müssten nicht neu geflochten werden, aber Willa sagte: »Ist das dein Ernst? Die lösen sich schon auf!« Sie entwirrte Elaines Haar, bürstete es und flocht neue Zöpfe, während ihre Schwester sich immer wieder krümmte und wegduckte. Als sie den Gummi um den zweiten Zopf schnalzen ließ, fühlte sie sich tüchtig und sehr geschickt. Doch dann protestierte Elaine: »Du hast es nicht richtig gemacht!«
»Wie, nicht richtig?«
»Sie sind zu locker.«
»Sie sind genau so, wie Mom sie immer macht.«
Das stimmte. Elaine ging aber trotzdem zum Spiegel an der Schranktür. Als sie sich zu Willa umdrehte, hatte sie Tränen in den Augen. »Sie sind nicht genau so! Sie sind ganz labbrig!«
»Besser kann ich es nicht. Mannomann!«
Jetzt quollen Tränen aus Elaines Augen und liefen ihre Wangen hinunter, aber sie sagte nichts mehr.
Zum Frühstück gab es Cheerios und Orangensaft aus dem Karton. Sie aßen ihre Vitamin-Kautabletten, und Willa stellte die Teller zusammen und wischte den Tisch ab. Auf der Arbeitsfläche stand inzwischen ziemlich viel schmutziges Geschirr, das von gestern Abend und das vom Frühstück. Ein deprimierender Anblick.
Ihr Vater hatte sich Kaffee gemacht, aber offenbar nichts gegessen, denn es war weder eine Schüssel noch ein Teller zu sehen.
Weil sie Angst hatte, den Schulbus zu verpassen – auf sich allein gestellt wusste sie nicht genau, wann sie das Haus verlassen sollte –, trieb sie Elaine und sich selbst zur Eile. Sie zogen hektisch ihre Jacken und Fäustlinge an, gingen hinaus, rannten zur Bushaltestelle und erreichten sie viel zu früh. Die Haltestelle bestand aus einem kleinen Wartehäuschen mit einem halb abgeblätterten Reklamebild für Schnupftabak. Sie setzten sich dicht nebeneinander auf die Bank, umschlangen ihre Schultaschen, um sich zu wärmen, und stießen triste weiße Atemfetzen in die Luft. Als die anderen kamen – Eula Pratt mit ihrem Bruder und die drei Turnstile-Jungs –, wurde es besser. Alle zwängten sich in das Wartehäuschen, hopsten auf der Stelle und prusteten vor Kälte. Da wurde es Willa halbwegs warm.
Elaine saß im Bus sonst immer neben Natalie Dean, aber an diesem Morgen folgte sie ihrer Schwester nach hinten, wo Sonya einen Platz für Willa frei gehalten hatte, und setzte sich gegenüber auf den leeren Platz an der anderen Gangseite. Ihre Zöpfe hingen wirklich ziemlich schlaff herab, und die Enden waren zu lang geworden. Ihre Mutter ließ immer nur ungefähr zwei Zentimeter ungeflochten.
Sonya sagte, sie habe nachgedacht. Wenn sie ihre Schokoriegel nur an ihre Verwandten verkaufen würden, müssten sie nicht herumgehen und bei fremden Leuten klingeln. »Ich habe vier Onkel mütterlicherseits und einen Onkel und zwei Tanten väterlicherseits. Die beiden Tanten wohnen zwar weit weg, aber das macht nichts. Sie schicken mir das Geld ganz einfach, und ich hebe die Schokoriegel auf und gebe sie ihnen, wenn sie uns das nächste Mal besuchen.«
»Du hast viel mehr Verwandte als ich«, sagte Willa.
»Und dann natürlich meine Großmutter Bailey, aber das ist ja klar«, sagte Sonya. »Meine anderen Großeltern sind alle tot.«
Willas Großeltern lebten alle noch, sie sah sie jedoch nicht oft. Die Eltern ihres Vaters sah sie überhaupt nie, weil Willas Mutter sagte, sie habe nicht die kleinste Gemeinsamkeit mit ihnen. Außerdem lebten sie auf dem Land und konnten das Vieh nicht allein lassen. Die Eltern ihrer Mutter kamen hin und wieder an Feiertagen aus Philly, aber nie lang; der Bruder und die Schwester ihrer Mutter kamen fast nie, weil ihre Mutter sie nicht besonders mochte. Sie sagte, ihr Bruder sei immer das Lieblingskind gewesen, weil er ein Junge war, und ihre Schwester, weil sie die Jüngste und so süß war; ihre Schwester sei total verzogen, sagte sie. Willa war sich fast sicher, dass von ihrer Mutter nur ein verächtliches Schnauben gekommen wäre, wenn sie gesagt hätte, dass sie den beiden gern Schokoriegel verkaufen würde. Aber wenn sie wirklich so schrecklich waren, würden sie wahrscheinlich sowieso keine kaufen.
»Vielleicht gehe ich nur zu den Leuten in meiner Straße«, sagte sie zu Sonya. »Da ist es auf jeden Fall leichter als bei Fremden.«
»Okay, denk bitte dran, dass Billy Turnstile in deiner Straße wohnt. Das heißt, du musst dich beeilen, sonst ist er vor dir da.«
Willa sah verstohlen zu Billy hinüber, der sich gerade mit seinem Bruder um ein Sandwich oder irgendeinen anderen in Zellophan verpackten Snack balgte. »Billy Turnstile ist einer von den Schlimmen«, sagte sie. »Dem ist das alles garantiert sowieso egal.«
»Ach so, und eine Patentante habe ich natürlich auch noch«, warf Sonya ein.
»Du Glückliche«, sagte Willa.
Sie würde später mal einen Mann aus einer großen Familie heiraten, in der sich alle nahestanden und es immer lustig zuging. Ihr Mann würde sich mit allen Verwandten verstehen – er wäre genauso locker und nett wie ihr Vater –, und die ganze Familie würde Willa lieben und sie wie eine von ihnen behandeln. Sie würde entweder sechs oder acht Kinder haben, eine Hälfte Jungs, eine Hälfte Mädchen, die immer mit ihren Unmengen von Cousins und Cousinen spielten.
»Du, deine Schwester weint«, sagte Sonya.
Willa warf einen Blick über den Gang und sah, dass sich Elaine mit dem Fäustling die Nase abwischte. »Was ist denn?«, fragte sie.
»Nichts«, antwortete Elaine leise. Oben auf dem Fäustling war ein glänzender Streifen zu sehen, so ähnlich wie eine Klebespur.
»Alles in Ordnung«, sagte Willa zu Sonya.
Doch gleich nach Willas Mittagspause kam die Schulkrankenschwester ins Klassenzimmer und bat die Lehrerin, Willa Drake aus dem Unterricht zu entlassen. »Deine kleine Schwester hat Bauchweh«, teilte sie Willa auf dem Weg in den Sanitätsraum mit. »Es ist wahrscheinlich nichts Ernstes, aber ich erreiche eure Mutter nicht, und deine Schwester möchte, dass du bei ihr bist.«
Zuerst gab ihr die Mitteilung das Gefühl, wichtig zu sein. »Die Bauchschmerzen sind bestimmt nur eingebildet«, sagte sie wie aus langer Erfahrung. Im Sanitätsraum hob Elaine den Kopf von der Liege und schien sich zu freuen, als sie ihre Schwester sah, und die Schulkrankenschwester brachte Willa einen Stuhl. Doch dann sank Elaine wieder zurück und legte den Arm über die Augen, und Willa hatte nichts zu tun. Sie sah der Krankenschwester zu, die am Schreibtisch Formulare ausfüllte, und betrachtete ein buntes Plakat, auf dem regelmäßiges Händewaschen angemahnt wurde. Einmal klopfte Mrs. Porter von der sechsten Klasse, und die Krankenschwester stand auf, um draußen mit ihr zu sprechen, ließ die Tür aber halb offen, sodass Willa die Siebtklässler in die Mittagspause stürmen sah. Als ein Siebtklässler einem anderen den Ellbogen in die Seite stieß und der andere ins Stolpern geriet, rief Mrs. Porter: »Ich habs gesehen, Dickie Bond!« Ihre Stimme dröhnte vielfach verstärkt durch den Gang, wie aus dem Inneren einer Muschel, und genauso klang es, als eine Siebtklässlerin sagte: »… so komisch rosa-orange, meine Zähne waren plötzlich ganz gelb …«
Kamen alle diese Kinder aus glücklichen Familien? Verschwieg kein einziges irgendein Problem, das es zu Hause gab? Es sah ganz danach aus. Das Mittagessen, ihre Freunde und Lippenstift – mehr schien sie nicht zu beschäftigen.
Die Krankenschwester kam zurück, schloss die Tür, und der Lärm auf dem Gang verhallte. Trotzdem bekam Willa den Beginn der Orchesterprobe mit. Mist. Sie liebte die Orchesterproben. Gerade studierten sie den Tanz der Polowetzer Mädchen von Borodin ein. Die ersten Töne klangen so sanft und suchend – schwache Töne, dachte Willa immer –, dass sie sie nicht gleich erfasste, aber im Hauptthema wurden sie dann kräftiger. Es war dieselbe Melodie wie Stranger in Paradise, und die schlimmen Jungs sangen immer schmalzig »Take my hand, I’m a strange-looking parasite …«, bis Mr. Budd mit dem Taktstock auf seinen Notenständer klopfte. Mr. Budd hatte etwas längere goldblonde Locken und richtig dicke Muskeln und sah super aus, fast wie ein Rockstar. Wenn Willa wirklich die meisten Schokoriegel verkaufen und mit ihm essen gehen dürfte, würde sie garantiert keinen Ton herausbringen. Fast wollte sie gar nicht mit ihm essen gehen.
Das Orchester brach ab und begann von vorn. Wieder der schwache Anfang, wieder »Take my hand …«, aber dann wurde es lauter und klang selbstbewusster.
»Glaubst du, dass Mom zu Hause ist, wenn wir heimkommen?«, fragte Elaine.
Willa sah sie an. Elaine hatte den Arm vom Gesicht genommen und runzelte besorgt die Stirn.
»Na klar«, sagte Willa.
Natürlich würde sie wieder da sein, aber im Bus eröffnete Willa ihrer Freundin Sonya sicherheitshalber, dass sie heute nicht mit zu ihr gehen könne. »Ich muss auf meine Schwester aufpassen«, erklärte sie ganz leise, damit Elaine, die wieder allein auf dem Platz an der anderen Gangseite saß, nichts hörte.
Von außen ließ sich schwer erkennen, ob sich jemand im Haus aufhielt. Die Fenster waren zwar dunkel, aber es war ja noch Tag. Das Gras sah flach aus, platt gedrückt, und die Blätter des Rhododendrons neben der Veranda waren eingerollt wie Zigarren, so kalt war es. Willa fingerte die Schnur mit dem Schlüssel vorne aus der Jacke. Sie hätte auch erst klingeln können, doch sie wollte nicht, dass ihre Schwester dastand und wartete, ohne dass sich etwas tat.
Im Flur herrschte drückende Stille. Im Wohnzimmer bewegte sich nur der über dem Heizkörper schwingende Vorhangsaum. »Sie ist nicht da«, sagte Elaine fast flüsternd.
Willa warf ihre Schultasche auf die Couch. »Lass ihr ein bisschen Zeit.«
»Wir haben ihr doch jetzt schon die ganze Nacht Zeit gelassen!«
»Zeit zum Nachdenken« nannte es ihr Vater. Ihre Mutter schrie ihn an und stampfte mit dem Fuß auf oder verpasste Willa eine Ohrfeige (wie verletzend, wie beschämend und beängstigend, ins Gesicht geschlagen zu werden) oder schüttelte Elaine, als wäre sie eine Puppe; dann raufte sie sich die Haare, sodass sie noch lange vom Kopf abstanden. Und dann war sie weg und ließ alles zitternd und verstört zurück, und ihr Vater sagte seelenruhig: »Halb so schlimm, sie braucht nur ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Sie ist einfach ein bisschen übermüdet.«
»Andere sind auch übermüdet und benehmen sich trotzdem nicht so«, hatte Willa einmal zu ihm gesagt.
»Ja, aber du weißt doch, wie reizbar sie ist.«
Willa konnte sich nicht erklären, warum er so viel Verständnis hatte, obwohl er selbst nie die Beherrschung verlor, ja noch nie auch nur die Stimme erhoben hatte, soweit sie sich erinnerte.
Sie hätte ihn gern dagehabt. Normalerweise kam er um vier nach Hause, aber heute war das nicht sicher, weil er bei jemand anderem mitfuhr.
»Willst du ein bisschen was essen?«, fragte sie Elaine. »Wie wärs mit Milch und Keksen?«
»Ja, Kekse …«
»Ohne Milch keine Kekse!«
Das sagte ihre Mutter immer, und obwohl es ihr schwerfiel, ahmte Willa auch die fröhlich trällernde Stimme nach.
Sie ging in die Küche, goss Milch in ein Glas, stellte es auf den Tisch und legte zwei Oreos dazu. Für sich selbst nahm sie nichts – sie hatte so einen merkwürdigen Kloß im Hals –, sondern hob die Schultasche von der Couch und trug sie ins Esszimmer, wo sie immer ihre Hausaufgaben machte. Doch noch bevor sie angefangen hatte, kam Elaine mit ihren Keksen, aber ohne die Milch, und setzte sich ihr gegenüber an den Tisch. Weil Erstklässler noch keine Hausaufgaben aufbekamen, fragte Willa: »Willst du in deinem Malbuch malen?«
Elaine schüttelte nur den Kopf.
Willa beschloss, sich nicht weiter um sie zu kümmern. Sie holte ihre Mathe-Hausaufgaben heraus und begann zu arbeiten, spürte jedoch die ganze Zeit den Blick ihrer Schwester auf sich ruhen, und bei jedem Bissen Oreo knirschte es leise.
Als sie sich das Arbeitsblatt Geschichte vornahm, hatte Elaine beide Kekse gegessen, saß einfach da und seufzte laut vor sich hin. Willa tat so, als würde sie nichts hören. Dann klingelte das Telefon. »Ich geh ran!«, sagte Elaine, aber Willa war schneller in der Küche und am Apparat. »Hallo?«, sagte sie.
»Hi, mein Schatz.« Es war ihr Vater.
»Hi, Pop.«
»Alles in Ordnung bei euch?«
Obwohl ihr klar war, was er eigentlich wissen wollte, sagte sie nur: »Ja, ja. Ich mache meine Hausaufgaben, und Elaine hat gerade ein bisschen was gegessen.«
Einige Sekunden blieb es still in der Leitung. Dann sagte ihr Vater: »Ich bin wahrscheinlich bald zu Hause. Ich warte nur noch auf Doug Law. Er hat noch ein Gespräch mit einem Schüler.«
Er fuhr also mit Mr. Law nach Hause. Besser als mit Mrs. Bellows, die manchmal bis sechs oder sieben in ihrem Büro saß. »Okay, Pop.«
»Freut euch ruhig schon mal auf die besten Käsetoasts der Welt!«
»Okay.«
Sie legte auf und sagte zu Elaine, die sie fragend ansah: »Er kommt bald.«
Elaine seufzte noch einmal auf.
Willa blickte sich in der Küche um. Auf der Arbeitsfläche und im Spülbecken stapelte sich schmutziges Geschirr. Das Glas Milch, das Elaine nicht angerührt hatte, stand zwischen den Krümeln vom Abendessen. »Wir sollten aufräumen«, sagte sie. »Hilfst du mir mit dem Abwasch? Ich spüle, und du trocknest ab, ja?«
»Ja!«, rief Elaine aufgeregt. Normalerweise spülte ihre Mutter und Willa trocknete ab. »Darf ich eine Schürze anziehen?«
»Klar.«
Willa band Elaine eine Schürze ihrer Mutter unter die Achseln, damit sie nicht am Boden schleifte. Dann füllte sie beide Becken mit heißem Wasser, und Elaine zog den Tritthocker über den Boden, damit sie herankam. Willa wusch den ersten Teller, tauchte ihn ins Spülwasser und legte ihn auf das Abtropfgestell. Elaine hob ihn vorsichtig hoch und trocknete ihn mit einem Tuch übertrieben sorgfältig ab. Es dauerte zwar eine Ewigkeit, aber umso besser, dachte Willa und begann ihrerseits noch gründlicher zu spülen, das Ganze in die Länge zu ziehen; und als sie mit dem Abwasch fertig waren, putzte sie jede Oberfläche, sogar den Herd, wischte die Krümel vom Tisch und stellte Elaines Milch in den Kühlschrank.
»Das habe ich gut gemacht, oder?«, sagte Elaine, als der letzte Teller abgetrocknet war.
»Ja, richtig gut, Lainey«, versicherte ihr Willa.
Eigentlich war es gar nicht so schlecht, verantwortlich zu sein. Sie stellte es sich als Dauerzustand vor – nur noch sie drei, wie sie alles alleine meisterten. Sie und ihr Vater würden das gemeinsam prima schaffen. Sie gingen beide gern methodisch vor, mit System. Sollte ihre Mutter jemals zurückkehren, würde sie sich umsehen und sagen: »Ihr habt hier ja alles viel besser im Griff als ich selbst!«
»Weißt du was? Ich bin dafür, dass wir eine Nachspeise machen«, sagte Willa zu Elaine.
»Nachspeise!« Elaine begann so zu strahlen, dass man ihre Zahnlücke sah. Sie strich die Schürze glatt. »Was denn für eine?«
»Einen Kuchen oder einen Pudding. Schokopudding.«
»Ja! Weißt du, wie das geht?«
»Wir finden bestimmt ein Rezept.« Die Idee begann ihr zu gefallen. Normalerweise gab es nie ein Dessert. Sie beneidete Sonya, deren Mutter jeden Abend eines auf den Tisch stellte. Und Schokopudding aß ihr Vater am liebsten. Schokoladenkuchen auch, aber an einen Teigboden wollte sie sich nicht wagen.
»Wir überraschen Pop und zeigen ihm den Pudding erst nach dem Essen. Der wird sich wundern!«, sagte sie zu Elaine, zog den Tritthocker vor das Bord mit den Kochbüchern, stellte sich darauf und fing an zu suchen. »Die Küche der Braut«, las sie vor. »Da stehen bestimmt die einfachsten Rezepte drin.« Sie stieg herunter und schlug das Buch auf der Arbeitsfläche auf. An den Ellbogen ihrer Schwester geschmiegt folgte Elaine mit dem Blick Willas Finger auf dem Weg durch das Inhaltsverzeichnis. »Schokoladenkuchen, Schokoladenmilch …«, las Willa laut vor. »Schokoladenpudding, zweihunderteinundsechzig.« Sie blätterte zu Seite zweihunderteinundsechzig. »Zucker, Kakaopulver, Salz. Milch, Sahne, Vanille … oh, oh: Speisestärke.« Obwohl sie nicht einmal wusste, wie Speisestärke aussah, ging sie zu dem Schrank, in dem ihre Mutter Mehl und Ähnliches aufbewahrte, und tatsächlich, da stand die Speisestärke. Als sie die Schachtel auf die Arbeitsfläche stellte, rief Elaine: »Darf ich rühren, Willa? Darf ich?«
»Klar«, sagte Willa.
Weil der Herd für Elaine noch tabu war, stellte Willa einen Kochtopf auf den Tisch und ließ sie dort alles vermischen. Natürlich veranstaltete Elaine in ihrer Begeisterung eine Riesensauerei. Einiges spritzte über den Topfrand, und die Speisestärke und das Kakaopulver lösten sich nicht auf, sondern bildeten Klümpchen, aber Willa sagte: »Gut gemacht, Lainey«, stellte den Topf auf den Herd und rührte vorsichtig weiter, während sich die Masse erhitzte.
Doch auch sie hatte kein Glück. Die Klümpchen blieben, selbst als es am Topfrand zu blubbern begann. Es sah aus wie normale Milch, in der braune und weiße Kieselsteine schwammen. »Und? Wird es schon Pudding?«, fragte Elaine, weil sie zu klein war, um in den Topf gucken zu können. Anstatt zu antworten, stellte Willa die Hitze höher, und alles wäre übergekocht, wenn sie den Topf nicht blitzschnell auf eine kalte Platte geschoben hätte. »Ich verstehe das nicht«, sagte sie, schaltete die rechte, rot glühende Platte aus und starrte in den Kochtopf.
»Was denn? Was denn?«
»Ich kapier das einfach …«
Im Wohnzimmer ertönte die Stimme ihres Vaters. »Hallo?«
Willa und Elaine sahen sich an.
»Jemand zu Hause?«
»Schnell! Versteck ihn!«, flüsterte Elaine. »Stell ihn in den Kühlschrank!«
»Das geht nicht. Das ist ja noch kein Pudding.«
»Was dann?«
»Was macht ihr denn da?« Ihr Vater stand in der Tür.
Willa drehte sich so zu ihm um, dass sie die Sicht auf den Topf blockierte, aber er kam näher und schaute ihr über die Schulter. Er trug noch seine Wolljacke und roch nach Winterluft. »Kakao?«, fragte er.
»Schokopudding«, murmelte Willa mit gesenktem Blick.
»Wie bitte?«
»Das ist Schokopudding, Papa«, rief Elaine aufgeregt. »Den haben wir als Nachspeise gemacht. Wir wollten dich überraschen!«
»Da bin ich aber wirklich überrascht! Ich wusste gar nicht, dass ihr kochen könnt. Wirklich allerhand!«
»Wir habens vermasselt«, sagte Willa.
»Wie bitte?«
»Es sind lauter Klümpchen drin!«, stieß sie hervor. »Die lösen sich nicht auf, dabei haben wir ewig gerührt!«
»Dann sehen wir uns das jetzt mal an«, sagte ihr Vater.
Sie trat zur Seite. Er stellte sich vor den Herd, ergriff den Löffel, der schräg im Topf lag, und rührte probehalber ein bisschen. »Hm. Ich verstehe.«
»Das ist total schiefgegangen«, sagte sie.
»›Total schiefgegangen‹ würde ich nicht sagen. Nur ein bisschen … Wo ist das Rezept?«
Willa reckte das Kinn zum Kochbuch hin, das aufgeschlagen dalag, und er ging zur Arbeitsfläche hinüber und las sich das Rezept durch. »Also, ihr habt den Zucker und den Kakao und das Salz vermischt und dann alles außer einem Viertelliter Milch-Sahne-Gemisch bei sehr schwacher Hitze eingerührt.«
»Äh …«
»Dann habt ihr in einer anderen Schüssel die Speisestärke und die restliche Mischung aus Milch und Sahne glatt gerührt –«
»Was? Nein. Wir haben alles auf einmal reingetan.«
»Na dann …«
»Sind deshalb so viele Klümpchen drin?«
»Das wird es wohl sein, mein Schatz.«
»Aber das wusste ich doch nicht!«
»Wenn man ein Rezept ausprobiert, sollte man sich die ganze Anleitung durchlesen, bevor man loslegt.«
Willa starrte wieder auf ihre Schuhe, damit er die Tränen in ihren Augen nicht sah.
»Als Erstes geht man die Zutaten durch, damit man auch alles hat, was man braucht –«
»Habe ich gemacht!«
»Gut. Dann stellt man alles vor sich auf –«
»Habe ich auch gemacht! Ich habe an alles gedacht!«
»Und dann liest man sich die ganze Anleitung durch. Das sage ich meinen Schülern auch immer, wenn sie etwas tischlern. Man sollte stets wissen, was man gleich und was man später tun muss, was als Erstes kommt und was als –«
Es ging ihr auf die Nerven, dass er sie so belehrte und immer weiter auf sie einredete, egal, was sie sagte. »Ich habs kapiert! Mannomann – ich bin doch kein Idiot!«
»Nein, natürlich nicht. Das ist ein Lernprozess. Beim nächsten Mal weißt du es dann.«
»Ich habe es schon dieses Mal gewusst! Ich habe alle Zutaten vor mir … Und jetzt – ich wollte dich doch überraschen!«
»Ist doch egal, Schätzchen.«
»Egal?«
Sie hob den Blick und starrte ihn an. Dass er ihre Tränen sah, kümmerte sie nicht mehr. Sollte er sie ruhig sehen! »Ich habe mir solche Mühe gegeben, und du sagst, es ist egal.«
»Nein, ich wollte doch nur –«
»Ach, vergiss es!« Sie drehte sich um, ging ins Esszimmer zurück, setzte sich auf ihren Stuhl und ergriff einen Stift.
Ihr Vater kam, von Elaine wie von einem Schatten gefolgt, hinterher. »Willa, mein Liebling.«
»Ich lerne.«
»Nun sei doch nicht so, Willa.«