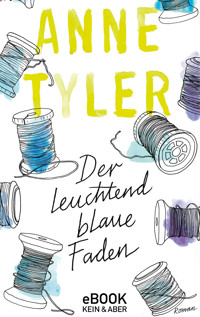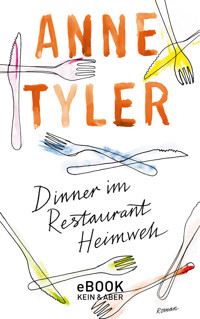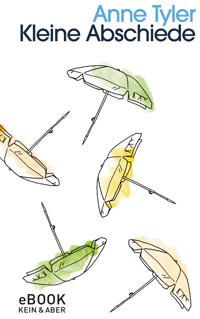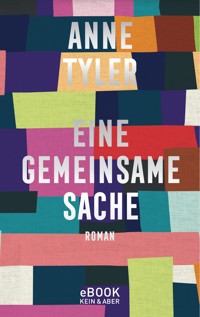17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Tage stehen an, in denen sich Gail und Max, beide über sechzig und seit Längerem getrennt, anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter Debbie zusammenfinden. Max reist, nichts ahnend von der Allergie des Bräutigams, überraschenderweise mit einer Katze an, weshalb er statt bei seiner Tochter bei Gail wohnen muss. Obwohl diese Vorstellung für Gail zunächst kaum auszuhalten ist, willigt sie ihrer Tochter zuliebe zähneknirschend ein. Doch schnell zeigt sich: Die alte Verbindung ist immer noch da. Gemeinsam müssen sie sich mit der Frage nach der Treue des Bräutigams auseinandersetzen, und damit, ob Vertrauen auch nach Jahren wiederhergestellt werden kann. Sie blicken aus belustigter Distanz auf die etwas zu traditionellen Feierlichkeiten, erinnern sich an Vergangenes und stellen sich Fragen nach der Zukunft – was hält das Leben noch für sie bereit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
www.keinundaber.ch
Über die Autorin
Anne Tyler, geboren 1941 in Minneapolis, Minnesota, ist Autorin von zahlreichen Romanen und Trägerin des Pulitzerpreises. Für ihr Lebenswerk erhielt sie den Sunday Times Award. Sie ist Mitglied der American Academy und des Institute of Arts and Letters. Bei Kein & Aber erschienen unter anderem ihre Bestseller Eine gemeinsame Sache, Launen der Zeit, Der leuchtend blaue Faden, mit dem sie auf der Shortlist des Man Booker Prize und des Women›s Prize for Fiction stand, sowie Der Sinn des Ganzen, der für den Booker Prize nominiert war. Anne Tyler lebt in Baltimore.
Über das Buch
Drei Tage stehen an, für die Gail und Max, beide Ende fünfzig und seit Längerem getrennt, anlässlich der Hochzeit ihrer Tochter Debbie zusammenkommen müssen. Max reist, nichts ahnend von der Allergie des Bräutigams, überraschenderweise mit einer Katze an, weshalb er statt bei seiner Tochter bei Gail wohnen muss. Ihrer Tochter zuliebe willigt Gail notgedrungen ein. Doch schnell zeigt sich: Die alte Verbindung zwischen den beiden ist immer noch da. Gemeinsam müssen sie sich mit Fragen zur Ehe auseinandersetzen und auch damit, ob Vertrauen nach Jahren wiederhergestellt werden kann. Aus belustigter Distanz blicken sie auf die traditionellen Feierlichkeiten, erinnern sich an Vergangenes und stellen sich Fragen nach der Zukunft – was hält das Leben noch für sie bereit?
I Schönheitstag
Niemand klopft mehr auf seine Uhr, ist Ihnen das auch aufgefallen?
Ich rede von ganz normalen Armbanduhren. Wissen Sie noch, wie man früher darauf geklopft hat?
Mein Vater zum Beispiel. Er hatte eine Timex mit einem Zifferblatt so groß wie ein Fünfzig-Cent-Stück, und immer wenn ihn meine Mutter warten ließ, sah er stirnrunzelnd auf die Uhr und klopfte. Womit er, wie ich heute glaube, sagen wollte: »Das gibts doch nicht. Kann es wirklich schon so spät sein?« Doch als ich klein war, dachte ich jedes Mal, er wollte die Zeit vorspulen, damit meine Mutter sofort, und zwar schon im Mantel, wie eine Figur in einem Zeitrafferfilm vor uns stünde.
Mir fiel das neulich wieder ein, als ich eines Freitagmorgens am Büro von Marilee Burton vorbeiging, der Direktorin der Schule, an der ich tätig war, und sie mich zu sich rief. »Komm, wir plaudern ein bisschen«, sagte sie, was nicht alle Tage vorkam. (Wir hatten eine mehr oder weniger rein professionelle Beziehung.) Sie winkte mich zu dem Windsor-Stuhl vor ihrem Schreibtisch, doch ich blieb in der Tür stehen und reckte den Kopf in ihre Richtung.
»Ich wollte dir sagen, dass ich am Montag nicht kommen kann«, sagte sie. »Ich muss eine Kardioversion durchführen lassen.«
»Eine was?«, fragte ich.
»Eine Behandlung am Herz. Es schlägt nicht mehr richtig.«
»Aha.« Ich schaffte es nicht, Erstaunen zu heucheln. Sie war eine von diesen damenhaften Frauen, die immer und überall High Heels tragen, eine perfekte Kandidatin für Herzprobleme. »Das tut mir leid«, sagte ich.
»Das Herz wird durch einen Stromstoß angehalten und neu in Gang gesetzt.«
»Ha – wie wenn man auf eine Uhr klopft«, sagte ich.
»Bitte?«
»Ist es gefährlich?«
»Nein, nein. Ich habe es sogar schon einmal machen lassen. Aber das war in den Frühjahrsferien, da habe ich es nicht angekündigt.«
»Okay«, sagte ich. »Und wie lange wirst du weg sein?«
»Am Dienstag bin ich zurück – in alter Frische. Für dich ändert sich gar nichts. Allerdings«, sagte sie, setzte sich aufrechter hin, räusperte sich und richtete mit abgezirkelten Bewegungen einen Stapel Papier aus, der nicht ausgerichtet zu werden brauchte – »allerdings bringt mich das zu einem Thema, das ich schon länger mit dir besprechen wollte.«
Auch ich machte den Rücken nun etwas gerader. Ich bin in Bezug auf den Tonfall anderer Leute sehr wach.
»Ich werde an meinem nächsten Geburtstag sechsundsechzig«, sagte sie, »und Ralph ist gerade achtundsechzig geworden. Er möchte ein bisschen reisen und die Enkel häufiger sehen.«
»Aha.«
»Ich werde also vor Beginn des neuen Schuljahrs kündigen.«
Das neue Schuljahr würde im September beginnen. Es war bereits Ende Juni.
»Willst du damit sagen, dass ich Direktorin werde?«, fragte ich.
Eine durchaus logische Frage. Irgendwer musste schließlich Direktorin werden. Und ich war ganz klar als Nächste dran. Ich war seit elf Jahren Marilees Stellvertreterin. Doch Marilee schwieg eine Weile, so als hätte ich mir etwas angemaßt. Dann sagte sie: »Genau darüber wollte ich mich mit dir unterhalten.«
Sie nahm das oberste Blatt von dem Stapel, drehte es zu mir hin und schob es über den Schreibtisch. Ich trat widerwillig einen Schritt nach vorn und spähte darauf. Eine maschinenbeschriebene Seite mit einem in einer Ecke angetackerten Zeitungsausschnitt – das Schwarz-Weiß-Foto einer ernst dreinblickenden jungen Frau mit resolut gelocktem dunklem Haar. Lehrerin aus Nashville gewinnt mit Studie über Lernunterschiede McLellan-Preis lautete die Überschrift.
»Nashville?«, las ich laut. (Wir lebten in Baltimore.) Und der McLellan-Preis sagte mir überhaupt nichts.
»Als ich die Kündigung in Erwägung zu ziehen begann, habe ich den Schulausschuss auf sie hingewiesen«, erklärte Marilee. »Dorothy Edge. Du hast vielleicht schon von ihr gehört. Ich hatte zuvor ihr Buch gelesen und war sehr beeindruckt.«
»Du hast den Schulausschuss auf sie hingewiesen«, wiederholte ich.
»Gail, du bist immerhin einundsechzig und wirst ebenfalls nicht mehr allzu lange berufstätig sein«, sagte sie.
»Ja, ich bin einundsechzig!«, erwiderte ich. »Eine Ewigkeit von der Pensionierung entfernt.«
»Es ist nicht nur eine Frage des Alters.« Sie sah mich an und hob dabei das Kinn, so wie Leute, die wissen, dass sie im Unrecht sind. »Machen wir uns nichts vor: Dieser Job steht und fällt mit der Sozialkompetenz, das weißt du genau! Und dass soziale Interaktion noch nie deine Stärke war, bestreitest du selbst wohl als Letzte.«
»Was soll das heißen?«, fragte ich. »Was meinst du mit sozialer Interaktion?«
»Du hast natürlich jede Menge anderer Kompetenzen«, sagte Marilee. »Du bist sehr viel besser organisiert als ich. Vor Publikum bist du eloquenter. Aber nehmen wir die augenblickliche Situation. Ich erzähle von meinen Herzproblemen, und du sagst nur ›Ach so‹ und gehst zu der Frage über, ob du meinen Job haben kannst.«
»Ich sagte ›Aha‹«, brachte ich ihr in Erinnerung. »Und ich sagte ›Das tut mir leid‹.« (Eine weitere Stärke von mir – ich habe ein ausgezeichnetes auditives Gedächtnis, auch was meine eigenen Worte betrifft.) »Was wolltest du denn noch hören?«
»Ich ›wollte‹ überhaupt nichts«, erwiderte sie. Ihr Kinn deutete inzwischen praktisch zur Decke. »Ich sage nur, dass man als Leiterin einer privaten Mädchenschule Taktgefühl braucht. Diplomatische Fähigkeiten. Da kann man nicht einfach sagen ›Meine Güte, Mrs Morris, es muss Ihnen doch klar sein, dass Ihre Tochter nicht die geringste Chance hat, in Princeton aufgenommen zu werden‹.«
»Katy Morris schafft es nicht mal auf eine anständige Berufsschule«, sagte ich.
»Darum geht es nicht.«
»Ach so? Nur weil ich nicht bereit bin, deinen stinkreichen Eltern Honig ums Maul zu schmieren, bin ich dazu verdammt, auf ewig stellvertretende Direktorin zu bleiben?«
»Oder«, sagte Marilee, fuhr ihr Kinn wieder hinunter und sah mich über den großen Schreibtisch hinweg herausfordernd an, »vielleicht gerade nicht zu bleiben.«
»Wie bitte?«
»Vielleicht solltest du eine andere berufliche Tätigkeit in Betracht ziehen. Mal in eine ganz andere Richtung denken. Etwas machen, wovon du seit Langem träumst. Was meinst du?«
Ich fragte mich, was um alles in der Welt das ihrer Ansicht nach sein sollte. Ich bin keine Frau, die davon träumt, etwas zu »machen«.
»Dottie – Dr. Edge – hat den Wunsch geäußert, dass wir die Stellvertreterin zu uns holen, mit der sie in Nashville zusammengearbeitet hat«, sagte Marilee. »Die zwei waren offenbar ein erfolgreiches Team.«
Dottie.
Ich hatte meine Handtasche die ganze Zeit mit beiden Händen vor mir gehalten. (Marilee hatte mich gleich morgens auf dem Weg in mein Büro abgepasst.) Jetzt fühlte ich mich wie eine Bettlerin, die in Gebetshaltung um einen Gefallen fleht, und ließ die Tasche an meine linke Seite sinken. »Tja, dann hoffe ich, dass die beiden hier glücklich werden. Auf Wiedersehen, Marilee.«
»Gail?«
Ich drehte mich schroff um und ging.
»Gail, nun sei doch nicht so!«
Ich hastete zurück in die Eingangshalle, vorbei am Trophäenschrank und zur Tür hinaus auf die Straße.
Ich hielt nicht mal an, um das Kugelschreiber- und Bleistift-Set von meinem Schreibtisch zu holen oder das Foto meiner Tochter bei der Schulabschlussfeier oder die Strickjacke, die immer im Schrank hing. Das sollen sie mir nachschicken, dachte ich, oder wegschmeißen, mir doch egal.
Auf dem Parkplatz standen nur drei Autos – das von Marilee, meines und das von Mario, dem Hausmeister. Der Himmel war grau und hing tief – für später war Regen vorhergesagt –, und die beiden Arbeiter, die auf dem Gehsteig Verkehrshütchen aufstellten, trugen grelle Warnwesten. Ich stieg in meinen Corolla ein, ließ den Motor an und fuhr sofort los; ich nahm mir nicht mal die Zeit, das Fenster herunterzulassen, obwohl es im Wagen schon glühend heiß war. Und zwar weil ich nicht beobachtet werden wollte. Ich fühlte mich beschämt; als würde ich Aufsehen erregen.
Keine Ahnung, warum. Schließlich war das Ganze nicht meine Schuld!
Ich wohnte so nah bei der Schule, dass ich manchmal sogar zu Fuß ging, doch an diesem Morgen hatte ich den Wagen genommen, weil ich hinterher zur Reinigung fahren und das Kleid abholen wollte, das ich am Abend bei der Hochzeitsprobe meiner Tochter – mit anschließendem Essen – tragen würde. Mittlerweile konnte ich mir allerdings nicht mehr vorstellen, daran teilzunehmen. Ich malte mir aus, wie ich in der halb leeren Kirche saß, während die restliche Hochzeitsgesellschaft mit dem Finger auf mich zeigte und »Die arme Gail, habt ihr schon gehört?« flüsterte.
Gefeuert. Mit einundsechzig.
Weil sie keine Sozialkompetenz hat.
War nicht mal in den heutigen Schönheitstag in Darleen’s Spa miteinbezogen. Den hat die Mutter des Bräutigams ganz allein organisiert. (Was sollte Gail schon dazu beitragen!, hatte sie wohl gedacht. Diese biedere Frau, diese blasse Person mit den Schnittlauchlocken, die sich nicht im Mindesten um ihr Aussehen schert!)
Aber sie hätten wenigstens mit mir darüber reden können. Immerhin war ich die Mutter der Braut.
Auch wenn ich nicht mal gewusst hatte, dass es so etwas wie einen Schönheitstag überhaupt gab.
Ich fuhr nicht zur Reinigung. Ich fuhr direkt nach Hause. Ich parkte am Straßenrand, ging die Verandastufen hinauf, schloss die Tür auf, trat ins Wohnzimmer und ließ mich in den erstbesten Sessel fallen, zufällig einer, der zum großen Fenster hin stand. Ein dünner weißer Vorhang verschleierte den Blick, niemand konnte hineinschauen und mich sehen. Auf dem Bücherschrank tickte die alte Kaminuhr von Grandpa Simmons. Ich besaß keinen Kamin. Mein Haus war sehr klein und sehr bescheiden. Es hatte zwei Schlafzimmer und war aus den Sechzigerjahren. Der Fernseher war so alt, dass er hinten gut einen halben Meter hervorstand. Über eine Armlehne der Couch hatte ich eine Häkeldecke gelegt, damit man nicht sah, dass der Bezug dort nur noch aus einzelnen Fäden bestand. Immerhin gehörte das Haus mir allein; gekauft mit dem Geld, das mir mein Vater hinterlassen hatte. Ich hätte mein Elternhaus übernehmen können, weil meine Mutter unmittelbar nach dem Tod meines Vaters in ein Hochhaus gezogen war, aber damals lief es in meiner Ehe schon nicht mehr gut, und ich brauchte etwas, was ich selbst instand halten konnte, ohne auf Max angewiesen zu sein. Womit ich nicht sagen will, dass Max ein Versager oder so war; er neigte nur zu schlecht bezahlten Jobs. Er lebte noch immer von der Hand in den Mund – unterrichtete an einer Schule für Risikojugendliche östlich der Chesapeake Bay. Wohnte in einem Einzimmer-Apartment über einer Garage zur Miete.
Dass ich keine Sozialkompetenz besäße, hatte mir noch nie jemand gesagt. Jedenfalls nicht so direkt. Meine Ex-Schwiegermutter hatte mir zwar ein Büchlein mit dem Titel Manieren für Ahnungslose geschenkt, aber das war ja wohl nur pro forma gewesen. Ein Buch über Umgangsformen kann jede Braut gebrauchen. Sie hatte mir damit keinen Hinweis geben wollen.
Ich hatte mich schriftlich für das Buch bedankt, um meine tadellosen Manieren unter Beweis zu stellen, und dann hatte Max vorgeschlagen, seine Eltern zum Essen einzuladen und die Etikette auf die Spitze zu treiben – mit Fingerschalen nach der Suppe, etwas in der Art. War natürlich nur ein Scherz gewesen. Ich glaube, seine Eltern waren in Wirklichkeit nicht ein einziges Mal bei uns zum Essen.
Dachte Marilee, ich wäre vermögend? Ich konnte es mir nicht leisten, die Arbeit aufzugeben!
Die Kaminuhr raffte unter lautem Surren ihre Zahnräder zusammen und gab mehrere wackelige Schläge von sich. Neun Uhr, dachte ich; aber von wegen, es war schon zehn. Ich hatte offenbar wie betäubt dagesessen. Ich stand auf und hängte meine Handtasche in den Schrank, als ich vor dem Fenster, hinter der Gardine, eine Bewegung wahrnahm, eine dunkle, schwerfällige Gestalt, die sich durch den Vorgarten kämpfte. Ich schob die Gardine ein Stückchen zur Seite. Oh mein Gott, Max. Max mit einer Reisetasche über der Schulter und einem sperrigen Hartschalen-Koffer in der linken Hand.
Ich öffnete die Vordertür und sah ihn durch das Fliegengitter hindurch an. »Das ist jetzt nicht wahr«, sagte ich.
»Du bist zu Hause?«
»Ja …«
»Debbie ist bei einem Schönheitstag oder wie das heißt.«
»Genau«, sagte ich.
»Dabei hat sie gewusst, dass ich komme. Ich habe es mit ihr besprochen. Und dann bin ich da, und keiner macht auf. Ich rufe sie auf dem Handy an, und sie sagt, sie hätte mich nicht so früh erwartet.«
»Und warum bist du so früh gekommen?«, fragte ich.
»Ich wollte nicht in die Hauptverkehrszeit geraten. Du weißt, was freitags auf der Bay Bridge los ist.«
Ein Grund mehr, nicht auf der anderen Seite zu wohnen, hätte ich anmerken können. Ich hielt ihm die Fliegengittertür auf und griff nach dem unförmigen Koffer, aber es war gar kein Koffer, sondern eine Art Tiertransportbox. Durch das Drahtgitter an der einen Seite blickte etwas mit leuchtenden Augen munter und wachsam hinaus. Max schwenkte die Box ein Stück von mir weg und sagte: »Geht schon.«
»Was ist das?«
»Eine Katze.«
»Eine Katze?«
»Dürfte ich vielleicht rein?«
Ich machte Platz, und er stapfte schnaufend ins Haus und brachte die Dielenbretter zum Federn. Max war zwar keineswegs dick, aber wuchtig, breitschultrig; er machte immer den Eindruck, mehr Raum für sich zu beanspruchen, als ihm zustand, obwohl er nicht wesentlich größer war als ich. In den Jahren seit unserer Scheidung hatte er sich einen Bart wachsen lassen, ob absichtlich oder nicht; vielleicht hatte er auch nur eine Zeit lang vergessen, sich zu rasieren. Kurzes graues Gekräusel passend zum gekräuselten Grau seines Kopfhaars. Und in Hinblick auf seine Kleidung hatte er offenbar kapituliert; sein Standard waren ausgeleierte Strickoberteile und weite Khakihosen. Hoffentlich hatte er für die Hochzeit einen Anzug dabei. Bei ihm wusste man nie.
»Hättest du die Katze nicht mit ein bisschen Futter und Wasser zu Hause lassen können?«, fragte ich, während ich ihm durchs Wohnzimmer folgte. »Als wäre es nicht schon genug, dass du mitten während der Hochzeitsvorbereitungen bei Debbie übernachtest!«
»Sie hatte nichts dagegen«, konterte Max. »Sie meinte, es wäre kein Problem.«
»Gut, aber dann auch noch mit Katze! Katzen kommen sehr gut allein zurecht. Eigentlich sind sie sogar am liebsten allein.«
»Die hier nicht.« Er stellte die Box auf die Arbeitsfläche in der Küche. »Die ist noch zu neu.«
»Ein Junges?«
»Nein, sie ist alt.«
»Du hast doch gerade –«
»Eine alte Katze, die einer sehr alten Frau gehört hat, und diese Frau ist gestorben, und jetzt trauert die Katze.«
Ich hätte dazu gleich mehrere Fragen gehabt, aber ich sparte sie mir. Ich beugte mich vor, um die Katze anschauen zu können. »Weiß Debbie, dass du sie mitbringst?«, fragte ich Max.
»Jetzt schon.«
Ich wartete.
»Es ist kompliziert.« Er hob die Schulter und tupfte sich das Gesicht daran trocken. »Ich habe sie angerufen und gefragt: ›Wo bist du?‹, und sie hat gesagt, dass sie beim Schönheitstag ist. ›Hast du den Schlüssel irgendwo hinterlegt?‹, habe ich sie gefragt, und sie meinte Nein, aber sie wäre in ein paar Stunden zurück. ›In ein paar Stunden?‹, habe ich gesagt. ›Ich kann nicht ein paar Stunden warten! Ich habe eine Katze dabei!‹ Und sie darauf: ›Eine was?‹ Und dann ist sie an die Decke gegangen. Ihr kommt keine Katze ins Haus, hat sie gesagt. Kenneth ist gegen Katzen allergisch.«
»Ach wirklich?«
»Eine lebensbedrohliche Allergie, hat sie wörtlich gesagt.«
»Aber Kenneth wohnt ja nicht dort.«
»Mach dir nichts vor – er übernachtet oft bei ihr, und außerdem zieht er nach der Hochzeit bei ihr ein.«
»Gut, aber erst nach der Hochzeit.«
»Eine lebensbedrohliche Allergie, Gail. Das heißt, wenn er ein Haus betritt, in dem sich auch nur ein paar Haare einer Katze befinden, und selbst wenn die Katze schon lang weg ist, braucht er einen Respirator.«
»Einen Respirator?«
»Oder wie die Dinger heißen, die Asthmatiker immer dabeihaben müssen.«
»Du meinst einen Zerstäuber.«
»Nein, keinen Zerstäuber. Wie heißt das noch gleich? Verdampfer?«
Ich überlegte.
»Jedenfalls hat Debbie das behauptet. Sie hat behauptet, dass er nur neben ihr stehen muss, und wenn an ihrem Pulli Katzenhaare hängen, schnürt es ihm alles zusammen, und er braucht einen …«
Wir standen da und grübelten.
Die Katze machte: »Hmm?«
Wir sahen zur Box.
»Wie auch immer«, sagte Max, löste die beiden Schnappverschlüsse und nahm den Deckel ab. Doch anstatt aus der Box zu hüpfen, duckte sich die Katze noch tiefer und sah zu mir hinauf. Eine schwarz-grau getigerte Katze mit einem runden Gesicht. »Mir ist nichts anderes eingefallen, als zu dir zu fahren«, sagte Max. »Wo du deinen Schlüssel versteckst, weiß ich. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du unter der Woche zu Hause bist.«
»Tja, also …«, sagte ich. Und zur Katze: »Na, du!«
Sie richtete den Blick auf mich.
»Wie heißt sie?«, fragte ich.
»Weiß ich nicht.«
»Was? Wie kann man so etwas nicht wissen?«
»Ich bin nur ihr Betreuer«, erklärte er. »Ich arbeite ehrenamtlich für ein Tierheim, das Leute braucht, die Tiere in Pflege nehmen, bis jemand sie adoptiert. Normalerweise Katzenjungen – haufenweise wilde Kätzchen, die erst mal gezähmt werden müssen –, aber die hier ist eine Seniorin. Ich glaube, ich nenne sie Pearl, zumindest solange sie bei mir ist.«
»Pearl?«
»Ja, wegen der Farbe.«
»Eine Katze nennt man nicht Pearl!«
»Warum nicht?«
»Katzen haben kein Ohr für Sprache«, antwortete ich. »Da sind sie ganz anders als Hunde. Katzen nehmen nur den allgemeinen Tonfall des Menschen wahr, und ›Pearl‹ klingt, als würde man knurren.«
»Findest du?«
»Ja, genau wie ›Ruby‹. Oder ›Rhinestone‹.«
»Aha!«, sagte Max. »Siehst du? Alles wendet sich zum Guten.«
»Wieso? Was soll das heißen?«
»Du bringst mir etwas über Katzen bei. Und wer weiß – vielleicht nimmst du sie sogar zu dir.«
»Max«, sagte ich. »Manchmal frage ich mich wirklich, ob du mich auch nur ein klitzekleines bisschen kennst.«
»Aber du liebst Katzen! Du hattest diese hässliche kleine Glückskatze. Und die hier ist ältere Frauen gewohnt.«
»Danke.«
»Ich habe ›ältere‹ gesagt, nicht ›alte‹.«
»Ich will keine wie auch immer geartete Katze«, erwiderte ich.
»Was hältst du von ›Mary‹?«, fragte er. »Oder ›Carol‹ – wie wäre ›Carol‹?«
»Vergiss es, Max. Und bloß kein R! Ein R ist immer ein Knurrlaut.«
»Ja, stimmt. Danke.« Er schwieg. »Und ›Lucy‹?«
»Vergiss es, habe ich gesagt.«
Er seufzte.
»Du könntest sie in ein Tierheim hier in Baltimore bringen«, sagte ich. »Man würde sie bestimmt nicht abweisen.«
»Wir dürfen unsere Schützlinge nicht einfach irgendwo abladen. Nein, ich lasse sie besser hier bei dir und nehme sie wieder mit nach Cornboro, wenn du sie partout nicht willst.«
»Ich will sie auf gar keinen Fall. Und einen Übernachtungsgast auch nicht.«
»Ja, aber meine Kleidung ist inzwischen voller Katzenhaare. Ich kann unmöglich zu Debbie, nicht mal ohne Katze.«
»Ich weiß nicht, ob du überhaupt zur Hochzeit gehen solltest«, sagte ich. »Stell dir vor, Kenneth bekommt keine Luft mehr, während sie sich das Jawort geben.«
Ich sagte das aus reiner Boshaftigkeit. Ich bezweifelte nämlich stark, dass Kenneth keine Luft bekommen würde; er hatte immer einen sehr robusten Eindruck auf mich gemacht.
Max reagierte pikiert. »Ich soll nicht zur Hochzeit meiner eigenen Tochter gehen?«
»Oder du ziehst einen Regenmantel an. Oder einen Chemikalienschutzanzug.«
Das Küchentelefon klingelte. Wir sahen beide hin. Es klingelte noch einmal und dann noch mal. »Gehst du nicht dran?«, fragte Max.
Ich dachte allerdings, dass es Marilee sein könnte, und prompt meldete sich nach meiner Ansage Marilee und fragte: »Gail? Bist du da?«
Genau aus diesem Grund hatte ich noch einen echten, physisch existenten Anrufbeantworter. Es gab einfach zu viele Leute, mit denen ich nicht unbedingt jederzeit reden wollte.
»Wir müssen unbedingt reden«, sagte Marilee. »Hebst du bitte ab?«
Max sah mich stirnrunzelnd an.
»Hör gar nicht hin«, sagte ich.
»Was ist da los?«
»Gar nichts ist los.«
»Na dann …«
Der Anrufbeantworter schaltete sich ab. Ich wandte mich wieder der Katze zu und schloss kurz die Augen vor ihr. Katzen empfinden das als beruhigend, es ist für sie, als würde man lächeln. Dann blickte ich in eine andere Richtung. Gleich darauf hörte ich etwas rascheln, und als ich zur Seite spähte, sah ich, dass sie sich streckte und nach und nach vorsichtig aus der Transportbox und auf die Arbeitsfläche trat. »Ein kleines Gewichtsproblem«, murmelte ich.
Wie um meine Einschätzung zu bestätigen, landete sie mit einem dumpfen Geräusch auf dem Boden.
»Das kommt bestimmt vom Stress«, sagte Max. »Sie war eine Zeit lang ganz allein, bis bemerkt wurde, dass ihre Besitzerin tot war.«
Ich schnalzte verständnisvoll mit der Zunge.
»Was ist denn mit Marilee?«, fragte Max. Sich aus anderer Leute Angelegenheiten rauszuhalten, hatte noch nie zu seinen Talenten gezählt.
Ich sagte: »Nichts ist mit Marilee.«
Die Katze hatte sich inzwischen auf den Weg ins Wohnzimmer gemacht, und ich tat wichtig und folgte ihr. Einmal blieb sie stehen und schnupperte an den Teppichfransen, dann tappte sie zu einem Sessel und sprang geschmeidiger als erwartet hinauf.
»Worüber will sie mit dir sprechen?«, fragte Max, der mir gefolgt war.
Ich gab auf. »Sie setzt sich im Herbst zur Ruhe und will, dass der Schulausschuss eine andere zu ihrer Nachfolgerin bestimmt, eine aus Nashville. Und die aus Nashville bringt ihre eigene Stellvertreterin mit. Ich sollte also besser kündigen, bevor ich gefeuert werde.«
»Sehr gut!«, sagte Max.
Ich drehte mich um und sah ihn an.
»Deine große Stärke ist das Unterrichten, das weißt du selbst«, sagte Max. »Du kannst wahnsinnig gut mit Kindern, die Angst vor Mathe haben.«
»Du vergisst, dass Lehrer nichts verdienen«, entgegnete ich. »Warum hätte ich sonst so viel Zeit und Mühe auf meinen Master-Abschluss verwendet?«
»Na und? Debbie ist mit dem Jurastudium fertig. Du kannst jetzt wieder das machen, was du gut kannst.«
»So einfach ist das nicht.«
Immerhin – er hatte gesagt, dass ich etwas gut könne, und das fand ich nett von ihm.
Doch er wechselte das Thema. »Ich bring dann mal die Sachen für die Katze rein«, sagte er, ging nach draußen und ließ die Haustür offen, obwohl die Klimaanlage lief.
Ich widmete mich wieder der Katze. Sie lag wie ein Brotlaib mit unter sich eingeschlagenen Pfoten im Sessel, und als sie bemerkte, dass ich sie ansah, schloss sie träge die Augen und öffnete sie sofort wieder.
Max kehrte mit einem Sack Katzenfutter zurück, der in einer braunen Plastikwanne steckte, und in der freien Hand trug er einen größeren Sack mit Streu. »Wohin soll das Katzenklo? In die Küche?«, fragte er mich.
»Nicht in die Küche! Also wirklich! Stell es ins Gästebad.«
Er ging ins Gästebad. Die Haustür stand natürlich immer noch offen. Ich ging hin und knallte sie zu.
Er hatte auf dem Rückweg vom Bad seine Reisetasche aus der Küche geholt und trug sie die Treppe hinauf. »Bettwäsche ist im Badezimmerschrank?«, rief er zu mir hinunter.
»Du brauchst keine, das Bett ist gemacht.«
»Nur gut, dass meine Mutter nicht mehr lebt!«, rief er. »Du weißt bestimmt noch, dass sie Gästebetten, die nicht ganz frisch bezogen waren, verabscheut hat.«
»Oh, nicht ganz frisch bezogene Gästebetten!«, erwiderte ich sarkastisch. »Und ›verabscheut‹ sogar!« Ich folgte ihm die Treppe hinauf. Mir war eingefallen, dass über das gesamte Bett verteilt alte Fotos lagen, die ich für eine Darbietung auf der Hochzeitsfeier durchgesehen hatte. »Manieren für Ahnungslose«, sagte ich.
»Hä?«
Ich stürmte vor ihm ins Gästezimmer und schob die Fotos zusammen, wodurch die Reihenfolge durcheinandergeriet. »Ach guck mal da!«, sagte Max erstaunt. »Wir in Bethany Beach.«
Er hatte ein Bild im Geldbeutelformat von einem Kissen genommen; der Rand war gezackt wie bei den Fotos früher. Max und ich, sehr jung und unfertig, und Debbie, wahnsinnig süß, in einem Badeanzug mit Rüschenröckchen. Das Foto würde nicht verwendet werden. Kenneths Mutter hatte für alle Fotos ein größeres Format vorgegeben. Aber Debbie sah auf dem Bild zum Niederknien aus! Sie hatte diese winzigen hellen Sommersprossen, die jeden Sommer kamen und bis Thanksgiving auf magische Weise wieder verschwunden waren. Ich nahm Max das Foto aus der Hand und betrachtete es. »Du solltest deine Haare wieder lang wachsen lassen«, sagte Max.
»Von hinten Blondine, von vorn Ruine.«
»Was?«
Ich schob das Foto in den Stapel und wandte mich zum Gehen, warf aber noch einen Blick hinter mich und sagte: »Du findest nicht, dass ich keine Sozialkompetenz habe, oder?«
»Hmm?«
»Marilee meint, dass mir jede Sozialkompetenz abgeht.«
»Aha«, sagte er.
Doch er war nicht ganz bei der Sache. Er hatte seine Reisetasche aufs Bett gestellt und öffnete den Reißverschluss.
»Ich bin zwar nicht der kontaktfreudigste Mensch der Welt, das ist mir klar«, sagte ich, »aber im Grunde halte ich