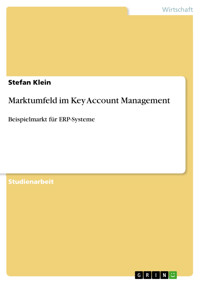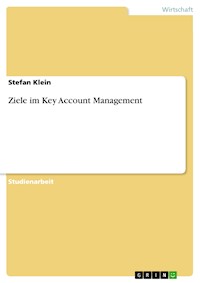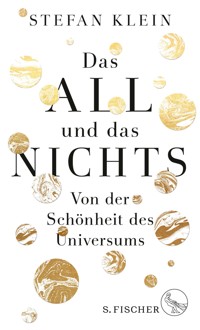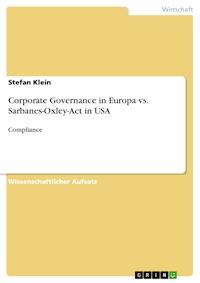8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Selbstlos siegt! Welche Gesetze über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben bestimmen. Den Selbstlosen gehört die Zukunft: Das ist die erstaunliche Quintessenz des neuen Buches von Stefan Klein, das unser Denken und Handeln verändern wird. Denn die neueste Forschung lässt die Ehrlichen keineswegs als die Dummen dastehen. Entgegen unserem Alltagsglauben schneiden Egoisten nämlich nur kurzfristig besser ab. Auf längere Sicht haben diejenigen Menschen Erfolg, die sich um das Wohl anderer bemühen. Denn nicht nur Wettbewerb, sondern auch Kooperation ist eine Triebkraft der Evolution. Ein Sinn für Gut und Böse ist uns angeboren. Stefan Klein zieht einen faszinierenden Querschnitt durch die aktuellen Ergebnisse der Hirnforschung und der Genetik, der Wirtschaftswissenschaften und der Sozialpsychologie. Er zeigt, welche Gesetze über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben bestimmen. Und er stellt dar, warum menschliches Miteinander und das Wohlergehen anderer zu unseren tiefsten Bedürfnissen gehören. Für andere zu sorgen schützt uns nicht nur vor Einsamkeit und Depression. Vielmehr macht uns Selbstlosigkeit glücklicher und erfolgreicher – und beschert uns nachweislich sogar ein längeres Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Stefan Klein
Der Sinn des Gebens
Warum Selbstlosigkeit in der Evolution siegt und wir mit Egoismus nicht weiterkommen
Über dieses Buch
Den Selbstlosen gehört die Zukunft: Das ist die erstaunliche Quintessenz des neuen Buches von Stefan Klein, das unser Denken und Handeln verändern wird. Denn die neueste Forschung lässt die Ehrlichen keineswegs als die Dummen dastehen. Entgegen unserem Alltagsglauben schneiden Egoisten nämlich nur kurzfristig besser ab. Auf längere Sicht haben diejenigen Menschen Erfolg, die sich um das Wohl anderer bemühen. Denn nicht nur Wettbewerb, sondern auch Kooperation ist eine Triebkraft der Evolution. Ein Sinn für Gut und Böse ist uns angeboren. Stefan Klein zieht einen faszinierenden Querschnitt durch die aktuellen Ergebnisse der Hirnforschung und der Genetik, der Wirtschaftswissenschaften und der Sozialpsychologie. Er zeigt, welche Gesetze über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben bestimmen. Und er stellt dar, warum menschliches Miteinander und das Wohlergehen anderer zu unseren tiefsten Bedürfnissen gehören. Für andere zu sorgen schützt uns nicht nur vor Einsamkeit und Depression. Vielmehr macht uns Selbstlosigkeit glücklicher und erfolgreicher – und beschert uns nachweislich sogar ein längeres Leben.
»Stefan Klein entzaubert Alltagsmythen, korrigiert Kollektivirrtümer, trennt Wischiwaschi von Handfestem … Aufklärung im besten Sinn des Wortes.« Weltwoche
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Imke Schuppenhauer
Coverabbildung: Laurence & Renaud / plainpicture
Illustrationen: Hermann Hülsenberg, Berlin
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2010
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401295-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Elias
Inhalt
Einleitung
Teil I
Die unerklärte Freundlichkeit der Welt
Der Held von nebenan
Das Mutter-Teresa-Problem
Jeden Tag ein Dutzend gute Taten
Ist Sex die Lösung?
Der Untergang der edlen Krieger
Darwins Dilemma
Was Groucho Marx empfiehlt
Der verkannte Altruist
Nehmen und Geben
Das Leben als Spiel
Die Logik der Verweigerung
Wie du mir, so ich dir
Eine kurze goldene Zeit
Feine Antennen für Betrug
Eine Hand wäscht die andere
Wie Vertrauen entsteht
Das Volk ohne Vertrauen
Die Ik und die Banker
Solidarische Gefühle
Zusammenarbeit macht glücklich
Gehirne im Gleichtakt
Lob des blinden Vertrauens
Homo oeconomicus macht schlechte Geschäfte
Vertrauen macht erfolgreich und reich
Die Entgrenzung des Ichs
Empathie schafft Vertrauen
»Den Arm hochgerissen«
Emotionale Ansteckung
Blinde Flecken im Spiegel
Männer ohne Nerven
Die eiligen Samariter
Der Geist in der Maschine
Erkenne dich selbst
Nobelpreis für Empathie
Das empathische Gehirn
Es gibt nur eine Liebe
Blut ist dicker als Wasser
Das altruistische Gen
Alle Menschen werden Brüder
Die Chemie der Liebe
Das Casanova-Molekül
Hormon der Harmonie
Coole Altruisten
Geben macht selig
Edle Wilde?
Der Schmerz der Ablehnung
Altruisten leben länger
Wer kalkuliert, verliert
Teil II
Menschen teilen, Tiere nicht
Teilen tut weh
Die Tragik der Gutwilligen
Sind Vampire Altruisten?
Von Löwen und Warzenschweinen
Grantige Schimpansen
Adoption im Regenwald
Auszug in die Savanne
Der Weg durch den Flaschenhals
Gemeinschaft in der Kinderstube
Erst freundlich, dann klug
Strafe muss sein
Gerechtigkeit und Altruismus
Weil es ums Prinzip geht
Die nettesten Menschen der Welt
Handeln macht großzügig
Übung schafft Gerechtigkeit
Wir sind Opportunisten
Wer nicht hören will …
Das Gegengewicht der Gier
Verlockende Strafen
Kaskaden der Dankbarkeit
Warum Belohnung die Moral untergräbt
Wir gegen die
Wettbewerb erzeugt Selbstlosigkeit
Tod eines Altruisten
Evolution auf allen Kanälen
Die Karten neu mischen
Das rechte Maß des Gebens
Der Ursprung der Scham
»So geht daxen nicht!«
Nicht die Gene allein
Die Geschichte der Moral
Das Böse im Guten
Adler gegen Klapperschlangen
Korruption durch Selbstlosigkeit
»Wenn Neid erzeugt gehäss’ge Irrung«
Tödliche Tabus
Der Turm von Babel
Normaler Wahnsinn
Ein gemeinsames Ziel
Die goldene Regel
»… dass man die Menschen sortierte«
Zum Retter geboren?
Die Liebe des Konfuzius
Vom Himmel auf die Erde
Die Achse des Guten
Ein Festmahl für den Feind
Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
Die Perspektive wechseln
Die Grenzen der Nächstenliebe
Erfolgsmodell Rom
Der Schatz Reputation
Selbstlos siegt
Der globale Autoreifen
Die Pleite der Nationen
Kapital und Kabeljau
Die Spielverderber aus Athen
Moral von unten
Das globale Dorf lebt
Die Büffel des Informationszeitalters
Epilog: Das Glück zu geben
Literaturverzeichnis
Danksagungen
Namen- und Sachregister
Für Elias
Inhalt
Einleitung
Wie gute Freunde, so können uns Texte jahrzehntelang begleiten, sogar faszinieren, ohne dass wir sie wirklich verstehen. Mir ging das so mit den folgenden Zeilen:
An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk
Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack
Mitfühlend sehe ich
Die geschwollenen Stirnadern, andeutend
Wie anstrengend es ist, böse zu sein.
Sie stammen von Bertolt Brecht und stehen unter dem Titel »Die Maske des Bösen«. Ich begegnete dem kurzen Gedicht mit 17 Jahren, als ich wie so viele Heranwachsende sehr böse auf die Welt und voll Sehnsucht nach einer besseren war. Natürlich leuchtete mir der vordergründige Sinn ein; wie viel Kraft es kostet zu hadern, spürte ich ja selbst zur Genüge. Welch eine Energieverschwendung der Zorn sein kann! Schlimmer noch als das unangenehme Gefühl an sich ist, dass es uns von anderen trennt. Wut ist ein Gefängnis. Jede ihrer Zielscheiben ist ein Mensch weniger, mit dem wir gemeinsame Sache machen können.
Aber »böse« bezeichnet nicht nur ein Gefühl, sondern auch ein moralisches Urteil. Fast sicher hatte Brecht diese Bedeutung gemeint: »Die Maske des Bösen« entstand im September 1942, als der Feldzug der Nazis seinen Höhepunkt erreichte und Hitlers Truppen vom Nordkap bis nach Nordafrika, von der Krim bis zum Atlantik Schrecken verbreiteten. Diese Lesart jedoch irritierte mich zornigen jungen Mann tief: Konnte es sein, dass Menschen, die andere ausnutzen, verletzen, sogar umbringen und einen Vorteil daraus ziehen, selbst unter ihrem Tun leiden? Verdienen am Ende gar Himmler und Hitler unser Bedauern?
Viel später begriff ich, dass sich der Gedanke auch umkehren lässt. Wenn wir frei von Bosheit bleiben und uns fair und großzügig zeigen, so tun wir es möglicherweise nicht nur aus Angst vor Strafen und weil es uns die Erziehung so eingebläut hat. Menschlichkeit im Umgang mit anderen könnte uns vielmehr selbst nutzen, weil sie das eigene Wohlbefinden erhöht. Die uralte Frage, ob man sich um andere oder lieber um das eigene Glück kümmern soll, fände dann von selbst ihre Antwort: Um beides – weil es das eine ohne das andere nicht gibt.
Aus dieser Überlegung heraus entstand das vorliegende Buch. Es will allen Ermahnungen zur Anständigkeit widersprechen, übrigens auch den jahrhundertealten Lehren der Philosophie, wonach wir die süße egoistische Neigung bekämpfen müssen, da die bittere moralische Pflicht es verlangt. Wenn eigenes und fremdes Wohlbefinden so eng verknüpft sind, so würde dies zugleich erklären, warum so viele Menschen ihrem privaten Glück hinterherjagen und es trotzdem nicht finden: Vielleicht haben sich diese Glückssucher die falschen Ziele gesetzt.
Dass ein glückliches Leben das Wohl anderer im Blick hat, vermutete der Philosoph Aristoteles schon vor mehr als 2500 Jahren. Aber der griechische Denker konnte seine Spekulation nicht beweisen. Auch darum setzte sich die Vorstellung durch, dass moralisches Handeln nur um den Preis des Verzichts zu bekommen sei. Heute geben empirische Untersuchungen Aristoteles recht: Menschen, die sich für andere einsetzen, sind in aller Regel zufriedener, oft erfolgreicher und sogar gesünder als Zeitgenossen, die nur an ihr eigenes Wohl denken. »Eines weiß ich«, bekannte Albert Schweitzer einmal, »wirklich glücklich werden nur die, die entdeckt haben, wie sie für andere da sein können.«[1] In diesem Sinn setzt dieses Buch mein früheres Werk »Die Glücksformel« fort.
Kommen Altruisten wirklich besser durchs Leben? Dagegen wehrt sich der Alltagsverstand. Wer etwas hergibt, hat hinterher weniger; wer dagegen seine Zeit, seine Kraft oder auch sein Geld für die eigenen Ziele einsetzt, ist auf den ersten Blick im Vorteil. Schon ein Blick auf die Natur scheint nahezulegen, die eigenen Güter zusammenzuhalten: Denn Menschen wie Tiere ringen um knappe Ressourcen. Wer hat, setzt sich durch, wer nicht hat, geht unter.
Mit diesem Buch will ich den Nachweis erbringen, dass und warum sich der Alltagsverstand irrt: Unser Zusammenleben verläuft nach sehr viel komplizierteren Regeln als denen des Dschungels. Die kommenden Seiten werden einige der Gesetze, die über Erfolg und Misserfolg in unserem Leben tatsächlich entscheiden, erklären. Eine zentrale Erkenntnis dabei ist, dass Egoisten nur kurzfristig besser abschneiden, auf lange Sicht aber meist Menschen weiterkommen, die sich auch für das Wohl anderer einsetzen. Weil »meist« natürlich nicht »immer« bedeutet, wird es auch darum gehen, wann die eine, wann die andere Strategie sich besser bewährt.
Wenn erfolgreicher ist, wer sich für seine Mitmenschen einsetzt, würde die Evolution solches Verhalten befördern. Damit steht eine faszinierende Hypothese im Raum: Ist es uns angeboren, für andere zu sorgen? Gibt es Gene für Altruismus?
Dass die Welt von Egoisten nur so wimmelt, spricht nicht dagegen. Denn sicher sind Menschen nicht nur darauf programmiert, selbstlos zu sein. Möglicherweise sind unsere Anlagen, erst auf den eigenen Vorteil zu achten, sogar stärker. Darum fruchten bloße Ermahnungen und Vorsätze, ein besserer Mensch zu sein, so wenig. Interessant ist aber nicht die Frage, ob ein gewisses Maß an Egoismus nun einmal zum menschlichen Wesen gehört. Viel mehr kommt es darauf an, ob wir darüber hinaus noch andere und weniger sattsam bekannte Regungen haben.
Menschen sind so widersprüchlich in ihren Motiven wie kein anderes Geschöpf. Auch sind wir ungewöhnlich frei, gegen unsere Instinkte zu handeln. Die Bandbreite, innerhalb derer wir unsere Talente einsetzen können, ist enorm. Die Evolution hat den Menschen als Läufer konstruiert, weshalb jede gesunde Person nach entsprechendem Training einen Marathon bewältigen kann. Andere legen selbst kurze Wege im Auto zurück, so dass ihre Beinmuskulatur völlig verkümmert. Genauso können wir unsere Anlagen zum Altruismus vernachlässigen – oder sie kultivieren.
Allerdings hat die Natur ein raffiniertes Mittel erfunden, mit dem sie uns dazu bringt, was sie von uns will – sie verführt uns mit guten Gefühlen. Sex ist aufregend und angenehm, denn er dient der Vermehrung. Wirkungsvoller, als vielen lieb ist, sind auch die Lustgefühle beim Essen, damit wir Fettpolster für schwere Zeiten anlegen. Auf ganz ähnliche Weise belohnt uns die Natur für Fairness und Hilfsbereitschaft: Es fühlt sich gut an, großherzig zu sein. Tatsächlich zeigt die Hirnforschung, dass Altruismus im Kopf dieselben Schaltungen aktiviert wie der Genuss einer Tafel Schokolade oder auch Sex.
»Wie traurig es ist, ein Egoist zu sein«, möchte man in Anlehnung an Brecht voll Mitgefühl feststellen – und wie gefährlich. Gar nicht so sehr für die Mitmenschen, denn entwickelte Gesellschaften zumindest halten allzu wilden Egoismus mit Gesetzen und Gerichten im Zaum. Doch wer schützt die Egoisten vor sich selbst? Schwere Depressionen verbreiten sich in Deutschland wie in den meisten Ländern in furchterregendem Tempo. Innerhalb nur eines Jahrzehnts hat sich das Risiko für junge Menschen, krankhaft schwermütig zu werden, mehr als verdreifacht.Und in weiteren zehn Jahren werden Depressionen laut der Weltgesundheitsorganisation bei Frauen die verheerendste Krankheit sein, bei Männern nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch mehr Schaden anrichten. Viele Fachleute erklären diese erschreckenden Zahlen damit, dass Bindungen an die Familie, an Freunde und Kollegen sich aufgelöst haben und dass in der heutigen Gesellschaft vor allem das Individuum zählt. Sicher ist, dass Einsatz für andere der krankhaften Traurigkeit vorbeugen kann.[2]
Was hindert uns eigentlich daran, zu unserem eigenen Besten mehr für andere zu sorgen? Wer es versucht, stellt fest, wie tief wir dem eigenen Wunsch, großzügig zu sein, misstrauen. Zwar spüren wir oft den Impuls, etwas für andere zu tun, aber dann unterdrücken wir ihn. Denn Altruismus ist fast immer riskanter, als nur auf eigene Rechnung zu handeln.
Da ist zum einen die Angst, uns lächerlich zu machen. Großherzigkeit genießt in unserer Gesellschaft einen seltsamen Ruf: Öffentlich lobt jeder selbstlose Menschen, doch hinter vorgehaltener Hand gedeiht der Zynismus. Bewunderung genießt, wer cool und durchsetzungsstark wirkt. Mitgefühl hingegen gilt als ein Zeichen von Schwäche. Man zweifelt am Verstand derer, die ihre Interessen bisweilen zurückstellen; allzu oft fällt der Begriff des naiven »Gutmenschen«. Dabei sind selbst – und gerade – die größten Spötter im Grund ihres Herzens von der Sehnsucht nach dem Guten erfüllt. Sarkasmus ist schließlich der beste Schutz gegen Enttäuschung.
So sind wir in Sachen Selbstlosigkeit rettungslos ambivalent: Wir wollen daran glauben, können es aber nicht, und wenn wir es könnten, würden wir es nicht zugeben. Nur auf einen Gedanken scheint niemand zu kommen: Dass die Bereitschaft zur Hingabe auf die Stärke eines Menschen hindeuten könnte.
Noch tiefer als die Furcht vor Spott sitzt die Angst, ausgenutzt zu werden. Sie plagt uns völlig zu Recht. Denn solange Menschen ihren eigenen Vorteil anstreben, werden Einzelne von der Gutwilligkeit der anderen profitieren wollen. Dies war die Tragödie jeder von Idealisten angezettelten Revolution.
So erzählt dieses Buch von Geben und Nehmen, von Vertrauen und Verrat, von Mitgefühl und Rücksichtslosigkeit, von Liebe und Hass. Aber die Frage wird nicht sein, ob Menschen gut oder böse sind. Darüber haben einige der größten Philosophen lange genug gerätselt. Was hierzu geschrieben wurde, erinnert manchmal an eine Diskussion darüber, ob Kino an sich lustig oder beunruhigend ist: Natürlich hängt es vom Film ab, der gerade läuft. Auch geht es nicht darum, wie wir uns verhalten sollen. Überzeugende Entwürfe einer Moralphilosophie gibt es mehr als genug. Die Frage ist allerdings, warum wir ihnen so selten folgen.
Vielmehr versuche ich zu klären, unter welchen Umständen Menschen fair und großzügig sind – und wann skrupellos und egoistisch. Dabei gilt es, zwei Fragen zu unterscheiden: Erstens, wie ist Uneigennützigkeit überhaupt möglich? Zweitens, was bewegt uns dazu, etwas für andere zu tun? Und warum sind manche Menschen so viel hilfsbereiter als andere?
Im ersten Teil dieses Buches steht die übersichtlichste, aber keineswegs einfachste Form des Zusammenlebens im Vordergrund: Ich und du. Untersucht wird die Neigung zu teilen, aber auch zu betrügen. Denn kooperatives Handeln lohnt sich zwar, den anderen zu prellen jedoch zumindest kurzfristig noch mehr. Wenn aber auf Dauer meist doch besser fährt, wer großzügig ist, anderen gute Absichten unterstellt und ihnen verzeiht: Wie entscheiden wir dann, wann wir vertrauen und wann wir uns besser zurückziehen sollten? Die Vernunft ist damit oft überfordert. Ihr zur Hilfe kommt ein Hirnsystem der Empathie, das ganz anders funktioniert als das gewohnte strategische Denken. Wenn wir andere Menschen in Freude oder Schmerz erleben, spiegeln wir ihre Gefühle in unserem eigenen Kopf wider. Als löste sich die Grenze zwischen »dir« und »mir« auf, schwingen dann beide Gehirne im Gleichtakt. Ähnliche Mechanismen sorgen dafür, dass Vertrauen und gegenseitiges Verständnis entstehen.
Das empathische Hirnsystem hat außerordentlich viele Facetten: Mitgefühl alleine etwa macht uns weder großzügig noch hilfsbereit, anders als häufig behauptet. Einsatz für andere setzt voraus, dass wir nachvollziehen können, was den anderen bewegt. Und schließlich haben Hirnforscher jüngst auf beeindruckende Weise sogar sichtbar gemacht, wie Freundschaft und Liebe in unseren Köpfen entstehen.
Thema des zweiten Teils ist die Gemeinschaft. Er beginnt mit einer Zeitreise in die ferne Vergangenheit: Wie haben unsere Vorfahren gelernt, miteinander zu teilen? Dies ist noch immer eines der größten Rätsel der Evolutionstheorie. Oft genug wurde der Mensch als das grausamste aller Geschöpfe gescholten; tatsächlich aber sind wir von einer einzigartigen Großherzigkeit. Nach heutigem Wissen der Forscher gibt kein Tier einem anderen freiwillig etwas ab, allenfalls der eigene Nachwuchs bekommt Futter. Menschen überall auf der Welt hingegen sorgen für ihre Nahrung gemeinsam, und schon kleine Mädchen und Jungen machen spontane Geschenke. Viel spricht dafür, dass unsere Vorfahren erst die freundlichsten Affen werden mussten, bevor sie eine Chance hatten, auch die klügsten Affen zu sein. Wir verdanken unsere Intelligenz unserer Bereitschaft zu geben.
Aber wir geben nicht wahllos. Gerechtigkeit gehört zu unseren stärksten Bedürfnissen überhaupt, und sie ist lebensnotwendig. Eine Gemeinschaft, die keinen fairen Umgang unter ihren Mitgliedern durchsetzt, geht über kurz oder lang unter. Gerechtigkeit ermöglicht erst Altruismus, doch der Hunger nach ihr beschert uns Rache und Neid. Und diese sind noch nicht einmal die dunkelsten Seiten der Selbstlosigkeit: Jede Gruppe hält umso besser zusammen, je stärker sie im Wettbewerb mit anderen Gemeinschaften steht. Deshalb sind Abgrenzung und Hass auf »die Anderen« die düsteren Schwestern des Altruismus. Ihren Anlagen, für andere zu sorgen, verdanken Menschen also nicht nur ihre edelsten, sondern auch einige ihre hässlichsten Züge. So bestätigt die moderne Forschung einen Zusammenhang, von dem Mythen zu allen Zeiten erzählten – beginnend mit Luzifer, dem gefallenen Engel, bis hin zu Darth Vader, der sich im Hollywoodepos »Star Wars« von der Lichtgestalt in einen finsteren Tyrannen verwandelt.
Können wir die guten Seiten des Altruismus ohne die schlechten ausleben? Nicht zuletzt davon hängt die Zukunft der Menschheit ab. Solange Unternehmen, Völker und Nationen die eigenen Interessen auf Kosten des Wohls aller verfolgen, wird es kaum möglich sein, die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zu schützen.
Die Geschichte der Menschheit begann mit einer altruistischen Revolution – unsere Vorfahren fingen an, für ihre Nächsten zu sorgen. Nur gemeinsam hatten sie eine Chance in einer Welt, in der Nahrung knapp wurde, weil das Klima sich wandelte. Heute stehen wir vor einer ähnlichen Schwelle: Die Herausforderung ist, Zusammenarbeit in viel größeren Maßstäben zu lernen. Es ist Zeit für eine zweite altruistische Revolution.
Wir haben durchaus Grund, optimistisch zu sein. Durch elektronische Netze, müheloses Reisen und globalen Handel rücken entlegene Gegenden der Welt näher, wachsen Kulturen in atemberaubendem Tempo zusammen. In diesem Buch möchte ich zeigen, wie die Vernetzung auch die Antriebe unseres Verhaltens verschiebt. Es kostet uns zunehmend weniger, selbstlos zu sein, während Egoismus immer riskanter wird.
Die Zukunft gehört den Altruisten. Mit den nötigen Anlagen, sich darin zu behaupten, sind wir geboren. Doch während uns das berechtigte Streben nach dem eigenen Vorteil vertraut ist, fremdeln wir noch mit den Regungen, die uns das eigene Glück im Glück anderer finden lassen. Dieses Buch ist eine Einladung, die freundliche Seite unseres Wesens zu erkunden.
Teil I
Ich und du
Die unerklärte Freundlichkeit der Welt
Eine Zeitung aus Manchester brachte eine ziemlich gute Glosse über mich. Ich soll bewiesen haben, dass »Macht recht hat« & dass deswegen Napoleon recht hat & und dass jeder betrügerische Kaufmann auch recht hat.
Charles Darwin[1]
Wesley Autrey wartete mit seinen beiden kleinen Töchtern auf die U-Bahn, als ein junger Mann neben ihm plötzlich zu zittern begann, sich verkrampfte, auf den Rücken fiel und wie ein Käfer mit hochgereckten Armen und Beinen zu strampeln begann. Gut hundert Menschen drängten sich auf dem Bahnsteig, aber die meisten sahen weg. Nur zwei Frauen eilten zur Hilfe. Doch Autrey war schneller. Geistesgegenwärtig fragte er nach einem Kugelschreiber und klemmte ihn dem Fremden zwischen die Zähne, damit dieser sich bei seinem epileptischen Anfall nicht auf die Zunge bisse. Nach kurzer Zeit gingen die Krämpfe vorbei, der junge Weiße stand auf, und Autrey glaubte, seine Fahrt durch den New Yorker Untergrund fortsetzen zu können.
Ein Rumpeln und das Scheinwerferlicht kündigten den Zug an. In diesem Moment taumelte der Epileptiker erneut. Er schwankte auf die Bahnsteigkante zu, stolperte und fiel auf das Gleis. Autrey bat eine der Frauen, die zuvor ihre Hilfe angeboten hatten, sich um seine Töchter zu kümmern, und sprang auf das Gleisbett. Schon fuhr der Zug ein, Autrey war keine Zehntelsekunde Zeit zum Nachdenken geblieben. Er packte den Gestürzten und versuchte, ihn auf den Bahnsteig zu hieven. Doch der Mann war zu schwer. Da zerrte Autrey ihn zwischen die Schienen und warf sich auf ihn. Der Epileptiker strampelte, Autrey drückte ihn mit aller Kraft nieder. Als etwas Kaltes seine Stirn berührte, presste Autrey seinen Kopf auf die Schulter des anderen. Zwischen seinem Scheitel und dem Zug blieben genau zwei Fingerbreit Luft.
Fünf Wagen rollten über ihn. Dann blieb der Zug stehen, und Autrey hörte die Schreie seiner Töchter. Als eine Rettungsmannschaft später die beiden Männer aus ihrem Gefängnis zwischen den Rädern befreite, tropfte Wagenschmiere von Autreys Mütze. Die Sanitäter stellten an dem Epileptiker nicht mehr als ein paar Prellungen fest; Autrey selbst verzichtete auf medizinische Hilfe. Ohnehin war er nicht der Ansicht, etwas Besonderes geleistet zu haben, auch wenn er genau wusste, dass er sein Leben riskiert hatte: »Ich sah nur einen Menschen, der Hilfe brauchte. Da tat ich, was zu tun war.«[2]
Wer sich nun Autrey als einen schweigsamen und etwas biederen Kämpfer für Recht und Anstand vorstellt, als einen Westernhelden vom Schlag Gary Coopers, täuscht sich. Und schon gar nicht erfüllt er das Klischee von den blutleeren Menschen, die sich demonstrativ mit Märtyrermiene für andere aufopfern. Wesley Autrey ist von athletischer Statur, und wer ihm, mit Trainingsanzug und umgekehrt aufgesetzter Baseballmütze bekleidet, in seinem Viertel in Harlem begegnet, könnte ihn für einen Rapper halten. Nur ein paar graue Haare im Vollbart deuten auf seine 51 Jahre hin.
Sein Einsatz in der Station an der 137. Straße von Manhattan an jenem 2. Januar 2007 machte ihn zu einem landesweit gefeierten Helden. Er wurde in Talkshows und ins Weiße Haus eingeladen, und Autrey redete so lebhaft, so selbstsicher und mit so wohlgesetzten Worten, als sei er große Auftritte seit jeher gewohnt. In Wirklichkeit verdiente er sein Geld als Vorarbeiter auf Baustellen, früher einmal war er drei Jahre lang als Postangestellter dritter Klasse bei der Kriegsmarine beschäftigt.[3] Doch wenn sich jemand bei seinen Interviews ungeschickt benahm, dann waren es Prominente wie der Talkmaster David Letterman, der in seiner Show mit mäßigen Witzen davon abzulenken versuchte, dass er der Eloquenz seines Gastes nicht beikam: Autrey ist ein cooler Typ.
Medien und Politiker feierten ihn als Vorbild, und wenn Autrey nun den U-Bahnhof an der 137. Straße betrat, versuchten immer wieder Passanten ihn anzufassen – als wollten sie sichergehen, dass es sich wirklich um einen Menschen aus Fleisch und Blut handele.
Niemand allerdings schien zu bemerken, wie verstörend Autreys Heldentat zugleich war: Was bringt einen Vater in Gegenwart seiner erst vier und sechs Jahre alten Kinder dazu, für einen Fremden sein Leben zu riskieren? Wie kann sich ein Mensch innerhalb weniger Augenblicke zur völligen Hingabe an einen anderen entschließen?
Der Held von nebenan
Millionen Fernsehzuschauer mochten Autrey bewundern, für die Wissenschaft aber bedeutet seine Tat eine echte Herausforderung. Denn nach ihren traditionellen Erklärungen hätten die Vorgänge unter der 137. Straße nie stattfinden dürfen. In der Verhaltensforschung setzte sich während der letzten Jahrzehnte ein Menschenbild durch, das uns als zutiefst eigennützige Wesen beschreibt. Biologen sahen uns auf maximalen Fortpflanzungserfolg programmiert, Evolutionspsychologen auf das Erringen von Status. Ökonomen, die wohl einflussreichsten aller Sozialwissenschaftler, verstanden menschliches Handeln mehrheitlich als Streben nach Bequemlichkeit und Wohlstand. Übereinstimmend beruhten alle Disziplinen auf der Annahme, jeder sei sich selbst der Nächste und Altruismus eine Illusion.
Welche Schwierigkeiten sich aus einem solchen Ansatz ergeben, erkannten die Forscher durchaus. Immerhin leben und arbeiten nicht nur Menschen, sondern auch Tiere einträchtig zusammen. Der Putzerfisch schwimmt Raubfischen ins Maul, die ihn mit einem Zuschnappen verschlingen können, und frisst Parasiten, die sich dort festgesetzt haben. Zackenbarsch und Muräne lassen es geschehen.
Ameisen, Bienen, Wespen und Termiten wiederum leben in Staaten mit Millionenbevölkerung und beweisen, dass Kooperation in großen Gruppen spektakulär erfolgreich sein kann.[4] So unscheinbar jedes dieser Insekten für sich erscheint, so bedeutsam sind ihre Gemeinschaften. Schätzungen zufolge besteht die Hälfte der tierischen Biomasse in den Tropen aus Termiten. Diese sozialen Insekten wiegen zusammen also soviel wie alle anderen Tiere, die das tropische Afrika, Südasien, Mittel- und Südamerika bevölkern. Nicht einmal die Verbreitung unserer eigenen Art hat solche Dimensionen erreicht. Die knapp sieben Milliarden Menschen auf der Erde erreichen zusammen nur das Gewicht aller übrigen Wirbeltiere. Dafür beherrscht Homo sapiens den ganzen Planeten und hat weltumspannende Organisationen gebildet. Ohne unsere Fähigkeit zur Zusammenarbeit wäre dieser Aufstieg undenkbar gewesen.
All das ließe sich kaum verstehen, hätte jeder nur seine eigenen Belange im Blick. So mühten sich die Verhaltensforscher jahrzehntelang mit dem Problem, wie Gemeinschaft möglich sein kann, wenn sich jede Handlung in einem persönlichen Vorteil auszahlen muss.
Und wie sollten sie mit ihrem Konzept erklären, dass sich immer wieder Menschen selbstlos für andere einsetzen und sogar wie Autrey ihr Leben dabei riskieren? Helden mögen selten sein. Doch kann man sie nicht einfach als Ausnahme wegdiskutieren?
Schließlich haben im Zweiten Weltkrieg mehrere zehntausend Menschen unter Lebensgefahr Juden vor dem Konzentrationslager bewahrt. Und überwältigend viele Mitbürger sind bereit, für andere Schmerzen zu ertragen: So haben sich mehr als drei Millionen Deutsche registrieren lassen, um per Operation Knochenmark zu spenden und damit einem unbekannten Leukämiekranken zu helfen. In den Vereinigten Staaten haben sogar Webseiten Zulauf, auf denen Freiwillige eine ihrer Nieren zur Transplantation anbieten – ohne jede Gegenleistung. Diese Art der Organspende an Fremde ist in Deutschland verboten.
Weniger spektakulär, dafür umso bedeutender für unser Zusammenleben sind die unzähligen Situationen des Alltags, die ebenfalls nicht zu dem Bild vom stets egoistischen Menschen passen: Warum etwa geben wir Trinkgeld, auch wenn wir wissen, dass wir ein Lokal nie wieder besuchen werden? Weshalb stürzen wir hinterher, wenn wir sehen, dass ein fremdes Kind auf die Straße rennt? Schwer ist der Eigennutz auch zu erkennen, wenn Menschen jahrelang bettlägerige Angehörige pflegen, anonym ihr Geld unbekannten Erdbebenopfern spenden oder ihre Freizeit einem Ehrenamt opfern, wie fast ein Drittel der Deutschen es tut. Auch würde Deutschland heute wohl anders aussehen, hätten vor zwanzig Jahren nicht erst Hunderte, später Zehntausende Montagsdemonstranten zum Nutzen ihrer Mitbürger der Stasi die Stirn geboten.
Und die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, nimmt sogar zu. Beispielsweise engagieren sich heute fast zwei Millionen mehr Menschen in einem Ehrenamt als noch vor zehn Jahren.[5] Und im Internet blühen ganz neue Formen von Kooperation und Selbstlosigkeit, bei denen Experten weltweit ihre Arbeitskraft verschenken. So entstanden beinahe über Nacht die zehn Millionen Artikel der Wikipedia und die kostenlosen Open-Source Programme, die Konzernen wie Microsoft ernsthaft Konkurrenz machen.
Bei vielen wissenschaftlichen Rätseln lässt es sich leicht verschmerzen, wenn die Forschung an ihrer Lösung scheitert. Die schwer zu erklärenden und dabei allgegenwärtigen altruistischen Akte aber werfen Fragen auf, die an unser Selbstverständnis rühren: Wie eigennützig, wie selbstlos können sich Menschen verhalten? Unter welchen Umständen stellen sie ihre eigenen Interessen zurück? Wie lässt sich das Engagement für andere fördern?
Oft klagen wir über den Egoismus unserer Zeitgenossen. Aber vielleicht verhält es sich mit der Freundlichkeit der Menschen wie mit der Luft: Wir bewegen uns ständig in ihr; darum vergessen wir leicht, dass es sie überhaupt gibt. Erst wenn sie wegbleibt, spüren wir, was fehlt. Wer ein Restaurant mit netter Bedienung verlässt, ohne Trinkgeld zu geben, gilt in aller Augen als Rüpel.
Das Mutter-Teresa-Problem
Klären wir zunächst, was Egoismus und Altruismus überhaupt sind. Im Alltag geben wir diesen Worten meist einen moralischen Beiklang und richten uns dabei nach den Motiven der Handelnden. »Egoist« schimpfen wir eine Person, von der wir glauben, dass sie nur an den eigenen Vorteil denkt. »Altruist« hingegen nennen wir jemanden, der nur das Beste für andere und für sich selbst gar nichts will. Wer einem Bettler sein letztes Hemd gibt, weil er sich gut dabei fühlt, wäre so gesehen kein Altruist. Denn selbst wenn der Spender nun nackt dasteht, hat er sich nicht für den Bettler, sondern um seiner guten Gefühle willen entkleidet.
Nach dieser Definition behält vordergründig fast immer recht, wer den Menschen als reinen Egoisten ansieht. Denn schließlich kann man jedem Wohltäter unterstellen, dass er Befriedigung, Stolz oder ein anderes erhebendes Gefühl als Lohn für die gute Tat empfindet. Auch die Anerkennung der Mitmenschen dürfte in den meisten Fällen nicht ausbleiben. Und sagen nicht viele engagierte Zeitgenossen selbst, erst der Einsatz für andere gebe ihrem Leben einen Sinn? Menschen, die selbstlos handeln, scheinen demnach nur auf raffiniertere Weise egoistischer zu sein als andere.
Doch das ist zu oberflächlich gedacht. Denn erstens ist damit nicht beantwortet, warum wir uns gut fühlen, wenn wir etwas für andere tun. Und zweitens: Wenn jemand nach einer uneigennützigen Tat in Hochstimmung ist, heißt das schließlich nicht, dass er nur deswegen altruistisch gehandelt hat, weil er sich gut fühlen wollte. Der alltägliche Sprachgebrauch krankt daran, dass wir die wahren Beweggründe anderer nicht kennen. Und das muss nicht an ihrer Unehrlichkeit liegen: Oft weiß ein Mensch ja selbst nicht genau, weshalb er etwas tut und das andere lässt.
Daher kann man dem Argument, Altruisten kümmerten sich nur zu ihrer persönlichen Befriedigung um andere, so schwer widersprechen. Zyniker behaupten gern, nicht einmal Mutter Teresa habe selbstlos gehandelt: Der Ordensschwester, die die Sterbenden von den Straßen Kalkuttas aufsammelte, den Leprakranken die Wunden wusch und aus freien Stücken im Slum wohnte, habe es einfach gut getan, die Ärmsten zu versorgen.[6]
Nun wissen wir außergewöhnlich viel über die Psyche der Mutter Teresa. Denn jahrzehntelang hat diese Frau ihr Inneres schonungslos erforscht, und vor kurzem gelangten ihre Tagebücher und vertraulichen Briefe an die Öffentlichkeit. Diese Dokumente zeigen, wie qualvoll die Friedensnobelpreisträgerin sich selbst und ihr Leben hinterfragte.[7] Lange Jahre fühlte sie, die sich doch ganz in den Dienst Jesu gestellt hatte, sich von Gott verlassen und zweifelte, ob er überhaupt existiere. Und noch misstrauischer war sie gegenüber ihren eigenen Empfindungen. »In meinem Inneren ist es eiskalt«, schrieb sie einmal. So verschaffen uns nicht einmal diese intimen Notizen Aufschluss darüber, was genau Mutter Teresa bewog – sie wusste es offenbar selbst nicht.
Es gibt allerdings Fälle, in denen man die Hoffnung auf Anerkennung und gute Gefühle fast sicher auszuschließen vermag. Sollte etwa Wesley Autrey für den Epileptiker sein Leben riskiert haben, weil er als Held gefeiert werden wollte? Schon das Tempo der Ereignisse macht dies wenig wahrscheinlich: Als er sich in Bruchteilen einer Sekunde zum Sprung auf das Gleisbett entschloss, hatte Autrey überhaupt keine Gelegenheit, sich auszumalen, wie er sich nach erfolgreicher Tat fühlen würde. Und selbst wenn er für solche Überlegungen Zeit gehabt hätte: Bei einem so hohen Risiko umzukommen ist die Aussicht, später vielleicht dem Präsidenten die Hand zu schütteln, eine schwache Motivation.
Ebenso wenig dürften Ehre, Pflichtgefühl oder Gewissen im fraglichen Moment eine Rolle gespielt haben, denn für derart komplexe Erwägungen war die Schrecksekunde erst recht zu kurz. So kann er sein Leben nur aus Beweggründen aufs Spiel gesetzt haben, die außerhalb seiner Person liegen. Autrey hat auch nach dem alltäglichen Sprachgebrauch vollkommen altruistisch gehandelt.
Doch ist die Tat eines Menschen, der nach reiflicher Überlegung beispielsweise das Risiko einging, einen verfolgten Juden aufzunehmen und vor den Häschern zu retten, weniger rühmenswert? Oder vielleicht sogar mehr?
Jeden Tag ein Dutzend gute Taten
Es führt also nicht weit, irgendwelche unklaren Motive als Maßstab für »Egoismus« und »Altruismus« heranzuziehen. Besser betrachtet man, was das jeweilige Handeln bewirkt. Jede Tat hat ihre Kosten und bringt hoffentlich Nutzen. Und an der Frage, wer die Kosten trägt und wer den Nutzen hat, offenbart sich sofort, ob sich ein Mensch egoistisch oder altruistisch verhält: Ein Egoist genießt einen Nutzen, für den andere zahlen. Extrem egoistisch benimmt sich etwa ein Dieb. Ein Altruist dagegen nimmt eigene Kosten in Kauf, um für andere Nutzen zu stiften – zum Beispiel, indem er etwas verschenkt, ohne dass eine Gegenleistung zu erwarten steht.
Diese Definition verwendet auch die Verhaltensforschung. Sie ist einfach und nützlich, weil man Kosten und Nutzen im Gegensatz zu den oftmals unbekannten Beweggründen beobachten kann. Allerdings muss ein Altruist für seine Tat nicht unbedingt zahlen. Es genügt, wenn er für einen anderen ein Risiko eingeht. Welsey Autrey kroch unter der U-Bahn, die ihn überrollt hatte, unverletzt wieder hervor. Doch da die Sache auch anders hätte ausgehen können, hat Autrey selbstlos gehandelt.
Altruismus bedeutet auch nicht, dass sich jemand für einen Bedürftigen aufopfern muss. Schon dann, wenn wir anderen zuliebe auf einen kleinen Vorteil verzichten, verhalten wir uns nach der wissenschaftlichen Definition altruistisch. Nutznießer muss auch nicht eine bestimmte Person sein. Oft handeln wir uneigennützig für das Wohl einer Gruppe oder sogar für ein abstraktes Prinzip, etwa um der Gerechtigkeit willen. Auch wenn ein Wohltäter als Mitglied einer Gruppe am gestifteten gemeinsamen Nutzen teilhat – zum Beispiel, wenn wir freiwillig Müll zum Recycling bringen –, benimmt er sich selbstlos, sofern seine Kosten (der Zeitaufwand) den eigenen Nutzen (eine um eine Winzigkeit weniger verschmutzte Umwelt) überwiegen.
Ob wir also das Geld zurückgeben, wenn sich die Kassiererin zu unseren Gunsten verzählt hat, ob wir für den Nachbarn ein Paket entgegennehmen oder ob sich ein Vater in den Elternbeirat wählen lässt: Wer so handelt, trägt die Kosten, während andere den Nutzen haben. So betrachtet steckt unser Alltag voller kleiner, manchmal auch größerer altruistischer Handlungen. »Jeden Tag eine gute Tat« soll ein Pfadfinder bekanntlich vollbringen. Tatsächlich entscheiden sich die meisten Menschen täglich Dutzende Male selbstlos.
Ist Sex die Lösung?
Wer die genannten Beispiele als banal abtut, übersieht, wie schwer sie zu erklären sind. Das geben auch die Skeptiker zu, die nicht an uneigennütziges Handeln glauben. Sie ziehen sich gerne darauf zurück, dass Kosten und Nutzen oft nicht so klar zu definieren seien. Denn bekanntlich spielen Menschen gern über Bande. Der scheinbar so auf das Wohl der Schülerschaft bedachte Vater könnte sich in Wirklichkeit beim Rektor beliebt machen wollen, um das Fortkommen seines eigenen Kindes zu fördern. »Kratz einen Altruisten und sieh einen Heuchler bluten«, spottete der Evolutionsbiologe Michael Ghiselin.[8]
Worin also bestehen Kosten und Nutzen? Leicht ist einzusehen, warum die wohl gängigste Art, beide zu messen, so oft nicht funktioniert. Bei »geben« und »nehmen« denken wir üblicherweise an Besitz oder an Zeit. Und beides rechnen wir ineinander um: Wie viel Zeit würde es kosten, uns ein bestimmtes Gut zu verschaffen? Wenn man sie um einen Gefallen bittet, kalkulieren die meisten Menschen so. Erst recht beruhen die traditionelle Wirtschaftswissenschaft und die Politik, die sich auf ökonomische Theorien beruft, auf einem rein materiellen Verständnis von Kosten und Nutzen.
Doch wer das Rätsel des Altruismus auf dieser Basis lösen will, verstrickt sich unweigerlich in Absurditäten. Ginge es allen Menschen nur darum, mit möglichst wenig Mühe reich zu werden, so wäre etwa seit der Einführung wirksamer Verhütungsmittel kein einziges Kind mehr zur Welt gekommen. Offensichtlich verschafft Babygeschrei den Eltern einen Gewinn, der sich nicht in Geld ausdrücken lässt – und für den sie bereit sind, mit aberwitzigen Arbeitszeiten im Kinderzimmer und jährlich mehreren Tausend Euro zu zahlen. Niemand würde denn auch behaupten, dass Menschen aus Altruismus eine Familie gründen.
Evolutionsbiologen haben ein sinnvolleres Maß für Kosten und Nutzen gefunden: Wie alle Organismen ist auch der Mensch darauf programmiert, die eigenen Gene weiterzugeben. So gesehen erscheint alles von Nutzen, was auf lange Sicht diesem Ziel dient. Kosten dagegen entstehen für das Individuum, wenn etwas seine Aussicht auf Nachkommenschaft mindert. Ein Egoist steigert folglich die eigenen Fortpflanzungschancen, indem er die von anderen verringert. Altruisten würden es genau umgekehrt machen.
Der evolutionäre Vorteil erklärt vieles plausibler als die rein auf das Materielle bedachte Kontoführung der Ökonomen – beispielsweise das lebhafte Interesse der Menschen am Sex, für den mancher Mann bekanntlich sogar Geld hinzulegen bereit ist. Dass Menschen um Status kämpfen, verwundert ebenfalls nicht, wenn man bedenkt, dass Prestige die Fortpflanzung nur begünstigen kann. Auf attraktive Geschlechtspartner wirken die Statussymbole schließlich so anziehend wie das Licht auf die Motten. Zwar zeugen Porschefahrer auch nicht mehr oder gesündere Kinder als andere Männer: Die evolutionäre Programmierung ist ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Sie entwickelte sich zu einer Zeit, als Status tatsächlich die Zahl der Nachkommen erhöhte. Trotzdem bestimmt sie unser Verhalten bis heute.
Das Ringen um Fortpflanzungschancen erklärt also auch auf den ersten Blick absonderliches Gebaren. Und obendrein erlaubt dieser evolutionsbiologische Ansatz einen Blick in die Zukunft: Wenn ein bestimmtes angeborenes Verhalten nämlich die Zahl der Nachkommen steigert, dann wird es sich von selbst in der nächsten Generation verbreiten. Denn Eltern mit den entsprechenden Erbanlagen werden überdurchschnittlich viele Kinder durchbringen, welche wiederum diese Gene in sich tragen.
Weil sich der Vorteil von Generation zu Generation summiert, kann er anfänglich sogar sehr klein sein. Wer auch nur um einen Deut vorteilhaftere Gene besitzt als andere, ist in einer ähnlichen Lage wie ein Sparer, der zur Zeit Christoph Kolumbus’ einen einzigen Pfennig auf eine der damals entstehenden Banken einzahlte: Selbst wenn man die Geldentwertung einrechnet, würden seine Nachkommen heute über mehr als zehn Millionen Euro verfügen – hätte es nur keine Währungsreformen gegeben. In der Evolution bringt ein genetischer Vorteil über weitaus längere Zeiträume Zinsen.
Der Untergang der edlen Krieger
Damit bietet die Evolutionstheorie den Skeptikern, die Altruismus rundweg leugnen, ihr stärkstes Argument: Wenn Selbstlosigkeit heißt, gegen das biologische Eigeninteresse zu handeln, wie kann ein solches evolutionäres Handicap dann auf Dauer existieren? Altruisten nehmen Kosten in Form geringerer Fortpflanzungschancen auf sich; der Nutzen kommt einem anderen zugute, der dafür mehr Kinder großzieht. Schon Charles Darwin, der Vater der modernen Evolutionstheorie, erkannte dieses Problem. In einer Welt des gnadenlosen Wettlaufs um Ressourcen schien ihm für Großzügigkeit wenig Platz. Darwin veranschaulichte diese bittere Einsicht am Beispiel eines Volkes von Kriegern: »Wer bereit war, sein Leben eher zu opfern, als seine Kameraden zu verraten, (…) wird oft keine Nachkommen hinterlassen, seine edle Natur zu vererben. Die tapfersten Leute, welche sich stets willig fanden, sich im Krieg an die Spitze ihrer Genossen zu stellen, (…) werden im Mittel in einer größeren Zahl umkommen als andere Leute.«[9] Nach ein paar Generationen wären die Altruisten ausgestorben.
So gesehen hätten sich Anlagen für Uneigennützigkeit niemals durchsetzen können. Das gelte nicht einmal nur für so dramatische Beispiele wie die Selbstaufopferung eines Soldaten, so die Skeptiker, da ja selbst minimale Nachteile in der Evolution zählen. Wer alte Leute pflegt, hat weniger Zeit, auf Brautschau zu gehen. Wer anonym spendet und selbst wer ein falsch abgezähltes Wechselgeld zurückgibt, dem bleiben weniger Mittel für seine Kinder. Und Wesley Autrey ließ sogar seine Töchter zurück, um sein Leben für einen Fremden aufs Spiel zu setzen.
Hiermit allerdings haben sich die Skeptiker in eine Sackgasse manövriert: Wenn man einfach die vordergründigen biologischen Vorteile einer Aktion aufrechnet, dürfte es weder Altenpflege noch Spenden und schon gar keine Menschen wie Autrey geben. Ist die Wirklichkeit verkehrt, wenn sie sich nicht der Theorie fügen will?
Trotzdem ist es bis heute enorm populär, mit Verweis auf Darwin zu behaupten, dass jeder sich jederzeit nur um das eigene Wohl kümmere. Wer rücksichtsloses oder gar unmoralisches Handeln rechtfertigen möchte, gibt diesem damit gern einen wissenschaftlichen Anstrich. Derlei Rhetorik ist so alt wie die Evolutionstheorie selbst. Der englische Philosoph Herbert Spencer, ein vom politischen Liberalismus fest überzeugter Zeitgenosse Darwins, erfand das geflügelte Wort vom »Survival of the Fittest« – dem »Überleben der Tüchtigsten«. In Büchern, die sich hunderttausendfach verkauften, versuchte Spencer als Erster, aus der Evolutionstheorie Regeln für das Zusammenleben abzuleiten. So sei es widersinnig und sogar von Übel, sich um Schwächere zu kümmern. Denn »das ganze Streben der Natur ist, sie los zu werden – die Welt von ihnen zu befreien, und Raum für die besseren zu schaffen«.[10]
Solche Vorstellungen fanden sich in Hitlers »Mein Kampf« als »Kampf ums Dasein« wieder. Aber auch in der Geschäftswelt wurde Spencer reichlich gelesen. Auf den angeblich natürlichen Egoismus berief sich John Rockefeller, der es im frühen 20. Jahrhundert zum reichsten Mann aller Zeiten brachte, indem er erst ganz Nordamerika von seiner Standard Oil Company abhängig machte und dann das Monopol mit allen Mitteln verteidigte. Ihm zufolge manifestiert sich im Wachstum der Konzerne das Überleben der Tüchtigsten – »das Wirken der Naturgesetze und das Gesetz Gottes«.[11] Und als Michael Douglas alias Spekulant Gordon Gekko im Film »Wall Street« aus dem Jahr 1987 mit seiner inzwischen legendären Parole »Gier ist gut, Gier ist richtig« den Zeitgeist der vergangenen Jahrzehnte auf den Punkt brachte, bemühte auch er die Biologie: »Gier ist der Kerngedanke der Evolution.«
Darwins Dilemma
Der häufigste Einwand gegen solch eine simple darwinistische Sichtweise lautet, dass uns Fairness und Hilfsbereitschaft wider unsere Natur anerzogen wurden. Moral sei allein eine Leistung unserer Kultur. Die meisten Sozialwissenschaftler, aber auch erstaunlich viele Evolutionsbiologen argumentieren so.[12] Doch diese These hilft nicht weiter. Denn sie erklärt keineswegs, warum Menschen im Ernstfall die Normen befolgen, die man ihnen einst beigebracht hat. Wenn ihm das einen Vorteil verspricht, sollte ein Egoist seine gute Kinderstube einfach vergessen.
Nun könnte man vermuten, dass moralische Maßstäbe uns durch einen geheimnisvollen Mechanismus in der Kindheit unauslöschlich eingebrannt wurden. Damit ist freilich das eigentliche Problem noch immer nicht gelöst: Wer Moral als Produkt der Kultur versteht, verschiebt das Rätsel nur in die Vergangenheit. Irgendetwas muss schließlich unsere Ahnen dazu gebracht haben, ihre Kinder gegen ihr biologisches Eigeninteresse ein gewisses Maß an Selbstlosigkeit zu lehren.
Und dann musste sich dieses für sie nachteilige Verhalten auch noch über Generationen hinweg erhalten. Darwins deprimierendes Argument lässt sich mit dem Hinweis auf die Kultur also nicht entkräften: Die aufopferungswilligen Krieger haben schlechtere Fortpflanzungschancen, ganz gleich, ob sie mit ihrem Edelmut auf die Welt kamen oder ob sie ihn lernten.
Charles Darwin fand keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Im Jahr 1902 führte der russische Schriftsteller, Universalgelehrte und Anarchist Fürst Pjotr Kropotkin zwar durchaus überzeugend den Nachweis, dass bei vielen Tierarten wie beim Menschen gegenseitige Hilfe die biologische Fitness einer Gruppe erhöht. Aber Darwins Einwand, dass die Hilfreichen sich innerhalb ihrer Gemeinschaft schlechter stellen als die Egoisten, konnte auch er nicht widerlegen. Nicht zuletzt weil der zum Linksradikalen gewandelte Adelige aus dem Zarenreich ein Außenseiter des traditionellen Wissenschaftsbetriebs war, wurde sein Werk bald vergessen.[13]
Darwins Nachfolger in Westeuropa und Amerika indes kamen nur auf eine plausible Lösung: Altruismus sei zwar zu erklären, aber einzig unter Verwandten. Wenn nämlich ein Vater für seine Tochter auf etwas verzichtet, dann nützt dies dem Fortbestand seiner Gene. Ist es dem Vater angeboren, für seine Familie zu sorgen, so gibt er auch die Anlage weiter. Und nicht allein in der direkten Erbfolge können sich Gene verbreiten, die Aufopferung innerhalb der Verwandtschaft begünstigen. Denn einen biologischen Vorteil hat auch die Tante, die sich für ihren Neffen einsetzt. Nach den Vererbungsregeln sind immerhin ein Viertel seiner Gene auch ihre. Wenn sie sich also gleich zweier ihrer Neffen annimmt, tut sie für die Weitergabe ihres Erbguts genauso viel, als umsorgte sie eines ihrer eigenen Kinder.
Der englische Genetiker John Haldane, auf den diese Überlegung zurückgeht, wurde einmal gefragt, ob er für seinen ertrinkenden Bruder in einen eisigen Fluss springen würde. »Nein«, antwortete er. »Aber für zwei Brüder oder acht Cousins würde ich mein Leben hergeben.«[14] Dann nämlich wäre, statistisch gesehen, die Weiterexistenz all seiner eigenen Gene gesichert.
Die Anhänger dieser Ideen nannten sich »Soziobiologen«. Ihnen gelang es etwa, den Altruismus in Ameisenstaaten zu erklären. Wie sich herausstellte, sind diese sozialen Insekten in der Regel umso eher zur Aufopferung für andere bereit, je enger sie mit diesen verwandt sind. Aus Kenntnis der Zahl der gemeinsamen Gene lässt sich sogar berechnen, wie viel eine Ameise, auch eine Biene oder Wespe, für eine Artgenossin leistet – nicht anders, als Haldane auf die Frage nach seinem Bruder schlagfertig kalkulierte. Von solchen Erfolgen beflügelt, versuchten die Soziobiologen ernsthaft das, was Haldane nur um einer guten Pointe willen tat: Sie übertrugen ihre Theorien auf den Menschen.
Bedauerlicherweise zielten sie damit an der eigentlich interessanten Frage vorbei. Eine Gruppe von Menschen ist keine Ameisenkolonie, in der alle miteinander verwandt sind. Wer unser Zusammenleben verstehen will, muss erklären, warum wir mit Personen außerhalb der Familie teilen und uns für sie einsetzen. Doch statt sich dieses Problems anzunehmen, diskutierten die Soziobiologen nur über das, das sie mit ihrem Ansatz lösen konnten: der Altruismus innerhalb der Familie.
Was Groucho Marx empfiehlt
Um sich aus der Affäre zu ziehen, postulierten die Soziobiologen, Selbstlosigkeit außerhalb der Verwandtschaft könne es nicht geben. Wo Menschen etwas für andere täten, spekulierten sie nur auf einen Handel. Und wo sie den Anschein erweckten, fair und gütig zu sein, geschehe es allenfalls zur Tarnung, um die eigenen Interessen umso gerissener zu verfolgen. Schließlich hatte schon Groucho Marx gelästert: »Das Geheimnis des Erfolgs sind Ehrlichkeit und Kulanz. Wenn du die vortäuschen kannst, hast du’s geschafft.«
Im Jahr 1976 erschien das Buch »Das egoistische Gen« und machte seinen Autor Richard Dawkins zum bekanntesten aller Soziobiologen. Mit seinem glänzend geschriebenen Text landete er nicht nur einen Bestseller, sondern prägte auch eine ganze Generation von Verhaltensforschern und Biologen. Bis heute finden sich Dawkins’ Sentenzen unter dem Markenzeichen »evolutionäre Psychologie« in Fachaufsätzen wie in populären Lebensratgebern. (Unter den Fans des Buchs war auch Jeffrey Skilling, der als Vorstandsvorsitzender des texanischen Ölkonzerns Enron für die größte Bilanzfälschung der Wirtschaftsgeschichte verantwortlich ist. Er soll »Das egoistische Gen« einmal sein Lieblingsbuch und seine Hauptinspirationsquelle genannt haben.[15])
Dawkins, der sich später als vehementer Religionskritiker hervortat, fand markige Worte für die nüchternen Formeln seiner Kollegen: »Wir sind Überlebensmaschinen – Roboter, blind programmiert zur Erhaltung der selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden.« Und weil unsere Gene »wie erfolgreiche Gangster in einer Welt intensiven Existenzkampfs überlebt« hätten, könne man weder von ihnen noch von uns Menschen Nachsicht erwarten. Denn »der Egoismus des Gens wird gewöhnlich egoistisches Verhalten des Individuums hervorrufen«.
Schon die Lebensgeschichte des geistigen Vaters der Soziobiologie lässt derart schrille Sätze fragwürdig erscheinen: John Haldane, der angeblich für seinen Bruder nicht in einen kalten Fluss steigen wollte, war in Wirklichkeit auf beeindruckende Weise um das Wohl seiner Mitmenschen besorgt. Als überzeugter Marxist diente er seiner Partei als Chefredakteur für das kommunistische Blatt Daily Worker, was seine wissenschaftliche Karriere nicht unbedingt beschleunigte. Sein Nebenjob hinderte Haldane aber nicht daran, zu einem der berühmtesten Biologen seiner Zeit und schließlich zum Mitglied der Royal Society aufzusteigen. Er unterstützte die Republikaner im spanischen Bürgerkrieg, verfasste mehr als ein Dutzend Bücher, in denen er einem großen Publikum seine Wissenschaft und seine Vorstellungen von einer besseren Gesellschaft erklärte, und sogar ein Kinderbuch. Später verließ er, entsetzt vom Terror in Stalins Reich, die kommunistische Partei, und im Jahr 1950 auch England, weil er zum Aufbau des bitterarmen, aber nun unabhängigen Indien beitragen wollte. Dort wurde er Vegetarier. Noch aus seinem Testament, in dem er seine Leiche einer medizinischen Provinzhochschule vermachte, spricht seine altruistische Haltung: »Ich habe keinen Gebrauch mehr für diesen Körper und will, dass er anderen nutze. Die Gebühren für seine Kühlung sollen der erste Posten sein, den man von meinem Nachlass abziehen möge.«[16]
Der verkannte Altruist
Das Prinzip »fressen oder gefressen werden«, den rücksichtslosen Kampf aller gegen alle mit dem Namen Charles Darwins zu verbinden, ist längst ein Gemeinplatz geworden. Doch in Wirklichkeit verzerrt das, was unter dem Namen »Darwinismus« in der Öffentlichkeit und selbst unter Wissenschaftlern kursiert, die Lehre des englischen Biologen. Schon zu seinen Lebzeiten wurde die Evolutionstheorie für alle möglichen politischen Deutungen ausgeschlachtet, worüber Darwin selbst höchst unglücklich war. Das Zitat am Beginn dieses Kapitels stammt aus einem Brief, den er 1860 an den befreundeten Geologen Charles Lyell absandte. Voller Sarkasmus beschwert sich Darwin darin, wie die Zeitung »Manchester Guardian« sein soeben erschienenes Buch »Die Entstehung der Arten« auffasste. Erst recht gerieten nach seinem Tod zentrale Gedanken Darwins in Vergessenheit, andere nahm man nicht ernst.
Oft als Prediger des Egoismus dargestellt, war Charles Darwin in Wirklichkeit ein höchst mitfühlender Mensch. Als er während seiner Weltreise mit der HMS Beagle einmal durch die Straßen einer brasilianischen Küstenstadt flanierte, hörte er ein gequältes Stöhnen. Vermutlich wurde irgendwo hinter den Mauern ein Sklave gefoltert, und er, Darwin, war hilflos und konnte nicht einmal protestieren. Diese Erinnerung beschäftigte ihn noch viele Jahre später. Immer, wenn er irgendwo in der Ferne einen Schrei hörte, suchte sie ihn heim.[17] »Ich will nie wieder ein Land, in dem Sklaverei herrscht, besuchen«, schrieb er später über diese Reise.[18]
Im südenglischen Dorf Down, wo er nach seiner Rückkehr von 1842 bis zu seinem Tod lebte, gründete Darwin eine »Friendly Society«, die sich um verarmte Landarbeiter kümmerte. Nicht einmal Tiere konnte Darwin leiden sehen, berichtete sein Sohn: »Eines Tages kam er von einem Spaziergang blass und ermattet nach Hause, weil er gesehen hatte, wie ein Pferd misshandelt wurde.«[19] Und als ihm zu Ohren kam, dass ein Bauer ein paar Schafe hatte verhungern lassen, sammelte er Beweismaterial und brachte die Sache vor den Friedensrichter, womit er sich im Dorf unbeliebt machte.
Wie konnte Darwin seine Selbstlosigkeit mit seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen vereinbaren? Er war ein viel zu gründlicher Forscher und besaß zu viel Lebenserfahrung, um sein Gedankenspiel über das Aussterben der edlen Krieger für bare Münze zu nehmen. Schon während der Weltreise mit der HMS Beagle notierte er Ereignisse, die mit einer rein egoistischen Natur des Menschen kaum vereinbar sind.
Auf Feuerland traf der damals 21-jährige Darwin Menschen, die so fremdartig erschienen, wie sie ihm bis dahin nie begegnet waren. So beschrieb er den »ersten Anblick eines Wilden«: »Es war ein nackter Feuerländer, sein langes Haar wehte umher, sein Gesicht war mit Erde beschmiert. Auf einem Felsen stehend stieß er Töne aus und machte Gestikulationen, gegen welche die Laute der domestizierten Tiere weit verständlicher sind.«[20] Die Bewohner Feuerlands litten oft Hunger und führten Krieg um die knappen Ressourcen. (Darwin legte Gemüsegärten an, um ihre Ernährungslage wenigstens etwas zu bessern.)
Und doch besaßen diese Menschen, die nach Darwins erstem Eindruck eher Tieren ähnelten, einen Gerechtigkeitssinn. Das erkannte der junge Forscher, als sich im Februar 1834 eine kleine Flotte Kanus der HMS Beagle näherte: »Ich gab einem Mann einen großen Nagel, ein äußerst wertvolles Geschenk, ohne die Geste eines Gegengeschenkes zu machen; er jedoch hob sofort zwei Fische auf und reichte sie mir an der Spitze seines Speeres herauf.« Auch untereinander waren die Feuerländer bereit zu verzichten: »Fiel ein Geschenk, das einem Kanu galt, in die Nähe eines anderen, so wurde es stets dem richtigen Besitzer übergeben.«
Mit einem Kampf aller gegen alle hatte das Verhalten der Indianer wenig zu tun. Es schien auch kaum vorstellbar, dass sie sich ihr Gerechtigkeitsempfinden von einer anderen Kultur abgesehen hatten. Denn die Feuerländer lebten völlig isoliert auf ihrer Insel. Woher also kam ihre Moral?
Diese Frage muss Darwin ein halbes Leben lang verfolgt haben, denn erst vier Jahrzehnte nach seiner Reise mit der Beagle kam er darauf zurück. In seinem Alterswerk »Die Abstammung des Menschen« widmete er ihr mehrere Kapitel. Darin stellte er die kühne Behauptung auf, dass sich geistige Fähigkeiten und Vorlieben im Lauf der Evolution ebenso entwickelten wie der Körperbau. So sei vielen Tieren ein »sozialer Instinkt« angeboren, der sie Geselligkeit suchen und Sympathie für ihren Artgenossen fühlen lasse. Bei einem geistig so hoch entwickelten Wesen wie dem Menschen führe dieser Instinkt »unausweichlich« zu einem angeborenen Sinn für Gerechtigkeit und Moral.[21] Eben deshalb sei altruistisches Verhalten im Laufe der Generationen nicht verschwunden: Die angeborene Neigung zum Miteinander zwinge den Menschen, zeitweilig selbstlos zu sein.