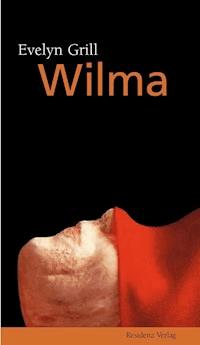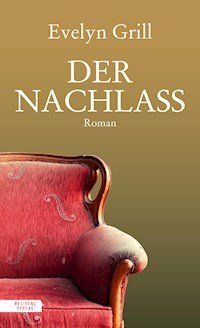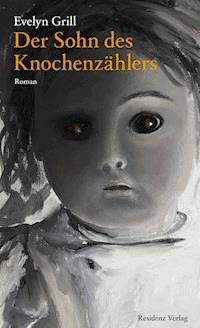
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Titus' Mutter verschwindet auf mysteriöse Weise. War es Flucht, ein Unfall oder gar Mord? Acht Monate ist es her, dass Titus' Mutter spurlos verschwand. Als Italienerin war sie im Dorf eine Fremde geblieben. Der Vater hatte sie von einer Forschungsreise mitgebracht. Nun kursieren Gerüchte, Vermutungen: Hat der See sie verschluckt, ist sie mit einem Liebhaber durchgebrannt oder wurde sie Opfer eines Verbrechens? Titus ist schon seit Jahren ein Außenseiter. Durch ein Brandmalgezeichnet, meidet er die Menschen. Das Angebot, dem neuen Totengräber zu assistieren und bei ihm zu wohnen, erscheint ihm als Möglichkeit, der Enge des Vaterhauses zu entkommen. Doch der Totengräber ist kein Unbekannter. Evelyn Grill führt ihre Leser in eine düstere Welt voller Geheimnisse. Fesselnd bis zum großen Knall!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Evelyn Grill
Der Sohn
des Knochenzählers
Roman
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2013 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4330-8
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1605-0
Inhalt
Weitere Bücher der Autorin
Es ist ein Irrtum zu meinen, daß die Toten fortgehen.Keiner geht weniger fort als die Toten.Viel eher die Lebendigen.
Ernst Wiechert
Er hatte die Frau noch nie gesehen. Sie kam aus Wien, das war zu hören. Sie nannte ihn gleich beim Vornamen. Sie sei eine Berufskollegin, behauptete sein Vater, die an seinem Archäologischen Institut zwei Tage lang irgendwas, wahrscheinlich Knochen oder Schädel, untersuchen wollte. Deshalb würde sie auch bei ihnen übernachten. Er interessierte sich nicht für die berufliche Tätigkeit seines Vaters, auch seine Mutter hatte sich kaum dafür interessiert, soweit er sich erinnerte, bald hatte der Vater auch aufgehört ihnen davon zu erzählen. Aber jeder im Dorf kannte das sogenannte Institut, das den weltberühmten keltischen Grabfunden angeschlossen war; sein Vater leitete es, zwangsläufig, denn er war der einzige Wissenschaftler. Er hatte ein halbes Dutzend Gehilfen, meist Männer, die durch die Schließung des Salzbergwerks ihre Arbeit verloren hatten und die unter seiner Überwachung nach keltischen Gräbern suchten. Man nannte ihn im Dorf den Knochenzähler. In dem Institut, es bestand aus einem langgestreckten Holzbau, wollte die Frau aus Wien etwas zu tun haben. Sie sollte also bei ihnen übernachten. Wo, bitte, wollte der Vater sie unterbringen? fragte er sich. Es gab nur den feuchten Kellerraum mit einem Bett und einem stinkenden, braun emaillierten Ölofen darin, außerdem eine Menge Bücher mit vergilbten Lederrücken auf braunen Regalen, und Schachteln, die sich auf dem Boden stapelten. Er bedauerte jetzt, daß er sich bisher nie für den Inhalt der Kartons interessiert hatte. Ein Fenster gab es nicht, nur einen schmalen Lichtschacht.
Die Person ließ sich tatsächlich im Keller unterbringen. Sie mußte ziemlich arm sein, ihr Brotberuf brachte ihr offensichtlich zu wenig ein, um sich für ein, zwei Nächte in einem der beiden Gasthöfe, die es im Dorf gab, ein Zimmer zu nehmen. Das Bett stammte aus der Haushaltsauflösung seiner Großeltern väterlicherseits, genauer gesagt, es war das Bett seiner Großmutter, das der Vater nicht zum Sperrmüll geben wollte. Er war der Meinung, man würde es irgendwann noch gebrauchen können, das Bett und die Matratze und das Federbett und das Kissen. Seine Mutter war nicht dieser Meinung gewesen, denn sie hielt es für modrig und mottenbesiedelt, aber sie setzte sich nicht durch, vielleicht wollte sie sich nicht durchsetzen, denn der Kellerraum interessierte sie wenig.
Die Person lächelte ihn an und sagte: Titus, ein schöner Name und faselte gleich etwas vom römischen Kaiser Titus und Vespasian und der Zerstörung Jerusalems, an der angeblich dieser Titus beteiligt gewesen sei, und dann fragte sie ihn, immer noch diese Art Kampflächeln im Gesicht, ob er schon einmal in Rom gewesen sei – natürlich war er schon in Rom gewesen vor Jahren mit seiner Schule –, aber er antwortete nicht. Trotzdem fuhr sie fort, wenn er einmal nach Rom käme, sollte er sich den Titusbogen anschauen. Da wandte er sich ab, sodaß sie seine linke Gesichtshälfte sehen konnte. Sofort war sie still und, er glaubte zu hören, daß sie förmlich nach Luft schnappte. Bevor er sich davonmachen konnte, rief ihm der Vater noch zu, daß er heute und morgen nicht zu Hause essen werde. Als er die Holztreppen in sein Zimmer hinaufpolterte, merkte er, daß er am ganzen Leib zitterte. Gott sei Dank hatte er noch drei Flaschen Bier im Kasten, die er nach und nach leerte. Das beruhigte ihn und stellte ihn wieder auf die Füße. Aus dem Hamsterkäfig kein Laut, kein Rascheln. Er trat mit dem Fuß dagegen, ganz leicht, die beiden Hamster hasteten aus ihren Schlupflöchern und rannten wie von Sinnen herum, bis sie sich wieder verkrochen. Er überlegte, ob er noch einmal einen Fußtritt anbringen sollte, ließ es aber, es begann ihn zu langweilen.
Zwei Tage lang sah er seinen Vater nicht mehr. Auch von der Person, die im Keller genächtigt haben mußte, bemerkte er keine Spuren, das heißt, der Mantel, ein verblichen-grüner Trenchcoat, so ein Burberry-Fake, dessen Taschen er natürlich durchsucht, jedoch nichts außer Papiertaschentüchern und Halspastillen entdeckt hatte, war weg. Er hatte an den Ärmeln geschnuppert, sie rochen nach irgendwelchen Kräutern. Vielleicht Minze oder Salbei. Er konnte Gerüche schlecht unterscheiden. Allerdings fand er die Tür zum Kellerraum erstmals verschlossen. Er wußte gar nicht, daß sich der Raum verschließen ließ. Er hatte noch nie einen Schlüssel an der Tür gesehen. Das machte ihn mißtrauisch, und er begann wieder zu zittern, der kalte Schweiß brach ihm aus. Er preßte sein Auge ans Schlüsselloch, doch er sah nichts, nur Finsternis. Klar. Hätte er sich sparen können.
Obwohl er nicht damit rechnete, die Frau je wiederzusehen, konnte er sie nicht vergessen. Sie trieb sich in seinen Gehirngängen herum wie eine Laborratte in einem Labyrinth. Je länger er sie nicht sah, desto deutlicher wurde die Erinnerung an sie. Sie wollte einfach nicht verblassen. Ihr schmales, ja hageres, strenges Gesicht und ihre tiefliegenden Augen in einer undefinierbaren Farbe, die ihn aufmerksam gemustert hatten – was hatte sie bloß an ihm zu interessieren? – dieser Blick, er hatte etwas Inquisitorisches, verfolgte ihn. Das strenge Lächeln auf schmalen Lippen erinnerte ihn an seinen Musiklehrer, dessen Mundgeruch, den er ihm beim Singen der alpenländischen Lieder zwischen seinen schwarzen Zähnen hindurch ins Gesicht blies, abgestoßen hatte. Auf modische Kleidung legte die Frau anscheinend wenig Wert. Der braune Stoff, Filz oder Loden, so was Kompaktes, lag wie ein Panzer um ihre Figur, und die Schuhe waren breit, entenlatschig. Er mußte zugeben, daß sie für das hiesige Klima und die alpine Umgebung nicht unpassend gekleidet war.
Sein Freund Connie wunderte sich, daß er immer wieder von ihr sprach. Er traf ihn neulich wie gewöhnlich am See in seinem Bootshaus, wo er die Planken seines Boots mit schwarzer Farbe anstrich. Niemand im Ort strich sein Boot mit schwarzer Farbe an. Aber Connie war einmal in Venedig gewesen und fasziniert von den Gondeln. Er sagte, die Fuhren, wie die Boote hier hießen, hätten große Ähnlichkeit mit den Gondeln. Auch die hiesigen Boote wurden nur von einer Person, die am Heck stand, gerudert.
Titus erzählte dem Freund, während der an den noch ungestrichenen Planken herumschmirgelte, von den Händen der Fremden. Grobe, zupackende Finger und breite, kurzgeschnittene Fingernägel. Er dachte an die Madonnenfinger seiner Mutter, und ihn ekelte vor den Händen der Frau. Laß doch gut sein, warum sprichst du immer von ihr, sagte Connie, hast du nichts anderes zu denken? Dann lud er ihn zu einem Zehn-Kilometer-Lauf ein. Den hatten sie früher regelmäßig gemeinsam unternommen, aber seit seine Mutter verschwunden war, nicht mehr. Connie wollte wie gewöhnlich durch den Sternwald laufen und auf die Briger Höhe und in der Gamsbergwarte einkehren. Die habe seit kurzem eine neue Wirtin gepachtet, die sei schwer in Ordnung. Da gehe immer was ab, lockte er. Touristinnen, vor allem Deutsche! Titus sagte wegwerfend: Kenn ich. Was sollte er mit Weibern, vor ihm würde jede die Flucht ergreifen. Hat er alles schon erlebt, danke, kein Bedarf mehr. Er trank sein Bier lieber allein und beobachtete seine Hamster, wie sie in ihren Käfigen herumkrochen und sich gelegentlich zu paaren versuchten, obwohl beide Männchen waren, oder mit gefletschten Zähnen aufeinander losgingen, weil beide Männchen waren.
Wegen der Hamster war sein Vater anfangs der Meinung gewesen, daß er Tiere liebe und es daher nahe läge, daß er Biologie oder Zoologie studieren sollte. Einmal schlug er ihm auch das Studium der Tiermedizin vor. Ein Mißverständnis, das ihm zu mühsam war, auszuräumen. Das Verhältnis zu seinem Vater bestand seit jeher nur aus Mißverständnissen. Daran war er gewöhnt. Ein Verständnis seines Vaters für seine Interessen, ja, schon die Kenntnis davon, hätte ihn irritiert. Davor brauchte er keine Angst zu haben. Jedenfalls wollte ihn der Vater aus dem Haus haben. Mein Vater will mich offenbar in eine Universitätsstadt abschieben. Nach Innsbruck oder nach Salzburg, sagte er zu Connie. Immerhin war er einundzwanzig, hatte die Matura in der Tasche und sollte mit seinem Leben etwas anfangen. Studieren oder eine Lehre beginnen, sagte er, verlangt mein Vater. Das mit der Lehre meinte sein Vater nicht ernst, er versuchte ihm damit zu drohen, denn natürlich sollte er als der Sohn eines Akademikers nicht als Lehrling bei einem Installateur schuften. Lehre oder Studium, jedenfalls Ausbildung, das hätte deine Mutter auch gewollt, behauptete sein Vater und glaubte, damit ein schlagendes Argument in der Tasche zu haben, sagte er zu Connie. Der zuckte nur mit den Schultern: Nicht mein Problem.
Er begann sein Werkzeug wegzuräumen. Titus fand es kühn, daß der Vater zu wissen vorgab, was seine Mutter von ihm erwartet hätte. Doch Connie hatte sich schon von ihm ab- und seiner Arbeit zugewandt. Das Boot würde das einzige schwarze Boot im Ort sein, überhaupt das einzige mit Ölfarbe angestrichene. Es würde auffallen. Aber Titus hatte heute dafür keinen Sinn. Er dachte an seine Mutter, die nie etwas von ihm erwartet hatte, sie war glücklich gewesen, daß es ihn gab, einzig sein Dasein war ihr wichtig gewesen, mein kleiner Prinz nannte sie ihn, später nur: mein Prinz oder mein Herzensprinz. Womit auch immer er sich beschäftigte, fand ihren Beifall. Doch wenige Monate vor ihrem Verschwinden wollte auch sie ihn zu einem Studium überreden. Sie dachte allerdings an Medizin, als Arzt habe er die besten Berufsaussichten, als Arzt würde seine entstellte Gesichtshälfte hingenommen werden, zumal er einen makellosen Körper und schöne Hände besäße; außerdem sei die rechte Seite seines Gesichts unversehrt. Wegen seiner schönen Hände hatte sie auch einmal versucht, ihm den Beruf des Physiotherapeuten schmackhaft zu machen. Wenn es mich einmal nicht mehr gibt, hatte sie in letzter Zeit, von der er nicht wußte, daß es die letzte Zeit war, immer wieder gesagt. Mein Vater verlangt, daß ich mich darum kümmern soll, mir selbst meinen Unterhalt zu verdienen. Er lebe auch nicht ewig, sagte er zu Connie, der endlich den Blick von seinem Boot abwandte, sich aufrichtete und ihn ansah. Ich verstehe deinen Alten, antwortete er, denk doch einmal drüber nach. So kannst du doch nicht weitermachen. Okay, sagte Titus, schaute auf seine Schuhspitzen, drehte sich um und ging. He, rief ihm Connie nach, was ist los?
Sein Vater nervte ihn vor allem mit seinen Ermahnungen bei den Mahlzeiten, die er kochte, weshalb er seit kurzem nicht mehr mit ihm gemeinsam aß, genauer gesagt seit dem Tag, an dem seine Mutter verschwunden war. Er ließ ihn allein am Tisch sitzen und zog sich mit seinem Teller in sein Zimmer zurück, in dem er sich einschloß. Außerdem störte ihn das Ticken der antiken Pendeluhr mit den römischen Ziffern in der Stube und ihr lautes Schlagen, das er bis in sein Zimmer unter dem Dach hörte und das ihn schier wahnsinnig machte. Auch seine Hamster schien das Ticken zu stören, denn sie wurden aggressiv. Immer wenn es tickte, wußte er, daß sein Vater im Haus war. Dann lief er die Treppen hinunter und hielt das Messingpendel an. Anfangs sagte sein Vater: Laß das! Doch kaum war er oben, hörte er erneut das Ticken. Dann lief er wieder hinunter und stoppte das Pendel. Das ging so eine Weile, bis der Vater aufgab und die Uhr nur noch anstellte, wenn er glaubte, sein Sohn sei nicht im Haus. Als die Mutter noch nicht verschwunden war, durfte die Uhr nie angestellt werden, und der Vater wagte nicht, gegen sie zu rebellieren. Auf diese Weise war immer Ruhe im Haus.
Er hat seiner Cousine Lea von der Frau erzählt, die der Vater im Keller übernachten ließ. Lea war die einzige in der Familie, mit der er Kontakt hatte. Leider konnte er sie nur telefonisch erreichen, und auch das war schwierig, denn sie war beruflich sehr eingespannt. Sie war angeblich Kinderkrankenschwester im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Er rief sie häufig an, wenn er ein Problem hatte mit seinem Vater oder mit sich selbst. Aber das stimmte nicht ganz, er hatte nur ein Problem mit seiner Mutter, das Problem mit der Mutter bestand darin, daß sie verschwunden war. Jedenfalls unauffindbar. Vielleicht ist sie tot, sagte Lea. Wie viele sterben mit achtundvierzig und noch früher? Ich sehe auch Babys sterben. Aber seine Mutter hatte ausgesehen wie ein junges Mädchen, sie hatte ausgesehen wie seine Schwester oder wie seine Frau. Sein Vater hatte nie wie ihr Mann gewirkt, eher wie ein älterer Onkel. Das hing nicht mit dem Altersunterschied zusammen, der war gar nicht groß, aber sein Vater hatte etwas Onkelhaftes, wenn er mit ihr zusammen war. Wenn er nicht mit ihr zusammen war, sah er nach gar nichts aus.
Titus hat Lea von der Person erzählt. Er hoffte, sie würde ihn beruhigen. Aber sie stieß nur einen Pfiff aus, kurz und scharf. Was heißt das, fragte er sie nervös, warum pfeifst du? Beruhige dich, ich pfeife immer, wenn ich eine Neuigkeit erfahre. Wird sie wiederkommen? Das weiß ich nicht, sagte er ungeduldig. Hat der Alte sie dir vorgestellt? Er versuchte es, sagte er trotzig, aber ich ließ mich nicht vorstellen. Nicht klug von dir, sagte Lea. Wie schaut sie aus? Nach gar nichts, graue Maus, struppige Haare, sagte er, sie hatte etwas am Institut zu tun, kommt aus Wien. Lea dachte nach, dann sagte sie: Wenn sie nach einem Monat wiederkommt und wieder im Keller übernachtet, dann ruf mich an. Mach ich, sagte er. Und war beunruhigt, weil Lea demnach nicht ausschloß, daß die Person wiederkommen könnte.
Als er neun Jahre alt war, kam Lea als Dreizehnjährige zu ihnen, nachdem ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Man stellte für sie ein Bett – bis im Haus ein anderer Platz gefunden wäre, wie seine Mutter betonte – in sein Zimmer. Der Raum war groß genug, und die Betten stellte man möglichst weit voneinander weg. Außerdem bekam Lea einen kleinen Schreibtisch und einen stählernes Gestell, auf dem sie ihre Kleider aufhängte. Die Mutter brachte einen Vorhang vor Leas Bett an, sodaß es beinahe aussah wie ein Himmelbett. In der ersten Zeit überzeugte sich die Mutter durch überraschende Besuche, sobald Schlafenszeit war, ob der Vorhang vor Leas Bett auch immer zugezogen war. Als er zehn Jahre alt war, kroch er häufig zu Lea ins Bett, und beide schmiegten sich eng aneinander. Lea hatte wasserblaue Augen und lange blonde Haare, die sie zu einem Roßschwanz band oder zu einem Zopf flocht.
Sie kam, als sie achtzehn Jahre wurde, in ein weit entferntes Internat, um dort Matura zu machen. Titus traf diese Entscheidung völlig unvorbereitet und er protestierte bei seiner Mutter. Sie erklärte ihm, es ginge nicht länger an, daß Lea mit ihm, einem heranwachsenden schönen Jüngling, in einem Zimmer schlafe. Er vermißte sie sehr und schrieb ihr lange Briefe, die Lea ab und zu knapp beantwortete. Titus versuchte sich manchmal vorzustellen, wie sie jetzt aussähe, er hatte sie einmal um ein Foto gebeten, doch sie hatte nie eines geschickt. Ein Jahr nach Leas Auszug hatte Titus den Unfall, der sein Leben von Grund auf veränderte.
Die Mutter konnte keine Kinder mehr bekommen. Er blieb ihr Einziger, er war ihr ein und alles. Du hättest deine Mutter beinahe das Leben gekostet, sagte der Vater. Er hörte so etwas wie einen Vorwurf in seiner Stimme. Das empörte ihn, denn konnte er etwas dafür, daß er eine sogenannte schwere Geburt war? Vielleicht hatte auch er unter dieser Entbindung gelitten, die angeblich über zwölf Stunden gegangen war und bei der die Mutter beinahe verblutet wäre. Stundenlang im Geburtskanal zu stecken war sicher für ihn auch kein Vergnügen gewesen und konnte an seiner Psyche nicht spurlos vorübergegangen sein. Seine Dermatitis und sein Asthma waren vielleicht Ausdruck eines Geburtstraumas.