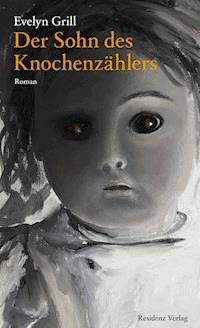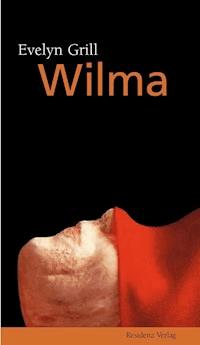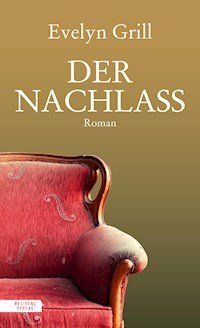Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
GRANDIOSE BEZIEHUNGSSTUDIEN Ein Kurzurlaub in Paris - das klingt für Isa nach Kultur und Shopping! Ihr Mann, der Wissenschaftler, hat aber ganz andere Pläne: Er wittert die Chance auf eine wissenschaftliche Sensation - und seine Frau soll ihn dabei unterstützen. Mit ihrem weiblichen Charme soll sie ihm dabei helfen, die letzten Geheimnisse jenes berühmten Dichters zu ergründen, dessen Leben und Werk er seit Jahren erforscht. Widerwillig spielt Isa mit - und spinnt dabei heimlich einen perfiden Racheplan ... GRANDIOSE BEZIEHUNGSSTUDIEN Evelyn Grill ist eine MEISTERHAFTE BEOBACHTERIN VON ZWISCHENMENSCHLICHEN BEZIEHUNGEN. Mit unbestechlich scharfem Blick und staubtrockenem Witz zeigt sie in ihren Erzählungen, was unter der scheinbar ruhigen Oberfläche von Ehen und Familien schwelt und brodelt: die kleinen Bosheiten und versteckten Revanchen, die nie ausgesprochenen und dennoch unübersehbaren Familienkonflikte, die klägliche Suche nach dem kleinen Beziehungsglück. Evelyn Grill erzählt ihre Geschichten KLUGER IRONIE UND SCHWARZEM HUMOR, mit viel Sympathie für die kleinen Absurditäten des ganz gewöhnlichen Lebens und für die Schrullen ihrer Figuren. So werden diese Szenen von den Kampfschauplätzen des Familien- und Ehelebens zu einem GROSSEN, ERHELLENDEN VERGNÜGEN. "Das Böse liegt Evelyn Grill. Und sie braucht nicht viel Raum, um es zu entfalten." FALTER, Kirstin Breitenfellner
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Evelyn Grill
Fünf Witwen
Erzählungen
Fünf Witwen
Mit seinem Entschluss hatte er seine Ängste befriedet.
Wenn er überlegte, warum er es nicht bedauerte, dass er diese Entscheidung nicht früher getroffen hatte, die alle seine Probleme gelöst hätte vor der Zeit, die ihn der Demütigungen, der haareraufenden Verzweiflungen entzogen hätte, die seinen Kreuzweg abgekürzt hätte, wenn er sich das überlegte, dann kam er zu dem Schluss und die Erkenntnis machte ihn heiter, dass er diese seine Entscheidung zur Tat ohne diesen Kreuzweg, diesen Irrweg, diese höhlenartigen Bittgänge und Unterwürfigkeiten nicht gefunden hätte. Der Entschluss wärmte ihn, lockerte und entspannte ihn. Die Realität war eine andere geworden, eine überschaubare und sinnfällige. Und eine zielführende. Nichts mehr würde ihn fortan ablenken, er hatte alle Ausgänge als Irrwege oder als ungangbar erkannt, er hatte sie alle abgetastet, er hatte, sich im Zentrum befindend, sich der sternförmig angeordneten Ausgänge bedient, sie auf ihre Tauglichkeit und Zielführung geprüft. Sie waren es alle nicht, weder tauglich noch zielführend; alle Wege, die er, getrieben von dem Bedürfnis nach Hilfe, unternommen hatte, waren untauglich und irreführend gewesen. Erst als er das erkannt hatte, hatte er sich zu dem Entschluss durchgerungen oder vielmehr, der Entschluss war in ihm aufgebrochen und mit einem Mal hatte er dessen Sinnhaftigkeit und Schönheit erkannt. Wohl dem, dachte er seit damals immer wieder bei sich, der am Ende seines Lebens solches erkennen darf, wohl dem, der sich bis zu seinem Tode an der Schönheit der Folgerichtigkeit erfreuen kann. Er spürte in sich eine sentimentale Versöhnungsbereitschaft. Er sah das Leben und alle seine Erscheinungsformen, mit denen er noch konfrontiert war in diesen Tagen, als etwas Belächelnswertes an. Er fand sein Lächeln wieder.
Seine Umgebung erleichterte dieses Lächeln, das sie natürlich missdeutete. Die Frauen in seinem Wohnhaus, in dem er in einer mietzinsgeschützten Küche-Zimmer-Wohnung logierte, kamen ihm mit gelüfteten Gesichtern entgegen, sie sprachen ihn wieder an, sie scheuten nicht mehr vor ihm zurück, denn es war ihnen durch dieses Lächeln offenbar geworden, er hatte sich wieder erfangen, er würde ihnen die Peinlichkeit einer Hilfesuche fortan ersparen, er hatte eine Lösung gefunden, hatte die eine oder andere Anregung von ihnen vielleicht sogar aufgegriffen, hatte endlich ein Einsehen gezeigt, hatte die Unbilligkeit seiner Bitten erkannt, hatte also nicht zuletzt zu seinem Wohle in die Rolle des stillen Mitbewohners zurückgefunden, die ein partnerschaftliches Nebeneinander- bzw. Übereinanderwohnen zuließ.
Er fühlte sich wohl, aber wenn er daran dachte, dass nun, da er sich so offensichtlich wieder wohl und anspruchslos befand, es dennoch an seiner Tür klopfen könnte und eine der fünf Witwen, die in diesem Hause wohnten, nachfragen könnte, ob er etwas brauche, wie sie es früher manchmal getan hatten, vielleicht weil sie einen Blick auf die verwüsteten Augen seiner armen Frau zu machen gierten, und womit sie immer nur kleine Einkäufe, Lebensmittelbesorgungen anboten, wenn er also daran dachte, es könnte auch heute noch eine von den erleichterten und freigesprochenen Gewissensträgerinnen anklopfen und sich danach erkundigen, dann krachte in ihm ein unbotmäßiges Wüten. Es kam niemand. Er war doch immer noch ein Risiko, ein Restrisiko, das sie scheuten, möglicherweise. Andererseits konnte er das Motiv ihres früheren Eintretens, wie er vermutete, den Anblick der Wahnsinnigen, nicht mehr bieten. Man hatte sie vor drei Tagen abgeholt. Und seine Tochter war gestern gegangen, nein, er hatte sie aus dem Haus getrieben. Er dachte mit Genugtuung daran. Seine letzte selbstlose Tat vor der allerletzten, die noch ausstand. Er hatte sie mit ihrem Verlobten weggeschickt.
Er saß in der Küche auf einem der vier Stühle beim Tisch. Er saß seiner letzten Nacht entgegen. Eine Mahlzeit zu sich zu nehmen hätte er als profan empfunden. Nur Wasser schien seiner Situation adäquat. Er trank aus dem vor ihm stehenden Glas trotzig gegen seinen Durst an, gegen seine Kehle, die sich mit rasselndem Sand abgab. Auch die Wohnung schickte sich an, sich von ihm zu verabschieden, nein, eigentlich sich von ihm loszusagen. Er hatte mit Anstrengung Ordnung in sie gebracht. Er hatte die Schubladen geschlossen, die offen geblieben waren, nachdem seine Tochter ihre Habseligkeiten aus ihnen entfernt hatte, sie mitgenommen hatte in ein neues Leben, in das er sie geschleudert hatte. Morgen würde sie über ihn hinwegfliegen. Er hatte richtig gehandelt. Er würde weiterhin richtig handeln. Die Schubladen hatte er geschlossen. Offene Schubladen, klaffende Schranktüren waren Zeichen von Verzweiflung und Hoffnung. Er wollte seine Wohnung mit den Möbeln zurücklassen als ein Niemandsland, aller Geister entledigt, von jedermann bewohnbar. Er war der Wohnung entfremdet.
Das Rauschen des Flusses, der unterhalb seines Fensters vorbeifloss, beharrlich und ahnungslos, erfüllte ihn mit Genugtuung. Der Fluss hatte viele seiner Gedanken mit sich genommen, nachdem er sie in die Wellen geworfen hatte. Manche waren auf ihnen fortgehüpft, blinkend und um die Wette gischtend, oder waren von den Strudeln zu Tode gewürgt worden, hatten sich in ihnen verirrt und waren zugrunde gegangen. Auch der Fluss würde sterben. Die Vermessungen waren abgeschlossen. Ihm würde man das Wasser abgraben. Ein Rinnsal würde an seiner Wohnung vorbeisudeln, ein fauliges Wässerchen. Den Fluss würde man kerkern zu einem See, dienstbar machen, kontrollierbar und berechenbar. Seiner Sprache würde man ihn berauben und seines Geschlechts, ein triefäugiger Kastrat würde sich auf der noch bewaldeten Fläche erstrecken. Ja, es war die rechte Zeit, auch für ihn, zu gehen.
Er saß auf dem Stuhl, und obwohl ihm das Sitzen unbequem wurde, schob er das Aufstehen und das Zubettgehen noch von sich. Er merkte, dass ihm vor den leeren Ehebetten, der glattgestrichenen Decke darüber graute. Er spielte in Gedanken so lange mit dem Bild der sorgfältig geglätteten Bettdecke über den Ehebetten, bis er merkte, dass es harmlos und zuletzt wertfrei wurde. Wertfreiheit war ein Zauberwort, dessen er sich angesichts unvorhergesehener Irritationen bediente.
Nun konnte er zu Bett gehen.
Ich habe mich heute im Altersheim umgesehen. Ich habe erkannt, dass ich es ohne Hilfe nicht schaffe. Ich kann ohne Hilfe nicht leben. Meine Frau haben sie wieder abgeholt. Als sie die Pflegergestalten sah, wurde sie ruhig und friedlich. Vielleicht hätte man ihr keine Injektion geben müssen. Andererseits wusste man nie, wann ihr Gemütszustand umschlagen und die Raserei wieder aus ihr brechen würde.
Vorher war sie mit Geschimpf und Fäusten auf mich losgegangen. Ganz unerwartet. Wie hochgepeitscht ist sie aus dem Bett, in dem sie den ganzen Tag verdämmert hatte, auf mich zugerannt. Sie hat mich zu Boden geworfen. Ich bin zwischen der Küchenkredenz und dem Küchentisch gelegen. Ich erinnere mich noch an die Stuhlbeine, die sich neben meinem Kopf reckten wie Baugerüste. Ich bin ein Krüppel. Ich kann mich nicht erheben, wenn ich mit dem Rücken auf dem Boden zu liegen komme. Nicht ohne Hilfe jedenfalls. Ich habe entzündete Kniegelenke, ein steifes Kreuz, die dies verhindern. Als ich lag und sah, dass meine Situation aussichtslos war, wurde ich ruhig und teilnahmslos. Meine arme Frau raste, spuckte Schimpf und Schande über mich und verrichtete schließlich ihre Notdurft auf den Fußboden, in unmittelbarer Nähe meines Kopfes. Sie presste mir ihre Ausscheidungen an den Kopf, lechzte mit ihren Blicken nach meiner Reaktion, aber ich hatte mich schon ergeben.
Vera Daschill, unsere Nachbarin, hatte die Gendarmerie gerufen. Wahrscheinlich muss ich ihr noch heute dafür dankbar sein. Erst als die Tür aufgebrochen war und die Gendarmen wie Baumstämme in der Öffnung erschienen, schämte ich mich auf eine gnadenlose Weise.
Man hat sie wieder in die Anstalt gebracht. Meine Tochter hat den Kot vom Fußboden geputzt, ohne ein Wort. Ich saß verkrochen in meiner Scham wie in einer schleimigen Höhle und hoffte und flehte und wartete auf ein Wort von ihr, die stumm und mit vor Ekel verkrampften Lippen den Unrat beseitigte und nicht einmal ihre Blicke in meine Nähe ließ.
Man hörte viel Gutes über das Altersheim, das sie nun Seniorenheim nannten. Nie hatte sich jemand darüber beklagt. Ich ging durch das hohe Glasportal in die Halle, deren Wände man mit Mosaiken geschmückt hatte. Alte Menschen in dekorativer Gebrechlichkeit strebten mit schwärmerischen Gesten Sonnenstrahlen zu, die nach den letzten aussahen. Auf modernen Stühlen und Bänken saßen die Alten und wirkten stilbrüchig in diesem Glanz aus Chrom und falschem Marmor. Die Einrichtung schien einem Fernsehstudio entnommen. Die Alten sahen aus, als hätten sie sich hierher verirrt und wären selbst über ihren Irrtum peinlich berührt, ihre Gesichter waren vollgeschrieben mit Bitten um Nichtbemerken, um Außerachtlassen, sogar um Vergebung ihres Irrtums. Man hatte sie in ihrer Hilflosigkeit, ihrer erdigen Hässlichkeit ans Licht gezerrt und sah nun ihren Jammer und ihre Ausgesetztheit, ihre Endlichkeit vergrößert und in Zeitlupe. Die meisten drehten ihm ihre Köpfe auf ihren raschelnden Hälsen zu.
Ich fühlte mich jünger als ich war mit meinen 52 Jahren, obwohl ich mich nur mühsam fortbewegen konnte mit meinen steifen, entzündeten Gelenken. Auch die Schwester, die auf mich zukam und die in meinem Alter sein mochte, hielt mich für einen Besucher und nicht für einen Bewerber. Ich klärte sie auf und auch über die Art der Unterstützung, die ich brauchte. Ich brauche Hilfe beim Anziehen, ich kann keine Schuhbänder binden, in keine Socken schlüpfen, ich kann mich nicht bücken, kurzum: Ich brauche jemanden, der mir die Hosen hochzieht, ich brauche Hilfe beim Waschen, allein komme ich nicht mehr zurecht.
Sie verstand sogleich und versicherte, dass mein Anliegen ein kleines wäre, hier würde allen geholfen. Sie unterstrich ihre Bemerkungen mit einigen Bewegungen ihrer harten Hände. Sofort spürte ich die kantigen Fingerkuppen auf meinem Unterleib, das Herauf- und Hinunterziehen meiner Hose mit diesen rohen Fingern.
Ich ging dann mit der Schwester durch den Bau, ich sah alles, die hellen Zimmer und die Balkons und den Komfort. Den alten Trakt zeigte sie mir auf Verlangen. Im neuen Trakt glaubte man, wenn man die Alten sitzen sah, man müsste sie riechen, ihren Greisengeruch, aber man roch nichts, alles war sauber und geruchlos. Im alten Trakt stank es, bevor man die Leute sah. Dorthin kamen die Aufsässigen, die Senilen, die Boshaften, die, mit denen man nicht mehr reden konnte, mit denen man auch nicht mehr rechnete, die, die es ohnehin nicht mehr mitkriegten, wo sie waren, die die schöne Umgebung in dem neuen Trakt nicht mehr zu schätzen wussten. Hier zwischen abbröckelndem Mauerwerk, mit den unverputzten Leitungsrohren, in der Düsternis und dem Gestank hatten die Alten auch wieder etwas von ihrer Würde gewonnen. Hier wirkten sie nicht mehr so peinlich wie im Neubau.
Ich sah die Alten in Finsternis, Gestank und Schmutz, und sie passten hierher, sie gehörten hierher, hier war alles stilecht. Aber ich gehörte da nirgends hin.
Wieder auf der Straße sah ich an dem Glaspalast hoch. In den Fenstern lagen als weißgraue Fensterpolster mit raupenähnlicher Bewegung die Köpfe der Insassen. Im alten Trakt sah man nichts.
Dieser Weg war für mich ungangbar. Ich hatte mir einen anderen zu überlegen. Mir schien, dass die Zeit drängte, obwohl meine Tochter bei mir geblieben war und noch bleiben würde. Solange ich sie brauchte. Der Verlobte drängte, er wollte heiraten, wollte sie mitnehmen nach Amerika, er wollte sich dort niederlassen, vielleicht in Kanada, als irgendwas. Ich interessierte mich nicht für Einzelheiten. Ich wusste nur, dass ich ihr den Weg freigeben musste.
Er hatte das Haus voller Witwen. Richtig gesagt, in dem Haus, in dem er lebte, wohnten fünf Witwen. Fünf Witwen und er. Fünf noch recht rüstige Witwen. Eine würde vielleicht darunter sein. Sie brauchte es ja nicht umsonst zu tun. Sie bekäme ordentlich bezahlt. Sie hätte es nicht zu bereuen.
Er war ein anspruchsloser Mensch. Vor nicht allzu langer Zeit waren die Witwen noch sehr freundlich zu ihm gewesen, bevor sich in den letzten Jahren seine Gelenke schmerzhaft versteift hatten. Als einziger Mann im Haus hatte er ihre Blicke bemerkt, die sie ihm damals zugeworfen hatten, die er jedoch nie gewagt hatte aufzufangen. Allerdings hatte er damals auch noch selbst die Hosen aus- und anziehen können.
Anfangs hatte er versucht, gegen die damals noch »Stimmungen« genannten Mutlosigkeiten seiner Frau anzugehen. Ihren verwunschenen Blick meinte er, entkerkern zu können. Es schien alles harmlos. Auch tauchte sie immer wieder auf aus den Grüften der Seele und war und blieb unter ihnen und sorgte für die Familie.
Wenn es über sie kam, an Tagen des Nebels, an schwelgerischen Sommertagen, vielleicht trug der Mond die Schuld daran, zerschlug sich ihr Gesicht wie unter einem Fausthieb und erstarrte in seinen entmutigten Muskeln. Sie erhob sich nicht mehr aus dem Bett, Blicke trafen ihn fremd und kalt, sie vergaß ihre hausfraulichen Pflichten. Es erreichte sie kein Drohen und kein Bitten. Manchmal lag ihr Gesicht in Zuckungen und Tränen, die sie nie abwischte.
Manchmal erhob sie sich und wütete gegen ihn und alles. Dann war es Zeit, den Arzt zu holen. Der injizierte und sie dämmerte wieder dahin. Wenn sich die manischen Anfälle häuften, holte man sie ab. In der Anstalt wurde sie behandelt, und nach mehreren Wochen kam sie wieder nach Hause. Wie es schien, vollkommen gesund und angepasst.
Wie lange es gut ging, konnte man nicht voraussehen. Sobald sie begann, sich gegen das tägliche Einkaufen zu wehren, sich nicht mehr unter Menschen wagte, musste er sich wieder auf eine Phase der Zerrüttung einstellen. Die Genesungsabstände verkürzten sich, in immer knapperen zeitlichen Intervallen brach die Krankheit über sie herein. Er hoffte lange. Der Arzt erzählte ihm vom Klimakterium der Frau, das manchmal zu solchen Erscheinungen führte, nach dessen Abklingen könnten auch die Gemütsverwirrungen bei seiner Frau wieder verschwinden. Er war bereit zu warten und Geduld zu haben. Was blieb ihm auch anderes übrig. Er hatte einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es war, wenn man ohne Hilfe dastand. Er musste sich auf seine Tochter verlassen. Er trug schwer an dieser Abhängigkeit. Und quälte sein Kind mit Arroganz und Hohn. Sie weinte, ihm zu Füßen kniend, seine Schuhbänder lösend, in zorniger Demut, er sah ihre zerpressten Lippen und begann sich zu hassen, auf eine unerhörte, blutrünstige Art begann er sich zu hassen.
Dann fing er an, seine nächsten Schritte zu planen. Er ging planmäßig vor. Er notierte die Namen der Witwen, die im Haus wohnten, und setzte sich eine Frist, innerhalb der er beginnen musste, eine nach der anderen abzufragen, um Hilfe vorstellig zu werden, an Mitgefühl und Wohlwollen zu appellieren. Er überlegte, ob er bei der ihm am aussichtsreichsten erscheinenden, hilfeversprechendsten Witwe oder bei der hoffnungslosesten, am wenigsten erfolgversprechenden beginnen sollte. Begänne er bei ersterer, würde sich seine Verzweiflung im Falle einer Ablehnung rasch steigern. Wenn schon am Anfang seine aussichtsreichste Option versagte, dann hätte er es schwer, einen Grund für Zuversicht zu finden. Möglich, dass er mutlos würde und die letzten Befragungen nicht mehr durchzuführen wagte aus Angst vor weiteren Misserfolgen oder einfach, weil ihm die Stöße der unvermuteten Hoffnungslosigkeit die konsequente Auslotung seines Falles verwehrten.
Deshalb begann er umgekehrt. Also mit denjenigen Witwen, von denen er kaum Hilfe erwartete, die er jedoch unbedingt und der Vollständigkeit halber befragen musste, damit keine mit feuchten Augen an seinem Grab stehen und sagen konnte: wäre er doch nur, hätte er doch nur … Seine Situation musste auch für den Außenstehenden eine absolut hoffnungslose darstellen. Nur so würde sein Abgang ein sauberer und gerechtfertigter und keinesfalls zu betrauernder sein.
Er schrieb die Namen der Witwen auf ein Blatt Papier, zog senkrechte Striche zu Rubriken. Er musste den einzelnen Personen aufgrund eines zu findenden Schlüssels Plus- und Minuspunkte geben. Die Witwe mit den meisten Punkten würde er zuletzt besuchen, die mit den wenigsten zuerst. Je jünger die Witwe, umso mehr Punkte, je gebrechlicher, umso weniger. Sollte er auch das Aussehen bedenken, das Gemüt, den Stand, die Bildung? Er beschloss, all dies zu berücksichtigen. Auch eventuell vorhandene Nachkommen, die Ansprüche an Mutter bzw. Großmutter stellten, mussten in seinen Schlüssel einfließen. Er brütete die halbe Nacht über seiner Aufstellung und ging zu Bett mit dem Gefühl, als hätte er allein durch das Erstellen dieser Liste seine Übersicht wiedergewonnen. Auch das Gefühl, sein Leben wieder in die eigenen Hände nehmen und damit nach Willkür verfahren zu können, gaukelte in ihm bis hinein in seine Träume.
Die Witwe mit den wenigsten Punkten war Johanna Schönleitner. Sie war 72 Jahre alt, wohnte direkt über ihm in dem einstöckigen Haus. Sie hatte einen gewaltigen glockenförmigen Körper, den sie täglich einmal mit rasselndem Atem zum Gemischtwarenhändler schaukelte. Dass sie schlecht roch, hatte ihr besonders viele Minuspunkte eingetragen.
Er besuchte sie am nächsten Nachmittag. Auf ihr Herein öffnete er die Tür. Er liebte Aktivitäten und Entscheidungen. Durch dieses erste Herein war, darüber war er sich mit Genugtuung klar, etwas in Gang gesetzt worden. Und er hatte es in Gang gesetzt. Er war die treibende Kraft. Doch schon in der Küche der Johanna Schönleitner musste er diese Kraft aus der Hand geben, schon war es vorbei mit seiner Illusion, er war doch abhängig, er war doch der Bittsteller.
Sie tat erfreut, ließ ihn am Tisch Platz nehmen, an dem sie selbst saß mit einem Packen Illustrierter, die sie noch ohne Brille zu lesen imstande war. Er wollte keine Zeit verlieren, zumal ihm vor den fetten Händen und dem unklaren Altweibergeruch angst und bange wurde. Er fragte, ob sie bereit wäre, und in der Lage, ihm täglich beim Aus- und Ankleiden behilflich zu sein, seine Schuhe nicht nur zu putzen, sie ihm auch an- und auszuziehen, und ihm auch besonders, denn er könne sich nicht bücken, sie wisse ja, beim Hosenhochziehen zu helfen.
Johanna Schönleitner quetschte sich von ihrem Kanapee hoch und am Tisch vorbei. Sie stellte sich vor ihn hin mit ihrem Glockenkörper, versuchte, er dachte zuerst an Turnübungen, eine Art Rumpfbeugen und bewies ihm damit die Anstrengung, die es ihr bedeutete, ihre Arme zu Boden zu bringen. Bläulich rang sie sich wieder hoch, schwenkte ihre Beine, mit den über die Hausschuhe quellenden Knöcheln wie Glockenschwengel vor seinen Augen, und seufzte: alles Wasser. Das stand ihr auch schon in den Augen, weil sie doch, wie er sehe, selbst bald auf Hilfe angewiesen sein würde.
Auf seiner Liste strich er mit unterlegtem Lineal den Namen Johanna Schönleitner durch.
Als zweite war Wetti Kunitzberger an der Reihe, 65 Jahre, verwitwet nach einem Justizwachebeamten, Schneiderin von Beruf, den sie noch immer, heimlich, ausübte. Wegen dieses noch immer ausgeübten Berufes machte er sich wenig Hoffnung, und er hatte Wetti Kunitzberger deswegen schon an die die zweite Stelle gesetzt, obwohl sie anhanglos und noch recht rüstig war.
Als er sie aufsuchte, am späten Nachmittag, saß sie unter dem scharfen Lichtkegel ihrer heruntergezogenen Lampe wie in einer Strahleninsel, behängt mit den Utensilien ihres Schneiderhandwerks, zwischen den Lippen Glaskopfstecknadeln. Ihre Finger nestelten daran, zogen sie einzeln wie Würmer aus dem Mund und steckten sie in das Nadelpolster. Sie war umgeben von Stoff und Fäden, einem Gewirr von ihn scheu machenden Wichtigkeiten. Wetti Kunitzberger schob die Lampe hoch, und so gelangte das ganze Zimmer zu einer angenehmen Helligkeit. Sie schob ihm einen Stuhl an den Tisch, fegte mit einer Handbewegung Stoffreste und Fäden zur Seite, um ihm Platz für seine Arme zu schaffen. Sie tat freundlich, nahm jedoch ihren Fingerhut nicht vom Finger, von dem er seinen Blick nur mit Mühe wenden konnte, von diesem Finger aus Eisen, diesem geharnischten Finger, den er sich deformiert und schwitzend vorstellen musste.
Er trug sein Anliegen vor. Wetti Kunitzberger machte es sich nicht leicht. Sie war keinesfalls bar eines Mitgefühls. Ihr Fingerhutfinger schabte auf dem vor ihr liegenden Stoffrest. Auf den Handrücken wanden und schlängelten Blutgefäße. Die leben gefährlich, dachte er, bei den vielen herumliegenden Nadeln. Was, wenn man in eine der prallen verwurzelten Adern stäche?
Wetti Kunitzberger bot ihm an, für ihn Knöpfe anzunähen. Reißverschlüsse einzusetzen, sogar Hemdkragen würde sie für ihn liebend gerne erneuern, aber sie könne sich unmöglich auf so etwas, wie er es verlange bzw. nötig habe, einlassen. Sie habe den ganzen Tag zu tun, ihre Kundschaft warte. Sie wies auf die Schneiderpuppe im Hintergrund, auf der ein fransiges Halbfabrikat hing. Diese Kostümjacke müsse bis morgen zur Anprobe fertig sein, und so gehe es das ganze Jahr.
Er verstand und war noch immer nicht entmutigt, ja sogar erleichtert, dass er den Kampf mit den Nadeln und Fäden verloren hatte, dass er den Fingerhutfinger nicht würde auf seiner Haut spüren müssen. Er strich den zweiten Namen durch.
Als dritte kam Aloisia Schatz, die Witwe eines Weichenstellers, 63 Jahre alt, an die Reihe. In diesem Haus wusste man alles voneinander. In diesem Haus wohnten keine von weither Zugereisten, manche, so Aloisia Schatz, waren sogar in diesem Haus zur Welt gekommen. Sie hatte die Wohnung von ihrer Mutter übernommen, die sie gepflegt hatte bis zu deren Tod. Man traf sich täglich mehrmals beim Wasserholen an der Bassena oder auf dem Weg vom oder zum Abort. Man verlor einander nicht aus den Augen, man bemerkte jede Veränderung am anderen sofort. Einer solchen misstraute man stets, wenn sie unverhofft auf einen zukam.
Er traf Aloisia Schatz an der Bassena. Obwohl sie ihren Blick geradewegs auf den Wasserstrahl gerichtet hielt, versäumte sie es doch, den Hahn rechtzeitig zuzudrehen. Erst als ihr das Wasser auf die Brust schwappte, riss sie den Eimer vom Rost, drehte den Hahn zu und lachte, den Herangekommenen bemerkend, überlaut. Sie setzte den Eimer ab und wand ihre Schürze in die Bassena. Ihre Worte gurgelten in den Abfluss. Sie hatten nicht abweisend geklungen, er fühlte sich aufgefordert, näher zu treten, auch das Haar, das wie ein Wergstrang über die rechte Schulter fiel und gegen das er sonst einen kämpferischen Abscheu verspürte, verlor durch das Glucksen an Widerwärtigkeit.
Er folgte ihr in die Küche, deren Tür sie kichernd hinter ihm schloss. Sie stieß den Wasserkübel hinter eine Stellage und schob einen Vorhang vor, ihn ließ sie auf einem Stuhl Platz nehmen. Er wandte den Blick vom Herd, am liebsten hätte er seine Augen in seine Hosentaschen gesteckt, weil ihn die Speisereste, das schmutzige Geschirr, die leeren und halbvollen Flaschen, die wie ein Bataillon entschlossen schienen, gegen ihn anzurücken, entmutigten.