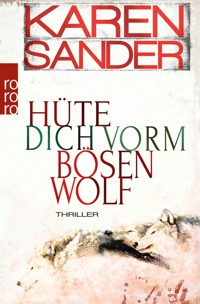9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Engelhardt & Krieger ermitteln
- Sprache: Deutsch
Die Lösung im Fall Lilli Sternberg führt Engelhardt & Krieger tief in die Vergangenheit. Drei Wochen sind seit dem Verschwinden von Lilli Sternberg vergangen. Die junge Frau ist höchstwahrscheinlich tot. Längst sind auch keine verschlüsselten Botschaften mehr eingetroffen. Die Ermittler Engelhardt und Krieger graben noch tiefer in Lillis Leben und stoßen auf eine neue Spur: Plötzlich sieht es so aus, als könnte Lillis Verschwinden mit dem Tod ihrer Mutter zusammenhängen, deren Leiche vor achtzehn Jahren genau dort gefunden wurde, wo die Polizei Lillis Blut entdeckte. Wurde damals der Falsche für das Verbrechen verurteilt? Läuft der wahre Täter noch frei herum und hat nun auch die Tochter umgebracht? Das furiose Finale der Ostsee-Trilogie von Karen Sander!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Karen Sander
Der Strand: Vergessen
Thriller
Über dieses Buch
Eine junge Frau wird vermisst.
Seit fast drei Wochen.
Die Spur führt zu einem alten Fall …
Die 19-jährige Lilli Sternberg ist höchstwahrscheinlich tot. Längst gibt es keine Lebenszeichen mehr von ihr, keine per Handy verschickten Nachrichten. Doch Hauptkommissar Tom Engelhardt und LKA-Kryptologin Mascha Krieger wollen sich nicht damit abfinden, dass Lillis Schicksal ungeklärt bleibt.
Gemeinsam mit ihrem Team stoßen sie auf eine Spur: Dort, wo die Polizei Blut von Lilli gefunden hat, wurde zwei Jahrzehnte zuvor die Leiche ihrer Mutter Cornelia entdeckt. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst und ist inzwischen tot. Wurde damals der Falsche verurteilt? Ist der wahre Mörder noch immer auf freiem Fuß und hat nun auch die Tochter umgebracht?
Tom Engelhardt & Mascha Krieger ermitteln.
Vita
Karen Sander arbeitete als Übersetzerin und unterrichtete an der Universität, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie hat über die britische Thriller-Autorin Val McDermid promoviert. Ihre Bücher wurden in verschiedene Sprachen übersetzt und haben eine Gesamtauflage von über einer halben Million Exemplaren. Mit ihrem Mann lebt sie die Hälfte des Jahres in ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Die übrige Zeit reist sie durch die Welt und schreibt darüber in ihrem Blog.
Mehr unter: writearoundtheworld.de
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung golero/iStock; Shutterstock
ISBN 978-3-644-01207-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zuvor Donnerstag, 5. September
Sellnitz auf dem Darß, nachmittags
Es ist der gleiche Wald wie immer, der Wald, den sie seit ihrer Kindheit kennt, doch heute ist er ihr fremd. Die knorrigen Eichen wirken abweisend, die schmalen Wasserrinnen zwischen den herbstgelben Blättern des Adlerfarns schimmern bedrohlich schwarz. Lilli tritt fest in die Pedale, als könnte sie so die Beklemmung vertreiben. Es ist warm, fast sommerlich. Trotzdem fröstelt sie. Sie ist nervös. Und sie hat Angst. Immer wieder blickt sie über die Schulter. Bestimmt ist der Wald voller Geräusche. Ben hat ihr beschrieben, wie raschelndes Laub klingt und der Gesang der Feldlerche. Sie haben den verschiedenen Lauten Farben zugeordnet. Das Rauschen des Meeres ist türkis, das Singen des Windes in den Kronen der Kiefern himmelblau. Den Schritten eines Verfolgers haben sie nie eine Farbe gegeben. Es würde auch nicht helfen gegen das Unbehagen. Lillis Kehle ist so eng, dass ihr das Atmen schwerfällt. Aber sie ist fest entschlossen. Was immer es kostet, sie wird es durchziehen.
«Alles wird gut gehen», sagt sie sich. «In ein paar Tagen ist es vorbei, du darfst jetzt nicht schwach werden.»
Ben hat sie eben noch einmal gefragt, ob sie sich auch ganz sicher ist. Ja, das ist sie. Sie hat lange genug gezögert, sich mit Halbwahrheiten vertrösten lassen.
«Du musst das nicht tun.» Ben hat sie eindringlich angesehen.
«Aber ich will. Du hilfst mir doch? Oder hast du es dir anders überlegt?» Langsam ließ sie ihre Hand nach der letzten Gebärde von der Schläfe sinken.
Er wischte mit dem Zeigefinger von links nach rechts. «Nein, natürlich nicht.»
Sie weiß, dass sie sich auf Ben blind verlassen kann. Er ist ihr Halt, ihr Fels in der Brandung. Ohne Ben würde sie das nicht durchstehen. Kein Mensch ist ihr so nah. Das war schon immer so, sie kann sich nicht an eine Zeit erinnern, in der er nicht in ihrem Leben war. Sören versteht das nicht, er hält Ben für einen Nebenbuhler. So ein Unsinn.
Ben ist ihr Bruder, ihr Blutsbruder.
Sie erinnert sich noch genau an den Tag, als sie mit dem rostigen Taschenmesser in ihre Arme geritzt haben, um ihr Blut zu mischen, oben auf dem Heuboden in der Scheune. Sie muss damals sechs gewesen sein und Ben acht. Untrennbar verbunden, bis in alle Ewigkeit. Wenn man genau hinsieht, erkennt man noch immer die helle dünne Narbe auf der Innenseite ihres Unterarms.
Bens Vater hat da noch gelebt. Er hat sie erwischt und ein Riesentheater gemacht. Hat Ben zusammengeschissen, weil er das arme kleine Mädchen zu so einem gefährlichen Unsinn angestiftet habe. Der faule Nichtsnutz, der bloß dumme Ideen im Kopf habe.
Lilli hat protestiert, es war ihre Idee gewesen, nicht Bens. Sie war die Wildere von ihnen beiden gewesen, zumindest damals. Aber es hat nichts geholfen, Bens Vater konnte keine Gebärden, er hat sie nicht einmal wahrgenommen.
Ben bekam eine Woche Hausarrest, und zudem wahrscheinlich eine ordentliche Tracht Prügel, auch wenn er das ihr gegenüber nie zugegeben hat. Doch Lilli kannte seinen Vater. Er war ein Mann mit festen Grundsätzen, und einer davon lautete, dass man Worten auch Taten folgen lassen musste, gerade bei ungezogenen Jungen.
Bens Mutter war damals schon tot. Wenn Lilli sich anstrengt, kann sie das Bild einer freundlichen, warmherzigen Frau heraufbeschwören, die in einem abgedunkelten Zimmer im Bett liegt, schwer gezeichnet von der Krankheit, die sie langsam tötet, aber dennoch tapfer ihrem Sohn Mut zuspricht. Manchmal ist sie traurig, dass sie eine Erinnerung an Bens Mutter hat, aber keine einzige an ihre eigene.
Der Abzweig kommt in Sicht. Geradeaus geht es zum Strand, wo sie mit Fabienne verabredet ist. Lilli zwingt sich, nicht an ihre Freundin zu denken. Nicht an Fabienne, nicht an ihre Großeltern. Nicht an Sören. Sie will niemandem wehtun, vor allem nicht den Menschen, die sie liebt. Aber sie muss das jetzt tun, es gibt keinen anderen Weg.
Sie fährt nicht weiter zum Strand, sondern biegt links ab Richtung Parkplatz Krielmoor. Zum Glück ist auch hier niemand zu sehen, der Wald liegt verlassen da. Die Eichen sind Kiefern und weiß leuchtenden Birken gewichen. Entlang des Forstwegs verläuft ein Graben, auf der schlammbraunen Wasseroberfläche schwimmt gelbes Laub.
In Gedanken geht Lilli noch einmal den Plan durch, überlegt zum hundertsten Mal, ob Ben und sie auch nichts vergessen haben. Am liebsten würde sie den Rucksack von den Schultern nehmen und nachschauen, ob sie wirklich alles dabeihat. Die beiden Handys, ihr Notizheft, das Foto, den Brief. Sie hat ihn vorhin noch einmal gelesen, und sie ist sicher, dass jedes Wort der Wahrheit entspricht.
Lilli ist so in Gedanken, dass sie die Person, die plötzlich hinter einem Weißdornstrauch hervor auf den Weg tritt, erst bemerkt, als sie nur noch wenige Meter entfernt ist. Erschrocken macht sie eine Vollbremsung, die Reifen blockieren, das Rad schlingert, kippt fast um. Als Lilli endlich sicher steht, hämmert ihr Herz wild in der Brust.
17 Tage später Sonntag, 22. September
Sellnitz auf dem Darß, am Nachmittag
Mascha Krieger packte den Stapel Papiere zurück in den Karton und klappte ihn zu.
«Nichts?», fragte Tom Engelhardt, der neben ihr im Schneidersitz auf dem Boden saß, den Rücken gegen das Regal mit den verstaubten Akten gelehnt.
«Nichts, das uns weiterhilft.» Mascha schob den Karton weg. «Rechnungen, Versicherungsunterlagen, Kontoauszüge.»
Seit zwei Stunden durchsuchten sie im Aktenraum des kleinen Sellnitzer Polizeireviers die Kartons mit den Unterlagen, die vor knapp zwei Wochen auf dem Anwesen von Benjamin Reichert beschlagnahmt worden waren. Zu dem Zeitpunkt war er ein Tatverdächtiger im Fall Lilli Sternberg gewesen. Das war er zwar immer noch, doch inzwischen war er selbst tot, erschlagen in seinem Atelier.
Einen Teil der Kartons hatten sie bereits vor Tagen durchgesehen, aber mehr als die Hälfte war versehentlich in einem anderen Revier gelandet, was erst gestern aufgefallen war. Die Unterlagen waren ihre letzte Hoffnung, doch noch herauszufinden, was mit Lilli geschehen war. Und wer ihren Kumpel Ben ermordet hatte.
Und ob es eine Verbindung zu Marina Sarow gab, der Frau, die knapp hundert Kilometer von Sellnitz entfernt aus der Psychiatrie weggelaufen war und Schüsse auf Tom und den Bauunternehmer Henning Mauritz abgegeben hatte. Sie befand sich noch immer auf der Flucht. Die Suche nach ihr hatten jedoch seit gestern die Zielfahnder des LKA übernommen, die darauf spezialisiert und viel besser ausgerüstet waren. Lediglich Björn André, der Kollege aus Teterow, der von Anfang an in die Suche nach Sarow involviert gewesen war, war noch mit von der Partie.
Am Vorabend hatten Mascha und Tom beschlossen, ihren freien Sonntag zu opfern, um die fehlenden Kartons durchzusehen. Ihre letzte Chance, bevor Mascha zurück nach Schwerin musste, wo sie als Kryptologin im LKA arbeitete. Toms fünfjährige Tochter Romy hatten sie mit aufs Revier genommen. Sie saß mit dem Streifenkollegen Bernd Kruse, der von allen nur Senior genannt wurde, an der Theke im Empfangsbereich und bastelte mit seiner Hilfe eine Polizeimarke, weil sie jetzt ja mit zum Team gehörte. Senior hatte vier Enkel und reichlich Routine im Basteln, und er freute sich über die Abwechslung beim langweiligen Sonntagsdienst.
Obwohl es in den vergangenen zweieinhalb Wochen in dem kleinen Ort an der Ostseeküste drei ungeklärte Todesfälle und zwei Mordanschläge gegeben hatte, war an diesem Sonntag nichts auf dem Revier los. Die Welle der Anrufe von Zeugen und Presse war verebbt und hatte der üblichen verschlafenen Ruhe Platz gemacht.
«Vielleicht war es eine Schnapsidee», sagte Tom und gähnte.
Mascha war noch nicht bereit aufzugeben. Sie hätte das Gefühl, Lilli im Stich zu lassen, wenn sie jetzt kapitulierte. Sie war sich darüber im Klaren, dass die Verbundenheit, die sie mit der jungen Frau empfand, unprofessionell war, aber das war ihr egal. Mascha war als Kind adoptiert worden und glaubte seit Kurzem sich zu erinnern, dass ihre leibliche Mutter mit ihr über die Ostsee in den Westen fliehen wollte.
Lilli Sternbergs Mutter Cornelia war ebenfalls adoptiert worden. Wäre sie nicht ein halbes Jahr nach Lillis Geburt ermordet worden, wäre sie heute nur wenige Jahre älter als Mascha. Mascha hatte den Verdacht, dass Lilli wie sie selbst nach ihren Wurzeln gesucht hatte, bevor sie verschwand, und dass ihr Verschwinden damit zusammenhing. Allerdings gab es für diese Theorie bislang nur ein paar vage Indizien.
«Einen Karton haben wir noch.» Mascha stand auf, hob ihn vom Tisch und stellte ihn vor Tom ab.
Sie entzifferte, was die Kollegen auf den Deckel geschrieben hatten: Schreibtisch, Wohnzimmer. Das klang vielversprechend. Der Inhalt der anderen Kartons war aus Schränken und Regalen genommen worden. Im Schreibtisch hatte Ben Reichert vermutlich die aktuellen Unterlagen aufbewahrt.
Sie öffnete den Deckel, nahm einen Stapel heraus und reichte ihn Tom.
«Du gibst wohl nie Ruhe», murmelte er.
«So gut solltest du mich inzwischen kennen.»
Sie ergriff einen weiteren Packen Unterlagen und nahm wieder auf dem Boden Platz. Unter ein paar losen Blättern ertastete sie eine Dokumentenmappe. Rasch legte sie die Papiere weg und öffnete die Mappe. Die meisten Dokumente hatten mit dem Haus zu tun, einem ehemaligen Bauernhof, den Benjamin Reichert von seinen Eltern geerbt und in dessen Scheune er sein Atelier eingerichtet hatte.
Mascha blätterte weiter und stockte. Mein Testament stand auf dem Blatt. Neugierig überflog sie den kurzen Text und pfiff durch die Zähne.
«Ben hat Lilli seinen gesamten Besitz vermacht.»
Tom hob den Kopf. «Interessant.»
«Finde ich auch.»
«Damit hätte sie ein Mordmotiv – wenn sie noch leben würde.»
«Du glaubst doch nicht …» Mascha beendete den Satz nicht, weil Tom heftig den Kopf schüttelte.
«Aber es wirft neue Fragen auf», sagte er nachdenklich. «Was geschieht nun mit seinem Besitz? Da ist ja nicht nur der Hof. Ich habe mal nachgeschaut, seine Skulpturen sind teilweise hohe fünfstellige Summen wert. Nach seinem Tod eher noch mehr.»
Mascha betrachtete das Blatt in ihren Händen. «Wenn Lilli nicht mehr lebt – wovon wir wohl ausgehen müssen –, ist die entscheidende Frage vermutlich, ob sie schon tot war, als Ben starb. Falls nicht, hätte sie ihn vor ihrem eigenen Tod beerbt, und alles würde an ihre nächsten Angehörigen gehen, also ihre Großeltern. Aber wenn sich nicht herausfinden lässt, wer zuerst starb, weil ihre Leiche nie gefunden wird …»
«Spannendes Problem.» Tom seufzte. «Nur leider verrät uns das alles nicht, was mit ihr geschehen ist. Wir tappen noch genauso im Dunkeln wie am Abend ihres Verschwindens.»
Mascha wollte protestieren, schließlich hatten sie inzwischen einiges herausgefunden über die Umstände von Lillis Verschwinden. Sie hatten ihr Fahrrad aus einem Tümpel im Wald geborgen, wussten, mit wem sie zuletzt gesprochen hatte, dass Daten von ihrem Laptop gelöscht wurden, dass sie ein zweites Handy besaß und dass ein Foto von ihrer Mutter fehlte, das über ihrem Schreibtisch gehangen hatte.
Doch als Mascha den Mund öffnete, klopfte es, und Senior steckte den Kopf zur Tür herein.
«Alles in Ordnung mit Romy?», fragte Tom.
«Bestens. Habe sie gerade zur Kriminaloberkommissarin befördert.» Senior grinste, wurde aber sofort wieder ernst. «Die Leitstelle hat sich gemeldet. Suizidversuch auf der Meiningenbrücke.»
Tom runzelte die Stirn. «Die haben doch bestimmt schon Kollegen hingeschickt.»
«Klar, aber sie dachten, es könnte dich interessieren. Es handelt sich um eine Frau. Mit einem Gewehr.»
Am selben Tag
Ich presse das Taschentuch auf die Wunde. Ich habe mich an einem hervorstehenden Draht verletzt, als ich um die Absperrung herumgeklettert bin, die Unbefugten den Zutritt auf die stillgelegte Brücke verwehrt. Angeblich wird sie demnächst saniert, denn die Bahnlinie, die den Darß mit dem Festland verbindet, soll wiedereröffnet werden, doch noch ist davon nichts zu erkennen. Statt der Schienen, die schon nach dem Krieg zurückgebaut wurden, gibt es staubigen Asphalt, über den kein Fahrzeug mehr gerollt ist, seit nebenan die neue zweispurige Brücke gebaut wurde.
Ich blicke nervös zur Seite. In regelmäßigen Abständen fahren Autos vorbei, doch bisher hat keins das Tempo gedrosselt oder gar angehalten. Anscheinend sind die Insassen zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um sich für eine Frau zu interessieren, die auf einer gesperrten alten Eisenbahnbrücke herumturnt.
Ich presse die Zähne zusammen. Mein rechter Unterarm brennt wie Feuer, das Blut hat eine Spur aus Tropfen auf die Fahrbahn gemalt und einen großen klebrigen Fleck auf meinem Kleid hinterlassen.
Egal. Bald werde ich noch viel stärker bluten, aber wohl nichts mehr davon merken. Eine Patrone ist noch im Magazin. Ich hoffe, dass ich trotz der Schmerzen im Arm genug Kraft haben werde, den Abzug zu ziehen. Und genug Mut.
Ich lade die Waffe durch und lehne sie vorsichtig an das hüfthohe Geländer. Die massiven grauen Stahlstreben mit den rostigen Nieten liegen zum Glück so weit auseinander, dass es nicht schwierig ist, auf die Außenseite der Brücke zu gelangen. Allerdings ist hier kaum Platz für die Füße. Ich positioniere mich mit dem Rücken zum Abgrund, presse meinen Bauch an das Metall und umschlinge mit dem unverletzten Arm den Handlauf. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, das Gewehr aufzuheben und auf mich selbst zu richten, ohne dass es ins Wasser fällt.
Ich verschnaufe einen Augenblick und denke an das Telefonat gestern mit der Journalistin. Diese Dayita Kumar scheint nett zu sein. Ich hätte ihr gern die Wahrheit erzählt, über Henning Mauritz, über Walter Sternberg, über das, was damals geschah. Das Verbrechen, das nie gesühnt wurde. Aber woher soll ich wissen, ob ich der Frau trauen kann?
Wenn die Journalistin mich verrät, wenn sie die Polizei informiert, stellt man mich wegen der Schüsse auf Mauritz und den Polizisten vor Gericht. Ich würde ins Gefängnis kommen, womöglich sogar in die geschlossene Psychiatrie. Ich würde den Rest meines Lebens in Gefangenschaft verbringen. Schließlich habe ich bewiesen, wie labil ich bin. Und wie gefährlich.
Aber sie werden mich nicht kriegen. Nicht lebend jedenfalls. Ich werde alldem ein Ende bereiten. Endgültig diesmal. Allerdings nicht, ohne Henning Mauritz ein Abschiedsgeschenk zu hinterlassen. Wenn ich mir gleich den Lauf des Gewehrs in den Mund schiebe und abdrücke, wird der Rückstoß mich in den Meiningenstrom katapultieren. Falls das Projektil mich nicht sofort tötet, werde ich innerhalb kürzester Zeit bewusstlos werden und ertrinken. Und mit etwas Glück wird die Strömung mich aufs offene Meer treiben und meine Leiche nie gefunden werden.
Henning Mauritz wird nie wissen, ob ich wirklich tot bin. Auch wenn ich offiziell für tot erklärt werde, kann er nicht ganz sicher sein. Er wird zeit seines Lebens auf der Hut sein, sich im Dunkeln auf der Straße umdrehen, wenn er Schritte hört, von dem klickenden Geräusch beim Laden einer Waffe aus dem Schlaf hochschrecken.
Nicht ganz die Strafe, die er verdient hat. Aber besser als nichts.
Am selben Tag
Tom trat das Gaspedal durch. Eine Frau mit einem Gewehr auf der alten Meiningenbrücke, das konnte nur Marina Sarow sein. Er hatte sofort alles stehen und liegen lassen und war zum Wagen gesprintet. Mascha hatte ihn begleiten wollen, doch er hatte sie gebeten, vor Ort zu bleiben.
«Du musst etwas finden, bevor die Akten morgen der Staatsanwaltschaft übergeben werden.»
Mascha hatte zweifelnd auf den Karton geschaut. «Setz mich nur unter Druck.» Aber sie hatte sich gefügt und den nächsten Stapel Papier herausgenommen.
Toms Gedanken schossen wieder zu Marina Sarow. Er brauchte sie, und zwar lebend. Nicht nur als Zeugin, weil sie als Einzige Licht ins Dunkel bringen konnte, sondern auch, weil dieser Fall schon zu viele Menschenleben gefordert hatte.
Tom passierte die Abfahrt nach Zingst. Jetzt war es nicht mehr weit. In der Ferne hörte er eine Sirene, die sich aus der entgegengesetzten Richtung näherte, vielleicht der Rettungswagen. Tom beschleunigte. Hoffentlich kam er nicht zu spät.
Autos stauten sich in der Kurve vor der Brückenauffahrt. Tom wechselte auf die Gegenspur und fuhr bis an die Absperrung. Heiko Gerdes alias Babyface hielt die Schaulustigen fern. An dem breitschultrigen jungen Mann kam so schnell keiner vorbei.
Er nickte Tom zu. «Schöne Scheiße.»
Tom reckte den Hals. «Sind noch Fahrzeuge auf der Brücke?»
«Nein. Alles frei. Auf der anderen Seite steht eine Streife aus Barth.»
«Wir brauchen Rettungsboote da unten. Fordere sie an. Und gib durch, dass niemand sich der Frau nähern soll. Ich übernehme das.»
Babyface verzog das Gesicht. «Ist das eine gute Idee? Immerhin hat sie auf dich geschossen, Chef. Sie könnte es wieder versuchen.»
«Das war eine Verwechslung. Außerdem bin ich vorsichtig, keine Sorge.» Tom tippte auf die Dienstwaffe in seinem Holster.
Babyface wirkte nicht überzeugt, doch er protestierte nicht, als Tom Gas gab.
Die Brücke war so konstruiert, dass sie geöffnet werden konnte, um größere Schiffe durchzulassen. Bei dem Neubau konnte man einen Teil der Fahrbahn hochklappen, bei der alten Eisenbahnbrücke das erste Stück seitlich wegdrehen. Seit die Brücke nicht mehr genutzt wurde, war dieser Teil dauerhaft eingedreht. Von der Halbinsel aus gab es also keine Verbindung mehr.
Als Tom sich den beiden Brücken näherte, erkannte er die Gestalt im dünnen Sommerkleid, die sich mit einer Hand von außen ans Geländer klammerte. In der anderen hielt sie ein Gewehr. Ein Steyr SM 12, da war Tom sicher. Das Gewehr, mit dem sie auf ihn geschossen hatte. Für einen winzigen Moment zitterte sein Fuß auf dem Gaspedal, und ein Stechen zuckte durch seine Schulter. Obwohl er von dem überzeugt war, was er zu Babyface gesagt hatte, war es ein merkwürdiges Gefühl, die Waffe zu sehen, die ihn beinahe getötet hätte, und das auch noch in den Händen der Frau, die geschossen hatte.
Zum Glück konnte Marina Sarow das Gewehr aus dieser Position heraus nicht schnell hochreißen und abfeuern. Ganz wohl war Tom trotzdem nicht. Vor allem als er über die neue Brücke aufs Festland zufuhr und Sarow dabei zwischen den Streben immer wieder für Bruchteile von Sekunden aus den Augen verlor.
Endlich hatte er das andere Ufer erreicht. Ein Uniformierter, den er nicht kannte, wartete neben einem Streifenwagen. Dahinter hatte ein RTW geparkt. Als Tom sich der Auffahrt zur alten Brücke zuwandte, erkannte er einen zweiten Kollegen, der mit einem Seitenschneider vor dem Bauzaun hockte, der als Absperrung diente. Einige Drähte hatte er bereits gekappt.
Tom blickte über ihn hinweg und stellte erleichtert fest, dass Marina Sarow noch immer am Geländer stand. Rasch sprang er aus dem Wagen und sprintete los.
Das Loch im Zaun war gerade groß genug. Tom quetschte sich hindurch. Beim Bücken zuckte ein Schmerz durch seine Schulter, als hätte ihm jemand einen Stromstoß versetzt. Tom stöhnte auf und dachte erneut voller Unbehagen an das Gewehr. Eigentlich dürfte sich nur noch eine Patrone darin befinden. Doch was, wenn der Jäger, dem Marina Sarow die Waffe entwendet hatte, sich irrte?
Tom richtete sich auf und machte ein paar vorsichtige Schritte auf die Gestalt im Kleid zu.
«Frau Sarow», rief er. «Ich bin Tom Engelhardt, und ich möchte mit Ihnen reden.»
Die Frau erwiderte nichts. Hatte sie ihn überhaupt gehört? Der Wind blies stark und wehte seine Worte auf den Bodden hinaus. Er öffnete sein Holster und bewegte sich langsam vorwärts.
«Bleiben Sie weg!», ertönte eine schrille Stimme.
Er blieb stehen. «Lassen Sie uns reden, Frau Sarow.»
«Nein!»
«Henning Mauritz hat uns seine Version der Ereignisse geschildert, aber ich bin sicher, dass das nicht die ganze Wahrheit ist.»
Beim Sprechen machte Tom zwei weitere Schritte auf sie zu. Er war jetzt noch etwa zehn Meter entfernt.
«Mir glaubt sowieso keiner», entgegnete die Frau.
Tom atmete auf. Das war schon fast ein Einlenken. «Ich glaube Ihnen, Frau Sarow. Ich weiß, dass Mauritz nicht so unschuldig ist, wie er tut.»
Noch während Tom die Worte aussprach, wurde ihm klar, dass er die Wahrheit sagte. Er misstraute dem Bauunternehmer zutiefst, nicht nur, weil er eine Affäre mit einer Frau im Alter seiner Tochter gehabt hatte. Der Mann war zu glatt, zu sauber, um echt zu sein. Ein paar nicht ganz korrekte Deals gehörten ja in seiner Branche fast schon zum guten Ton. Aber Tom vermutete, dass das nicht alles war.
«Sie wollen mich reinlegen», rief Marina Sarow.
«Nein, ganz sicher nicht. Reden Sie mit mir, lassen Sie Mauritz damit nicht davonkommen.»
Tom war jetzt so nah, dass er sehen konnte, wie erschreckend dünn sie war und wie groß ihre dunklen Augen in dem blassen Gesicht wirkten. Sie zitterte am ganzen Körper, und der Stoff des Kleides war blutbefleckt.
«Es ist zu spät.» Sie schüttelte langsam den Kopf, sah ihn voller Bedauern an.
Dann riss sie das Gewehr hoch und schob sich den Lauf in den Mund.
«Nein!»
Tom hechtete auf sie zu, wollte ihr die Waffe entreißen, doch der verletzte Arm gehorchte ihm nicht, hilflos griff er ins Leere. Marina Sarow zuckte zurück, das Steyr rutschte ihr aus der Hand, schlug krachend gegen eine Stahlstrebe und verschwand aus Toms Blickfeld.
Er streckte beide Arme aus, bekam den dünnen Stoff des Kleides zu fassen. Doch Marina riss die Arme hoch und warf sich mit aller Kraft nach hinten. Der Stoff glitt Tom aus den Fingern. Ein Schrei entfuhr ihrer Kehle, unmittelbar gefolgt vom Aufprall aufs Wasser.
Tom zögerte nicht. Er legte das Holster mit der Waffe ab und stieg aus den Schuhen. Gerade als er über das Geländer klettern wollte, packte ihn jemand am Arm.
«Denk nicht einmal daran, mit deiner Schulter.»
Er fuhr herum, blickte in die stahlblauen Augen seines Kollegen Paul Hendricks.
«Duke?», stammelte Tom überrascht. «Aber ich dachte …»
Paul war leidenschaftlicher Surfer und hatte seinen Spitznamen von der hawaiianischen Surflegende Duke Kahanamoku. Nach den anstrengenden Ermittlungen der vergangenen Wochen hatte er sich ein paar Tage freigenommen, um seinem Hobby nachzugehen.
«Dich kann man ja nicht allein lassen.» Paul war mit einem Satz auf der anderen Seite des Geländers.
Erst jetzt fiel Tom auf, dass er einen Neoprenanzug trug. Er hatte keine Zeit, sich darüber zu wundern, denn im nächsten Moment sprang Paul von der Brücke und tauchte hinab in die Fluten.
Am selben Tag
«Sie müssen mir helfen.» Die Stimme war leise, die Worte kaum zu verstehen.
Dayita Kumar presste das Telefon fester ans Ohr und ließ sich vorsichtig auf dem Stuhl nieder. Sie war nur in die Redaktion gekommen, weil sie gestern ihre Brieftasche auf dem Schreibtisch vergessen hatte, und eigentlich schon wieder auf dem Weg nach draußen.
«Mit wem spreche ich?»
«Wollen Sie noch immer die Wahrheit wissen?», fragte die Stimme zurück.
Marina Sarow, großer Gott.
«Und ob ich das will», erwiderte Dayita mit trockener Kehle.
Die Frau hatte schon einmal angerufen und angedeutet, Dinge über Henning Mauritz zu wissen. Ein Exklusivinterview mit der Frau, die aus einer psychiatrischen Klinik geflohen war, ein Gewehr gestohlen und auf zwei Männer geschossen hatte, wäre allein schon ein Knaller. Sie würde die Story anderen Zeitungen anbieten, denn sie war viel zu groß für die Wochenzeitung eines Küstenörtchens mit ein paar Tausend Einwohnern. Wenn Marina Sarow zudem etwas über die dubiosen Geschäfte des Bauunternehmers zu berichten hatte, wäre vielleicht sogar noch mehr drin. Die Enthüllungsgeschichte, auf die Dayita wartete, um ihre Reputation wiederherzustellen, um zu beweisen, dass sie es noch draufhatte.
Beim letzten Anruf hatte die Frau einfach aufgelegt, und Dayita hatte keine Chance gehabt, sie zu kontaktieren. Sie nahm das Telefon kurz vom Ohr und blickte auf das Display. Unbekannte Nummer.
«Wohin soll ich kommen?», fragte sie und zog einen Notizblock zu sich heran. Sie würde mit der Frau sprechen und sie danach überreden, sich zu stellen. Und sie würde sich irgendwie absichern. Bei einer psychisch kranken Person musste man mit allem rechnen. Zumal sie höchstwahrscheinlich noch immer bewaffnet war.
Die Frau hatte ihre Frage noch nicht beantwortet, und Dayita befürchtete, dass sie erneut einfach aufgelegt hatte. Ein Klicken ertönte, dann ein Klimpern, wie von Münzen.
Eine Telefonzelle? Dayita hatte nicht einmal gewusst, dass es auf dem Darß noch Münzfernsprecher gab. Besaß nicht jeder heutzutage ein Handy?
«Frau Sarow, sind Sie noch dran?»
«Fahren Sie in Richtung Zingst. Kurz vor dem Abzweig liegt auf der rechten Seite ein Parkplatz.»
Dayita griff nach einem Kugelschreiber. «Ja, den kenne ich.»
«In einer halben Stunde. Und keine Polizei.»
«Selbstverständlich.»
«Sie kommen wirklich allein?»
«Versprochen.»
Die Frau zögerte.
«Ist noch etwas, Frau Sarow?»
«Könnten Sie mir was zum Anziehen mitbringen? Eine Hose und einen Pullover vielleicht? Und ein Handtuch.»
Dayita legte überrascht den Kuli weg. Auf der Fahrt in die Redaktion hatte sie im Autoradio gehört, dass die Meiningenbrücke wegen eines Polizeieinsatzes vorübergehend gesperrt war. Sie hatte noch überlegt hinzufahren, dann aber entschieden, dass es genügte, auf die Pressemitteilung zu warten. Schließlich war Wochenende, die nächste Ausgabe des Sellnitzer Wochenblatts erschien erst am Mittwoch, und sie hatte schon den kompletten Samstag am Schreibtisch verbracht.
«Ich bringe Ihnen die Sachen mit», versprach sie. «Und eine Kanne mit heißem Kaffee.»
«Danke.»
Es klickte, die Verbindung wurde unterbrochen. Dayita sprang auf. Wenn sie erst noch nach Hause wollte, um Kleidung für die Frau zu holen, musste sie sich beeilen. Außerdem würde sie unterwegs versuchen, ihren Informanten bei der Polizei zu erreichen, um zu erfahren, ob die Aktion auf der Brücke womöglich mit Marina Sarow zusammenhing.
Und dann musste sie sich noch um ihre Absicherung kümmern.
Am selben Tag
Mascha winkte dem Wagen hinterher, bis er nicht mehr zu sehen war. Nicole, Romys Erzieherin, hatte das Mädchen vom Revier abgeholt. Der Einsatz auf der Brücke dauerte an, und niemand wusste, wie lange Tom noch dort eingespannt sein würde. Er hatte gezögert, Nicole um Hilfe zu bitten. Seit er wusste, dass ihr Bruder ein vorbestrafter Gewalttäter war, wollte er ihr seine Tochter eigentlich nicht mehr anvertrauen. Aber ihm war nichts anderes übrig geblieben. Die neue Tagesmutter würde sich erst ab morgen um Romy kümmern, wenn der Kindergarten geschlossen war.
Arme Romy, dachte Mascha. Sie hatte sich so darauf gefreut, den Sonntag mit ihrem Papa auf dem Revier zu verbringen. Aber eigentlich hatte er gar keine Zeit für sie gehabt. Erst hatte Senior sie beaufsichtigt, und jetzt Nicole.
Mascha ging wieder ins Revier, wo Senior gerade das Telefon weglegte.
«Marina Sarow ist gesprungen», berichtete er. «Noch haben die Kollegen sie nicht gefunden.»
«So ein Mist. Was ist mit dem Gewehr?»
«Das liegt irgendwo auf dem Grund des Meiningenstroms.»
«Immerhin kann sie damit keinen Schaden mehr anrichten.»
«Tom fürchtet, dass sie ertrunken sein könnte. Sie muss wohl sehr entkräftet gewirkt haben. Zwar ist Paul sofort hinterher, aber er hat sie nicht erwischt.»
«Paul? Wirklich?»
«Unser Duke ist ein echtes Sportass. Lass dich nicht von seinen grauen Haaren täuschen.»
Mascha hob lächelnd die Hände. «Würde ich niemals tun.»
Der Kollege räumte die Stifte zusammen, mit denen Romy gemalt hatte. «Oh, unsere Kriminaloberkommissarin hat ihre Dienstmarke vergessen.»
«Die nehme ich.» Mascha streckte die Hand aus. «Ich kann sie ihr später geben.»
Senior zog die Brauen hoch. «Ich dachte, du fährst heute nach Schwerin zurück?»
«Solange ich nicht weiß, was mit Marina Sarow ist, bleibe ich hier», sagte Mascha bestimmt.
«Und dein Chef?»
«Schuldet mir noch eine Woche Urlaub.»
Senior grinste.
Das Telefon auf der Theke klingelte, und er hob ab. Mascha wollte sich gerade in den Aktenraum verziehen, wo der letzte Karton wartete, als Senior sie zurückrief.
«Die Kriminaltechnik. Eine Lisa Alandt will jemanden aus der Soko Strand sprechen.»
Mascha kehrte zum Tresen zurück und nahm das Telefon entgegen. «Hallo, Lisa. Du machst wohl auch kein Wochenende», begrüßte sie die Kollegin.
Lisa lachte. «Ihr da oben auf dem Darß lasst uns ja nicht zur Ruhe kommen.»
«Bitte sag mir, dass du gute Nachrichten hast.»
«Kommt darauf an.»
«Erzähl.»
«Ich habe vorhin die Asservate im Mordfall Benjamin Reichert zusammengepackt, und dabei ist mir etwas an der Tatwaffe aufgefallen. Der Hammer, du erinnerst dich?»
«Natürlich.»
«Leider wurde er abgewischt. Es gab keine Fingerabdrücke.»
«Ja, ich weiß.» Mascha versuchte, nicht ungeduldig zu klingen. «Also, was ist dir aufgefallen?»
«Der Hammerkopf war locker. Mir kam die Idee, dass er sich möglicherweise gelöst haben könnte, als der Täter zuschlug, und dieser ihn wieder auf den Stiel gedrückt hat, vielleicht, um noch einmal zuzuschlagen. Und dass er womöglich nicht daran gedacht hat, dort auch die Fingerabdrücke wegzuwischen.»
«Und?», fragte Mascha gespannt.
«Es gibt einen wunderschönen Daumenabdruck auf dem Holz unter dem Kopf. Und eine Schmierspur. Blut des Opfers. Also ist der Fingerabdruck definitiv nicht zu einem früheren Zeitpunkt dort hinterlassen worden.»
«Das ist ja fantastisch!»
«Freu dich nicht zu früh.»
«Ach nein?» Mascha tauschte einen Blick mit Senior, der dem Gespräch gebannt lauschte, obwohl er nur die Hälfte mitbekam.
«Der Abdruck stammt nicht von eurem Tatverdächtigen.»
«Sicher?»
«Kein Zweifel. Und leider gab es auch keinen Treffer in der Datenbank.»
«Wäre ja auch zu schön gewesen. Danke, Lisa. Gute Arbeit.»
Mascha verabschiedete sich und legte das Telefon zurück auf die Station. «Ein Fingerabdruck am Hammer, mit dem Ben Reichert getötet wurde. Und zwar nicht von Sören Brandner.»
«Da geht er dahin, unser Hauptverdächtiger», murmelte Senior.
«Seit wir erfahren haben, dass Reichert zwanzig Minuten nach dem Kampf mit Sören erschlagen wurde, haben wir ja sowieso bezweifelt, dass er es war. Allerdings gibt es noch immer das Geständnis.»
«Ich schätze mal, sein Anwalt wird ihm raten, das zurückzuziehen, und einen Haftprüfungstermin beantragen.»
«Das denke ich auch.» Mascha seufzte.
Immerhin hatten sie jetzt endlich den Hinweis auf einen anderen Verdächtigen, den Toms Chef zur Bedingung für weitere Ermittlungen gemacht hatte. Fragte sich nur, ob diese Spur sie endlich zum Täter führte.
Am selben Tag
Tom legte seinem Kollegen die Hand auf die Schulter. «Du hast alles versucht.»
«Aber es hat nicht ausgereicht.» Paul verzog frustriert das Gesicht und zog die Decke enger um sich, die einer der Rettungssanitäter ihm umgelegt hatte. «Ich verstehe das nicht. Ich bin nur eine halbe Minute nach ihr gesprungen.»
«Vielleicht wurde sie direkt von einer Strömung erfasst und weggetrieben. Mach dir bitte keine Vorwürfe. Du hast deine Gesundheit riskiert, um sie zu retten, mehr kann man nicht erwarten. Es grenzt ohnehin an ein Wunder, dass du so schnell vor Ort warst.»
Paul hatte sich gerade bereit gemacht, auf dem Bodden zu kiten, als er die Fahrzeuge auf der Brücke bemerkt hatte. Ihm war sofort der Verdacht gekommen, dass der Einsatz der flüchtigen Frau galt. Innerhalb weniger Minuten war er vor Ort gewesen, gerade rechtzeitig, um Tom an einer Dummheit zu hindern. Mit seiner Schussverletzung wäre es gefährlich gewesen, ins Wasser zu springen, mal ganz davon abgesehen, dass er mit dem Arm gar nicht hätte schwimmen können.
«Fahr nach Hause», forderte Tom seinen Kollegen auf. «Stell dich unter die heiße Dusche und zieh dir trockene Sachen an. Das ist eine Dienstanweisung.»
Er klopfte Paul noch einmal auf die Schulter, dann wandte er sich ab und eilte zum Streifenwagen, wo Babyface am Funkgerät Wache hielt.
«Irgendwelche Neuigkeiten?»
«Leider nicht.» Der junge Kollege wippte mit dem Fuß. Tom konnte ihm ansehen, dass er am liebsten losgelaufen wäre, um bei der Suche zu helfen. Stillsitzen und abwarten war nicht seine Stärke.
«Was ist mit dem Heli?», fragte er.
«Ist noch immer bei dem anderen Einsatz.»
«Mist.»
Mehr als ein Dutzend Boote von Polizei und Seerettung fuhren den Bodden auf beiden Seiten der Brücke ab, die Küstenwache patrouillierte in dem Abschnitt zwischen Zingst und der Südspitze der Insel Hiddensee, wo die Fahrrinne aus dem Bodden ins Meer mündete, auch wenn es unwahrscheinlich war, dass der Körper von Marina Sarow so weit abgetrieben wurde.
Tom blickte in Richtung Brücke. Das Gefühl, versagt zu haben, nagte an ihm. Eben noch hatte er Paul gut zugeredet, weil er sich Vorwürfe machte, dabei erging es ihm selbst ganz ähnlich. Er hätte Marina Sarow vom Springen abhalten können, wenn er die richtigen Worte gefunden hätte. Wenn er schneller gewesen wäre, wenn sein verletzter Arm nicht schlappgemacht hätte.
Sinnlose Gedankenschleifen. Aber er schaffte es nicht, sie abzustellen.
All das wäre nicht weiter tragisch, wenn Marina Sarow noch lebte. Doch anderenfalls …
Er hatte schon bei Lilli Sternberg versagt, hatte die junge Frau nicht gefunden, hatte nicht einmal ermitteln können, was mit ihr geschehen war. Ob die Wahrheit je ans Licht käme, stand in den Sternen. Tom wandte den Blick von der Brücke ab. Er hatte sich in den vergangenen Wochen oft genug wie ein Versager gefühlt. Als Ermittler. Und als Vater. Er durfte sich nicht selbst fertigmachen, damit war niemandem geholfen.
Babyface stieg aus dem Wagen. «Gerade kam ein Funkspruch. Einem Taxifahrer ist eine Frau aufgefallen, die in einem völlig durchnässten Kleid im Boddenweg in Zingst aus einer Telefonzelle trat.»
Hoffnung durchströmte Tom. «Beschreibung?»
Babyface hob die Schultern. «Mehr weiß ich nicht. Aber die Leitstelle hat die Nummer des Taxifahrers.»
«Ich muss sofort mit ihm sprechen.»
Am selben Tag
Dayita setzte den Blinker und bog auf den Parkplatz. Nervös spähte sie durch die Windschutzscheibe. Unebener, sandiger Boden, ein paar Bäume, dahinter Wiesen, die sich bis zum Bodden erstreckten, zur Straße hin Sträucher, die den Platz vom Verkehr abschirmten. Sonst nichts. Kein anderes Fahrzeug, kein Mensch weit und breit.
Sie blickte nach oben, wo ein Bussard im bleigrauen Himmel seine Kreise zog. Es sah nach Regen aus.
Langsam fuhr sie eine Runde über den holprigen Untergrund und hielt dann nah der Ausfahrt, ließ den Motor laufen. Gegenüber führte eine Treppe auf den Deich, ein Schild zeigte den Strandübergang 32 an. Sie zog ihr Handy hervor und sah auf die Uhr. Etwas mehr als dreißig Minuten waren vergangen, seit sie mit Marina Sarow telefoniert hatte. Auf dem Beifahrersitz lag eine Tüte mit einem Handtuch, dicken Socken und einem Jogginganzug, in den sie seit Jahren nicht mehr hineinpasste. Sie war nicht dick, aber doch deutlich fülliger als die Frau, die sie bisher nur vom Foto kannte.
Die Thermoskanne mit dem Kaffee sowie zwei Becher standen im Fußraum. Zur Sicherheit hatte Dayita noch eine Packung Kekse eingesteckt.
Ein Lieferwagen fuhr auf der Landstraße vorbei. Dann ein dunkler Kombi. Für einen Moment glaubte Dayita, es wäre derselbe Wagen, der hinter ihr gewesen war, als sie auf den Parkplatz abbog. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Sie rief sich zur Ordnung, seit wann war sie so ein Hasenfuß?
Der Wind frischte auf, fuhr durch die Sträucher am Straßenrand. Dayita versuchte zu erkennen, ob sich dahinter noch etwas anderes bewegte. Sie war nervös, sah überall eine Bedrohung. Wenn doch nur ihr Backup Zeit gehabt hätte! Der Mann, ein leidenschaftlicher Kampfsportler, hatte ihr schon häufiger bei nicht ganz koscheren Treffen mit Zeugen Deckung gegeben. Aber er hatte heute eine andere Verabredung.
Dafür hatte sie mit ihrem Informanten gesprochen. Der Polizist hatte im Flüsterton bestätigt, dass Marina Sarow von der Meiningenbrücke gesprungen sei und noch gesucht werde. Dayita wusste, dass sie die Polizei sofort nach Marinas Anruf hätte informieren müssen, aber dann hätte sie ihr Treffen vergessen können.
Wieder fuhren einige Autos vorbei, von Marina Sarow keine Spur. Dayita zögerte, dann stieg sie aus, ließ jedoch die Tür offen und den Motor laufen.
«Frau Sarow? Marina?»
Sie lief ein paar Schritte, spähte in das dichte Gestrüpp unter den Bäumen. Vielleicht versteckte sich die Frau dort irgendwo und wagte sich nicht heraus.
«Ich bin allein, und ich habe Ihnen trockene Sachen mitgebracht.»
In einem Busch raschelte es. Dayita fuhr herum, eine Elster flatterte auf und flog laut schimpfend davon. Dayita presste die Hand auf die Brust, um ihr rasendes Herz zu beruhigen.
Sie lief bis zur Straße, spähte in beide Richtungen. In der Ferne glitzerte etwas im fahlen Licht, als würde dort ein Fahrzeug parken, ansonsten war alles still.
Dayita nahm eine Bewegung auf der gegenüberliegenden Straßenseite wahr, wo der Deich parallel zur Fahrbahn verlief. Sie schaute nach oben, und im gleichen Moment tauchte dort eine Gestalt auf. Eine Frau in einem dünnen Kleid, das ihr am Körper klebte. Auch das Haar war feucht. Sie trug keine Schuhe, ihre Haut war so blass, dass sie fast durchscheinend wirkte.
Kein Gewehr.
Dayita atmete auf.
«Kommen Sie, Frau Sarow», rief sie ihr zu. «Im Auto ist es warm. Und es gibt Kaffee und Kekse.»
Die Frau starrte sie einen Moment lang an, als würde sie sie gar nicht wahrnehmen. Dann warf sie einen beunruhigten Blick auf die Straße.
«Es ist niemand da außer mir», versicherte Dayita ihr. «Kommen Sie!»
Endlich setzte die Frau sich in Bewegung, lief erst langsam und unsicher, dann immer schneller den Deich hinab.
Dayita hörte den Motor erst, als das Fahrzeug sie schon fast erreicht hatte. Ein dunkler Pkw, der auf sie zuraste. Dayita wollte reagieren, wollte Marina warnen, aber es ging viel zu schnell. Eben hatte die Frau noch auf dem Deich gestanden, im nächsten Moment war sie auf der Fahrbahn. Das Auto erfasste ihren schmächtigen Körper, er wurde durch die Luft geschleudert wie eine Puppe.
Bremsen quietschten. Jemand schrie.
Einen Moment lang war Dayita wie erstarrt, dann rannte sie los, auf die Frau zu, die reglos am Straßenrand lag. Noch im Laufen entsperrte sie ihr Handy und wählte den Notruf. Das Telefon ans Ohr gepresst, sank sie neben Marina auf die Knie und versuchte ihren Puls zu finden. Der Schrei hallte ihr noch immer in den Ohren. Ihre eigene Stimme, schrill vor Entsetzen. Dann hörte sie etwas anderes. Hinter ihr quietschten Reifen über den Asphalt, ein Motor heulte auf.
Dayita drehte den Kopf und sah, dass der dunkle Wagen gewendet hatte und sich in die Richtung entfernte, aus der er gekommen war. Fassungslos starrte sie ihm hinterher. Was in aller Welt war hier gerade geschehen?
Am selben Tag
Mascha fuhr an die provisorische Straßensperre, wo ein Streifenbeamter stand, den sie nicht kannte, und zeigte ihm ihren Dienstausweis.
«Am besten parken Sie hier am Straßenrand, Kollegin», sagte er. «Die Unfallstelle ist da vorn.»
Sie dankte ihm, stellte den Wagen ab und ging das letzte Stück zu Fuß. Die Wolken waren dichter geworden, der Wind stärker, Feuchtigkeit hing schwer in der Luft. Sie entdeckte Tom, der gerade telefonierte.
Als er sie erblickte, winkte er sie herbei. Er beendete das Gespräch und steckte das Telefon in die Hosentasche. «Schöne Scheiße.»
«Was ist passiert?»
«Marina Sarow wurde angefahren. Sie ist schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Sieht nicht gut aus.»
Mascha nickte, der Krankenwagen war ihr entgegengekommen.
«KT ist angefordert. Aber es dauert, bis die da sind. Die Straße ist ein Nadelöhr, aber ich will nicht, dass irgendwer hier durchfährt, bevor die Kollegen Spuren gesichert haben. Babyface sorgt dafür, dass eine Umleitung über die Feldwege eingerichtet wird.»
Mascha blickte sich um. Je ein Streifenwagen, der die Straße blockierte, keine weiteren Fahrzeuge. Offenbar wurde die Umleitung bereits genutzt. Andererseits war die Brücke womöglich ebenfalls noch gesperrt, also konnten auf diesem Weg keine Autos vom Festland auf die Halbinsel gelangen.
Zwei Streifenkollegen vermaßen die Unfallstelle. Mascha glaubte, eine Bremsspur zu erkennen. Und ein Stück dahinter glitzerte etwas. Splitter, wahrscheinlich von einem Scheinwerfer.
«Ich hatte sie fast», sagte Tom. «Ich habe ihr Kleid in den Händen gehalten. Aber sie hat sich losgerissen. Meine Schulter …» Er berührte mit der gesunden Hand den Verband.
«Es ist nicht deine Schuld.»
«Ich wünschte, du hättest recht.»
Mascha ließ erneut den Blick wandern. «Was ist mit dem Unfallwagen?»
«Abgehauen.»
«Arschloch.»
«Das ist nicht alles. Es gibt eine Zeugin.»
Tom deutete in Richtung Parkplatz. Toms Bulli stand dort, und ein älterer Golf.
«Das ist doch eine gute Nachricht», sagte Mascha. «Jemand hier aus der Gegend?»
«Dayita Kumar, die Chefredakteurin des Sellnitzer Wochenblatts.»
Mascha runzelte die Stirn. «War die nicht auf dem Hof, als wir Ben Reichert festgenommen haben?»
«Genau.»
«Hast du schon mit ihr gesprochen?»
«Nur kurz, ich wollte, dass du dabei bist.» Tom sah sie an. «Sie behauptet nämlich, es war ein Mordanschlag.»
Anklam, am selben Tag
Holger Dietrich warf die Kippe auf die Straße und schloss das Fenster. Wenn er allein im Büro war, ging er nicht extra nach draußen, um zu rauchen. Wozu auch?
Er setzte sich wieder an den Schreibtisch. Eigentlich hatte er als Erster Kriminalhauptkommissar und Ermittlungsleiter ein eigenes Büro, doch seit das Disziplinarverfahren gegen ihn lief, das Mascha ihm eingebrockt hatte, hatte sich seine Stellvertreterin Mette Hansen dort breitgemacht.
Der Gedanke an Mascha trieb Holger die Zornesröte ins Gesicht. Warum nur versuchte sie mit aller Gewalt ihm das Leben schwer zu machen? Und nicht nur ihm. Ihr Feldzug richtete sich auch gegen seine Eltern, gegen die Menschen, die Mascha aufgenommen und ihr ein Zuhause geboten hatten, als niemand sie haben wollte. Die sie liebten, als wäre sie ihr eigen Fleisch und Blut. Aber statt dankbar zu sein, bereitete sie ihnen nichts als Kummer.
Holger versuchte, sich wieder auf seinen Bericht zu konzentrieren. Er hasste Schreibtischarbeit und hatte sie immer wieder vor sich hergeschoben. Deshalb war er gezwungen, am Sonntag ins Büro zu kommen, damit der Bericht Montagmorgen auf dem Schreibtisch des Kommissariatsleiters lag. Es ging noch immer um die Razzia vor gut zwei Wochen. Holger hatte die Ermittlungen in einem Mordfall geleitet, und einer der Dealer war sein Hauptverdächtiger gewesen, weshalb er und sein Team an der Razzia teilgenommen hatten. Der Mörder hatte inzwischen gestanden, doch den Erfolg hatte Mette eingeheimst.
Holger hatte seinen Leuten gegen die ausdrückliche Anordnung des Einsatzleiters den Zugriff befohlen, und er stand noch immer zu seiner Entscheidung. Hätte er es nicht getan, wäre der Mörder ihnen entwischt und untergetaucht.
Um seinen Alleingang zu rechtfertigen, hatte Holger sich ein paar Akten über die Mitglieder des Dealerrings kommen lassen. Einer der Männer, der schon seit fast dreißig Jahren im Geschäft war, aber erst einmal eine kurze Haftstrafe verbüßt hatte, war ihnen auch diesmal durchs Netz geschlüpft. Er war zu clever, um sich persönlich blicken zu lassen, und auch in den beschlagnahmten Unterlagen war sein Name nicht aufgetaucht. Offiziell betrieb er einen kleinen Fahrradladen in Greifswald, doch Holger wusste, dass er davon nicht seinen aufwendigen Lebensstil finanzieren konnte.