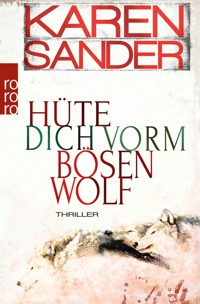
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stadler & Montario ermitteln
- Sprache: Deutsch
Auf einer Kriminalistentagung lernt Hauptkommissar Georg Stadler die französische Kollegin Isabelle Hernier kennen. Sie erzählt ihm von einem Wesen, halb Mensch, halb Wolf, das in den Wäldern um ihre kleine Gendarmerie im Juragebirge sein Unwesen treibt. Angeblich hat der Wolfsmann bereits eine junge Bagpackerin zerfleischt. Am nächsten Morgen ist Isabelle weg. Stadlers Neugier ist geweckt und er reist ihr hinterher. Vor Ort erwartet ihn eine Überraschung: Die echte Isabelle Hernier ist viel älter und überhaupt nicht begeistert von seinem Besuch. Als eine Frau tot aufgefunden wird, nimmt sie Stadlers Hilfe an. Zusammen mit der hochschwangeren Profilerin Liz Montario machen sie sich auf die Suche nach dem mysteriösen Wolfsmann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Karen Sander
Hüte dich vorm bösen Wolf
Thriller
Über dieses Buch
Auf einer Kriminalistentagung lernt Hauptkommissar Georg Stadler die französische Kollegin Isabelle Hernier kennen. Sie erzählt ihm von einem Wesen, halb Mensch, halb Wolf, das in den Wäldern um ihre kleine Gendarmerie im Juragebirge sein Unwesen treibt. Angeblich hat der Wolfsmann bereits eine junge Backpackerin zerfleischt. Am nächsten Morgen ist Isabelle weg. Stadlers Neugier ist geweckt, und er reist ihr hinterher. Vor Ort erwartet ihn eine Überraschung: Die echte Isabelle Hernier ist viel älter und überhaupt nicht begeistert von seinem Besuch. Als eine Frau tot aufgefunden wird, nimmt sie Stadlers Hilfe an. Zusammen mit der hochschwangeren Profilerin Liz Montario machen sie sich auf die Suche nach dem mysteriösen Wolfsmann.
Vita
Karen Sander arbeitete viele Jahre als Übersetzerin und unterrichtete an der Universität, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie lebt mit ihrem Mann im Rheinland und hat über die britische Thriller-Autorin Val McDermid promoviert. Unter ihrem wahren Namen Sabine Klewe hat sie bereits zahlreiche Krimis und Thriller geschrieben. Bei rororo erschien neben der Stadler-Montario-Reihe zuletzt ihr Thriller «Wenn ich tot bin».
Pressestimmen zur Stadler-Montario-Reihe:
«Sander glänzt in ihrem Thrillerdebüt mit überraschenden Wendungen, einem schnörkellosen Stil und einem Ermittlerduo, das Serienreife besitzt.» Rhein-Neckar-Zeitung über Band 1
«Ein clever inszeniertes Katz-und Maus-Spiel. Sanders Thriller lässt einen frösteln.» BRF 1 über Band 2
«Der Fall hat alles, was ein mitreißender Thriller haben muss: einen Spannungsbogen bis zum Schluss, geschickt gelegte falsche Fährten und glaubwürdige Charaktere.» Ruhr Nachrichten über Band 3
«Die Leser sollten sich vielleicht darauf einstellen, dass sie beim Lesen das Atmen vergessen. Ein Spitzenthriller auf internationalem Niveau!» The Huffington Post über Band 4
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2020
Copyright © 2020 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung yellowfarm gmbh, Stefanie Freischem
Coverabbildung Design Pics/John Hyde/plainpicture; mauritius images
ISBN 978-3-644-00366-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Montag, 11. Mai
Nahe La Frasnée, Département Jura, Frankreich
Sophie unterdrückte einen Aufschrei, als das eisige Wasser in ihre Turnschuhe schwappte. Sie stolperte, die Hände schützend nach vorn ausgestreckt, die Augen zusammengekniffen, in der Hoffnung, irgendetwas zu erkennen. Aber da war nichts als milchige, formlose Dunkelheit.
Irgendwo vor ihr musste Louise sein. Sophie hörte ihren keuchenden Atem und das Patschen ihrer Füße im Bach. Das Geräusch hatte etwas Beruhigendes, gab ihr die Gewissheit, dass sie in dieser feindseligen Umgebung nicht allein war.
Oder kam das Patschen von hinten? Machte Es sich womöglich genau in diesem Augenblick bereit, sich auf sie zu stürzen?
Panik pulsierte durch Sophies Adern. Sie stöhnte auf, zwang ihre Beine, das Tempo zu beschleunigen. Doch schon nach wenigen Schritten rutschte sie auf einem moosigen Stein aus. Der Aufprall war hart, das kalte Wasser ein Schock. Der Rucksack rutschte ihr von den Schultern, etwas Spitzes bohrte sich schmerzhaft in ihre Hüfte. Tränen schossen ihr in die Augen, Verzweiflung schnürte ihr die Brust ein. Was für eine idiotische Idee, bachaufwärts zu laufen! Dabei hatten sie sich für so schlau gehalten. Kein Unterholz, keine Gefahr, im Kreis zu laufen. Keine Spuren, denen Es folgen konnte.
Sophie rappelte sich auf. Hätten sie doch nur den Weg in Richtung Dorf genommen, dann wären sie vielleicht schon in Sicherheit. Sie hätten an die Türen hämmern, die Leute aus dem Schlaf reißen können.
Doch jetzt war es zu spät. Sophie lief weiter, schlitterte über nasse Kiesel, kletterte über morsche Äste, die quer im Bach lagen, krabbelte auf allen vieren über einen Felsklotz.
Louise war schon ein ganzes Stück weiter. Nur noch leise hörte Sophie das Klatschen ihrer Schritte, dann unvermittelt ihre Stimme, viel näher als erwartet.
«Fuck. Blöder Ast!»
«Alles okay?» Keuchend schloss Sophie auf.
«Bin mit den Haaren hängen geblieben, das Scheißding hätte mich beinahe stranguliert. Ich –»
Sie verstummte. Es knackte im Unterholz. Irgendwo links von ihnen. Mit einem leisen «Shit» setzte Louise sich wieder in Bewegung. Sophie rannte dicht hinter ihr her. So schnell sie konnte, stolperte sie weiter durch das Bachbett. Zweige peitschten ihr ins Gesicht, Steine bohrten sich durch die dünnen Sohlen ihrer Turnschuhe und schabten an ihren Knöcheln, die nasse Jeans klebte unangenehm kalt auf ihrer Haut.
Plötzlich prallte Sophie gegen etwas Weiches. Sie schrie.
«Schscht», machte Louise. «Ich bin’s.»
«Was ist los?» Sophie konnte das Gesicht ihrer Freundin nur erahnen. Wann war diese verfluchte Nacht endlich vorbei?
«Ich habe meine Kette verloren. Das muss eben an dem Ast passiert sein.»
«Ist doch egal.»
«Nein. Sie ist mein Glücksbringer. Ich muss sie holen.»
«Bist du wahnsinnig?» Sophie packte ihre Freundin am Arm. «Dieses … dieses Ungeheuer ist hinter uns her. Wenn du umkehrst, erwischt es dich.»
«Ich bin ganz schnell zurück.» Louise machte sich los.
«Tu das nicht, bitte!», flehte Sophie. «Lass mich nicht allein.» Sie griff nach Louises Hand, die sich überraschend warm zwischen Sophies eisigen Fingern anfühlte. «Wir müssen zusammenbleiben.»
Sophie spürte, wie Louise ihre Finger drückte. «Lauf weiter, bis du auf eine Straße oder Häuser stößt. Dort treffen wir uns.»
«Nein, Louise, wir dürfen uns nicht trennen.»
«Mach schon, lauf. Ich finde dich.» Louise ließ sie los, und im nächsten Augenblick verschwamm ihre Silhouette mit den Konturen der Baumstämme. Nur das Platschen ihrer Schritte war noch eine Weile zu hören, dann nichts mehr.
Sophies Brust schnürte sich zusammen, der Wald schien näher zu rücken, als wolle er ihr die Luft abdrücken, sie in eine tödliche Umarmung zwingen. Sie setzte sich wieder in Bewegung, benommen vor Angst und Kälte. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als sie ein Rauschen hörte, das allmählich lauter wurde. Kurz darauf lichtete sich der Wald, aus dem diffusen Dunkel schälten sich Konturen.
Dann sah sie es. Nur wenige Meter vor ihr erhob sich eine steile, nackte Felswand, die sich im sternenlosen Nachthimmel verlor. Das Wasser stürzte von irgendwo weit oben in die Tiefe, sammelte sich in einem Becken und floss dann über das Bachbett ab, in dem Sophie stand.
Sackgasse. Hier ging es nicht weiter. Sie musste umkehren. Immerhin bedeutete das, Louise entgegenzulaufen.
Sophie wollte sich gerade abwenden, als sie merkte, dass sie nicht allein war. Entsetzt hielt sie mitten in der Bewegung inne. In Todesangst entleerte sich ihre Blase, ihre Beine zitterten unkontrolliert.
Sie wollte losrennen, doch sie konnte sich nicht vom Fleck rühren, sie schaffte es nicht einmal, den Blick abzuwenden. Unverwandt starrte sie die Gestalt an, die wenige Meter über ihr auf einem Felsvorsprung stand und gierig die Zähne bleckte.
Freitag, 15. Mai
Amsterdam, Niederlande
«Im Jahr 1764 tötete das Untier, das später als die Bestie von Gévaudan in die Geschichte eingehen sollte, zum ersten Mal. Eine junge Hirtin fiel ihm zum Opfer. Im Allgemeinen wird angenommen, dass es sich bei dem Angreifer um einen besonders großen und ungewöhnlich angriffslustigen Wolf handelte, der in der armen und weit abgelegenen Region Frankreichs sein Unwesen trieb. Dutzende von Opfern werden ihm zugeschrieben, die meisten davon Frauen und Kinder. Der vom König entsandte Capitaine Duhamel mit seinen Dragonern stellte ihm ebenso vergeblich nach wie der angesehene Hofjäger Marquis d’Apcher. Zwischen 1764 und 1767 wurden bei der Jagd auf das Untier mehr als hundert Wölfe getötet. Ob die sogenannte Bestie von Gévaudan letztlich darunter war, ist ungewiss. Die Todesfälle selbst werden von der Wissenschaft nicht angezweifelt. Allerdings existiert kaum seriöse Forschung zum Thema, dafür gibt es umso mehr Verschwörungstheorien, angefacht vor allem dadurch, dass offenbar einer großen Zahl von Opfern nicht nur tödliche Bisswunden zugefügt, sondern auch der Kopf abgetrennt wurde. Und das anscheinend mit einem sauberen Schnitt. So zumindest ist es in den zahlreichen Berichten festgehalten. Wohl eher nicht die Tat eines wilden Tieres. Es sei denn, jemand hätte ihm den Umgang mit Messer und Gabel beigebracht.»
Leises Lachen ertönte im Tagungsraum. Guy Manning, Professor für Forensische Psychologie am Londoner University College, lächelte zufrieden, fuhr sich durch das zottelige braune Haar und drückte die Fernbedienung des Beamers. Eine Zeichnung von einem übergroßen Wolf wurde an die Wand geworfen, auf zwei Beinen stehend und mit aufgerissenem Maul, im Begriff, sich auf eine junge Frau zu stürzen.
Kriminalhauptkommissar Georg Stadler unterdrückte ein Gähnen. Nicht, dass er den Vortrag nicht interessant fand. Aber es war der vierte an diesem Tag, noch dazu auf Englisch, und ihm rauchte der Kopf. Ursprünglich hatte Stadler gar nicht nach Amsterdam fahren wollen. Er war kein Fan von komplexen Theorien über Verbrechen, sondern ein Mann der Praxis. Andererseits hatte er mehr als einmal erlebt, dass die Theorie bei den Ermittlungen hilfreich sein konnte.
Zudem war er gebeten worden, selbst einen Vortrag auf dieser internationalen Kriminalistentagung zu halten, und zwar über den Serientäter, den sein Team im vergangenen Herbst gejagt hatte. Und als sein Chef gedroht hatte, den Kollegen Hubert Burghausen an seiner Stelle zu schicken, war Stadler eingeknickt. Sosehr ihm solche Auftritte zuwider waren – dass ein anderer sich mit seinen Lorbeeren schmückte, verletzte seinen Stolz.
«Die Theorien, die aus dem Menschenfresser ein Fabelwesen machen, mögen aus kriminalistischer Sicht eher uninteressant sein», fuhr Manning fort, «doch die Kriminalistik interessiert mich heute nur am Rande. Ich möchte mich der Mystik widmen. Den Ungeheuern.» Manning ließ eine weitere Zeichnung an die Wand werfen, diesmal einen übergroßen Menschen mit Fell, Schwanz und riesigen Zähnen.
«Es ist nicht immer leicht, bei Geschichten über monströse Verbrechen den Blick auf die nüchternen Fakten zu beschränken. Wir neigen dazu, das Böse zu verklären. So geben wir Serienmördern Namen, die ihre Taten pathetisch überhöhen und finstere Helden aus ihnen machen: Das Monster von Turin alias Giancarlo Giudice in Italien, Doktor Tod alias Harold Shipman in Großbritannien, das Biest von Atteridgeville alias Johannes Mashiane in Südafrika, der Sandmann alias Adolf Seefeldt in Deutschland, der böse Geist von Kaukjarvi alias Igor Chernat in Russland, der Vampir von Niterói alias Marcelo Costa de Andrade in Brasilien. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.»
Bei jedem Namen hatte Guy Manning ein Schwarz-Weiß-Foto auf der Wand erscheinen lassen, sodass nun sechs Serienmörder auf das Publikum herabschauten.
Er holte Luft. «Jede dieser Bezeichnungen enthält eine Überhöhung, eine Dramatisierung. Diese Mörder sind keine gewöhnlichen Menschen, sollen sie sagen, sondern Ungeheuer, Wesen aus der Unterwelt, die ans Licht gekrochen sind, um uns unschuldige Menschen das Fürchten zu lehren.
Warum tun wir das? Woher kommt dieser Drang, den Verbrecher zu dämonisieren? Da ist zum einen natürlich das Bedürfnis, sich von seinen Taten zu distanzieren. Die Bestie ist keiner von uns, sollen sie sagen, wir wären zu solch grauenvollen Verbrechen niemals in der Lage.»
Stadler ließ den Blick durch den Tagungsraum schweifen. Die meisten Zuhörer hingen dem Psychologen an den Lippen. Einige jedoch beugten sich über ihr Smartphone, und ein dicker Mann in der letzten Reihe hatte die Arme verschränkt, den Kopf auf die Brust gesenkt und schlief ganz offensichtlich. Stadler erinnerte sich, dass es ein Kollege aus Spanien war, der am Vorabend dem Bier reichlich zugesprochen hatte. Schräg vor dem Spanier machte eine junge Frau sich eifrig Notizen. Jetzt hob sie den Kopf, und ihre Blicke trafen sich.
Die Frau lächelte. Sie war Stadler bereits am Vortag aufgefallen. Anfang dreißig, rundes, kindliches Gesicht. Pechschwarze Haare, dazu gletscherblaue Augen. Eine exotische Kombination.
Früher hätte er die Frau in der Pause angesprochen, auf einen Drink eingeladen und sein Glück versucht. Unverbindlicher Sex. Eine nette Abwechslung, gut fürs Ego. Aber die Zeiten waren vorbei. Er machte sich nichts mehr aus One-Night-Stands. Sie hinterließen einen schalen Geschmack. Stadler wandte den Blick ab und richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf den Vortrag.
Guy Manning hob den Finger und schüttelte seine Zottelmähne. «Aber das ist nur ein Teil der Erklärung. Diese mystischen Namen entspringen auch dem Bedürfnis, den Dingen einen Sinn zu geben, eine Bedeutung, eine inhärente Logik. Und gerade heute, in Zeiten, wo immer weniger Menschen, zumindest in unserer westlichen Welt, an einen Gott glauben, hat solcher Ersatzglaube an Monster und Ungeheuer Hochkonjunktur. Googeln Sie mal nach Verschwörungstheorien. Schauen Sie sich an, was Menschen alles glauben, wo sie nach Bedeutung suchen. Sie werden nicht nur auf Berichte über Ufosichtungen, Chemtrails oder angebliche geheime Machenschaften der Regierungen stoßen. Sondern auch auf solche über alle möglichen Fabelwesen, über den Mothman oder das Montauk-Monster oder wie auch immer sie heißen mögen. All diese Gestalten, seien sie nun frei erfunden oder mystisch überhöhte reale Personen, sind Ausdruck des Bedürfnisses, Sinn zu finden und so unserer Existenz eine Bedeutung zu verleihen, die über unseren willkürlichen und letztlich bedeutungslosen Tod hinausgeht.»
Manning ließ seine Worte einen Augenblick wirken, dann bedankte er sich für die Aufmerksamkeit. Applaus brandete auf, Gemurmel setzte ein, Stühle wurden gerückt.
Stadler eilte mit den Ersten nach draußen. Er brauchte dringend einen Kaffee. Nach der Pause stand ein letzter Vortrag auf dem Programm, danach war Abreise. Jedoch nicht für ihn. Er hatte eine weitere Nacht im Hotel gebucht, schließlich war Freitagabend, und er war in Amsterdam. Vielleicht blieben einige Kollegen ebenfalls noch, und sie konnten ein bisschen durch die Altstadt ziehen.
Mit dem Kaffeebecher in der Hand, stellte Stadler sich ans Fenster. Obwohl er nur mit halbem Ohr zugehört hatte, hallte der Vortrag in ihm nach. War es wirklich so, dass das Böse eine Art Ersatzreligion darstellte? Dass die Menschen um jeden Preis an etwas glauben wollten, das größer und mächtiger war als sie selbst? Oder war solcher Monsterglaube nicht vielmehr ein Überbleibsel aus Zeiten, in denen die Menschen nicht nur an Gott, sondern auch an den Teufel, an Hexen und allen möglichen anderen Zauber geglaubt hatten?
«Interessante Geschichte, die mit der Bestie, finden Sie nicht?»
Stadler fuhr herum. Vor ihm stand die junge Frau mit den schwarzen Haaren und den auffallend hellen Augen. Sie streckte die Hand aus.
«Major Isabelle Hernier, Gendarmerie Nationale», sagte sie mit unüberhörbarem französischem Akzent. «Aus Clairvaux-les-Lacs. Das liegt im Juragebirge, in der Nähe der Schweizer Grenze, wohin sich nur wenige deutsche Touristen verirren.»
«Kriminalhauptkommissar Georg Stadler aus Düsseldorf. Ich habe –»
«Ich weiß.» Sie lächelte. «Ich habe Ihren Vortrag gehört. Die armen Mädchen. Ein grauenvolles Verbrechen.»
«Ja.» Stadler nahm einen Schluck Kaffee. Während seines Vortrags am Abend zuvor hatte er es geschafft, die berufliche Distanz zu wahren. Privat sprach er nicht gern über die Ereignisse vom vergangenen Herbst. Sie hatten eine Kollegin verloren. Auch durch sein Versäumnis.
«Ich habe übrigens auch eine Bestie in meinem Revier.» Isabelle lächelte.
Stadler zog eine Braue hoch.
«So wie die von Gévaudan.»
«Ach ja?»
«Eine Art Mischung aus Wolf und Mann.»
«Interessant.» Stadler wusste nicht, ob die Frau ihn auf den Arm nehmen wollte. «Dann sollten Sie mit Doktor Manning darüber reden.»
«Ich würde aber lieber mit Ihnen reden, Georg. Ich darf doch Georg sagen? Sie scheinen mehr Erfahrung mit derartigen Untieren zu haben.»
«Ach, ist das so?» Noch immer war Stadler nicht sicher, was diese Isabelle von ihm wollte. War das eine Anmache? Oder ein ehrlich gemeintes Hilfeersuchen?
«Ich habe einen Vorschlag. Wir schwänzen den letzten Vortrag. Ich lade Sie zum Essen ein und erzähle Ihnen von meinem Fall.»
Stadler musste sich eingestehen, dass er neugierig war. Und dass die Aussicht, mit einer attraktiven Frau essen zu gehen ihn weit mehr reizte, als sich einen weiteren Vortrag anzuhören, für den sein Hirn definitiv keine Kapazitäten mehr besaß.
«Also gut.» Er lächelte. «Ich nehme Ihre Einladung an.»
«Sie werden es nicht bereuen.»
Forêt de la Crochère, Département Jura, Frankreich
Florentine Gaudreault setzte den Korb ab und stemmte die rechte Hand in die Hüfte. Ihr Atem ging schwer und schneidend. Früher hatte sie solche Aufstiege mühelos bewältigt. Aber das war Jahrzehnte her. Heute musste sie immer wieder eine Rast einlegen, um Luft zu holen und den schmerzenden Knien eine Pause zu gönnen.
Immerhin war sie fast auf dem Gipfel. Die Opferstelle war zugewachsen und kaum noch als solche zu erkennen. Ein paar auffällige Felsbrocken, dicht mit krüppeligen Kiefern, Weißdorn und Farn überwuchert. Ein Wanderer, der sich zufällig hierher verirrte, würde wohl kaum erkennen, dass die Steine nicht von der Natur, sondern von Menschenhand so angeordnet worden waren.
Florentine langte nach dem Korb und nahm das letzte Stück des Aufstiegs in Angriff. Es war besonders steil, zudem machten Geröll und glattgeschliffener Fels es nahezu unpassierbar. Bergauf ging es noch, bergab musste man jeden Schritt genau setzen. Immerhin wäre der Korb dann leer und sie würde den Stock besser einsetzen können.
Oben sah alles so aus wie bei Florentines letztem Besuch im vergangenen Herbst. Sie stellte den Korb ab und sah sich um. Kiefern, Weißdorn, Farn, ein wenig Gras, wo das Sonnenlicht zwischen den Baumkronen hindurchdrang, und Moos an den besonders schattigen Stellen auf den Steinen. Ein paar Federn unter einem Strauch. Pfotenabdrücke in der feuchten Erde. Ein Kaninchen. Ein Vogel. Keine Spuren menschlicher Anwesenheit.
Florentine atmete auf. Der Ort war in den alten Büchern erwähnt, doch offenbar machte sich niemand die Mühe, sie zu lesen. In die Erleichterung mischte sich Enttäuschung, denn auch von ihm gab es keine Spur.
Ob er manchmal herkam, so wie damals? Sie musste darauf vertrauen, eine andere Wahl blieb ihr nicht. Sie schob einige Ranken zur Seite und befreite den großen, flachen Stein, der für die Gaben vorgesehen war, von Nadeln und Laub. Dann packte sie aus, was sie mitgebracht hatte. Ein Stück Käse, ein Glas Honig, eingemachte Bohnen, Brot und eine kleine Flasche Milch.
Sorgfältig deponierte sie alles auf dem Stein, trat zurück und betrachtete ihr Werk. Sie hatte lange darüber nachgedacht, was sie ihm bringen sollte. Mutter hatte nie Details erwähnt. Nun konnte Florentine sie nicht mehr danach fragen. Vielleicht machte er sich nichts aus Milch und Honig, und sie hätte lieber ein Rebhuhn schießen sollen. Andererseits zählte beim Opfer die Absicht, der gute Wille, nicht der Wert der Gaben.
Florentine trat zurück und ging ächzend in die Knie. Sie legte die Handflächen aneinander, berührte damit erst ihre Stirn, bevor sie sich vorbeugte, bis sie das Gras an ihren Fingern spürte.
«Vater, komm zu mir», murmelte sie. «Es ist an der Zeit, ich spüre es, meine Knochen rufen nach dir. Ich weiß, dass du in diese Wälder zurückgekehrt bist, um mich zu holen. Gib mir ein Zeichen, ich bin bereit.»
Langsam richtete Florentine sich wieder auf, verneigte sich dreimal und erhob sich unter großer Anstrengung wieder vom Boden. Einen Moment lang blieb sie abwartend stehen. Die Vögel sangen, der Wind ging leise säuselnd durch das Laub, doch das erwartete Zeichen blieb aus.
Enttäuscht griff Florentine nach dem Korb. Sie musste Geduld haben, durfte sich nicht grämen, wenn er nicht sofort antwortete. Als sie sich wegdrehte, um sich an den langen und beschwerlichen Abstieg zu machen, ertönte ein Knacken hinter ihr. Eine Dohle stob krächzend aus einem Baum und flatterte davon.
Florentine drehte sich um, und da stand er.
«Vater», murmelte sie. Tränen brannten in ihren Augen. «Du bist gekommen.»
Statt einer Antwort hob er die Hand und legte den Finger an die Lippen. Sie nickte kaum merklich. Er neigte das Haupt, und im selben Moment verschmolz er mit dem Dämmerlicht unter den Baumkronen und war verschwunden.
Amsterdam, Niederlande
«Und? Schmeckt es?»
«Ausgezeichnet.» Stadler lächelte Isabelle an und schob sich eine Gabel Wachtelfilet in den Mund.
Es stimmte, das Essen war exquisit und der Merlot ebenso. Auch die Location konnte sich sehenlassen. Das kleine französische Restaurant lag direkt an der Prinsengracht, Lampions warfen warmes Licht auf die Bistrotische, von denen man die Boote vorbeiziehen sehen konnte, während man die Speisen genoss.
Trotzdem fühlte Stadler sich unbehaglich. Auch wenn Isabelle geschickt versucht hatte, es zu kaschieren, war offensichtlich gewesen, dass sie das Lokal nicht spontan ausgesucht, sondern den Tisch reserviert hatte. Sie verfolgte einen Plan, so viel war sicher. Nur wusste Stadler noch nicht, ob sie es auf ihn als Mann oder als Ermittler abgesehen hatte. Oder beides.
Obwohl er lieber ein saftiges Steak und dazu ein Bier zu sich genommen hätte, hatte er Isabelle die Wahl der Speisen überlassen. Schließlich hatte sie ihn eingeladen, und zudem war sie als Französin die Expertin. Es schmeckte köstlich, keine Frage, aber die ganzen Gänge, bei denen kaum etwas auf dem Teller war und jedes Mal das Besteck gewechselt werden musste – erst marinierte Flusskrebse, dann Entenlebercarpaccio und schließlich Wachtelfilets in Pflaumensoße – das alles war Stadler heute etwas zu viel. Sein Kopf schwirrte noch von den Vorträgen.
Isabelle hingegen schien vollkommen in ihrem Element zu sein. Sie plauderte angeregt, wollte alles Mögliche über seine Ermittlungen erfahren, über die Zusammenarbeit mit den Kollegen, über die Gründe, warum er Polizist geworden war. Von sich selbst erzählte Isabelle fast nichts, was daran liegen mochte, dass sie als Beamtin in einem kleinen Bergdorf vermutlich wenig Spektakuläres erlebte.
Stadler tunkte ein Stück Brot in den letzten Rest Soße auf seinem Teller und steckte es in den Mund. «So», sagte er, nachdem er geschluckt hatte. «Das war’s für mich. Ich schaffe keinen Bissen mehr.»
Isabelle verzog das Gesicht. «Kein Käse? Kein Nachtisch? Sie haben eine vorzügliche Tarte Tatin hier, habe ich mir sagen lassen. Es gibt auch Fondant au chocolat. Oder vielleicht Crème brûlée?»
Stadler hob abwehrend die Hände. «Nicht für mich.»
«Aber einen Kaffee?»
«Sehr gern.»
Als die Teller abgeräumt waren und sie beide an ihrem Kaffee genippt hatten, lächelte Isabelle ihn an. «Sie sind wirklich sehr geduldig.»
«Ach ja?»
«Sie haben nicht einmal gefragt, warum ich Sie hergelockt habe.»
Stadler leerte die Tasse. «Ich dachte, Sie fangen schon irgendwann davon an.»
«In Frankreich heißt es, dass man wichtige Verhandlungen nicht beim Essen führen soll. Oder zumindest nicht vor dem Hauptgang. Das gehört sich nicht.»
«Verhandlungen? Habe ich etwas verpasst?»
«Das Geschäftliche halt. Reden über den Anlass des Treffens.»
«Verstehe.»
«Also dann.» Isabelle tupfte sich mit der Serviette den Mund ab und lehnte sich zurück. «Ich bin seit zehn Jahren in Clairvaux, und mein einziger Toter war ein Angler, der am Seeufer einen Herzinfarkt erlitten hatte.»
«Nicht sehr spektakulär.»
«Sie sagen es. Natürlich gibt es Straftaten bei uns. Langeweile haben wir nicht. Aber das meiste sind Diebstähle, Einbrüche oder Verkehrsdelikte.» Sie zuckte mit den Schultern. «Zumindest war das bis vor zwei Wochen so.»
«Erzählen Sie.»
«Dazu muss ich etwas weiter ausholen. Begonnen hat es im vergangenen Herbst. Ein älteres Ehepaar, Touristen aus England, kam in die Gendarmerie. Die beiden waren vollkommen aufgelöst. Sie erzählten etwas von einem Wolfsmann, den sie im Wald gesehen hätten.»
«Einen Wolfsmann? Wirklich?»
«Ja. Eine große Gestalt, die aufrecht auf zwei Beinen lief, aber den Kopf eines Wolfs hatte. So beschrieben sie ihn.»
«Und?»
«Wir haben brav einen Bericht getippt, ihn abgeheftet und das Ganze vergessen. Die beiden hatten sich irgendwas eingebildet, dachten wir. Einen Schatten gesehen, zu tief ins Weinglas geschaut. Etwas in der Art. Aber dann berichtete im Winter eine Gruppe Wanderer aus der Schweiz etwas Ähnliches. Und kurz darauf machte sogar einer der Einheimischen Andeutungen, er hätte etwas gesehen, ein Wesen, halb Tier, halb Mensch.»
«Sind Sie der Sache nachgegangen?»
«Selbstverständlich. Ich habe mit dem Garde Champêtre gesprochen, dem Feldhüter. Der hatte die Geschichten auch schon gehört. Er wusste von einem Landstreicher, der sich in der Gegend herumtreibt. Ein knapp zwei Meter großer Mann mit langem Bart, der in Pelze gewickelt durch den Wald streift und irgendwo im Unterholz einen Unterschlupf hat. Bruno, der Garde Champêtre, war sicher, dass er es war, den die Leute gesehen haben. Ich machte einen Vermerk in den Akten und vergaß die Sache erneut. Bis vor zwei Wochen die Leiche einer Touristin gefunden wurde, einer jungen Dänin namens Liva Johansen. Sie lag in einer Schlucht am Ufer eines Bachs, war allem Anschein nach den Felsen hinuntergestürzt. Aber sie hatte merkwürdige Bisswunden am Körper.»
«Tierfraß ist doch normal.»
«Das haben die Kollegen von der Police Nationale auch gesagt. Aber es gab einige Unstimmigkeiten in dem Fall.» Isabelle sah ihn an. «Die Frau trug lediglich ihre Unterwäsche. Sie konnte überhaupt nur identifiziert werden, weil in der Nähe der Leiche ihr Büchereiausweis entdeckt wurde.»
«Sind die Sachen auch später nicht aufgetaucht?»
«Nein. Keine Spur. Weder von der Kleidung noch von ihrem sonstigen Gepäck. Sie ist Mitte April gestorben, etwa eine Woche bevor sie gefunden wurde. Da war es noch sehr kalt in den Bergen.»
«Dann litt sie vielleicht an Unterkühlung. Menschen ziehen sich manchmal aus, kurz bevor sie erfrieren, weil sie große Hitze empfinden. Eine paradoxe Reaktion auf die drohende Unterkühlung. In dem Fall liegen ihre Sachen woanders, viel weiter weg von der Leiche, als man annehmen würde.»
«Und die Bissspuren? Die waren gewaltig. Sie hätten sie sehen sollen. Das war kein Fuchs oder Marder. Ganz bestimmt nicht. Außerdem war da noch etwas: ein Abdruck auf ihrem Rücken. Er hatte die Form einer riesigen Wolfspfote, man konnte sogar die blutigen Kratzer sehen, wo die Krallen sich in die Haut gebohrt hatten.»
«Sie glauben, dieser mysteriöse Wolfsmann hat sie überfallen, entkleidet und totgebissen?» Stadler hob skeptisch die Brauen.
«Ich weiß nicht, was ich glauben soll», gab Isabelle zu.
«Was war denn die Todesursache?»
«Genickbruch. Laut offizieller Version verunglückte Liva Johansen, vermutlich weil sie zu nah an den Abgrund trat und das Gleichgewicht verlor.»
Stadler nickte nachdenklich. «Wurden die Bissspuren analysiert?»
«Nein.» Isabelle schaute in ihre leere Tasse. «Sie fragen sich, warum ich Ihnen all das erzähle.»
«Ehrlich gesagt, ja. Es liegt in der Verantwortung der französischen Polizei, Ihrer Kollegen von der Police Nationale, der Sache nachzugehen. Wie sollte ich Ihnen da helfen?»
«Ja. Schon klar.» Sie lächelte. «Ich schätze, ich wollte einfach mit jemandem darüber reden. Mir von einem Kollegen, der sich auskennt, bestätigen lassen, dass ich ein Phantom jage.» Sie winkte dem Kellner. «Trinken wir noch einen Absacker an der Hotelbar?»
Stadler blinzelte, überrascht darüber, dass Isabelle so rasch aufgab, nicht für ihre Theorie kämpfte. «Gern.»
Sie schlenderten durch den lauen Maiabend zurück zum Hotel, sprachen über die Tagung, aber nicht weiter über den Wolfsmann. An der Bar bestellte Stadler ein Bier für sich und einen Gin Tonic für Isabelle. Sie stießen an, nahmen einen Schluck.
Eine Weile schwiegen sie. Dann legte Isabelle ihm die Hand auf den Oberschenkel. «Wir könnten die Drinks mit hochnehmen. Was meinst du?»
Stadler umklammerte das Glas fester. «Lieber nicht.»
Sie rückte näher, so nah, dass ihre schwarzen Haare seine Wange streiften und er ihr blumiges Parfüm roch. «Sicher? Wir könnten unser Gespräch über den Wolfsmann vertiefen. Oder gar nicht reden, was immer dir lieber ist.»
Stadler stellte das Glas etwas zu abrupt ab. «Ich bin müde, sorry.»
Isabelle rückte ab und nickte. «Ihr Herz ist vergeben. Ich verstehe.»
«Unsinn», widersprach er, plötzlich verärgert. «Ich bin einfach total kaputt.»
«Ja. Natürlich.»
Er öffnete den Mund, um sich zu rechtfertigen, doch sie war schneller, winkte ab und rutschte vom Hocker. «Kein Problem, ehrlich. Ich gehe jetzt ins Bett. Allein. Sehen wir uns morgen beim Frühstück?»
Stadler schnappte nach Luft. Die abrupten Themenwechsel waren offenbar Teil ihres Spiels. Wäre er nicht so erschöpft und vom Alkohol benebelt, würde er es besser durchschauen.
«Ich frühstücke nicht. Ich trinke nur Kaffee», sagte er.
«Dann leisten Sie mir beim Frühstücken Gesellschaft. Es gibt da etwas, dass ich Ihnen noch nicht erzählt habe.»
«Über den Wolfsmann?»
«Etwas, das Ihre Sicht auf den Fall radikal ändern könnte.»
«Ach ja? Was denn?»
«Morgen, Georg Stadler.» Sie betonte den Namen auf der letzten Silbe, wie es im Französischen üblich war. Was charmant klang, wie er sich widerwillig eingestehen musste. In den vergangenen Stunden war ihm ihr Akzent kaum aufgefallen, aber jetzt bemerkte er ihn wieder ganz deutlich.
«Meinetwegen.»
«Wunderbar.» Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. «Bis morgen früh also. Schlafen Sie gut. Und versetzen Sie mich nicht.»
Samstag, 16. Mai
Bois de la Sambine, Département Jura, Frankreich
Es dämmerte gerade erst, der Morgen war noch blass und fahl, doch er musste los. Ein paar Stunden Schlaf waren das Äußerste, was er an Ruhe aushielt. Oft war er schon lange vor dem ersten Licht wach und lauschte den Stimmen des Waldes, dem vertrauten Rascheln, Knistern und Klopfen. Sobald es hell genug war, musste er aufstehen, sich bewegen, umherwandern, in seinem Revier nach dem Rechten sehen.
Hugo Montricher griff nach seinem Rucksack und stieß einen kurzen Pfiff aus, woraufhin Gaspard aus dem Busch hervorgekrochen kam, wo er die Witterung eines Eichhörnchens aufgenommen hatte.
«Auf geht’s, alter Junge. Wir laufen nach Westen. Schauen nach unserem Mädchen.»
Gaspard schien ihn zu verstehen, schlug ohne zu zögern die richtige Richtung ein, suchte sich einen Weg zwischen den Bäumen hinab ins Tal. Hugo folgte ihm mit langen, kräftigen Schritten. Etwa vierzig Kilometer waren es bis zu seinem Ziel. Wenn er ordentlich ausschritt, würde er am späten Nachmittag ankommen, eine Rast bei einem seiner Lebensmitteldepots eingerechnet.
Er blieb stehen und blickte in den Himmel. Das Grau verfärbte sich allmählich in zartes Blau. Regen würde es heute keinen geben, den hätte er gerochen. Ein guter Tag für die Eindringlinge, die Wanderer, die Touristen. Ein schlechter für ihn, denn er würde ihnen aus dem Weg gehen müssen. Regentage waren ihm lieber, da hatte er den Wald für sich. Aber immerhin war keine Jagdsaison. Die Jäger waren die Schlimmsten. Sie brachten das gesamte Land in Aufruhr. Während diese Unholde durch sein Revier trampelten und eine Spur der Zerstörung hinterließen, zog Hugo sich am liebsten ins Hochgebirge zurück. Dort gab es zwar weniger Bäume, die ihm Schutz boten, aber er hatte seine Ruhe. Denn so hoch hinauf kletterten die Jäger nicht, sie blieben im Tal, in der Nähe der Parkplätze, wo ihre dicken SUVs standen.
Hugo erreichte eine Senke, in der ein Bach floss, die Bienne, deren Lauf er nach Norden folgen würde, bevor er sich wieder nach Westen wandte, um den nächsten Berg zu erklimmen. Später würde er die Bienne ein zweites Mal überqueren, wenn sie bereits ein reißender Fluss geworden war und in ihrem schmalen steinigen Bett zurück nach Südwesten floss. Über die steile Schlucht, durch die sie sich dann fraß, gab es weit und breit nur eine einzige Brücke. Und ganz in der Nähe lag eins seiner Depots.
Bei dem Gedanken an die Schlucht fiel Hugo das Mädchen wieder ein. Sein letzter Besuch war schon eine Weile her. In den vergangenen Wochen hatte er sich viel an der Schweizer Grenze aufgehalten, im Bois de Péron und im Forêt du Massacre. Ein oder zwei Mal hatte er sich sogar über die Grenze gewagt, hatte die Dôle bestiegen und sehnsüchtig auf den See hinuntergeschaut, magisch angezogen von seiner unfassbar schönen bleigrauen Oberfläche.
Aber heute zog es ihn in die andere Richtung. Zu ihr. Zu Julie. Seinem kleinen Mädchen. Er nannte sie Julie, ihren richtigen Namen kannte er nicht. Als er sie entdeckt hatte, war sie noch fast unversehrt gewesen. Er hatte seinen üblichen Weg durch den Wald hinunter ins Tal des Forêt de la Crochère genommen und sie dort zwischen ein paar Felsbrocken auf einer Lichtung liegen sehen. Im ersten Moment hatte er gedacht, sie sei viel jünger, ein kleines Mädchen noch, kaum älter als Pauline. Erst beim Näherkommen hatte er erkannt, dass sie bereits erwachsen war, eine junge Frau mit schulterlangem braunem Haar und Augen von der gleichen erdigen Farbe.
Er hatte über ihre kalte Haut gestrichen, über ihr Gesicht, die Wangen, die so rosig ausgesehen hatten, als würde sie nur schlafen. Dann hatte er sich ganz eng an sie gekuschelt und an ihrer Seite so gut geschlafen wie seit Monaten nicht mehr.
Natürlich war ihm klar gewesen, dass er die Gendarmerie hätte verständigen müssen. Aber er hatte es nicht übers Herz gebracht. Sie sah so friedlich aus, so glücklich. Außerdem wollte er sie noch ein wenig für sich behalten. Nur ein paar Stunden. Ein paar Tage. Sie war ja ohnehin tot, also kam es nicht darauf an.
In Wahrheit gab es natürlich noch einen ganz anderen Grund, warum er niemandem etwas von ihr erzählt hatte. Er fürchtete, dass man es ihm anhängen würde. Dabei hatte er mit ihrem Tod nichts zu tun. Bestimmt war sie verhungert oder an Unterkühlung gestorben. Er hatte sie sich nicht näher angesehen.
Doch wenn die Polizei herausfand, wer er war, wenn sie von seiner Vergangenheit erfuhr, würde sie ihn beschuldigen, da war er sicher. Wer sich einmal an einem Mädchen vergriff, tat es immer wieder, so dachten sie doch. Dabei hatte er keine von ihnen verletzen wollen. Nur anfassen, nur streicheln, mehr hatte er nie gewollt. Und dann war es eben passiert. Das war doch nicht seine Schuld.
Aber das hatte ihm niemand geglaubt. Sie hatten ihm ja nicht mal zugehört, ihn einfach in dieses dunkle Loch gesperrt, wo er beinahe elend krepiert wäre. Und sie würden ihm auch diesmal nicht zuhören. Deshalb erzählte er niemandem von Julie. Sie war sein Geheimnis, sein kleines Mädchen. Wieder und wieder besuchte er sie auf seinen Streifzügen durch die Wälder, vergewisserte sich, dass sie noch da war, dass sie in Frieden schlief, dass kein anderer sie entdeckt und in ihrer Ruhe gestört hatte.
Bis auf die Tiere natürlich. Die ließen sich nicht fernhalten. Aber das störte ihn nicht. Nein, die Tiere sorgten bloß dafür, dass Julie für immer zu einem Teil des Waldes wurde.
Nahe Liverpool, England
Liz Montario spannte den Schirm auf und stemmte sich gegen den Regen. Was für eine Schnapsidee, sich hier draußen zu treffen! Aber vor einer Stunde, als sie den überraschenden Anruf von ihrer Freundin erhalten hatte, war der Himmel noch blau gewesen, von keinem Wölkchen getrübt, und Liz hatte gedacht, dass ihr ein Spaziergang an der frischen Luft guttun würde. Dabei wusste sie, wie schnell das Wetter umschlagen konnte, sie lebte schließlich schon lange genug in England.
Anouk hatte ihren Anschlussflug verpasst und saß für fünf Stunden in Liverpool fest. Da war ihr die Idee gekommen, sich bei Liz zu melden, die ja ganz in der Nähe wohnte. Also hatte Liz ihren gemütlichen Platz auf dem Sofa verlassen, wo sie es sich mit einer Kanne Tee und einem Buch bequem gemacht hatte, und war von Chester hierhergefahren.
Sie schaute sich um. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Früher war sie gern hier spazieren gegangen, vor allem, wenn ihr der Kopf von zu viel Arbeit am Schreibtisch geschwirrt hatte. Das kleine Naturschutzgebiet, wo der Weaver in den Mersey mündete, war so etwas wie eine Oase am Stadtrand von Liverpool. Wenn es auch nicht gerade still war, denn der Flughafen lag direkt am anderen Ufer.
Liz trat in eine Pfütze und fluchte leise. Zum Glück hatte sie ihre Gummistiefel angezogen. Jetzt sah sie eine Gestalt, die sich durch den Regenschleier näherte. Auch sie hielt einen Schirm in der Hand. Es war Anouk. Sie trug einen hellen Mantel, das blonde Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden.
«Hallo, Liz. Wie schön, dich zu sehen.» Sie nahm Liz in den Arm und drückte sie kurz. Anouk hielt nichts von allzu innigen Zuneigungsbekundungen.
«Ich freue mich auch. Wir haben uns viel zu lange nicht gesehen.»
Anouk hob den Schirm ein Stück an und betrachtete sie. «Du bist tatsächlich schwanger. Ich konnte es fast nicht glauben. Wie lange hast du noch?»
«Vier Wochen. Dabei habe ich jetzt schon das Gefühl, jeden Augenblick zu platzen.»
«Ich hätte nie gedacht, dich mal als Mutter zu sehen.»
«Ich auch nicht.» Liz grinste. «Aber ich freue mich darauf. Meistens jedenfalls.»
Anouk und sie hatten beide keine Kinder gewollt, sondern Erfüllung in ihrem Beruf gefunden. Das war einer der Gründe gewesen, weshalb sie sich auf Anhieb verstanden hatten, damals an der Düsseldorfer Uni. Liz hatte am Psychologischen Institut gearbeitet, Anouk war Molekularbiologin. Beide waren Außenseiterinnen, brillant in ihrem Fach, aber eher ungeschickt, was das Zwischenmenschliche anging. Zudem hatten sie weder eine Familie, noch waren sie die Art Frau, die gern auf Partys oder mit Freundinnen shoppen ging. Also hatten sie häufig ihre Mittagspause zusammen verbracht und über Gott und die Welt geplaudert.
Anouk sah sich um. «Nett hier, aber etwas nass.»
«Tut mir leid, war ’ne blöde Idee.»
«Ich bin doch diejenige, die dich rausgelockt hat», widersprach Anouk. «Ich muss mich entschuldigen. Also, was machen wir?»
«Wir könnten mit meinem Auto in den nächsten Pub fahren. Oder ein kleines Stück laufen, hinter dieser Baumgruppe kommt ein Unterstand, von dem aus man Wasservögel beobachten kann. Dort ist es trocken, und eine Bank gibt es auch.»
«Dann dorthin. Da haben wir unsere Ruhe.» Anouk wandte sich um und lief los.
Liz hatte Mühe mitzukommen. Schon bei Anouks Anruf hatte sie das Gefühl gehabt, dass es kein reiner Zufall war, dass die Freundin sich bei ihr gemeldet hatte. Der Kontakt war zwar in all den Jahren nicht ganz abgerissen, aber er hatte sich auf gelegentliche Nachrichten über die sozialen Netzwerke und eine Handvoll Mails beschränkt.
Sie erreichten den Unterstand, stellten die Schirme ab und blickten auf die Salzwiesen und den Mersey. Es war Ebbe, Vögel mit langen Schnäbeln stakten durch das Watt und suchten nach Beute.
«Wusstest du, dass ich als Kind Vogelkundlerin werden wollte?», fragte Anouk.
«Wirklich?»
«Deshalb habe ich Biologie studiert. Ich habe Vögel geliebt. Aber irgendwie bin ich dann in die Molekularbiologie gerutscht. Die Tiere waren mir zu real. Zu echt. Vielleicht war es mir auch einfach zu unbequem, immer nach draußen zu müssen. Die Arbeit im Labor liegt mir mehr.»
«Schade, als Ornithologin hättest du mich häufig besuchen können. Die Engländer beobachten für ihr Leben gern Vögel. Sie sind ganz verrückt danach.»
«Ich weiß.»
«Bedauerst du es manchmal? Ich meine, dass du nicht bei den Vögeln geblieben bist?»
«Bedauern wir nicht alle hin und wieder unsere Entscheidungen?», fragte Anouk zurück.
Liz zuckte innerlich zusammen. Sie näherten sich dem eigentlichen Thema, das spürte sie, dem Grund, weshalb Anouk nach all den Jahren aus heiterem Himmel angerufen hatte.
«Also», sagte sie. «Was hast du auf dem Herzen?»
Anouk seufzte. «Ich war in Dublin. Und da du mich ja sowieso durchschaust, gebe ich es gleich zu. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich den Anschlussflug gekriegt. Aber ich dachte, es wäre ein Wink des Schicksals.»
Liz sagte nichts, schaute weiter den Vögeln zu. Gerade zog einer etwas aus dem Watt, ein zweiter Vogel stürzte herbei und versuchte, seinem Kumpel die Beute streitig zu machen.
«Eli ist weg.»
Liz fuhr herum. «Deine Schwester? Weg? Aber wie ist das möglich?»
«Sie ist für ein Auslandssemester nach Dublin gegangen. Ans Trinity College. Ich habe versucht, es ihr auszureden. Ich kann ja verstehen, dass man ins Ausland geht, wenn man eine Fremdsprache studiert. Oder einen Platz an einer für sein Fach besonders renommierten Uni bekommt. Aber Eli studiert Musik. Sie ist gut, hat schon jede Menge Konzerte gegeben. Und sie ist fast fertig. Warum musste sie unbedingt an eine andere Uni, so kurz vor dem Abschluss?»
«Komm, wir setzen uns.» Liz deutete auf die Bank. «Dann kannst du es mir in Ruhe erzählen.»
«Da gibt es nicht viel zu erzählen.» Anouk trat zur Bank und ließ sich auf der Kante nieder. «Sie wollte ins Ausland, meinte, es wäre besser für ihre Karriere. Es schien auch gut zu laufen, im Juli wollte sie zurückkommen nach Düsseldorf.»
«Und? Was ist geschehen?» Liz setzte sich ebenfalls. Ihr war plötzlich kalt.
«Eli ist über Ostern mit einer Freundin in Urlaub gefahren. Normalerweise haben wir eine Vereinbarung. Wenn sie unterwegs ist, schickt sie einmal am Tag ein Lebenszeichen. Eine kurze Nachricht über Telegram genügt. Aber dieses Mal hatten die beiden vor herumzureisen, und Eli wollte frei sein von Verpflichtungen. Mir war das gar nicht recht. Ich weiß gern, dass es ihr gutgeht, schließlich haben wir nur noch uns.»
Liz nickte. Sie wusste, dass die Mädchen den Vater verloren hatten, da war Eli gerade ein Jahr alt, ihre mittlere Schwester Malou drei und Anouk zehn. Malou lebte inzwischen ebenfalls nicht mehr, sie war mit fünfzehn an Leukämie gestorben. Seit ein paar Jahren war auch die Mutter tot.
«Das verstehe ich gut», sagte sie.
«Ich habe eingewilligt, ich wollte, dass Eli ihre Reise genießt. Anfang April ist sie aufgebrochen. Seither habe ich zwei Nachrichten über Telegram bekommen, beide Anfang Mai, als sie schon längst wieder in Dublin hätte sein sollen, und beide ziemlich merkwürdig, untypisch für Eli. Ich habe angerufen, es geht immer sofort die Mailbox an. Ich habe ihr Nachrichten geschickt. Keine Antwort. Die Vorlesungen haben längst wieder angefangen, sie ist seit fast drei Wochen überfällig. Ich kann mir das nicht erklären, ich mache mir Sorgen, deshalb bin ich nach Dublin geflogen.»
«Und?» Die Kälte war Liz bis tief in die Knochen gekrochen. Auch das Baby schien sie zu spüren, es protestierte strampelnd. Liz legte beruhigend die Hand auf den Bauch, streichelte das kleine Füßchen, das sie deutlich unter ihren Fingern spürte. Obwohl sie den Arzt gebeten hatte, ihr nicht zu verraten, ob es ein Mädchen oder Junge war, glaubte sie zu wissen, dass sie eine Tochter erwartete, und nannte sie Mia.
Alles gut, meine Kleine, sagte sie in Gedanken zu ihr. Du bist in Sicherheit.
«Niemand hat Eli seit ihrer Abreise gesehen oder von ihr gehört», sagte Anouk. «Ihre Mitbewohnerin im Studentenwohnheim hat keine Ahnung, wo sie steckt.»
«Und die Freundin, mit der sie verreist ist?»
Anouk senkte den Blick. «Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht einmal, wie sie heißt.» Sie ergriff Liz’ Hand und sah sie an, ihre Augen schimmerten feucht. «Die irische Polizei hat mich weggeschickt, die nehmen mich nicht ernst. Eli ist erwachsen, haben sie gesagt, sie kann so lange in Urlaub fahren, wie sie will. Aber ich weiß, dass etwas passiert sein muss. Was soll ich nur tun? Hilf mir, Liz, bitte!»
Clairvaux-les-Lacs, Département Jura, Frankreich
Als Georg Stadler das Ortsschild passierte, brannten ihm die Augen vor Müdigkeit. Sieben Stunden hatte er gebraucht von Amsterdam bis Clairvaux-les-Lacs, trotz Stau bei Brüssel und bis auf die Tankstopps ohne Pause.
Er ließ den Mustang durch den kleinen Bergort rollen, hielt nach dem Hotel Ausschau, das irgendwo auf der linken Straßenseite kommen musste. Es lag auf der Kuppe, direkt neben der Kirche. Stadler parkte und schloss für einen Moment die Augen. Vor seinem inneren Auge erschien ein flammendes Straßenband. Bestimmt würde er heute Nacht einen Albtraum haben, in dem eine endlose Abfolge von Bäumen rechts und links an ihm vorbeischoss.
Trotzdem bereute er seine Entscheidung nicht. Es war ein spontaner Impuls gewesen, als er auf der Autobahn kurz hinter Amsterdam das Schild nach Antwerpen gesehen hatte. Ohne darüber nachzudenken, hatte er seinen Mustang statt nach Deutschland in Richtung Frankreich gelenkt.
Ihm war bewusst, dass Isabelle Hernier höchstwahrscheinlich genau das beabsichtigt hatte, dass sie ihn aus der Ferne manipulierte. Aber das war ihm egal. Irgendetwas stimmte nicht. Mit der französischen Polizistin und dem Dorf in den Bergen, in dem sie die Gendarmerie leitete. Er würde der Sache auf den Grund gehen. Es war schließlich Wochenende. Was er in seiner Freizeit tat, war seine Angelegenheit. Wenn das Ganze sich als Luftnummer entpuppte, würde er Montagmorgen an seinem Schreibtisch sitzen, als wäre nichts geschehen, und niemandem ein Wort davon erzählen.
Davon abgesehen schuldete die Polizistin ihm eine Erklärung. Sie war am Morgen nicht im Frühstücksraum erschienen. Drei Tassen Kaffee hatte Stadler getrunken und auf seinem Smartphone die Zeitung gelesen, während er auf sie gewartet hatte. Dann war er zur Rezeption gegangen und hatte sich nach ihr erkundigt.
Zu seinem maßlosen Erstaunen hatte Isabelle Hernier bereits am Vortag ausgecheckt, und zwar am Morgen noch vor Beginn der Vorträge. Sie hatte gar nicht mehr im Hotel übernachtet, und es auch nie vorgehabt.
Stadler hatte daraufhin gegoogelt und halb damit gerechnet, dass auch die abenteuerliche Geschichte vom Wolfsmann, die Isabelle ihm aufgetischt hatte, gelogen gewesen war. Doch das stimmte nicht. Er hatte einige kurze Berichte über die verunglückte dänische Touristin gefunden, und auch einen über Gerüchte von einem wolfartigen Untier, das die junge Frau ermordet haben soll. Leider waren alle Artikel auf Französisch verfasst gewesen, sodass Stadler mit seinen rudimentären Kenntnissen der Sprache nur ein paar Brocken verstanden hatte.
Er straffte die Schultern und stieg aus. Das Hotel verfügte offenbar auch über ein Restaurant. Stühle standen unter dem Vordach, an einem Tisch in der Ecke saß ein einzelner Gast vor einer winzigen Tasse Kaffee, ein alter Mann mit grauem Bart und Pfeife im Mundwinkel. Schräg gegenüber gab es zudem eine Bar, ein großes Schild pries internationale Biersorten an. Stadler nickte zufrieden. Genau das, was er brauchte. Aber später. Zuerst wollte er Isabelle finden.
Er buchte ein Zimmer und fragte dann nach der Gendarmerie. Aus dem Wortschwall der Rezeptionistin schloss er, dass er die Polizeiwache bereits auf dem Weg zum Hotel passiert haben musste, um diese Zeit jedoch ohnehin niemand





























