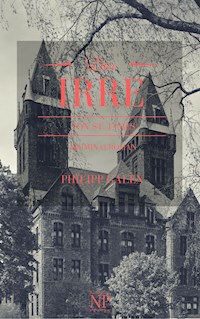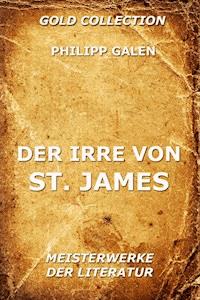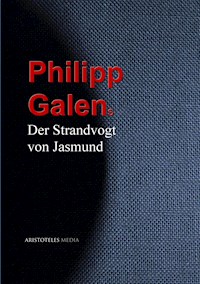Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Strandvogt von Jasmund" ist ein historischer Roman aus der Zeit der Napoleonischen Kriege. Protagonist ist der Strandvogt Waldemar Granzow, also eine Person, der küstennah auf dem Land besondere Rechte und Pflichten übertragen sind, auf der Halbinsel Jasmund bei Rügen. Nach dem Sturm auf das von den Franzosen besetzte Stralsund rettet Waldemar seinen Jugendfreund Magnus aus dem Kerker und versteckt ihn auf Rügen vor den suchenden Besatzern ....
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1317
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Strandvogt von Jasmund
Geschichtliches Lebensbild aus der Okkupationszeit der Insel Rügen durch die Franzosen von 1807-1813.
Philipp Galen
Inhalt:
Der Strandvogt von Jasmund
Erster Band
Einleitung.
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zweiter Band
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Dritter Band
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Vierter Band
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Schlußkapitel.
Der Strandvogt von Jasmund, P. Galen
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849629977
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Der Strandvogt von Jasmund
Erster Band
Einleitung.
Rügen! Du wunderbar gestaltete Insel des schönen baltischen Meeres, von der Natur schon so reich mit zauberischem Reiz bedacht und jetzt auch geschmückt mit den Zierden der Kunst, die ein hochsinniger Fürst auf deinen Boden verpflanzt – mit einem heiligen Schauer der Erinnerung betreten wir deinen von zahllosen Dichtern besungenen Strand! Vom brausenden Meere, das dich in seiner unbegreiflichen Laune bald vergrößert, bald zerstückt, in tausend Fetzen zerrissen, durchwühlt von tausend Stürmen, welche die Elemente wie die Leidenschaften der Menschen über dich haben ergehen lassen, getränkt von Blut, in grausigen Schlachten von wilden und zivilisierten Nationen vergossen, einst der Tummelplatz der düsteren Gestalten eines zurückschreckenden Heidentums, jetzt das Land des Friedens und der heilbringenden Ruhe – zu dir, ja zu dir flüchten wir aus der Mitte unserer von Rauch und Nebel einer unbezähmbar dahinstürmenden Kultur und dem tumultuarischen Gewoge übervoller Städte so gern, so oft, um aus deinen balsamischen Lüften einen reinen Atemzug zu schöpfen und von deinen zerklüfteten Felsen, auf denen der Schatten jahrhundertalter Wälder lagert, einen Blick über das unermeßliche Meer zu werfen, welches die deutschredenden Kinder von ihren skandinavischen Brüdern und den Bewohnern der russischen Steppen trennt! –
Doch bevor wir unsere Leser auf bestimmte Punkte dieser so oft genannten und doch immer noch wenig gekannten Insel führen und ihnen einige Personen vorstellen, die, ebenso einfach zwar in ihrer Erscheinung und Handlung, wie unbedeutend an Rang und Lebensstellung, doch mit den letzten Kriegsschicksalen Rügens eng verflochten waren, wollen wir denjenigen welche nur wenig von den geographischen und geschichtlichen Merkwürdigkeiten des kleinen Eilands wissen, einen allgemeinen Ueberblick über beides geben; der unterrichtete Leser dagegen verzeihe uns diese Einleitung, die nicht notwendig zu unserer Erzählung gehört, überschlage sie und richte seine Aufmerksamkeit erst auf das nächste Kapitel, welches ihn in die Mitte der Personen und Ereignisse leiten wird, die zu schildern in unserer Absicht liegt.
Wenn man aus der Vogelschau herab einen Blick über das kleine Eiland in Rede werfen könnte, so würde man inmitten eines gewaltigen Wasserbeckens, das nur an der Südwestseite, wo es die deutschen Küsten bespült, einen schmalen Seegürtel bildet, einen wunderbar gestalteten, grün und grau gefärbten Erdenfleck wahrnehmen können. Man würde ein Stück Land sehen, welches, wenn es zu einem Ganzen vereinigt wäre, sich ungefähr sechs Meilen in die Länge und Breite dehnt und von Westen an sich allmählich erhebend, an der Nordostküste die höchste Höhe erreicht, wo es mit seinen schroffen Kreidefelswänden plötzlich in die wogende See abstürzt. Ein Stück Land, das, vom grollenden Meere umflutet, in unbeschreiblich viele und kleine Inseln, Halbinseln und Werder zerrissen ist, in die das mächtigste der Elemente wie ein nimmersatter Verwüster eindringt, die es zerfrißt, zerstückelt und dadurch Buchten, Meerengen und Binnengewässer erzeugt, wie wir sie in ähnlicher Menge und Gestaltung fast auf keiner der zahllosen Inseln der großen Ozeane antreffen.
Dieser kleine Erdenfleck nun bietet unserem verwunderten Auge einen ganz eigentümlichen und höchst mannigfaltigen Anblick dar. Von des blauen Meeres weiten Armen umschlungen, gewahren wir weite grüne Saatfelder, einige saftige Anger und Wiesenflecke, dann und wann dunkelschattige Wälder, abwechselnd mit eintönigen stillen Moorgründen, und zwischen alle diese eine unzählbare Menge von Städten, Flecken und Dörfern, Höfen und einzelnen Landwohnungen eingestreut. Tausend fleißige Hände schaffen und weben auf diesem kleinen Raum und bemühen sich, bald dem Lande, bald dem Meere seine Schätze zu entlocken; zufrieden mit ihrem bescheidenen Erdenlose, einsam dem Gewoge der brüllenden See und dem tosenden Sturmwinde ausgesetzt, die ihre Kräfte und ihren Mut jeden Augenblick in Anspruch nehmen, sind sie abgehärtet gegen alle Gefahr und haben es gelernt, mit Herz und Hand allen feindlichen Elementen zu trotzen. Hauptsächlich mit aus diesem Grunde bewahren sie, so weit von ihren deutschen Brüdern abgetrennt, die Sitten der Väter in fast allzu treuer Weise und genießen auf ihre Art das Leben mit so zufriedenem Gemüte, als wäre ihnen der reichste Besitz im sicheren und bequemen Festlande zuteil geworden.
Wenden wir uns jetzt zu der Geschichte dieses kleinen Eilandes und überfliegen wir mit wenigen Worten die verschiedenen Zeitepochen, die zu der Gestaltung des Charakters von Land und Volk, wie wir beides noch heute vorfinden, ohne Zweifel sämtlich beigetragen haben.
Aber da begegnet uns zunächst eine düstere, von den Schrecken des Heidentums umnachtete und mit den Täuschungen der Fabel reich ausgestattete Zeit. Die Phantasie des Menschen, wir können es allerdings nicht leugnen, hat auf Rügen wunderbare Dinge geschaffen, und die Poesie hat sich derselben bemächtigt und ihnen einen Schein der Wahrheit umgehängt, wie man eine häßliche hölzerne Figur mit einem kostbaren Mantel drapiert und ihr dadurch das Ansehen eines lebenden Organismus gibt. Die ruhigen Forschungen klarsehender Gelehrten aber haben nachgewiesen, daß das Reich der Fabel hier weit geöffnet ist, und daß von allem Göttlichen, Heldenartigen und Wunderbaren nur sehr Weniges auf dieser kleinen Insel die Probe der Wahrheit verträgt. Aber auch abgesehen von diesen der Phantasie und Poesie angehörenden Fabeln ist Rügen schön, seltsam und merkwürdig genug, und wir werden später noch Gelegenheit haben, die Reize des blitzenden Meeres zu bewundern, das sich bald kosend und spielend an seine Seite schmiegt, bald brüllend und donnernd feine Dünen peitscht, oder uns an der Pracht seiner Wälder und wunderbar gestalteten Felsen zu ergötzen, zwischen denen sich seltsame Grabstätten, ungeheure Leichenfelder und riesige Totenhügel gruppieren, die kurzsichtigen Menschen den Glauben eingeflößt haben, als seien die früheren Bewohner jener Landesteile an Gestalt und Kraft selbst Riesen gewesen.
Doch wir wollten von der ältesten Geschichte Rügens sprechen, die sich tief in das Schattenreich der Mythen verliert. Die folgenden historischen Einzelheiten bis zur Zeit der Invasion der Franzosen sind teils dem ebenso interessanten wie geistreichen Werke: die Insel Rügen, Reise-Erinnerungen von Ernst Boll, entnommen, welches nachzulesen ist, wenn man noch speziellere Data aus der Rügenschen Geschichte zu hören verlangt, teils Grümbles vortrefflichen Darstellungen der Insel Rügen und Biesners Abriß der Geschichte Pommerns und Rügens entlehnt, obgleich wir verschiedene Bemerkungen auch manchem andern Schriftsteller verdanken, deren Namen zu nennen uns hier zu weit führen würde. Der Verf. Die ältesten Spuren der Bewohner der Insel deuten ohne Zweifel auf das slavische und noch vorslavische Heidentum hin und noch heute finden wir diese Spuren in fast zahlloser Menge in Gestalt, von Tempel- und Burgwallruinen, Opfersteinen, Gerichtsstätten, sogenannten Hünengräbern und verschieden geformten Begräbnisstätten auf. Wer die ältesten dieser uralten Ueberbleibsel hinterlassen, wissen wir nicht, die späteren Reste aber stammen sicher von den zum slavischen Volksstamme gehörigen Ranen her, die ein im ärgsten Heidentum verstricktes und blutdürstiges Seeräubervolk waren, das schrecklich gestaltete Götzenbilder anbetete, selbst nicht vor Menschenopfern zurückbebte, auf Arcona aber seinen Haupttempel hatte und von dort aus seine Herrschaft über die ganze Nachbarschaft ausdehnte.
Diese beutelustigen Ranen sollen die Dänen im Jahre 1100 sich zinspflichtig gemacht und sogar durch einen Statthalter beherrscht haben, aber selbstverständlich ging diese Unterwerfung nicht ohne Kampf und Blutvergießen ab, und offene Empörung, die nur zu neuen Kämpfen führte, war die nächste natürliche Folge davon.
Bei diesen Ranen nun hielt sich der heidnische Kultus am längsten in Norddeutschland, den selbst Karls des Großen Sohn, Ludwig, als er das rügensche Land dem heiligen Veit im Kloster Corvey weihte, nicht auszurotten vermochte. Selbst das gottgeweihte Streben des Bischofs von Bamberg, der im Jahre 1124 von Usedom und Wollin aus das Christentum auf die Insel zu verpflanzen versuchte, scheiterte an der Ungunst des nordischen Sturmwetters, das ihn wiederholt von der Landung abhielt, wie es auch dem Dänenkönig Erich III. nach der Eroberung von Arcona mißglückte, durch Einsetzung eines christlichen Bischofs den Svantevit-Kultus ganz auszurotten. Endlich aber gelang es den Dänen doch, den widerstrebenden Nacken der alten Götzendiener unter die sanftere Herrschaft des Christentums zu beugen.
Im Jahre 1168 landete der Dänenkönig Waldemar in Gemeinschaft der Pommernfürsten Bogislav und Kasimar, des Bischofs Absalon von Roschild und des Bischofs Berno von Schwerin an verschiedenen Küstenpunkten, belagerte die Tempelfeste Arcona, nahm sie ein und stürzte den Götzen Svantevit, worauf sich die Ranen unterwarfen und das Christentum annahmen, zu dessen segensreicher Verbreitung aus Dänemark gesandte Priester das Meiste beitrugen.
Bald darauf aber entspann sich ein Streit unter den Besiegern der Ranen, dessen blutige Entscheidung zum Teil wieder auf rügianischem Boden ausgefochten wurde. Die Pommernfürsten mit dem mächtigen Sachsenherzoge Heinrich dem Löwen im Bunde, fielen in Rügen ein, unternahmen Raubzüge nach Dänemark unter Beistand des Obotritenfürsten Pribislav, wobei anfänglich sowohl die Rügianer wie die Dänen Niederlagen erlitten, indem König Waldemar dem Sachsenherzog die Hälfte der erbeuteten Tempelschätze, der Geißeln und des jährlichen Tributes der Ranen abtreten mußte. Als nun aber König Waldemars Nachfolger Knud im Jahre 1182 sich übermütig gegen den deutschen Kaiser erwies, der Heinrich des Löwen Macht gebrochen, stiftete jener den Pommernherzog Bogislav an, Rügen noch einmal durch einen Eroberungskrieg zu bedrohen, der aber so unglücklich ausfiel, daß Bogislav geschlagen wurde und sein eigenes Land unter dänische Herrschaft geriet. Der Ranenfürst Jaromar aber erhielt außer seinem eroberten Lande Tribsees durch Knud noch mehrere pommersche Landstriche, die Bogislav abtreten mußte, so daß jetzt seine Herrschaft außer der Insel den größten Teil des jetzigen Neuvorpommerns umfaßte, was insgesamt mit der Insel vereint den Namen Fürstentum Rügen erhielt.
Jaromar hat für Rügen sehr segensreich gewirkt. Er rief deutsche Ansiedler in sein durch die vielen Kriege von Menschen gelichtetes Land, kräftigte die junge christliche Kirche, stiftete das Cistercienserkloster zu Bergen und war außerdem auf die Hebung der Landwirtschaft bedacht.
Unter seinem Sohne Wizlav I. versuchten es die Pommerfürsten, sich im Jahre 1227 des entrissenen Landteiles wieder zu bemächtigen, was ihnen auch teilweise gelang. Von Dänemarks Hilfe verlassen, dessen König durch die Schlacht bei Bornhöved in Holstein seine Oberherrschaft im nördlichen Deutschland eingebüßt hatte, sah sich Wizlav nach einer anderen Hilfe um, die er auch in dem reichen Vetternkreise fand, der ihm durch seine Verheiratung mit Margarethe, der Tochter des Herzogs von Braunschweig und Lüneburg, Heinrichs des Löwen Urenkelin, zuteil geworden war. Auf diese Weise löste sich das Band mit Dänemark; indessen erst 1438 entließ König Erich die Insel ihrer Lehnspflicht.
Unter Wizlav II. erhielt der Abt des Cistercienserklosters zu Campe bei Stralsund die Insel Hiddens-öe geschenkt, worauf daselbst ein Kloster dieses Ordens gegründet ward. In seinem Testamente gab er seine leibeigenen Sklaven frei.
Unter Wizlav des III. Regierung im Jahre 1317 suchten die Stralsunder die Insel durch einen feindlichen Einfall heim, er selbst rettete sich auf seine uneinnehmbare Burg Rügegard (Rugard). Mit dem ihm verwandten pommerschen Herzog schloß er einen Erbvertrag, infolge dessen Rügen an die Herrschaft der Pommern kam, trotzdem seine nächste Erbberechtigten, die Herren von Putbus und Gristow, die von Erich VII. von Dänemark schon 1309 auf die Halbinseln Jasmund und Wittow die Anwartschaft erhalten, Ansprüche auf den alten Familiensitz hatten.
Von dieser Zeit an bis 1637, also drei volle Jahrhunderte, fließt nun die Geschichte der Insel Rügen mit der des Herzogtums Pommern zusammen, was inbezug auf die Gesittung und den geistigen Fortschritt der Insel von überaus großem Einflusse war, da während dieser Zeit die Germanisierung der Insel mit Riesenschritten vorwärts ging, indem teils neue Kolonisten daselbst ihren Einzug nahmen, teils die noch übrigen Slaven sich diesen in Sprache und Sitte nach und nach völlig gleichstellten. Schon im Jahre 1404 starb auf Jasmund Frau Gulitzin, die letzte Rügianerin, die wendisch reden konnte.
Das wendische Recht dagegen erhielt sich noch Jahrhunderte lang auf der Insel lebendig, welches die Rügianer dem dänischen und schwerin'schen vorzogen, welches erstere sich durch die dänische Herrschaft einbürgerte, das letztere aber durch sächsische Kolonisten und durch kirchliche Verbindung, des festländischen Teils des Fürstentums Rügen mit dem schwerinschen bischöflichen Sprengel in Uebung kam. Durch einen Mann wendischen Stammes, den Landvogt Waldemar, Herrn von Putbus, kam das wendische Recht zur Geltung, der das Bedürfnis fühlte, die dortigen verwickelten Rechtsverhältnisse zu regeln, indem unter dem Einfluß derselben allerlei Gewalttat, Mißbrauch und Unfug sich auf der Insel eingeschlichen hatte.
Im Jahre 1536 wurde die Reformation auf der Insel eingeführt und die katholischen Geistlichen, die sich der neuen Ordnung der Dinge nicht fügen wollten, ihrer Aemter entsetzt oder anderweitig, versorgt.
Auf die vielen blutigen Scharmützel, die Rügens Bewohner von Zeit zu Zeit mit ihren händelsüchtigen festländischen Nachbarn zu bestehen hatten, folgte 1628 die Geißel des dreißigjährigen Krieges. In diesem Jahre besetzte der kaiserliche Oberst Götze die Insel und störte von dort aus unablässig Handel und Schiffsverkehr mit Stralsund, das Wallenstein vergebens zu erobern gesucht hatte. Um diesem Uebelstande ein Ende zu machen, wandte sich die Stadt endlich mit der Bitte um Beistand an den mit ihr Verbündeten König von Schweden, der nun durch seine Truppen die Insel Hiddens-öe und die alte Fähre einnehmen und besetzen ließ. Das war der Anfang einer traurigen Zeit für die stillen Inselbewohner. Der Oberst Götze machte einen Angriff auf die schwedischen Besatzungstruppen, und da dieser fehlschlug, gab er die ganze Insel seiner wilden Soldateska preis, was gräßliche Szenen im Gefolge hatte. Allein bald darauf wurden die Kaiserlichen wieder von den Schweden vertrieben und von ihnen unter Gustav Adolf, dem nordischen Helden, die Insel behauptet. So war denn Rügen für die Pommerfürsten verloren, und daher erklärt es sich, daß Herzog Bogislav XIV. noch in demselben Jahre, mit Genehmigung und unter Vermittlung des deutschen Kaisers, die Insel dem König von Dänemark zum Kaufe anbot. Allein Gustav Adolf ließ die willkommene Beute nicht wieder fahren, schaltete mit ihr, wie mit einem angestammten Besitztum und verpfändete Domanial- und Klostergüter, um Geld zur Kriegführung in Deutschland zu erlangen. Durch diese schwedische Okkupation blieb Rügen fernerhin vor den Verwüstungen der kriegführenden Parteien bewahrt, während die festländischen Nachbarländer von den Gräueln des unnatürlichsten Krieges verwüstet wurden.
Mit diesen Ereignissen fiel das Erlöschen des pommerschen Fürstenhauses im Jahre 1657 zusammen, infolge dessen abermals sich ein Zwist um das erledigte Herzogtum entspann, indem die rechtlichen Ansprüche des Kurfürsten von Brandenburg von den Schweden und Kaiserlichen zugleich bestritten wurden. Letztere, die den Besitz Rügens erkämpfen und zuerst sich Rügens bemächtigen wollten, wurden zweimal durch die Ungunst der Witterung von der Insel abgeschnitten, und beim dritten Versuche erlitten sie durch die Schweden einen solchen Verlust, daß sie sich eiligst nach Mecklenburg zurückziehen mußten.
Erst im Jahre 1684 klärte sich der interimistische Zustand der viel heimgesuchten Insel auf. Denn nachdem die angeblichen Ansprüche des Klosters Corvey zurückgewiesen waren, das in der Person seines Abtes Arnolds IV. den Kurfürsten von Brandenburg mit der Insel als Corveysches Lehn beglücken wollte, welches Glück dieser zurückwies, kam man im westfälischen Frieden überein, Schweden, als im faktischen Besitze der Insel, denselben für ewige Zeiten zuzuerkennen, während sich der Kurfürst von Brandenburg mit Hinterpommern begnügen mußte.
So blieb denn Vorpommern und Rügen etwas länger als 150 Jahre in den Händen der damaligen Großmacht Schweden, welches die privaten Grundbesitzerverhältnisse beinahe gänzlich unangetastet ließ, und es scheint für unsere folgende Erzählung nur erwähnenswert, daß der schwedische Feldmarschall Wrangel 1649 mit der durch Tod erledigten Herrschaft Spyker belehnt wurde, welche, als auch dieser kinderlos starb, 1676 an die schwedischen Grafen Brahe überging, von denen sie schließlich wieder 1816 der Fürst Malte von Putbus durch Kauf erwarb.
In den heftigen Kriegen aber, die Schweden am Ende des siebzehnten Jahrhunderts mit seinen gewaltigen Nachbarstaaten zu bestehen hatte, wurde der Kampfplatz wiederholt auf die kleine Insel verlegt und diese durch allerlei Verwüstung hart heimgesucht. So eroberten sie z. B. die Dänen 1677 im Kriege Schwedens mit dem großen brandenburgischen Kurfürsten, verloren sie aber im folgenden Jahre wieder an die Schweden. Diesen nahmen sie 1678 wieder die Dänen und der Kurfürst Friedrich Wilhelm durch den Feldmarschall Dörflinger ab. In dem Frieden zu St.-Germain aber, den der Kurfürst durch den intriguanten Einfluß Ludwigs XIV. schließen mußte, ward sie den Schweden nochmals ausgeliefert.
Zum letzten Male im vorigen Jahrhundert nun wurde die kleine Insel durch den nordischen Krieg heimgesucht. Obgleich Karl XII. sie stark besetzt und mit vielen Schanzen befestigt hatte, so landeten dennoch am 15. November 1715 die Preußen und Dänen bei Stresow unter der Anführung des alten Dessauers, verschanzten sich daselbst und bemächtigten sich von hier aus, nachdem Karl XII. zurückgeschlagen, der ganzen Insel, welche nun die Dänen bis zum Friedensschlusse behielten. Durch diesen aber fiel sie zuletzt an Schweden zurück, und erfreute sich nun längere Zeit einer wohlverdienten Ruhe, indem sie in die Strudel des siebenjährigen Krieges nicht hineingerissen wurde, sondern während desselben als ein Zufluchtsort für die mecklenburgischen Truppen diente.
Fast hundert Jahre nun sah Rügen keine feindlichen Truppen auf seinem Boden, während welcher Zeit sie unter dem milden Szepter der schwedischen Regierung sich von ihren Leiden erholte und mancherlei innere Verbesserungen erfuhr, indem König Gustav IV. Adolf die Leibeigenschaft mit allen Frohn- und Zwangsdiensten aufhob, wozu unser ehrwürdiger Vorkämpfer in allen die persönliche Freiheit betreffenden Dingen, Ernst Moritz Arndt, durch seine Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen den hauptsächlichsten Anstoß gegeben haben soll.
Nach der unglücklichen Schlacht bei Jena aber, durch welche ein großer Teil des nördlichen Deutschlands in die Hände der Franzosen geriet, besetzten diese das ganze preußische Pommern, auch Stettin, während nur Colberg heldenmütig widerstand. Bei der Annäherung eines französischen Streifkorps verließen die Schweden das Herzogtum Lauenburg und zogen sich nach Pommern zurück, wo sie von Zeit zu Zeit durch die Franzosen beunruhigt wurden, indem diese z. B. von Wolgast allein tausend Louisd'or Kontribution erpreßten, weil es den Preußen den Durchmarsch gestattet hatte. Gegen den damaligen König von Schweden hegte Napoleon vor allen einen heftigen Groll, denn dieser schlug nicht nur wiederholt seine Friedensvorschläge aus, sondern wies auch die ihm zur Pflicht gemachte Neutralität gegen die anderen Mächte zurück, trotzdem Napoleon ihm eine Gebietsvergrößerung und andere wichtige Vorteile versprach. Diesem trotzigen Widerstande, den der siegreiche Corse bei den mit ihm Krieg führenden Monarchen nicht zu finden gewohnt war, mußte die Strafe auf dem Fuße folgen, und so ging Marschall Mortier mit 12+000 Mann bei Demmin und Anclam über die Peene und drängte die Schweden bis Stralsund zurück.
Hierdurch kam Schwedisch-Pommern in lange nicht erlebte Not. Requisitionen folgten auf Requisitionen und die ganze französische Armee mußte von dem Lande unterhalten werden.
Indessen war Mortier nicht stark genug, Stralsund ordentlich zu belagern, namentlich fehlte es ihm an schwerem Geschütz, das bei den schlechten Wegen nicht so leicht herbeizuschaffen war. So schloß man es nur ein und erschöpfte sich auf beiden Seiten in mutigen Gefechten, bis der schwedische Generalgouverneur Essen, als ein Teil der französischen Armee nach Polen beordert ward, die Gelegenheit benutzte und am 1. April 1807 einen Ausfall machte, worauf sich der Rest der Franzosen bis Greifswald und zuletzt über die Peene zurückzog.
Da nun die Franzosen einsahen, daß sie hier mit so schwachen Kräften nicht viel ausrichten konnten und dafür den kleinen Krieg mit um so gehässigerer Brutalität führten, so versuchte es Napoleon noch einmal, den Schwedenkönig durch glänzende Anerbietungen zu ködern. Allein auch diesmal wies Gustav IV. Adolf das kaiserliche Geschenk als eines Königs unwürdig zurück.
Mit den Truppen aus Schweden besetzten nun zugleich auch die Hannoveraner das kleine Rügen, die England – zufolge einer Uebereinkunft – den Schweden als Beistand zuführte; allein nur auf kurze Zeit, denn alsbald gingen sie nach Kopenhagen, um Dänemark für die Bundesgenossenschaft mit Napoleon durch die Beschießung seiner Hauptstadt zu strafen.
Nach der Schlacht bei Friedland endlich kam der Friede zu Tilsit am 9. Juli 1807 zustande. Obgleich nun Alexander dem Könige von Schweden anbot, an diesem Frieden ohne irgend eine Aufopferung teilzunehmen, so schlug doch der eigensinnige Gustav IV. Adolf auch dies Anerbieten aus, und noch dazu in einem Augenblick, wo Napoleon keinen Feind mehr in Waffen auf dem festen Lande hatte. Dafür rückten unter General Brüne einige französische Armeekorps, zur Beobachtung, wie es hieß, an die schwedische Grenze, und da eine Zusammenkunft Gustavs mit Brüne keinen Erfolg hatte, kündigte Schweden den Waffenstillstand gegen Frankreich auf.
So rückte denn Marschall Brüne mit 60+000 Mann bei Anclam und Damgarten in Schwedisch-Pommern ein und drängte die Schweden bis unter die Wälle Stralsunds zurück, woraus allen schwedischen Städten, namentlich Greifswald, eine harte Begegnung zuteil ward.
Die französische Armee rückte nun, mit Belagerungsapparaten, die die pommerschen Wälder liefern mußten, wohl versehen, durch große Kontributionen für ihren Unterhalt sorgend, vor Stralsund, und da schon früher auf schwedischen Befehl alle Schiffe, Kähne und Fähren aus Pommern nach Rügen gebracht waren, um eine Landung auf der Insel zu verhüten, so wurde eine Anzahl Boote und sonstiger Fahrzeuge aus dem Preußischen mühsam auf Wagen herbeigefahren und zu einer Landung auf Rügen in Bereitschaft gesetzt.
Als Gustav alle diese Anordnungen gegen sein geliebtes Stralsund und Rügen sah, verstand er sich zur Nachgiebigkeit. Er räumte Stralsund und zog sich nach Rügen zurück. Jetzt wollten die Franzosen die lange vorbereitete Landung ausführen, aber der schwedische General schloß eine Übereinkunft mit dem französischen Marschall, vermöge welcher die Schweden Rügen räumten und sich zuletzt mit allem Kriegsmaterial auf Mönchgut nach Schweden einschifften.
Am 29. Dezember 1807 befahl die französische provisorische Regierung zu Stralsund, daß niemand in Deutschland und auf Rügen mit Schweden in Verbindung trete, da dies dem kaiserlichen Interesse zuwider; seitens der Militärgesetze werde alle diesem Befehl zuwider Handelnden die strengste Strafe treffen, selbst wenn sie nur in mittelbare Kommunikation mit dem verräterischen Schweden träten.
So mußte denn Pommern für alle Bedürfnisse des französischen Okkupationsheeres sorgen. Große Summen mußten aufgebracht werden und zu diesem Behufe wurde eine Steuer nach der andern ausgeschrieben. Aber nicht nur der Beutel der Leute wurde in Anspruch genommen, auch ihre Häuser wurden ihnen zum Teil entzogen und ihre Kirchen in Heumagazine und ihre Schlösser und Klöster in Hospitäler umgewandelt.
Als nun Napoleon in seinem Zorne befahl (1808), die Festungswerke Stralsunds abzutragen, mußten alle männlichen Einwohner ohne Unterschied des Standes, sobald die Reihe an sie kam, sich acht Tage lang in Stralsund zur Arbeit stellen und dazu noch mit den nötigen Lebensmitteln versehen. Täglich wurden auf diese Weise 4000 Mann nach Stralsund beordert, um unter dem Oberbefehl der großmächtigen Franzosen wie Tagelöhner ohne Lohn zu arbeiten und die Wälle ihrer eigenen Festung niederzureißen.
Unterdes war der Krieg zwischen Frankreich und Österreich im Anfang des Jahres 1809 ausgebrochen.
Dieser gewaltige Krieg nötigte das erstere, einen gewaltigen Teil seiner Truppen aus Pommern zur süddeutschen Armee abzuberufen und nur eine schwache Besatzung in Pommern und Rügen zu lassen. Dieser Umstand war es, der dem Major Schill, obgleich Preußen damals mit Frankreich in Frieden lebte, die Kühnheit einflößte, jenen abenteuerlichen Zug nach dem Nordwesten Deutschlands zu unternehmen, der am 31. Mai 1809 in Stralsund so unglücklich für Schill selbst endete.
So sind wir nun endlich zu dem Zeitpunkte gelangt, wo unsere Erzählung beginnt, und wir wollen zum Schluß dieser Einleitung nur noch einige Worte hinzufügen, die auf die nach Rügen gesandten Franzosen wie auf die Bewohner der Insel ein klareres Licht werfen und namentlich die Stimmung der letzteren in ihren damaligen Bedrängnissen charakterisieren.
Bei der eigentümlichen, vom Festlande durch breite Wasserstreifen abgesonderten Lage der Insel Rügen konnten die Wirkungen eines gewaltigen, beinahe das ganze Europa umfassenden Krieges nicht dieselben sein, wie auf diesem Festlande selbst. Auf der kleinen Insel hielten sich keine großen schlagfertigen Heere auf, wenige Dinge waren daselbst zu gewinnen und am wenigsten große Reichtümer fortzuschleppen, nach denen die Franzosen von jeher so lüstern gewesen waren. Denn hier gab es keine Könige zu besiegen, keine Fürsten in den Staub zu werfen und es mangelte an Gelegenheiten, den Vergnügungen und dem Taumelgenuß großer Städte nachzugehen. Ganz im Gegenteil war sogar das Brod sehr schwarz, die ewige Fischnahrung bot ein beinahe quälendes Einerlei dar und die Winde wehten Tag und Nacht schaurig kalt über die weiten Wasserflächen, was den weichlichen Franzosen in anbetracht der engen und nicht gehörig verwahrten Häuser sehr unbehaglich erschien. Außerdem war die Kommunikation mit dem Festlande beschwerlich, zu Zeiten für große Truppentransporte sogar ganz unmöglich, die Wege auf der Insel selbst sehr schlecht und schließlich der siegestrunkene Franke den Angriffen des von der See her gefürchteten Engländers überall preisgegeben. Aus allen diesen Gründen beschränkten sich die Feindseligkeiten auf dem winzigen Insellande nur auf den sogenannten kleinen Krieg, Kontributionen, Räubereien, wie sie im Rücken eines siegreichen Heeres so leicht vorkommen, auf Quälereien der Landbewohner, Drohungen, allgemeine und einzelne Erpressungen und was dahin gehört, und immer war der leichtblütige Franzose im allgemeinen froh, wenn er das Wasser wieder überschritten und den nicht mehr wankenden Boden des festen Landes von Deutschland betreten hatte. Unbegreiflich aber war und blieb ihnen, wie sich auf manchen getrennten, öden und flachen Inseln, wie z. B. auf Hiddens-öe Menschen ansiedeln und glücklich fühlen konnten; die Sprache derselben erschien ihnen barbarisch, die Nahrung ungenießbar, die Wohnungen unerträglich und die Langeweile über alle Maßen unausstehlich. Nur auf einigen reicher begabten und von liebenswürdigen Menschen bewohnten Gütern fühlten sie sich leidlich wohl und sie gaben dies Wohlwollen gern dadurch zu erkennen, daß sie sich so viel wie möglich von den vorgefundenen und von ihrer Stelle abzulösenden Besitztümern anzueignen strebten.
Indessen, der König von Schweden hatte in ihrer Meinung gegen den Kaiser der Franzosen, den gewaltigen Napoleon, schwer gesündigt und er mußte dafür bestraft werden. Er war der einzige Potentat Europas, der es gewagt, dem Herrn der Welt zu trotzen, sein Bündnis zu verschmähen, seine Freundschaftsbeweise abzulehnen und seine Drohungen nicht zu fürchten. Er hatte ihm Schach geboten, als mächtigere Herren vor ihm im Staube lagen, und darum mußte er gedemütigt werden. Da der große Kaiser aber an den König selbst nicht herankommen konnte, so mußten seine Bürger und Bauern leiden, und dazu war Schwedisch-Pommern und Rügen wie geschaffen. Es wurde also ein Heer ausgesendet, um sich vollzusaugen von dem Safte des kleinen Ländchens, und demselben Generäle vorgesetzt, die es verstanden, den modernen Brennus zu spielen, und denen die Sorgen der Männer, die Tränen der Weiber und das Blut der Kinder so wenig galten, als wären sie Fliegen gewesen, die Gott der Herr nur zur Plage der herrlichen Franzosen geschaffen.
Unter diese Verhältnisse nun versetzen wir den geneigten Leser; um dem Charakter der Inselbewohner aber nicht zu nahe zu treten, bemerken wir hier gleich, daß er sich dieselben nicht vorzustellen hat wie Leute, die einen panischen Schrecken, über den Einzug der Franzosen empfanden. Allerdings konnte man auf Seite der Frauen und eines Teiles der Männer der gebildeteren Klasse eine gewisse Besorgnis vor den feindlichen Scharen wahrnehmen, aber auf Seite des Landmanns und Fischers war dieselbe nirgends zu finden. Diese, von kaltem Blute und von jeher phlegmatischen Temperaments, waren ihr ganzes Leben hindurch an so ernste Dinge, so viele und häufig drohende Gefahren gewöhnt, daß diese neue Fährlichkeit sie nicht mehr erbeben ließ, und mit ruhigem Gleichmut sahen sie den kommenden Tagen entgegen, voll der Erwartung, daß, so lange der alte Gott noch lebe, ihre Insel inmitte der Stürme festsitze und die See noch Fische erzeuge, auch noch keine Verzweiflung Platz greifen dürfe, vielmehr auch dieser Krieg einmal ein Ende nehmen müsse, wie alles auf der Welt einmal ein Ende nimmt.
So hatte denn auch nur ein kleiner Teil der vorsichtigeren und reicheren Gutsbesitzer Rügen während der Besitzergreifung der Franzosen verlassen und sich nach Schweden begeben, ihr unbewegliches Gut der Aufsicht eines zuverlässigen Pächters anvertrauend. Andere, weniger Bemittelte, vielleicht auch weniger Furchtsame, waren im Lande geblieben und warteten mit Ergebung das ihnen bestimmte Schicksal ab. Der gemeine Mann dagegen, der nicht im königlichen Dienste oder auf Schiffen außerhalb war, blieb hartnäckig auf seiner Scholle sitzen, die erste beste Gelegenheit erspähend, dem leichtfertigen Franzosen, der sein Bestes für einen Quark ansah und damit nach Belieben wirtschaftete, einen fühlbaren Streich zu versetzen.
Dennoch aber war alles in gedrückter Stimmung, trübe in die Zukunft blickend und gespannt auf die endliche Entwickelung der Gegenwart, wie es sich unter solchen Umständen kaum anders erwarten läßt; zu behaglichem Stilleben aber und den Genüssen eines ungestörten Lebens, wie sie die Insel zufolge ihrer Lage, ihrer Eigentümlichkeiten und patriarchalischen Sitten so reichlich gewährt, waren nur wenige aufgelegt, denn der Donner der Kanonen, der vom Festlande herüberschallte, und die Unterbindung des eigentlichen Lebensnervs der Insulaner, der mit dem Interdikt des französischen Gewalthabers belegte Handel und Wandel zur See, war allein schon hinreichend, den Sinn dafür zu nehmen und allen Geistesaufschwung zu lähmen, der notwendig mit dazu gehört, um ein Volk, sei es noch so klein und isoliert, sich glücklich und zufrieden fühlen zu lassen.
Erstes Kapitel.
Der Strandvogt im Kiekhause bei Sassnitz.
Der geneigte Leser folge uns nach der Halbinsel Jasmund, jenem eigentümlichen, schönen und durch die Landzungen: »die schmale Haide« mit der eigentlichen Insel Rügen, durch »die Schabe« mit der Halbinsel Wittow verbundenen Hochlande, dessen der Ostseite zugewandte Küsten, schwer zugängliche Kreidefelsen, mit herrlichen Buchenwipfeln gekrönt, jäh in die See abstürzen und, wenn man das Glück hat, sie bei ruhigem Wasser von einem fern auf dem Meere schwimmenden Boote aus zu betrachten, wie der felsige Bug eines riesigen Schiffes erscheinen, das seine steinernen Rippen kühn und unverzagt dem gewaltigen Anprall der schäumenden Wogen entgegendrängt. Jene vorhergenannten schmalen Landzungen, deren nördliche die grollende Tromper-Wiek die südliche die gemäßigter brausende Prorer-Wiek bespült, erblickt man dann wie ein Paar weite, nach Süden und Norden sich ausbreitende Flügel, auf deren südlichstem Endpunkt die waldreiche Granitz und das seltsam gestaltete Göhrensche Höwt, genannt Peerd, hervorragt, auf deren nördlichem Auslauf aber die majestätisch blickende Küste von Arcona thront, welches das äußerste nördliche Vorgebirge unseres großen deutschen Vaterlandes ist.
Wenden wir uns zunächst der von uralten Erdrevolutionen, Stürmen und Regengüssen vielfach zerklüfteten Südostküste dieser Halbinsel zu, die hie und da nach dem Meer sich öffnende Schluchten, hier Lithen genannt, zeigt, in denen Bäche rieseln, kräftige Buchen prangen und die kühnen Menschen Schutz finden vor dem Ungestüm der Witterung, wenn sie nach schwerer Arbeit auf dem mächtigen Element, aus dem sie ihre tägliche Nahrung schöpfen, abends am flackernden Herdfeuer ruhen.
Eine dieser Schluchten, und zwar die, durch welche der Steinbach rinnt, nimmt auch uns zuerst auf und führt uns zu der Wohnung des Mannes, den die Überschrift dieses Kapitels genannt hat.
In dieser Schlucht nämlich, auf jeder dazu geeigneten Stelle, ob hoch oder niedrig, luftig oder dumpfig, gleichwie die Vögel ihre Nester in Erdlöchern anlegen, wo sie sie finden, haben die Fischer des Dorfes Sassnitz ihre Häuserchen erbaut, die, was die malerische Lage an der schönen See betrifft, vor vielen ähnlichen Niederlassungen weit und breit begünstigt sind. Freilich stellen sich diese kleinen Strandwohnungen ebensowenig als elegante, wie als besonders geräumige Landsitze dar, am wenigsten in dem Jahre, welches wir hier vor Augen haben, allein das zerklüftete und mit einem undurchdringlichen Gestrüpp grüner Bäume und weithin kriechender Gebüsche bedeckte hohe Ufer, die üppige, von der Seeluft und den Winden gekräftigte Vegetation, der rauschende Steinbach, der im tieferen Hintergrunde der Schlucht selbst eine Mühle treibt, und das patriarchalisch einfache und natürliche Leben der Strandbewohner, die sich fast allein mit Ackerbau- und Fischfang beschäftigen, gewähren ein so anziehendes und harmloses ländliches Bild, daß wir wohl die Liebhaberei einiger Touristen begreifen können, die sich in neuerer Zeit hier im Laufe mehrerer Sommer häuslich niedergelassen und Sassnitz zu einem nordischen Seebadeorte umgewandelt haben, der heutzutage alljährlich schon mehrere Hundert Gäste anzulocken imstande ist.
Unmittelbar am Ausgang dieser Schlucht ersteigen wir vom Strande aus auf einem schmalen Pfade langsam die Höhe der Uferwand und stehen nun etwa achtzig Fuß hoch über dem Meere, das, sobald wir das erstaunte Auge darauf geworfen haben, uns einen Ausruf freudiger Bewunderung entlockt. Denn vor uns dehnt sich in unabsehbarer Weite das baltische Meer aus, in der Ferne nur vom dunkelazurnen Horizont begrenzt; zu unserer Linken beschränkt die Aussicht der höher ansteigende kreidefelsige Klippenrand, der sich nach Stubbenkammer und weit darüber hinaus erstreckt; zu unsern Füßen aber weit und breit zur Rechten hin rauscht die Prorer Wiek und bespült in der Ferne das schön bewaldete Ufer der Granitz, während über dem schon erwähnten seltsam gestalteten Peerdvorgebirge hinaus die pommerschen Küsten mit ihren Städten und Dörfern im Nebel des Meeres verschwinden.
Aber wir bleiben nicht lange auf der, dem Dorfe zunächst liegenden Bergplatte stehen, sondern wenden uns nordwärts noch etwas höher, einen mit kräftigen Buchenstämmen dicht bewachsenen Hügel hinan, auf dessen freierem Gipfel ein Häuschen steht, welches an Zierlichkeit und Größe die Fischerhäuser in der Schlucht bei weitem überragt. Durch einen wohlgepflegten, mit Nuß- und Obstbäumen reichlich bestandenen Garten, den ein grüngestrichenes, drei Fuß hohes Holzstacket umgibt, schreiten wir auf den westlichen Eingang des Einsiedlerhäuschens zu, das auch einen östlichen, dem Meere zugewandten Ausgang hat. Die ganze westliche, also dem vom Lande herkommenden Wanderer zugekehrte Seite des Hauses ist mit wildem Wein und Efeu bis zum Giebelfelde hinauf bewachsen, so daß die zwei zu jeder Seite der Tür befindlichen kleinen Fenster im Sommer und Herbst fast ganz davon beschattet sind, was indes zu der Jahreszeit, in welcher wir es zum ersten Mal betrachten, noch nicht vollkommen der Fall ist.
Bevor wir jedoch in das Innere desselben treten, begeben wir uns einen Augenblick auf seine Ostseite und finden hier einen üppigen Rasenfleck, dessen Mitte zwei mäßig starke Buchenstämme einnehmen, die vom häufig brausenden Seewinde mit ihren Wipfeln etwas westwärts geneigt sind. Beide verbindet eine zierlich geschweifte Rasenbank, und acht Fuß darüber, zum Teil von den starken Baumästen getragen, hat der Besitzer sich eine kleine Warte angelegt, auf der wir, wenn wir ihre paar Stufen ersteigen, den höchsten Punkt erreicht haben, der von dieser Gegend aus den weitesten Fernblick gestattet und dem Orte den Namen »Kiekhaus« verschafft hat.
Haben wir auch hier unser Verlangen gestillt und die blaue Ferne lange genug überschaut, so wenden wir uns endlich nach dem Hause selbst, um mit seinen Bewohnern einen Freundschaftsbund zu schließen, der bis an das Ende dieses Buches und hoffentlich noch länger dauern wird.
Der Besitzer dieses Häuschens ist der alte Strandvogt Daniel Granzow, der mit seiner Frau Ilske im Mai 1809 allein hier wohnt. Er ist für seine bescheidenen Verhältnisse und mit den Fischern in Sassnitz verglichen, ein wohlhabender Mann, denn er hat sich das Kiekhaus, zwar nicht aus eigenen Mitteln erbaut, aber doch in der behaglichsten Art jener Zeit wohl ausgestattet.
Das Zimmer, in dem er sich gewöhnlich aufhält, ist ein mäßig geräumiges, schneeweißgetünchtes Gemach, dessen zwei Fenster oberhalb des angedeuteten Rasenflecks liegen und also nach der See hinausgehen. Unter der Decke desselben zieht sich eine Kante frischen Efeus herum, der an den Wänden von Strecke zu Strecke festgenagelt ist und hie und da einige frische Zweige, namentlich nach den Fenstern hin, absendet. Hinter dem dunkelumrahmten Spiegel zwischen diesen Fenstern stecken zu jeder Seite Zweige des immergrünen Hülsbusches, und zwischen den Füßen eines mit schwarzem Wollenzeuge überzogenen Sofas sowie eines Großvaterstuhls und den anderen hier und da aufgestellten Stühlen sind in zierlichen Schlangenlinien zerstückelte Wachholderästchen wie eine fortlaufende grüne Schnur gelegt, was in älteren Zeiten überall gebräuchlich war und vielleicht auch noch jetzt an manchen Orten in dem altväterischen Rügen für einen beliebten Zimmerschmuck gilt.
Von gleicher Ordnung und Sauberkeit glänzen auch die anderen Zimmer des Häuschens, nur sind sie nicht so verschwenderisch mit Bequemlichkeitsmöbeln versehen; das wohlgelüftete Schlafzimmer der Alten aber zeigt ein ungeheures Ehebett, dessen dickaufgewulstete Pfühle fest zugezogene Gardinen von blau gestreiftem Baumwollenzeuge verdecken.
Es ist nachmittag vier Uhr, und also die Zeit, wo der Hausherr sein gewöhnliches Mittagsschläfchen hält. Er sitzt halb liegend auf seinem Sorgenstuhl, der dicht neben dem gewaltigen schwarzen Kachelofen steht, um den eine schwere Bank läuft, breit genug, damit man im Winter nicht allein darauf sitzen, sondern im Notfall auch liegen kann. Über dem Sorgenstuhl hängt an einem Wandriegel des Strandvogts glanzlederner Seemannshut, eine kurze Pfeife, deren Kopf das Bildnis des großen Schwedenkönigs Gustav Adolf zeigt, eine lange Strandbüchse, um Seevögel zu schießen, nebst Pulverhorn, zwei lange Reiterpistolen, ein Entermesser in Aalhautscheide, ein kurzes Sprachrohr von Blech, das vom langen Gebrauch ganz schwarz geworden, und endlich an einem langen Riemen ein vortreffliches Fernglas, welches das kostbarste Besitztum des alten Seemanns ist.
Daniel Granzow hat eine kräftige, mehr untersetzte als lange Seemannsfigur mit breiten Schultern, muskulösen Armen, etwas großen und rauhen Händen und ist, abweichend von den gewöhnlichen Seeleuten auf Rügen, über die ihn seine amtliche Stellung und seine größere Bildung erheben, in ein blautuchenes Wamms mit Weste und Hose von gleichem Stoff gekleidet, nur trägt er aus alter Gewohnheit noch bis zur Mitte des Oberschenkels reichende Wasserstiefel, die er nie von sich streift, bevor er nicht zu Bett geht. Sein von vielfachen Stürmen, Regengüssen und Sonnenstrahlen hart mitgenommenes Gesicht ist wohlgenährt, trotz seines Alters – er zählt etwa sechzig Jahre – wenig gerunzelt und rings von einem etwas struppigen eisgrauen Barte umgeben, der sich an den Schläfen an ein ebenso gefärbtes, sehr dicht emporstehendes Haupthaar anschließt. Jetzt, wo er sanft schläft und nur bisweilen einen tiefen Schnarchton ausstößt, zeigt sein Gesicht den Ausdruck einer fast kindlichen Ruhe, dem keineswegs die männliche Würde fehlt; wenn er aber sein großes blaues Auge aufschlägt, gewahrt der mit ihm Redende in diesen wettergebräunten Kernzügen sehr bald einen leichten Anflug kummervoller Resignation, der dem mit einer Stentorstimme sprechenden alten Seemann eine gewisse Milde verleiht, die offenbar viel dazu beiträgt, daß man rasch großes Vertrauen zu ihm faßt und ihn bald lieb gewinnt.
Auf einem Stuhle am Fenster, das Gesicht dem schlafenden Manne zugewendet, dem sie alle Aufmerksamkeit schenkt, welche ihr die Beobachtung des Wetters, der See und des vor ihr liegenden Strandes übrig läßt, sitzt Vater Granzows Frau: »Mutter Ilske«, wie sie von Groß und Klein in der ganzen Nachbarschaft seit Jahren genannt wird.
Sie ist eine große, stattliche Frau von etwas vollkommenen Verhältnissen, deren Gesicht auf den ersten Blick die Spuren einer großen, noch nicht ganz entwichenen Schönheit verrät. Mutter Ilske ist eine geborne Mönchguterin und kann als solche noch immer nicht die Gebräuche und Gewohnheiten ihrer seltsamen Heimat vergessen, was sich namentlich in manchen Teilen ihrer eigentümlichen Kleidung ausspricht. Diese ist zwar nicht die vollständige Tracht der Mönchgutischen Schönen, wie wir sie, seit Jahrhunderten unverändert, noch heute bei ihnen antreffen, aber sie erinnert doch lebhaft daran. So trägt sie z.B. statt der spitz zulaufenden ungeschlachten wollenen Mütze ein schneeweißes Häubchen von feinem holländischen Cambrick, das mit einer faltenreichen Spitze geschmackvoll besetzt ist und unter welchem ihre gescheitelten grauen Haare höchst ehrwürdig matronenhaft hervorblicken. Auch die roten Strümpfe, die mit Werg ausgestopfte dicke Wulst von Leinwand um die Hüften, sowie der kurze schwarze Rock fehlen, allein reichlich gefaltet ist das etwas lang gewordene Kleid von schwarzem Wollstoff noch immer und der bunte Brustlatz, der vorn das Camisol von dunklem Tuche schließt, ist mit gleichfarbigem schmalen Bande im Zickzack zugeschnürt.
Fleißig ist Mutter Ilske wie jede Mönchguterin, die, wenn sie sich einmal, was selten geschieht, außerhalb ihrer Heimat verheiratet, stets die Gebräuche und guten Eigenschaften derselben überall beibehält: keine Minute ruht die alte Frau den ganzen Tag über; sauber wie sie selbst, muß das Hauswesen vom Dach bis zum Keller sein, und sogar Wenn sie mit ihrem Manne über wichtige Dinge spricht, holt sie ihren Strickstrumpf aus der Tasche hervor, dessen Nadeln sie mit einer bewundernswerten Schnelligkeit in Bewegung setzte
Auch heute ist sie mit dieser Arbeit beschäftigt, aber nur mechanisch, denn ihre Gedanken weilen durchaus nicht dabei: vielmehr tummeln, sie sich, wie schon gesagt, auf der weiten Meeresfläche, wo ihr Auge den Flug der Möven, des Seeadlers und der Schwalben verfolgt, und kehren dann stets wieder zu dem Gesicht des Alten zurück, dessen Erwachen sie nicht übersehen möchte, um ihm sogleich den schon lange bereitgehaltenen Nachmittagsimbiß aufzutragen, worunter sich der Leser jedoch keinen Kaffee vorstellen darf, da man in der Zeit, von der wir hier schreiben, unter den eisernen Gesetzen der Kontinentalsperre litt, die der gewaltige Halbgott von Frankreich in seinem Hasse gegen die seemächtigen Engländer auch über diese kleine Insel verhängt hatte.
Wie gesagt, beginnt im Monat Mai und zwar am 29. dieses Monats nachmittags vier Uhr unsere Geschichte. Der Mai ist auf Rügen noch kein Blütenmonat, oft sogar sehr rauh und sich mehr dem April als dem Juni zuneigend. Allein in diesem Jahre war das Wetter auffallend gut, die Winde mäßig kalt und der Sonnenschein andauernd genug gewesen, so daß die Blätter der Bäume schon teilweise sichtbar, der Rasen saftig grün und die Luft von jenem Hauche durchzogen war, der den Anzug des Sommers zu verkündigen pflegt. So freute sich denn Mutter Ilske über die auflebende Natur vor ihren Fenstern und ihrem Gärtchen, und nur der traurige Umstand, daß so wenig Leben auf der See herrschte, da Handel und Wandel mit anderen Nationen stockte und die Schiffahrt gänzlich still stand, schien ihr nicht zu behagen und vielleicht die Seufzer hervorzulocken, die manchmal ihren noch immer kirschroten Lippen entschlüpften.
Schon mehrere Male hatte sie ihr hellbraunes Auge auf die große Wanduhr gerichtet, die dem Spiegel gegenüber neben der Tür stand und ihr schnarrendes Rasselgeräusch im stillen Gemache überall vernehmen ließ. Die vierte Stunde hatte sie schon seit einigen Minuten geschlagen, und immer noch nicht wollte der Strandvogt die Augen öffnen. Da endlich, gerade als Mutter Ilskes Blicke einen Seeadler verfolgten, der, wie die Franzosen, seine Beute sogar aus dem Meere sich geholt, hörte sie den Alten behaglich gähnen, und sogleich wandte sie ihr Gesicht auf das des Erwachten, welches ihr freundlich wie immer einen guten Tag zunickte.
»Na, Alter, du hast ja heute lange geschlafen,« sagte sie lächelnd und ihm munter seinen Gruß zurückgebend. »Ich dachte schon, du hättest die Absicht gehegt, Nacht aus dem Tage zu machen.«
»Nein, Ilske, die Absicht habe ich nicht gehabt; es wäre auch die erste gewesen, die ich je im Schlafe gehegt, wo man ja so glücklich ist, weder Absichten noch sonst etwas zu haben, was einen an die hoffnungslosen Aussichten auf Erden erinnert. Ach ja!«
»So, so! Hast du denn auch nichts, geträumt, Alter?«
Der Alte seufzte, ohne zu antworten, und machte sich mit seiner tönernen Pfeife zu schaffen, die neben ihm am Sessel lehnte, woraus Ilske den Schluß zog, daß er allerdings geträumt, aber eben nichts Angenehmes, da er es sonst wohl sagen würde, und Träume zu hören und wo möglich zu deuten, war eine Lieblingsbeschäftigung der guten Mutter Ilske.
Während sie nun hinausgegangen war, um den Vesperimbiß zu besorgen, erhob sich der Strandvogt gemächlich von seinem Stuhle, gähnte und reckte sich und trat ans Fenster, um den Himmel und die See zu betrachten, und wie es seine alltägliche Gewohnheit war, daraus einen Schluß auf das kommende Wetter zu ziehen. Als er auf diese Weise eine Weile Nähe und Ferne geprüft, fing er an, etwas heftig durch die Zähne zu pfeifen, eine Musik, die Mutter Ilske stets richtig zu deuten wußte, was auch diesmal ihre Frage bewies, als sie zur Tür hereingetreten war und ihren Alten seinen Sturmmarsch flöten hörte.
»Nun,« sagte sie, Teller nebst Zubehör auf den Tisch stellend, »was gibt's, Daniel? Pfeifst du schon wieder den Sturm herbei? Laß ihn draußen Mann, wir haben lange genug schwer Wetter gehabt, und der dünne Sonnenschein tut jeder Kreatur wohl.«
»Ich möchte ihn schon draußen lassen, Ilske, wenn er sich daran kehren wollte. Aber du magst es immer glauben: jetzt ist es halb fünf, und es werden keine zwei Stunden vergehn, so wird die frostige See eine weiße Spitzendecke übergeworfen haben, und eine tüchtige schwere Böe wird sich gerade gegen unsern Strand wälzen. Schau, da hinaus gegen Südosten sitzt der Übeltäter; die breite Nebelwand hinter der Oie gefällt mir nicht – es gibt was!«
»Wahrhaftig, Alter, du hast recht, wie immer. Ich habe es mir auch schon gedacht, als du so glücklich nicktest, denn die Möven fliegen so niedrig, kommen haufenweise landeinwärts und die Schwalben jagen sich wie unklug am Strande.«
»Ha, Ha! Es ist merkwürdig! Die Tiere wissen es ebensogut und fast noch besser als die Menschen. Auch ich habe eine Art Instinkt darin, denn wenn ich am Morgen aufwache, und es liegt mir so bleischwer in den Knochen, Gott weiß, woher es kommt, dann bin ich im Klaren, was das zu bedeuten hat.«
»Ja, ja, und wenn die See erst donnert –«
»Ha, wenn sie erst donnert, Alte, dann wissen es sogar die Strandjungen, daß etwas Großes im Anzuge ist.«
»Heute habe ich noch nichts gehört, und es sollte mir leid tun, wenn das schöne warme Wetter so rasch ein Ende nähme. Jetzt aber laß Sturm Sturm sein – komm her. setze dich und laß es dir schmecken. Gott segne es, Daniel!«
»Ja, er segne es!«
Die beiden Alten hatten sich an dem handfesten Tische vor dem Kanapee niedergelassen und langten zu von dem, was in reichlicher Menge aber freilich geringer Auswahl vorhanden war, denn das ganze Vespermahl bestand aus Brod, geräuchertem Aal und trockenen Flundern, die vor nicht langer Zeit noch lebendig und munter unten in der See gespielt hatten. Kaum aber waren die ersten Bissen in den Mund gesteckt, so legten sie beide plötzlich Messer und Gabel nieder, denn ihre scharfen Ohren hatten zu gleicher Zeit ein Geräusch vernommen, welches in dieser abgelegenen Gegend selten gehört ward.
Es war das Gewieher eines Pferdes, dem alsbald das Stampfen seiner Hufen folgte, und zwar dicht vor der Tür, die nach dem Landwege hin lag.
»Halloh! Da kommt Besuch!« rief der alte Strandvogt freudig und sprang auf den kleinen Flur, in nicht gar langer Zeit von seiner guten Ilske gefolgt, da sie beide, wie jeder Rügianer in damaligen Zeiten, ihren Ruhm darin suchten, mit zu den gastlichsten Leuten im Lande zu gehören.
In dem Augenblicke, als die beiden Eheleute die Tür erreichten, sahen sie von einem kleinen aber sehr kräftigen Schecken einen Mann steigen, der, seiner äußeren Erscheinung nach, nur ein Geistlicher sein konnte, ihnen aber, was bei ihren Besuchen sehr selten stattfand, gänzlich unbekannt war.
»Ha, Ilske!« sagte der Alte mit leiser Stimme, als er neben seiner Frau dem Fremden durch den Garten entgegenging, »das ist eine angenehme Überraschung; ich wette, es ist der neue Diakonus des guten Herrn Pastors von Willich zu Sagard, und er kommt, uns seinen nachbarlichen Antrittsbesuch zu machen.«
Der Alte hatte sich nicht geirrt, es traf alles haarscharf ein, wie er es vermutet, es war wirklich der neue Diakonus – wir wollen ihn Wohlfahrt nennen – der seine Rundreise angetreten, um die Pfarrkinder, die zu seiner Kirche in Sagard gehörten, aus eigener Anschauung kennen zu lernen.
Die Geistlichen auf Rügen haben sich von jeher nicht allein durch große geistige Bildung, sondern auch durch liebenswürdige Eigenschaften des Charakters und Herzens ausgezeichnet, weshalb sie sich stets einer großen Popularität bei ihren Pfarrkindern erfreuten. Letzteres war sehr natürlich, denn der schlichte Sinn der Landbewohner Rügens begriff sehr bald, daß ihre Geistlichen ein Herz für sie hatten, und ebenso gefiel es ihnen wohl, daß sie das Wort Gottes lehrten, wie es lebendig aus ihrem Herzen kam, daß sie ihre Erklärungen der heiligen Schrift an die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen der sie umgebenden großartigen Natur knüpften und sich dabei fern von aller Heuchelei und Duckmäuserei hielten, die einem einfachen Naturmenschen ebenso unnatürlich erscheinen und leicht zuwider werden, wie dem feingebildeten und vernunftgemäß urteilenden Denker.
Die Geistlichen Rügens waren im Verhältnis zu ihren Amtsbrüdern im platten Lande Norddeutschlands sehr gut gestellt; ihre Einnahmen, größtenteils aus den Abgaben ihrer Gemeindeglieder fließend, waren reichlich, wie man denn auch die auf den Halbinseln Jasmund und Wittow wohnenden vier Pfarrer, nämlich in Sagard, Bobbin, Wiek und Altenkirchen die Vierfürsten nannte und ihrer äußeren Stellung damit alle Ehre erwies, indem man sie gewissermaßen mit zu dem vielfach begünstigten Adel zählte. Mit diesem Adel waren die Pfarrer überdies sehr innig befreundet, ja sogar oft durch Blutsverwandtschaft verbunden, und weil man bei dem sehr geringen Verkehr mit den kleinen Städten und den oft weit entfernten größeren Gütern nicht allzu wählerisch verfahren konnte, so verknüpfte Adel und Geistlichkeit ein natürliches Interesse, sie suchten ihren gegenseitigen Umgang, teilten sich ihre Ansichten, ihre Bildung mit, und so entstand zwischen beiden eine gewisse liberale Denkungsart, die Generationen hindurch fortlebte und ebenso viel zum Wohlbehagen der Einzelnen, wie zum Nutzen des Allgemeinen beigetragen hat.
Mit aus diesem Verhältnis entsprang auch zu beiderseitigem Frommen die schöne Pflege der Gastfreundschaft, die sich von den ersten Ständen bis auf die letzten erstreckte. Denn da der Mensch ein geselliges Wesen ist, Fremde aber zu damaliger Zeit die Insel wenig besuchten, so waren die Bewohner derselben auf sich selbst angewiesen, und man freute sich wahrhaft, einem Bekannten die Tür öffnen und die Stunden seines Aufenthalts so angenehm wie möglich machen zu können.
So viel, von dem Verhältnis der Geistlichen zu den Bewohnern Rügens und dieser unter sich im allgemeinen. – Der Diakonus, den wir hier einzuführen im Begriff stehen und der leider nicht mit zu den Hauptpersonen unserer Erzählung gehört, die wir diesmal in einer anderen Klasse zu suchen haben, war erst vor kurzer Zeit als Adjunkt dem allverehrten Pastor von Willich in Sagard zur Seite getreten und mochte es nun für seine Schuldigkeit halten, von Hof zu Hof zu wandern und seine Person den ihm von vornherein freundlich ergebenen Pfarrkindern vorzustellen.
Für diese aber hatte der Besuch eines Geistlichen gerade in jenen trüben Tagen einen noch viel höheren Wert als zu gewöhnlichen Zeiten. Mancher Trost konnte nur von ihrer Einsicht gespendet, manche Hoffnung zum Besseren nur von ihrem warmfühlenden Herzen gesprochen werden, und so war denn Diakonus Wohlfahrt heute bei unserm Strandvogt doppelt willkommen, der, wie wir bald sehen werden, auch des geistlichen Zuspruchs bedurfte und aus seinen Tröstungen Gewinn für sein einsames Leben schöpfen konnte.
Nachdem der junge Geistliche, denn jung war er noch, obwohl ihm eine natürliche Würde und ein ernstes, sinniges Wesen den Anstrich eines durch Erfahrung gereiften Mannes gab, seinen Namen genannt, schüttelten ihm Mann und Frau warm die Hände und führten ihn sofort ins Zimmer, wo er sich ohne weiteres an dem Tische des Vogts niederließ und von den aufgetragenen Speisen nahm, nachdem Mutter Ilske einen reinen Teller geholt und einige Worte der Ermunterung dabei gesprochen hatte. Sie selbst nahm indessen nicht sogleich neben ihrem Gaste Platz, vielmehr einem Winke ihres Mannes folgend, begab sie sich hurtig in ihre Vorratskammer und entnahm einer wohlverwahrten Kiste eine bestäubte Flasche, deren Inhalt sie zwei alten hochfüßigen Römern einverleibte, die sie den Männern kredenzte, worauf diese den allbeliebten portugiesischen Wein in den Gläsern funkeln sahen.
Hören wir nun dem folgenden Gespräche aufmerksam zu, denn aus ihm werden sich von selbst die Verhältnisse des Strandvogts ergeben, deren Bericht wir dem Leser bis jetzt schuldig geblieben sind.
»Ja, ja,« sagte der Strandvogt, während sein Gast tüchtig zulangte, denn er hatte soeben einen weiten Ritt zurückgelegt, »ich freue mich herzlich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Die Leute, die Sie früher gesprochen, haben mich neugierig auf Sie gemacht, und es kann uns ja nicht gleichgültig sein, welchen einstigen Nachfolger unser guter Herr Pfarrer in Sagard hat. Er befindet sich doch wohl, der vortreffliche Herr?«
»Ganz wohl, Herr Strandvogt, und er läßt Sie bestens grüßen. Auch würde er einmal selbst schon zu Ihnen gekommen sein, um sich nach Ihrem Wohlergehen zu erkundigen, wenn ihn nicht die vielen Geschäfte mit den Herren Franzosen an sein Haus und seinen Schreibtisch fesselten.«
»Ich glaube es gern. Ach, was sind das für Zeiten, Herr Diakonus, und was werden wir noch zu erleben haben!«
»Nicht mehr, als uns Gott auferlegt, lieber Mann, ganz gewiß nicht mehr.«
»Ja freilich, mehr wird es nicht sein, aber das ist auch schon genug. Nun ist die Reihe des Leidens auch an Schweden und uns gekommen, nachdem fast ganz Europa die Faust des Eroberers auf seinem Nacken gefühlt. O unser armer König! So schnell ist es mit ihm zu Ende gegangen! Aber ich glaube, man konnte ihn wirklich nicht länger am Steuer des Staatsschiffes lassen.«
»Wie es scheint, nein! Er steuerte sein Schiff harten Klippen entgegen, und die heutige Zeit verlangt kundige Seefahrer. Wir haben eben Sturm, und beim Sturm muß man, Sie wissen es ja, alle Segel einziehen! Gustav IV. Adolf aber gefiel es, sie alle flattern zu lassen, und das mußte Unheil bringen. Nun, gebe nur Gott, daß der alte Herr, der uns jetzt regiert, von Weisheit und Milde erleuchtet sei, dann wird sich das Übrige schon finden, wenn wir Geduld auf das Zukünftige und Ergebung in das Unvermeidliche besitzen, wie ein Christ es ja soll. Aber sagt mir einmal, alter Herr, habt Ihr schon viel von den Fremdlingen zu leiden gehabt, die auf unserer Insel die gebietenden Herren spielen?«
»Daß ich nicht wüßte, Herr Diakonus, nein, eigentlich nicht. Ich habe zwar wiederholt meinen Anteil an Steuern und Kontributionen entrichtet, die sie über uns verhängt, aber auf meinen Hof und in mein Haus sind nur wenige gekommen und höchstens nur beim Vorübermarsch. Pah! was sollten sie auch bei mir suchen und von mir wollen! Sie lieben mehr die großen Höfe und reichen Herren, und ein armer Strandvogt, wie ich, hat wenig, was ihrem Verlangen entspricht und ihr Begehren reizt.«
»Eure Geschäfte sind durch die fremden Herren auch nicht sonderlich vermehrt worden?«
»Leider nein, ach ganz und gar nicht! Es kommen wenig Fahrzeuge mehr in diese Gewässer, denn der Handel mit unsern Freunden, den Engländern, ist ja verboten, und die paar Schiffe, die dann und wann vorübersegeln, sind dänische Spürhunde, die unsere Küsten bewachen, damit kein Schmuggel mit den verbotenen Waren getrieben wird.«
»Mit den Lotsengeschäften habt Ihr nichts zu tun in Eurer jetzigen Stellung?«
»Von Amtswegen gerade nicht, nein, Herr; aber wer kann von einem Handwerk lassen, das er dreißig Jahre betrieben hat, wie ich? Wenn es daher was zu lotsen gibt, da drüben, so habe ich gern noch meine Hand im Spiele und lasse meine Stimme mit im Rate der Leute erschallen, die die Küstenschiffahrt sicher stellen.«
»Ihr seid früher Lotsenkommandeur gewesen, wie ich gehört habe?«
»Ach ja!« sagte der Alte mit einem Seufzer, der aus tiefstem Herzen kam. »Viele, viele Jahre sogar, und es gibt keinen Sturm in den letzten dreißig Jahren, den ich Ihnen nicht von Anfang bis zu Ende in allen Wirkungen beschreiben könnte und der mir nicht die Kleider bis auf die Haut durchnäßt hätte.«
»So seid Ihr auch wohl sehr erfahren in der Küstenschiffahrt dieses Landes?«
»Ja, Herr, das kann ich dreist von mir behaupten, besser sogar, wenigstens ebensogut, wie irgend ein anderer. Ich kenne jeden Stein im Wasser, rings um die Insel herum, jede Furt, jede Untiefe ist mir bekannt, und fast jeder Windstoß weht mir als ein guter Freund oder ein böser Feind entgegen, und daher kommt eben meine Liebhaberei für das Handwerk, denn was man in der Jugend getrieben, liebt man im Alter und kann nicht davon lassen, wie der Fisch nicht vom Schwimmen läßt, so lange er lebendig im Wasser liegt.«
Der Geistliche nickte zustimmend und nippte von dem feurigen Wein, der noch unangerührt vor ihm perlte. Offenbar hatte er eine Frage auf dem Herzen, aber er schien innerlich zu erwägen, ob er sich damit herauswagen solle.
Endlich faßte er Mut dazu, und während Mutter Ilske den Tisch abräumte, die Flasche und die Gläser aber vor den redenden Männern stehen ließ, sagte er mit merkbarer Bewegung in seiner weichen Stimme:
»Ihr wohnt hier in diesem kleinen Hause allein mit Eurer guten Frau, nicht wahr?«
»Ja, Herr, jetzt wohne ich mit ihr allein; nur eine alte Magd ist noch da, die den Garten und das Vieh besorgt, während meine Frau sich mit unserm kleinen Hauswesen zu schaffen macht. Meine Nichte – sie ist die Stieftochter der Schwester meiner Frau – hat uns gegenwärtig verlassen, um ihren Pflichten in Mönchgut nachzugehen, woher sie stammt, wie auch meine alte Ilske daselbst geboren ist.«
»In Mönchgut? Was hat denn Eure Nichte da für Pflichten zu erfüllen?«
»Ihr Pate ist ein alter Mann, Herr, Besitzer des Gutes Bakewitz, im Süden von Peerd. Er liegt leider im Sterben und hat den Wunsch ausgesprochen, unsere gute Hille so lange bei sich zu behalten, bis er das Zeitliche gesegnet hat. Nun ist sie schon seit drei Wochen auf Bakewitz, und wir sind allein.«
»Hm! Habt Ihr sonst keine Familie?«
Der Alte warf einen scheuen Blick auf seine Frau, die sich wieder mit ihrem Strickstrumpf am Fenster niedergelassen hatte, und da sie die Augen fest auf ihre Arbeit gerichtet hielt, so sagte der Vogt: »Mutter, sieh doch, wo Trude ist, und sag' ihr, sie solle das Vieh aus der Lithe holen, damit es im Stalle ist, ehe der Wind losbricht – denn er kommt allmählich herauf, ich habe es ja gesagt.«
Mutter Ilske erhob sich ohne Zögern, denn sie merkte, daß jetzt von ihrer Familie die Rede sein würde, und kannte ihren guten Alten, der sie stets zu entfernen bemüht war, wenn er von seiner Vergangenheit sprach, um ihr den Kummer zu ersparen, der für sie in der Erinnerung daran lag.
So waren denn die beiden Männer allein. Der Vogt, der einen Blick auf das Meer geworfen, war vom Fenster an den Tisch zurückgekehrt und hatte seinem Gaste gegenüber wieder Platz genommen. »Ich schicke meine Alte absichtlich hinaus,« sagte er flüsternd, »weil ich weiß, daß meine Antwort auf Ihre Frage ihr nicht lieb sein kann. Sie fragen nach meiner Familie, Herr Diakonus, nicht so? Ja, ich habe eine Familie, und eine recht große. Der Himmel hatte mir sieben Söhne, und recht wackere, starke und gute Söhne gegeben.«
»Er wird sie Euch doch nicht alle wieder genommen haben?«
Der Alte schüttelte wehmütig den Kopf, und seine Miene nahm einen so kummervollen Ausdruck an, daß man ihm ansah, wie tief ihn die zuletzt ausgesprochene Frage erschütterte. »Wer schaut in des Himmels Rat?« sagte er leise. »Ich bin ihm noch dankbar, daß er mir einst so viel Freude gegeben, so daß ich also mit Ergebung auch das Leid ertragen muß, womit er mich nachher geprüft hat, wie selten einen Mann und Vater. Ja,« fuhr er mit halb gebrochener Stimme fort, »er hat sie mir fast alle wieder genommen, und das ist es, was ich die alte Ilske nicht wollte hören lassen, obwohl ich wetten will, daß sie weiß, wovon wir sprechen.«
»Da sind Sie ja sehr zu beklagen, armer Mann! Sind Ihre Söhne Ihnen schon in frühester Jugend gestorben? Sie verzeihen, daß ich auch danach frage, aber ich nehme Anteil an Ihrem Schicksal und werde noch mehr daran nehmen, wenn ich es genauer kenne.«
»Das sollen Sie, ja, das sollen Sie, und um so lieber will ich es Ihnen mitteilen, da mich schon seit mehreren Tagen mein Familienleid tiefer bedrückt, denn je, da es noch immer nicht sein Ende erreicht zu haben scheint.«
»So sprecht Euch die Brust frei, es tut wohl, einem teilnehmenden Herzen seine Sorge auszuschütten, und ich will Euch trösten, so gut ich es mit Empfindungen und Worten vermag. Also Ihr hattet sieben Söhne?«