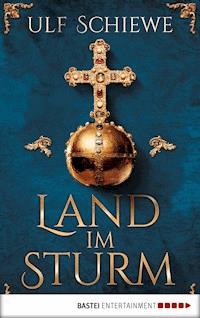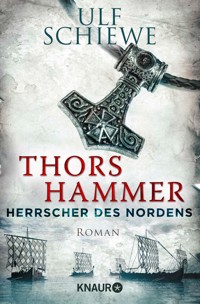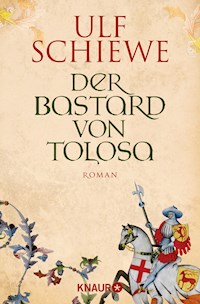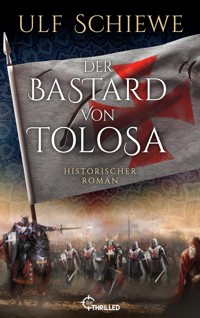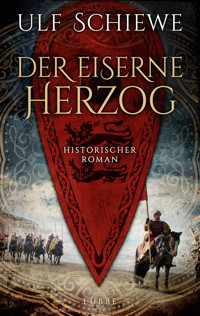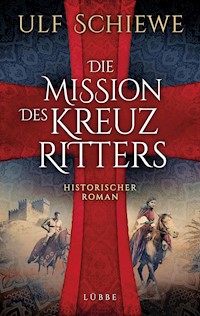9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Normannensaga
- Sprache: Deutsch
Süditalien 1057: Für den jungen Normannen Gilbert und seinen Herrn Robert Guiscard stehen die Zeichen schlecht. Innere Zerrissenheit und Bruderkrieg drohen das Normannenreich zu zerstören. Auch der Papst sinnt auf Rache, und die heimliche Liebe der Fürstin Gaitelgrima bringt Robert in den Kerker. Ein erbitterter Kampf um die Herrschaft entbrennt. Nur Gilbert kann seinen Herrn noch retten. Doch er steht allein gegen eine gewaltige Übermacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Ulf Schiewe
Der Sturm der Normannen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der vierte Band in Ulf Schiewes spannender Normannen-Saga.
Süditalien 1057: Für den jungen Normannen Gilbert und seinen Herrn Robert Guiscard stehen die Zeichen schlecht. Innere Zerrissenheit und Bruderkrieg drohen das Normannenreich zu zerstören. Auch der Papst sinnt auf Rache, und die heimliche Liebe der Fürstin Gaitelgrima bringt Robert in den Kerker. Ein erbitterter Kampf um die Herrschaft entbrennt. Nur Gilbert kann seinen Herrn noch retten. Doch er steht allein gegen eine gewaltige Übermacht.
Inhaltsübersicht
Die Belagerung
Die Kloake
Gerlaine
Die Fürstin Gaitelgrima
Die Normannenhasser
Streit unter Brüdern
Der Gefangene
Gaitelgrimas Versprechen
Der Prinz von Salerno
Gilbert muss sich stellen
La Mala Aria
Belagerung
Pietros Rammbock
Das Herz der Baronessa
Bruderzwist und Hungersnot
Monsignore Ildebrando
Epilog
Die wichtigsten Personen
Die Hauteville-Familie
Andere (historische) Normannen
Kirchenvertreter
Die Fürstenfamilie von Salerno
Fiktive Personen
Nachwort des Autors
Die Belagerung
Robert Guiscard war wütend. Man konnte es an seinem angespannten Rücken sehen, wie er zwanzig Schritt von uns entfernt am Flussufer stand und zu den Mauern von Cosenza hinüberstarrte. Dreimal schon hatte die Stadt ihm getrotzt und den Zugang zum Süden verwehrt. Dabei hatte Kalabrien nur der Anfang sein sollen. Robert war jetzt zweiundvierzig Jahre alt und ungeduldiger denn je. Ihn dürstete nach mehr.
Täglich war er am Ufer entlanggegangen und hatte die gegenüberliegende Mauer nach Stellen abgesucht, die man überwinden könnte. Es kümmerte ihn auch nicht, dass die Byzantiner gelegentlich Pfeile in seine Richtung schossen. Irgendeinen Zugang musste es doch geben. Man musste ihn nur finden.
Doch die Befestigungen der alten Römerstadt waren in bestem Zustand und wurden von der Besatzung gut verteidigt. Die beiden Flüsse, der Crati und der Busento, die hier direkt unter den Mauern zusammenliefen, umschlossen die Stadt auf drei Seiten und bildeten ein natürliches Hindernis. Dahinter die eng zusammengepferchten Häuser, die sich den Hang eines Hügels hinaufzogen. Hoch oben thronte die ehemals sarazenische citadella zur Verteidigung der südlichen, der Bergseite.
In den Flussniederungen davor lagerten wir seit Wochen mit vierhundert Mann, waren aber im Grunde zur Untätigkeit verdammt. Nicht nur Guiscard war frustriert. Auch die Männer langweilten sich und vermissten die warmen Betten ihrer Liebsten. Robert hatte seine Wanderung wieder aufgenommen, und ich wandte mich meinen Kameraden zu, die am Ufer standen und ebenfalls zu den Wehrgängen des Feindes hinüberblickten.
Thore beschattete die Augen mit der Hand, um in der grellen Mittagssonne besser sehen zu können. Sein helles Haar, das ihm fast bis auf die Schultern fiel, wehte in der leichten Brise. Neben ihm der dunkelbärtige Dardan. Beide hielten Bögen in den Händen.
»Siehst du den Kerl da oben auf der Mauer?« Thore deutete auf einen der Verteidiger links neben dem Brückentor.
»Was ist mit dem?«
»Der steht da so frech, als könnte ihm keiner was anhaben. Jetzt winkt er auch noch. Ich glaube, der Scheißkerl lacht uns aus. Denkt, seine verdammte Mauer macht ihn unverwundbar.«
»Ich könnte ihm einen Pfeil verpassen«, knurrte Dardan, »dann vergeht ihm das Lachen.«
»Das schaffst du nicht. Zu weit und außerdem viel zu windig.« Thore warf ihm einen kurzen Blick zu und grinste listig.
Ich kannte dieses Grinsen. Dardan sollte lieber vorsichtig sein. Aber so, wie er sich nachdenklich die Lippen leckte, schien er angebissen zu haben. Tatsächlich strich ein unregelmäßiger Wind von den umliegenden Hügeln. Ich blickte zum Himmel auf, an dem weiße Wolkenfetzen dahinsegelten. Die Baumkronen schaukelten sanft, und auf dem Turm über dem gegnerischen Brückentor flatterte ein Banner.
»So windig ist es nun auch wieder nicht.« Dardan streckte sein Kinn vor. »Was gibst du mir, wenn ich den Bastard von der Mauer hole?« Er grinste herausfordernd, was seine gelben Pferdezähne sehen ließ.
»Dann würde ich sagen, gut gemacht!«
»Nein, im Ernst. Was wetten wir?«
»Schieß den Kerl meinetwegen von der Mauer«, mischte ich mich ein. »Aber mach kein Wettspiel daraus. Das ist unpassend.«
Dardans Antwort war nur ein kurzer, verständnisloser Blick.
»An deiner Stelle würde ich auch nicht wetten.« Thore strich sich durch die blonde Mähne und lächelte gönnerhaft. Er war es gewesen, der Dardan das Bogenschießen beigebracht hatte, und führte sich immer noch als sein Lehrmeister auf. »Du kannst nur verlieren.«
»Scheiße, Thore, hast du etwa Angst um dein Geld?«
»Eher um deines. Ich will dich ja nicht beklauen.« Thore wandte sich halb um und zwinkerte mir verschwörerisch zu. Ich verdrehte die Augen gen Himmel. Manchmal benahmen sich die Kerle wie Kinder.
»Hach!« Dardan zog geräuschvoll den Rotz durch die Nase und spuckte verächtlich ins Ufergras. »Hältst dich wohl immer noch für den Besten, was? Aber ich werd’s dir zeigen.«
Er wählte einen Pfeil aus dem ledernen Köcher, der an seinem Gürtel hing, schielte am Schaft entlang, um sich zu vergewissern, dass er vollkommen gerade war, und prüfte sorgfältig die Befiederung.
Dardan war einer der albanischen Flüchtlinge, die sich uns hier in Kalabrien vor neun Jahren angeschlossen hatten. Das war, als Roberts kleine Truppe, gerade erst aus der Heimat gekommen, noch verzweifelt Verstärkung benötigt hatte. Seitdem waren er und einige andere seiner Landsleute verlässliche Krieger geworden. Dardan und Thore forderten sich gern gegenseitig heraus, seit Thore ihm einmal kurzfristig die Frau ausgespannt und der Albaner ihn dafür nach Strich und Faden verprügelt hatte. Aber der Zwischenfall hatte sie nicht daran gehindert, gute Freunde zu werden.
»Also was ist, Thore?«, knurrte Dardan. »Eine runde Goldmünze sagt, ich schieß den Kerl von der Mauer.«
Thore zog die Mundwinkel nach unten und zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Na gut, wenn du unbedingt darauf bestehst. Aber beklag dich nicht, wenn du dein Geld los bist.«
Wir standen am Nordufer des Busento in einer freien Stelle zwischen Weidensträuchern. Eine Gruppe Kameraden näherte sich, neugierig, wie die Wette ausgehen würde. Auch Roger, einen Kopf größer als die meisten und der jüngste der Hauteville-Brüder, befand sich darunter. Für mich war er Freund und Ziehbruder zugleich, denn wir waren zusammen aufgewachsen, auch wenn ich nur ein Findelkind gewesen war.
Ich war jetzt siebenundzwanzig und Roger ein Jahr jünger. Er war Anführer eines kleinen Reiterschwadrons unter Roberts Kommando. In mehreren Unternehmungen hatte er sich als tapferer Anführer erwiesen, besonders vor drei Jahren, als wir zusammen in Sicilia gewesen waren. Er besaß ein fröhliches Gemüt, und die Männer mochten ihn. Ich selbst war mit einer Hundertschaft für Roberts Sicherheit zuständig, obwohl er mich auch gern für andere Aufgaben einsetzte, wenn es ihm in den Sinn kam.
»He, Dardan«, ließ sich Rollos tiefer Bass vernehmen. »Ich setze auch ein Goldstück. Aber gegen dich. Tut mir leid.«
Wir alle wussten, dass Rollo, ein Hüne von Kerl, jede Gelegenheit wahrnahm, sein Geld zu verwetten, solange noch ein paar Silberstücke in seinem Beutel klimperten. Dafür verzichtete er sogar aufs Hurenhaus. Das Glücksspiel und seine abendlichen Trinkgelage waren ihm wichtiger. Was den Wein betraf, war es immer wieder erstaunlich, wie viel er schlucken konnte, ohne dass man es ihm anmerkte.
»Ja, wettet nur gegen mich«, erwiderte Dardan mit zur Schau getragener Selbstsicherheit. »Umso besser. Das macht dann schon zwei Goldstücke, die ich euch abnehmen werde.«
»Erstmal musst du treffen.« Thore grinste herausfordernd. »Was kaum wahrscheinlich ist.«
»Nun mach schon, Dardan«, sagte ich. »Wenn ihr noch lange quatscht, ist der Kerl weg.«
Aber der Besagte stand immer noch, ohne sich zu rühren, auf dem Wehrgang und blickte über unser Zeltlager, das sich hinter uns am unteren Lauf des Crati entlangzog. Auch andere Soldaten der feindlichen militia hielten auf der Mauer Wache, aber Thore hatte sich ausgerechnet diesen ausgesucht. Vielleicht, weil sein Helm so schön silbern in der Sonne glänzte oder weil er besonders großspurig dastand, nicht wissend, dass zwei Normannen am anderen Ufer seinen Tod beschlossen hatten. Allein, um ihre Langeweile zu vertreiben.
Dardan legte den Pfeil auf und beobachtete sorgfältig die Bewegungen des Banners über dem Brückentor. Als der Wind sich einen Augenblick lang beruhigte, holte er tief Luft, zog die Sehne bis ans Ohr, zielte, atmete langsam aus, und schon klang der Bogen wie eine scharf gezupfte Harfensaite. Der Pfeil schnellte davon, stieg in einer flachen Kurve auf, bis er seinen Höhepunkt erreichte, und begann, sich auf das ahnungslose Opfer herabzusenken. Dardan war gut, sehr gut sogar. Ich war sicher, das würde ein Treffer werden. Doch plötzlich begann das Banner auf dem Turm zu flattern, der Wind erfasste den Pfeil und ließ ihn um Haaresbreite das Ziel verfehlen. Erschrocken zuckte der Mann auf der Mauer zusammen und zog sich hastig hinter eine Zinne zurück.
»Verdammte Scheiße!«, fluchte Dardan. »Das war der Wind. Ihr habt es gesehen. Im allerletzten Augenblick!«
»Guter Schuss«, lobte Thore gleichmütig. »Leider daneben.«
»Versuch’s doch selbst. Ich wette, du schaffst es auch nicht. Dann sind wir quitt.«
»Ich bin doch nicht blöd!« Thore grinste. »Also los, her mit dem Geld.«
»Du bist ein verdammter Bastard, Thore. Hab ich dir das schon mal gesagt?«
Der lachte nur. »Schon oft. Aber zahlen musst du trotzdem.«
Missmutig griff Dardan in die Gürteltasche, um seine Wettschulden zu begleichen. Rollo schlug ihm gutgelaunt auf die Schulter. »Mach dir nichts draus, Alter. Wenn wir wieder in Argentano sind, geb ich einen aus.«
»Jaja«, murrte Dardan. »Bis dahin bist du längst wieder abgebrannt.«
Davon konnte man ausgehen, denn Rollo brachte sein Geld immer schnell unter die Leute. Einmal hatte er sogar seine Waffen verpfänden müssen, und wir hatten alle zusammengelegt, um sie auszulösen.
»Versucht es nochmal«, sagte Roger. »Wer trifft, kriegt diesmal eine Goldmünze von mir. Was ist mit dir, Thore? Willst du es nicht doch versuchen?«
Der schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich wollte er nicht seinen guten Ruf als Meisterschütze aufs Spiel setzen.
»Lasst mich es versuchen«, meldete sich Ardoin, ein junger Lombarde, der sich uns vor ein paar Jahren angeschlossen hatte. »Leihst du mir deinen Bogen, Dardan?«
Aber bevor Ardoin einen Pfeil auflegen konnte, ließ sich hinter uns Robert Guiscards tiefe Stimme vernehmen. »Hört mit dem verdammten Unsinn auf!« Aus stahlgrauen Augen starrte er übel gelaunt in die Runde. »Steht nicht so blöd rum und hört auf, eure Pfeile zu vergeuden. Wir haben Besseres zu tun.«
Er trug bequeme Reitstiefel, eine alte, sonnengebleichte Tunika und darüber seinen bewährten Kettenpanzer, häufig ausgebessert, aber wie immer auf Hochglanz poliert. Vor neun Jahren war das als junger Knappe noch meine Aufgabe gewesen. Wenn auf Feldzügen unterwegs, war Robert nicht besser gekleidet als seine Männer. Und doch hätte ihn jeder sofort als den Anführer erkannt, denn er war ein beeindruckender Mann, hochgewachsen und breitschultrig, mit kantigen Gesichtszügen und einem durchdringenden Blick aus tiefliegenden Augen.
Und immer noch hart wie Granit, trotz der ersten grauen Strähnen, die sich durch sein weizenfarbenes Haar zogen. Niemand konnte ihn im Zweikampf bezwingen, und auf dem Schlachtfeld tönte seine Stimme wie die eines Löwen. Er konnte hart durchgreifen. Trägheit und mangelnder Einsatz riefen seinen Zorn hervor, doch Treue und Tapferkeit belohnte er großzügig. Er selbst teilte alles mit seinen Kriegern, gleichgültig, ob Hunger, Mühsal oder Leid. Und am abendlichen Lagerfeuer lauschte er nicht selten den Geschichten, die sie erzählten, stimmte in ihr Gelächter ein oder gab selbst einiges zum Besten. All das und seine Erfolge machten ihn bei den Männern beliebt. Ihm würden sie bis in die Hölle folgen.
Auch für mich war Robert der fähigste unter den normannischen Baronen des Mezzogiorno. Ich war gewiss nicht der Einzige, der ihn in Melfi gern als Graf von Apulien gesehen hätte. Aber das war sein älterer Halbbruder Onfroi, verheiratet mit Gaitelgrima, einer Prinzessin des bedeutenden Fürstentums Salerno. Eine Ehe, die Onfrois Titel Gewicht verlieh, auch bei den Lombarden. Außerdem hatte er zwei kleine Söhne, die ihn beerben würden. Und selbst wenn nicht, standen andere mächtige Männer bereit, die schon länger im Mezzogiorno kämpften und einen größeren Anspruch hatten als Robert.
Deshalb kümmerte er sich in letzter Zeit wenig darum, was in Melfi vor sich ging, sondern setzte all sein Geschick daran, sein kleines Reich in Kalabrien zu erweitern, die Byzantiner Stück für Stück zurückzudrängen, bis das ganze Land von Rossano bis zur Südspitze des Landes ihm gehörte. Besonders das reiche Reggio hatte es ihm angetan. Doch der Weg dorthin führte über das leider bisher unbezwungene Cosenza, dessen Lage an der tausend Jahre alten Via Popilia strategisch wichtig war. Kein Wunder, dass Robert gereizt war.
»Roger!«, knurrte er seinen Bruder an. »Ruf deine Truppe zusammen. Wir haben lang genug untätig auf dem Arsch gesessen. Wird Zeit, den Bastarden eine Lehre zu erteilen.«
Ich konnte mir denken, was er vorhatte. Wenn es uns schon nicht gelang, die Mauern zu überwinden, sollten die reichen Bürger wenigstens Schutzgeld zahlen. Ein paar Dörfer im Umland hatten wir bereits geplündert. Davon wurde man satt, aber nicht reich. Geld war allein in der Stadt zu holen, entweder durch Eroberung oder Tribut. Tribut aber hatten die Byzantiner bisher nicht zahlen wollen, auf Drohungen gepfiffen. Und inzwischen war die Frist, die wir ihnen gesetzt hatten, mehr als abgelaufen.
»Was ist zu tun?«, fragte Roger ohne große Begeisterung.
»Rainulfs Männer satteln bereits die Pferde. Du wirst dich ihnen anschließen. Was an Korn und Vieh zu finden ist, sammelt ihr ein. Scheunen und Bauernhütten könnt ihr in Brand stecken. Aber so, dass die Verheerungen von der Stadt aus gut zu sehen sind. Ein paar Olivenhaine könnt ihr auch vernichten und das eine oder andere Weizenfeld abbrennen. Mal sehen, ob sie dann nicht vernünftig werden.«
Das war die übliche Art, Druck auszuüben, um Schutzgeld zu erpressen oder säumige Zahler daran zu erinnern, dass der jährliche Tribut fällig war. Ohne den Weizen, der gerade heranreifte, würde Cosenza hungern. Und die Zerstörung von Olivenbäumen und Rebstöcken war ein besonders herber Verlust, den zu ersetzen Jahre kosten würde. Wenn wir die Stadt schon nicht erobern konnten, war es an der Zeit, wenigstens ein Zeichen zu setzen, dass mit uns nicht zu spaßen war, dass Normannen die Ebene des Crati beherrschten und sonst niemand.
Rogers Miene hatte sich bei Guiscards Anweisungen verfinstert. Ich wusste auch, warum. Ihm gefiel nicht, von seinem Bruder herumkommandiert zu werden, als wäre er nicht besser als einer seiner Unterführer. Schließlich war auch er ein Hauteville und hatte sich in den drei Jahren, die er im Mezzogiorno verbracht hatte, genügend bewiesen. Er verlangte, auf Augenhöhe behandelt zu werden. Aber seltsamerweise wollte Robert ihm das nicht zugestehen. Mit allen anderen gab er sich umgänglich und großzügig, nur bei seinem jungen Bruder war er oft kurzangebunden, übertrug ihm weniger Verantwortung, als dieser verdient hätte. Vielleicht, weil sie sich nur allzu ähnlich waren. Nicht allein in Wuchs und gutem Aussehen, wie alle aus ihrer Sippe, sondern vor allem in ihrem unbändigen Ehrgeiz. Ich glaube, Robert spürte, dass ihm in seinem jüngsten Bruder ein ernsthafter Konkurrent herangewachsen war.
»Bevor du hier alles abfackelst, sollten wir endlich die verdammte Stadt einnehmen«, sagte Roger aufsässig. »Da springt mehr bei raus, als Tribut abzufordern.«
»Und wie stellst du dir das vor? Willst du die Mauern mit Leitern erstürmen? Wie viele dürfen denn deiner Meinung nach dabei draufgehen? Hast du dir das überlegt? Oder ist es dir gleichgültig, wie viel Blut es kostet?«
Aber Roger ließ sich nicht einschüchtern. In seinen Augen blitzte es verwegen auf. »Niemand wird dabei draufgehen«, kam die kühne Antwort. »Ich erledige das allein. Nur mit einer Handvoll Männer.«
Die Behauptung war wirklich verwegen. Was hatten wir schließlich die letzten Wochen getan, wenn nicht sorgsam alle Möglichkeiten abzuwägen, wie man in die Stadt kommen könnte? Cosenza auszuhungern, dafür fehlte Robert die Geduld. Außerdem hätten wir für eine vollständige Umschließung nicht genug Männer gehabt. Belagerungstürme waren ausgeschlossen. Unmöglich, sie durchs Flussbett und dann nah genug an die Mauer zu schieben. Und eines der Tore mit einem Rammbock zu zertrümmern, das hätte bedeutet, ihn unter dem Pfeilhagel der Byzantiner über eine der zwei schmalen Brücken in Stellung zu bringen. Ein schwieriges und verlustreiches Unterfangen. Und auch ein Leiterangriff hätte zu viele Menschenleben gekostet.
Bei allem Draufgängertum war Robert kühl berechnend, wog Kosten und Nutzen ab, bevor er zuschlug. Es war nicht seine Art, ohne zwingende Not das Leben seiner Männer aufs Spiel zu setzen. Es sah also ganz danach aus, als müssten wir ein weiteres Mal ergebnislos das Feld räumen. Gerade deshalb ärgerte ihn Rogers anmaßende Bemerkung.
Gereizt runzelte er die Stirn. »Ach, so ist das«, sagte er gedehnt. »Du spazierst da einfach so rein und überredest den Kommandanten zur Übergabe. Hab ich das richtig verstanden?«
»So in etwa«, erwiderte Roger ungerührt.
»Das heißt, was wir in zehn Jahren nicht geschafft haben, erledigt mein kleiner Bruder ganz allein an einem sonnigen Nachmittag.« Sein beißender Spott war nicht zu überhören, und die Männer um uns herum lachten.
Roger war rot geworden. Die verletzenden Worte hatten ihr Ziel nicht verfehlt. Dennoch hielt er unverwandt den Blick auf seinen Bruder geheftet. Es war eine Herausforderung. Nicht viel anders als die, mit der Thore den Albaner zur Wette verleitet hatte. Ich konnte nur hoffen, dass er sich das gut überlegt hatte, denn hier ging es um mehr als eine Übung im Bogenschießen. Leider war Roger für tollkühne Einfälle bekannt, bei denen man fürchten musste, dass keiner lebend aus der Sache rauskam.
Vielleicht dachte Robert das Gleiche. Er sagte eine Weile nichts, bedachte seinen Bruder nur mit einem zweifelnden Blick. Am Ende aber gewann seine Neugierde die Oberhand. »Ich nehme an, du hast einen Plan«, grollte er.
»Und ob ich den habe.«
»Dann lass, verflucht nochmal, hören.«
Roger grinste frech und schlug einen Spaziergang am Flussufer vor, um ihm sein Vorhaben zu erklären. Robert bedeutete mir, mich ihnen anzuschließen. Die anderen Kameraden hätten gern auch von Rogers Plan gehört, aber der zog es vor, die Sache vorerst geheim zu halten. Nur Loki, mein großer Abruzzenhund, der mich seit unserem Abenteuer in Salerno begleitete, durfte mit. Aber dem war mehr danach, im Ufergras herumzuschnüffeln und jeden Baum anzupinkeln.
Angeblich hatte Roger eine Stelle gefunden, an der die Stadtmauer niedriger war. Dort könne man in der Nacht mit Wurfhaken und Seilen hochklettern, meinte er, die Wachen überwältigen und eines der Tore öffnen. Durchaus möglich, dachte ich, und sowas war sicher schon gemacht worden. Trotzdem ein Unternehmen, bei dem einem die Haare zu Berge standen, wenn man daran dachte, was alles schiefgehen könnte. Der Erfolg würde von vielen glücklichen Umständen abhängen, und ob es uns gelang, den Feind zu überraschen.
Robert hörte sich die Sache an, ohne ein Wort zu verlieren. Als er nach einer Weile immer noch nichts sagte, begann ich, einige der Gefahren aufzuzählen. Aber Roger lachte nur. »Du bist übervorsichtig, Gilbert. Glaub mir, mit Entschlossenheit und ein paar guten Männern wird das ein Spaziergang.«
»Ach ja? Da habe ich meine Zweifel.«
Ich blickte zu Robert hinüber, neugierig, was er sagen würde. Guiscard war nachdenklich geworden. Er begann, ebenfalls an dem Plan herumzumäkeln. Doch er konnte mir nichts vormachen. In seinen Augen hatte es zu funkeln begonnen. Robert liebte Unternehmungen, bei denen der Feind durch Mut und List überrumpelt wurde. Er hatte angebissen, da war ich mir sicher. Und nachdem er sich noch eine Weile geziert hatte, gab er plötzlich seine Zustimmung.
»Könnte klappen«, brummte er. »Ist aber mehr als gewagt und, wie Gilbert schon sagte, nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Der Plan muss verbessert werden. Überhaupt, vielleicht sollte das ein anderer machen, und nicht du.«
»Wieso?«, schoss Roger zurück. Ihm war erneut das Blut zu Gesicht gestiegen. »Traust du mir das nicht zu?«
»Hör zu, mein Kleiner. Keiner zweifelt an deinem Mut. Aber ich habe nicht vor, wegen diesem elenden Kaff einen Bruder zu verlieren. Noch dazu Mutters Lieblingssöhnchen.« Er lachte kurz auf.
Das hätte er nicht sagen dürfen. Die Bemerkung ärgerte Roger maßlos. Er war zwar der jüngste der zwölf Brüder und tatsächlich der Liebling seiner Mutter, aber Muttersöhnchen ließ er sich von niemandem nennen.
»Kommt gar nicht in Frage!«, rief er aufgebracht. »Der Einfall ist von mir. Also erledige ich das und sonst keiner!«
Er trat ein paar Schritte ans Flussufer und drehte uns wütend den Rücken zu. Ich war ehrlich gesagt besorgt, denn ich kannte ihn. Vorsicht war nicht gerade seine hervorstechendste Tugend. Überhaupt war ich sicher, dass er mit dieser Aktion im Grunde nur seinen Bruder beeindrucken wollte. Besonnenheit statt Kühnheit wäre mir bei einem solchen Vorhaben lieber gewesen. Denn auch ich wollte Roger nicht verlieren.
»Wenn überhaupt, dann sollte alles gut überlegt und geplant werden«, sagte ich.
Robert nickte. »Ganz recht. Deshalb brauchen wir dich, Gilbert. Du bist doch Meister in solchen Dingen.«
»Ich?«, fragte ich und tat unschuldig.
Aber ich wusste schon, auf was er anspielte. Die Eroberung von Salerno, zum Beispiel, als ich mich nachts in die Stadt geschlichen hatte, um für Roberts Heer das Tor zu öffnen. Oder Gerlaines waghalsige Befreiung aus einer uneinnehmbaren Burg. Seitdem hatte es auch noch andere heikle Einsätze gegeben. Robert Guiscard war für seine Kriegslisten berühmt. Nur wenige wussten, dass einige davon auf meine Kappe gingen.
»Ich hatte ein paarmal Glück …«, murmelte ich.
»Mehr als Glück. Ich will, dass du Roger bei der Sache hilfst.«
Der aber warf einen zornigen Blick über die Schulter. »Ich brauche keinen verdammten Aufpasser«, entrüstete er sich. Plötzlich war er nicht mehr so umgänglich wie sonst. Seine Wangen hatten sich gerötet, und seine Augen schossen Blitze.
Aber auch Guiscards Brauen zogen sich drohend zusammen. »Du tust, was ich dir sage. Hast du mich verstanden?«
Wütend starrte Roger wieder auf den trägen Fluss. Seine angespannte Haltung drückte Ärger und Protest aus. Aber nach einer Weile entspannte er sich, drehte sich plötzlich wieder um und grinste. »Na gut. Mit Gilbert kann ich leben.« Er trat näher und legte mir den Arm um die Schultern. »Wir haben zusammen schon so einigen Unsinn verbrochen. Dann werden wir das auch hinkriegen.«
Ganz recht. Unsinn hatten wir jede Menge ausgeheckt, damals in der Heimat, als wir noch Kinder gewesen waren. Aber es war etwas anderes, einem Bauern das Pferd zu klauen, als einen waghalsigen Nachtangriff auf eine hohe, schwerbewachte Stadtmauer durchzuführen. Das heißt, wenn wir es überhaupt bis auf die Mauerkrone schafften und nicht schon vorher im Pfeilhagel verreckten.
Unwillkürlich musste ich an Ivo denken, meinen kleinen Sohn. Und natürlich an Gerlaine. Seit ihrer Entführung durch Sklavenjäger, damals vor drei Jahren, war ich immer ein wenig in Unruhe, wenn ich nicht bei ihnen war, obwohl ich sie in unserem Haus in San Marco Argentano in Sicherheit wusste. Auch Gerlaine ging es ähnlich, wenn ich in den Krieg zog. Wenn sie wüsste, was wir hier vorhatten, würde sie uns für verrückt erklären.
»Ich weiß, du traust dir einiges zu«, sagte ich zu Roger. »Aber so, wie du dir das vorstellst, ist die Sache nur schwer durchführbar. Um ganz ehrlich zu sein, ich halte das für ein Todeskommando.«
So, jetzt hatte ich meine Meinung deutlich gesagt, auch auf die Gefahr hin, dass sie mich für einen Hasenfuß hielten.
»Heißt das, du willst kneifen?«, rief Roger erstaunt.
Ich zuckte mit den Schultern. Ich konnte nur hoffen, dass Robert ein Einsehen hatte. Aber leider war er jetzt Feuer und Flamme, das ließ sich an seiner Miene erkennen. Der Schneid seines Bruders imponierte ihm. Und sollte es tatsächlich klappen, ohne viel Blutvergießen Cosenza zu erobern, wäre das ein Durchbruch. Zum Glück schien er aber meine Einwände ernst zu nehmen.
»Ich verstehe deine Bedenken«, ließ er nach einigem Nachdenken verlauten. »Aber in einem hat Roger recht – es wird Zeit, diese verdammte Stadt einzunehmen. Seit Jahren sitzen wir hier fest und kommen nicht weiter. Langsam bin ich es leid. Also denkt euch gefälligst was Besseres aus. Nehmt so viele Männer, wie ihr braucht. Nur keine unnötigen Heldentaten.«
Beide sahen mich erwartungsvoll an. Dabei hatte ich das ungute Gefühl, im Hintergrund das Fadenspinnen der Nornen zu hören. Doch was hätte ich noch sagen sollen? Keiner kann seinem Schicksal entrinnen, wenn die Stunde geschlagen hat. Schließlich konnte ich mich schlecht drücken.
»Also gut. Aber die Sache läuft nur unter meinem Befehl, damit das klar ist.« Irgendjemand musste Rogers Ungestüm zügeln, wenn wir Erfolg haben wollten.
»Meinetwegen«, stimmte Roger zu und grinste.
»Und du, Robert, versprichst mir eines: Sollte ich dabei draufgehen, kümmerst du dich um Gerlaine und Ivo.«
Robert schlug mir auf die Schulter und lachte. »Red kein dummes Zeug. Dir geschieht nichts, da hab ich keine Sorge. Und wenn doch … für Gerlaine und deinen Balg ist gesorgt.«
Und so war es beschlossen.
Es war früher Abend, die Sonne war hinter den Hügeln verschwunden, und über Cosenza lagen tiefe Schatten. Ich hatte mich von den anderen zurückgezogen und saß am Flussufer, um meine Gedanken zu ordnen. Loki lag neben mir, hatte alle viere von sich gestreckt. Ab und zu hob er die feuchte Nase in den Wind, als fürchtete er, ihm könnte etwas entgehen. Dann ließ er seinen Kopf wieder ins Gras sinken und grunzte zufrieden, wenn ich ihm übers helle Fell strich.
In Salerno war er ein heruntergekommener Straßenköter gewesen. Durch einen seltsamen Zufall waren wir uns begegnet und seitdem unzertrennlich geworden. Er stammte von diesen großen Hirtenhunden ab, wie man sie oft in den Abruzzen findet, war aber ein eigenwilliger Streuner, der die Leine hasste, gern seine eigenen Wege ging und auftauchte, wenn man es am wenigsten erwartete. Deshalb hatte ich ihn nach dem Gestaltwandler, dem verschlagensten und unberechenbarsten aller Götter benannt. Loki schien der Name zu gefallen, denn er hörte darauf.
Ich grübelte darüber nach, wie wir Rogers Vorhaben am besten umsetzen könnten. Aber es fiel mir wenig ein. Stattdessen wanderten die Gedanken zu Gerlaine. Sie war aus unserem Dorf in der Normandie und die Liebe meines Lebens. Gelegentlich überfielen mich noch die schrecklichen Bilder, wie sie blutend und zu Tode verwundet in meinen Armen gelegen hatte. Der Anblick des Pfeils in ihrer Brust und ihre brechenden Augen hatten mich fast um den Verstand gebracht. Es lief mir immer noch kalt über den Rücken, wenn ich daran dachte.
Das war vor drei Jahren in Sicilia gewesen. Seitdem war sie wieder ganz genesen, obwohl sie lang gebraucht hatte, sich von den Monaten in der Gewalt der Sklavenjäger zu erholen. Wir hatten geschworen, einander nie mehr zu verlassen, und ich war dankbar für jeden Tag, den die Götter uns gewährten. Wäre der Pfeil nicht um eine Handbreit abgelenkt worden, hätte sie nicht überlebt.
Wie so oft hängt das Leben von einem Zufall ab oder, wenn man will, von einer Laune der Götter. Die Moslems sprechen vom Willen Allahs. Die Christen nennen es Vorsehung und behaupten, ein gütiger Gott lenke die Geschicke der Menschen, ein Gott der Liebe. Man müsse nur inbrünstig genug zu ihm beten, um erhört zu werden.
Aber daran kann ich nicht glauben. Die Götter lieben uns nicht. Sie sind unberechenbar und grausam. Unglück, Krankheit und Tod begleiten uns auf Schritt und Tritt. Niemand ist gefeit, auch nicht die Christen. Ich habe gute Kameraden verloren, bin selbst so manches Mal nur mit knapper Not davongekommen. Seuchen raffen ganze Dörfer dahin, Kinder sterben im zarten Alter, Frauen im Kindbett und Männer im Kampf. Oft überfällt uns das Unglück, wenn wir es am wenigsten erwarten. Es trifft die Guten wie die Bösen und meist die Unschuldigen. Wo ist da die Gerechtigkeit? Nein, im Grunde treiben die Götter nur ihr Spiel mit uns Menschen, lassen ihre Launen an uns aus. Zu welchem Zweck, das bleibt uns verschlossen. Nach einem höheren Sinn zu forschen, ist müßig.
Im hohen Norden, im Land der Fjorde, aus dem mein Vater stammt, glauben die meisten immer noch, dass es die Nornen sind, die den Lebensfaden der Menschen spinnen. Nach welchem Muster sie vorgehen und wann sie entscheiden, ihn abzuschneiden, das wissen nur sie selbst. Doch gleichwohl, ob es die Nornen sind oder die Götter oder doch nur der Zufall – was bleibt dem Menschen anderes übrig, als mit Fassung zu tragen, was das Schicksal ihm entgegenschleudert.
Ich beugte mich vor und schöpfte ein wenig Wasser aus dem Fluss, um mein Gesicht zu erfrischen. Was hatte mich nur in diese Stimmung versetzt? Die Aussicht auf den gefährlichen Einsatz? Es war nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass ich mein Leben riskierte. Meine Kameraden und ich waren jung, hatten aber schon viel erlebt, Freunde und geliebte Menschen verloren, Blut vergossen, Feinde getötet. Wir wussten, was es heißt, an klaffenden Wunden zu verrecken oder dem Wundbrand zu erliegen. Wir wussten alles über das Sterben. Und wir kannten auch die Angst, die sich einem in die Eingeweide frisst, wenn man dem Feind in der Schlacht gegenübersteht. Und auch den Rausch, der einen erfasst, wenn man diese Angst vergisst und nur noch ans Töten denkt.
Jeder von uns trug Schreckensbilder im Herzen, halb vernarbte Wunden auf der Seele. Jeder hatte seine Weise, damit umzugehen. Rollo gab sich meist gleichmütig. Aber wenn ihn die Schwermut überfiel, suchte er Zuflucht im Wein. Sein Freund, der kleine Hamo, spielte den Witzbold, auch wenn ihm zum Heulen war. Und Thore fand Trost bei den Weibern. Mein Trost lag bei Gerlaine und Ivo. Ich war vernarrt in den Kleinen, hätte gern noch mehr Kinder gehabt. Aber seit man Gerlaine in Sicilia so Schändliches angetan hatte, war sie nicht mehr schwanger geworden. Auch dies ein Scherz der Götter?
Ich hatte mit meinen siebenundzwanzig Jahren immer häufiger angefangen, meine Handlungen zu hinterfragen, mir Gedanken zu machen, wohin mein Weg führte, was das Richtige sein mochte und das Gerechte. Beides ließ sich nicht immer vereinbaren. Und doch war ich nicht wirklich frei. Ich war Roberts Mann und schuldete ihm Gefolgschaft und Treue. So wie jetzt.
Für einen Augenblick schloss ich die Augen und lauschte dem leisen Gurgeln des Flusses und den letzten Vogelrufen des schwindenden Tages. Da hörte ich Schritte im Gras und fuhr zusammen.
»Was, zum Teufel, sitzt du da und starrst ins Wasser?«
Ich blickte auf. Wer hinter mir stand, war Roger, ein freundliches Grinsen auf dem Gesicht. Neben ihm meine beiden Freunde Thore und Ivain.
»Ich denke nach«, sagte ich. »Über dein Vorhaben.«
»Keine Sorge. Wir machen das schon.«
Seine Unbekümmertheit war ansteckend. Und gefährlich. Roger hatte mich bereits als Junge in wilde Streiche verwickelt. Dabei konnte man ihm, was auch immer er anstellte, nicht zürnen, am wenigsten seine Mutter. Besonders nicht bei diesem fröhlichen Lächeln, das er der Welt zeigte. Thore war ihm in dieser Hinsicht ähnlich.
Im Grunde war ich froh, dass die drei mich aus meinen Gedanken gerissen hatten. Sie hockten sich zu mir ins Ufergras und blickten über das Wasser hinüber zur Stadt. Die Sonne war jetzt ganz verschwunden, nur noch der Himmel über uns sorgte für einen Rest von Helligkeit. Die Häuser von Cosenza lagen in tiefer Dämmerung, und in den Fenstern waren Lichter aufgetaucht. Hinter uns ließen sich die üblichen Lagergeräusche vernehmen. Männer, die sich hungrig um die Kochfeuer scharten, Gelächter, gelegentliches Pferdegewieher. Der Geruch von geröstetem Fleisch wehte zu uns herüber. Irgendwo sang einer. Hier am Fluss war es dagegen still. Libellen spielten im schwindenden Licht, Frösche quakten. Auf der Stadtmauer gegenüber war niemand zu sehen. Das hieß aber nicht, dass sie uns nicht im Blick hatten.
»Hier irgendwo ist das Grab dieses Gotenkönigs«, sagte ich. »So lautet die Legende. Alarich hieß der und soll Rom eingenommen haben. Aber hier ist er gestorben. Seine Männer haben angeblich den Busento vorübergehend umgeleitet und ihn im Flussbett begraben.«
Ivain sah auf. »Warum denn das?«
In der Dämmerung bemerkte man kaum die schrecklichen Brandnarben, die seine linke Gesichtshälfte verunstalteten. Als Halbwüchsiger war er bei einem Überfall ins Feuer gefallen. Menschen fürchteten sich deshalb vor ihm, wenn sie ihm ins Gesicht blickten, und machten das Zeichen gegen den bösen Blick. Ganz zu Unrecht, denn er tat keinem etwas zuleide. Außer unseren Feinden natürlich.
»Es sollte wohl niemand seine letzte Ruhe stören. Oder seinen Goldschatz finden, den sie ihm ins Grab gelegt haben.«
Dieser Alarich hatte ganz Rom geplündert, all die reichen Häuser und Paläste, seinen Schatz mit sich herumgeschleppt und ihn am Ende doch nicht mitnehmen können in die Unterwelt. Doch nicht einmal seinen Nachkommen hatte er das Gold gegönnt.
Thore pfiff durch die Zähne. »Muss aber ein gewaltiger Schatz gewesen sein, wenn er Rom geplündert hat. Statt uns mit Cosenza abzumühen, sollten wir vielleicht nach dem Grab suchen.«
»Das haben schon viele versucht.«
»Dummes Zeug«, meinte Roger. »Glaubt doch nicht an Ammenmärchen. Ich bin sicher, es gibt keinen Schatz. Und wenn, dann ist er schon längst gehoben. Lasst uns lieber darüber reden, wie wir über die verdammte Mauer kommen. Also, was ist, Gilbert? Für sowas hat Robert doch eure Truppe aufgestellt. Wird Zeit, dass ihr endlich mal euer Brot verdient.« Er grinste mich herausfordernd an.
»He, mit solchen Sprüchen machst du dir keine Freunde«, schoss ich zurück, aber es war nicht bös gemeint.
Roger hatte recht. Wir gehörten zur Hundertschaft der Besten. Und ausgerechnet ich war ihr Anführer. Es war Roberts Idee gewesen, eine Schutztruppe aufzustellen, eine besonders erprobte und kampfstarke Einheit, ähnlich wie die berühmten Waräger in Byzanz, die zum größten Teil aus Nordmännern bestanden, oder wie die húskarlar des Dänenkönigs Knut, wie seine axtschwingenden Leibgardisten hießen.
Gunnar Knutson, der selbst bei den Warägern gedient hatte und ein erfahrener Waffenmeister war, hatte mir geholfen, die Männer auszusuchen, sie auszurüsten und in Form zu halten. Alle waren Meister im Umgang mit Lanze, Schwert und Kriegsaxt, viele auch mit dem Bogen. Und ihre Pferde beherrschten sie, als wären sie mit ihnen verwachsen. Denn Normannen kämpfen am liebsten hoch zu Ross.
Der Kern der Truppe bestand aus alten Kameraden, die mit uns vor zehn Jahren aus der Heimat gekommen waren. Das heißt, soweit sie die vielen Schlachten und Scharmützel im Mezzogiorno überlebt hatten, denn einige weilten nicht mehr unter uns. Anders als sonst üblich, stattete Robert uns auf seine Kosten mit den besten Waffen und Pferden aus, was unter den anderen Kriegern nicht selten Neid weckte, die ihre Ausrüstung selbst bezahlen mussten. Irgendjemand hatte uns deshalb mal verächtlich »les maudits chiens de Guiscard« genannt, Guiscards verdammte Hunde.
Der Name war haften geblieben, wir hatten uns daran gewöhnt, waren sogar stolz darauf. Ich hatte ein Banner anfertigen lassen mit einem weißen Hund auf schwarzem Grund, ganz wie mein Loki. Es passte irgendwie, denn an meinem großen Abruzzenvieh erkannte man uns schon von weitem.
Zwanzig Mann der Truppe standen unter Gunnars Befehl immer zum Schutz von Roberts Familie bereit, die sich gegenwärtig in Argentano aufhielt. Die Übrigen dienten unter meiner Führung als Roberts Leibwache und waren je nach Bedarf auch für andere Aufgaben verfügbar, geheime oder besonders gefährliche. So etwas wie Rogers nächtlicher Überfall hier in Cosenza gehörte durchaus zu unseren Aufgaben.
Er sprach nochmal von jenem Mauerabschnitt, wo man es seiner Ansicht nach mit Wurfhaken und Seilen schaffen könnte hochzuklettern. »Tief in der Nacht natürlich, wenn die Wachen schlafen. Und dann öffnen wir das Tor.«
»Wo ist die Stelle?«, fragte Thore. Als Roger es uns erklärte, schüttelte er den Kopf. »Zu weit vom Tor weg. Selbst wenn wir es unbemerkt über die Mauer schaffen, müssten wir noch durch die halbe Stadt rennen. Wir kennen uns nicht aus und laufen Gefahr, entdeckt zu werden, bevor wir auch nur in die Nähe des Tors kommen.«
Ähnliches hatte ich ihm auch schon gesagt, aber Roger ließ nicht locker. »Dann meinetwegen an anderer Stelle. Vielleicht mit Leitern.«
»Leitern sind sperrig«, sagte ich. »Die müssten wir erstmal über den Fluss schaffen. Vergiss nicht, auf den Wehrgängen stehen überall Wachen. Auch nachts. Unbemerkt ist das nicht zu machen.«
»Und mit genug Männern?«
»Hast du schon mal einen Leiterangriff miterlebt? Das ist kein Spaziergang. Es braucht nicht viele Verteidiger, um die Leitern von der Mauer zu stoßen, schwere Steine auf uns zu werfen und uns mit Pfeilen zu beharken. Unsere Verluste wären gewaltig und die Aussichten auf Erfolg eher gering.«
Wir besprachen noch andere Möglichkeiten und verwarfen diese ebenso schnell. Roger wurde allmählich ungehalten. Schließlich hatte er seinem Bruder versprochen, die Stadt im Handstreich zu erobern.
»Verdammt nochmal!«, rief er. »Ich weiß, ich habe nicht eure Erfahrung in diesen Dingen, aber es muss doch irgendwie möglich sein, in diese verfluchte Stadt zu kommen.«
Während er sich mit Thore noch einmal über Leitern stritt, bemerkte ich, wie Loki sich erhob, die Luft prüfte und sich davonschlich. Anscheinend war ihm ebenso langweilig geworden wie mir. Das ganze Gerede brachte nichts. Das Verflixte war, dass Robert einen Erfolg von uns erwartete. Herbeizaubern ließ der sich allerdings nicht.
Roger runzelte die Stirn und dachte lange nach. Plötzlich hellte sich seine Miene auf. »Dann müssen wir uns eben verkleiden.«
»Verkleiden?« Thore sah ihn verdutzt an.
»Ja. Wir schleichen uns ein. Am helllichten Tag bei geöffneten Toren.«
Thore schüttelte verständnislos den Kopf, aber ich hatte begriffen. Natürlich, das war’s. »Dazu brauchen wir Ardoin«, sagte ich.
Roger nickte. »Der sieht nicht so verdammt normannisch aus wie wir.« Ivain erbot sich, ihn zu holen, und entfernte sich.
»Bin ich blöd?«, rief Thore. »Wie wollt ihr euch einschleichen, wenn die Tore verschlossen sind?«
»Die sind nur verschlossen, weil wir die Stadt belagern«, sagte ich. »Also heben wir die Belagerung auf und ziehen ab. Sie werden Robert ein paar Kundschafter nachschicken, aber sobald er mit dem Heer außer Sichtweite ist, öffnen sie bestimmt die Tore.«
Langsam dämmerte es ihm. »Und bis dahin verstecken wir uns.«
»Ganz recht. Die Städter werden nach diesen Wochen gierig nach frischem Gemüse sein und ihre Bauern einlassen. Und die sollten uns als Tarnung dienen.«
»Ardoin könnte sich als Mönch verkleiden«, schlug Roger vor. »Das erweckt Vertrauen.«
Ardoin stammte aus Salerno. Mit seinem dunklen Bart und den schwarzen Locken unterschied er sich nicht von den Leuten aus der Gegend. Er war ein tapferer Bursche, mittelgroß, schlank und zäh, konnte mit allen Waffen umgehen und sprach besser Griechisch als wir alle zusammen. Das war wichtig, denn ein lombardisch untermischtes Griechisch war die Sprache des südlichen Kalabriens. Außerdem hatte er Ähnliches schon mal gemacht. Mit mir zusammen.
»Und wo willst du eine Kutte auftreiben?«
Roger deutete hinter uns auf eine Hügelkette. »Da oben ist ein Kloster«, sagte er. »Da wird sich schon was finden.«
Ivain war inzwischen mit Ardoin zurückgekehrt. Wir erklärten ihm, was wir vorhatten.
»Wie in Salerno«, sagte er nur und zwinkerte mir zu.
Auch Thore war jetzt ganz bei der Sache. »Wir brauchen einen Bauern, der überzeugend wirkt«, erklärte er. »Am besten einen harmlosen Alten, den keiner verdächtigen würde. Und einen großen Karren muss er haben, auf dem Roger und Gilbert sich verstecken können, voll mit Heu bepackt.«
»Ich frag mich, ob so ein Kerl uns am Ende nicht doch ans Messer liefert«, gab ich zu bedenken.
»Wir drohen, seine Familie umzubringen, sollte er uns verraten.«
Alle nickten ihre Zustimmung. Das war also in groben Zügen der Plan. Robert Guiscard würde mit dem Heer abziehen, während wir einen Bauern zwingen würden, uns vor Einbruch der Dunkelheit in die Stadt zu bringen. Dort mussten wir bis Roberts Rückkehr ein Versteck finden, um dann in der Nacht die Wachen zu erledigen und das Stadttor zu öffnen.
»Gleich morgen früh werde ich Reiter ausschicken, um einen passenden Bauernhof zu finden«, sagte Roger. »Am besten ein abgelegenes Gehöft.«
»Lass das meine Leute machen«, sagte ich. »Je weniger davon wissen, umso besser.«
Thore und ich blieben am Flussufer zurück, während die anderen zum Lager zurückkehrten, um sich ihr Abendmahl zu sichern, bevor alles verzehrt war. Auch mir knurrte der Magen. Es war Nacht geworden. Über der dunklen Flusslandschaft glitzerte ein Meer von Sternen, manche so hell wie winzige Edelsteine auf einem nachtschwarzen Gewand. Und über das Wasser huschten kaum erkennbare Schatten – Fledermäuse, die nach Nahrung jagten. Thore und ich schwiegen eine Weile, als plötzlich Loki geruhte, uns seine Aufwartung zu machen. Er kam am Ufer entlang auf uns zugelaufen und trug etwas im Maul, das er vor mir ins Gras legte und mich dann schwanzwedelnd anlächelte.
»Nicht doch!«, rief ich lachend. »Eine verdammte Ratte!«
Als ich ihm übers Fell streichen wollte, merkte ich, dass es nass war. Und außerdem stank er zum Erbarmen. War er durch den Fluss geschwommen? Nein, er roch eher nach einer Latrine. »Wo hast du dich nur wieder rumgetrieben, du Halunke?« Ich packte die Ratte mit zwei Fingern am Schwanz und warf sie in den Fluss. Loki sprang hinterher und fischte sie aus dem Wasser. Dann kam er mit dem toten Biest im Maul an Land, ließ es fallen und schüttelte sich, dass die Tropfen flogen. Hoffentlich war er durch den Sprung ins Wasser ein wenig sauberer geworden.
Ich scheuchte ihn weg. »Verschwinde mit deiner Ratte!«
»Er will doch nur sein Fressen mit dir teilen«, meinte Thore und lachte.
»Ich weiß. Ist leider auch nicht das erste Mal.«
Während Loki im Gras lag und an seiner Ratte knabberte, blickte ich zum Himmel auf. »Gut, dass Neumond ist. Das könnte nützlich werden.«
Thore fasste mich am Arm. »Du musst das nicht auf dich nehmen. Lass mich gehen.«
»Was ist der Unterschied? Außerdem ist deine Chara schwanger.«
In Sicilia hatte Thore sich in eine Griechin aus Catania verliebt. Er verliebte sich oft. Oder die Frauen verliebten sich in ihn, in seine stattliche Gestalt und sein freches Grinsen. Zu meiner Überraschung war es diesmal aber eine ernsthafte Sache geworden, und Chara war ihm nach Argentano gefolgt. Dort hatten wir nach unserer Heimkehr eine Doppelhochzeit gefeiert.
»Du bist unser Anführer, Gilbert. Es gehört sich nicht, dass du dein Leben riskierst. Lass mich das machen.«
»Und du bist mein Freund. Also halt die Klappe!«
Die Kloake
Am nächsten Tag durchsuchten wir die Gegend nach einem Bauern für unser Vorhaben. In der Nähe der Stadt war sämtliches Landvolk verschwunden und in die Berge geflüchtet. Kein Wunder, denn der Einfall einer Horde Normannen versprach nichts Gutes.
Robert hatte vor der Belagerung angeordnet, nur Nahrungsmittel zu nehmen und die Leute ansonsten zu verschonen. Trotzdem trafen wir hier und da auf abgebrannte Hütten, aufgedunsene Viehleiber, aus denen man wahllos Fleischstücke herausgeschnitten hatte, und sogar auf ein paar menschliche Kadaver, Männer, die sich gewehrt hatten. Hätten sie es besser nicht getan. Nun lagen sie mit schwarzen Gesichtern und aufgeblähten Bäuchen in der Mittagshitze und stanken.
Auch eine halbnackte Frauenleiche war darunter. Ich wandte mich ab, wollte gar nicht wissen, was man dem Weib angetan hatte, denn ich verabscheue solche Greueltaten aus ganzem Herzen. Es erinnert mich jedes Mal an meine Mutter, die vor meinen Augen vergewaltigt und ermordet worden war. Damals war ich fünf Jahre alt gewesen. Selbst wenn man den Kerlen den Galgen androht, kommt so etwas immer wieder vor.
Wir waren schon fast bereit, die Suche aufzugeben, als wir in einem Seitental an einen winzigen Hof kamen, in dem die Familie geblieben war. Viel hatte das Leben diesen Menschen nicht geschenkt, zwei karge Äcker, ein paar Olivenbäume, eine angepflockte Ziege, die vergeblich versuchte, vor meinem Hund zu fliehen. Die Hütte bestand nur aus einem Raum und war aus groben Feldsteinen errichtet. Der Bauer und sein Weib fielen vor uns auf die Knie und flehten um Gnade.
Ein junger Bursche, vielleicht der Sohn, stand im Hintergrund neben einer Schafhürde und warf uns finstere Blicke zu. Die Bauersfrau hielt ein kleines Kind im Arm, das sie vor kurzem noch gestillt hatte. Zwei schon etwas ältere Geschwister lugten aus dem Hütteneingang und verfolgten jede unserer Bewegungen mit großen, dunklen Kinderaugen, in denen die Furcht stand.
Der Bauer musste etwa fünfzig Jahre zählen, bärtig, verfilzte Haare, tiefe Furchen in einem Gesicht wie Leder, der Leib ausgemergelt von harter Arbeit, Dreck unter zerbrochenen Fingernägeln. Schuhe schien er nicht zu besitzen. Sein Weib war wesentlich jünger und gar nicht mal hässlich. Wahrscheinlich seine zweite Frau, nachdem die erste im Kindbett gestorben war.
Wir stiegen von den Pferden und machten ihnen ein wenig Angst. Das gehörte zu unserem Vorhaben. Besonders vor Rollos grimmer Miene und mächtigen Fäusten schreckten sie zurück. Und die Kinder schrien vor Angst, als Loki sich ihnen näherte.
Ragnar schlug dem jungen Knecht die Nase blutig, als dieser aufmucken wollte, und Thore schnappte sich eines der schreienden Kleinen, so dass die Mutter jämmerlich aufheulte und ihre milchgeschwollenen Brüste entblößte. Lieber sollten wir ihr etwas antun als einem der Kinder. Der Mann stand wie gelähmt daneben, überzeugt, wir würden sein Weib schänden und danach alle umbringen.
Wir trieben sie zusammen und bewachten sie mit blanken Klingen. Ich winkte den Bauern zu mir heran, dem vor Angst fast die Knie versagten. Fünf kräftige Kerle in voller Rüstung, die mit gezogenen Schwertern seine kleine Familie in Schach hielten, das war zu viel für den armen Kerl. Er zitterte am ganzen Leib, murmelte unverständliches Zeug und hörte nicht auf, sich zu bekreuzigen. Dann warf er sich vor mir auf die Knie und versuchte, mir die Hand zu küssen. Ich aber fasste ihn am Arm und zog ihn wieder auf die Füße.
»Wie heißt du?«, fragte ich in nicht unfreundlichem Ton.
»Orestes, Herr.« Es klang kläglich, fast wie ein Schluchzen.
»Hör zu, Orestes, wir werden dir und den Deinen nichts antun. Aber nur, wenn du uns hilfst.«
»Helfen?« Mit großen Augen starrte er mich an. »Was muss ich tun?« Seine Stimme bebte, aber wenigstens sprach er jetzt etwas deutlicher.
»Du wirst uns helfen, Cosenza einzunehmen.«
Er fuhr zurück. Der Gedanke schien für ihn so abwegig, dass er glaubte, sich verhört zu haben. Oder dass ich meinen Scherz mit ihm trieb. Ich musste mich wiederholen. Als er begriff, dass es mir ernst war, wich er noch einen Schritt zurück, als habe er einen Verrückten vor sich. »Cosenza? Wie kann ich … das ist unmöglich!«, stotterte er.
»Kennst du dich in der Stadt aus?«
»Ja, Herr. Mein Sohn und ich gehen dort häufig zum Markt.«
»Na also. Du wirst uns heimlich in die Stadt bringen und uns helfen, ein Versteck zu finden. Deine Familie hier halten wir so lange als Geiseln fest, bis Cosenza in unserer Gewalt ist. Dann lassen wir euch alle frei, das ist versprochen. Aber wehe, du tust nicht, was wir sagen, dann seid ihr alle tot. Hast du verstanden? Wiederhol, was ich gesagt habe!«
»Wir sind alle tot«, murmelte er.
»Nur, wenn du nicht tust, was ich dir auftrage.«
Natürlich hatte ich nicht vor, seine Familie umzubringen, doch er schien keine Zweifel an meinen Worten zu hegen. Das Blut war ihm aus dem Gesicht gewichen. Grau und alt sah er plötzlich aus. Aber er nickte heftig, wie um mich zu beschwichtigen. So richtig verstanden hatte er allerdings immer noch nicht, das konnte ich sehen. Also erklärte ich ihm alles nochmal, langsam und sorgfältig. Zweimal sogar. Dann schien endlich bei ihm angekommen zu sein, was wir von ihm wollten. Unsicher leckte er sich die Lippen und blickte zu seinem Weib hinüber, die ängstlich ihr Kleines an die Brust drückte. Es war ein langer Blick, mit dem er sie bedachte, als wollte er Abschied nehmen.
»Und wenn ich sterbe, Herr?«, hauchte er. »Lasst Ihr sie auch dann frei?«
»Natürlich«, sagte ich. »Vorausgesetzt, du verrätst uns nicht.«
Auch das musste ich ihm wiederholen. Sein Weib wimmerte bei diesen Worten, als wäre er schon tot. Aber der Bauer war jetzt gefasster, holte tief Luft und hatte plötzlich neuen Mut gefunden, Mut im Angesicht des Unvermeidlichen. Sein eigenes, klägliches Leben bedeutete ihm vielleicht nicht viel, aber für seine Familie war er bereit, alles zu tun. Er zeigte mehr Haltung, als ich ihm zugetraut hätte. Umso besser.
Wir banden Orestes und seinem Sohn die Hände, legten ihnen einen Strick um den Hals, dessen Enden wir jeweils am Sattelknauf eines der Pferde befestigten. Bei dem Weib verzichteten wir darauf. Sie und die Kinder würden wohl nicht weglaufen. Einen Karren besaß der Bauer nicht, aber irgendwo würden wir schon einen auftreiben. Auf der Wiese hinter dem Haus weidete ein altes Maultier. Wir beluden es mit Gemüse aus dem Garten und nahmen auch ein paar Hühner mit, damit die Familie in ihrer Geiselhaft etwas zu essen bekäme. Dann machten wir uns auf den Rückweg.
Der erste Schritt war getan. Unterwegs fanden wir bald auch einen großen, zweirädrigen Ochsenkarren samt den dazugehörenden Zugtieren und frisches Heu, das auf einer Wiese trocknete. Wir beluden den Karren, bis er voll war, und ließen auch die kleinen Kinder darauf fahren. Etwas abseits gelegen, aber in der Nähe des Lagers, entdeckten wir einen verlassenen Hof. Dort sperrten wir die Bauernfamilie in die Scheune. Wir ließen Rollo und Ragnar zur Bewachung zurück, während Thore und ich ins Lager ritten, um zu berichten.
Robert zeigte sich zufrieden. »Gut. Dann können wir morgen früh abziehen. Ich nehme an, ihr drei haltet euch auf dem Hof versteckt, bis sie die Tore öffnen.«
»Richtig. Aber wir brauchen noch eine Kutte für Ardoin.«
»Schon erledigt«, sagte Roger. »Wir waren auch nicht untätig.«
»Und wo werdet ihr euch in der Stadt verstecken?«, fragte Robert. »Wie wisst ihr überhaupt, wann ihr losschlagen müsst?«
»Der Bauer kennt sich in Cosenza aus. Er sagt, das beste Versteck sei auf dem Turm des duomo. Da steigt niemand hinauf. Und von da oben können wir sehen, wann du mit dem Heer zurück bist.«
»Ich hoffe, ihr könnt dem Kerl vertrauen.«
»Wenn nicht, dann stirbt seine Familie«, erwiderte ich grimmig. »Und das weiß er.«
Wir hatten alles vorbereitet. Trotzdem hatte ich ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Ich schlenderte zum Flussufer hinüber, um noch einmal über alles nachzudenken. Auf dem Weg dorthin sah ich mich nach Loki um. Aber wie so oft war er verschwunden. Hoffentlich brachte er mir nicht wieder eine Ratte von seinen Streifzügen mit, dachte ich belustigt.
Am Ufer blickte ich zur Stadt hinüber. Auf dem Wehrgang standen Soldaten der byzantinischen militia und starrten herüber. Etwas weiter links lag das Stadttor, das, soweit ich es erkennen konnte, aus mächtigen Eichenbohlen bestand. Davor ein eisernes Fallgitter. Vom Nordufer führte eine schmale, steinerne Brücke mit runden Bögen über den Fluss, die vermutlich noch aus der Römerzeit stammte.
Morgen oder übermorgen würden Roger und ich in unserem Ochsenkarren darüberrumpeln, im Heu versteckt. Heu für die Pferde der Besatzung, das sollte der Bauer den Wachen sagen. Würden sie uns ohne sorgsame Überprüfung durchlassen? Hoffentlich stocherten sie nicht mit Speeren im Heu herum oder bestanden darauf, gleich abzuladen. Ardoin musste sich etwas einfallen lassen, um sie abzulenken, und gleichzeitig dem Bauern zur Seite stehen, damit dieser nichts Dummes anstellte. Eine Menge Gefahren und Unwägbarkeiten. Je mehr ich darüber nachdachte, umso weniger gefiel mir der Plan.
Ein Schwarm Wasservögel stieg lärmend auf und riss mich aus meinen Grübeleien. Dabei entdeckte ich Loki am anderen Ufer unterhalb der Stadtmauer. Er musste die Vögel aufgescheucht haben. Vielleicht hatte er mich gesehen, jedenfalls kam er über die Brücke gerannt. Ein Pfeil löste sich von der Zinne, verfehlte ihn aber zu meiner Erleichterung. Mit langen Sätzen erreichte er das diesseitige Ufer und stürmte mit hängender Zunge heran. Ein paar Schritte vor mir blieb er heftig atmend stehen, wedelte freudig mit dem Schwanz und setzte sich dann auf die Hinterläufe. Ich blickte zur Stadtmauer hinüber, aber da schien niemand mehr auf uns schießen zu wollen.
Als ich mich ihm näherte, wehte mir wieder dieser eklige Geruch entgegen. Sein Bauchfell war durchnässt, und die Läufe dunkel vor schleimigem Dreck. Wo, zum Teufel, war er gewesen? Ich roch an ihm. Ohne Zweifel Latrinengestank. Er musste wieder Ratten gejagt haben.
Auf einmal kam mir die Erleuchtung. Denn wo gab es mehr Ratten als anderswo? In der Stadt natürlich. Loki musste einen Zugang gefunden haben. Vielleicht einen Ausfluss, eine Kloake, die unter der Mauer hindurch in den Fluss führte. Cosenza lag an einem Hang. Möglicherweise gab es ein unterirdisches Kanalsystem, das Abwässer sammelte und in den Fluss spülte. Ich hatte von so etwas gehört. Kluge, römische Baukunst. Auch hier in Cosenza? Warum nicht? Die Stadt war alt, ursprünglich römisch. Und wenn so ein großer Hund wie Loki durchgekommen war, musste es uns auch gelingen. War das die Lösung, nach der wir gesucht hatten?
»He, du Schlingel. Wenn ich die Stelle finde, kriegst du ein Riesenstück Rindfleisch, ganz für dich allein. Und einen Knochen obendrein.«
Loki sprang auf und blickte mich erwartungsvoll an. Ich hob ein Aststück vom Boden auf und warf es in den Fluss. Der Hund hetzte hinterher und schwamm die kurze Entfernung, bis er den Ast zu fassen bekam. Wieder an Land, ließ er die hölzerne Beute fallen, schüttelte sich und versprühte Wasser in alle Richtungen. Zumindest stank er jetzt weniger.
Ich wanderte langsam am Fluss entlang, um am gegenüberliegenden Ufer den Ausgang der Kloake zu finden, wenn es denn so etwas gab. Das Flussufer unterhalb der Mauer war von allerlei Gesträuch bedeckt. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich sicher war, die Stelle gefunden zu haben. Sie lag in der Nähe, wo der Busento sich mit dem Crati vereinigte, hinter Büschen versteckt. Was wie eine kleine Einbuchtung am Fuß der Mauer aussah, musste die Mündung sein, denn die Oberfläche unter den überhängenden Sträuchern kräuselte sich leicht, und die Farbe des Wassers kam mir eine Winzigkeit dunkler vor.
Mein langsames Auf-und-ab-Wandern musste die Aufmerksamkeit der militia auf der Mauer erregt haben, denn plötzlich zischte ein Pfeil an meinem Ohr vorbei, so dicht, dass ich den Luftzug spürte. Ein zweiter jagte knapp über meinem Kopf in die Büsche hinter mir. Ich rief Loki und zwängte mich eiligst zwischen die Sträucher. Noch ein Pfeil streifte mein Kettenhemd an der Schulter, dann warf ich mich hinter einen Baum. Der Hund war mir gefolgt und hatte sich ebenfalls zwischen den Zweigen hindurchgezwängt. Wütend knurrend blieb er neben mir stehen, bis ich ihn am Fell packte und aus der Schusslinie zerrte.
Vorsichtig spähte ich zur Stadtmauer hinüber. Eine Handvoll Bogenschützen hatte sich auf dem Wehrgang versammelt. Sie hoben ihre Fäuste und brüllten Beleidigungen zu mir herüber. Dann lachten sie. Es hatte ihnen Spaß gemacht, mich rennen zu sehen. Nur gut, dass sie nicht besser schießen konnten als Dardan. Rasch entfernte ich mich vom Ufer und lief ins Lager, um Roger und die anderen zusammenzurufen.
»Ich weiß jetzt, wie wir in die Stadt gelangen können«, sagte ich aufgeregt. »Schon heute Nacht können wir es versuchen.«
»Mit dem Heuwagen?«, fragte Thore verständnislos.
»Nein, nicht mit dem Heuwagen. Es gibt einen versteckten Eingang, ihr werdet sehen. Den Bauern nehmen wir aber trotzdem mit. Damit wir uns in der Stadt nicht verlaufen.«
An seinem oberen Lauf wie hier bei Cosenza ist der Crati weder besonders breit noch besonders tief. Noch weniger sein Zubringer, der Busento. Im Hochsommer ist dieser fast nur noch ein breiter Bach, während er im Frühjahr, nach Regenfällen und der Schneeschmelze auf den Bergen, gefährlich anschwillt. Auch jetzt war er noch gut gefüllt, aber nicht so sehr, dass man ihn nicht leicht durchwaten konnte.
Den Busento also hatten wir vor, in der Nacht zu durchqueren, aber weiter flussaufwärts und in einiger Entfernung von der Stadt, um nicht die militia zu alarmieren. Die passende Stelle hatte ich am späten Nachmittag ausgespäht. Zwischen dem Flusslauf und dem Hügel der citadella befand sich nichts als Brachland und vereinzelte Waldstücke. Gute Deckung also, um ungesehen bis zur Stadtbefestigung schleichen und uns dann im Schatten der Mauer weiter bis zum Ausfluss der Kloake vorantasten zu können. Ob ein Einstieg durch die verborgene Röhre möglich war, konnte niemand wissen, aber ich hatte Robert und die anderen überzeugt, es zumindest zu versuchen.
Für diese Aufgabe hatten wir unsere kleine Einsatztruppe leicht erweitert. Neben Roger, Ardoin und mir war auch Thore nicht davon abzuhalten gewesen, mitzukommen, was sich später als Segen herausstellen sollte. Gern hätten wir auch Rollo dabeigehabt, mussten aber wegen seiner Körpermaße auf ihn verzichten. Denn wer konnte wissen, wie eng der unterirdische Tunnel sein würde. Dafür nahmen wir noch Ragnar mit, ein schlanker, sehniger Kerl und großartiger Schwertkämpfer. Mehr Männer hielt ich nicht für angesagt, wenn wir unentdeckt bleiben wollten. Loki ließ ich angekettet zurück. Er hatte seine große Fleischportion genossen und räkelte sich faul neben meinem Zelt.
Robert Guiscard wechselte aufmunternde Worte mit uns und versprach, das Heer bereitzuhalten. Die Brüder umarmten einander, und dann, etwa eine Stunde nach Mitternacht, machten wir uns auf den Weg. Dank des Neumonds war die Nacht stockdunkel, und es dauerte eine Weile, bis sich unsere Augen an das karge Sternenlicht gewöhnt hatten. Aber danach ging es zügig voran.
Eine Meile weiter nördlich verließen wir den Weg, schlugen uns durch dichtes Gestrüpp und näherten uns wieder dem Flussbett. Unsere Gegenwart scheuchte ein paar Wasservögel aus der Deckung, ansonsten herrschte Grabesstille. Selbst die Frösche schwiegen. Am Ufer angekommen, trafen wir die letzten Vorbereitungen. Lanzen und Schilde hatten wir zurückgelassen. Zu sperrig für das, was wir vorhatten. Und da uns kein Glitzern von Helm und Panzer verraten sollte, trugen wir dunkles Leinen über den Kettenhemden, und um die Helme banden wir lose Zweige und Gräser. Gesichter und Hände schwärzten wir mit Ruß und Asche.
»He, Gilbert, bist du sicher, du stammst nicht von den Orks ab?«, spottete Ragnar. »Du siehst zum Fürchten aus. Wie ein Gespenst aus der Unterwelt.«
Thore lachte. »Du musst ein neues Banner nähen lassen, Gilbert. Von nun an sind wir Roberts Orks.«
Unterdrücktes Gelächter war die Antwort.
Auch dem Bauern Orestes hatten wir Gesicht und Hände geschwärzt. Bis jetzt hielt der Mann sich gut, obwohl ich spürte, dass er Angst hatte. Aber mit Frau und Kindern in Rollos Gewalt hatte er keine Wahl, als sich zu fügen. Trotzdem beschloss ich, ihn nicht aus den Augen zu lassen.
»Keine Angst, Orestes«, raunte ich ihm zu, »es wird schon werden.« Und zu Roger: »Wir sind so weit.«
»Also los, Jungs«, sagte Roger und stieg gleich als Erster ins seichte Wasser, als könnte er es gar nicht abwarten.
Einer nach dem anderen folgten wir ihm. Vor mir ging Orestes. Ich kam als Letzter, um sicherzustellen, dass sich keiner im Dunkeln verirrte. Zur Mitte hin wurde der Fluss tiefer. Aber selbst da reichte er uns nur bis knapp über die Hüften. Jeder hatte sein Schwert auf den Rücken geschnallt und trug einen langen Dolch im Gürtel. Thore und Ardoin waren außerdem mit Pfeil und Bogen bewaffnet, die sie an den tieferen Stellen schützend über dem Kopf hielten. Ich hatte Fackeln dabei, Ragnar einiges an Werkzeug, und Orestes trug ein langes, zusammengerolltes Seil um die Schultern. Roger und ich hatten außerdem noch jeder eine Kriegsaxt im Gürtel. So glaubten wir, für alles gerüstet zu sein.
Am anderen Ufer leerten wir die vollgelaufenen Stiefel aus, dann gingen wir weiter. Die Nacht war pechschwarz, besonders inmitten der Bäume und Büsche des Brachlandes. Unbeholfen stolperten wir über Wurzeln und Steine, denn nur schemenhaft ließ sich erkennen, wohin man die Füße zu setzen hatte. Ab und zu fluchte einer leise, bis Roger sich umdrehte und zischte, wir sollten endlich das Maul halten. Ohne den Fluss linker Hand, der die Sterne widerspiegelte, und ohne die unbestimmte, dunkle Masse des Burghügels zur Rechten hätten wir uns verlaufen. Im Flussbett selbst wäre das Gehen leichter gewesen, aber die unvermeidlichen Geräusche beim Wassertreten hätten uns verraten können, besonders unterhalb der Mauer.
Von Menschen war nichts zu hören. Dafür aber begleitete uns das leise Zirpen der Zikaden, die auch nachts nicht schliefen, und ab und zu die unheimlichen Rufe eines Käuzchens. Als es einmal heftig im Unterholz raschelte, blieben wir erschrocken stehen. War das eine feindliche Patrouille? Es knackte noch ein paarmal, aber dann war es wieder still. Gewiss nur ein Wildschwein. Wir nahmen unseren Weg wieder auf.
Als wir der Stadtmauer näher kamen, schlichen wir noch langsamer vorwärts, um kein Geräusch zu machen. Fünfzig Schritt vor der Mauer blieben wir stehen und horchten. Nichts, alles war still. Irgendwo in der Stadt brannte ein Licht, denn über den Dächern lag ein schwacher Schein. Vielleicht das Truppenquartier der militia. Um uns herum säuselte der Wind in den Blättern. Sonst war nichts zu hören, außer dem eigenen Herzklopfen.
»Kommt!«, flüsterte Roger.
Vorsichtig tasteten wir uns auf dem schmalen Uferstreifen an der Mauer entlang. Zwischen Steinen, langem Gras und wirrem Gestrüpp kamen wir nur langsam voran. Dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte, war nicht gerade hilfreich. Als wir nach einer Weile den halben Weg bis zur Brücke zurückgelegt hatten, vernahmen wir über unseren Köpfen leise Männerstimmen, die sich näherten. Das mussten Soldaten auf dem Wehrgang sein, die ihre Runde gingen.
Ausgerechnet jetzt trat einer von uns auf einen trockenen Ast. Das Knacken klang wie ein Donnerschlag in unseren Ohren. Sofort schmiegten wir uns eng an die Mauer. Nur Orestes war stehen geblieben und starrte erschrocken nach oben. Kurzerhand packte ich ihn am Hals, zerrte ihn zu mir heran und hielt ihn von hinten umklammert. Mit der anderen Hand griff ich nach dem Messer.
»Keine Bewegung!«, flüsterte ich ihm ins Ohr.