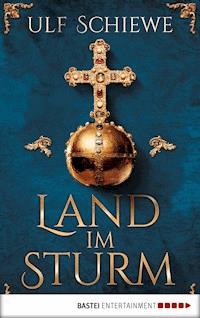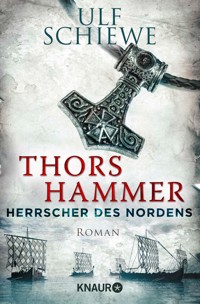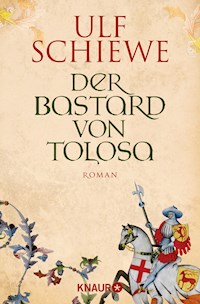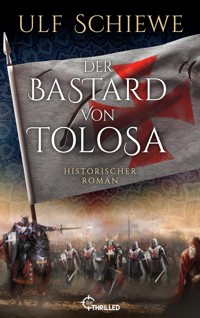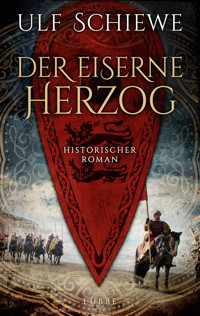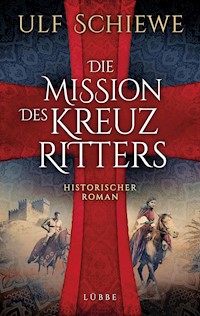
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Tempelritter und die Thronerbin - Abenteuer, Kampf und Liebe im Heiligen Land
Jerusalem, 1129. Als älteste Tochter des Königs soll Melisende einst die Krone erben und über das Heilige Land herrschen. Den von ihrem Vater ausgesuchten Bräutigam lehnt die eigenwillige junge Frau jedoch vehement ab. Heimlich verlässt sie mit einer Eskorte die Stadt. Doch sie kommt nicht weit. Ihre Reisegruppe wird überfallen, ihre Wache getötet, sie selbst als Geisel verschleppt. Um sie zu retten, schickt König Baudouin den Tempelritter Raol de Montalban aus. Bald merkt er: Gefahr droht von mehr als einer Seite ...
Ein packender Roman über einen mutigen Tempelritter und eine ungewöhnliche Frau des 12. Jahrhunderts: Melisende von Jerusalem
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Der Tempelritter und die Thronerbin – Abenteuer, Kampf und Liebe im Heiligen Land
Jerusalem, 1129. Als älteste Tochter des Königs soll Melisende einst die Krone erben und über das Heilige Land herrschen. Den von ihrem Vater ausgesuchten Bräutigam lehnt die eigenwillige junge Frau jedoch vehement ab. Heimlich verlässt sie mit einer Eskorte die Stadt. Doch sie kommt nicht weit. Ihre Reisegruppe wird überfallen, ihre Wache getötet, sie selbst als Geisel verschleppt. Um sie zu retten, schickt König Baudouin den Tempelritter Raol de Montalban aus. Bald merkt er: Gefahr droht von mehr als einer Seite …
Ein packender Roman über einen mutigen Tempelritter und eine ungewöhnliche Frau des 12. Jahrhunderts: Melisende von Jerusalem
Über den Autor
Ulf Schiewe wurde 1947 im Weserbergland geboren und wuchs in Münster auf. Er arbeitete lange als Software-Entwickler und Marketingmanager in führenden Positionen bei internationalen Unternehmen und lebte über zwanzig Jahre im Ausland, unter anderem in der französischen Schweiz, in Paris, Brasilien, Belgien und Schweden. Schon als Kind war Ulf Schiewe ein begeisterter Leser, zum Schreiben fand er mit Ende 50.
www.ulfschiewe.de
Ulf Schiewe
Die Missiondes Kreuzritters
Historischer Roman
Lübbe
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch-Download erschienen.
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Karte: Markus Weber, Guter Punkt, München
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Kozlik/shutterstock.com; VetraKori/shutterstock.com; javarman/shutterstock.com; Kozlik/shutterstock.com; Kozlik/shutterstock.com; Sergei25/shutterstock.com; konstantinks/shutterstock.com
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0978-1
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Niemand sollte daran zweifeln, dass edle Frauen durchaus in der Lage sind, sich vor Gefahren wenig zu fürchten, dass sie hohen Mut besitzen, Ehrbewusstsein und Urteilsvermögen.
Usama ibn Munqidh
(1095–1188)
Buch der Belehrungen
Autobiografie
PROLOG
Nordsyrien, nahe dem Dorf Sarmada, Juni 1119
Stechender, pulsierender Schmerz. Das ist die erste Wahrnehmung. Alles andere ist verworren und undeutlich wie in einem dichten Nebel. Das einzig Wirkliche sind der Schmerz im Kopf und das scharfe Stechen in der Brust, bei jedem Atemzug. Der Kopf fühlt sich an, als schlage jemand mit dem Hammer darauf. Immer und immer wieder. Und dann die Rippen. Sind sie gebrochen? Raol hört jemanden stöhnen und merkt nicht, dass er selbst es ist. Er versucht zu schlucken, doch die Zunge ist geschwollen und wie festgeklebt, der Rachen brennt wie Feuer.
Seine Lider flattern, als er versucht, die Augen zu öffnen. Die sind irgendwie zugekleistert. Mit einem Wimmern gibt er es auf und liegt still, nur mit Mühe atmend. Die Atemnot macht ihm Angst. Ein tonnenschweres Gewicht hält ihn niedergedrückt. Es lastet auf Brust, Bauch und dem linken Arm. In der Ferne krächzende Laute. Sind das Krähen?
Nach heftigem Blinzeln bekommt er das rechte Auge frei. Aber zu sehen ist nichts, nur Dunkelheit. Er versucht, den Kopf zu heben. Sofort überfällt ihn ein scharfer Stich in den Rippen. Er gibt es auf und bleibt liegen. Obwohl noch nicht ganz bei Bewusstsein, so versteht er doch, dass die Schmerzen erträglicher sind, wenn er sich nicht bewegt. Immer nur ruhig atmen, gegen das Gewicht, das auf ihm lastet, gegen den Schmerz in den Rippen, gegen das Hämmern in seinem Schädel. Ganz flach atmen und still liegen, dann ist es zu ertragen.
Langsam löst sich die Anspannung. Die Schmerzen sind noch da, aber nicht mehr so schlimm. Auch die Angst ebbt ab und weicht einer müden Trägheit.
Nach einer Weile suchen ihn gespenstische Bilder heim, Bilder, die ihn erschrecken und doch gleich wieder verfliegen, bevor er sie greifen kann, grausige, verworrene, unverständliche Bilder wie in einem Traum. Sie tun ihm nicht gut, und er versucht, sie zu verbannen. Er muss sich weiter ruhig halten. Langsam ein- und ausatmen. Sein ganzes Wesen konzentriert sich jetzt darauf.
Und es hilft. Ein warmes, angenehmes Gefühl erfasst ihn. Vor seinem inneren Auge erscheint eine Burg, hoch auf einem Felsen, im Sonnenuntergang. Rocafort. Ein vertrautes Bild. Dort ist er aufgewachsen, dort war er glücklich. Bei seiner Mutter und seinem kleinen Bruder. Könnte er sich doch nur wie ein Vogel in die Lüfte schwingen und zu ihnen fliegen.
Plötzlich schreckt er auf. Sein Herz schlägt heftig. Herr im Himmel, ich darf nicht schlafen! Nicht schlafen! Schlafen ist der Tod. O Gott, lass mich nicht sterben! Ich darf mich nicht gehen lassen. Aber da ist auch eine andere Stimme: Warum willst du dagegen ankämpfen? Das ist doch zwecklos. Lass alles von dir abfallen. Träum weiter von Rocafort. Du bist ohnehin schon tot. Im Himmel wirst du sie alle wiedersehen.
Das Hämmern in seinem Schädel hat sich wieder verstärkt. Ihm ist schwindelig davon. Er kann immer noch nicht klar denken. Verzweifelt tastet er mit der Rechten neben sich. Anscheinend liegt er im Gras. In feuchtem, klebrigem Gras. Ist das Tau? Aber Tau ist nicht klebrig. Dann stößt er auf etwas Hartes, Metallisches. Eine Waffe? Vielleicht ein Schwert?
Etwas lenkt ihn ab, das er bisher vor lauter Kopfschmerzen nicht bemerkt hat. Etwas seltsam Warmes tropft ihm ins Gesicht. Auf die linke Wange neben der Nase und nicht weit vom Auge. Langsam und immer auf dieselbe Stelle. Von dort läuft es in den Bart, am Ohr vorbei und in den Nacken. Tropf … Tropf … Tropf. Was ist das? Und was, zum Teufel, liegt da auf ihm und schnürt ihm die Luft ab? So schwer wie ein Dutzend Mehlsäcke.
Er tastet danach. Mehlsäcke sind es nicht, denn die fühlen sich nicht wie Stahlringe an. Stahlringe? Langsam dämmert es ihm. Stahlringe über ihm und eine Waffe neben ihm. Und das andauernde Tropfen. Dazu dieser durchdringende Gestank nach Schweiß und Blut. Mit einem Mal lichtet sich der Nebel in seinem gequälten Hirn. Es liegen keine Mehlsäcke auf ihm. Es ist eine Leiche. Vielleicht sogar mehr als eine. Gott im Himmel, ich liege unter Leichen begraben!
Die Erkenntnis erschreckt ihn so sehr, dass ihm übel wird. Eigentlich war ihm schon die ganze Zeit übel, aber jetzt würgt es ihn in der Kehle. Bittere Galle schießt ihm ins Maul und in die Nase, droht ihn zu ersticken. Er hustet, er würgt. Panik erfasst ihn. Mit einem Ruck versucht er, das Gewicht, das auf ihm liegt, loszuwerden, sich mit aller Kraft dagegenzustemmen.
Doch sofort bestrafen ihn die gebrochenen Rippen. Dazu ein höllisches Stechen im Oberschenkel, sodass er sich wieder zurückfallen lässt. Zumindest ist ihm gelungen, die Galle, oder was immer er da im Magen gehabt hat, auszuspucken. Viel kann es nicht gewesen sein. Zitternd bleibt er liegen und bemüht sich, Herz und Atem zu beruhigen.
Der stechende Schmerz im Oberschenkel wird schwächer und wandelt sich zu einem pulsierenden Pochen. Zumindest ist er jetzt klar genug bei Sinnen, um Bestand aufzunehmen. Er muss einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf abbekommen haben. Die Rippen scheinen gebrochen zu sein. Hat ihn ein Pferd getreten? Er kann sich an nichts erinnern.
Und was ist mit seinem Bein? Noch eine Verletzung? Er versucht, danach zu tasten, muss Hand und Schulter strecken, bis er sie vorsichtig fühlen kann, eine Handbreit über dem Knie. Ein tiefer, klaffender Schnitt, soweit die zitternden Finger wagen, die Wunde zu erkunden, die bei jeder Berührung höllisch schmerzt. Eine Menge Blut muss ausgetreten sein. Wahrscheinlich blutet die Wunde immer noch, denn seine Hand ist ganz nass. Auch der Stoff seiner Reiterhose ist völlig durchtränkt. Dazu die klebrige Feuchtigkeit im Gras – Blut, sein eigenes Blut. Herrgott, ich verblute!
Noch einmal strengt er sich an, mit einem Ruck die Leiche von sich zu wälzen. Es gelingt ihm auch diesmal nicht, verursacht nur wieder unsägliche Schmerzen. Er lässt los und stöhnt. Entweder ist er zu schwach, oder es liegt mehr als ein Kerl auf ihm.
Er zwingt sich, nicht in Panik zu geraten, versucht, sich zu erinnern, wieso er unter Leichen liegt, was ihm widerfahren ist. Und dann überwältigen ihn wirre, schemenhafte, aber vor allem grausige Bilder von Kampf, Schlachtenlärm und Gemetzel. Und das mit unerwarteter Heftigkeit. Brechende Lanzen und zerhackte Schilde. Pfeilgespickte Leiber. Das Schreien und Röcheln von Sterbenden, das Gebrüll der Kämpfer. Ein Gestank von Blut und Schweiß, von Angst und Urin. Die entsetzlichen Schreie tödlich verletzter Pferde, die vergeblich versuchen, auf die Beine zu kommen. Berge von Leichen, manche ohne Kopf, Gefallene mit klaffenden Wunden oder abgehackten Gliedern, einige noch am Leben. Das Gras scharlachrot von Blut. Und schließlich der Anblick einer Gruppe noch stehender, von allen Seiten bedrängter Christenkrieger, ein dicht zusammengedrängtes Häuflein, das sich verzweifelt wehrt und doch immer kleiner wird. Und er selbst ist mittendrin. Bestimmt auch der Kerl, der so schwer auf ihm lastet.
Endlich weiß er, wo er sich befindet und was geschehen ist. Sie sind in eine Falle getappt, das ganze stolze antiochenische Heer. Er selbst hat Roger di Salerno, den Regenten, fallen und sterben sehen. Dumm von ihm, sich in eine Falle locken zu lassen. Hochmütig, die Gefahren kleinzureden, bis es zu spät war. Für diesen Hochmut hat Rogers ganzes Heer bezahlen müssen, auch wenn er selbst heldenhaft und bis zuletzt gekämpft hat. Wie so viele andere, wie auch Raol. Ein ganzes Christenheer ist heute vernichtet worden. Antiochia ist nun ohne Schutz den Seldschuken ausgeliefert. Herr im Himmel, warum hast du uns verlassen? Uns, die dein Reich gegen die Ungläubigen verteidigen?
Dann packt ihn wieder der Schmerz, die Atemnot. Ihm ist klar, dass er elendig verbluten wird. Das heißt, wenn er nicht schon vorher unter dem Gewicht der Leichen erstickt. Sie kommen ihm immer schwerer vor. Wahrscheinlich liegt er hier schon seit Stunden, denn die Schlacht fand am späten Nachmittag statt. Vielleicht sollte er jetzt beten, sein Leben überdenken, seine Sünden bereuen, solange er kann. Aber es fällt ihm schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Zu anstrengend, über Sünden nachzudenken. Gott wird schon wissen, was er von ihm zu halten hat. Besser still liegen, den Schmerz aushalten und warten, bis der Tod kommt.
Wie das wohl ist, wenn man stirbt? Vielleicht wird er wieder bewusstlos und merkt am Ende gar nichts davon. Das wäre das Beste. Ein gnadenvoller Tod. Auf den Schwingen eines Engels gen Himmel fahren. Eine wundervolle Vorstellung.
Der Durst wird langsam unerträglich. Wenn er doch nur einen Tropfen Wasser bekäme! Aber da ist nichts, kein Wasser, keine Hilfe, nur das Krächzen der Krähen, die bestimmt schon angefangen haben, die Augen der Gefallenen auszupicken. Die Augen nehmen sie sich immer als Erstes vor. Das hat er schon öfter gesehen. Ab und zu hört er das Jammern und Stöhnen anderer Verwundeter, anderer armer Teufel, die wie er noch immer an ihrem kleinen, unbedeutenden Leben hängen. Auch für sie wäre ein schneller Tod das barmherzigste Ende. Statt eines langen Siechens. Statt bei lebendigem Leib von Krähen und Hunden angefallen zu werden.
Und dann hört er noch etwas anderes. Schritte im Gras. Männer, die Türkisch sprechen. Ein Verwundeter schreit auf, als sie ihn abstechen. Das Geräusch war eindeutig. Dann noch einer, der vergeblich um sein Leben bettelt, und kurz darauf wieder einer. Es genügt ihnen nicht, dass sie uns besiegt haben. Sie wollen keinen von uns am Leben lassen. Wieder steigt die Angst in ihm hoch. Gleich werden sie auch mich finden und umbringen. Sein Herz klopft heftiger. Ihn überkommt das überwältigende Bedürfnis, aufzuspringen und zu fliehen. Aber es geht nicht. Er ist eingeklemmt und kann sich nicht rühren. Besser, sich gar nicht zu bewegen, sich tot zu stellen.
Jetzt sind noch mehr türkische Stimmen zu hören. Einer lacht. Zweifellos fleddern sie die Leichen. Zwei der Männer hört er vor Anstrengung ächzen. Wahrscheinlich ziehen sie einem der Toten gerade die Rüstung vom Leib. Oder die Stiefel. Und natürlich durchsuchen sie die Taschen nach Silber. Vater im Himmel, lass sie nicht in meine Nähe kommen! Das Blut rauscht ihm in den Ohren. Er hat wieder Mühe, Luft zu bekommen. Nur keinen Laut machen, nur nicht bewegen.
Zu seinem Schrecken nähern sich Schritte. Ganz nahe reden zwei Seldschuken miteinander. Er kann sie deutlich hören, auch wenn er nicht versteht, was sie sagen. Und plötzlich bewegt sich die Leiche, die auf ihm liegt. Sie zerren an ihr, sodass sie ein Stück zur Seite rutscht. Wer weiß, was sie bei dem Kerl suchen. Seinen Dolch? Seinen Helm? Seinen Ringpanzer jedenfalls nicht. Dann merkt Raol, wie an seinen Stiefeln gezogen wird. Er beißt sich auf die Lippen, um nicht laut zu schreien, denn der Schmerz im Oberschenkel ist unerträglich. Einer nach dem anderen rutschen die Stiefel von seinen Füßen. Er spürt die kühle Nachtluft an den nackten Zehen. Langsam entfernen sich die Schritte und die Stimmen.
Herr, ich danke dir!
Auch wenn ich trotzdem bald sterbe.
Aber wenigstens in Würde.
Dass die Leiche auf ihm etwas zur Seite gerückt wurde, macht das Atmen leichter. Trotzdem bleibt Raol weiter reglos liegen und lauscht in die Nacht hinein. Von den Seldschuken ist nach einer Weile nichts mehr zu hören. Auch kein Stöhnen Verwundeter. Ist er der einzige Überlebende? Eine unheimliche Stille hat sich über das Schlachtfeld gesenkt, nur von den heiseren Schreien der Krähen unterbrochen. Und vom Bellen und Knurren wilder Hunde, die der Geruch des Blutes angelockt hat.
Vielleicht kann er sich doch noch retten. Die Ruhe der Nacht und die gelegentlichen Tierlaute haben ihm neue Energie gegeben, nicht aufzugeben. Der schreckliche Gedanke, von Hunden oder gar Ratten gefressen zu werden, flößt ihm neue, verzweifelte Kraft ein. Aber er muss zuerst sein Bein verbinden, wenn er nicht verbluten will.
Mit einem gewaltigen Ruck gelingt es ihm, die Leiche von sich zu wälzen. Eine Welle des Schmerzes wäscht über ihn hinweg. Tränen schießen ihm in die Augen. Aber endlich ist das elende Gewicht von seiner Brust. Auch wenn der linke Arm immer noch feststeckt. Er bemüht sich, weiter nach rechts zu rutschen, wo das Schwert liegt. Der Schmerz in den Rippen bringt ihn fast um, aber es gelingt ihm, den Arm zu befreien.
Raol setzt sich auf. Endlich kann er etwas sehen. Bleiches Mondlicht erhellt das Schlachtfeld. Überall Tote, ganze Haufen, die übereinanderliegen, zerborstene Schilde, Kadaver von Pferden, Helme. Dazwischen die dunklen Schatten flügelschlagender Krähen, die sich in Scharen um die besten Stücke balgen.
Raols Kopf dröhnt immer noch schmerzhaft. Mit Mühe gelingt es ihm, Helm und Kettenhaube abzuziehen. Der Helm hat an der linken Seite eine gewaltige Beule. Ein Schwert oder eine Axt muss ihn dort mit voller Wucht getroffen haben. Er versucht, sich auch des schweren Kettenhemdes zu entledigen. Aber das übersteigt seine Kräfte. Den Helm legt er achtlos zur Seite.
Plötzlich sieht er sich einem großen Köter gegenüber, der ihn wütend und zähnefletschend anknurrt. Das Biest sieht aus, als wolle es sich auf ihn stürzen. Raol tastet nach dem Schwert, bekommt es zu fassen, holt aus und schwingt es nach dem Viech. Aber das macht den verdammten Köter nur noch wilder. Seine Augen glühen im Dunkeln, als käme er direkt aus der Hölle. Noch einmal schwingt Raol das Schwert. Er muss getroffen haben, denn das Tier gibt plötzlich ein schrilles Winseln von sich und verschwindet.
Von Anstrengung und Schmerz wird es Raol einen Moment lang schwarz vor Augen. Er fühlt sich elendig schwach. Das muss der Blutverlust sein. Er lässt das Schwert fallen. Als es ihm besser geht, sieht er sich um. Neben ihm liegen vier oder fünf Tote übereinander. Unter denen hat er also gelegen. Er packt wieder das Schwert und säbelt an der Tunika der neben ihm liegenden Leiche herum, bis es ihm gelingt, einen langen Streifen abzureißen. Den bindet er über die immer noch blutende Wunde.
Ich muss hier weg. Bevor mich noch mehr Hunde anfallen, bevor am Morgen Seldschuken zurückkommen, um auch noch das Letzte an sich zu nehmen, was es hier zu plündern gibt. Unter großen Schmerzen und auf das Schwert gestützt gelingt es ihm, auf die Beine zu kommen. Das macht Mut. Neuer Lebenswille durchflutet ihn. Er kann es schaffen, wenn er nur will.
Humpelnd, mit nackten Füßen und unendlich langsam bewegt er sich über das Schlachtfeld, an Toten vorbei, an viel zu vielen Toten. Das Ausmaß der Vernichtung ist kaum zu fassen. An die zehntausend Mann hat Rogers Heer gezählt. Nur wenige haben aus dem Kessel der Seldschuken fliehen können, wie Raol sich jetzt erinnert.
Jeder Schritt verursacht Schmerzen, besonders im Bein, und ist nur mit zusammengebissenen Zähnen zu ertragen. Tränen laufen ihm über die Wangen. Immer wieder muss er anhalten, bevor ihm schwarz vor Augen wird. Dann müht er sich weiter. Noch ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt. An verstümmelten Leichen vorbei, an Gesichtern, die leblos in den Nachthimmel starren, an zerborstenen Schilden.
Endlich erreicht er freies Feld. Doch deshalb wird das Gehen nicht leichter, denn hier ist das Gras nicht niedergetrampelt, sondern steht hoch. Er hält inne, um zu verschnaufen, tastet nach der Wunde am Bein. Sein behelfsmäßiger Verband ist völlig durchgeblutet.
Als ihm die Sinnlosigkeit seines Unterfangens bewusst wird, verlässt ihn der Mut. Wohin soll er sich wenden? Das Lager der Seldschuken dürfte nicht weit von hier liegen. Nur wo?
Sie werden mich entdecken, sobald es hell wird, sagt er sich. Doch er gibt nicht auf. Stunde um Stunde kämpft er sich weiter. Der Polarstern am Nachthimmel zeigt ihm Norden an und abgeleitet davon den Weg nach Westen. Zweimal sinkt er vor Schwäche ohnmächtig zu Boden, nur um sich nachher wieder auf die Beine zu kämpfen und weiterzuhumpeln. Einmal würgt es ihn heftig, doch mehr als ein wenig bittere Galle gibt sein Magen nicht her. Immer öfter muss er anhalten und verschnaufen. Er spürt, wie ihn die Kraft verlässt. Es wäre so schön, sich ins Gras zu legen, um auszuruhen. Aber nein. Er kämpft sich weiter durchs Gras und an Gestrüpp vorbei, schließlich durch ein Pinienwäldchen.
Als der Morgen anbricht, hat er es auf einen schmalen Feldweg geschafft. Dort verlassen ihn endgültig die Kräfte. Mehr als das. Zum dritten Mal seit Verlassen des Schlachtfeldes verliert er das Bewusstsein und stürzt schwer zu Boden.
Als er aufwacht, ist es heller Tag. Er liegt auf dem Rücken, und ein zerfurchtes Gesicht beugt sich über ihn. Der Mann betrachtet ihn eingehend. Nicht feindselig. Eher mit Sorge.
»Wasser«, murmelt Raol.
Der Mann nickt und verschwindet aus seinem Blickfeld. Dann taucht er wieder auf und träufelt etwas Wasser aus einem durchnässten Tuch auf seine Lippen. Raol kann es kaum fassen, dass er noch lebt. Und wie herrlich jeder einzelne Tropfen schmeckt. Dann hilft ihm der Mann aufzusitzen und stützt ihn, während er ihm einen Flaschenkürbis mit Wasser an die Lippen hält. Raol will gar nicht mehr aufhören zu trinken, während der Mann fröhlich grinst und auf ihn einredet. Irgendetwas auf Arabisch oder Aramäisch. Er muss ein Bauer sein, ein Fellache.
»Shukraan!«, bedankt sich Raol. Wenigstens dieses Wort weiß er auf Arabisch. »Merci, merci!«, fügt er noch hinzu.
Der Bauer nickt zufrieden. »Merci«, sagt er und grinst.
Dann deutet er mit sorgenvoller Miene auf Raols Wunde. Das gesamte Hosenbein ist von Blut durchtränkt, das meiste schon getrocknet. Nur über der Wunde ist der Notverband noch nass. Der Bauer macht eine unmissverständliche Geste.
Raol nickt. »Ich weiß. Muss genäht werden.«
Der Mann zeigt auf Raols Brust und anschließend auf einen Maulesel, der ein paar Schritte neben ihnen steht.
»Da soll ich drauf?«
Der Bauer nickt, als habe er verstanden. Dann zeigt er auf irgendetwas in der Ferne und redet wieder wie ein Wasserfall. Raol blickt, wohin der Mann deutet, und erkennt ein Feld mit heranreifendem Weizen. Sieht jedenfalls so aus. Dahinter eine Hütte. Und davor Kinder, die in der Morgensonne spielen. Ein Bild des Friedens. Raol bekreuzigt sich bei dem Anblick.
»Komm!«, sagt der Bauer. »Komm, komm!«
»Also gut«, murmelt Raol und packt sein Schwert, um sich zu stützen. »Aber scheiß auf den Maulesel.« Er reicht dem Mann die linke Hand. »Hilf mir auf, Samariter. Das letzte Stück schaff ich auch noch zu Fuß.«
DIE GRABESKIRCHE
Zehn Jahre später, Jerusalem, März 1129
Ihr wollt einfach nicht verstehen!«
Melisendes gereizter Ausruf hallt von den Wänden des großen Kirchenraums wider. Erschrocken sieht sie sich um. Doch außer dem alten Geistlichen, dem die Worte galten, und ihrer Magd Maria, die etwas abseits steht, ist im Halbdunkel des Kirchenschiffs niemand zu sehen.
In der Rotunde jedoch, an deren Eingangsportal sie stehen, befinden sich zwei Männer. Zweifellos Pilger, die schon zu früher Stunde gekommen sind, um am Grab Christi zu beten. Einer hockt auf Knien und hält eine brennende Kerze in der Hand. Er wendet den Kopf und blickt zu ihnen herüber. Der andere liegt bäuchlings und mit weit ausgebreiteten Armen vor dem Allerheiligsten, der Ädikula, unter der sich die Grabkammer befindet. Man hört ihn inbrünstig flüstern.
»Nicht hier!«, raunt der Geistliche und zieht Melisende am Ärmel ein paar Schritte weiter ins Hauptschiff hinein, wo Maria wartet. Er legt den Zeigefinger auf die Lippen. »Und nicht so laut. Wir stören die Andacht dieser guten Leute.«
Melisende wirft einen ungeduldigen Blick auf die Betenden, dann tritt sie mit zornig funkelnden Augen dichter an den Geistlichen heran. »Ich sage es noch einmal«, raunt sie, deutlich leiser, wenn auch nicht weniger eindringlich. Ihr vorgebeugter Oberkörper scheint vor innerer Anspannung zu beben. »Ich habe keine Lust, mich mit diesem Mann zu vermählen. Und ich werde es auch nicht tun. Das schwöre ich!«
Étienne de la Ferté, ihr Gegenüber, seit einem Jahr Patriarch von Jerusalem, weicht vor ihrem Ungestüm einen Schritt zurück und hebt Hände und Schultern in einer Geste der Hilflosigkeit, als wollte er sagen, das habe alles nichts mit ihm zu tun. Der Mann ist Anfang sechzig und kaum größer als Melisende. Das bodenlange, mit Goldfäden durchwirkte Gewand seines hohen Amtes ist fast zu groß für ihn. Er wirkt unbeholfen darin, als habe er sich an seine neue Rolle noch nicht gewöhnt. Sein hageres Mönchsgesicht ist glatt rasiert und von tiefen Furchen durchzogen. Vom Haupthaar ist nur ein weißer Kranz geblieben, dessen Strähnen ihm über die Ohren und bis in den Kragen hängen.
Mit einem Seufzer hebt er die buschigen Brauen und schüttelt den Kopf. »Mein Kind, es ist weder an mir noch an dir, das zu entscheiden. Dein Vater weiß, was das Beste ist. Und es ist deine heilige Pflicht, ihm zu gehorchen und dich zu fügen. Zum Wohle des ganzen Königreichs.«
Melisende ballt die Fäuste und tritt einen weiteren Schritt vor. »Meine Pflicht!« Sie speit ihm das Wort förmlich ins Gesicht. »Ich kann das nicht mehr hören. Für uns Frauen gibt es nichts als Pflichten. Das wird uns seit der Kindheit eingebläut. Immer sollen wir tun, was erwartet wird, brav nicken, alles mitmachen, alles ertragen, was den Herren gerade einfällt. Aber wo tun sie selbst ihre Pflicht? Sie huren und saufen und zetteln Kriege an.«
»Nicht so laut!« Der Patriarch sieht sich unsicher um. Dann wendet er sich ihr wieder zu. »Du übertreibst. Dein Vater –«
»Gut!«, unterbricht sie. »Reden wir von meinem Vater. Tut der etwa immerfort seine Pflicht? Da hab ich nämlich schon ganz anderes erlebt.«
»Ich denke, im Großen und Ganzen tut er das. Er hält das Reich zusammen.«
»Ach ja? Dabei seid Ihr oft gar nicht einverstanden mit ihm. Ich habe euch streiten hören.«
»Nun, in Kirchendingen sind wir nicht immer der gleichen Meinung, das gebe ich zu. Aber immerhin ist er der König. Und er hat, was dich betrifft, entschieden –«
»Richtig!«, unterbricht sie ihn erneut. »Er ist der König. Aber ich bin die älteste Tochter des Königs. Und Erbin des Throns. Soll ich mir gefallen lassen, dass man mir irgendeinen dahergelaufenen Fürsten aufzwingt? Ich will selbst entscheiden, wen ich heirate.«
»Aber, mein Kind, was redest du? Der Comte d’Anjou ist nicht irgendeiner. Er ist ein mächtiger Mann. Der König von Frankreich selbst hat ihn empfohlen, und dein Vater hält große Stücke auf ihn. Foulques ist ein erfahrener Mann und ein guter Heerführer. Genau, was wir brauchen. Es geht schließlich um unser ganzes Land, um Palästina, um den Erhalt des Königreichs. Gerade du als Thronerbin solltest das verstehen.«
»Der Mann ist alt und hässlich. Ich will ihn nicht.«
»Tja, was soll ich sagen? Außer, dass es wahrlich Wichtigeres gibt als Schönheit bei einem Mann.«
»Ihr wollt mir also nicht helfen.«
Der Patriarch seufzt. »Ich fürchte, mir sind die Hände gebunden.«
»Die Kirche verlangt, dass auch die Braut ihr Einverständnis gibt. Wollt Ihr nicht auf mein Recht bestehen?«
Étienne de la Ferté ist die Unterredung inzwischen sichtlich peinlich und unangenehm. Er verdreht die Augen gen Himmel, als wollte er Gottes Beistand erflehen. Dann sagt er: »Ich bin sicher, mein Kind, du wirst am Ende dein Einverständnis geben. Wenn du erst einmal verstehst, wie wichtig für uns alle diese Verbindung ist.«
Melisende starrt ihn lange wortlos an. Sie wollte ihn für sich gewinnen. Das Wort des Patriarchen von Jerusalem hätte Gewicht gehabt, hätte ihren Vater vielleicht umgestimmt. Schon früh am Morgen ist sie deshalb zur Grabeskirche geeilt, um Étienne abzufangen, bevor sich die Mitglieder der Haute Cour versammeln. Denn, bei Gott, was weiß ein Foulques, ein Graf aus dem fernen Anjou, schon von Palästina? Der ist keiner von ihnen, keiner, der hier geboren ist. Und auch keiner der alten Kämpfer, die das Land für die Christenheit erobert haben. Keiner wie Bohemund oder Tankred, Joscelin oder ihr Vater. Mit diesem Mann das Bett zu teilen, die Vorstellung ist ihr ein Graus.
Sie schüttelt zornig den Kopf. »Ihr seid stur wie ein Esel!«
»Wie bitte? Wie nennst du mich?« Der Patriarch ist entrüstet.
»Jedenfalls benehmt Ihr Euch wie einer!«
»Jetzt reicht’s aber. Das muss ich mir nicht sagen lassen.«
»Es bringt also nichts, noch weiter mit Euch zu reden.«
»Nein, das bringt in der Tat nichts«, erwidert Étienne erbost. »Zumindest nicht über diese Angelegenheit. Und nicht in diesem Ton!«
Melisende wirft ihm einen finsteren Blick zu, wirft den Kopf in den Nacken und wendet sich ab. »Na schön. Wenigstens ist der Frühling zurück, also genießt den sonnigen Tag, Monseigneur!«
Mit vor Zorn geröteten Wangen stolziert sie auf den Ausgang zu. Neben der schweren Eichentür taucht sie kurz die Finger ins Weihwasser, betupft sich die Stirn und schlägt das Kreuz.
Maria ist ihr gefolgt. »Das war gewiss nicht recht, Domina«, flüstert die Magd ihr zu.
»Und wieso nicht?«, zischt Melisende.
»Mit Verlaub, Domina. Er ist doch der Patriarch. Er verdient Respekt.«
»Und ich? Verdiene ich keinen Respekt?«
»Natürlich. Aber Ihr wart unhöflich und habt ihn einfach stehen lassen.«
»Stimmt«, murmelt Melisende, jetzt doch ein wenig zerknirscht. »Und dann habe ich ihn auch noch einen Esel genannt.« Eigentlich sollte sie sich entschuldigen, das ist ihr bewusst. Sie schaut sich nach ihm um. Doch der Patriarch ist nicht mehr zu sehen, hat sich wahrscheinlich in die Sakristei zurückgezogen. »Er wird sich beim König beschweren. Aber im Grunde hat er’s verdient. Selbst mein Vater hält ihn für einen Esel.«
Tatsächlich war Étiennes Ernennung eine Notlösung, nachdem Warmund, sein langjähriger Vorgänger, gestorben war.
In diesem Augenblick fliegt die schwere Kirchentür so heftig auf, dass sie mit Wucht gegen Maria knallt. Mit einem Aufschrei taumelt die Magd zurück und reibt sich die schmerzende Schulter.
Im morgendlichen Sonnenlicht, das durch die offene Tür ins Innere der Kirche flutet, steht ein großer, kräftiger Mann, eine Hand noch an der bronzenen Klinke. Er trägt ein graues, formloses Gewand, das ihm bis auf die Stiefel fällt. Man würde ihn für einen Mönch halten, wären da nicht die Sporen, das lange Schwert an der Seite und das von Bart und dunklen Locken umrahmte wettergegerbte Gesicht, auf dem eine feine silbrige Narbe von der linken Wange bis in den Bart verläuft. Zweifellos ein Chevalier.
»Tut mir leid«, hört sie ihn brummen. Er hat eine sonore Stimme mit provenzalischem Einschlag.
Sie fährt ihn an. »Was fällt Euch ein? Stürmt Ihr immer so rücksichtslos in ein Gotteshaus? Fast hättet Ihr meiner Magd die Schulter zertrümmert.«
Mit gleichmütiger Miene starrt der Kerl auf sie hinab, dann wirft er einen flüchtigen Blick auf Maria. »Was muss sie auch hinter der Tür stehen? Außerdem sagte ich schon, es tut mir leid.«
Ohne ein weiteres Wort zwängt er sich an ihnen vorbei und schreitet mit langen Schritten in Richtung Rotunde, wobei er ganz leicht das rechte Bein nachzieht. Eine alte Kriegswunde, sagt sich Melisende. Sie beobachtet, wie er vor dem Allerheiligsten niederkniet, sich bekreuzigt und die Hände zum Gebet faltet.
»Wer, bei allen Heiligen, ist denn dieser Rüpel?«
»Kennt Ihr ihn nicht, Domina? Er war schon einige Male im Palast. In Begleitung des Großmeisters. Anscheinend hat er Euch genauso wenig erkannt. Erstaunlich eigentlich. Wo Euch doch alle Welt kennt.«
»Er ist ein Templer?«
Die Magd nickt. »Ganz recht. Ein Provenzale. Stammt aus der Corbières, nicht weit von Narbonne. Raol de Montalban ist sein Name.«
»Und woher weißt du das alles?«
Die Magd wird rot und kichert verlegen. »Nun ja. Er ist ein stattlicher Mann. Da ist man doch neugierig.«
»Aha! So ist das also.« Melisende grinst belustigt. »Wenn er ein Templer ist, sind deine Hoffnungen aber vergebens. Die leisten ein Keuschheitsgelübde.«
Maria tut unschuldig. »Aber woher denn? Ich will doch gar nichts von dem. Hab nur nach seinem Namen gefragt.«
Immer noch lächelnd zieht Melisende die Kapuze ihres langen Umhangs über die aschblonden Haare, die ihr in einem langen geflochtenen Zopf über den Rücken fallen, und schließt die Fibel vor der Brust. »Na komm! Mein Magen knurrt. Ich hab noch nichts gegessen heute. Vor der Versammlung haben wir gerade noch Zeit, etwas zu uns zu nehmen.«
Drei Leibwachen, die draußen vor dem Kirchenportal gewartet haben, schließen sich den beiden jungen Frauen an. Es sind ausgesucht große, kräftige Kerle, mit Helm, Kettenpanzer und Speer bewaffnet, die zur Schutztruppe des Königs gehören. Ihr Anführer, ein hellhaariger Normanne, schreitet voran, um in den engen Gassen Platz zu schaffen. Seine beiden Kameraden bilden die Nachhut.
Melisende würde am liebsten auf Wachen verzichten, aber es ist zu gefährlich. Zu viel Gesindel treibt sich in der Stadt herum. Unbegleitete Frauen, besonders wenn sie vornehm gekleidet sind, können überfallen, ausgeraubt oder gar zur Beute für Geiselnehmer werden. Also hat der König es so angeordnet: kein Ausgang ohne bewaffnete Eskorte. Deshalb trägt Melisende über der Kleidung auch einen unscheinbaren Umhang aus grobem Tuch. Maria ist ähnlich gekleidet.
Beim Anblick des blauen Himmels über den Dächern bleibt Melisende stehen und schlägt die Kapuze zurück. Das morgendliche Licht über der Stadt ist zu angenehm, um es nicht zu genießen. Es lässt alles in starkem Kontrast erscheinen: die grünen Hügel ringsum; das Meer der Dächer; die hellen Wände der Häuser, deren Läden meist noch verschlossen sind; das jahrhundertealte ausgetretene Pflaster; aber auch die langen Schlagschatten der Zypressen und Ölbäume; die dunklen Ecken, in denen Bettler und Obdachlose lungern; die finsteren Seitengassen, wo in der Nacht Huren und Zuhälter ihr Geschäft betreiben. Und über allem die Türme der vielen Gotteshäuser, in deren Schatten die Sünde blüht wie nirgendwo sonst.
Von den fernen Olivenhainen und den mit dunklen Pinien bedeckten Hügeln her streicht ein sanfter Wind über die sonnendurchflutete Stadt. Mit ihm ein Duft von Zitronen, von Thymian und wilden Blumen. Es sind diese Gerüche und das mediterrane Licht, die Jerusalem so besonders machen.
Und natürlich die Pilger aus aller Welt, das Gedränge in den engen Gassen, die Rufe der Händler, das Hämmern und Klappern der Handwerker in ihren offenen Werkstätten, die von Eseln gezogenen Karren der Bauern und im Gegensatz dazu die bunten Gewänder der aus Arabia kommenden Kaufleute, die mit ihren hochbeladenen Kamelen Halt machen, bevor sie nach Jaffa oder Akkon weiterreisen, wo Genuesen und Venezianer auf sie warten. Gewürze, Seide und Elfenbein aus dem Orient gegen Wein, Bernstein, Silber und Erze aus dem Westen.
Ob es zu Jesu Zeiten auch schon so war, dieses Jerusalem, fragt sich Melisende, als die Römer hier herrschten und die Hohen Priester unseren Heiland verrieten und ihn vom Volk verhöhnt durch die Gassen schleppen ließen? Oder war alles anders?
»Sollten wir nicht besser gehen, Domina?«, hört sie Maria fragen. »Ihr kommt sonst zu spät.«
»Ja, natürlich. Gehen wir.«
Sie biegen in eine der Hauptgassen ein. Hier sind schon wesentlich mehr Menschen unterwegs. Händler öffnen die Läden ihrer Stände, Bauern bringen Obst und Gemüse zum nahen Sankt-Georgs-Markt. Kinder spielen, rennen lachend auf nackten Füßen über das unebene Pflaster. Eine alte Vettel beugt sich aus dem Fenster ihres Hauses im ersten Stock, um den Nachttopf auszuleeren. Beinahe hätte es einen von Melisendes Leibwachen getroffen. Der Mann flucht, hebt drohend die Faust und beschimpft die Alte, die lautstark zurückkeift.
Kaum sind sie an ihr vorbei, kommt ihnen eine Gruppe Mönche der griechisch-byzantinischen Kirche entgegen. Beim Anblick der Leibwachen machen sie Platz, unterhalten sich aber lautstark weiter, lachen über eine Bemerkung. Sie tragen schwarze Gewänder und ebenso schwarze Hauben auf dem Kopf. Ihre Gesichter sind von langen Bärten umrahmt, die Haare im Nacken zu einem Knoten gebunden. Einer starrt Melisende im Vorbeigehen an. Mit dem abschätzenden Blick eines jungen Mannes, der einer Frau nachschaut. Dabei haben sie doch Keuschheit geschworen, denkt sie belustigt. Und sie tragen Schwarz, die Farbe des Todes. Weil sie der Welt entrückt sein sollen und im Grunde gar nicht mehr leben. Jedenfalls nicht in unserer Welt. Deshalb werden Bart und Haare auch nicht geschnitten. Wer tut das schon bei Toten?
Schade eigentlich. Der Mann hatte ein hübsches Gesicht. »Haben die nicht irgendwas Slawisches geredet? Die müssen vom Balkan sein.«
Maria nickt. »Serben vielleicht. Oder Bulgaren.«
»Manchmal denke ich, es gibt mehr Fremde in der Stadt als Einheimische. Und ich rede nicht nur von Pilgern.«
»Das stimmt. Aber ihr Franken habt sie doch alle vertrieben. Die Einheimischen, meine ich. So gut wie alle Muslime und die meisten Juden.« Maria ist selbst armenische Christin. Ihre Familie stammt aus dem Norden Syriens und ist vor den Türken hierher geflüchtet. Melisende spricht oft Armenisch mit ihr, schließlich ist sie selbst halb Armenierin und mit der Sprache ihrer Mutter aufgewachsen.
»Jerusalem ist jetzt eine christliche Stadt, vergiss das nicht. Hier ist der Heiland für uns gestorben. Hier steht die Wiege unseres Glaubens.«
»Ja, Domina. Natürlich.«
»Es war ein großer Sieg über die Ungläubigen. Die Befreiung der Heiligen Stätten. Für alle Christen.«
»Aber dieser Sieg hat viele Opfer gekostet. Auf beiden Seiten.«
»Ohne Opfer kann nichts Großes entstehen, Maria.«
Melisende weiß natürlich, welche Gräuel hier stattgefunden haben. Dass die Anführer des Christenheeres ihre Männer nicht mehr hatten zurückhalten können. Männer, die während des langen Kreuzzugs Hunger, Pestilenz, Tod und Verwundung erlitten und so viel Hass auf den Feind angesammelt hatten. Kaum hatten sie die Mauern bezwungen und die ägyptischen Verteidiger überwunden, waren sie in die Stadt geströmt und hatten in ihrem Blutrausch ein entsetzliches Gemetzel angestellt. Ob Muslime, Juden oder Christen, sie machten kaum einen Unterschied. Alles, was ihnen vor die Schwerter kam, wurde abgeschlachtet, Frauen wurden geschändet, Kinder erschlagen. Ströme von Blut rannen durch die Gassen und sammelten sich in großen Lachen. Überall wurde geplündert, gemordet und zerstört. Und das tagelang, bis die meisten zu erschöpft waren, um sich noch länger auf den Beinen zu halten, geschweige denn ein Schwert zu heben.
Die Eroberung hatte Jerusalem in eine Geisterstadt verwandelt. Wer nach dem Ansturm und den Plünderungen noch lebte, flüchtete oder wurde vertrieben. Die große, von Menschen aller Herkunft und Religionen wimmelnde Stadt war plötzlich wie leer gefegt. Danach gab es in Jerusalem jahrelang kaum mehr Einwohner als in einem großen Dorf. Das große Christenheer hatte sich aufgelöst, die meisten Krieger waren heimgekehrt. Nur eine Garnison hartnäckiger Abenteurer war geblieben. Jerusalems erster König, Baudouins Vetter gleichen Namens, hatte größte Mühe, genug Männer zusammenzutreiben, um sein Reich gegen die Heere der fatimidischen Ägypter zu verteidigen, die regelmäßig einfielen, um die Stadt zurückzuerobern. Erst am Ende seines Lebens war das Königreich einigermaßen gesichert.
»Ja, es hat Opfer gekostet«, fährt Melisende fort. »Und es liegen sicher noch harte Jahre vor uns. Die Sarazenen wünschen sich nichts sehnlicher, als uns ins Meer zu treiben. Solange das so ist, kann es keinen Frieden geben. Und vergiss nicht, wie grausam der Feind auch bei uns in Edessa gewütet hat. Besonders die Seldschuken. Da könnte ich dir Dinge erzählen … Aber du weißt es ja selbst.«
Maria nickt. »Meine Eltern haben alles verloren, mussten fliehen. Nur mit den Kleidern am Leib sind sie entkommen. Dabei haben sie noch Glück gehabt. Andere aus meiner Familie haben die Überfälle nicht überlebt.«
Melisende legt den Arm um ihre Magd. »Aber nun bist du bei mir, und all das ist gottlob Vergangenheit.«
Maria lächelt. »Ich hoffe es.«
Schweigend gehen sie weiter, während Melisende sich an ihre Kindheit in Edessa erinnert. Sie gehört zur Generation derer, die im Land geboren wurden. Gewalt ist ihr nicht unbekannt. Nur durch ständige Kampfbereitschaft lassen sich die eroberten Gebiete und Fürstentümer halten. Mit Burgen versuchen die neuen Herren, ihre Grenzen zu sichern. Raubüberfälle und Kriegszüge gehören zur täglichen Wirklichkeit. Wenn ihr armenischer Großvater nicht regelmäßig Krieger geschickt hätte, wäre das Edessa ihrer Kindheit vielleicht schon verloren.
Sie weiß also, wie es ist, wenn Bauernhöfe und Felder brennen, wenn ganze Familien dem Schwert zum Opfer fallen, wenn elternlose Kinder um Brot bettelnd durch die Gassen irren und die eigenen Leute nach einem Scharmützel Tote und Verwundete heimbringen. Wie oft haben sie mit bangen Herzen den Vater unter den Gefallenen vermutet und Gott inbrünstig gedankt, wenn er dann doch hoch zu Ross durchs Tor geritten kam, stark und unverwüstlich selbst nach Niederlagen. Wie sehr hat sie ihn geliebt und wie laut hat sie gejauchzt, wenn er sie vor sich auf den Sattel hob, um mit ihr durch die Gassen bis zum Palast zu reiten, wo ihre Mutter Morphia wartete.
Wenn man jetzt, dreißig Jahre nach dem Fall Jerusalems, durch die friedlichen Gassen geht, erinnert nichts an den Krieg. Die Gräuel der Eroberung scheinen vergessen zu sein. Auf dem Land bestellen die Bauern ihre Äcker wie eh und je, ernten Oliven und pressen Öl. Sie haben sich an ihre neuen Herren gewöhnt, an deren Burgen, an die für sie seltsamen Gewohnheiten und an die feudale Herrschaft, die diese dem Land übergestülpt haben. Wie sie sich in den Jahrhunderten immer wieder an fremde Herren gewöhnt haben, an Griechen und Römer, an Araber und Ägypter. Und nun an Ritter aus dem Westen.
Nach der Eroberung haben sich Christen von überallher in Jerusalem angesiedelt; sie haben die Lücken gefüllt, die verlassenen Häuser besetzt und der Stadt neues Leben eingehaucht. Syrer, Griechen, Bulgaren, Ungarn, Armenier, Georgier, darunter Nestorianer, Maroniten, Kopten, Orthodoxe und natürlich Latiner aus dem Westen. Daher auch das Sprachengewirr in den Gassen, obwohl das Fränkische, die Lingua franca, zur allgemeinen Sprache der Levante geworden ist. Allerdings kann man es kaum mehr reines Fränkisch nennen, denn es hat sich angereichert mit arabischen und griechischen Brocken und sogar einigen türkischen.
Am Sankt-Georgs-Markt bleibt Melisende erneut stehen. Ihr ist eingefallen, dass sie nach byzantinischer Seide Ausschau halten wollte. Der Markt ist trotz der frühen Stunde voller Menschen, die sich zwischen den Ständen bewegen, Ware prüfen und um Preise feilschen. Unüberhörbar werben die Händler für ihr Angebot. Über den Markt zu gehen ist jedes Mal ein Erlebnis. Immer findet man etwas Ausgefallenes. Neben Fleisch, Obst und Gemüse gibt es Schmuck, bunte Stoffe und Schnitzereien, silberne Haarnadeln, Rosenkränze aus Bernsteinperlen, sogar Reliquien. Sie sind bei den Pilgern besonders beliebt.
Mit Bedauern reißt Melisende sich los. »Vielleicht kommen wir heute Nachmittag wieder«, sagt sie und bedeutet den Wachen, dass es weitergeht.
Sie lassen den Markt hinter sich und nähern sich dem Jaffator. Es ist seit Tagesanbruch geöffnet, und unter den aufmerksamen Augen der Torwache herrscht ein reges Kommen und Gehen. Direkt daneben erhebt sich die mächtige Davidzitadelle, eine gewaltige Festung, einst von Herodes erbaut und in ihrer langen Geschichte nie eingenommen. Etwas weiter südlich sind die Mauern des neuen Königspalastes zu sehen.
Beim Anblick des Palastes wird Melisende bange zumute. Was ihr Vater wohl sagen wird, wenn er erfährt, wie ungehörig sie sich dem Patriarchen gegenüber verhalten hat? Es war eine Dummheit, den Mann gegen sich aufzubringen. Ihr ungestümes Gemüt ist mal wieder mit ihr durchgegangen. Sie bereut das inzwischen. Besonders, dass sie ihn einen Esel genannt hat, Worte, die sie nicht mehr zurücknehmen kann. Vaters Zorn kann schrecklich sein. Und doch ist sie entschlossen, die Ehe mit diesem Angeviner zu verweigern, komme, was wolle.
»Domina, was ist Euch? Ihr seid so nachdenklich.«
»Ach, nichts! Ich muss nur plötzlich an meine Mutter denken.«
»Ihr vermisst sie?«
Melisende nickt.
Ja, ich vermisse sie, denkt sie. Wäre sie doch nur noch am Leben. Sie hätte mich verstanden. Sie war aus anderem Holz geschnitzt als diese blassen fränkischen Weiber. Eine Frau des Ostens voller Leidenschaft und Liebe, für ihren Mann genauso wie für uns Töchter. Eine Löwin, die, wenn nötig, nicht zögerte, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie hätte mich verstanden.
Doch sie ist tot. Drei Jahre ist es schon her, dass sie gestorben ist. Vater hat es noch immer nicht verwunden. Sie wird mit ihm reden und in Mutters Namen an ihn appellieren. Er mag herrisch und cholerisch auftreten. Aber er weiß auch, wie es ist, jemanden zu lieben.
Die zwei Pilger, die zuvor in der Rotunde waren, haben die Kirche verlassen. Der Patriarch, den er kennt und dem er kurz zugenickt hat, ebenfalls. Auch die beiden jungen Frauen am Kirchenportal sind zum Glück gegangen, wer auch immer sie sein mögen. Raol ist allein unter der hohen Kuppel der Rotunde, wo jedem Geräusch ein Echo folgt, jedem Schritt, jedem Räuspern, jedem Rascheln der Kleidung.
Dies ist das Grab Christi, der heiligste Ort der Christenheit. Die Ädikula, die kleine Kapelle über dem Grab, glänzt in Gold und Silber. Gott ist in seiner Erhabenheit nicht körperlich zu greifen, dieses aus dem Fels gehauene Grab aber ist wirklich und anfassbar. Genau so wie die Richtstätte Golgatha nebenan. Und der Stein, auf den sie den Leichnam des Herrn gelegt haben, um ihn für das Begräbnis zu salben und in ein Leinentuch zu wickeln. Hier ist es geschehen. Wo sonst in der Welt käme man Gott so nahe?
Raol liegt auf den Knien, hat die Hände im Schoß gefaltet. Den Kopf hält er gesenkt und die Augen geschlossen. Man sollte meinen, er befände sich tief im Gebet. Aber der Eindruck täuscht. Er betet nicht. Er kommt nicht oft hierher, und wenn, dann eher zum In-sich-hinein-hören, um auf seinen Atem zu lauschen, der im immer gleichen Rhythmus anschwillt und abebbt wie die Brandung des Meeres. Zum Nachdenken ist er gekommen. Als könne er hier in der Stille am Grab des Herrn Antworten finden. Dabei weiß er nicht einmal genau, auf welche Fragen er Antworten sucht.
Antworten auf die Fragen des Lebens vermutlich. Nein, nicht allgemein, sondern zu seinem eigenen Leben. Er ist an einem Punkt angelangt, an dem alles unklar geworden ist, irgendwie verworren. Wie soll es mit ihm weitergehen? Was will er vom Leben? Wozu ist er hier auf dieser Erde? Was hat Gott mit ihm vor, wenn er es schon selbst nicht weiß? Hat er mit einem abgehalfterten Gotteskrieger überhaupt etwas vor? Mit einem, der zu viel erlebt, zu viel gesehen, zu viel Blut vergossen hat? Immer im Namen des Herrn, obwohl es doch heißt, du sollst nicht töten.
Vielleicht gibt es gar keinen Plan Gottes. Weder für mich noch für andere. Vielleicht gibt es auch keinen Gott, und wir bilden uns das alles nur ein.
Laut würde er so etwas natürlich nicht sagen. Aber verborgen in seiner Seele gibt es Zweifel. Raol öffnet die Augen und hebt den Blick zur Kuppel empor, durch deren Mitte Licht ins Innere der Rotunde fällt. Gibt es dich, Gott, da oben? Wenn ja, dann gib mir Antworten, auch wenn ich zu unbedeutend bin. Wenigstens die Antwort auf eine kleine Frage: Warum sind wir auf dieser Welt? Warum bin ich hier? Was erwartest du von mir?
Natürlich ist das keine kleine Frage, sondern eine große, eine ganz große sogar. Warum sind wir hier auf Erden unter dem unendlichen Sternenzelt des Himmels? Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und ist für uns gestorben. Und was jetzt? Hat es etwas verändert? Die Sünden der Welt hat sein Opfer bisher jedenfalls nicht verbannt. Das kann man jeden Tag von Neuem sehen.
Gott zu dienen war seine Bestimmung. Daran hat er geglaubt. Tatsächlich dient Raol seinem Gott seit Jahren. Und doch befriedigt es ihn nicht mehr. Es erfüllt ihn nicht mehr. Er fühlt sich wie eine ausgeleerte Amphore, die hohl klingt, wenn man daran klopft. Er hat alles gegeben, und nun ist nichts mehr da. Wenn seine Ordensbrüder beten, dann tut er nur so, aber er betet nicht.
Wozu auch? Wofür soll er denn beten? Dafür, dass sie eine Burg erobern, eine von vielen, die sie schon vor einem Jahr erobert und wieder verloren haben? Oder dass nicht noch mehr seiner Kameraden sterben? Besser, man gewöhnt sich nicht zu sehr an sie, an ihre Gesichter, an ihre Stimmen, an ihr Lachen. Dann ist es leichter, wenn man sie in ihrem Blut liegen sieht und später ihr Stuhl im Refektorium leer bleibt.
Soll er für sein Seelenheil beten? Oder gar für sein eigenes unwichtiges Leben? Es ist ihm egal, ob er lebt oder stirbt. Das Leben hat seinen Reiz verloren. Gott hat seine Bedeutung verloren. Die Hölle hat ihren Schrecken verloren, besonders wenn man die Hölle schon auf Erden erlebt hat.
Kurz schließt er erneut die Augen. Dann erhebt er sich und verlässt die Kirche.
Die Mitglieder der Haute Court sind bereits versammelt, als Melisende, bevor die Tür geschlossen wird, noch schnell in den Saal schlüpft. Das Gemurmel verstummt, die Köpfe wenden sich ihr zu. Aber nur kurz. Dann achtet man nicht weiter auf sie, und die privaten Gespräche werden wieder aufgenommen.
Sie findet einen Platz gleich neben der Tür, weit weg von der Estrade am gegenüberliegenden Ende des Saals, auf der König Baudouin, der Patriarch und Graf Foulques sitzen. Auch sie unterhalten sich leise und scheinen Melisende nicht bemerkt zu haben. Dieser Foulques behandelt sie ohnehin wie Luft. Für ihn ist sie anscheinend nur Mittel zum Zweck und außer dem gelegentlichen Austausch höflicher Floskeln keine weitere Beachtung wert.
Melisende beobachtet, wie der Patriarch sich vorbeugt und ihrem Vater etwas ins Ohr raunt. Sofort blickt Baudouin zu ihr herüber. Ihr steigt das Blut ins Gesicht. Hat der verdammte Geistliche sie gerade verraten? Doch zu ihrer Erleichterung nickt der Vater ihr zu. Was auch immer Étienne gesagt hat, besonders gram scheint der König ihr nicht zu sein. Melisende atmet erleichtert auf.
Manchmal fragt sie sich, warum ihr Vater auf ihrer Anwesenheit bei diesen Beratungen besteht. Angeblich soll sie verstehen, welche wichtigen Entscheidungen im Königreich zu treffen sind und wie die politische und militärische Lage ist. Auch den Debatten soll sie lauschen, die Männer einschätzen lernen, auf deren Schultern das Wohl des Königreichs ruht. Schließlich ist sie die Thronerbin.
Gleichzeitig hat er ihr klargemacht, dass sie nur geduldet ist, solange sie im Hintergrund bleibt und den Mund hält. Denn eine junge Frau in dieser ehrwürdigen Runde, auch wenn es die Tochter des Königs ist, geht vielen der großen Barone gegen den Strich. Nun, sie müssten sich nicht sorgen. Sie hat auf keinen Fall vor, sich an dem endlosen, meist langweiligen Gerede zu beteiligen. Dem Himmel sei Dank, dass diese Zusammenkünfte höchstens zwei- oder dreimal im Jahr stattfinden!
Der Fußboden des eigens zu diesem Zweck eingerichteten großen Saals ist mit grauen und weißen Marmorplatten im Schachbrettmuster ausgelegt. Zu beiden Seiten steht eine Reihe aufsteigender Bänke, auf denen insgesamt an die hundert Personen Platz finden. Jeder Adelige des Königreichs hat das Recht, an den Beratungen teilzunehmen und zu allen wichtigen Entscheidungen seine Stimme abzugeben.
Heute sind jedoch deutlich weniger zugegen, denn die Zusammenkunft beschränkt sich wie meistens auf die Herren der großen Lehen, die direkten Vasallen des Königs, die ihn beraten und über neue Steuern und Abgaben abstimmen oder über größere kriegerische Unternehmungen.
Die Haute Court dient zugleich als eine Art Gericht unter Gleichgestellten. Es werden Dispute unter Edelleuten verhandelt, ebenso Landrechte, die Vergabe großer Lehen, die Anfechtung von Erbschaften, die Schlichtung von Fehden oder die Verletzung von Treuepflichten. Aber auch Mord, schwere Tätlichkeiten oder Vergewaltigungen werden verhandelt.
Die Zusammenkünfte werden je nach Bedarf vom König einberufen oder auf Verlangen der Barone, was aber selten vorkommt. Die durch eine Wahl getroffenen Entscheidungen sind auch für den König bindend. Das hat sich seit den Eroberungen im Heiligen Land so eingebürgert. Denn der König braucht seine Barone, ohne ihre Krieger kann er das Königreich wohl kaum verteidigen. Er ist also im Grunde so etwas wie ein Primus inter Pares, der Erste unter Gleichen. Das gilt nicht nur für Jerusalem, sondern noch viel mehr für die anderen christlichen Fürstentümer Tripolis, Antiochia und Edessa. Die sind eigenständig und dem König in keiner Weise lehnsverpflichtet und daher noch viel schwerer unter einen Hut zu bringen als die Barone, auch wenn sie dem König eine gewisse Führungsrolle zugestehen, besonders wenn ihnen Gefahr droht. Meist aber verfolgen sie ihre eigenen Ziele.
Melisende sieht sich unter den Anwesenden um. Die Herren der reicheren Lehen, die auch die größte Zahl an Rittern aufzubieten haben, sitzen vorn, dem König am nächsten. Fast alle tragen bunt schillernde seidene Gewänder nach byzantinischer Mode, die bis über die Stiefel fallen. Haare halblang, Bärte sorgsam getrimmt. Es blitzt vor Edelmetall: feine silberverzierte Gürtel, goldene Fibeln, mit Edelsteinen besetzte Ringe. Die Herren zeigen gern ihren Reichtum. Waffen sind nicht erlaubt, nicht einmal Dolche, seit es in der Vergangenheit einige Male zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen ist.
Die Namen der bedeutenden Barone sind Melisende vertraut. Da ist zunächst Gerard Grenier, Herr über Sidon, ein noch junger Mann und in der Pflicht, hundert Krieger zu stellen. Sein Vater, dem die Baronie ursprünglich verliehen war, ist vor sechs Jahren gestorben.
Neben ihm sein Bruder Gauthier Grenier, Herr über Cäsarea, der dem König ebenfalls hundert Ritter schuldet.
Diesen beiden gegenüber hockt, mit den Ellbogen auf den Knien, Guillaume de Bures, Prinz von Galiläa. Sein Lehen hat ebenfalls hundert Ritter zu stellen. Der früh ergraute Endvierziger genießt das besondere Vertrauen des Königs. Im Stillen verflucht Melisende den Mann, denn er hat die Gesandtschaft angeführt, die ihr Vater letztes Jahr zum König von Frankreich geschickt hat, um einen Bräutigam für sie zu finden.
Neben Guillaume sitzt Gauthier de Brisebarre, Herr über Beirut. Auch er war Teil der Gesandtschaft. Er hat nur zwanzig Ritter zu stellen, gehört aber trotzdem zu den einflussreichsten Baronen.
Im Anschluss an die Brüder Grenier sitzt Robert de Troyes, Baron von Akkon, das zur königlichen Domäne gehört und hundert Ritter stellt. Er ist ein dickwanstiger alter Kämpe der ersten Tage mit einem vom Biergenuss geröteten Gesicht. Ihm fehlen zwei Finger an der rechten Hand. Irgendwie sieht er aus, als würde er sich in einem groben Lederwams wohler fühlen als in seinem feinen Aufzug.
Ihm gegenüber sitzt Onfroy de Toron, nördlich von Galiläa. Er hat achtzig Ritter aufzubieten. Der Mann ist Normanne und wie viele von ihnen groß und kräftig, hat Hände wie Schaufeln und ein Kinn, das aussieht wie mit der Axt geformt. Dazu misstrauische, stechende Augen.
Er unterhält sich mit Robert de Brun, dem Herrn über Nablus, ebenfalls Teil der königlichen Domäne, achtzig Ritter wert, und Payens d’Oultrejordain, Herr über das neue Gebiet jenseits des Jordans, sechzig Ritter wert.
Kurz verweilt Melisendes Blick bei Henri d’Auric, Baron von Hebron, sechzig Ritter. Er ist ein finster blickender hagerer Mann von üblem Ruf und glühendem Hass auf Muslime. Hinter seinem Rücken nennen sie ihn den Schlächter von Hebron. Man kann sich denken, warum.
Einigen dieser Männer würde ich ungern im Dunkeln begegnen, denkt Melisende. Aber es sind erfahrene Kriegsherren. Und die braucht das Land.
Ebenfalls zugegen sind die Herren von Sabaste, Bethsan, Nazareth und von weiteren, kleineren Baronien. Deren Gesichter sind Melisende bekannt, die Namen allerdings weniger. Vergeblich sucht sie nach ihrem Freund, Hugues du Puiset. Er hat nach dem Tod des Vaters vor sechs Jahren die Grafschaft Jaffa geerbt. Hugues besitzt Sinn für Humor und hätte bestimmt etwas Frivoles über jeden der hier Anwesenden zu sagen oder hätte ihr den neuesten Klatsch berichtet.
Dass eine Grafschaft an den Sohn vererbt wird, ist nicht zwingend. Am Ende entscheidet der König, an wen die Grafschaft nach dem Tod des Barons geht, und wenn nötig die Haute Court, immer zum Wohle des Königreichs. Schwächlinge kann man unter den Baronen des Landes nicht brauchen. Hugues aber genießt Baudouins Vertrauen. Zudem waren beide Familien schon im alten Land miteinander befreundet. Melisende selbst kennt Hugues seit ihrem zwölften Lebensjahr, seit die Familie nach Jerusalem umgesiedelt ist.
Während sie vergeblich nach ihm Ausschau hält, fallen ihr in einer der hinteren Bänke zwei Männer auf. Über schlichten dunklen Gewändern aus grobem Stoff trägt jeder von ihnen ein ärmelloses Surcot aus gebleichtem Leinen mit einem großen roten Kreuz. Offensichtlich Ritter des Tempels. Zu ihrer Überraschung erkennt sie in einem der beiden den unhöflichen Kerl von heute Morgen, der Maria einen blauen Fleck beschert hat. Jetzt starrt er auch noch zu ihr herüber – mit der gleichen finsteren, sauertöpfischen Miene wie in der Grabeskirche. Doch dann scheint es ihm zu dämmern, wer sie ist, denn seine Brauen heben sich erstaunt, und er mustert sie genauer.
Ich hoffe, du bereust jetzt dein rüdes Benehmen, denkt sie. Dann blickt sie weg. Was hat der hier zu suchen? Und wie hatte Maria ihn genannt? Raol irgendwas. Dann fällt es ihr ein. Raol de Montalban. Ein Provenzale. Am liebsten würde sie ihm noch einmal die Meinung sagen, aber im Grunde ist der Kerl es nicht wert, sich mit ihm zu befassen. Es wundert sie nur, dass heute Templer zugegen sind. Ungewöhnlich. Ein Stimmrecht haben sie nicht.
In diesem Augenblick räuspert sich der König lautstark und hebt die Hand. Das leise Geraune privater Gespräche erstirbt. »Liebe Freunde und Kampfgefährten«, sagt er in seinem tiefen Bass. »Ich danke euch für euer Erscheinen und erkläre die Versammlung für eröffnet.«
Melisendes Vater ist groß und breitschultrig, sehr schlank bis hager, eher sehnig als besonders muskulös. Er ist ähnlich wie die anderen Herren gekleidet, trägt außer einem großen Siegelring aber keinen Schmuck. Die goldblonden Haare wie auch sein langer Bart, auf den er immer sehr stolz war, sind von Grau durchzogen, schließlich ist er nicht mehr der Jüngste. In seinen wasserblauen Augen blitzt es oft schelmisch, aber sie können auch Furcht einflößen, wenn er zornig ist. Die Sonne des Südens hat ihm übel mitgespielt. Das zeigt sich besonders auf Stirn und Nase und auf den Händen, die von braunen Flecken übersät sind. Alles in allem und trotz seiner sechsundfünfzig Jahre ist er ein beeindruckender Mann.
»Um was geht es denn heute?«, fragt der Baron von Caesarea. Seine Stimme klingt rau, als wäre er erkältet. »Ich hab was von einem Feldzug läuten hören.«
Baudouin nickt. »Da liegst du nicht ganz falsch, Gauthier. Aber zunächst etwas anderes.«
Er wendet sich Foulques zu und legt ihm die Hand auf die Schulter. »Ich möchte euch den Comte d’Anjou und zukünftigen Gemahl meiner ältesten Tochter vorstellen. Erst vor wenigen Tagen ist er bei uns angekommen.« Er hebt die Stimme und winkt kurz Melisende zu. »Und du, Tochter, hörst ausnahmsweise mal nicht zu. Am besten tust du jetzt so, als wärest du gar nicht anwesend.«
»Das tu ich doch immer«, entfährt es ihr.
Sie hört ein paar der Männer lachen. Auch Baudouin muss lächeln. »Da hört ihr’s. Nicht auf den Mund gefallen, mein Töchterchen. Ich sage euch, vier Töchter aufzuziehen ist schlimmer, als einen Wurf Katzen zu hüten.« Er wendet sich Foulques zu. »Sei gewarnt, mein Lieber. Dich erwartet eine scharfe Zunge.«
Auch der Graf lächelt und blickt zu ihr herüber. Er sitzt zu weit entfernt, als dass Melisende hätte sagen können, ob das Lächeln echt oder vorgetäuscht ist. Eher vorgetäuscht, vermutet sie. Jedenfalls nach den ersten Eindrücken, die sie von ihm gewonnen hat. Höflich, aber kalt wie ein Fisch. Er soll vierzig Jahre alt sein, ist Witwer und hat vier Kinder, die er aber im alten Land zurückgelassen hat. Es heißt, er stehe sich gut mit dem König des Frankenreichs, noch besser mit dem englischen König, dessen Tochter erst vor einem Jahr seinen ältesten Sohn geehelicht hat.
Und nun soll ausgerechnet ich sein Bett wärmen, denkt Melisende. Dabei könnte der Gegensatz zwischen Foulques und ihrem Vater nicht größer sein. Im Vergleich zu Baudouin ist Foulques von bescheidenem Wuchs. Er wirkt gedrungen und hat krumme Beine, dazu feuerrote Haare, das Gesicht voller Sommersprossen, einen schmallippigen, verkniffenen Mund und kleine grüne Augen, die alles zu bemerken scheinen. Nein, so hat sie sich ihren Zukünftigen nicht vorgestellt. Eher wie den Sohn des Normannen Bohemund, den Alice geheiratet hat, einen blonden Helden. Alice hat mit diesem Prachtkerl von Mann wirklich Glück gehabt. Und jetzt ist sie auch noch Fürstin von Antiochia.
Der König verliert noch einige freundliche Worte über Foulques, die von der Versammlung wohlwollend aufgenommen werden. Dann meldet sich Robert de Troyes zu Wort. »Mein lieber Foulques, im Namen aller hier möchte ich sagen: Herzlich willkommen zurück in Jerusalem! Wann warst du das letzte Mal hier?«
»Muss vor zehn Jahren gewesen sein«, ist die Antwort.
»In Foulques haben wir einen, dem das Land und die Lage hier nicht unbekannt sind«, fügt der König hinzu. »Ich denke, das ist wichtig.«
»Auf jeden Fall«, brummt Robert. »Vor allem ist er kein Grünschnabel. Ein gestandener Mann und Heerführer.«
»Das kann ich bestätigen«, fügt Brisebarre hinzu.
»Außerdem ein Förderer unser Tempelritter«, sagt de Bures. »Hab ich nicht recht, Foulques?«
Der nickt. »In der Tat. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, meinen alten Kampfgefährten, Großmeister Hugues de Payens, wiederzutreffen. Aber unsere Schiffe scheinen sich gekreuzt zu haben. Ich bin hier, und Hugues ist in Frankreich.«
Der König nickt. »Der Großmeister versucht, Geld und Krieger für den Orden aufzutreiben. Deshalb habe ich Robert de Craon heute eingeladen. Er vertritt Hugues in dessen Abwesenheit.«
Alles blickt zu den beiden Templern hinüber. Robert de Craon verbeugt sich kurz. Er ist für diese Aufgabe noch recht jung, aber tatkräftig und mutig soll er sein. Und ein guter Anführer. »Wir Templer sind hocherfreut und möchten den Grafen ebenfalls herzlich willkommen heißen«, sagt er. »Auch und besonders im Namen Gottes. Denn er wird uns helfen, weiter Gottes Werk zu tun.«
»Und wir alle wissen«, fügt Baudouin hinzu, »wie wichtig uns der Orden geworden ist. Auch wenn er erst aus fünfzig Rittern besteht.«
»Ich habe mich beim fränkischen König für die Templer verwendet«, sagt Foulques. »Unser Freund, der Großmeister, wird dort offene Ohren für sein Anliegen finden.«
»Ausgezeichnet«, sagt Baudouin. »Vielleicht treffen Verstärkungen ja noch vor Ende des Sommers ein, rechtzeitig vor unserem Feldzug gegen Damaskus.«
»Ah, daher weht also der Wind«, knurrt der Baron von Hebron. »Ich hab mir schon so was gedacht.«
»Die Damaszener Seldschuken sind geschwächt, seit ihr Fürst letztes Jahr gestorben ist«, sagt Baudouin. »Eine Gelegenheit, auf die wir lange gewartet haben. Sollte es gelingen, das reiche Damaskus einzunehmen … Na, ich muss euch nicht erklären, was das für uns bedeuten würde.«
Zustimmendes Gemurmel füllt den Saal. Aber nicht alle sind überzeugt. Es gibt auch skeptische Mienen. »Wir können doch hoffentlich auf dich zählen, Foulques«, sagt Robert de Brun.
»Aber natürlich«, erwidert der Graf. »Ich bin bereit, das Kreuz nach Damaskus zu tragen. Gott wird auf unserer Seite sein und uns den Sieg schenken.«
Melisende hat langsam genug von dem Gerede. In ihr kocht die Wut hoch. Was ist das hier? Ein Viehmarkt? Die tun gerade so, als hätten sie einen Preisbullen erstanden. Und sie soll die Kuh für ihn sein. Dabei verliert man über sie kein einziges Wort. Sie ist diesen Kerlen völlig unwichtig, solange sie nur einen Mann wie Foulques kriegen. Halten sie diesen rothaarigen Zwerg etwa für den Gesalbten, für den Retter der Christenheit? Da hat sie aber noch ein Wörtchen mitzureden.
Wütend erhebt sie sich und verlässt den Saal.
»Was ist nur in dich gefahren?«, fährt der König seine Tochter an. Offensichtlich ist er ziemlich ungehalten. »Warum zum Teufel hast du den Saal verlassen?«
»Ich hatte genug von eurem Gegurre. Foulques hier und Foulques da. Das war ja nicht zum Aushalten.« Sie ist immer noch wütend.