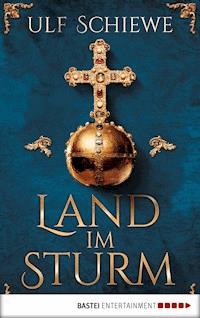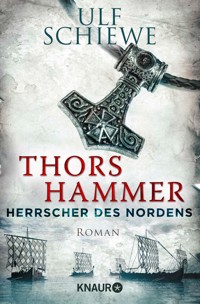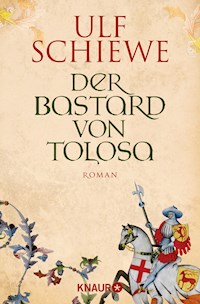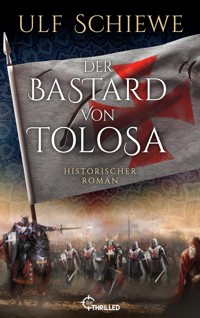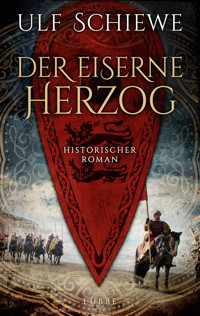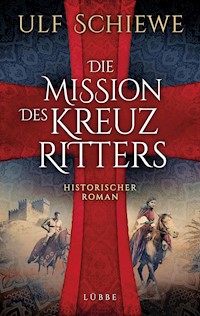9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Mysterium der Himmelsscheibe, eine Hochkultur im Herzen Europas und der immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse - ein großer historischer Roman mit unvergesslichen Figuren, ausgezeichnet mit dem Goldenen Homer 2021!
Nebra vor 4000 Jahren: Lange haben sich die Menschen der Willkür des mächtigen Fürsten Orkon gebeugt, der das Volk quält und ausbeutet, sich nimmt, wonach immer es ihn gelüstet. Jetzt endlich regt sich Widerstand. Die junge Priesterin Rana will Orkons dunkle Herrschaft brechen und die Menschen befreien. Das Werk ihres Vaters soll ihr dabei helfen: eine bronzene Scheibe, die den Sternenhimmel zeigt und eine geheime Botschaft der Götter enthält. Sie steht für die Göttin des Lichts, die dem Hass Liebe entgegensetzt. Doch Ranas Weg ist gefährlich, viel steht auf dem Spiel. Auch das Leben derjenigen, die ihr am liebsten sind ...
Auf einem Hügel bei Nebra stießen Sondengänger Ende der 1990er-Jahre auf eine bronzene Scheibe. Sie zeigt Mond und Sterne, gilt heute als die erste konkrete Himmelsdarstellung der Menschheitsgeschichte. Ein Sensationsfund, den die Finder zunächst an Hehler verscherbelten. Erst 2002 kam die Himmelsscheibe in die kundigen Hände von Archäologen. Seither wird sie erforscht - und hat das Bild unserer Vorfahren geändert. Ulf Schiewe lässt ihre unbekannte Kultur auferstehen und spinnt um sie einen großen, epischen Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
ÜBER DAS BUCH
Das Mysterium der Himmelsscheibe, eine Hochkultur im Herzen Europas und der immerwährende Kampf zwischen Gut und Böse – ein großer historischer Roman mit unvergesslichen Figuren
Nebra vor 4000 Jahren: Lange haben sich die Menschen der Willkür des mächtigen Fürsten Orkon gebeugt, der das Volk quält und ausbeutet, sich nimmt, wonach immer es ihn gelüstet. Jetzt endlich regt sich Widerstand. Die junge Priesterin Rana will Orkons dunkle Herrschaft brechen und die Menschen befreien. Das Werk ihres Vaters soll ihr dabei helfen: eine bronzene Scheibe, die den Sternenhimmel zeigt und eine geheime Botschaft der Götter enthält. Sie steht für die Göttin des Lichts, die dem Hass Liebe entgegensetzt. Doch Ranas Weg ist gefährlich, viel steht auf dem Spiel. Auch das Leben derjenigen, die ihr am liebsten sind …
Auf einem Hügel bei Nebra stießen Sondengänger Ende der 1990er-Jahre auf eine bronzene Scheibe. Sie zeigt Mond und Sterne, gilt heute als die erste konkrete Himmelsdarstellung der Menschheitsgeschichte. Ein Sensationsfund, den die Finder zunächst an Hehler verscherbelten. Erst 2002 kam die Himmelsscheibe in die kundigen Hände von Archäologen. Seither wird sie erforscht – und hat das Bild unserer Vorfahren geändert. Ulf Schiewe lässt ihre unbekannte Kultur auferstehen und spinnt um sie einen großen, epischen Roman.
Ulf Schiewe
Die Kindervon Nebra
Historischer Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Audio-Download erschienen.
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Karte: Markus Weber, Guter Punkt, München
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Himmelsscheibe von Nebra: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt – Landesmuseum für Vorgeschichte –, Richard-Wagner-Straße 9, 06114 Halle/Saale; © shutterstock.com: raresirimie | Anelina | Roxana Bashyrova | Yuri | hebalius; © State Museum of Prehistory, Halle, Germany/Bridgeman Images
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-8639-4
www.luebbe.de
www.lesejury.de
DIE FLUSSGEISTER
O ihr verspielten Wesen. Verzückt lauschen wir eurem Plätschern und Flüstern. Ihr lieblichen Jungfrauen mit Wasserrosen im Haar, die ihr jeden Bach und jeden Fluss lebendig macht. Auch wenn ihr es in eurem Übermut bisweilen zu weit treibt und die Auen überflutet.
Rana hockt an einen Erlenstamm gelehnt am Flussufer und lauscht dem Murmeln des Wassers. Es ist ein einsamer Ort tief im Wald. Sie ist schon oft hier gewesen, dabei noch nie auf menschliche Spuren gestoßen. Nur auf die der Rehe, die an dem kleinen Fluss ihren Durst stillen, oder die eines Fuchses. Deshalb liebt sie es hier. Es ist ein guter Ort, um nachzudenken, um ihr Herz zu befragen.
Unter dem Blätterdach des Waldes herrscht angenehmes Halbdunkel. Hoch oben in den Baumkronen aber bringt die Sonne das helle Frühlingsgrün der Knospen zum Leuchten wie auch das der Gräser auf der kleinen Lichtung gegenüber, wo die ersten Blumen blühen. Licht und Schatten. Ein Gegensatz wie die beiden Lebenswege, zwischen denen sie zu wählen hat.
Soll sie ein einfaches, unbedeutendes Leben führen, wie andere junge Frauen einen Mann finden, Kinder gebären und damit zufrieden sein? Oder soll sie ihr Leben der Göttin weihen? Soll sie tun, was alle im Dorf und vor allem ihre Mutter von ihr erwarten, oder soll sie sich dem verweigern? Es ist die wichtigste Entscheidung ihres jungen Lebens, eine Entscheidung darüber, wer sie ist und wer sie sein will, über ihre Aufgabe in der Gemeinschaft, über die Bürde, die sie ein Leben lang tragen wird, falls sie sich für Mutters Weg entscheidet.
Noch ist sie unentschlossen und verwirrt. Ihre Gedanken jagen in die eine und dann wieder in die andere Richtung, ohne dass sich Gewissheit einstellen will. Sie hat sich hierher geflüchtet, um den vorwurfsvollen Blicken ihrer Mutter zu entgehen, die nicht versteht, warum sie plötzlich Zweifel hat. Hier im Wald und im Schatten der Bäume muss sie keine Fragen beantworten, muss sich nicht erklären. Wenn sie doch nur wüsste, was das Beste ist!
Eine Amsel schwirrt heran und unterbricht die quälenden Gedanken. Auf einem Zweig nicht weit von ihr lässt sie sich nieder, legt den Kopf auf die Seite und betrachtet Rana misstrauisch aus einem Auge. Dann wippt sie mit dem Schwanz und fliegt davon, als habe sie Besseres zu tun, als ihre Zeit mit einem Menschenweib zu vergeuden.
Rana reibt sich übers Gesicht, als könne sie damit die trübe Stimmung verscheuchen. Ihr Bruder Arni hat recht. Sie sollte sich nicht unnötig mit endlosem Grübeln herumschlagen. Arni ist ein ruhiger Mann. Er redet nicht viel, aber er scheint immer zu wissen, was er will. Sie beneidet ihn darum.
Ihr Blick wandert über die kleine Wiese am anderen Ufer und über den Wald. Dies ist ihr ganz eigener Ort, sie muss ihn mit niemandem teilen. Ein Zauber liegt über dem sich windenden Fluss mit seinem Uferschilf, dem angeschwemmten Fallholz, den halbhohen Büschen zu beiden Seiten, den tief hängenden Ästen, die sich im Wasser spiegeln. Über die sich kräuselnde Oberfläche flirren Libellen und andere Insekten, in der Tiefe huscht ab und zu der Schatten eines Fisches vorbei.
An der Stelle, wo sie sitzt, befindet sich ein winziger Sandstreifen, der einlädt, die Zehen in ihm zu vergraben. Neben den Vogelrufen und dem Säuseln des Windes in den Zweigen der Bäume ist wenig zu hören. Besonders liebt sie das Plätschern und Murmeln des Wassers. Oder ist es das Raunen der Flussgeister, die miteinander reden? Jedes Gewässer hat seine Geister. Manchmal vermeint sie, eine der vielen Flussgöttinnen zu hören, die für einen Augenblick den Kopf aus dem Wasser hebt und dann wieder verschwindet. Oder war es doch nur eine Fischflosse? Bestimmt hat auch das Liebesquaken der Frösche eine Bedeutung. Vielleicht ist es Panos, der seiner Liebsten nachstellt. Aber die Geister stören Rana nicht. Im Gegenteil. Sie fühlt sich ihnen verbunden. Auch wenn sie nicht versteht, was sie einander zu sagen haben.
Rana ist gern allein. Im Gegensatz zu anderen jungen Frauen im Dorf, die andauernd reden müssen und es seltsam finden, dass Rana sich absondert, allein durch die Wälder streift, sogar auf Bäume klettert und manchmal erst nach Einbruch der Dunkelheit zurückkehrt. Sie schütteln den Kopf und sagen, so etwas tun doch nur Jungs oder Männer, und sie fragen, ob sie denn keine Angst hat, sich so weit von der Siedlung zu entfernen und ganz allein durch die Wildnis zu wandern.
Nein, Angst hat sie nicht. Sie liebt den Wald und die Tiere darin. Einmal hat sie ein verlassenes Rehkitz heimgebracht und es mit Kuhmilch aufgezogen. Selbst vor Wölfen oder Bären fürchtet sie sich nicht, sie ist sicher, dass Astaris, die jungfräuliche Jägerin, sie beschützt. Ist der Bär, der Herrscher der Wälder, nicht ihr geweiht?
Sogar ihre Mutter hat es längst aufgegeben, Rana für diese Ausflüge zu schelten, obwohl sie sich Sorgen macht. »Rana ist eben anders«, pflegt sie zu sagen.
Der Gedanke an ihre Mutter führt unweigerlich zu der quälenden Frage, an der sie seit Wochen nagt und die sie am liebsten von sich schieben würde. Mutter zürnt ihr wegen ihres Zögerns. Schließlich sei sie von den Göttern erwählt, von Destarte selbst, und dürfe sich ihrer Bestimmung nicht verweigern.
Rana seufzt. In einem hat Mutter recht: Sie ist nicht wie andere junge Frauen im Dorf, sondern die Tochter der edlen Herdis, einer von allen verehrten Priesterin. Jeder erwartet, dass sie in Mutters Fußstapfen tritt. Vorbestimmt sei das, behauptet vor allem Herdis und mahnt, daraus erwachse ihr eine besondere Verantwortung. Schließlich habe sie Rana seit Langem auf diese Aufgabe vorbereitet, ihr alles beigebracht, was es zu wissen gibt. Und jetzt soll all das umsonst gewesen sein? Rana versteht nur zu gut, dass ihre Mutter aufgebracht ist.
Wenn es nach Herdis ginge, sollte Rana während des großen Festes geweiht werden. Mit allem, was die Riten bei dieser Gelegenheit von ihr verlangen. Doch anstatt sich zu freuen, denkt sie mit Beklemmung an das, was ihr bevorsteht. Nicht vor der Weihe fürchtet sie sich, vielmehr vor der Verantwortung für das nahe Heiligtum auf dem Hügel und für die Menschen, die sich hilfesuchend an sie wenden werden, wenn Mutter sich zurückzieht. Je näher der Tag rückt, desto weniger fühlt sie sich der Aufgabe gewachsen. Wie könnte sie jemals ihre Mutter ersetzen? Und will sie das überhaupt? Im Grunde ist sie nicht sicher, was sie eigentlich will.
Was, wenn sie nicht Destartes Priesterin wird? Mit ihren achtzehn Wintern wird sie schon bald über das beste Heiratsalter hinaus sein. Bisher hat sie sich für den Dienst an der Göttin aufgehoben. Dass sie vielleicht nie heiraten wird, stört Rana eigentlich nicht. Für ein Dutzend Rinder an einen Großbauern verkauft zu werden, den sie nicht liebt, wäre noch schlimmer als Priesterin zu werden. Außerdem gefällt ihr keiner der jungen Männer im Dorf. Weshalb man sie für spröde hält. Aber auch das hat sie wahrscheinlich von ihrer Mutter, dieses Anderssein, Anders-sein-Wollen, denn auch Herdis kann man nicht mit anderen Weibern vergleichen.
Rana seufzt ein weiteres Mal.
Ein Sonnenstrahl fällt durch die Blätter und badet ihre Gestalt für einen Augenblick in gleißendem Licht. Heute ist der erste wirklich schöne Tag dieses Frühlings. Die Sonne hat schon mehr als die Hälfte ihres Weges zurückgelegt. Es ist Nachmittag und warm geworden. Unter dem Laubdach des Waldes ist die Luft schwül. Rana hat Lust, sich abzukühlen und den weichen Flussgrund zwischen den Zehen zu spüren. Sie löst die Riemen ihrer Sandalen und streift sie von den Füßen.
Als sie sich erhebt, glaubt sie ein fernes Wiehern zu vernehmen. Sie dreht den Kopf, um zu lauschen. Ein Pferd? Hier im Wald, wo es weit und breit keine Weide gibt? Wo ein Pferd ist, ist meist auch ein Reiter. Aber sosehr sie sich bemüht, es ist nichts weiter als Vogelgezwitscher zu vernehmen.
Nach einer Weile gibt sie es auf. Sie muss sich getäuscht haben. Wer sollte sich hier auch herumtreiben? So weit entfernt von den Hütten des Dorfs. Weit und breit ist nichts als Wildnis, wahrlich kein Gelände für Pferde. Kurz entschlossen zieht sie sich ihr Gewand über den Kopf und lässt es ins Gras fallen. Mit beiden Händen sammelt sie ihr langes Haar und bindet es im Nacken zu einem lockeren Knoten.
Nackt steigt sie die Uferböschung hinunter und ins grelle Sonnenlicht. Sie spürt die Wärme auf der Haut, während sie vorsichtig ins Wasser steigt. Doch der Fluss ist noch so kalt, dass sie Gänsehaut bekommt. Sie watet in die Mitte, wo das Wasser ihr bis an die Schamhaare reicht. Einen Augenblick lang bleibt sie stehen, um sich an die kalte Strömung zu gewöhnen.
Sie ist kurz davor, sich hinzuhocken und ganz einzutauchen, als sie einen Schwarm Vögel auffliegen hört und dann das Knacken eines Zweiges. Erschrocken legt sie die Hände vor ihre Brüste und schaut sich hastig um. Ist da jemand?
Doch es ist nichts zu sehen als das Uferschilf und die Büsche, die den Fluss säumen, die Erle, an der sie gesessen hat, und die dicht stehenden Stämme des Waldes. Wahrscheinlich war es nur ein Tier. Und doch fühlt sie sich auf einmal beobachtet und bekommt Angst.
»Wer ist da?«, ruft sie.
Nichts regt sich, keine Antwort.
Das Baden ist ihr verleidet, und sie watet aufs Ufer zu. In diesem Augenblick hört sie ein unterdrücktes Kichern. Vor Schreck zuckt sie zusammen. Das war eine Männerstimme, kein Zweifel! Unwillkürlich tritt sie einen Schritt zurück und versucht erneut, ihre Blöße zu bedecken. Das Herz schlägt ihr plötzlich bis zum Hals.
»Wer ist da?«, ruft sie ängstlich. »Zeig dich, damit ich dich sehen kann.«
Ein Kopf taucht zwischen den Büschen auf. Dann tritt ein Mann aus dem Schatten des Waldes ans Ufer, und zu Ranas Entsetzen zwängen sich zwei weitere Kerle durch die Büsche und starren grinsend zu ihr herüber.
Sie weicht noch einen Schritt zurück. Das sind keine Bauern aus ihrem Dorf. Diese hier sehen mit ihren harten bärtigen Gesichtern, gestählten Muskeln und breiten, in Leder gekleideten Schultern wie Krieger aus. In den Händen tragen sie Jagdbögen, im Gürtel Kriegsäxte. Mit gierigen Augen mustern sie von oben bis unten Ranas nackten Leib. Noch nie hat sie sich so verwundbar wie unter diesen Blicken gefühlt.
»Was haben wir denn hier?«, ruft einer der drei und lacht.
Der Mann ist größer als die anderen, dunkelhaarig und gut aussehend. An seiner linken Schläfe sind ein paar Strähnen zu einem dünnen Zopf geflochten. Auf der rechten Wange trägt er eine Tätowierung. Sieht aus wie eine Schlange. Der Mann ist noch jung, und doch geht etwas Dunkles von ihm aus, eine gefährliche Aura. Ganz offensichtlich ist er der Anführer. Besonders die kalten Augen machen Rana Angst. Etwas an ihm kommt ihr bekannt vor. Es ist das Schlangentattoo. Wo hat sie das schon gesehen?
»Habt ihr euch endlich satt gestarrt?«, ruft sie ihnen zu, weit mutiger, als sie sich fühlt. »Werft mir lieber mein Gewand herüber!«
»Nackt siehst du aber hübscher aus«, erwidert einer der drei. Sein Lachen entblößt eine Zahnlücke im Oberkiefer. Er scheint etwas älter als die anderen zu sein. Er trägt eine ähnliche Tätowierung unter dem rechten Auge.
»Was denkst du, Arrak?«, fragt der Dritte, ein grobschlächtiger junger Bursche mit einer gebrochenen Nase. »Schnappen wir sie uns?«
Arrak! Natürlich! Die Erkenntnis jagt ihr einen noch größeren Schrecken in die Glieder. Arrak heißt der Sohn des Fürsten. Ein Kerl von üblem Ruf. Grausam und unbeherrscht soll er sein. Der Vater ist schon schlimm genug, aber dieser Arrak, so heißt es, scheut vor keiner Schandtat zurück. Wenn auch nur die Hälfte von dem wahr ist, was man sich über ihn erzählt, muss sie jetzt um ihr Leben bangen. Von Panik erfasst blickt sie um sich. Wie kann sie entkommen? Wohin kann sie fliehen?
»Also gut«, hört sie Arrak sagen. »Wer mir das hübsche Häschen fängt, hat eine Belohnung verdient!«
Sofort springen seine zwei Gefährten ins Wasser. Rana wendet sich zur Flucht. So schnell sie kann, watet sie die wenigen Schritte bis zum gegenüberliegenden Ufer und zieht sich an einem Grasbüschel an der Böschung empor. Hinter ihr das Geräusch der beiden Männer, die eiligst durch den Fluss waten. Einer der Kerle bekommt ihren Fuß zu fassen und versucht, sie zurück ins Flussbett zu zerren. Sie kreischt vor Angst, kann sich jedoch mit einem Tritt befreien und rennt, so schnell sie kann, durchs kniehohe Gras der Lichtung.
Sie stolpert mit ihren nackten Zehen über einen Stein oder eine Wurzel, droht zu stürzen, fängt sich wieder und rennt weiter. Den Schmerz spürt sie kaum, angetrieben von dem Johlen der Männer, die sie verfolgen.
Ein hastiger Blick über die Schulter. Auch Arrak hat den Fluss überquert und rennt mit dem Jagdbogen in der Hand hinter den anderen her.
Wieder stolpert Rana, und diesmal stürzt sie zu Boden. Schon wirft sich einer der Verfolger auf sie. Es ist der mit der Zahnlücke. Den Bogen hat er fallen lassen, stattdessen versucht er, sie niederzuringen.
Jetzt werden sie mich umbringen, fährt es ihr durch den Kopf, und sie sucht mit den Händen nach einem Stein oder irgendetwas, um sich zu verteidigen. Aber da ist nichts als Gras.
Sie wehrt sich verzweifelt, bockt wie ein wildes Fohlen, aber der Kerl ist stark und vor allem schwer. Er sitzt ihr rittlings auf dem Bauch, packt sie bei den Armen und drückt sie mit seinem Gewicht ins Gras. Sein bärtiges Gesicht ist direkt über ihr. Schweißgestank und fauliger Atem wehen sie an. Rana stößt mit dem Kopf vor und bekommt sein Ohr zwischen die Zähne. Mit aller Kraft beißt sie zu.
Der Mann reißt den Kopf zurück und brüllt vor Schmerz. Rana schmeckt Blut und spuckt etwas Weiches aus. Dann trifft sie ein Faustschlag, der ihr beinahe die Besinnung raubt. Ihr Angreifer sitzt immer noch auf ihr, auch wenn ihm jetzt das Blut am Hals herunterläuft. Er flucht ausgiebig und verpasst ihr noch einen Faustschlag. Seine Gefährten stehen dabei und lachen.
»Hoho! Da haben wir ja eine richtige Wildkatze«, sagt der, den sie Arrak nennen.
Rana hat nicht vor, sich kampflos zu ergeben. Sie bekommt einen Arm frei und schlägt um sich, haut dem Kerl, der auf ihr sitzt, die Faust ins Gesicht, windet sich und versucht, ihn abzuwerfen, doch vergebens. Jetzt packt der Kerl sie auch noch am Hals und drückt ihr die Gurgel zu, sodass sie keine Luft mehr kriegt.
»Verfluchtes Weibsstück!«, hört sie ihn brüllen. Blut aus seiner Wunde tropft ihr ins Gesicht. »Hilf mir mal einer!«
Rana glaubt zu ersticken. Jemand packt von hinten ihre Arme. Jetzt kann sie nur noch mit den Beinen strampeln. Aber auch das hilft nicht. Bevor ihr vor Atemnot die Sinne vergehen, nimmt der Kerl, der auf ihr sitzt, die Hand von ihrer Kehle, sodass sie endlich Luft schnappen kann.
»Lasst mich los, ihr Bastarde!«, keucht sie.
»Hübsches Weib«, grunzt der Mann, der ihre Arme festhält. »Was meinst du, Arrak? Du magst sie doch wild.«
Arrak nickt. »Wild wie eine feurige Stute.« Er lacht.
Der Kerl, der auf ihr sitzt, betastet seine Wunde und flucht ausgiebig. »Die hat mir doch tatsächlich das Ohr abgebissen!«
»Nur ’n kleines Stück, Brunn. Stell dich nicht so an«, sagt Arrak und hebt geringschätzig die Schultern. »Du hast sie als Erster geschnappt und deine Belohnung ehrlich verdient.« Er grinst. »Also zeig dem Weib, was für ’n Kerl du bist.«
Der Angesprochene fletscht die Zähne zu einem hässlichen Grinsen. »Haltet sie gut fest«, knurrt er. »Sonst beißt die mir das andere Ohr auch noch ab.«
Er steht auf und nestelt an seinem Gürtel. Rana nimmt die Gelegenheit wahr und tritt ihm mit Wucht zwischen die Beine. Sie muss gut getroffen haben, denn der Kerl stöhnt auf, packt seine gequälten Hoden und krümmt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht nach vorn.
Das rettet ihm das Leben, denn genau in diesem Moment jagt ein Pfeil über seinen Kopf hinweg. Fast zeitgleich surrt ein zweiter heran und fährt dem Kerl, der Rana festhält, zwischen die Schulterblätter. Mit einem Schrei gibt der ihre Arme frei und sinkt zur Seite.
Sofort rappelt Rana sich auf und rennt, so schnell sie kann. Nur weg, nur weg! Mit wenigen Schritten hat sie den Wald erreicht, stolpert über gefallene Äste und hastet weiter durch altes Herbstlaub. Ihr Herz hämmert wie wild. Ihr Atem kommt stoßweise, und die Kehle schmerzt ihr vom Würgegriff des Kerls, der sie niedergerungen hat. Erst nach fünfzig Schritten wagt sie einen Blick über die Schulter.
Niemand folgt ihr. Im Gegenteil. Die beiden Männer heben ihren verwundeten Kameraden auf die Schulter, um sich eilig zum Fluss zurückzuziehen. Hinter der Böschung gehen sie in Deckung und spannen ihre Bögen. Aber kein Ziel scheint sich zu bieten. Vom Waldrand fliegen keine Pfeile mehr in ihre Richtung.
Wer, bei allen Göttern, hat da geschossen? Es müssen mindestens zwei Schützen gewesen sein, so kurz aufeinander sind die Pfeile gekommen. Das Surren der Befiederung hat sie noch im Ohr und den dumpfen Aufschlag des Treffers.
Rana zittert am ganzen Leib. Sie kann es kaum glauben, aber sie scheint ihren Angreifern fürs Erste entkommen zu sein. Sie sieht sich um. Warum zeigen sich ihre Retter nicht? Sind sie genauso eine Gefahr wie die anderen? Vielleicht wollen sie denen nur die Beute abjagen. Ja, so fühlt sie sich – wie eine Beute. Am liebsten möchte sie in den Boden kriechen, in irgendein Mauseloch.
Astaris, hilf mir!, fleht sie die Jägerin und Göttin des Waldes an. Und natürlich ihre geliebte Destarte. Wenn ich deine Dienerin sein soll, o Himmlische, dann beschütze mich!
Rana holt tief Luft, versucht, klar zu denken. Zurück zu ihren Sachen kann sie nicht. Vor allem sollte sie nicht hier stehen bleiben, obwohl ihr rechter Fuß blutet. Besser schnell weg von hier und sich irgendwo verstecken. Humpelnd hastet sie weiter, blickt dabei immer wieder mit bangen Blicken um sich. Doch niemand scheint sie zu verfolgen. Der Wald liegt still. Von den drei Männern, die sie überfallen haben, ist nichts zu sehen. Verschwunden wie ein böser Spuk. Aber auch die fremden Retter zeigen sich nicht. Das wird ihr langsam unheimlich.
Ein Geräusch lässt sie zusammenfahren. Doch es ist nur ein Eichhörnchen, das vor ihr flieht und einen Baumstamm hinaufrast. Noch einmal atmet sie tief durch, um sich zu beruhigen, dann geht sie langsam weiter, tastet sich durch Gebüsch und Unterholz, bemüht, trockene Zweige zu meiden. Neben einem morschen Baumstamm bleibt sie stehen und lauscht. Das Hämmern eines Spechts hallt durch den Wald. Irgendwo raschelt es im Laub, aber als sie in die Richtung blickt, aus der das Geräusch kam, ist nichts zu sehen.
Sie beschließt, einen weiten Bogen zu schlagen, bis sie wieder auf ihr Dorf trifft. Dann zögert sie. Es könnte sein, dass dieser Arrak und seine Männer irgendwo auf sie lauern. Vielleicht sollte sie warten, bis es Nacht wird. Andererseits könnte sie sich im Dunkeln leicht verlaufen, denn der Wald ist endlos. Und nachts wird es um diese Jahreszeit noch empfindlich kalt. Ohne ihr Kleid wird sie schrecklich frieren.
Rana fühlt sich verloren. Noch nie zuvor hat sie sich allein im Wald gefürchtet. Doch jetzt hat sie Angst. Die Gewalt, die man ihr antun wollte, lässt sie immer noch in ihrem Innersten zittern. Auch wenn sie am Ende ungeschoren davongekommen ist. Und dass es ausgerechnet an ihrem verzauberten Ort, den sie so liebt, geschehen ist, kommt ihr wie eine doppelte Schändung vor. Wird sie jemals dorthin zurückkehren können, ohne sich an diese Augenblicke zu erinnern? Ihre Augen füllen sich mit Tränen.
Sie hört ein winziges Geräusch, und als sie erschrocken nach links blickt, steht ein Mann vor ihr. Keine fünf Schritte entfernt. Lautlos ist er aufgetaucht, als wäre er urplötzlich aus dem Boden gewachsen.
Rana schreit auf und will davonlaufen, doch der Mann ruft ihr etwas zu. Es klingt nicht bedrohlich, sondern beinahe freundlich. Nach zwei Schritten bleibt sie stehen und dreht sich um. Weglaufen ist ohnehin zwecklos. Der Mann ist ein großer, wild aussehender Kerl mit wüsten Haaren und struppigem Bart. Fremd sieht er aus, seltsam, wie aus einem Albtraum. Doch er hebt beschwichtigend die Hand und lächelt. »Keine Angst!«, hört sie ihn sagen. Seine Stimme klingt tief und rau, aber durchaus freundlich.
In der Hand hält er einen langen Bogen, an der Seite trägt er eine Felltasche, aus der Pfeilfedern ragen. Das also ist ihr Retter, ein Jäger, der durch Zufall Zeuge des Vorfalls war. Er scheint ihr nichts antun zu wollen. Trotzdem bedeckt sie ihre Brüste, weil ihr peinlich bewusst ist, dass sie immer noch nackt ist. Wer weiß, was von so einem zu erwarten ist. Wirklich vertrauenswürdig sieht er nicht aus.
»Wer bist du?«, flüstert sie, als er näher tritt.
»Egill«, sagt der Fremde und legt den Zeigefinger auf die Brust. »Ich bin Egill.«
Er scheint mit der Aussprache Mühe zu haben. Kein Ruotinger also. Doch was ist er dann? Sie starrt ihn ängstlich an – und erschrickt von Neuem, als ein zweiter Mann ebenso unbemerkt zwischen den Büschen auftaucht und sich neben den ersten stellt. Wie schaffen sie es, sich so lautlos durch den Wald zu bewegen?
Der Mann, der sich Egill nennt, deutet auf den anderen. »Mein Sohn«, sagt er und legt dem Jüngeren die Hand auf die Schulter.
Misstrauisch und bereit, beim kleinsten Anzeichen einer schlechten Absicht die Flucht zu ergreifen, wandern Ranas Augen vom einen zum anderen. Am Oberkörper tragen sie Rehfell, um die Lenden einen Schurz aus ähnlicher Tierhaut und um die Stirn lederne Riemen. Auch die Beine unterhalb der Knie sind mit Tierhaut umwickelt, und an den Füßen tragen sie grob genähte lederne Schuhe. Beide Männer sind schlank und sehnig, jedoch größer als die meisten Bauern in Ranas Dorf. Die Gesichter wie auch die Haut ihrer nackten Arme sind seltsam dunkel, ein helles bis mittleres Braun. Und tätowiert sind sie. Irgendwelche Zeichen. Schwer zu erkennen, was sie bedeuten sollen. Eigentlich sehen die beiden eher furchterregend aus, wäre da nicht Egills freundliches Lächeln.
Wie ein Blitz trifft es Rana. Die Männer müssen zu jenem geheimnisvollen Volk der Wildnis gehören, um das sich unzählige Geschichten ranken. Zauberkräfte sollen sie besitzen. Nicht ungefährlich sollen sie sein, aber scheuer als Rehe. Selten, dass man einen von ihnen zu Gesicht bekommt.
»Ihr seid Alben«, sagt sie, jetzt doch wieder beunruhigt.
Egill zuckt mit den Schultern und nickt. »Ihr Ruotinger nennt uns so.«
Ich sollte mich vor ihnen fürchten, fährt es ihr durch den Sinn. Vielleicht wollen sie mich verschleppen. So was erzählt man sich in den Dörfern. Man droht den Kindern damit, wenn sie nicht gehorchen. Es heißt, dass sie Weiber rauben, sie verzaubern und zu ihren Frauen machen. Dass es gefährlich ist, sich ihnen zu nähern. Viele, die es getan haben, seien spurlos im Wald verschwunden, um nie mehr wiederzukehren, heißt es. Ist es das, was sie mit mir vorhaben?
Sie spürt den Blick des Jüngeren aufwärtswandern, von ihren Beinen bis zu ihrem Gesicht. Wieder fühlt sie sich in ihrer Nacktheit ausgeliefert. Doch als ihre Blicke sich kreuzen, sieht er verlegen zur Seite. Was ist davon zu halten? Was soll sie tun? Weglaufen nützt nichts. Die beiden sind mit Sicherheit schneller als sie. Und stärker allemal.
Der Mann, der sich Egill nennt, ist der weitaus Ältere. Sein struppiger Bart ist grau, das Gesicht voller Furchen. Erstaunt bemerkt sie, dass die Augen in diesem wettergegerbten Gesicht von hellem Blau sind. Auch die seines Sohnes. Wie bei den meisten von uns, denkt sie. Und doch gehören sie einer fremden Rasse an. Sie spürt, dass der Sohn sie beobachtet. Als sie ihn ansieht, blickt er wieder verlegen zur Seite.
»Ihr habt also auf diese Männer geschossen.«
Egill nickt. »Schlechte Männer.«
»Ich muss euch danken«, sagt sie unsicher. »Ihr habt mich gerettet. Und was habt ihr jetzt mit mir vor?«
Egill runzelt die Stirn. »Nichts. Was sollen vorhaben?« Dann lächelt er. Der Mann hat gesunde Zähne. Anders als die meisten Ruotinger, die in diesem Alter oft schlechte Zähne haben. Er reicht seinem Sohn den Bogen, zieht sich das Rehfellhemd über den Kopf und hält es Rana hin. »Zieh an«, sagt er. »Dann nicht kalt.«
Sie beide wissen, dass es nicht nur darum geht, sie warm zu halten. Etwas zögerlich nimmt Rana das Hemd entgegen, dann aber streift sie es sich dankbar über. Es bedeckt ihre Blöße bis zu den Oberschenkeln und riecht nach Rohleder und warmem Männerschweiß. Aber der Geruch ist nicht unangenehm.
»Danke!«, sagt sie und fühlt sich besser.
Auch der junge Mann wagt nun, ihr ins Gesicht zu sehen. »Du bist aus dem Dorf am Fluss«, sagt er.
»Ihr wisst, wo das ist?«, fragt sie erstaunt.
»Natürlich«, erwidert er, als wäre das eine dumme Frage.
»Wir gehen mit dir bis Waldrand«, sagt Egill. »Aber erst, wenn dunkel. Bis dahin dauert es noch.« Er deutet auf den morschen Baumstamm, neben dem sie stehen. »Setzen wir und reden.«
»Und wenn die Männer wiederkommen?«
Egill schüttelt den Kopf und lacht. »Ruotinger fangen uns nicht.«
Rana lässt sich auf der rauen Rinde des morschen Stammes nieder. Egill setzt sich zu ihr. Sein Sohn bleibt stehen und lässt den Blick in alle Richtungen schweifen, als hielte er Wache. Rana kann nicht glauben, dass sie hier friedlich mit Alben plaudert.
»Diese Männer sind gefährlich«, sagt sie. »Einer von ihnen ist der Sohn unseres Fürsten.«
Egill nickt. »Wir wissen von ihm.«
»Ihr wisst alles über uns, aber wir nichts über euch.«
Egill lächelt. »So soll es bleiben.«
»Warum habt ihr euch eingemischt? Es ist, als ob die Götter euch geschickt hätten.«
»Nicht eure Götter. Geister des Waldes haben es befohlen. Schlechte Männer stören Frieden des Waldes.«
»Ihr habt eingegriffen, weil sie den Frieden gestört haben?«
»Und weil schlechte Männer auch uns angetan haben, was sie dir antun wollten. Ist lange her.«
»Euren Frauen?«
»Viele Tote. Dorf zerstört. Frauen geschändet, Kinder geraubt.«
»Auch deine Frau?«
Egill nickt. »Auch meine. Tokis Mutter.«
* * *
Arrak und seine Gefährten erreichen die Stelle, an der sie die Pferde zurückgelassen haben. Er und Brunn, der Mann mit der Zahnlücke, haben sich mit dem Tragen ihres verwundeten Kameraden abgewechselt und lassen ihn jetzt erschöpft zu Boden gleiten. Der Mann ist halb bewusstlos. Er stöhnt und spuckt eine Menge Blut. Die Pfeilspitze steckt ihm noch im Rücken. Allerdings hat Arrak den Schaft zwei Handbreit über der Wunde abgebrochen, um ihn sich genauer anzusehen.
»Sieht nicht gut aus«, sagt Brunn. »Wenn er Blut spuckt, ist die Lunge getroffen.« Vorsichtig betastet er sein verwundetes Ohr. »Verdammtes Weibsstück«, murmelt er.
»Zieh den Pfeil raus«, sagt Arrak.
»Was?«
»Du sollst ihm den Pfeil rausziehen, sag ich.«
»Besser nicht.«
»Ich will wissen, wer da geschossen hat.«
»Wenn wir den Pfeil ziehen, blutet’s noch mehr. Dann ersäuft er am eigenen Blut.«
Arrak wirft ihm einen gereizten Blick zu. »Wenn du’s nicht tust, dann ich!« Kurzerhand packt er den verbliebenen Pfeilschaft und reißt ihn mit einem Ruck heraus. Der Verwundete schreit auf, windet sich vor Schmerz und verliert das Bewusstsein.
»Bei Wuodan! Musste das sein?«
»Sei kein Weichling!«, knurrt Arrak. »Der ist ohnehin erledigt.«
Er bückt sich, nimmt etwas Herbstlaub vom Boden und wischt das Blut von der Pfeilspitze. »Eine Steinspitze«, murmelt er erstaunt. »Feuerstein.«
»Na und?«
»Wer macht sich die Mühe, Pfeilspitzen aus Stein zu fertigen? Das ist nicht so leicht. Da steckt ’ne Menge Arbeit drin. Deshalb haben wir alle Bronzespitzen.«
»Das gilt für unsere Krieger, aber nicht für die Bauern. Dein Vater hat doch verboten, ihnen bronzene Waffen zu überlassen. Dabei gehen die doch auch jagen.«
»Sieh dir das Ding mal genau an.« Arrak hält Brunn die Pfeilspitze unter die Nase. »Und fühl die Kanten. Die sind so scharf, dass du dir damit den Bart scheren könntest. Das ist das Werk eines Meisters, sage ich dir. Nicht die Arbeit eines Bauern.«
»Bei Wuodan, du hast recht«, sagt Brunn, nachdem er sich die Spitze genauer angesehen hat. »So was kann nicht jeder.«
»Sag ich doch«, knurrt Arrak. Er zieht den dazugehörigen Schaft mit den Federn aus dem Köcher, wo er ihn verwahrt hat, und untersucht ihn. »Sieh dir die Verzierungen an. Seltsame Muster, sogar mit Ocker eingefärbt. Das müssen Zauberzeichen sein.«
»Du meinst …«
»Kein Zweifel. Das ist ein Albenpfeil!«
»Warum sollten sich Alben einmischen? Die gehen uns doch sonst auch aus dem Weg. Lassen sich fast nie sehen.«
»Wer weiß?« Arrak zuckt mit den Schultern. Dann zeigt sich ein Wolfsgrinsen auf seinen Zügen. »Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Waldmenschen, die uns aus dem Hinterhalt angreifen? Ich denke, demnächst ist Jagd auf Alben angesagt.«
»Du weißt, die sind schwer zu finden. Und gefährlich obendrein. Wir haben es gerade erlebt. Die Pfeile kamen aus dem Wald geflogen wie von Zauberhand. Hast du vielleicht einen von ihnen gesehen? Ich nicht. Wie von Zauberhand, sag ich dir.«
»Willst du deinen Kameraden nicht rächen?« Arrak deutet auf den Verwundeten am Boden, der sich langsam wieder regt.
»Ja, schon. Aber, bei Wuodan, die Alben können einen mit schrecklichen Flüchen belegen. Solche, die man nie mehr los wird. Ich kenn einen, der ist plötzlich krank geworden und wurde jeden Tag schwächer, bis er unter Schmerzen verreckt ist. Der hat gesagt, es waren die Alben. Weil er sie beim Tauschhandel betrogen hat.«
»Dummes Zeug! Und ruf nicht dauernd deinen Wuodan an. Hador ist unser Gott. Du weißt das, verdammt noch mal! Muss ich dich dauernd dran erinnern?«
Brunn nickt verlegen. »Es ist, weil ich mit Wuodan aufgewachsen bin. Da kommt es vor, dass ich mich vergesse.«
»Wenn ich dich noch einmal diesen Namen sagen höre, lasse ich dich auspeitschen. Ist das klar?«
Brunn weiß, dass das keine leere Drohung ist. Seit Helma, Orkons Großvater, die Klans mit Hilfe Hadors vereinigen konnte, ist Wuodans Einfluss geschwunden, und seine Schreine sind verkommen. Er hat sich von den Menschen abgekehrt und ist in die Welt der Riesen zurückgekehrt, heißt es. Vielleicht auch in die alten Weidegründe im Osten. Das sagen jedenfalls die Helminger und Hadors Priester. Hador, der Gott der Unterwelt, hat die Herrschaft über die Welt an sich gerissen. Er mag kalt und grausam sein, aber die Welt selbst ist grausam und unerbittlich. Nur wer sich Hador unterwirft, kann in ihr bestehen. Als die Leute noch Wuodan huldigten, gab es ständig Kampf und Streit unter den Klans. Seit die Helminger Hador als Gott der Götter, als Vater nicht nur der Unterwelt, sondern auch der Erde und des Himmels verehren, ist Friede im Land eingekehrt. Nun wagt keiner mehr, sich gegen die rechtmäßige Ordnung aufzulehnen. Wer es dennoch tut, der wird dem gefräßigen Hador geopfert.
Brunn nickt beklommen. »Es wird nicht mehr vorkommen, Arrak.«
Der Verwundete dreht sich stöhnend auf die Seite. Aus seinem Mund dringt erneut ein Schwall von Blut. Er hustet, als drohe er daran zu ersticken, und windet sich vor Schmerz. »Lasst mich nicht hier verrecken«, flüstert er.
Arrak beugt sich über ihn. »Keine Sorge, Freund. Du stirbst zu Hause. Wir nehmen dich mit.« Er wendet sich an Brunn: »Hol seinen Gaul, damit wir ihn auf den Sattel heben können.«
Die Sättel der Reittiere bestehen aus lederbezogenen, mit Polstern und Schaffellen versehenen kurzen Brettern, die beidseitig der Rückenwirbel des Pferdes aufliegen und mit einem Gurt fest um den Leib des Tieres gezurrt werden. Brunn tut wie geheißen, und mit vereinten Kräften hieven sie ihren verwundeten Kameraden aufs Pferd. Das heißt, sie hängen ihn ohne große Umstände bäuchlings über den Sattel, sodass die Beine auf der einen und der Kopf auf der anderen Seite baumeln. Während der Mann vor Schmerzen stöhnt, binden sie ihn mit Lederschnüren fest.
Arrak zieht Ranas Leinenkleid aus dem Gürtel und schüttelt es aus, um es zu betrachten. Er schnuppert daran, als hoffe er, noch ihren Geruch zu erhaschen. Auch ihre Sandalen hat er mitgenommen.
»Was für ein Weib!«, murmelt er versonnen. »Hast du ihre göttlichen Titten gesehen? Und laufen kann sie wie ein Reh. Ich sag dir, die könnte mir gefallen.«
»Ja, bis sie dir das Ohr abbeißt«, erwidert Brunn grimmig. »Vielleicht sogar den Schwanz.«
Arrak lacht. »Eine mit Feuer im Hintern. Dagegen ist nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil. Man muss sie nur richtig einreiten.« Er stopft Ranas Sachen in eine Satteltasche und bindet seinen Hengst los, einen kräftigen Falben. »Ich bin sicher, die stammt aus dem Dorf hier in der Nähe. Wir sollten morgen wiederkommen. Sie wird ihre Sachen suchen.«
»Ich weiß, wer sie ist«, sagt Brunn. »Nicht weit von hier ist das Heiligtum der Destarte.«
»Du meinst das, wo die Weiber hinpilgern, wenn sie geschwängert werden wollen?« Arrak grinst spöttisch. »Möchte nicht wissen, was da so vor sich geht. Es heißt, selbst alte Vetteln kriegen noch ein Balg, wenn sie sich Destarte zu Füßen werfen.«
»Du hast doch bestimmt von Herdis, der Priesterin, gehört.«
»Ja. Aufmüpfiges Weib. Weigert sich, Hador zu huldigen.«
»Das Mädchen ist ihre Tochter.«
»Bist du sicher?«
»Ich hab sie vorhin nicht gleich erkannt. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, bin ich mir sicher. Ich hab sie mal gesehen, als sie ihrer Mutter zur Hand ging.«
»Was hattest du denn bei Destarte zu suchen?«
»Mein Bruder hatte letztes Jahr zwei tot geborene Kälber. Gleich hintereinander. Da hat er es mit der Angst zu tun gekriegt, dass er die ganze Herde verlieren könnte. Ich hab ihn begleitet.«
»Da hast du sie also gesehen?«
Brunn nickt. »Du solltest sie in Ruhe lassen. Könnte Ärger geben. Du weißt, wie verbreitet der Kult der Destarte ist. Selbst dein Vater achtet ihn.«
»Mein Vater«, knurrt Arrak verächtlich. »Was weiß der denn schon! Nun, vielleicht hast du recht. Trotzdem. Wir bringen den da zurück, und in den nächsten Tagen kommen wir wieder.«
Brunn fällt auf, dass der Verwundete sich nicht mehr regt und seit einer Weile keinen Ton mehr von sich gegeben hat. Aus dem offenen Mund rinnt immer noch Blut. Es läuft an den Armen herunter und tropft von den Fingern auf den Waldboden. Brunn packt den Mann mit der Rechten am Haarschopf und hebt ihn an. Den linken Handrücken hält er ihm kurz vor den Mund.
»Ich spür nichts. Ich glaube, er atmet nicht mehr.«
Arrak zuckt gleichmütig mit den Schultern. »Dann ist er jetzt im Reich der Toten. Da enden wir schließlich alle irgendwann.«
* * *
»Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll«, sagt Rana. »Nicht mal ein Geschenk kann ich euch machen. Hab ja nichts bei mir.«
Das Licht der dünnen Mondsichel sickert nur spärlich durch die Baumkronen. Im Wald selbst, unter den hohen Buchen, wo Rana und die beiden Alben auf einem bemoosten Felsen hocken, herrscht nahezu Dunkelheit. Die Männer neben ihr sind nur als Schatten wahrnehmbar.
»Wir brauchen nichts«, sagt Egill.
Der Fels, an dem sie auf die Dunkelheit gewartet haben, liegt nicht weit vom Waldrand entfernt. Durch die Baumstämme schimmert die Onestruda, der größte Fluss der fruchtbaren Talebene. In sie ergießen sich viele Gewässer der Gegend, auch die liebliche Gerra, an der Rana am späten Nachmittag überfallen wurde.
Am gegenüberliegenden Nordufer liegt Ranas Dorf. Wenn man genau hinschaut, sind zwischen den schlanken Baumstämmen die geduckten Schilfdächer der Hütten zu erkennen. Die meisten sind Langhäuser, in denen Mensch und Tier unter einem Dach leben. Hier und da das hellere Grau von aufsteigendem Rauch oder der schwache Lichtschein aus einer offenen Tür.
»Wir könnten uns morgen wieder hier treffen. Mein Vater schmiedet Kupfer und Bronze. Ihr werdet doch ein gutes Beil brauchen können. Oder ein Messer.«
»Wir brauchen nichts«, wiederholt Egill, diesmal bestimmter.
»Aber warum nicht? Beile und Messer sind nützlich.«
»Wir mögen die Nähe eurer Dörfer nicht. Waren nur hier, weil wir die Spur eines Keilers verfolgt haben.«
»Wo kann ich euch denn finden?«
»Nicht nötig. Und sag deinen Leuten nichts von uns. Sie kommen uns sonst suchen. Wir haben heute einen von euch getötet.«
»Aber die hätten mich vielleicht umgebracht.«
»Deine Leute werden es nicht glauben.«
»Ich würde gern mehr über euch erfahren. Wo ihr wohnt, wie ihr lebt. Und euch ein Geschenk machen.«
»Nein. Zu gefährlich für uns. Wir ziehen morgen weiter, damit man uns nicht findet.«
Rana ist enttäuscht. So fremd die beiden Männer ihr auch sind, sie fürchtet sich nicht länger vor ihnen. In Gegenteil. Sie haben die Zeit genutzt, um sich zu unterhalten. Geredet hat allerdings meist Egill. Manchmal hat er Dinge gesagt, über die sie lachen musste. Zum Beispiel, dass er nicht versteht, wieso die Ruotinger sich den ganzen Tag auf ihren Feldern abmühen, wenn es genügt, ein Reh zu erlegen, um sich und die Familie für Tage zu ernähren. »Weil es gar nicht genug Rehe gibt, um uns alle zu ernähren«, hat sie ihm geantwortet.
Der Sohn hat nicht viel gesagt, aber zugehört. Vielleicht weil er nur wenige Worte von Ranas Sprache spricht. Egill hat sie beim Tauschhandel gelernt. Anscheinend gibt es Orte, wo Alben und Bauern sich treffen, um zu handeln. Tierzähne und Felle gegen Kupferbeile, scharfe Steinklingen gegen Bronzeperlen oder gegen gewebte Stoffe. Rehhaut ist besser, sagt Egill, aber Frauen mögen Stoffe.
Rana hat von ihrer Familie erzählt, von ihrer Göttin Destarte und dem anstehenden Frühlingsfest. Die geplante Priesterweihe hat sie nicht erwähnt. Gern hätte sie mehr über das Leben dieser Waldmenschen erfahren. Im Gegensatz zu ihnen sind die meisten Ruotinger Hirten und Bauern. Einige auch Handwerker oder Krieger, aber die allermeisten leben von der Feldarbeit und der Viehzucht. Die Alben hingegen ernähren sich von dem, was der Wald bietet. Dass ihnen das genügt!, wundert Rana sich. Und was tun sie im Winter bei Frost und Kälte, wenn wir uns in unseren Häusern verkriechen und ums warme Herdfeuer scharen?
Doch ihren Fragen ist Egill ausgewichen. Über ihr tägliches Leben oder ihre Familien hat er sich nichts entlocken lassen. Nur von der Jagd hat er erzählt und ein wenig von den vielen Geistern des Waldes, die in jedem Baum und jedem Strauch wohnen, in jedem Fels und jedem Gewässer, im Wind und im Regen. Und natürlich in jedem Tier. Der Schamane beschwört den Geist des Bären. Auf dass er sie in Ruhe lässt und ihnen nicht nachträgt, dass sie das Wild in seinem Wald jagen. Auch mit den Wölfen redet er und nennt sie Brüder. Das ist ihr selbst nicht fremd. Ihr Volk kennt ebenfalls viele Geister und Götter.
»Ich hatte gehofft, dass wir uns wiedersehen«, sagt sie.
Egill zögert, bevor er antwortet. »Dann musst du in die Berge gehen. Vielleicht finden wir dich«, sagt er schließlich. »Vielleicht auch nicht. Vielleicht sind wir ganz woanders.«
Es wird Zeit, sich zu verabschieden. Arrak und seine Männer muss sie wohl nicht mehr fürchten, denn Egills Sohn ist gerade zurückgekommen, nachdem er die Umgebung längs des Flusses ausgespäht hat.
»Also gut.« Rana steht auf und zieht sich Egills Hemd über den Kopf. Mit Bedauern reicht sie es ihm, denn es ist kühl geworden. »Danke für alles Egill. Auch dir, Toki. Mögen die Götter euch beschützen.«
Egill erhebt sich. Er fasst nach ihrer Hand und hält sie sich kurz an die Stirn, dann wendet er sich ab und bedeutet seinem Sohn, ihm zu folgen. Ein paarmal hört sie es noch im Laub rascheln, danach nichts mehr. Als habe der Erdboden die beiden verschluckt.
Rana spürt die kalte Nachtluft auf der nackten Haut und fröstelt. Sie kommt sich plötzlich allein und verlassen vor. Dass Destarte sie aus ihrer Not errettet hat, erfüllt sie mit großer Dankbarkeit. In der Dunkelheit flüstert sie ein stilles Gebet an die Göttin. Und noch eines an Astaris. Die könnte sich sonst zurückgesetzt fühlen. Vielleicht war es ja die Jägerin, die die Alben geschickt hat.
Vorsichtig, einen Fuß vor den anderen setzend, wandert sie durchs raschelnde Laub auf das Flussufer zu. Das Erlebte des Nachmittags und des Abends ist noch allzu gegenwärtig. Die Begegnung mit den Alben, aber vor allem die schrecklichen Momente an der Gerra. Noch nie war sie jemandem an dieser Stelle begegnet. Ausgerechnet heute mussten die drei Männer dort auftauchen.
Man wird sagen, sie sei selbst schuld. Warum läuft sie auch immer allein im Wald herum? Einmal musste so was doch passieren. Orkons Männer sind seit Langem eine Bedrohung für das ganze Land. Sie plündern Bauern aus und nennen es Tribut. Wer nichts zu geben hat, dem stehlen sie das Vieh. Oder die Töchter. Alles im Namen von Hador, dem düsteren Gott der Unterwelt und Wuodans Bruder. Ihm opfern sie nicht nur Rinder und Pferde, sondern auch Menschen. Besonders solche, die sich ihnen widersetzen. Natürlich hat es Menschenopfer auch schon vor Urzeiten gegeben. Doch nur selten, wenn das Volk in großer Not war. Unter Orkon kommt es jetzt häufig vor. Alles, um ihren gefräßigen Gott zu beschwichtigen.
Ranas Mutter sagt, in Wirklichkeit tun sie es, um das Volk in Angst und Schrecken zu halten. Ihr eigenes Dorf haben Orkons Männer bisher verschont. Vielleicht aus Respekt vor Destartes Schrein. Aber wie lange noch? Dass Arrak sich in der Gegend herumtreibt, ist kein gutes Zeichen. Rana zweifelt nicht, was mit ihr geschehen wäre, hätten die Alben nicht eingegriffen. Zuerst hätten die Kerle sie halb totgeschlagen, dann hätten sich alle drei mit ihr vergnügt. Und danach? Hätten die sie am Leben gelassen?
Rana überlegt, ob sie daheim überhaupt erzählen soll, was geschehen ist. Mutter wird sich fürchterlich aufregen und vielleicht selbst in Gefahr bringen. Sie ist von Fürst Orkon ohnehin nicht gut gelitten. Aber wie soll sie das Erlebte verbergen, wenn sie ohne Schuhe und Kleider heimkommt, mit zerschundenen Füßen und Spuren von Gewalt an Hals und Gesicht?
HELLA
Wuodans Gefährtin, Mutter der Kinder, Hüterin des Hauses und der Familie, der Vorräte und der Kornspeicher, gütig bist du, treu und beständig. Was wären wir ohne deine Fürsorge?
Die Siedlungen der Ruotinger liegen weit verstreut und hauptsächlich in den Flussniederungen, wo weite Flächen abgeholzt und urbar gemacht wurden. Auch die Viehzucht hat den Wald durch ihren Bedarf an Weideflächen zurückgedrängt. Und doch ist der größte Teil des Landes immer noch von dichtem Urwald bedeckt. Jagen und Fischen ergänzen die Nahrungsquellen der Menschen.
Ranas Dorf heißt Altorp und liegt an einer Furt der Onestruda, in der das Wasser nur bis über die Knie reicht. In trockenen Sommern auch nur bis zu den Waden. Auch die kleine Gerra mündet hier ganz in der Nähe. Auf Flüssen zu reisen ist die bequemste Art, von einem Ort zum anderen zu gelangen, weshalb auf der Onestruda häufig flache Lastkähne und Ruderboote anzutreffen sind, sogar solche mit Segeln.
Seit Urzeiten durchziehen zudem Wanderwege und Saumpfade das Land. Zwei davon kreuzen sich hier an der Furt. Der eine verbindet die Kuffaberge, wo sich Orkons dunkle Festung befindet, mit dem Heiligtum der Destarte. Dort endet er, denn weiter gen Süden entlang der Gerra ist nichts als Wildnis. Der zweite Weg kommt von weither aus dem hügeligen Land im Westen. Er folgt der Onestruda, wenn auch in unregelmäßigen Abständen, bis diese drei Tagesmärsche weiter gen Osten in die Sala mündet. Die Sala selbst ergießt sich in den großen Strom, der sich Albija nennt und irgendwo weit weg im Norden, wo wildes, kriegerisches Volk haust, in das gewaltige Salzmeer fließt, das die ganze Welt umspült.
Altorp ist ein großes Dorf, seit Generationen gewachsen. Wegen des ertragreichen Bodens am Fluss haben sich schon immer Menschen hier angesiedelt, schon bevor die Ruotinger kamen. Alles gedeiht in dieser schwarzen, schweren Erde der Flussauen, auch wenn das Pflügen mühsam ist. Und dann sind da noch die vielen Besucher des Schreins. Wobei niemand so genau weiß, was zuerst hier war: das Dorf oder das Heiligtum. Wahrscheinlich ist es das Heiligtum, denn es ist schon sehr alt.
Umgeben von Äckern und Viehweiden leben siebzig oder achtzig Familien im Dorf, vielleicht noch mehr, denn so genau hat niemand nachgezählt. Der Wohlstand einer Sippe misst sich an der Größe der Ackerfläche, die sie bewirtschaftet. Oder am Viehbestand, denn viele Ruotinger sind Viehhalter. Nicht nur Rinder, auch Ziegen und Schafe sichern ihren Reichtum. Und natürlich Söhne und Töchter, die helfen, das Land zu bewirtschaften und das Vieh zu versorgen. Da ist vor allem die schwere Arbeit auf den Feldern. Kühe sind zu melken, Schafe zu scheren, Korn zu dreschen. Nicht zu vergessen die Jagd und der Fischfang. Wintervorräte müssen angelegt werden. Die Milch wird zu Käse verarbeitet, das Korn zu Mehl. Hanffasern werden zu Seilen gedreht, und aus Tonerde wird Geschirr. Flachs und Hanf werden versponnen und zu Stoffen gewebt, aus denen dann Kleider genäht werden. Im Wald wird Holz geschlagen. Nicht nur zum Häuserbau, sondern vor allem, um die Kochfeuer zu unterhalten und die Häuser zu wärmen.
Wer es sich leisten kann, erwirbt zur Hilfe ein paar Sklaven, Gefangene von Kriegszügen der Klans in benachbarte Regionen. In letzter Zeit sind auch wieder Flüchtlinge gekommen, Bauern mit ihren Familien, die anderswo von ihrer Scholle vertrieben wurden. Nicht immer werden sie bereitwillig aufgenommen. Oft hat es Streit darüber gegeben.
Die Alteingesessenen und besonders die Wohlhabenderen des Dorfs wohnen entlang der Onestruda in geräumigen Langhäusern, die in einigem Abstand voneinander stehen. Dazwischen liegen Gemüsebeete und Einzäunungen für Ziegen und Schweine. Rinder- und Pferdeweiden und die Äcker, auf denen Korn, Gerste und Flachs angebaut werden, verteilen sich auf der Nordseite. Auch dort begrenzt von Wald, aus dem man neue freie Flächen geschlagen hat.
Die Ärmeren und vor allem die Flüchtlinge hausen am Rande des Dorfes in wackeligen Hütten oder am Waldrand, wo sie versuchen, neues Land zu erschließen, obwohl es eine unmenschliche Arbeit ist, ohne Zugochsen die Wurzeln alter Bäume aus der Erde zu reißen. Deshalb lässt man sie oft einfach im Boden und pflügt um sie herum. Natürlich ist auch das Pflügen ohne Zugtiere schwerste Arbeit. Der Mann stemmt sich in die Riemen, um den Reißpflug zu ziehen, die Frau dahinter drückt ihn in die Scholle. Glücklich ist, wer unbearbeitetes Land von einem Reicheren gegen Abgaben pachten und von ihm Pflug und Ochsen leihen kann. In Altorp gibt es daneben Gemeinschaftsbesitz, Weiden und Ackerland, das von Neuankömmlingen oder jungen Familien genutzt werden kann. Auch das Heiligtum der Destarte besitzt solches Land.
Dennoch sind alle im Dorf zu Abgaben verpflichtet, ob reich oder arm. Denn die großen Familien und die Klanführer der Ruotinger verlangen nach der Ernte von jedem Dorf und jeder Siedlung ihren Tribut. Allen voran Orkons Familie, die das Land beherrscht, seit es Orkons Großvater, dem legendären Helma, gelang, die übrigen Klans zu einigen und sich damit zum Fürst über sie zu erheben. Die Menschen in Altorp gehören zu den Nebroni, die den größten Teil des Tals der Onestruda besiedeln. Auch sie sind Ruotinger, nach dem Urahn Ruoto benannt, der vor unzähligen Generationen mit vielen Getreuen von den weiten Steppen her eingewandert ist und dem später andere gefolgt sind, um sich in dieser Region niederzulassen.
Altorp ist nicht nur durch die fruchtbare Erde, sondern auch durch seine Lage an Fluss und Wegen begünstigt, über die Fremde, die etwas zu tauschen haben, das Dorf erreichen. Entweder per Boot oder mit Lasttieren auf den alten Saumpfaden. Gehandelt werden vor allem Salz, feine Tonerde, Erze aller Art, Hornkämme, schöne Muscheln, Bernstein oder die langen Zähne eines Fabelwesens aus dem Norden, das sich Walross nennt. Natürlich auch irdene oder kupferne Gefäße, Pfeilspitzen, Feuersteine, Äxte und Waffen. Meist wird nur getauscht, ansonsten dienen kleine Kupferbarren als Bezahlung. Manchmal auch Silber oder feines Flussgold. Letzteres ist sehr begehrt, weil es so selten ist und herrlich glänzt. Natürlich ist Gold viel zu weich, um etwas Nützliches damit anzufangen. Und es als Schmuck oder Verzierung zu verwenden ist allein den Klanherren vorbehalten. Und natürlich der Fürstenfamilie.
Der Handel fördert das Handwerk. Ranas Vater Utrik ist ein angesehener Schmied, der nicht nur mit Kupfer umzugehen weiß, sondern auch die Kunst des Bronzeschmiedens beherrscht. Er ist nicht der einzige Handwerker in Altorp. Es gibt drei Töpfer und einen Wagenbauer. Und zwei Familien, die sich besonders gut aufs Weben verstehen. Der Handel wird auf dem Tauschplatz an der Kreuzung bei der Furt abgewickelt. Dort bieten neben wandernden Händlern auch Bauern an, was sie selbst nicht zum Leben brauchen, und man trifft sich, um über Saat, Wetter oder den Stand des Getreides zu reden und sich den neuesten Klatsch zu erzählen.
Die Dorfältesten dagegen treffen sich in Utriks Haus, wenn sie etwas zu besprechen haben. Es ist das größte im Ort. Groß genug, um so etwas wie eine Halle aufzuweisen, wo die Männer rund um die Feuerstelle sitzen und Bier trinken. Ranas Vater ist nicht nur ein angesehener Schmied, sondern hat auch meist das letzte Wort, wenn es etwas zu entscheiden gibt. Ranas Mutter nimmt als Priesterin eine noch bedeutendere Stellung ein, nicht nur im Dorf, sondern überall, wo Menschen der Destarte huldigen. Und das ist praktisch im ganzen Land.
* * *
Rana nähert sich dem Hof der Eltern mit gemischten Gefühlen. Natürlich ist sie froh, endlich daheim und in Sicherheit zu sein, fürchtet sich aber vor der Aufregung, die sie erwartet, und vor den unweigerlichen Fragen, wenn sie nackt und mit blutigen Schrammen im Gesicht heimkehrt. Ihr ist, als müsse sie sich dafür schämen. Als sei sie selbst schuld an dem, was geschehen ist. Warum streunt sie auch schon wieder allein im Wald herum?, wird ihre Mutter sagen. Wieso musste sie nackt im Fluss baden? Am liebsten wäre sie unbemerkt durch den Stall ins Haus und in ihr Bett gekrochen, um allen Fragen aus dem Weg zu gehen.
In der Dunkelheit schlüpft Rana an den Langhäusern und Schuppen vorbei, hält sich verborgen, so gut es geht. Es gibt hier keine Befestigungen, die die Häuser vor Eindringlingen schützen. Die Gegend ist sicher genug. Nicht einmal die Alten können sich an kriegerische Überfälle erinnern. Zum Glück begegnet ihr niemand. Was würde es für ein Getratsche geben, wenn man sie so sehen würde!
Beinahe unbemerkt betritt Rana den Hof der Eltern. Nur Ioni, der große Wachhund, erkennt sie sofort. Schwanzwedelnd kommt er auf sie zugerannt, springt an ihr hoch und versucht, ihr das Gesicht zu lecken.
»Ioni, nicht!«, murmelt sie lachend und wehrt ihn ab.
Plötzlich knurrt der Hund leise, als ob ihn etwas stört. Hat er etwa den Geruch von Arraks Männern oder vom Hemd des Alben in die Nase bekommen? Das würde sie nicht überraschen, denn Ioni kann einen Fuchs oder Wolf schon auf große Entfernung riechen. Doch dann wedelt er wieder mit dem Schwanz und drückt sich wohlig stöhnend an ihre Beine, während sie sein Fell rubbelt.
Als sie aufhört, steckt er ihr seine feuchte Nase zwischen die Beine. »Das reicht jetzt!«, sagt sie und schiebt ihn von sich. »Ab zu deinem Schlafplatz!« Sie macht eine drohende Bewegung, um ihn wegzuscheuchen.
»Wer ist da?«, hört sie die Stimme ihres Bruders. »Rana, bist du das?« Arni steht in der offenen Tür. Hinter ihm das rotgoldene Licht des Herdfeuers. »Wo warst du? Wir haben uns Sorgen gemacht.« Als sie aus der Dunkelheit tritt, reißt er die Augen auf. »Bei Wuodan, du hast ja nichts an …?«
»Hör auf, mich anzuglotzen«, sagt sie gereizt und schlüpft an ihm vorbei durch den Eingang. Nacktheit ist keine Schande bei den Ruotingern. Seines Körpers muss man sich nicht schämen. Aber nach dem Vorfall am Nachmittag fühlt Rana sich unwohl, von einem Mann angestarrt zu werden. Auch wenn es nur ihr Bruder ist.
Arni scheucht den Hund davon und schließt die Tür.
Der große Innenraum des Hauses liegt im Halbdunkel, nur schwach erleuchtet vom Schein der Feuerstelle in der Mitte. Die Familie hat gerade ihr Abendmahl beendet. Der Kessel hängt noch an seiner Kette über dem Feuer, und Ette, die Magd, sammelt gerade die benutzten Näpfe ein, um sie draußen im Trog zu waschen. Verlegen bleibt Rana stehen. Bei ihrem Anblick hebt Vater Utrik erstaunt die Brauen. Die Magd hält inne und starrt sie offenen Mundes an. Ebenso Aiko, der Knecht.
Mutter Herdis erhebt sich langsam. »Rana!«, ruft sie erschrocken. »Wie siehst du aus? Was ist geschehen?«
Statt zu antworten geht Rana die wenigen Schritte bis zum Schrein der Ahnen und kniet kurz nieder, um ihnen Respekt zu erweisen. Dann erhebt sie sich, tritt zur Feuerstelle und hält die Hände gegen die Flammen, um sich zu wärmen. »Ette! Hol mir was zum Anziehen. Mir ist kalt.«
Die Magd stellt hastig die Näpfe ab und eilt dorthin, wo sich hinter einer dünnen Wand die Schlafstellen und die Truhen befinden. Ranas Vater hat sich erhoben und legt Rana das Schaffell um die Schultern, auf dem er gesessen hat. Es ist noch warm von seinem Körper. Dankend blickt sie zu ihm auf, rückt dann einen freien Hocker ans Feuer und setzt sich.
Herdis starrt sie ärgerlich an. »Antworte mir gefälligst!« Sie packt Rana am Kinn und dreht ihr Gesicht zum Feuerschein, um besser sehen zu können. »Bei allen Göttern, Kind! Was ist passiert?«, fragt sie erschrocken, als sie das geschwollene Auge bemerkt und die blutige Schramme auf der Wange.
»Nichts«, sagt Rana trotzig und dreht den Kopf weg.
»Nichts? Und die blauen Flecken am Hals? Wer hat das getan? Wo sind deine Kleider und deine Schuhe?«
»Weiß nicht«, antwortet Rana, ohne die Mutter anzusehen. »Man hat sie mir gestohlen.«
»Lüg nicht. Und sieh mich an, wenn du mit mir redest! Was soll das heißen: gestohlen? Wer hat dich so zugerichtet? Sprich endlich!« Mit einem Mal werden Herdis’ Augen feucht. »Hat man dich etwa …?«
Ette kehrt mit einem warmen Wollkleid zurück. Rana steht auf, kehrt der Mutter den Rücken zu und zieht sich das Gewand über den Kopf. Dann gibt sie dem Vater das Fell zurück und lässt sich mit einem genervten Seufzer nieder. Die Fragerei ist ihr unangenehm. »Habt ihr noch was für mich zu essen?«
»Du weichst mir aus«, sagt Herdis. Ihre Stimme zittert plötzlich.
»Ich habe Hunger.«
»Ette. Gib ihr zu essen.« Herdis setzt sich auf ihren Hocker. Erregt und angespannt beugt sie sich vor und starrt Rana ins Gesicht: »Und jetzt rede mit uns. Wer hat dir das angetan?«
Rana schielt zu ihrem Vater hinüber. Utrik ist ein großer Mann, weißhaarig und hager und von den Jahren ein wenig gebeugt, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Er hat bisher noch kein Wort gesagt, doch auch in seinem Blick liegt tiefe Besorgnis. Er hat die weisen, etwas traurigen Augen eines Mannes, der alles im Leben gesehen hat, wenig davon Gutes.
»Sprich, Kind!«, sagt er leise und nickt ihr ernst, aber aufmunternd zu.
Rana nimmt der Magd Löffel und Napf mit dem noch warmen Bohneneintopf aus der Hand und beginnt zu essen.
»Nichts ist passiert«, sagt sie kauend. »Ich konnte weglaufen.«
»Destarte sei Dank!«, murmelt Herdis und legt erleichtert die Hand aufs Herz. »Dabei hab ich dir immer gesagt –«
»Ich weiß, was du gesagt hast, Mutter!«, unterbricht Rana scharf. »Wir müssen es nicht noch mal hören.«
»Was soll das heißen, ›es ist nichts passiert‹?«, knurrt Arni wütend. »Man sieht doch, dass jemand dich geschlagen hat. Wahrscheinlich auch noch gewürgt. Sag uns endlich, wer das war, damit ich das Schwein umbringen kann.«
Rana löffelt weiter Eintopf. »Keiner aus dem Dorf«, sagt sie.
»Wer dann?«
Sie spürt, wie alle sie anstarren. Auch die Magd. Und Aiko, der Knecht, der sonst gern still in einer Ecke hockt und sich wenig an Gesprächen beteiligt. Er hat aufgehört, an dem Stück Holz zu schnitzen, das er in den Händen hält, und blickt nun ebenfalls zu ihr herüber.
»Also«, sagt sie genervt. »Ich war im Wald. Irgendwo an der Gerra. Es war warm, und ich wollte mich abkühlen. Hab Sandalen und mein Kleid ausgezogen und mich fast schon ins Wasser gesetzt, als plötzlich drei Krieger aufgetaucht sind. Ich denke, sie waren auf der Jagd.«
Herdis macht große Augen. »Und?«
Rana zuckt mit den Schultern. »Nichts! Ich bin weggelaufen. Reicht euch das nicht?« Bei der ganzen Fragerei ist ihr der Hunger vergangen. Sie stellt den Napf auf den Boden.
»Und woher hast du das geschwollene Auge und die Flecken am Hals?«, stellt ihre Mutter sie aufgeregt zur Rede.
»Was willst du uns verheimlichen?« Auch Vater Utrik klingt nicht so ruhig wie sonst. »Haben sie dich etwa doch erwischt? Nun rede endlich!«
Sie blickt ihn einen Augenblick fast feindselig an. »Ja, sie haben mich erwischt, Vater. Bist du jetzt zufrieden? Aber ich hab mich gewehrt und konnte ihnen entkommen.«
Arni schüttelt ungläubig den Kopf. »Drei Kriegern willst du entkommen sein? Wer, bei Wuodan, soll dir das glauben?«
Rana senkt den Blick und starrt ins heruntergebrannte Feuer. Den Alben hat sie versprochen, nichts zu verraten. Aber wie soll sie so ihre Rettung erklären? Schließlich holt sie tief Luft und blickt kurz in die Runde. »Also schön. Ich werde es euch sagen. Aber es muss unter uns bleiben. Ich habe versprochen, sie nicht zu verraten.«
»Wen nicht verraten?«, fragt Utrik.
»Die beiden Alben.«
»Alben?«
»Ja, es waren zwei Alben, die mich gerettet haben.«
Und dann berichtet sie, was sich wirklich zugetragen hat. Dass die beiden Alben einen der Krieger angeschossen und die anderen verscheucht haben, sodass sie flüchten konnte. Und dass sie mit ihr gewartet haben, bis es dunkel wurde, für den Fall, dass ihre Angreifer sich noch in der Gegend herumtreiben.
»Du warst die ganze Zeit mit diesen … diesen Wilden zusammen?«, fragt Herdis.
Rana nickt. »Sie haben mich beschützt und sicher heimgebracht.«
Herdis kann es kaum glauben. »Na, so was!«, murmelt sie.
»Du siehst, es ist nichts passiert, Mutter. Nur ein paar Schrammen.«
»Aber dass Alben …«, wundert sich Arni. »Wie kommen die dazu? Die sind doch gefährlich. Es heißt immer, man soll sich vor ihnen in Acht nehmen. Vor allem, dass sie Frauen rauben. Warum haben sie dich nicht entführt?«
»Man muss nicht alles glauben, was die Leute erzählen«, sagt Vater Utrik. »Eigentlich ist es umgekehrt. Es sind die Waldmenschen, die sich in Acht nehmen müssen. Vor uns Ruotingern. Wenn es stimmt, was Rana erzählt, kann sie sich glücklich schätzen, dass die beiden zur rechten Zeit da waren und sich eingemischt haben.«
Herdis nimmt ihre Tochter in die Arme. Ihre Augen schimmern feucht. »Das muss mehr als Glück sein. Es kann nur bedeuten, dass die Götter dir besonders gewogen sind. Vielleicht hat Destarte dich für Großes ausersehen und dich bewahren wollen.« Dann bricht sie in Tränen aus, bedeckt ihre Augen und schluchzt so heftig, dass ihre Schultern zucken. Der Gedanke, sie hätte Rana verlieren können, ist zu viel für sie.
Utrik steht auf, hockt sich neben seine Frau und streicht ihr sanft über den Rücken. Die Geschwister werfen sich einen verlegenen Blick zu. Es kommt nicht oft vor, dass sie ihre Mutter weinen sehen. Herdis ist die starke Stütze der Familie, die stolze Priesterin, die allen Widerständen trotzt, die anderen Mut zuspricht und sich nicht unterkriegen lässt. Herdis in Tränen, das sind sie nicht gewohnt.