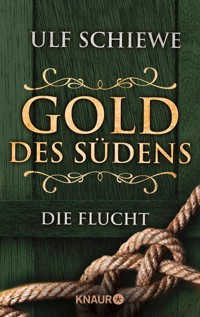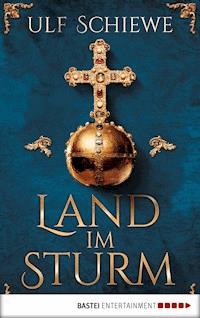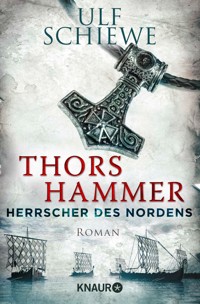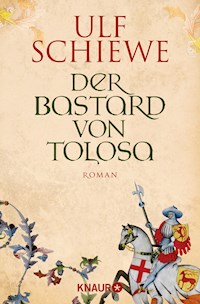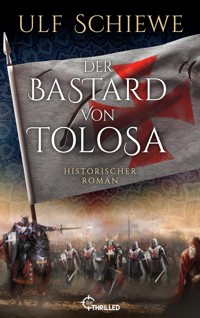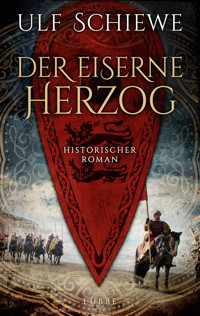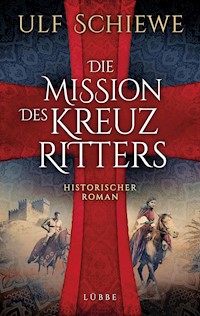6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Wikinger-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Saga des Wikingerkönigs Harald Hardrada – seine Abenteuer und Kämpfe, seine Frauen und sein unbezwingbarer Ehrgeiz. AD 1042: In Konstantinopel tobt ein blutiger Volksaufstand. Der verhasste, neue Herrscher verschanzt sich im Palast, wo er die Kaiserin Zoe gefangen hält. Harald kämpft, um sie zu befreien und den Despoten abzusetzen. Schließlich zieht es ihn in die Heimat. Auf abenteuerliche Weise gelangt er nach Kiew, wo er Elisif, die Tochter des Großfürsten, heiratet, die all die Jahre auf ihn gewartet hat. Mit seinem Beutegold wirbt er ein Heer an und segelt mit ihr nach Norwegen, um sich zum König zu machen. Doch dort hält sein Neffe Magnus den Thron besetzt. Nach "Thors Hammer" und "Odins Blutraben" der krönende Abschluss der historischen Saga um den Wikinger-König Harald Hardrada.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 669
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Ulf Schiewe
Herrscher des Nordens – Die letzte Schlacht
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
AD 1042: In Konstantinopel tobt ein blutiger Volksaufstand. Der verhasste, neue Herrscher verschanzt sich im Palast, wo er die Kaiserin Zoe gefangen hält. Harald kämpft, um sie zu befreien und den Despoten abzusetzen. Schließlich zieht es ihn in die Heimat. Auf abenteuerliche Weise gelangt er nach Kiew, wo er Elisif, die Tochter des Großfürsten, heiratet, die all die Jahre auf ihn gewartet hat. Mit seinem Beutegold wirbt er ein Heer an und segelt mit ihr nach Norwegen, um sich zum König zu machen. Doch dort hält sein Neffe Magnus den Thron besetzt.
Inhaltsübersicht
Prolog
TEIL I
Seekrieger
Der Aquarius
Nacht über Miklagarðr
Kampf im Palast
Kaiserliche Schwestern
Kunde aus Kiew
Die eiserne Kette
TEIL 2
Der Abschied
Sweyn Estridsson
Der Spruch der Seherin
Der Pakt
TEIL 3
Die Axt im Stamm
König Magnus
Tod in Nideros
TEIL 4
Herrscher des Nordens
Jarl Tostig
Norðymbraland
Anhang
Nachwort
Historische Ortsnamen
Skandinavien
Russland / Ukraine / Türkei
United Kingdom
Glossar
Personen
Harald und seine Familie (historisch)
Andere historische Personen
Fiktive Personen
April 1042
Konstantinopel ist der Bauchnabel der Welt, die Hauptstadt des mächtigen byzantinischen Reichs, Herrscherin über weite Teile Europas und Asiens, über Berge, Ebenen und Meere. Sie ist Mittelpunkt des Handels, der Wissenschaften, viele sagen sogar, der Christenheit, mehr noch als Rom. Und ausgerechnet hier tobt der Aufruhr.
Seit Tagen kennt der Volkszorn keine Grenzen. Die Leute haben sich bewaffnet, Barrikaden errichtet. Militia und kaiserliche Truppen sind dazwischengegangen. Der Basileus Mikhaél hat sich in seinem Palast verschanzt. Es hat Tote gegeben. Viele Tote. Auf beiden Seiten.
Im Grunde ist der Aufstand zum Scheitern verurteilt. Denn in sieben Tagen, vielleicht schon früher, ist militärische Verstärkung zu erwarten.
Ein ganzes Heer ist im Anmarsch, aus den Grenzgebieten Makedoniens, soweit ich weiß. Mit Sicherheit sind noch mehr Truppen unterwegs, auf Kriegsschiffen, von den Küsten Griechenlands oder des Schwarzen Meers. Die gewaltige Kriegsmacht des Byzantinischen Reiches ist auf dem Weg nach Konstantinopel, um den Aufruhr niederzuschlagen. Man wird allen Widerstand in einem Meer von Blut ertränken, die Rädelsführer hinrichten und die Vermögen der reichen Familien einziehen, die es gewagt haben, mit dem Volk gemeinsame Sache zu machen.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dieser Aufstand in sich zusammenfällt. Und doch habe ich, Harald Sigurdsson, mich entschlossen, den Aufstand zu unterstützen, das Unmögliche zu wagen, den Palast zu stürmen und den verhassten Despoten zu entmachten.
TEIL I
Brüder werden gegeneinander kämpfen
und sich den Tod bringen,
Schwesternsöhne werden die Bande der Verwandtschaft brechen.
Schlimm steht es um die Menschen, viel Ehebruch, Axtzeit, Schwertzeit, gespaltene Schilde, Windzeit, Wolfszeit, bis die Welt zugrunde geht.
Ragnarök, das Ende der Welt,
die Weissagung der Seherin
Seekrieger
Was geht uns an, was die Byzantiner treiben?« Thorkel lehnt mit verschränkten Armen an der Wand. Etwas abseits von den anderen, die im Kreis um mich versammelt sitzen. Herausfordernd blickt er mich an. »Warum, zum Teufel, willst du dich einmischen?«
Dass er nichts von meiner Absicht hält, wundert mich wenig. Thorkel ist mein Bremser, mein misstrauischer Geist, der zuweilen verhindert, dass ich mich unüberlegt in gefährliche Abenteuer stürze. Und er hat recht. Was wäre gefährlicher, als sich gegen Mikhaél Kalaphates, den mächtigen Basileus des Byzantinischen Reiches, aufzulehnen? Des größten und mächtigsten Reiches der Welt. Ich muss verrückt sein.
»Du weißt, warum«, erwidere ich.
»Aus Rache?«
»Auch deshalb.«
»Weil Kalaphates dich zu Unrecht zum Tode verurteilt hat? Weil Sigurd dich hat auspeitschen lassen? Deshalb willst du den Palast stürmen?«
»Auch deshalb. Aber nicht nur.«
»Etwa wegen der Kaiserin?«
Ulfr unterbricht, bevor ich antworten kann. »Aber das ist Hochverrat, Harald. Wir haben einen Eid auf den Basileus geschworen. Wenn uns die Sache nicht gelingt, werden sie uns allen den Kopf abschneiden.«
Ich nicke, aber sage nichts. Er könnte recht haben. Ein größeres Heer soll im Anmarsch sein. Wir dagegen haben nur fünfhundert Mann. Und selbst wenn es gelingt, den Palast zu stürmen, was dann? Wen sollen wir zum Herrscher machen? Und würden wir uns überhaupt halten können? Es gibt so viele Fragen und so wenig Zeit, um für alle eine Antwort zu finden.
»Der Eid zählt nicht«, mischt Maria sich hitzig ein. Maria, der ich ein Versprechen gegeben habe, nachdem wir die halbe Nacht darüber gestritten haben. Erregt beugt sie sich vor. Ihr Gesicht ist gerötet. Sie ist hellwach, unruhig und in kämpferischer Laune, obwohl wir kaum geschlafen haben. Für langes Gerede mit den Gefährten, jetzt im Morgengrauen, hat sie wenig Geduld. Sie will, dass ich etwas unternehme. Und zwar sofort. »Der Kerl mag den Titel haben«, sagt sie, »aber er ist nicht von kaiserlichem Blut und gehört nicht auf den Thron. Er ist ein Usurpator.«
»Ein was?«, fragt Ulfr und sieht sie verständnislos an.
»Einer, der unrechtmäßig die Macht an sich reißt«, sage ich.
Ulfr schüttelt den Kopf. »Aber er wurde doch gekrönt. Vom Patriarchen selbst. Und wir haben unseren Schwur auf ihn erneuert.«
»Das stimmt«, sage ich. »Aber eigentlich hat nur Kaiserin Zoë Anrecht auf den Thron. Sie allein ist Byzanz. Unser Schwur gilt im Grunde ihr.«
»Und ausgerechnet sie hat der Mistkerl gefangen genommen«, sagt Maria. »Wenn eines Hochverrat ist, dann das.«
Zoë und ihre Schwester Theodora sind die Töchter des vor vierzehn Jahren verstorbenen Kaisers Konstantinos und somit porphyrogénnete, in Purpur geboren, wie die Griechen es nennen. Nach heiliger Tradition erfolgt die Entbindung der kaiserlichen Kinder in einer besonderen, mit kostbarem Purpur ausgekleideten Kammer, die sich im Palast befindet. Daher der Name. Nur solche Kinder sind erb- und thronberechtigt. Mangels anderer, männlicher Nachkommen ihres Vaters gilt dies für die Schwestern, obwohl beide nicht mehr jung sind. In erster Linie betrifft es Zoë, die Ältere. Sie ist die wahre Kaiserin.
»Aber ihr Kaiser Mikhaél war doch auch nicht in Purpur geboren. Trotzdem war er Basileus«, sagt Halldor. »Wir haben für ihn gekämpft.«
Er meint Zoës kürzlich verstorbenen Gemahl, der ebenfalls Mikhaél hieß. Der vierte Mikhaél. Ein beliebter Name bei den Byzantinern. Unter seiner Führung konnten wir die Bulgaren besiegen. Am Ende war der Mann schrecklich krank, Wassersucht, unförmig angeschwollen an Leib und Gliedern, der ganze Körper mit Schwären bedeckt. Nach langem Leiden ist er vor vier Monaten verstorben.
»Der war Basileus, weil Zoë ihn sich zum Gemahl genommen hat«, erwidere ich. »Wen die Thronerbin ehelicht, der wird Kaiser.«
Seinen unbeliebten Neffen und Erben, den fünften Mikhaél auf dem Thron, nennen sie im Volk verächtlich Kalaphates, den Kalfaterer, nach dem ursprünglichen Beruf seines Vaters. In der kurzen Zeit, seit er im Amt ist, hat der Mann es geschafft, sich so verhasst zu machen, dass in ganz Konstantinopel ein blutiger Aufstand tobt. Die aufgebrachte Menge hat sogar versucht, den Palast zu stürmen. Bisher erfolglos. Es hat Tote gegeben, was die Wut der Menschen nur noch mehr aufstachelt. Kalaphates hockt hinter seinen Mauern verschanzt, von der Leibwache beschützt. Von Sigurd Erlingsson, der den Befehl über die kaiserliche Schutztruppe hat.
»Dass einer Basileus wird, wenn er die Kaiserin heiratet, das verstehe ich«, sagt Ulfr. »Aber nun ist er tot. Und diesen Kalaphates hat sie adoptiert. Noch vor dem Tod ihres Mannes. Rechtlich ist er also ihr Sohn. Hat er damit nicht Anspruch …«
»Hat er nicht!«, unterbricht Maria ihn scharf. Sie überrascht mich heute, denn sie sprüht förmlich vor unterdrückter Wut. Maria ist sehr hübsch, schlank und zierlich und meist von sanfter Natur. So viel Feuer hätte ich ihr gar nicht zugetraut. »Diese sogenannte Adoption ist doch nur von dem verdammten Eunuchen eingefädelt worden, seinem Oheim, um ihre elende Sippe an der Macht zu halten«, sagt sie erregt. »Der Kaiser war sterbenskrank und nicht mehr recht bei Sinnen. Und die arme Zoë haben sie zur Adoption gezwungen, ich weiß nicht, wie. Denn im Grunde kann sie Kalaphates gar nicht ausstehen. Ich sage euch, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen.«
Ich bin mir nicht so sicher, ob sie recht hat. Mikhaél Kalaphates ist in aller Form von seinem Vorgänger und Oheim noch vor dessen Tod adoptiert und zum Thronerben ernannt worden. Es wurde zwar gemurrt, und viele haben sich gewundert, aber niemand hat wirklich dagegen protestiert. Weder die Witwe Zoë noch der Patriarch oder der Hochadel. Doch vielleicht weiß Maria mehr als wir. Schließlich ist sie über drei Ecken mit der kaiserlichen Familie verwandt, redet Zoë sogar mit Tante an. Obwohl ich bezweifle, dass sie wirklich ihre Tante ist. Die Familien des byzantinischen Hochadels sind vielfach untereinander verflochten.
»Wie dem auch sei«, sage ich. »Es gibt diesem Kalaphates jedenfalls nicht das Recht, die Kaiserin, die wahre Thronerbin, zu entführen und gefangen zu halten. Wahrscheinlich will er nicht, dass sie ihm dazwischenredet. Er fürchtet ihren Einfluss. Denn sie ist beim Volk beliebt. In den Straßen rufen sie in Sprechchören nach ihr. Man kann es bis hierher hören.«
Ich sage es nicht laut, aber Zoës Schicksal ist mit ein Grund, warum ich mich entschlossen habe, etwas zu unternehmen. Thorkel weiß von meinem Verhältnis zu ihr. Ihr ganzes Leben ist sie von Männern herumgeschubst und bevormundet worden. Erst von ihrem Vater, dann von ihren Ehemännern. In der Jugend war sie eine große Schönheit, ist immer noch mehr als ansehnlich, auch wenn sie inzwischen über sechzig ist. Ihr halbes Leben hat sie hinter Klostermauern verbringen müssen. Lieber stürbe sie, als das noch einmal zu ertragen. Das hat sie mir vor nicht allzu langer Zeit gesagt.
»Es ist unrecht, was man ihr antut«, sage ich. »Sie ist die Kaiserin. Sie gehört nicht auf dieser winzigen Insel eingesperrt. Mitten im Marmarameer. Dort wird sie zugrunde gehen.«
Bei Zoës Erwähnung nicken die Männer nachdenklich. Ich werfe einen Blick zu Thorkel hinüber, in Erwartung, dass er sich einmischt, um mir zu widersprechen, mir die Sache auszureden. Aber im Moment sagt er nichts, lehnt nur an der Wand und hört zu.
»Den Eunuchen Johannes hat er vor kurzem auch verbannt. Obwohl er dem alles verdankt«, sagt Thjodolf, unser isländischer Skalde. »Dafür hat er eine Menge korrupter Freunde in Amt und Würden gebracht. Ein wirklich übler Bursche, dieser Kalaphates.«
»Die ganze Sippe ist korrupt«, ereifert sich Maria. »Angefangen mit dem Eunuchen, den wir jetzt, Gott sei gelobt, los sind. Es war ein Fehler von Zoës Vater, dem Mann so viel Macht zu geben. Überall hatte der Kerl seine Finger im Spiel, alles hat er an sich gerissen, Verwandte in höchste Ämter gebracht, die ganze Verwaltung mit Günstlingen unterwandert. Seinen Schwager hat er zum Befehlshaber der Flotte gemacht. Dabei verstand der elende Kerl von Schiffen nicht mehr, als dass er Arbeiter in den Werften gewesen war.«
Sie hält einen Augenblick inne. In ihren Augen lodert Wut und Verachtung über diese Sippe von Emporkömmlingen. Es ist in Byzanz nicht ungewöhnlich, dass ehrgeizige Familien einen ihrer Söhne kastrieren und ausbilden lassen und dann versuchen, ihn in der kaiserlichen Verwaltung unterzubringen. Denn für wichtige Beamtenposten bevorzugen die Kaiser Eunuchen. Die können keine Erben zeugen, keine kaiserlichen Eheweiber verführen und somit auch keine Erbansprüche stellen. Die Herrscher wollen als Beamte möglichst treue, dienstbare Geister, nicht mehr und nicht weniger. Aber dieser gewiefte Johannes Orphanotrophus war mehr als das. Ganz nach oben hatte der sich emporgearbeitet, sich unersetzlich gemacht bei Kaiser Konstantinos, den Verwaltungsdinge langweilten. Und dann hatte er die Gelegenheit genutzt, seine gesamte Verwandtschaft zu fördern.
»Der Eunuch hatte am Ende mehr Macht als der Kaiser selbst«, fährt Maria fort. »Die eigene Familie hat er mit Gold überhäuft. Doch das war ihm nicht genug. Sein Ehrgeiz kannte keine Grenzen. Einer von ihnen sollte Kaiser werden. Und dazu wurde der armen Zoë die Liebe seines hübschen Bruders vorgespielt, bis sie ihn geheiratet hat.«
Ja, sie hat sich den Kopf verdrehen lassen. Vor sechs oder sieben Jahren, kurz vor unserer Ankunft in dieser Stadt. Hat sich von den Aufmerksamkeiten eines gutaussehenden Mannes verführen lassen, der ihr seine Liebe vorgegaukelt hatte, nicht mal halb so alt wie sie selbst. Sie war schwachgeworden, regelrecht verrückt nach ihm.
»Für den soll sie ihren anderen Ehemann vergiftet haben«, sagt Halldor.
»Das ist eine Lüge«, faucht Maria. »Sie hat Romanos nicht vergiftet. Warum sollte sie? Es hätte doch genügt, sich den hübschen Mikhaél als Liebhaber zu nehmen. Wäre schließlich nicht ihr erster gewesen. Romanos hat seine Ehe kaum vollzogen. Dem wäre es gleich gewesen. Aber das hätte nicht in die Pläne des Eunuchen gepasst. Heiraten sollte sie Mikhaél, damit er Kaiser werden konnte. Und zwar gleich sofort, kaum dass Romanos’ Leiche kalt war. Das ist der wahre Grund, warum er sterben musste. Der Eunuch steckt dahinter. Kein anderer.«
Halldor pfeift kopfschüttelnd durch die Zähne. »Was für eine Schlangengrube, dieses Miklagarðr. Die schrecken vor nichts zurück.«
»Vielleicht beten sie deshalb so viel«, sagt Thjodolf mit respektlosem Grinsen. »Erst sündigen sie, dann rennen sie in die Kirche, um sich die Verbrechen vergeben zu lassen, die sie am Vortag begangen haben.«
»Ich sehe, du hast das Christentum durchschaut«, sagt Ragnar und lacht.
Eigentlich sollte Maria sich beleidigt fühlen, denn ich weiß, dass sie eine fromme Christin ist. Aber sie hat gar nicht zugehört. Sie ist viel zu gefangen in ihrer Empörung und Verachtung für Johannes’ Familienklan.
»Dabei war Zoës Mikhaél noch der Beste dieser Bande«, fährt sie unbeirrt fort. »Er war sogar ein einigermaßen guter Herrscher. Aber dann ist er gestorben. Und deshalb musste schnell der Neffe her, der Sohn des elenden Kalfaterers. Ausgerechnet der Schlimmste dieser korrupten Familie. Dem geht es nur um persönlichen Reichtum. Der kriegt den Hals nicht voll. Ein kléptokratos, sage ich euch, der vor nichts zurückschreckt. Das Volk stöhnt unter den neuen Steuern, die er sich ausgedacht hat. Und wenn einer von den adeligen Familien den Mund aufmacht, wird er sofort festgenommen, enteignet und verbannt, wenn nicht gar hingerichtet. In seiner kurzen Herrschaft hat er unzählige Familien an den Bettelstab gebracht. Es wird höchste Zeit, ihm das Handwerk zu legen.«
Sie sieht sich mit beschwörenden Blicken in der Runde um. Thjodolf schenkt ihr ein ermutigendes Lächeln. Er ist auf ihrer Seite. Ob aus Überzeugung oder weil sie eine hübsche Frau ist, da bin ich mir bei ihm nicht so sicher. Thjodolf hat eine ausgeprägte Schwäche für hübsche Weiber. Halldor sitzt mit grimmiger Miene auf seinem Stuhl. Unentschlossen, würde ich sagen. Halldor braucht meist eine Weile. Besonders, wenn etwas seinen bisherigen Überzeugungen widerspricht. Ulfr ist nachdenklich geworden. Snorri schweigt, hat ihr aber aufmerksam zugehört. Ich hätte gern gewusst, was er denkt. Ragnar und Bogdan nicken. Auch diese beiden sind mit ihr einverstanden. Der große Bjorn sitzt mit stoischer Miene dabei. Was immer ich entscheide, er wird es ohne Murren unterstützen.
Schließlich meldet Snorri sich zu Wort. »Ich habe nichts dagegen, dem Kerl das Handwerk zu legen«, sagt er. »Aber es ist ein Wagnis. Der Palast ist gut gesichert. Kaiserliche Truppen sind unterwegs. Es bleibt uns nicht viel Zeit. Ich spreche nicht für mich, Harald. Aber du hast deinen Hort gesammelt, um eines Tages, vielleicht bald sogar, nach Norðvegr heimzukehren. Mit uns. Mit einem Heer. Hab ich recht?«
Ich nicke.
»Du könntest alles verlieren. Nicht nur deinen Hort, auch dein Leben.« Er sieht mich an und lächelt. »Ist es das wert?«
Genau das ist die Frage, die auch ich mir gestellt hatte. In der Nacht war ich noch der Meinung gewesen, die Ereignisse in diesem Land gingen uns wenig an. Wir sind Söldner, kämpfen für Silber, tun unseren Dienst. Wer hier herrscht, kann uns gleich sein. Und ich habe anderes vor, weit entfernt von hier, in meiner Heimat, die ich zwölf Jahre lang nicht gesehen habe. Weder meine Berge, meine Wälder noch meine Familie. Ich hatte vor, den Hort zu bergen und zusammen mit den Kameraden zu verschwinden, um Miklagarðr für immer den Rücken zu kehren. Besonders, nachdem dieser Kalaphates mir so übel mitgespielt hat. Doch dann hat Maria mich umgestimmt.
»Ob es das wert ist, fragst du?«, sage ich. »Wenn es nur um mich ginge, Snorri, dann sicher nicht. Aber es geht um mehr, denke ich.«
Die Männer sitzen einen Augenblick lang still da, ohne etwas zu sagen. Unser Gespräch findet in den Mannschaftsunterkünften meiner fünfhundert væringjar statt, in dem Raum, in dem die Unterführer und ich für gewöhnlich die Mahlzeiten einnehmen. Ich lehne mich vorsichtig zurück, denn mein Rücken tut verdammt weh von Sigurds Peitschenhieben. Nach Wochen in diesem Dreckloch von Verlies.
Im Grunde habe ich am eigenen Leib erlebt, wovon Maria gerade erzählt. Der Mann nimmt jede Gelegenheit wahr, um andere auszuplündern. Auch meinen Hort wollte er an sich reißen. Ein beträchtlicher Schatz an Gold und Silber, den ich im Laufe der Jahre zusammengetragen habe. Rechtmäßige Beute aus sechs Kriegsjahren. Gut versteckt. Nur Thorkel, Bjorn und ich wissen, wo. Deshalb die Peitschenhiebe und die Androhung, mich hinrichten zu lassen, wenn ich nicht den Mund aufmache.
Und wer hatte Kalaphates’ Gier angestachelt, ihm von meinem Hort erzählt, ihm angeboten zu teilen? Kein anderer als Sigurd Erlingsson, mein ewiger Feind. Ihm habe ich die blutigen Striemen und offenen Wunden auf dem Rücken zu verdanken. Ja, an diesen beiden Bastarden würde ich mich gern rächen. Aber das ist nicht der wahre Grund, warum ich Maria versprochen habe, den Palast zu stürmen und den Despoten abzusetzen.
Halldor räuspert sich und sieht mich an. Er ist noch nicht überzeugt. Aber er will sich auch nicht mit mir streiten. »Ist es nicht so«, beginnt er vorsichtig von neuem, »dass die Griechen Nordmänner wie uns als Schutztruppe des Kaisers einsetzen, nicht allein, weil wir gute Kämpfer sind, sondern weil wir als Fremde keine Bindungen zum Adel haben, weil es uns gleich ist, wer regiert, solange wir bezahlt werden? Wir gehören keiner Partei an. Das ist doch der Gedanke hinter der Warägergarde.«
»Das ist richtig«, erwidere ich.
»Aber jetzt willst du dich einmischen. Du willst Partei ergreifen. Das widerspricht unserer Bestimmung. Wir kämpfen für den Basileus, wo immer er uns hinschickt. Wir kämpfen für Sold. Und wenn nötig, sollen wir für Sicherheit sorgen, ohne Rücksicht darauf, wer auf dem Thron sitzt. Wir sollen den Basileus schützen, ganz gleich, wie er heißt.«
»Auch das ist richtig.«
»Und auch die Palastwache besteht aus væringjar so wie wir. Wir würden also gegen unsere eigenen Leute kämpfen.«
»Damit müssen wir rechnen. Sigurd Erlingsson ist ihr Anführer.«
»Ein gewiefter Gegner.«
»Das ist er.«
Halldor schüttelt den Kopf. »Ich weiß nicht, Harald. Ich denke wie Thorkel. Wir sollten uns da raushalten.«
»Wer sagt denn, dass ich das denke.« Thorkel löst sich von der Wand und lässt sich auf einem freien Stuhl nieder.
»Aber du hast doch gerade Harald gefragt, warum er sich einmischen will.«
»Stimmt. Aber ich wollte nur wissen, ob es einzig aus persönlichen Gründen ist, aus Rachegefühlen, oder ob wir unsere Knochen für etwas Sinnvolles hinhalten sollen.«
»Und zu welchem Schluss bist du gekommen?«
Thorkel fährt sich mit der Rechten kurz durch die Haare. Dann sitzt er einen Augenblick lang still, wie um nachzudenken.
»Weißt du, Halldor«, sagt er dann, »seit ich denken kann, hat mein Stiefvater meine Mutter geschlagen. Die konnte sich nicht wehren. Er war ein ziemlich kräftiger Kerl. Sie hat es eingesteckt, ohne sich zu beklagen. Manchmal hat er sie übel zugerichtet. Einmal hätte er ihr fast die Nase gebrochen. Und mich hat er auch geschlagen. Weil ich ein Bastardkind bin. Das hat ihn gewurmt. Er hat mich geschlagen, bis ich zu groß dafür war.«
Zum ersten Mal spricht Thorkel über diese Dinge. Bisher hat er über seine uneheliche Herkunft immer geschwiegen, sich dafür geschämt. Nun scheint er endlich den vermeintlichen Makel überwunden zu haben.
»Das ist schlimm«, sagt Halldor. »Aber warum erzählst du uns das?«
»Das will ich dir sagen. Es hat mich gelehrt, dass man solchen Kerlen keinen freien Raum geben darf. Vor allem nicht erlauben, Schwächere zu unterdrücken, zu quälen und auszunutzen. Sigurd Erlingsson ist auch so einer. Gewalttätig, hinterhältig und rücksichtslos. Bei den Tschuden hat er ganze Dörfer abgebrannt, Leute gefoltert, ihre Habe gestohlen. Er ist sich auch nicht zu schade, Kameraden zu bestehlen. Sieh, was er mit Harald gemacht hat.«
Halldor nickt. »Der hat eine Abreibung verdient, aber das allein …«
Thorkel unterbricht ihn. »Du hast recht. Das allein genügt nicht, um unsere ganze Truppe in den Kampf zu schicken, um unseren Eid zu brechen und das Leben unserer Männer aufs Spiel zu setzen. Und Harald ist sicher stark genug, ein paar Peitschenhiebe zu überstehen.«
»Und warum willst du dann …«
Thorkel hebt die Hand. »Lass mich ausreden. Es geht ja gar nicht um Sigurd. Es geht um Kalaphates. Der ist zehnmal schlimmer als ein Sigurd, von meinem Stiefvater gar nicht zu reden. Dieser Mann bestiehlt ein ganzes Reich, er unterdrückt ein ganzes Volk. Er ist ein Tyrann, eine Bestie übelster Sorte. Er knebelt, beraubt und tötet alle, die sich ihm widersetzen. Maria redet davon, was er den Adeligen und Reichen antut. Aber seht euch doch um. Seit Tagen herrscht ein Volksaufstand. Nicht nur der Adel, sondern das ganze Volk ist empört. Nur vier Monate hat er gebraucht, um eine friedliche Stadt ins Chaos zu stürzen. Und das allein, um sich und seine Kumpane zu bereichern, um seine Machtgelüste auszuleben, um allen zu zeigen, dass er über dem Gesetz steht. Das widerstrebt mir. Das stinkt zum Himmel. Das ist nicht unsere Weise, Halldor! Das ist nicht die Art von konungr, dem sich freie Männer unterwerfen. Dieser Bastard hat schon viel zu lange gewütet.«
Er hatte konungr gesagt, das Wort für einen im Thing, in der öffentlichen Versammlung freier Männer, gewählten König, einem Mann unseres Vertrauens, der das Wohl aller im Blick hat, einem, dem wir mit Freude folgen und die Treue schwören. Und für einen, den wir genauso schnell wieder absetzen, wenn er dieses Vertrauen missbraucht. Kalaphates ist kein konungr. Keiner, der diesen Namen verdient. Das ist, was Thorkel sagen wollte. Und die anderen haben es verstanden.
Selbst Halldor nickt jetzt seine Zustimmung. »Also gut«, sagt er mit einem Seufzer. »Ich bin dabei.«
Ragnar brummt zufrieden. »Wir werden auf sein Grab pissen. Das verspreche ich dir, Maria.«
Ulfr räuspert sich. »Wir müssen vor allem die Männer da draußen überzeugen. Es geht auch um ihren Kopf, falls die Sache nicht gelingt.«
»Später«, sage ich. »Erstmal müssen wir die Lage klären. Und überlegen, wie wir es am besten anstellen.«
»Wie viel Mann hat Sigurd zur Verfügung«, fragt Snorri.
»Ich schätze, an die zweihundert.«
»Wenn es uns also gelingt, die Palastmauer zu überwinden, dann hätten wir Kämpfer genug.«
»Aber die Mauern sind hoch«, sage ich. »Und wahrscheinlich bewacht.«
»Und das alte Badehaus?«, fragt Thjodolf.
Das Zeuxippos war einst ein berühmtes Badehaus gewesen, dem Gott Zeus geweiht, vor Jahrhunderten aber für militärische Zwecke umgebaut. Es lag parallel zum Augustaion und beherbergte neben Unterkünften für die Palastwache auch ein Gefängnis. Auf dem Dach befanden sich zwei Türme, die das Haupttor überblickten. Ein guter Platz für Bogenschützen.
Halldor schüttelt den Kopf. »Da verlieren wir zu viele Männer.«
»Und wenn ihr daran denkt, das Haupttor aufzubrechen, vergesst es am besten gleich wieder«, meint Ragnar. »Das ist fußdick. Außen zu beiden Seiten aus solider Bronze und innen mit Zement gefüllt. Wiegt Tonnen.«
»Vielleicht vom Hippodrom aus in den Daphne-Palast. Da gibt es doch Zugänge«, schlägt Halldor vor. Er scheint seine Bedenken über Bord geworfen zu haben und ist voll bei der Sache. Ein guter Mann in jedem Kampf. Umsichtig, entschlossen. Ein ausgezeichneter Anführer.
»Ja, könnte sein«, erwidere ich. »Da ist auch der hintere Eingang zum Bukoleon-Palast.« Über diese Pforte hatte ich mich nachts zu Zoë geschlichen. Vor Ewigkeiten, wie es mir jetzt vorkommt. »Oder an der seeseitigen Außenmauer, über die Terrasse bei der alten Scholae. Da, wo ich selbst entkommen bin.«
»Oder überhaupt von See her«, meint Thorkel. »Über den kleinen Hafen am Bukoleon-Palast.«
Es folgen noch weitere Vorschläge, aber nichts, was mich wirklich überzeugt. Das Palastgelände ist riesig und von hohen Mauern umschlossen. Mit Sicherheit gibt es Schwachstellen, aber es fehlt uns an genauen Kenntnissen der einzelnen Örtlichkeiten. Wo könnte ein Angriff erfolgreich sein und am wenigsten Opfer kosten? Denn ich will vermeiden, dass wir uns eine blutige Nase holen.
Nach einer Weile habe ich genug von dem Gerede. Es bringt uns nicht weiter. »Eines muss klar sein«, sage ich. »Ich will auf keinen Fall übereilt handeln. Bevor wir uns also festlegen, werden wir alle Möglichkeiten genauestens auskundschaften. Auf einen Tag mehr kommt es nicht an.«
Thorkel sagt: »Aber wir dürfen nicht zu lange warten. Das Heer aus Makedonien wird bald hier sein. Spätestens in einer Woche. Vielleicht sogar früher.«
»Ich weiß.«
Ich wende mich Snorri zu. Er ist unser Fährtenleser. Nicht, dass er diese Fähigkeit hier benötigt, aber Snorri besitzt eine wunderbare Beobachtungsgabe. Ihm entgeht nicht die kleinste Einzelheit. Und er weiß sie zu deuten. Und auch, wie man einen Vorteil daraus ziehen kann.
»Du wirst die Schwachstellen des Palastes finden, Snorri. Ich verlass mich auf dich. Such dir ein Dutzend Männer dazu aus. Ohne Helm und Panzer, würde ich sagen, am besten versteckt ihr euch unter Kapuzenumhängen. Damit niemand Verdacht schöpft, warum ihr um die Palastmauern herumschleicht. Nehmt auch ein paar Sklaven mit. Die erkennt man nicht gleich als væringjar.«
Snorri nickt. »Gib mir eine Stunde zur Vorbereitung, dann machen wir uns auf den Weg.«
Zu Halldor und Ulfr sage ich: »Ihr beiden kümmert euch darum, dass die Männer kampfbereit sind. Und dass wir für alle Möglichkeiten die nötige Ausrüstung haben und es uns an nichts mangelt. Wir brauchen vor allem Wurfspeere, Bögen und eine Menge Pfeile. Und alles Nötige für einen Angriff auf die Mauer. Eiserne Wurfhaken, Seile, Leitern, schwere Äxte, vielleicht sogar einen Rammbock. Wie steht’s mit Katapulten?«
»Wir haben zwei cheiroballistras auf Rädern für schwere Eisenbolzen. Und auch drei leichte scorpios. Sicher keine Mauerbrecher.«
»Trotzdem. Könnten nützlich werden. Und bereitet Fackeln vor und jede Menge Pech. Ich will den Palast nicht abbrennen, aber wenn nötig, setzen wir auch Feuer ein.«
Maria starrt mit großen Augen von einem zum anderen. Wahrscheinlich war die Erstürmung des Palastes bisher nur eine Idee für sie gewesen. Jetzt dämmert ihr, dass es Zerstörungen und Verluste, vergossenes Blut und grausame Wunden bedeuten könnte.
Fast furchtsam blickt sie zu mir auf. »Und ich? Was kann ich tun?«
»Du bleibst an meiner Seite«, sage ich. »Ich will mir einen Überblick darüber verschaffen, was in den Straßen los ist. Und dann statten wir deinem Oheim einen Besuch ab. Vielleicht weiß er mehr darüber, was an Widerstand zu erwarten ist und ob noch andere Einheiten unterwegs sind, die uns gefährlich werden könnten.«
Marias Oheim ist ein ehemaliger strategos und Befehlshaber eines wichtigen Verwaltungs- und Militärbezirks in Anatolia. Jetzt nicht mehr im Amt, aber immer noch mit guten Verbindungen zur Verwaltung des Heeres. Das heißt, wenn man in dem Durcheinander des Aufruhrs überhaupt einen Verantwortlichen erreichen kann.
Besonders zu fürchten sind die gepanzerten Reiter der Tagmata, die berittene Schutztruppe des Kaisers und Kern des byzantinischen Heeres. Von denen gibt es mehrere Einheiten mit Quartieren an verschiedenen Orten im Reich. Eine davon hat ihr Lager in der Stadt, südwestlich von uns und innerhalb der Mauern, in der Nähe des Goldenen Tors. Obwohl Reiter für den Straßenkampf nicht unbedingt geeignet sind, würden fünfzehnhundert gut ausgebildete Kämpfer unser Vorhaben unmöglich machen. Zum Glück haben sie sich bisher zurückgehalten. Die Tagmata besteht größtenteils aus jungen Adeligen. Besonders die Offiziere. Für die Söhne der großen Familien des Reiches ist es eine Pflicht, in ihr zu dienen. Und es sind gerade diese Familien, die Kalaphates verachten und ihn gern loswerden würden. Vielleicht sogar, um selbst den Thron zu beanspruchen. Marias Oheim hat mir sagen lassen, dass ein Eingreifen der Tagmata unwahrscheinlich sei. Aber man kann nie wissen. Ich schicke zwei berittene Späher aus, um ihr Lager zu beobachten und uns zu warnen, falls sie doch ausrücken.
Meine Gefährten und ich wappnen uns. Hringa-brynja, runder Schild und Helm. Ausrüstung und Waffen sind die gleichen, wie wir sie auch in der Heimat verwenden, Waffen, mit denen wir gewohnt sind zu kämpfen. Thorkel prüft die Schärfe seiner geliebten Axt. Auch bei den meisten anderen unserer Truppe ist das die Lieblingswaffe. Deshalb nennen sie uns im Volksmund »die axttragenden Weinschläuche des Kaisers«. Weil wir mit Äxten kämpfen und jeden Südländer unter den Tisch saufen können.
Ich gürte mich mit Gunnlogi, meinem Ulfberht-Schwert, König Anunds fürstlichem Geschenk, das mir all die Jahre gute Dienste geleistet hat. Und Leggbitr, dem wertvollen Sax meines Vaters. Maria beobachtet mich bei den Vorbereitungen. Ich glaube, es erschreckt sie ein wenig, mich in voller Kampfausrüstung zu sehen. Besonders der Helm mit eisernem Nasenbügel und Wangenschutz sieht wahrscheinlich zum Fürchten aus.
»Lassen wir die Schilde zurück«, sage ich. »Ich denke, wir werden sie nicht brauchen. Und in der Menge sind sie nur hinderlich.«
»Ich weiß nicht. Ich hätte meinen gern dabei«, sagt Thorkel. Aber dann stellt er doch den Schild in die Ecke.
Bjorn wartet schon draußen auf uns. Er ist mein Bannerträger und bei jedem Einsatz an meiner Seite. Bjorn ist ein gewaltiger Kerl, fast noch größer als ich, mit einem Kreuz wie ein Schrank und mit Schenkeln wie Baumstämme. Auch Thjodolf besteht darauf, mitzukommen. Immer, wenn es etwas Neues zu sehen gibt, ist er dabei. Zu fünft machen wir uns also auf den Weg. Dazu ein Dutzend bewaffneter Kameraden als Begleitung.
Unsere Unterkünfte bestehen aus einfachen, langen Schuppen, in denen die Feldbetten der Männer untergebracht sind. Die Schuppen sind rund um einen großen Übungsplatz angeordnet, auf dem wir uns körperlich in Form halten. Trotz der frühen Stunde sind schon einige dabei, Balken zu stemmen oder gegen sandgefüllte Säcke anzurennen. Halldor und Ulfr werden bald alle zusammenrufen und ihnen erklären, was wir vorhaben.
Das Lager befindet sich außerhalb der konstantinischen Mauer, aber so nahe, dass man von der Mauerkrone bis auf die Schuppendächer spucken kann. Die alte, bröckelnde Mauer steht immer noch, obwohl sie unter mehreren Erdbeben stark gelitten hat. Von unserem Lager bis zu den neueren und weitaus gewaltigeren Befestigungsanlagen des Theodosius, mit den dreifachen Mauerwerken und dem breiten Wassergraben davor, ist es etwas mehr als eine Meile. In unserer Nähe haben sich über die Mauer hinweg Behausungen ausgebreitet. Sie gehören einfachen Arbeitern oder freigelassenen Sklaven. Doch der Großteil der Fläche zwischen den beiden Befestigungen wird für den Ackerbau genutzt. Im Fall einer Belagerung könnte Konstantinopel sich einige Monate lang selbst ernähren.
Auch die Wasserversorgung ist gesichert, denn an mehreren Stellen innerhalb des Mauerrings wurden schon vor langer Zeit große, offene Zisternen angelegt, von denen unterirdische Röhren bis in alle Stadtviertel führen. Ein Wunderwerk griechisch-römischer Baukunst. Und im Stadtkern gibt es außerdem noch weitere unterirdische Zisternen, in denen das Regenwasser, das von den Dächern herabläuft, gesammelt wird. Viele Paläste haben sogar ihre eigene Zisterne unter dem Fundament.
Es ist also kaum denkbar, Konstantinopel einzunehmen. Und wenn, dann nur mit einem riesigen Landheer, mit viel Geduld und einer großen Flotte, um gleichzeitig die Versorgung von See aus zu unterbinden. Vor etwas mehr als dreihundert Jahren sollen Araber es versucht haben. Zweimal sogar, aber ohne den geringsten Erfolg.
Wir verlassen das Lager und marschieren auf dem Nordstrang der Mese durch eines der zerfallenen Tore der alten Mauer. Linker Hand auf dem Hügel steht die Apostelkirche, nach der Hagia Sophia die bedeutendste Kirche der Stadt. Viele Kaiser sollen dort beigesetzt worden sein.
Es ist seltsam still. Wie ausgestorben. Ungewöhnlich, sogar hier am Stadtrand. Besonders die Mese ist normalerweise voller Menschen. Maultierkarren, Essbuden, fliegende Händler und Wasserträger. Wo sonst gefeilscht, gelacht, gelärmt wird, ist heute niemand zu sehen und nichts zu hören. Außer unsere Schritte, die von den Häuserwänden widerhallen. Auch die Gassen zu beiden Seiten sind wie leergefegt. Als stünde das Leben still. Als hielte die Stadt den Atem an. An einer Ecke stehen ein paar Weiber und tuscheln miteinander. Als sie uns bemerken, eilen sie ängstlich davon.
Wir marschieren weiter und kommen an der Markians-Säule vorbei. Der Sockel ist mit in Stein gehauenen Bildern geschmückt, und hoch oben vom Kapitell blickt das Standbild Kaiser Markians auf uns herab. Linker Hand, über den Dächern, ist die Krone des Aquädukts zu sehen, der zwei der sieben Hügel der Stadt miteinander verbindet, ebenfalls Teil der Wasserversorgung.
Auch hier ist es ruhig, aber nicht länger menschenleer. Hier und da sind junge Kerle unterwegs. In bewaffneten Banden bewegen sie sich durch die leeren Gassen. Meist bleiben sie stehen, wenn sie uns sehen, starren misstrauisch herüber oder ziehen sich zurück. Ich schätze, es sind Plünderer, die es ausnutzen, dass die Ordnung zusammengebrochen und die militia anderweitig beschäftigt ist. Aber mit væringjar wagen sie nicht, sich anzulegen.
In einer Gasse, an der wir vorbeikommen, sind mehrere übel aussehende Gestalten dabei, in die Werkstatt eines Silberschmieds einzubrechen. Der Besitzer liegt blutüberströmt auf dem Pflaster, während seine Frau sich weinend über ihn beugt. Die Plünderer haben uns bemerkt, lassen sich aber nicht stören. Rufen sogar rüde Beschimpfungen zu uns herüber.
»Bastarde!«, knurrt Thjodolf und bleibt stehen. »Wir sollten der Frau helfen.«
Ich fasse ihn am Arm und ziehe ihn weiter. »Heute wird überall geplündert, davon kannst du ausgehen. Wir können nicht jedem Dieb nachlaufen. Wir haben anderes zu tun.«
Als wir weitergehen, dreht Maria sich noch einmal um und starrt mitleidig auf den Mann und seine weinende Frau. Dann wirft sie mir einen vorwurfsvollen Blick zu, jedoch ohne etwas zu sagen.
»Was?«, frage ich, ein wenig gereizt. »Wir werden heute noch mehr Gewalt zu Gesicht bekommen. Besser, du gewöhnst dich dran.«
»Schon gut«, murmelt sie.
Sie ist mir gegenüber merklich kühler geworden, seit ich ihr in der Nacht eröffnet habe, dass ich nicht vorhabe, noch viel länger in Konstantinopel zu bleiben, und dass unsere Liebe irgendwann ein Ende haben wird. Kühler oder nachdenklicher oder einfach nur traurig. Sie hätte es schon vermutet, hat sie gesagt. Und sie sei mir auch nicht böse deshalb. Aber sie ist unglücklich. Das spüre ich deutlich. Und nun ist es mit uns nicht mehr das Gleiche.
Seit einer Weile schon hat sich ein fernes Geräusch bemerkbar gemacht. Ein Raunen von tausend Stimmen. Wie die Massen im Hippodrom bei den Pferderennen. Als wir uns dem säulengeschmückten Philadelphion nähern, wird es lauter. Es klingt jetzt fast wie ein Bienenschwarm, dazwischen einzelne Rufe, die von dumpfem Gebrüll abgelöst werden. Der Lärm scheint vom großen Konstantin-Forum in der Innenstadt zu kommen. Hört sich an, als ob dort die halbe Stadt versammelt wäre.
Wir marschieren unter dem Triumphbogen hindurch, der hier die Mese überspannt, und überqueren das Forum Tauri. Das ist ein großer, quadratischer Platz, umsäumt von herrschaftlichen Häusern und von Statuen bedeutender Männer der byzantinischen Geschichte. Ringsum erlauben Bogengänge, an heißen Tagen im Schatten zu wandeln.
Nach fast sieben Jahren in Grikaland kenne ich Konstantinopel gut. Trotzdem bin ich immer noch erstaunt über die schiere Größe der Stadt, die unglaubliche Menge an Bewohnern, die gewaltigen Befestigungen im Westen, die Häfen im Norden und Süden. Ich bewundere die großen Plätze wie dieses Forum, die vielen Mietshäuser, sechs und sieben Stockwerke hoch, die geschäftigen Marktplätze, auf denen es alles zu kaufen gibt, was die Welt zu bieten hat, die feinen Paläste, die Gärten mit ihren Springbrunnen, die wunderbaren Kirchen. Und was ich noch zu schätzen gelernt habe, da ich nun das Lesen beherrsche, das sind die Bibliotheken mit ihren Tausenden zum Teil jahrhundertealten Werken.
Doch an diesem Morgen ist nicht der rechte Augenblick, darüber nachzudenken. Auf dem Forum Tauri ist viel Volk unterwegs. Einzeln und in Gruppen strömen sie aus den benachbarten Gassen und hasten in die gleiche Richtung wie wir. Die meisten sind junge Männer, mit Messern und Knüppeln bewaffnet. Sie scheinen begierig, sich am Aufstand zu beteiligen, sich den Aufrührern anzuschließen und die Absetzung des Basileus zu fordern. Wenn nötig, dafür zu kämpfen. Manche machen grimmige Gesichter, aber viele lachen, rufen sich Scherzhaftes zu, als ob es aufregend und ein Spaß wäre, gegen die militia in die Schlacht zu ziehen.
»Die werden sich blutige Köpfe holen«, sage ich. »Dann wird ihnen das Lachen vergehen.«
»Du vergisst, der Aufstand hält schon Tage an«, sagt Thorkel, »während du noch im Kerker warst. Die militia hat die Sache längst nicht mehr im Griff. Die meisten der Aufständischen gehen nicht einmal nachts nach Hause. Die haben sich auf dem Konstantin-Forum eingerichtet und halten von dort das ganze Viertel besetzt, bis zum Palast. Es wird schwer sein, durchzukommen. Du wirst sehen.«
Über uns in den Häusern und Palästen zu beiden Seiten der Mese ragen die Köpfe Schaulustiger wie Trauben aus den Fenstern. Hier und da brüllt einer den jungen Aufständischen Parolen und Ermutigungen zu. Uns dagegen beschimpfen sie, denken, wir gehören zu den Ordnungskräften. Wie anders war es noch beim Triumphzug des Kaisers vor sechs Monaten. Hier auf der gleichen Prachtstraße, nach dem Sieg über die Bulgaren. Da waren die Mese und alle Foren vollgepackt von begeisterten Menschen. Da hingen sie auch in den Fenstern, haben uns bejubelt. Jetzt spucken sie auf uns herab.
»Glauben die, wir sind zu Feinden des Volkes geworden?«
Maria antwortet verlegen: »Sie meinen, wir gehören zu Kalaphates.«
»Wahrscheinlich kann man es ihnen nicht verdenken. Wir Waräger haben einen Eid auf das Kaiserhaus geschworen. In ihren Augen gehören wir zu den Unterdrückern.«
Wir verlassen das Forum Tauri und folgen weiter der Mese. Hier wird die Menge dichter. Einige wenden die Köpfe, zeigen auf uns, als sie uns als væringjar erkennen. Immer mehr drehen sich um, bilden plötzlich eine Front gegen uns. Mit wütenden Worten stachelt ein grober, dunkelbärtiger Kerl die Leute gegen uns auf. Drohend fuchteln sie mit Knüppeln, mit Sicheln und Hämmern. Ich sehe einen untersetzten Kerl mit einem Schlachtbeil. Und auf einmal fliegt ein Stein, der mich knapp verfehlt. Ich stelle mich vor Maria, um sie zu schützen. Sie hält sich dicht hinter mir, blickt ängstlich um sich. Wir könnten uns wehren und einige erschlagen, aber es sind zu viele. Am Ende würden sie uns in Stücke reißen.
»Wir sind auf eurer Seite«, rufe ich ihnen mit lauter Stimme zu. »Lasst uns durch! Wir sind auf eurer Seite!«
Noch ein Stein kommt geflogen. Der trifft mich diesmal an der Schulter. »Glaubt ihnen nicht. Das sind Warägerschweine!«, brüllt einer. »Macht sie fertig!« Noch mehr Steine. Einer trifft Thorkel am Helm.
»Nieder mit Kalaphates!«, brüllt Thorkel plötzlich geistesgegenwärtig. Das ist es, was sie seit Tagen in den Straßen rufen. Und sofort stimmen wir mit ein in diesen Schlachtruf. »Nieder mit Kalaphates! Nieder mit Kalaphates!«
»Wir sind hier, um den Bastard abzusetzen«, füge ich hinzu.
Das verändert alles. Zuerst starren die Kerle uns verdutzt an. Dann lachen sie auf und brüllen mit uns im Chor. Die ganze Straße entlang tönt es jetzt: »Nieder mit Kalaphates! Zoë auf den Thron! Nieder mit Kalaphates! Zoë auf den Thron!«
Die gleichen Männer, die uns eben noch umbringen wollten, grinsen uns jetzt zu. Und als wir uns einen Weg weiter durch die Menge bahnen, klopfen sie uns sogar auf die Schulter. Wenig später betreten wir das riesige, kreisrunde Forum mit der hohen Konstantin-Säule in der Mitte.
Der Konstantin-Platz scheint das Zentrum des Aufstands zu sein. Überall stehen die Leute dicht an dicht. Sie reden, gestikulieren und schreien durcheinander, skandieren lautstark in Sprechchören gegen Kalaphates oder verlangen nach der Kaiserin. Zoë scheint auf einmal für Gerechtigkeit im Land zu stehen. Ich frage mich, wie sie zu dieser Ehre gekommen ist. In einer Ecke des Forums unterhalten ein paar Geschäftstüchtige Kochfeuer und rösten Fleischstücke, die sie verkaufen. Ich sehe Betrunkene mit Huren im Arm, als wären sie zum Vergnügen hier. An einer anderen Stelle wird getrommelt, und ein paar Feierlustige tanzen dazu. Sogar Kinder sind dabei. Fast glaubt man sich auf einem Volksfest.
Eigentlich hätte ich militia mit Schlagstöcken erwartet oder gar mit scharfen Waffen. Aber von den Hütern der Ordnung ist weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen diese bunte Menge. Zum Teil wilde, abgerissene Gesellen, Gesindel, die den Aufstand als Gelegenheit sehen, zu streiten und zu prügeln. Aber in der Hauptsache sind es einfache Leute aus dem Volk. Bäcker, Gerber, Schreiner, Bootsbauer, Ladenbesitzer, Weinhändler. Es sind aufgebrachte Männer, vor allem junge, aber auch Graubärte, ausgemusterte Soldaten mit Schlagstöcken. Manche sogar mit richtigen Waffen in den Händen. Es scheint sich in den letzten Jahren eine Menge Wut aufgestaut zu haben. Und Kalaphates hat die Beule zum Platzen gebracht.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Forums führt die Mese weiter Richtung Augustaion, wo besondere Zeremonien abgehalten werden. Am Ende der Straße ist das Milion zu sehen, auf dem die Entfernungen zu allen wichtigen Städten des Reiches eingemeißelt sind. Links davon, hoch über den Dächern, ragt die Kuppel der Hagia Sophia. Rechts sind die Giebel des Kaiserpalastes zu erkennen.
Ganz gleich, wo man hinschaut, überall sind Massen von Menschen unterwegs. Es müssen Hunderttausende sein. Auf der Mese, Richtung Milion, stehen sie so dicht, dass überhaupt kein Durchkommen ist. Dort ist das Ende der Mese von Barrikaden versperrt, hinter denen sich die Aufständischen verschanzt haben. Eine Barrikade aus Tischen und Bänken und Karren, soweit ich das erkennen kann. Sie scheinen die Schenken des Viertels ausgeräumt zu haben.
Und noch weiter vorn, auf der anderen Seite der Barrikade, sieht man Helme und Speerspitzen in der Morgensonne glänzen. Dort steht eine doppelte Schildreihe von Kriegern. Aber es ist nicht die militia, sondern es sind die ganz in Rot gekleideten Männer der Palastwache. Sie halten die Stellung gegen die Aufrührer, schirmen den breiten Durchgang zwischen Zeuxippos und Augustaion ab, dem Zugang zum großen Bronzenen Tor des Kaiserpalastes. Und auf den beiden Türmen des Zeuxippos sind ebenfalls Krieger in Rot zu erkennen. Vermutlich Bogenschützen.
»Das ist die Kampflinie«, sagt Thorkel. »Da ist es schon mehrmals zu Zusammenstößen gekommen. Und zu Toten. Und trotzdem geben sie nicht auf.«
Ich erinnere mich an das Gericht im Palast, als Kalaphates geruhte, mich zum Tode zu verurteilen. Ich könnte wählen, hat er gemeint, die Art der Vollstreckung sei mir überlassen. Während dieser sogenannten Verhandlung habe ich sie draußen vor dem Tor ihren Schlachtruf brüllen hören. Genau wie es heute immer wieder um uns herum erschallt: »Nieder mit Kalaphates! Zoë auf den Thron! Nieder mit Kalaphates! Zoë auf den Thron!«
Da können sie lange brüllen, denke ich. Zoë ist gefangen und befindet sich weit von hier auf einer einsamen Insel im Marmarameer. Und solange die Palastwache das Bronzene Tor verteidigt, ist Kalaphates Basileus. Außerdem wird in wenigen Tagen ein Heer die Stadt erreichen. Dann ist es aus mit dem Widerstand. Dann wird Kalaphates schreckliche Rache nehmen.
Trotz des Lärms und des Zorns der Menge scheint im Augenblick so eine Art Waffenstillstand zu herrschen. Keine Seite traut sich so recht, etwas zu unternehmen. Sigurds Männer fürchten die schiere Masse der aufgebrachten Menschen. Und die Aufständischen fürchten die Schwerter und Pfeile der Palastwache. Deshalb auch die Barrikaden.
Trotzdem beneide ich nicht die Jungs, die da vor dem Palast stehen und eine doppelte Schildreihe bilden. Ein entschlossener Ansturm Tausender würde sie schnell überwältigen. Und wo ist überhaupt die militia?
Ich frage mich, wie Snorri in diesem Gedränge seinen Auftrag erfüllen soll. Er wird kaum an den Palast herankommen. Was unsere kleine Gruppe angeht, so versuchen wir, möglichst friedlich auszusehen. Wir nehmen die Helme ab und stimmen in den Schlachtruf der Menschen ein. Schon zu unserer eigenen Sicherheit.
Und jedes Mal, wenn wir mit der Menge brüllen, grinsen die Umstehenden erfreut und jubeln uns zu. Dass ausgerechnet Waräger auf der Seite des Volkes sind, scheint die Leute zu begeistern. Um uns herum sind nicht nur Männer, auch junge Weiber. Die schreien am lautesten und wünschen dem Basileus die Pest an den Hals. Eine der Frauen nähert sich Thorkel, legt ihm die Arme um den Nacken und küsst ihn auf den Mund. Dann tritt sie zurück und brüllt aus voller Kehle ihre Wut gegen Kalaphates heraus. Die Menge klatscht dazu Beifall und grölt mit.
Ich überlege, ob wir uns weiter bis zu den Barrikaden vorkämpfen sollen, als der ständige Lärm der Stimmen von einem ganz anderen Geräusch übertönt wird, einem plötzlichen Aufheulen, gefolgt von ängstlichen Rufen und wildem Gekreische. Es kommt von der Südseite des Forums. Das ist kein Protest gegen Kalaphates. Das sind Schmerzschreie und Gebrüll von Leuten in Todesangst. Bei Oðin! Da wird gekämpft, und Menschen sterben, so viel ist sicher.
Im gleichen Augenblick geht ein spürbarer Ruck durch die Menge. Die Leute drängen von Süden her in unsere Richtung, Männer und Frauen mit angstverzerrten Gesichtern. Sie stolpern und stürzen übereinander. Es sieht nach Panik aus. Ich fürchte, einige werden zu Tode getrampelt werden. Die Fluchtwelle drückt auch gegen uns. Wir werden abgedrängt und müssen aufpassen, nicht zu straucheln. Wer stürzt und überrannt wird, ist verloren. Ich reiße Maria an mich und halte sie fest, während wir Schritt für Schritt zurückweichen.
»Was ist das?«, ruft sie ängstlich. »Was ist los?«
Trotz des Gedränges versuche ich, etwas zu erkennen. Meine Körpergröße hilft. Und was ich da am Südende des Forums zu sehen kriege, jagt mir einen verdammten Schrecken in die Glieder. Ich sehe Schwerter, die auf stolpernde und fliehende Menschen niedergehen. Behelmte Köpfe von Kriegern, rechteckige Schilde und Klingen, die in der Morgensonne blitzen.
Eine ganze Phalanx von Söldnern ist dabei, sich rücksichtslos eine blutige Schneise durch die Menge zu schneiden. Wem es nicht sofort gelingt, das Weite zu suchen, der wird erschlagen. Männer brüllen vor Wut und Furcht, Weiber kreischen in panischer Angst. Das Forum ist erfüllt von den Schreien der Verwundeten und Sterbenden. Die schildtragenden Krieger aber rücken vor, in den Fäusten ihre Schwerter, die immer wieder neue Opfer finden. Selbst Frauen metzeln sie nieder.
Es herrscht ein unbeschreiblicher Lärm. Der ganze Platz ist in Bewegung. Alles rennt in dem verzweifelten Bemühen, den Kriegern zu entkommen, die unaufhaltsam vorrücken. Jemand stürzt in eines der Grillfeuer. Man hört ihn kreischen. Wir werden mitgerissen vom Strom der Fliehenden. Jemand boxt mir in die Seite. Ich stolpere über etwas am Boden. Ist das ein Bein? Ich wage nicht, hinzuschauen, halte Maria fest. Ich darf sie nicht verlieren. Das wäre ihr Ende.
Thjodolf wird abgedrängt. Thorkel und andere Kameraden versuchen, sich gegen den Strom zu stemmen, um uns alle zu schützen. Die Menge drückt dagegen. Wieder müssen wir weichen. Zum Glück steht Bjorn wie ein Fels vor uns und hilft, Maria abzuschirmen. Dann lässt der Druck etwas nach. Zu beiden Seiten strömen die Leute an uns vorbei, fliehen in die Gassen, die vom Forum wegführen.
Doch nicht alle laufen davon. Junge Kerle mit Waffen in den Fäusten sind geblieben, wenn auch nur auf der Nordseite des Forums. Es sieht aus, als wollten sie sich formieren, Widerstand leisten. Den Söldnern sind im Augenblick die Opfer ausgegangen. Zumindest in ihrer nächsten Nähe. Sie halten inne, um Atem zu schöpfen, umgeben von Leichen und sich am Boden krümmenden Verwundeten.
Thjodolf ist wieder bei uns. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. »Die hätten mich beinahe zu Boden gerissen. Mann, ich dachte schon, das wär’s für mich gewesen.«
Aber es ist noch nicht zu Ende. Viele der todesmutigen Rebellen, die nicht geflohen sind, reißen Pflastersteine aus dem Boden und bewerfen die Truppe. Zwei der Krieger gehen zu Boden. Die anderen recken ihre Schilde hoch und stürmen erneut vor, erschlagen gleich mehrere dieser jungen Kerle, die es gewagt haben, sich gegen sie zu stellen. Trotzdem werden drei der Söldner verwundet.
Doch als die Rebellen merken, dass sie gegen diese zweifellos disziplinierten Söldner nicht ankommen, ziehen sie sich zurück. Die Truppe ist ruhig, aber mit äußerster Brutalität vorgegangen. Jemand muss den Befehl gegeben haben, keine Gnade zu zeigen.
Ich sage: »Wer, zum Teufel, sind die Kerle?«
»Die sind vom Galeerenhafen gekommen«, meint Bjorn. »Ich schätze, das sind Seekrieger. Müssen gerade gelandet sein.«
»Wie viele?«
»Mehr als hundertfünfzig. Vielleicht zweihundert.«
Ich denke, Bjorn hat recht. Byzantinische Galeeren haben neben ihren Ruderern je nach Größe zwischen dreißig und fünfzig Seekrieger an Bord. Die sind besonders gut ausgebildet. Ihre Aufgabe ist es, gegnerische Schiffe zu entern und die Decks von Feinden zu säubern. Ich versuche, sie zu zählen, und komme ebenfalls auf etwa zweihundert.
»Scheiße, Harald.« Thorkel verschafft sich über den erneuten Lärm hinweg Gehör, denn die Aufständischen haben wieder mit ihren Sprechchören angefangen. »Das sind Verstärkungen des Kaisers.«
»Sieht so aus. Mindestens vier oder fünf Galeeren. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr.«
Die Seekrieger haben ihre verwundeten Kameraden aufgelesen und marschieren jetzt über den halbleeren Platz in Richtung Mese. Ihr Ziel ist zweifellos der Palast. Die Vordersten bilden einen Keil. Dahinter andere, die beide Flanken schützen, obwohl im Moment niemand mehr wagt, sie anzugreifen. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie eine von Sklaven getragene Sänfte mit sich führen. Unmöglich, zu sehen, wer sich darin befindet. Vorhänge verwehren den Blick ins Innere.
»Seht ihr die Sänfte? Wer könnte das sein?«
»Vielleicht niemand«, erwidert Thjodolf. »Vielleicht nur ein Goldschatz. Steuereinnahmen aus den Provinzen.«
»Deshalb die Seekrieger?«
»Könnte doch sein. Die sollen den Hort beschützen.«
Ich sage: »Das waren keine Steuereinnahmen in der Sänfte. Da bin ich mir sicher. Irgendjemand befand sich darin.«
»Wer sollte das sein?«
»Jemand von Bedeutung.«
Wir denken darüber nach, als Maria sagt: »Ich weiß, wer sie anführt. Ich hab ihn erkannt. Das ist der Kerl da neben der Sänfte.«
»Wer?«
»Konstantinos, Kalaphates’ Oheim.«
»Sein Oheim? Wie viele Oheime hat der Mann eigentlich?«
»Nachdem der Eunuch verbannt wurde, ist dieser der Letzte. Weißt du denn nicht, dass er diesen Konstantinos zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte ernannt hat? Die beiden verstehen sich gut. Die sind aus dem gleichen Holz geschnitzt.«
»Du vergisst, ich hab mich die letzten Monate in einem Verlies aufgehalten.«
»Ja, tut mir leid. Aber ich hab gehört, dass der Kerl in Trapezunt war. Jetzt ist er wohl zurückgekehrt.«
Konstantinos, Oheim des Basileus. Oberster Befehlshaber des Heeres. Der also hat das Gemetzel befohlen. Und jetzt eilt er seinem verfluchten Neffen zu Hilfe. Das erklärt aber nicht, wer sich in der Sänfte befindet. Vielleicht niemand, wie Thjodolf meint, nur Steuereinnahmen. Das wäre ein Fest gewesen, wenn die Plünderer so einen Hort erbeutet hätten. Aber ich glaube nicht daran. Ich bin sicher, ein Mensch war in der Sänfte. Nur wer?
Die Truppe verlässt den Platz, und die vielen Leute, die dicht gedrängt zwischen Forum und Palast auf der Mese stehen, haben längst gemerkt, was auf sie zukommt. Die meisten verdrücken sich schon in die Seitengassen. Einige Mutige aber stellen sich den Kriegern in den Weg, versuchen, eine Art Schlachtreihe zu bilden. Doch der Widerstand dauert nur Augenblicke. Kaum haben die Söldner die Ersten niedergemacht, da verlässt die Verteidiger der Mut, und sie fliehen ebenfalls. Schweigend beobachten wir, wie die Seekrieger die behelfsmäßige Barrikade auseinanderreißen und samt der Sänfte zum Palasttor marschieren, wo sie von Sigurds Männern jubelnd in Empfang genommen werden.
»Scheiße!«, flucht Thorkel. »Zweihundert Seekrieger im Palast. Die haben uns gerade noch gefehlt.«
Auf dem Forum ist es still geworden. Nur das Heulen und Stöhnen der Verwundeten ist zu hören. Betroffen sehen wir uns um. Der halbe Platz ist von Toten und Verletzten übersät. Sie liegen, wo sie gefallen sind. Viele, vielleicht Hunderte. Es ist ein wahres Schlachtfeld, vom Forum bis zu den Barrikaden am Ende der Mese.
»Herr im Himmel«, murmelt Maria und bekreuzigt sich. Sie hat Tränen in den Augen. Dann schlägt sie die Hände vors Gesicht, als könnte sie den Anblick nicht länger ertragen.
Nicht alle wurden Opfer der Schwerter. Manche wurden einfach nur zu Tode getrampelt. Blut versickert zwischen Pflastersteinen. Verwundete schreien und jammern. Andere beugen sich über sie, versuchen verzweifelt, zu helfen. Ein Mann hält seinen leblosen Freund oder Bruder im Arm. Eine junge Frau wirft sich über den Leichnam ihres Mannes. Ein kleines Mädchen hockt weinend neben seiner toten Mutter, hebt hilflos die Arme, das kleine Gesicht verzerrt. Die Verletzten, die noch in der Lage dazu sind, lassen sich aufhelfen und humpeln stöhnend davon. Endlich nimmt auch jemand das Kind auf den Arm.
Der Aquarius
Vor mir sitzt Alkibiades Anargyros, Marias Oheim. Der Mann ist an die sechzig, mittelgroß, gut in Form, mehr drahtig als schlank. Kinn und Wangen sind glatt rasiert, auch das weiße Haar ist kurz geschnitten, die Haut wettergegerbt wie die eines Mannes, der viele Jahre im Freien verbracht hat. Er sitzt kerzengerade trotz der bequemen und mit seidenen Kissen ausgestatteten Sitzgelegenheiten, auf denen wir uns niedergelassen haben. Und obwohl reich, ist er schlicht gekleidet. Nicht der übliche zur Schau gestellte Pomp byzantinischer Adeliger und hoher Beamter. Man sieht ihm an, dass er ein Leben lang Offizier war, dass er das harte Leben im Feldlager gewohnt ist, es vielleicht dem jetzigen sogar vorzieht. Sein Blick ist der eines Mannes von Autorität, aber nicht hochmütig, sondern ernst, der Lage angemessen.
Ob ihm mein Verhältnis zu Maria, die ebenfalls zugegen ist, missfällt, zeigt er nicht. Obwohl ich sicher bin, dass ihre Liebe zu einem Barbaren wie mir bei dieser feinen Familie nicht gerade auf Begeisterung stößt. Ihre Tante war höflich genug, mich zu begrüßen und nach Erfrischungen zu rufen, hat sich dann aber schnell verabschiedet.
Ja, für Alkibiades und seine Frau bin ich kein geeigneter Mann für ihre Nichte. Und es muss sie insgeheim empören, dass Maria es sich herausnimmt, gelegentlich die Nacht bei mir zu verbringen. Aber sie lassen es zu, wenn auch widerwillig, denn wir leben in unsicheren Zeiten. Und ich bin der Mann der Stunde. Für den scheint Alkibiades mich jedenfalls zu halten. Der Mann, der Kalaphates entmachten und in die Verbannung schicken kann. Das heißt, wenn wir uns beeilen und die Gelegenheit nutzen, solange kaum Truppen in der Stadt sind. Wir sind also Verbündete. Verschwörer gewissermaßen.
»Weißt du, dass sie die Kaiserin seit Monaten gefangen halten?«, fragt Alkibiades mich als Erstes.
»Maria hat es mir erzählt.«
»Ich frage mich, was der Mann sich als Nächstes ausdenkt.« Er starrt mir forschend in die Augen. »Was hast du vor?«, erkundigt er sich. »Gibt es einen Plan?«
Die Frage hatte ich erwartet. Kein langes Herumgerede, kein Gejammer über die Toten unten auf dem Platz, nicht einmal Entrüstung über die Brutalität, mit der man Menschen gemeuchelt hat. Alkibiades ist nicht umsonst strategos. Er kommt gleich zur Sache, hält sich nicht mit Gefühlen auf. Was ist mein Plan, will er wissen. Die Frage ist berechtigt. Aber das Schlimme ist, ich habe keinen Plan. Jedenfalls keinen, der etwas taugt.
»Wird es noch mehr Überraschungen geben?«, frage ich.
»Ich hoffe nicht. Konstantinos war unterwegs, um unsere Truppen an der Schwarzmeerküste zu besichtigen. Er ist unverhofft früh zurückgekehrt.«
»Vielleicht hat man ihm Boten geschickt.«
»Unwahrscheinlich. Ich denke, hier hat der Zufall gespielt.«
»Und? Was könnte noch auf uns zukommen? Sind noch andere Truppen unterwegs?«
»Nur das Heer aus Makedonien. Mehr ist mir nicht bekannt.«
»Wer war in der Sänfte?«
Er zuckt mit den Schultern. »Ist das wichtig?«
»Könnte sein. Ich möchte wissen, mit wem oder was wir es zu tun haben.«
»Vielleicht noch ein Verwandter dieser elenden Familie. Vielleicht haben sie den Eunuchen zurückgeholt. Der verstand es jedenfalls besser, mit Schwierigkeiten umzugehen. Aber ich denke, es hat keine Bedeutung.«
»Alles kann eine Bedeutung haben. Wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis.«
»Auf dünnem Eis?« Er hebt die Brauen. Mit zugefrorenen Seen hat man hier wohl selten zu tun. Aber dann versteht er und lächelt. »Ja, da hast du recht. Auf sehr dünnem Eis. Guter Vergleich.« Dann runzelt er die Stirn. »Du tust in jedem Fall gut daran, vorsichtig zu sein. Dieser Konstantinos ist genauso korrupt wie Kalaphates, aber klüger. Und mit der Verstärkung an Seekriegern …«
»Ich fürchte eher Sigurd Erlingsson, den Befehlshaber der Palastwache. Der hat mehr Kampferfahrung als ein Konstantinos, ganz gleich, wie klug der Mann ist.«
Alkibiades runzelt die Stirn. »Auch ein Waräger. So wie du.«
»Ja, so wie ich. Aber seit Jahren mein Feind.«
Das Haus der Familie liegt ganz in der Nähe des Konstantin-Forums. Sie müssen das Geschrei des Gemetzels bis hierher gehört haben. Auch jetzt ist schon wieder der Lärm des Aufstands zu hören, die Sprechchöre, die Trommeln. Sie geben nicht auf, so viel ist sicher. Der Protest tönt trotzig, aber nach dem Massaker doch etwas gedämpfter, weniger frech und aufmüpfig, weniger selbstbewusst. Aber genug, um sich immer noch gegenseitig Mut zu machen. Ich frage mich, ob man die Leichen schon entfernt hat. Ich frage mich auch, wo in dem Tumult Snorri steckt.
»Du hast also noch keinen Plan.« Alkibiades sieht mich scharf an.
»Ich habe Kundschafter da draußen, die nach Stellen suchen, wo wir ohne allzu große Verluste über die Mauer kommen. Spätestens am Abend erwarte ich ihren Bericht. Dann sehen wir weiter.«
Er zuckt mit den Schultern, zieht die Mundwinkel herunter. »Auf Wunder zu hoffen, war wohl zu viel erwartet«, knurrt er. »Aber ich verstehe. Die Sache ist nicht einfach. Und dein Einsatz und der deiner Männer … nun, wir werden es alle sehr zu schätzen wissen.«
»Wer ist wir?«
»Alles, was Rang und Namen hat in der Stadt.«
»Wenn es so wäre, warum schließt sich uns nicht die Tagmata an?«
»Wenn du den Anfang machst, werden ihre Offiziere folgen.«
»Das ist aber eine recht bequeme Einstellung.«
Er seufzt. »Da hast du recht. Sie fürchten die Rache des Usurpators, falls die Sache danebengeht.«
»Das Volk da draußen auf den Straßen ist nicht so zögerlich.«
»Lastenträger und Straßenkehrer haben weniger zu verlieren.«
Ich werfe ihm einen gereizten Blick zu. »Sie haben ihr Leben zu verlieren. So wie heute. Ist das nichts?«
»Tut mir leid. So hatte ich das nicht gemeint.«
»Das heißt also, wir Waräger sollen uns erstmal die Finger verbrennen, während die feinen Herren zuschauen und abwarten, wie die Sache ausgeht, um sich am Ende dem Gewinner anzuschließen.«
Alkibiades nickt verlegen. »Da hast du nicht ganz unrecht. Aber so ist es doch leider oft im Leben. Nicht alle wollen die Ersten sein, die sich vorwagen. Einer muss immer vor allen anderen den Mut aufbringen.«
»Und das soll ich sein.«
»Darauf hoffe ich, Harald.«
»Nimm’s mir nicht übel, Alkibiades, auch wenn ich mich wiederhole, aber das gemeine Volk da unten auf der Straße hat mehr Mut als deine edle Tagmata. Und das wollen Krieger sein.«
Alkibiades strafft die Schultern. »Wenn ich jünger wäre«, sagt er nicht ohne Würde, »würde ich ohne Zögern an eurer Seite kämpfen. Ich wäre unter den Ersten, die über die Mauer klettern.«
Das glaube ich ihm sogar. Dem alten Krieger wäre es auch noch heute zuzutrauen. Man sieht ihm an, wie sehr es ihn schmerzt, dass einfache Menschen auf den Foren der Stadt und Fremde, so wie wir, mehr Mut aufbringen, gegen den Tyrannen zu kämpfen, als seine Standesgenossen.
»Wir werden einen Weg in den Palast finden«, sage ich. »Aber ich muss auch meine eigenen Männer überzeugen. Wer hier Basileus ist, ist ihnen völlig gleich. Aber wir verlangen, dass sie ihren Eid brechen. Sie sollen gegen ein gekröntes Haupt vorgehen. Dafür können sie bestraft werden. Was kann ich ihnen bieten?«
Alkibiades seufzt. »Verstehe. Es läuft also wie immer auf Gold hinaus.«
»Es sind Söldner«, sage ich. »Und wenn wir sie angemessen entlohnen, kann ich verhindern, dass sie plündern.«
Wir fangen an zu schachern. Er bietet eine Summe pro Kopf, ich verlange das Fünffache. Nach langem Hin und Her einigen wir uns auf einen dreifachen Jahressold pro Mann. Eine Riesensumme.
Ich sage: »Hoffentlich kommt das Geld nicht allein aus deiner Tasche.«
»Keine Sorge«, erwidert er grimmig, »das hole ich mir schon wieder zurück.«
Wahrscheinlich mit Gewinn, denke ich. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass in Byzanz nichts läuft, wenn sich nicht jemand daran bereichert. Deshalb habe ich auch keine Bedenken, eine angemessene Gegenleistung für meine Männer zu fordern. Schließlich sollen sie die Knochen hinhalten. Und bei mir wird natürlich auch etwas hängenbleiben. Aber das ist nicht der Grund, warum ich das alles tue.
»Noch etwas«, sage ich. »Falls die Dinge so abgehen, wie wir es uns wünschen, dann ist da immer noch das Volk auf den Straßen. Die meisten sind ehrenwerte Leute, aber es befindet sich auch eine Menge bösen Gesindels darunter. Die werden nicht wieder friedlich zurück in ihre Löcher kriechen. Es könnte zu schlimmen Ausschreitungen kommen. Und ich habe nicht genug Männer, um die ganze Stadt unter Kontrolle zu halten. Was ist mit der militia? Die ist seltsamerweise seit gestern völlig abwesend.«
»Ich kenne den Befehlshaber der militia. Ich werde nach ihm schicken. Und ich bin sicher, auch die Tagmata wird helfen. Kann ich sonst noch etwas für euch tun?«
»Uns warnen, falls die Lage sich verändert.« Ich erhebe mich. »Jetzt muss ich zu meiner Truppe zurück.«
Maria, die bisher von einem zum anderen geblickt und besorgt zugehört, aber selbst kein Wort gesagt hat, springt ebenfalls auf.
»Ich komme mit«, sagt sie.
»Auf keinen Fall. Es ist zu gefährlich.«
»Das ist mir gleich.«