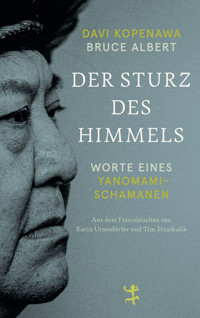
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Sturz des Himmels ist ein alle Gattungen sprengendes, monumentales Werk: schamanisches Lehrstück, leidenschaftliche Verteidigung der Rechte indigener Völker und kompromisslose Verurteilung der Verwüstungen, die an Mensch und Umwelt begangen werden. Die Autobiografie des Schamanen Davi Kopenawa ist eine für das Menschheitsgedächtnis höchst bedeutende Erzählung, entstanden aus der jahrzehntelangen Freundschaft zwischen dem Schamanen und dem Anthropologen Bruce Albert: Zwischen 1989 und 2001 führten sie in unregelmäßigen Abständen Gespräche auf Yanomami, die sie auf Tonband aufnahmen und die von Albert transkribiert wurden. Albert gelang dabei auf geniale Weise, die lebendige und schillernde Rede des Davi Kopenawa in einer ebenso luziden wie literarischen Sprache zu fixieren: In ihr wird das Leben der Yanomami greifbar, ihre Kosmologie und ihr Schamanismus, ihre Auffassungen über Verwandtschaft, Krieg, Anführerschaft und Redekunst. Kopenawa verflicht kunstvoll literarische Gattungen und wissenschaftliche Disziplinen. In seiner Rede drückt sich aus, wie verwoben persönliche Geschichte und kollektives Schicksal sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1470
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Sturz des Himmels
DAVI KOPENAWA
BRUCE ALBERT
Der Sturz des Himmels
Worte eines Yanomami-Schamanen
Aus dem Französischenvon Karin Uttendörfer und Tim Trzaskalik
Mit einem Vorwortvon Eduardo Viveiros de Castroaus dem brasilianischen Portugiesischvon Marie Trzaskalik
Inhalt
Editorische Vorbemerkung
Vorwort. Die Botschaft des Waldes
Vorbemerkung
Karten
Gegebene Worte
Anders werden
I. Schriftzeichnungen
II. Der erste Schamane
III. Der Blick der xapiri
IV. Die Tierahnen
V. Die Initiation
VI. Die Häuser der Geister
VII. Das Bild und die Haut
VIII. Der Himmel und der Wald
Metallschwaden
IX. Bilder von Fremden
X. Erste Kontakte
XI. Die Mission
XII. Ein Weißer werden
XIII. Die Straße
XIV. Den Wald träumen
XV. Erdesser
XVI. Das kannibalische Gold
Der Sturz des Himmels
XVII. Zu den Weißen sprechen
XVIII. Häuser aus Stein
XIX. Die Liebe zur Ware
XX. In der Stadt
XXI. Von einem Krieg zum anderen
XXII. Die Blüten des Traums
XXIII. Der Geist des Waldes
XXIV. Der Tod der Schamanen
Omamas Worte
Postskriptum: Wenn Ich ein anderer ist (und umgekehrt)
Anhang
I. Ethnonyme, Sprache und Rechtschreibung
II. Die Yanomami in Brasilien
III. Zu Watorikɨ
IV. Das Massaker von Haximu
Anmerkungen
Ethnobiologisches Glossar
Geografisches Glossar
Bibliografie
Thematischer Index
Index der schamanischen und kosmologischen Entitäten
Verzeichnis der Karten
Dank
Editorische Vorbemerkung
Das vorliegende Buch ist die deutschsprachige Übersetzung des 2010 in der Collection Terre Humaine bei Plon erschienenen Werks La chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami von Davi Kopenawa und Bruce Albert. Textgrundlage ist allerdings nicht diese Originalausgabe, sondern die 2014 bei Pocket erschienene Taschenbuchausgabe, für welche die Erstausgabe von den Autoren leicht überarbeitet wurde.
Das Vorwort, das Eduardo Viveiros de Castro zur 2015 erschienenen portugiesischen Übersetzung von Beatriz Perrone-Moisés (São Paulo: Companhias das Letras 2015) geschrieben hat, haben wir nach Rücksprache mit Bruce Albert in der Übersetzung von Marie Trzaskalik in die vorliegende deutsche Ausgabe aufgenommen. Die Bibliografie wurde entsprechend ergänzt und aktualisiert.
Im Zuge der Vorbereitung einer spanischen Ausgabe hat Bruce Albert im Frühjahr 2023 zahlreiche inhaltliche Aktualisierungen vorgenommen sowie insbesondere sein Nachwort und den Anhang zur Sprache der Yanomami zum Teil beträchtlich überarbeitet. Wir haben diese Aktualisierungen und Überarbeitungen bei unserer Übersetzung miteinbezogen.
Wo im französischen Original anthropologische, literarische oder philosophische Werke anderer Autorinnen und Autoren zitiert werden, haben wir uns bei ihrer Übersetzung an vorhandenen deutschsprachigen Übersetzungen orientiert, wobei wir diese mitunter modifiziert haben, was wir nur hier an dieser Stelle anzeigen.
Unser Dank gilt Marie Trzaskalik für ihre Übersetzung des Vorworts von Eduardo Viveiros de Castro sowie für ihre Hilfe zur Einbeziehung der Aktualisierungen und Überarbeitungen anhand der spanischen Ausgabe. Des Weiteren möchten wir uns bei Bruce Albert bedanken, der für unsere im Zuge des Übersetzens aufkommenden Fragen stets ein offenes Ohr hatte. Eine überaus wertvolle Hilfe war uns Gabriele Herzog-Schröder, die ihr reichhaltiges Wissen über die Yanomami großzügig mit uns geteilt und uns zahlreiche wichtige Hinweise und Ratschläge gegeben hat. Für ihre Unterstützung sind wir ihr sehr verbunden.
Karin Uttendörfer und Tim Trzaskalik,
Oktober 2023
Eduardo Viveiros de Castro
Vorwort. Die Botschaft des Waldes
Aus dem Portugiesischenvon Marie Trzaskalik
Doch da ich solchem wundersamen Ruf
die Antwort widerstrebend schuldig blieb –
[…]
während die Weltmaschine, die verstoßene,
sich wieder nach und nach zusammensetzte,
indessen, wägend, was mir nun verloren,
ich langsam weiterschritt, mit wiegenden Händen.1
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
Endlich erscheint in der eleganten Übersetzung von Beatriz Perrone-Moisés die portugiesische Ausgabe von Davi Kopenawas und Bruce Alberts Der Sturz des Himmels. Fünf Jahre sind ins Land gegangen seit der französischen Erstveröffentlichung in der seit sechzig Jahren bestehenden und prestigeträchtigen Schriftenreihe Terre Humaine, wo dieses Buch in einer Intensität erstrahlt, die vielleicht nur mit der des zweiten Bandes dieser Sammlung, Traurige Tropen2, vergleichbar ist – wobei Der Sturz des Himmels durchaus als eine starke Variante dieses Werkes angesehen werden kann, in dem Sinne, den der Autor der Traurigen Tropen in seiner strukturalen Mythologie diesem Wort verleiht. Oder, besser noch, das Buch von Kopenawa und Albert ist bezüglich seines illustren Vorgängers ein Beispiel für jene ›kanonische Verwandlung‹, die Lévi-Strauss als das dynamische Prinzip der Mythopoesis verstand, die »doppelte Umkehrung«, durch die sich die semiotische Notwendigkeit und die historische Kontingenz, die analytische Vernunft und die dialektische Vernunft komplizieren (und koimplizieren).3 Auch wenn sich dadurch Der Sturz des Himmels sehr von Traurige Tropen unterscheiden mag, so verbindet es ihn dennoch strategisch damit, und zwar auf unterschiedlichen Wegen. Aber keiner dieser Wege ist ein Rundweg, noch weniger ein gepflasterter, so wie im Fall der Emulationen oder Epigonen, die sich auf Traurige Tropen berufen haben. Selbst wenn Der Sturz des Himmels das mit dem revolutionären Werk von 1955 beginnende Projekt – die Erfindung einer narrativen Ethnologie, die zugleich poetisch, philosophisch, kritisch und reflexiv ist – zweifellos meisterhaft ergänzt, so belebt dieses Buch jenes Projekt doch auch gänzlich neu auf schwindelerregenden und spiralförmigen Pfaden (eine logarithmische Spirale, keine archimedische), die den anthropologischen Diskurs über die amerindianischen Völker verschieben, invertieren und erneuern, indem dessen methodologische und pragmatische Bedingungen der Äußerung neu definiert werden. »Caminhamos« –»Schreiten wir voran«.
Einige würden sagen, es hat gedauert bis zur Veröffentlichung von Der Sturz des Himmels in unserem Land4, in dem der Hauptautor geboren und das Buch quasi gänzlich ausgearbeitet wurde und auf das es sich zudem hauptsächlich bezieht. Aber für ein Werk von mehr als 900 Seiten, das über zwanzig Jahre gebraucht hat, um ausgetragen zu werden, über dreißig Jahre des Miteinanders der zwei Unterzeichner eines »ethnografischen Paktes« (in dem zwischen den Zeilen ein schamanischer Pakt geschlossen wird), das beispiellos in der Geschichte der Anthropologie ist und auf circa vierzig Jahren Kontakt des Ethnologen-Schriftstellers mit dem Volk des Schamanen-Erzählers beruht, sind fünf Jahre nicht besonders viel Zeit. Und die Zeit ist reif.
Ein Buch über Brasilien, über ein Brasilien – auch wenn es ausdrücklich um den existenziellen Werdegang von Davi Kopenawa geht, der als Denker und politischer Yanomami-Aktivist mit einem französischen Anthropologen spricht, um über die uralte Kultur und die jüngste Geschichte seines Volkes (sowohl in Brasilien als auch in Venezuela) nachzudenken, um den mythischen Ursprung und die unsichtbare Dynamik der Welt zu erklären, wobei Davi Kopenawa auch die ungeheuerlichen Züge der westlichen Zivilisation als ein Ganzes beschreibt und eine unheilvolle Zukunft für den Planeten kommen sieht – ein Buch über uns, ein Buch, das an uns, an die Brasilianer, die sich nicht als Índios ansehen, gerichtet ist. Denn mit Der Sturz des Himmels haben sich das Niveau und die Begriffe des ärmlichen Dialogs verändert, des sporadischen und sehr ungleichen Dialogs zwischen den indigenen Völkern und der nichtindigenen Mehrheit unseres Landes, die aus denen besteht, die Davi Kopenawa »Weiße« (napë)5 nennt. In diesem Dialog erfahren wir etwas Wesentliches über den ontologischen und ›anthropologischen‹ Status dieser Mehrheit – es sind kannibalische Gespenster, die ihre Herkunft und Kultur vergessen haben –, wo sie lebt – in hohen und schimmernden, auf einem nackten und unfruchtbaren Boden aufgestapelten Häusern aus Stein, in einer kalten und regnerischen Welt, unter einem Himmel in Flammen – und wovon sie träumt, entgeistert von einem grenzenlosen Verlangen – von ihren giftigen Waren und ihren leeren, auf Papierhäuten aufgezeichneten Worten. Diese Mehrheit, wie ich sagte, sind wir, unter anderem, wir, die ›legitimen‹ Brasilianer, die Portugiesisch als Muttersprache sprechen, die Samba mögen, Novela und Fußball, die es anstreben, ein ziemlich fetziges Auto zu haben, ein eigenes Haus in der Stadt und, wer weiß, eine Fazenda mit ihrem reichen Viehbestand und ihren endlosen Hektaren an Soja, Zuckerrohr oder Eukalyptus. Die Mehrheit dieser Mehrheit denkt zudem, dass sie in »einem Land, in dem es vorangeht«, lebt, wie schon der Jingle der Diktatur tönte, von der wir denken, dass sie einer hinfälligen Vergangenheit angehört.
Vom Standpunkt also der autochthonen Völker aus, deren Gebiete Brasilien ›eingegliedert‹ hat, sind die Brasilianer, die nicht Índios sind – so viel wir uns auch auf unsere einzigartige Kultur gegenüber Europa oder den Vereinigten Staaten einbilden mögen, wenn uns nicht genau das Gegenteil stolz macht –, lediglich »Weiße/Feinde« wie alle anderen napë, seien es Portugiesen, Nordamerikaner, Franzosen. Wir sind irgendwelche Repräsentanten dieses barbarischen und exotischen Volkes aus Übersee, das eine erstaunliche und absurde Unfähigkeit an den Tag legt, den Wald zu verstehen und wahrzunehmen, wahrzunehmen, dass die »Maschine der Welt« ein aus unzähligen Lebewesen zusammengesetztes Lebewesen ist, ein Superorganismus, der kontinuierlich erneuert wird von der wachsamen Aktivität seiner unsichtbaren Hüter, der xapiri, ›spiritueller‹ Bilder der Welt, die der hinreichende Grund und die Wirkursache dessen sind, was wir Natur nennen – auf Yanomami hutukara –, in die wir Menschen von Natur aus eingetaucht sind (der Pleonasmus rechtfertigt sich selbst). Die ›Seele‹ und ihre laizistischen, modernen Avatare, die ›Kultur‹, die ›Wissenschaft‹ und die ›Technologie‹, sie lösen uns weder von der Welt ab, noch erlösen sie uns von unserer unhintergehbaren Verpflichtung zur Welt6, auch deshalb nicht, weil die Welt, laut den Yanomami, ein animistisches plenum ist, und weil eine wirkliche Kultur und eine effiziente Technologie in der Herstellung einer von Aufmerksamkeit und Fürsorge geprägten Beziehung zur »mythischen Natur der Dinge«7 besteht – eine Qualität, die uns Weißen eben gerade fehlt. Mithin kann man von uns das sagen, was der Erzähler von den schlechten Yanomami-Jägern sagt – also von denjenigen, die die Angewohnheit haben, ihre Beute, die sie töten, für sich zu behalten (und deswegen fliehen die Tiere vor ihnen): »Ihre Augen mögen weit geöffnet sein, sehen tun sie nichts.« (Siehe unten, S. 595.) Und sollten sich die zu Recht pessimistischen Prophezeiungen von Davi konkretisieren, werden wir tatsächlich erst dann etwas sehen, wenn es nichts mehr zu sehen gibt. Dann werden wir also, wie der Dichter, abwägen, was wir verloren haben.
Ein trefflicher Ausdruck von Patrice Maniglier, mit dem dieser Philosoph definiert, was er als das allerhöchste Versprechen der Anthropologie bezeichnet, nämlich »uns ein Bild von uns selbst zurückzuspiegeln, in dem wir uns nicht wiedererkennen«8, erhält mit Der Sturz des Himmels einen sowohl symmetrischen als auch zuwiderlaufenden Sinn, der, weit davon entfernt, diese Definition in Abrede zu stellen, sie um eine zusätzliche, unerwartete, ironische Wendung anreichert. Es ist in der Tat unmöglich, uns nicht in dieser getreu entstellenden Karikatur unserer ›selbst‹ wiederzuerkennen, wie sie, zu unserer Verachtung, von diesem anderen ›Wir‹, diesem Anderen gezeichnet wurde, der uns dennoch mit Nachdruck darauf hinweist, dass wir am Ende des Tages (aber vielleicht auch erst am Ende des Tages) alle gleich sind, denn wenn der Wald am Ende sein wird und das Innere der Erde von den erzfressenden Maschinen vollständig zerstört, werden die Fundamente des Kosmos zusammenbrechen und der Himmel wird auf alle Lebewesen herabstürzen. Das ist schon einmal geschehen, erinnert der Erzähler. Was eine indianische Art und Weise ist zu sagen, dass es nochmals geschehen wird.
Der Sturz des Himmels ist unbestreitbar ein wissenschaftliches Ereignis, das, so vermute ich, einige Jahre brauchen wird, um von der anthropologischen Gemeinschaft angemessen aufgenommen zu werden. Aber ich hoffe, dass alle, die das Buch lesen, sofort das sehr viel umfassendere politische und spirituelle Geschehen sowie seine folgenschwere Bedeutung erkennen. Kurzum, es ist höchste Zeit; wir sind verpflichtet, absolut ernst zu nehmen, was uns die Índios durch Davi Kopenawas Stimme sagen – die Índios und alle anderen ›kleinen‹ Völker des Planeten, die extranationalen Minderheiten, die noch der totalen Auflösung durch den modernisierenden Mixer des Abendlandes standhalten. Für die Brasilianer, wie für die anderen Nationalitäten der Neuen Welt, die auf Kosten des amerikanischen Genozids und der afrikanischen Sklaverei aufgezogen wurden, drängt sich eine solche Verpflichtung mit doppelter Kraft auf. Denn wir haben schon zu viel Zeit mit unserem nur auf uns selbst gerichteten Geist verbracht, abgestumpft von den alten, immergleichen, auf den Karavellen mitgebrachten Träumen von Gier und Eroberung und Imperium, jedes Mal »voller Vergessen«9 im Kopf, in eine düstere existenzielle Leere getaucht, im Laufe unserer wenig ruhmreichen Geschichte nur ab und zu erleuchtet durch ein Aufblitzen von politischer und poetischer Klarheit. Davi Kopenawa hilft uns, die berühmten »verlegten Ideen« an den richtigen Ort zu bringen, denn sein Diskurs ist ein Diskurs über den Ort, und das Subjekt der Äußerung dieses Diskurses weiß, welcher Ort der seine ist, wo er ist und was er ist. Höchste Zeit also, dass wir uns mit den Ideen dieses Ortes auseinandersetzen, den wir mit Eisen und Feuer den indigenen Völkern genommen und ohne geringste Scham als »unseren« ausgerufen haben; Ideen, die vor allen Dingen eine globale Theorie des Ortes bilden, lokal erzeugt von den Indigenen, im konkreten und etymologischen Sinne dieses letzten Wortes.10 Eine Theorie darüber, was es bedeutet, an seinem Ort zu sein, auf der Welt als Haus, Schutz und Umwelt, oikos, oder, um die Begriffe der Yanomami zu benutzen, hutukara e urihi a: die Welt als ein fruchtbarer Wald, von Leben überquellend, die Erde als ein Wesen, das ein Herz hat und atmet, wie es im Epigraf zu Kapitel XXIII heißt (s. u., S. 588), nicht als ein Lager mit in den Tiefen eines giftigen Untergrunds verborgenen ›knappen Ressourcen‹ – mineralische Massen, vom Demiurgen in der Unterwelt gelagert, damit sie dort belassen werden, denn sie sind die Fundamente, die Pfeiler des Himmels; und die Welt auch als diese andere Erde, jenes himmlische ›Supraerdreich‹, das die zahlreichen transparenten Wohnstätten der Geister trägt, und nicht wie dieser ›Niemandshimmel‹, dieser kosmische Sertão, den die Weißen zu erobern und zu kolonisieren träumen – unheilbar, wie sie sind. Darum sagt Davi Kopenawa, dass die Idee-Sache »Ökologie« immer Teil seiner Theorie-Praxis des Ortes war:
Im Wald sind wir, die Menschen, die Ökologie! Aber genauso wie wir sind die xapiri, das Wild, die Bäume, die Flüsse, die Fische, der Himmel, der Regen, der Wind und die Sonne Ökologie! Sie umfasst alles, was im Wald ins Dasein gelangt ist, weit weg von den Weißen, alles, was noch nicht von Zäunen eingeschlossen ist. Die Worte der Ökologie, das sind unsere alten Worte, jene, die Omama unseren Vorfahren gegeben hat. Die xapiri verteidigen den Wald, seit er existiert. Und weil sie sie besitzen und an ihrer Seite haben, haben unsere Vorfahren den Wald nie verwüstet. Ist der Wald nicht immer noch so lebendig? Die Weißen, die früher von all diesen Dingen nichts wussten, fangen jetzt an, sie zu hören. Deshalb haben einige von ihnen neue Worte erfunden, um den Wald zu schützen. Sie nennen sich jetzt »Leute der Ökologie«, denn sie sind in Sorge, dass ihr Land, ihre Erde immer heißer wird. […] Wir sind Bewohner des Waldes. Wir wurden im Zentrum der Ökologie geboren und sind dort aufgewachsen. (Siehe unten, S. 603 f., Hervorhebung E. V. C.)
Die Welt also gesehen – oder besser, gelebt – von hier aus, dem ›Zentrum der Ökologie‹, dem indigenen Herzen dieser ausgedehnten und unbegrenzten kosmopolitischen Erde, wo sich unzählige Erdlinge nomadologisch verteilen11, und nicht als eine abstrakte Sphäre, ein von außen gesehener Globus, von den Nationalstaaten eingezäunt und in Verwaltungsgebiete aufgeteilt, Skizzen der euroanthropozentrischen Halluzination, bekannt unter Namen wie »Souveränität«, »Vorherrschaft«, »geopolitische Projektion« und Phantasmagorien ähnlichen Kalibers. Vielleicht ist es tatsächlich höchste Zeit zu schlussfolgern, dass wir das Ende einer Geschichte erleben, der des Abendlandes, einer von den europäischen Mächten, ihren ehemaligen amerikanischen Kolonien und ihren zeitgenössischen asiatischen Widersachern aufgeteilten und imperialistisch angeeigneten Welt. Es würde uns folglich zustehen zu konstatieren und von da aus die angemessenen Konsequenzen zu ziehen: »Das Nationale gibt es nicht mehr, es gibt nur noch das Lokale und das Globale.«12 Man wird sagen, dass eine solche Aussage das Gerede eines dekadenten Europäers ist, die Fantasie eines romantischen ›Lokalisten‹, das Mantra eines unverantwortlichen Anarchisten, wenn nicht sogar, Gott bewahre uns, ein Rülpser des ›Libertarismus‹ nach amerikanischer Art, dieses schrecklichen suprematistischen Faschismus des weißen, machistischen, bewaffneten Individuums, das in unserem großen Bruder aus dem Norden wütet. Was uns Brasilianern zusteht – sagen wir es mit erhobenem Haupt –, ist, das Sozialistische Vaterland der Zukunft zu errichten, das versprochene Land der glücklichen Mittelschicht, unterstützt von einem starken Staat, der in der Lage ist, es vor der internationalen Gier zu beschützen13, oder, um ›proaktiv‹ zu sein, es dem erlesenen Club der Besitzer dieser Welt beitreten zu lassen. Aber, wenn das Nationale tatsächlich – warten wir es ab – dort draußen zu existieren aufhört (nur dass es dort draußen nie gegeben hat, denn das hier drinnen war immer und wird immer ein ›Ableger‹ des dort draußen sein), ist es wahrscheinlich, dass das Konzept des Nationalen letzten Endes auf der ganzen Welt den Ort wechseln wird, das heißt, den Sinn, und dies sogar ›hier drinnen‹. Zumindest werden wir uns vielleicht bewusst, dass, wenn wir weiterhin stur das Lokale zerstören, dieses Lokale der Welt, das wir ›unseres‹ nennen – aber wem steht, jenseits des bloßen pronominalen Anspruches, das auf brutale Weise Besitz beanspruchende Recht dieses Possessivpronomens zu? –14, weder mehr Fonds noch Fundamente übrig bleiben, um was auch immer für ein anachronistisches oder futuristisches Nationales aufzubauen. Brasilien ist groß, aber die Welt ist klein.
Der Sturz des Himmels ist reich an Lektionen, unter anderem über die effiziente Inkompetenz, die bösartige Irrelevanz, den närrischen Chauvinismus der Theorie und Praxis der ›nationalen‹ Staatlichkeit, dieses antinomischen nomos, der einen Raum, den er einzurichten glaubt, während er von ihm in Wirklichkeit getragen wird, gleichzeitig zerfurcht und verwüstet. Der Nationalstaat? Sehr gut, sehr schön; aber lange vor ihm gibt es die unsichtbaren Geister des Waldes, die metallenen Fundamente der Erde, den teuflischen Rauch der Epidemien und die degenerative Krankheit des Himmels – und nichts davon hat Grenzen, Barrieren oder Banner. Die Schamanen und ihre xapiri15 haben keine von Menschen ausgestellten Reisepässe und kein Visum; sie sind es, die sehen, ob sie gut gesehen werden von den allsehenden, unsichtbaren Lebewesen des Waldes …16 Brasilien? Das Brasilien, in dem so schönen und melancholischen Bild von Oswald de Andrade, war schon einmal eine »föderative Republik voller Bäume und Menschen, die Lebewohl sagen«. Heute gleicht es eher einem Wirtschaftskonzern, der, so weit das Auge reicht, von genverwandelten und agrotoxischen Monokulturen bedeckt ist, durchzogen von Hügeln, die zu unförmigen Löchern umgekehrt wurden, in denen Hunderte Millionen Tonnen Erz für den Export abgebaut werden, bedeckt von einer dicken Ölwolke, die unsere Städte erstickt, während wir Rekorde in der Automobilproduktion verkünden, verstopft von Tausenden von Kilometern an Flüssen, die aufgestaut wurden, um Energie von zweifelhafter ›Sauberkeit‹ und zu noch zweifelhafteren Zwecken zu erzeugen, gebrandmarkt von ländergroßen Wald- und Savannengebieten, die abgeholzt wurden, um 221 Millionen Rindern (die heute zahlreicher sind als unsere menschliche Bevölkerung) Weidefläche zu bieten.17 Und wir? Wir sagen weiter Lebewohl – den Bäumen. Lebewohl ihnen und der Republik, zumindest in ihrem ursprünglichen Sinn als res publica, Sache und Anliegen des Volkes.
***
Die Zeugenaussage-Prophezeiung von Kopenawa erscheint somit zur rechten Zeit; denn diese Zeit ist selbstverständlich furchtbar. Jetzt, in dieser Republik, mit dieser Regierung, sind wir Zeugen abgekarteter politischer Machenschaften, die Umweltschutzgebiete, Quilombola-Gemeinden, Rohstoffreserven und insbesondere indigene Territorien zur Zielscheibe haben. Das Ziel ist die ›Befreiung‹ (die juristische Preisgabe) möglichst vieler staatlicher Flächen oder, allgemeiner ausgedrückt, all jener Gebiete, die unter traditionellen oder populären Territorialisierungsregimen stehen und außerhalb des unmittelbaren Kreislaufs des kapitalistischen Markts und der Logik des Privateigentums bleiben; und all das auf eine Art und Weise, in der diese Flächen ›produktiv‹, das heißt lukrativ für die großen Geschäftsleute der Agrarindustrie, des Bergbaus und der Bodenspekulation werden, von denen viele selbst im Kongress sitzen oder ihre Marionetten dafür bezahlen, dort für sie zu sitzen. In Wirklichkeit sind es die Drei Mächte unserer föderativen Republik, die schon seit Langem eine kriminelle Offensive gegen die indigenen Rechte führen18, Rechte, die schwer erkämpft wurden im Jahrzehnt zwischen 1978, dem Jahr des ›Projekts der Emanzipation‹ der Diktatur (das auf spektakuläre Weise schiefgelaufen ist), und 1988, dem Jahr der ›Constituição cidadã‹, der ›staatsbürgerlichen Verfassung‹, die die ursprünglichen Rechte der indigenen Völker über ihre Territorien anerkannte und damit das Instituto fundamental do indigenato verewigte. Diese Einbeziehung der Índios als differenzierte, soziokulturelle Kategorie mit vollen und permanenten Rechten in der Nation hat eine wilde Entschlossenheit zur Vergeltung seitens des Systems der Großgrundbesitzer hervorgerufen, die heute mehrere Minister stellen, den Kongress kontrollieren und über eine Legion an Schergen im Gericht verfügen. Von allen Instanzen und von allen Seiten der konstitutiven Mächte gehen Versuche aus, die Konstitution, die sie konstituiert hat, zu entstellen, mittels legislativer Projekte, exekutiver Winkelzüge, gerichtlicher Entscheidungen19, die in dem Vorhaben konvergieren, den Geist jener Artikel, die in dieser Konstitution die indigenen Rechte20 garantieren, auszulöschen.
Die jetzige Regierung21, ich beziehe mich hier auf die Exekutive, von ihrer Oberbefehlshaberin bis zu ihren ministeriellen Anordnungen, stellt unter Beweis, dass es, seit unserer schüchternen Redemokratisierung, in Bezug auf die Wahrung dieser Rechte möglich ist, die bereits schlechte Verwaltung ihres Vorgängers noch zu übertreffen: praktisch gar keine Verfahren mehr zur Demarkation und Homologierung von indigenen Territorien; eine so gut wie inexistente, desaströse Gesundheitspolitik für die indigenen Gemeinschaften; eine beinahe von der Mittäterschaft ununterscheidbare Gleichgültigkeit in Bezug auf den kontinuierlich und vor aller Augen begangenen Genozid an den Guarani-Kaiowá oder zeitweise und ›aus Achtlosigkeit‹ an den Yanomami und anderen nativen Völkern sowie das methodische Ermorden der indigenen Anführer und der Umweltschützer im ganzen Land – eine Praxis, in der Brasilien, wie man weiß, Weltmeister ist.
Schlussendlich, aber darum nicht weniger beklagenswert, wäre da noch das Kronjuwel der höchsten Dienerin der Republik, das ständige Bauen durch privatkapitalistische Megabauunternehmen, wobei dieses Privatkapital den Behörden dient und/oder umgekehrt, wie auch die Gesetzgebung ihm dient, wenn sie ein schamloses Erschaudern vorspielt, wo es darum geht, die Kosten von ›Finanzierungen‹ in obszönen Dimensionen abzuwägen, zulasten des sogenannten Geldes des Volkes, zum Bau von zahllosen Staudämmen im Amazonasbecken, die schwerwiegende Schäden mit sich bringen für das Leben von Hunderten indigenen Völkern und Tausenden traditionellen Gemeinschaften22 – um nicht von den Zehntausenden23 anderen Spezies von Waldbewohnern zu sprechen, die in ihm leben, von ihm und mit ihm; die letztlich der Wald selbst sind, das Makrobiom oder das autotrophe Megarhizom, das ein Drittel Südamerikas bedeckt und dessen logisch-metaphysische Struktur, wenn ich mir den Ausdruck erlauben darf, Kopenawa in Der Sturz des Himmels klar und deutlich dargestellt hat. Aber was nützt das alles angesichts der unerbittlichen Gesetze der Weltwirtschaft und des höchsten Ziels des Fortschritts des Vaterlandes? Die wachsende Entropie verwandelt sich auf dialektische Weise in triumphierende Anthropie. Und man sagt immer noch, dass es die indigenen Völker sind, die an unmögliche Sachen glauben.
Kurzum, was die Unternehmer-Militär-Diktatur nicht geschafft hat, dem Erdboden gleichzumachen, zerstört die von der … Arbeiterpartei! geführte Koalition mit erschreckender Effizienz. Ihr materielles Instrument sind gleichwohl dieselben politisch-ökonomischen Kräfte, die das Machtprojekt der Diktatur unterstützt und finanziert haben. Diese destruktive ›Effizienz‹, wohlgemerkt, ist weit entfernt von der marxistischen und schumpeterianischen »schöpferischen Destruktion«, was auch immer das in den dunklen heutigen Zeiten noch wert sein mag. Es gibt absolut nichts Schöpferisches oder Kreatives in dem, was die herrschende Klasse und ihr Exekutivorgan im Amazonasgebiet tun. Was ihr an Intelligenz und Umsicht abgeht, macht sie wett mit Habgier und Gewalt.
Die Invasionen der Goldsucher in die Territorien der Yanomami – und ihre Konsequenzen: die Epidemien, Vergewaltigungen, Morde, die Vergiftung der Flüsse, die Dezimierung des Wildbestands, die Zerstörung der materiellen Grundlagen und moralischen Fundamente der indigenen Wirtschaft – folgen in monotoner Häufigkeit aufeinander, je nach den Schwankungen des Goldkurses und anderer wertvoller Erze auf dem Weltmarkt. Am Tage selbst, an dem ich diesen Absatz schreibe (7. Mai 2015), lese ich die Nachricht, dass eine »kriminelle Goldextraktionsorganisation« im Yanomami-Territorium, die mehr als eine Billion Reais in den letzten zwei Jahren bewegt hat, von der Bundespolizei aufgedeckt wurde (in einem noch nie zuvor existierenden Eifer an Effizienz, der schon seine Gründe haben wird). Bei diesen kriminellen Machenschaften waren lokale Beamte beteiligt – unter ihnen auch Beamte von der FUNAI, Juweliere aus den großen Städten im Amazonasgebiet dienten als Vermittler und »Unternehmer aus diesen Bereichen, vor allen Dingen aus São Paulo« als Finanzierer.24 Davi Kopenawa wurde kontinuierlich mit dem Tod gedroht, und das seit mindestens 2014, weil er diese Situation denunzierte. Und wie in diesem Buch zu lesen sein wird (siehe vor allem Kapitel XV), waren es seine fassungslose Bestürzung, während er als Zeuge die vom Goldrausch in den Yanomami-Territorien ausgelösten und aufeinanderfolgenden Katastrophen zwischen 1975 und 1990 miterlebte – nach dem schlecht-unvollendeten Bau der Perimetral Norte in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre bis zur massiven, vom Militär angestachelten Goldgräberinvasion ab der Einführung des Projektes Calha Norte während der Sarney-Regierung im Jahr 1985 –,25 waren es diese Wut und diese Perplexität, in militante Überzeugung umgewandelt26, die Kopenawa dazu gebracht haben, sich in seiner doppelten Position als Schamane und Diplomat zu engagieren (es handelt sich, wie wir sehen werden, um ein und dieselbe Position). Er hat so die Polarität seiner Funktion als Dolmetscher in Diensten der Weißen, die er einige Zeit als Angestellter der FUNAI ausübte, invertiert, um ein Dolmetscher und permanenter Verteidiger seines Volkes gegen die Weißen zu werden, wie es Albert scharfsinnig beschreibt.27
Das Garimpo-System ist dem des Drogenhandels ähnlich und letztlich die geopolitische Taktik des Kolonialismus schlechthin: Die schmutzige Arbeit wird von den elenden, gewalttätigen und verzweifelten Menschen erledigt, aber wer das Dispositiv finanziert und kontrolliert und naturgemäß den Gewinn einheimst, der lebt bequem und in Sicherheit, weit weg von der Front, von höchst diversen Immunitäten geschützt. Im Falle der Goldsucher bei den Yanomami sind an dem Dispositiv, wie in diesem speziellen Umfeld offenkundig jeder weiß, wichtige Politiker aus Roraima beteiligt, einige von ihnen hervorstechende Verteidiger, im Kongress, der in Bezug auf die indigenen Gebiete ›liberalisierenden‹ Reformen der Bergbaugesetze. Diese Mächtigen tauchen nicht in den Nachrichten über das Aufdecken der jüngsten kriminellen Umtriebe auf. Ich bezweifle, dass sie jemals auftauchen werden. Wer weiß, vielleicht existieren sie gar nicht. Die Leute denken sich ja so allerhand aus …
Aber wir besitzen nicht die Exklusivität des Schlechten; unsere ethnozidäre, ökozidäre und letztlich suizidäre Dummheit ist nicht einmal originell. Die internationale Konkurrenz ist allzu groß. Die Diagnose und die Prognose, die in Der Sturz des Himmels enthalten sind, betreffen nicht nur die Brasilianer. Zurzeit wohnen wir einer Veränderung des globalen thermodynamischen Gleichgewichts bei, wie es sie in den letzten elftausend Jahren der Geschichte des Planeten nie gegeben hat, und mit ihr verbunden einer nie zuvor in der menschlichen Geschichte existenten geopolitischen Beunruhigung – wenn (noch) nicht in der Intensität, dann sicherlich in der Ausdehnung, sofern diese ganz wörtlich ›alle Welt‹ betrifft. Zurzeit gibt es also nichts, was angebrachter wäre als eine aus der Abgeschiedenheit der Welt, aus diesem indigenen Amazonien, das den aufeinanderfolgenden Überfällen noch standhält, wenn auch abgeschwächt zu uns dringende Nachricht, eine Prophezeiung der Yanomami, eine Botschaft des Waldes, die uns vor dem Verrat warnt, den wir an unseren Landsleuten begehen – an unseren Miterdlingen, unseren Mitlebenden – sowie an der nächsten Generation an Menschen; und demzufolge an uns selbst. Was wir in Der Sturz des Himmels lesen, ist der erste systematische Versuch einer »symmetrischen Anthropologie« oder einer »Gegenanthropologie«28 des Anthropozäns, der gegenwärtigen geologischen Epoche, die nach der wachsenden, einvernehmlichen Meinung der Spezialisten das Holozän abgelöst hat und in der die Auswirkungen der menschlichen Aktivität – es versteht sich von selbst, dass damit die auf fossiler Energie und auf dem exponentiell wachsenden Konsum von Raum, Zeit und Rohstoffen basierende Industriewirtschaft gemeint ist – die Dimension einer physischen Stärke angenommen hat, die den Planeten dominiert, abgesehen vom Vulkanismus und von den tektonischen Bewegungen. Der Sturz des Himmels, der zugleich eine Erklärung der Welt aus Sicht einer anderen Kosmologie und eine Charakterisierung der Weißen aus Sicht einer anderen Anthropologie (einer Gegenanthropologie) ist, verflicht diese zwei Stränge, um zu der Schlussfolgerung einer unmittelbar bevorstehenden Zerstörung der Welt zu gelangen, einer Zerstörung durch die Zivilisation, die sich für die Wonne der Menschheit hält – Leute, die sich von jedem ›rückständigen Aberglauben‹ und von jedem ›primitiven Animismus‹ befreit haben, die nur auf die heiligste Dreieinigkeit von Staat, Markt und Wissenschaft schwören beziehungsweise auf Vater, Sohn und Heiligen Geist der modernistischen Theologie.29 Im Übrigen wird solch ein fanatischer Glaube den indigenen Völkern in der Regel mit einem seltsamen Instrument in den Rachen gestopft, einem Instrument, das zugleich archaisch und modernisierend ist, mit dem Teosi (Gott) der evangelikalen nordamerikanischen Missionare, die Davi nur allzu gut kennengelernt hat, diese unausstehlichen Agenten des Telemarketings des Kapitals.
Ein weiterer Grund, sich daran zu erfreuen, dass Der Sturz des Himmels für die brasilianischen Leser genau zur richtigen Zeit zugänglich wird, ist, dass er das hiesige Erscheinen des jüngsten Ergusses einer bedauerlichen Persönlichkeit der amazonischen Anthropologie kompensiert oder, besser noch, demoralisiert. Ich meine hier das kürzlich erschienene Buch von Napoleon Chagnon, einem Protagonisten in den ›kontroversen‹ Episoden der Geschichte der Beziehung zwischen den Yanomami und der abendländischen Wissenschaft, Episoden, von denen das Mindeste, was man von ihnen sagen kann, ist, dass in ihnen bestimmte ethische Basisprotokolle der Forschung geschändet wurden. Wie der Sensationalismus verkaufen sich die reaktionäre Dummheit und das rassistische Vorurteil sehr gut, das Buch von Chagnon, 2013 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, hat nicht lange gebraucht, um in Brasilien übersetzt und mit angemessenem Paukenschlag von der verantwortlichen Firma positioniert zu werden.30 Die Erinnerungen des Anthropologen Chagnon, der im Gegensatz zum Koautor von Der Sturz des Himmels jeglichen relevanten Kontakt zu den Yanomami schon seit, tja, Jahrzehnten abgebrochen hat, bestehen hauptsächlich aus einer langen, gekränkten Selbstverteidigung, einem Begleichen von Rechnungen mit seinen Kritikern, die er dadurch zu erledigen glaubt, dass er sie als »Linke« bezeichnet, und einem neuerlichen Abspulen seiner theoretischen Dogmen, deren angeblich ethnografische und statistische Evidenzen von einer Menge an Wissenschaftlern widerlegt wurden. Als Meister einer der am wenigsten ausgearbeiteten Versionen der humanen Sozialbiologie, einer Disziplin (?), die in der Regel nicht einmal zu beeindrucken vermag, weder was die aufgestellte Theorie noch was die Fruchtbarkeit ihrer Vermutungen betrifft, hat Chagnon ein Bild der Yanomami als »wildes Volk« (Titel seines berühmtesten Buches) verbreitet, als ein Stamm voller dreckiger, primitiver und gewalttätiger Leute, echte Nebenfiguren eines hobbesschen Grand-Guignol. Solch ethnozentrische Klischees wurden wiederholt von den vielen Agenten der Weißen – Bürokraten, Missionare, Politiker – gegen die Yanomami verwendet, in der Absicht, ihnen das Land und/oder die Seele zu rauben. Der nordamerikanische Wissenschaftler vertritt die These, neben anderen bizarren Vorstellungen, dass das Volk von Davi Kopenawa aus genetischen Automaten bestehe, die von dem Imperativ der Maximierung des reproduktiven Potenzials der großen ›Töter‹ angetrieben seien, also der Männer, die die größte Anzahl im Kampf getöteter Feinde vorzuweisen haben. Dass es sich dabei um ein groteskes Missverständnis der Kriegsbräuche der Yanomami handelt, ist bewiesen, denn diese Bräuche haben nichts mit genetischen Konditionierungen zu tun, aber alles mit einem ausgereiften soziopolitischen System und mit einem rituellen Bestattungsdispositiv von großer symbolischer Dichte, wobei beide auf ihre Art mit einer Vision von Leben und Tod zusammenhängen, von Raum und Zeit, der menschlichen Physiologie und der kosmischen Skatologie, von der wir eine Vorstellung bekommen können, wenn wir die großartigen Darstellungen in diversen Kapiteln von Der Sturz des Himmels lesen.31 Die Bücher von Chagnon sind in den Einführungskursen der Anthropologie an den Universitäten der Vereinigten Staaten sehr populär – nicht zufällig, da ihre ›Yanomami‹ bestimmten männlich-dominanten Modellen in diesem Land sehr viel ähnlicher sind als die homonymen Índios. Der Autor wurde ebenfalls zu einer Art Maskottchen der stumpfsinnigsten szientistischen Strömung der nordamerikanischen Akademie, in der, zwischen Vertretern der Big Science und Nostalgikern des kalten Kriegs, Psychosoziobiologen mit zweifelhaften Zertifikaten prahlen, Vulgarisierer, die darauf spezialisiert sind, die darwinistische Theorie zu verdrehen und sie in eine Apologie des ›rugged‹ Individualismus zu verwandeln: eine Rechtfertigung der männlichen Domination und, mehr oder weniger verstohlen, des Rassismus. Es bleibt nur zu hoffen, dass das Buch von Kopenawa und Albert, das schon in den Vereinigten Staaten übersetzt ist, als Gegengift zu diesem Festival des reaktionären Jokus dienen möge. Und dass die brasilianische Ausgabe von Der Sturz des Himmels die Verbreitung eines solchen Irrwitzes hier in der Gegend ein wenig erschweren möge, im Lande der Pondés, der Narloch, der Reinaldos Azevedos und der Rodrigos Constantinos.
Der Sturz des Himmels wird eine Wasserscheide sein, wie ich schon sagte, was die intellektuelle und politische Beziehung zwischen Índios und Nichtíndios in Amerika betrifft. Es stimmt, dass es nicht an Büchern über indigene Memoiren mangelt, im weiten oder engen Sinne des Wortes, sowohl Auto- als auch Heterobiografien, vor allen Dingen von Angehörigen der Völker Nordamerikas.32 Den Landsleuten von Davi Kopenawa selbst liegt ein wichtiger autobiografischer Bericht vor, und zwar von Helena Valero, einer jungen Frau des Baré-Volkes, die von einer Yanomami-Gemeinschaft im Jahre 1936 gefangen genommen wurde und mit ihnen mehrere Jahre zusammenlebte.33 Erwähnenswert sind auch die vielen wertvollen Zeugenaussagen und Berichte, die das Instituto Socioambiental über die indigenen Sichtweisen zu Herkunft und Natur der Weißen (Ricardo, Org., 2020) veröffentlicht hat, oder das jüngste Buch mit Interviews von Ailton Krenak (2015), einem anderen herausragenden indigenen Anführer und Denker, dessen Lebensweg signifikante Unterschiede zu dem von Kopenawa aufweist, was beide nicht davon abhält, seit Jahrzehnten Seite an Seite an derselben Front zu stehen.
Aber Der Sturz des Himmels ist ein bunt gemischtes und komplexes ›Objekt‹, wie es nie zuvor existiert hat, quasi einzigartig in seinem Genre. Denn dieses Buch ist gleichzeitig: eine singuläre Biografie eines außergewöhnlichen Individuums, eines indigenen Überlebenden, der etliche Jahre unter den Weißen gelebt hat, bis zur Wiedereingliederung in sein Volk und der Entscheidung, Schamane zu werden; eine detaillierte Beschreibung der poetisch-metaphysischen Fundamente einer Weltanschauung, deren Weisheit wir gerade erst anfangen anzuerkennen; eine leidenschaftliche Verteidigung des Existenzrechts eines nativen Volkes, das von einer zivilisatorischen, unermesslich mächtigeren Maschine verschluckt wird; und, schließlich, eine schlagfertige und sarkastische Gegenanthropologie der Weißen, des »Volks der Ware«34 und seiner krankhaften Beziehung zur Erde – einem Diskurs entsprechend, den Albert (1993) lapidar als eine »schamanische Kritik der politischen Ökonomie der Natur« charakterisiert hat.
Das Buch hebt sich von seinen vermeintlichen Artgenossen ab, insbesondere wegen der unerhörten Dichte und Solidität seines Erstellungskontextes: Eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht, in einem ›zwischenbiografischen‹ Dialog, der auch die Geschichte eines politisch konvergenten Projektes ist, zwischen einem indigenen Denker mit einer langen und schmerzhaften, ›pragmatischen‹ (aber auch intellektuellen) Erfahrung der Welt der Weißen, einem scharfsinnigen Beobachter unserer Besessenheit und Mängel, und einem Anthropologen mit einer langen ›intellektuellen‹ (aber auch praktischen) Erfahrung (nicht frei von Schwierigkeiten) der Welt der Yanomami – dem Autor, der dieses vierhändige Werk unter anderem auch deshalb erschaffen konnte, weil er bereits über ein ethnografisches Wissen verfügte, das er in Arbeiten unter Beweis gestellt hat, die längst zu den wichtigsten Studien über die Völker des Amazonasgebietes zählen, und dessen Biografie in seiner Weigerung, sich von der akademischen Karriere gefangen nehmen zu lassen, fast so ›anomal‹ ist wie die des Schamanen-Erzählers. Auf eine Unterscheidung zurückgreifend, die mir von Vinciane Despret vorgeschlagen wurde, um ein ähnliches Problem zu denken, kann man sagen, dass weder Kopenawa noch Albert wirklich repräsentativ für ihr Milieu und ihre ursprünglichen soziokulturellen Repertoires sind – Amazonasgebiet und Yanomami-Schamanismus, Europa und französische, universitäre Anthropologie –, dass es aber genau diese Kondition von Sprechern in atypischer Position ist, grenzgängerisch oder ex-zentriert, die sie zu idealen Repräsentanten ihrer jeweiligen Traditionen werden lässt, in der Lage zu zeigen, wozu sie wirklich in der Lage sind, sobald sie sich befreit haben von dem Mit-sich-selbst-Beschäftigtsein und dem kosmologischen ›Monolinguismus‹; wenn, in anderen Worten, diese Traditionen gezwungen sind – durch die historischen Gegebenheiten und die Charakterstärke des Protagonisten einerseits, durch den existenziellen Kompromiss seines Mitarbeiters anderseits –, die interkulturelle Differenz auszuhandeln, bis zu dem Punkt einer gegenseitigen und ungemein wertvollen ›Zwischenübersetzung‹, die umso wertvoller ist, je mehr sie sich ihrer Unvollkommenheiten bewusst ist, ihrer zwiespältigen Annäherungen, ihrer unmöglichen Äquivalenzen und, alles in allem (diese Schlussfolgerung habe allein ich zu verantworten), ihrer absoluten metaphysischen und anthropologischen Unverträglichkeit, die nur, so fürchte ich, mit der materiellen oder spirituellen Zerstörung der Ursprungszivilisation des einen oder des anderen Gegenübers zu überwinden sein wird. Und wie ich es schon in einer Fußnote weiter oben angedeutet habe, ist keineswegs klar, welche von beiden zuerst zusammenbrechen wird unter den unvorstellbaren materiellen Bedingungen, die uns in den »Zeiten der Katastrophen«, der »kommenden Barbarei«, erwarten.35
Herausragend an diesem Buch ist auch seine Fröhlichkeit in den im eigentlichen Sinne übersetzerischen Entscheidungen, sowohl diejenigen, die versuchen, die große Distanz zwischen ›Enzyklopädie‹ und ›Semantik‹ der jeweiligen Sprachen-Kulturen zu überwinden, als auch diejenigen, die die Konventionen der Textualisierung eines mündlichen Diskurses, seine enunziative Verkettung und die pragmatischen und metapragmatischen Dimensionen des Textes betreffen. Diese Entscheidungen diskutiert Albert ausführlich in seinem Postskriptum, einem Teil von Der Sturz des Himmels, der aufgrund seines kritisch-reflexiven Inhalts und seiner metatextuellen ›Mise-enabyme‹-Perspektive besondere Aufmerksamkeit verdient – Aspekte, die unmittelbar die Ethnografen angehen, und alle, deren Beschäftigung im weitesten Sinne das Vermitteln ist, also das Verwandeln des fremden Wortes. Das Postskriptum zeichnet die Geschichte des Paktes nach, der zu diesem Buch geführt hat, des Paktes zwischen dem Koautor und Davi Kopenawa. Bruce Albert gedenkt erneut der Peripetien einer Berufung und der Wechselfälle einer Feldforschung, die hauptsächlich während der düsteren Zeiten unserer Militärdiktatur unternommen wurde, als Anthropologen – diese Kommunisten und Kiffer, die unter wilden Binationalen leben – ganz und gar nicht willkommen waren, und noch weniger, wenn es sich um Ausländer handelte; und er webt überaus stichhaltige Reflexionen über die Bedingungen eines postkolonialen ethnografischen Schreibens, sowohl vom politisch-diplomatischen Standpunkt seiner Möglichkeit und Pertinenz aus als auch von dem rhetorisch-epistemischen seines Stils, in jedem möglichen Sinn dieses letzten Wortes.
Ich sehe voraus, dass die ›soziologischen‹ Kritiker, diejenigen, die unentwegt schreiben und sich nicht um das Paradox der Textualisierung scheren – die eingipsende Einschreibung und Übersetzung einer flüssigen, vibrierenden, ›authentischen‹ Oralität (die, so vermute ich, idealerweise in der Lage sein sollte, sich telepathisch auf eine ebenfalls monosprachliche Zuhörerschaft zu übertragen) –, in diesem Buch eine gute Dosis an ›Künstlichkeit‹ sehen werden, da Kopenawas hier veröffentlichtes Narrativ das Ergebnis einer fürsorglichen Kompositionsarbeit ist – wie es, o welch ein Wunder!, jedes Schreiben, ganz gleich welcher Art, ob ethnografisch, biografisch, fiktional, bestenfalls immer ist. Was wir vor uns haben, ist eine Ausgabe Tausender Seiten mit im Laufe von zwölf Jahren und zu verschiedensten Anlässen aufgenommenen und transkribierten Gesprächszyklen, explizit rekonstruiert, zusammengefasst und homogenisiert; ein französischer (portugiesischer) Text, der versucht, die charakteristischen Wendungen und Manierismen der Ursprungssprache beizubehalten, aber jegliche pittoreske ›Primitivisierung‹ der Zielsprache verweigert – und im Gegenteil deren Standardprosa poetisch und rhythmisch erneuert. Schließlich sticht ein in Kapitel eingeteilter Aufbau hervor, der einer rigorosen Symmetrie gehorcht, die zwischen zahlreichen Kapiteln interne Resonanzen erzeugt und das Buch zu einem Triptychon entfaltet, dessen Hauptgemälde – das die katastrophische Kollision der Yanomami mit den Weißen schildert und die Art und Weise, wie diese ›Fehlbegegnung‹ das Leben und die Berufung des Erzählers geprägt hat – von einem ersten Abschnitt flankiert ist, der Davi Kopenawas schamanische Ausbildung bei seinem Schwiegervater beschreibt und die kosmologischen nativen Parameter darlegt, und von einem zweiten, in dem der Erzähler die anthropologisch-schamanische Erfahrung kommentiert, die er während seiner Reisen in den Teil der Nordhemisphäre erworben hat, den wir Brasilianer noch die ›Erste Welt‹ (Vereinigte Staaten, Frankreich, Großbritannien) nennen, Ort der Ahnen der kannibalischen napë, die gekommen sind, die Erde der Yanomami zu essen, nachdem sie die eigene verschlungen haben. Für eine noch größere Symmetrie ist das Triptychon eingerahmt von einer doppelten Einführung (die eine von Albert signiert, die andere von Kopenawa) und von einer doppelten Schlussfolgerung (idem) – ohne hier näher auf das doppelte Epigraf einzugehen, das eine von Lévi-Strauss, das andere wiederum von Kopenawa – ein Dualismus, der beharrlich (und beinahe hätte ich hier »obsessiv« geschrieben) die Dualität der beiden miteinander verflochtenen Stimmen markiert.
Dort also, wo diejenigen, die an eine immanente Natürlichkeit des Diskurses des ANDEREN glauben – aber nur wenn sie es sind, die ihn wiedergeben; die Kritiker der ANWESENHEIT haben die Angewohnheit, Meister zu werden, wenn sie ihr beiwohnen –, in Der Sturz des Himmels, so vermute ich, architektonischen Kunstgriff, textuelles Artefakt, vielleicht ideologische, pietätvolle Fälschung sehen werden, sehe ich, ganz im Gegenteil, höchste Kunst und das höchste Können am Werk, zu dem das anthropologische Schreiben in der Lage ist. Ich sehe eines der seltensten jüngsten Beispiele für eine tatsächliche reflexive Erfindung auf der Ebene der Techniken der ethnografischen Textualisierung einerseits (vielleicht nur vergleichbar, mutatis mutandis, mit dem, was Marylin Strathern mit Melanesien gemacht hat)36, und, andererseits, für die radikale Erneuerung einer distinktiven Gattung französischer Tradition, zwischen Ethnografie und Literatur.37 Der Koautor-Anthropologe ist sich der Risiken der getroffenen Entscheidungen bewusst – Akribie und Skrupel sind vielleicht das Markanteste an den Eingriffen des weißen Schriftstellers dieses Buchs, angefangen mit dem ausführlichen Anmerkungsapparat, der die Erzählung von Davi begleitet, über das paradigmatische Postskriptum bis zu den Anhängen, den Glossaren, den verschiedenen Indexen und der gewissenhaften Bibliografie. Albert zeigt sich auf der Höhe der Kontroversen, die sich durch die postmoderne Krise rund um die (Auto)biografie als Gattung entzündet haben, er weiß um die Spannung zwischen dem Ich des Erzählers und dem des Schriftstellers, um die »Ökonomie der Person«, wie sie in der Ethnografie impliziert ist, und um den Prozess der »ontologischen Delegation«, der auf den Plan getreten ist, um sie zu erneuern (Salmon 2013). Er ist sich im Klaren über die ›eigene‹ Alterität jeglicher Autorschaft und vor allem über die der »ethnografischen Situation« inhärente Asymmetrie und über ihre epistemischen Konsequenzen (Zempléni, 1984; Viveiros de Castro, 2002), eine nicht zu behebende Asymmetrie, gegen die der Schreiber/Schriftsteller von Der Sturz des Himmels Abhilfe zu schaffen sich bemüht, ohne jemals zu versuchen, sie als solche zu verhehlen: Abhilfe durch eine Gesamtheit an narrativen Lösungen, die unter dem Zeichen des »geringsten Übels« (S. 679) stehen. Dieser letzte Ausdruck scheint mir besonders treffend, um das Wesen der ethnografischen Gattung zu charakterisieren – »approximative Kenntnis« von Natur aus, würde Bachelard sagen (oder eher, ›von Kultur aus‹), und, noch allgemeiner, um das Gefühl eines unvermeidbaren Verlustes zu benennen, wie er durch jede Arbeit der Übersetzung hervorgerufen wird, sei diese interlinguistisch, interkulturell, intersemiotisch oder selbst, wie wir es in schmerzhafter Weise in unseren eigenen Leben konstatieren, interpersönlich – ganz zu schweigen von dieser dunklen, unablässigen und äquivoken intrapersönlichen Übersetzung, die im Tumult unserer multiplen ›inneren‹ Stimmen entsteht, unter dem unerbittlichen Druck des Unbewussten. Und sollte der Verlust letzten Endes in der Tat rein imaginär sein. Noch etwas (unvermeidlich) Äquivokes über das Äquivoke.
Aufgrund des bisher Gesagten ahnt man, dass das vorliegende Buch den Anthropologen und anderen Studierenden oder Hermeneutikern der indigenen Stimmen viel zu lehren hat, sowohl durch die exemplarische Erzählung von Davi Kopenawa als auch durch die Reflexion, die uns im Postskriptum vorgestellt wird. Der Autor dieses Letzteren definiert dort, indem er einen Artikel, den er vor Jahren veröffentlicht hat, wieder aufgreift (Albert, 1997), das, was er den ethnografischen Pakt nennt. Der »Pakt« beginnt mit der Beachtung der drei grundlegenden Imperative jeglichen Engagements des Anthropologen mit einem indigenen Volk:
»Zunächst natürlich gewissenhaft der begrifflichen Einbildungskraft [seiner] Gastgeber Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, dann den lokalen und globalen soziopolitischen Kontext, mit dem ihre Gesellschaft zu kämpfen hat, rigoros einzubeziehen und, zu guter Letzt, sich eine kritische Sichtweise auf den Rahmen der ethnografischen Beobachtung selbst zu bewahren.« (S. u., S. 657 f.)
Das Vermögen – die Neigung und das Talent – das die Ethnografen bei der Befolgung dieser drei Anforderungen zeigen, ist, wie man weiß, recht unterschiedlich.38 Aber, so oder so, diese drei Anforderungen sind nicht hinreichend. Wie Albert fortfährt, muss der Ethnograf darauf vorbereitet sein zu verstehen, dass das Hauptziel seiner indigenen Gegenüber – und das Fundament seiner Kooperation mit ihnen – darin besteht, den Forscher in einen politischen Alliierten zu konvertieren, in ihren diplomatischen Repräsentanten oder Dolmetscher, gemeinsam mit der Gesellschaft, aus der er kommt, um »den ungleichen Tausch, der vorweg jeder ethnografischen Beziehung zugrunde liegt, so weit wie möglich umzukehren« (s. u., S. 659). Die Einheimischen akzeptieren es, sich gegenüber dem fremden Beobachter zu objektivieren, in dem Maße, wie dieser es akzeptiert (und technisch gesehen darauf vorbereitet ist), sie adäquat zu repräsentieren gegenüber der Gesellschaft, die sie verfolgt und bedroht – dies ist der »ethnografische Pakt«, durch den die politische und die wissenschaftliche Bedeutung der Idee der ›Repräsentation‹ zu koinzidieren gezwungen werden (zwangsläufig koinzidieren). Dies setzt jedoch voraus, dass der Forscher, der die Funktion des diplomatischen Gesandten der Einheimischen vor seinem eigenen ›Volk‹ auf sich nimmt, dies tun kann und sollte, »ohne aber deshalb der Singularität seiner eigenen intellektuellen Neugier abzuschwören (von der die Qualität und Effizienz seiner Vermittlung im Wesentlichen abhängen)« (s. u., S. 661).
Diese letzte Einschränkung scheint mir besonders wichtig. Es reicht nicht aus, das Schicksal der Kolonisierten zu bemitleiden. Es reicht nicht aus, großzügige emanzipatorische Absichten gegenüber dem Einheimischen zu zeigen, sich als derjenige zu präsentieren, der glaubt, über die theoretisch-politischen Instrumente zu verfügen, um ihn von seiner Unterwerfung zu befreien – Befreiungsinstrumente, die, in den meisten Fällen, aus dem Werkzeugkasten kommen, aus dem auch die Unterwerfungsinstrumente stammen, wie es viele ›Einheimische‹ bereits beobachtet haben (Means, 1980; Nandy, 2004; Rivera Cusicanqui, 2014). Die zahlreichen Auszüge der Zeugenaussage Kopenawas, in denen wir mit abscheulichen Aktionen (oder Inaktionen) der Weißen konfrontiert werden, in denen wir der Tragödie zuschauen, dem Auslöschen von Familien oder ganzen Dörfern durch Epidemien, eingeschleppt von vermeintlichen Wohltätern der Yanomami, der plötzlichen Reduzierung der zuvor noch unversehrten und stolzen Gemeinschaften auf eine Ansammlung elender Bettler, den aufeinanderfolgenden Invasionen von Agenten der materiellen und moralischen Zerstörung eines Volkes – nichts davon klingt in Der Sturz des Himmels danach, bloß eine weitere jener herzzerreißenden Litaneien zu sein, die viele Weiße, seien sie Akademiker, Befreiungstheologen, Journalisten, Aktivisten für indigene Rechte – sie alle, ich beharre darauf, selbstverständlich mit guten Absichten (selbst wenn sie ihre tenure dem Unheil anderer verdanken) – bis zur Erschöpfung wiederholen. Und wenn nichts in Kopenawas Worten so klingt, dann, weil alles, was er sagt, sich in ein Buch einfügt, das ausgehend von einer Sichtweise komponiert wurde, die theoretisch darauf vorbereitet ist, diesen Katastrophen Sinn zu geben, indem sie diese in den begrifflichen Rahmen einer singulären ›gelebten Welt‹ stellt, wodurch sie mit einer unendlich reicheren Bedeutung versehen werden als der von Beispielen unter anderen für die menschliche Misere. Kurzum, ohne die »intellektuelle Neugier«, die den Anthropologen-Schriftsteller bewegt hat, und ohne die (gegen-)anthropologische Neugier, die den Schamanen-Erzähler bewegt hat, gäbe es dieses Buch nicht, oder es wäre undenkbar.
Ein Punkt muss hier ganz unmissverständlich hervorgehoben werden: Sosehr die Schule des »interethnischen Kontaktes« (oder der »interethnischen Friktion« – Albert, 1997) dem Schriftsteller-Anthropologen von Der Sturz des Himmels auch geholfen haben mag, die neokoloniale und hyperkapitalistische Situation zu verstehen, in der sich die ethnischen Minderheiten in Brasilien befinden, und ihn dazu inspiriert hat, das anregende, theoretische Programm einer »post-malinowskischen Feldforschung« (Albert, 1997) zu formulieren, so wenig gelangen diese Schule sowie ihre Entfaltung zu einer Doktrin der »Ethnizität« – eine hegemoniale Tendenz in der brasilianischen Anthropologie während des gesamten letzten Viertels des vergangenen Jahrhunderts – und ebenso wenig die Schriften von militanten Ethnografen aus dem – gestehen wir es ihnen zu – ›linken‹ Spektrum (das hervorstechendste Beispiel ist Terence Turner, der Autor einer laboriösen, paramarxistischen Theorie eines Übergangs »von Kosmologie zu Ideologie«, der die Kayapó wie ein Wunder erfasst haben soll) –, so wenig gelangen alle diese für eine ›radikale‹ Position repräsentativen Autoren (aber wer sieht sich nicht gern als radikal an?) auch nur im Entferntesten dahin, eine Bresche in der zwischen Índios und Weißen errichteten dialogischen Mauer zu öffnen, wie es Der Sturz des Himmels vermocht hat. Es ist offensichtlich, dass Alberts theoretische Ausbildung, seine »intellektuelle Neugier« auf ›strukturalistischer‹ Grundlage39, verantwortlich ist für die Abstimmung seines analytischen Gehörs auf die Wellenfrequenz der begrifflichen Einbildungskraft von Kopenawa, der seinerseits, zusammen mit seinem französischen ›Paktierer‹, einen Diskurs produziert, der weit über Denunziation und Lamentation hinausreicht – denn der unwiderruflichen Verurteilung des Erzählers von allem, was man sich von unserer »Zivilisation« erwarten darf, geht eine umfängliche philosophische Darstellung der Fundamente einer indigenen Welt voraus (von der Erstere abgeleitet wird), in ihren drei Aspekten, dem ontologischen, dem kosmologischen und dem anthropologischen. Wobei man zudem auch zur Kenntnis nehmen sollte, dass das vitale Engagement mit den Yanomami – in Gestalt einer der längsten Feldforschungen in der Geschichte der Amazonas-Ethnologie, die den Bau medizinischer Notfalleinrichtungen, epidemiologische Studien, Umweltprojekte, ethnoökologische und ethnogeografische Studien zur indigenen Ökonomie, beharrliches Anzeigen und mühevolle Pressedokumentationen, umfassende Mitarbeit in den NGOs, die die indigenen Rechte unterstützen, miteinschließt – den weißen Koautor dieses Buchs nicht davon abgehalten hat, neben dieser umfassenden Tätigkeit als Helfer und Aktivist ambitiöse kreative Wetten einzugehen, wie die des 2003 von der Fondation Cartier finanzierten Treffens zwischen Yanomami-Schamanen und einer Gruppe abendländischer Avantgarde-Künstler (Albert und Kopenawa, 2003). Denn wer sich weigert, den Índios die Rolle eines Gesprächspartners einzuräumen, der sich ästhetisch und philosophisch radikal ›horizontal‹ zu unserer Gesellschaft befindet, wer sie zur Rolle des Objektes eines externalisierten ›Assistenzialismus‹ verdammt, des Klienten eines weißen, aufgeklärten Aktivismus oder des Opfers eines verzweifelten ›Denunziantismus‹, der verweigert ihnen ihre absolute Zeitgenossenschaft. Unsere Zeit ist die Zeit des Anderen, um die Flagge zu kommentieren und umzukehren, die Johannes Fabian 1983 schwenkte.40 Denn die Zeiten sind andere. Und umso mehr der Andere.
Es wäre hier unpassend, Davi Kopenawas Narrative zusammenzufassen, deren Bedeutung weit über die oben erläuterten ›anthropologischen‹ Fragen und Querelen hinausgeht. Denn wichtiger als alles andere ist, was dieses Buch den Nichtanthropologen zu denken geben kann; was zählt, ist das, was Davi Kopenawa zu sagen hat, für diejenigen, die ihm zuzuhören wissen, über die Weißen, über die Welt und die Zukunft. Dass sein begriffliches Repertoire und sein Universum an Referenzen von unseren sehr weit entfernt sind, zeigt nur noch mehr, wie wichtig und beunruhigend seine ›schamanische Prophezeiung‹ ist, die zusehends weniger ›bloß‹ imaginär und mehr und mehr der Realität ähnlich wird. Wie Bruno Latour im Rahmen der ontologischen Krise der Modernen und der mit ihr verbundenen planetarischen Umweltkatastrophe beobachtet, sehen wir heute eine »progressive Rückkehr zu den alten Kosmologien und ihren Anliegen, von denen wir plötzlich erkennen, dass sie gar nicht so unbegründet sind« (Latour, 2012: 452). Wobei man in dieser Beobachtung vor allem das Wort »alte« relativieren sollte – denn was wir »plötzlich erkennen«, ist, dass sie zeitgenössisch sind; auch wenn sie vor den unseren existierten, haben sie nie aufgehört, mit ihnen zu koexistieren, und, wie wir bereits gesagt haben, ist es nicht unmöglich, dass sie die unseren überleben. In den Vorhersagen des Yanomami-Schamanen mangelt es nicht an stichhaltigen Hinweisen, und ihr poetischer ›Lokalismus‹ macht sie nur noch besorgniserregender. Führen wir hier lediglich ein Beispiel von vielen an in Form einer wissenschaftlichen Übersetzung (das heißt, kulturell ›normalisiert‹ für die Weißen) der Beobachtungen von Davi über die »Erdesser«, die »wie riesige Gürteltiere oder Pekaris« die Substanz des Planeten verschlingen: eine kürzlich veröffentlichte und äußerst empfehlenswerte Studie von Ugo Bardi (2013) über das Aufbrauchen der weltweiten Erzvorkommen.
Es gibt indessen zwei kleine Passagen in Der Sturz des Himmels, die mich besonders berühren, dank ihrer epigrammatischen Weise, das zusammenzufassen, was ich die indigene Differenz nennen würde. Die erste, das Epigraf des XVII. Kapitels, »Zu den Weißen sprechen«, ist ein Zitat aus einem Wortwechsel vom 19. April 1989 (dem »Dia do Índio« – Tag des Índio) zwischen dem General Bayma Denys, der während der Sarney-Regierung – sie schon wieder – zu den ranghöchsten Militärs zählte, und Davi Kopenawa. Wir können fast den arroganten und abfälligen Tonfall heraushören, mit dem der militärische Würdenträger, höchstwahrscheinlich dazu verpflichtet, mit irgendeinem Índio an diesem lästigen Jahrestag zu plaudern, Davi fragt:
»Dein Volk möchte Anleitungen bekommen, wie man die Erde bestellt?«
Worauf der furchtlose Schamane entgegnet:
»Nein. Was ich auf der Stelle erhalten möchte, ist die Demarkation unseres Territoriums.«
Vorhang zu. Was mich an diesem Wortwechsel fasziniert, abgesehen natürlich von der großartigen Gleichgültigkeit Kopenawas gegenüber der Uniform, ist die Anmaßung des Generals, sich einzubilden, den Meistern der Erde beibringen zu können, wie man diese bestellt, das heißt kultiviert – davon überzeugt, dass das Volk der Natur, die Índios, nichts von Kultur versteht, Bayma Denys muss geglaubt haben, dass die Yanomami ›Nomaden‹ oder so etwas Ähnliches seien –, und dazu noch, dass es die armen Índios danach dürste, sich an jener agronomischen Wissenschaft der Weißen zu laben, einer Wissenschaft, die uns mit krebserregenden Pestiziden, chemischen und gentechnisch veränderten, monopolistischen Düngern segnet, während die Yanomami sich an den tadellosen ›biologischen‹ Erzeugnissen ihrer Gärten satt essen. Noch faszinierender jedoch ist die totale Umkehrung der Konzepte durch Davi in seiner Antwort, wahrhaftiger Coup eines Schwertkampfmeisters. Der General spricht von »Erde« (i. O. »terra«) überhaupt, wo er eigentlich vom »Territorium« (i. O. »território«) der Yanomami sprechen müsste. Er will sie lehren, die Erde zu kultivieren, wo doch das, wofür er als Militär in Diensten eines Nationalstaates zuständig ist, die topografische und ›agronomokratische‹ Demarkation des Territoriums ist. Bayma Denys weiß nicht, was die Yanomami wissen; und was weiß er als Militär schon vom Bestellen oder Kultivieren des Erdreichs, was weiß er von der Erde? Aber Kopenawa weiß genau, was die Weißen wissen; er weiß, dass die einzige Sprache, die die Weißen verstehen, nicht die der Erde ist, sondern die des Territoriums, des umzäunten Raums, der Schranken, der Divisionen, der Grenzen, der Markierungen und der Register. Er weiß, dass es unerlässlich ist, das Territorium zu sichern, um die Erde zu bestellen. Längst schon hat er die Spielregeln der Weißen erlernt und sie nie wieder vergessen. Man schaue sich sein Gespräch beim Portal Amazônica an, das exakt 26 Jahre vor dem Kolloquium mit dem General stattfand:
Der Weiße war es, der das Demarkieren gelehrt hat. Die Demarkation, das Aufteilen der Erde, das Grenzen-Ziehen, ist ein Brauch des Weißen, nicht des Índios. Der Brasilianer hat gelehrt, indigene Erde zu demarkieren, also sind wir dazu übergegangen, dafür zu kämpfen. Unser Brasilien ist so groß, und unsere Erde so klein. Wir indigenen Völker sind die hiesigen Bewohner, bevor die Portugiesen gekommen sind.
Ich habe für die Yanomami-Erde gekämpft, damit mein Volk lebt, wo es geboren ist und aufwächst, aber das Registrieren der Demarkation der Yanomami-Erde liegt nicht in meiner Hand, sondern in den Händen der Regierung. Selbst angesichts der Schwierigkeiten ist die Größe unserer Erde ausreichend für uns, solange sie tatsächlich nur für uns ist und wir sie nicht mit Garimpeiros und Ruralistas teilen müssen.41
Die zweite Passage, und hier gebe ich drei Absätze aus dem Kommentar wieder (denn ich könnte es nicht besser machen …), den Déborah Danowski und ich zusammen über sie verfasst haben in Há mundo por vir?42 (In welcher Welt leben? Ein Versuch über die Angst vor dem Ende, aus dem Portugiesischen von Clemens von Loyen und Ulrich von Loyen, Berlin 2019), kommt einem regelrechten Traktat einer Gegenanthropologie der Weißen gleich:
Die Weißen behandeln uns als Dummköpfe, nur weil wir andere Leute sind als sie! Aber ihr Denken ist sehr kurz und dunkel. Es kann sich nicht ausdehnen und erheben, weil sie den Tod nicht wahrhaben wollen. […] Sie trinken ununterbrochen Cachaça und Bier*, die ihre Brust erhitzen und einräuchern. Aus diesem Grund werden ihre Worte so schlecht und verworren. Wir wollen sie nicht mehr hören. Für uns ist Politik etwas anderes. Politik sind die Worte Omamas und die der xapiri, die er uns hinterlassen hat. Es sind die Worte, die wir während der Zeit des Traums hören und die wir allen anderen vorziehen, weil es wirklich unsere eigenen sind. Die Weißen hingegen träumen nicht so weit wie wir. Sie schlafen viel, aber sie träumen nur von sich selbst. (S. u., S. 491 f., Hervorhebungen E. V. C.)
Der eitle Wunsch, den Tod nicht wahrhaben zu wollen, hängt, so Kopenawa, mit der Fixierung der Weißen auf die Beziehung zum Besitz und auf die Warenform zusammen. Sie sind in die Waren »verliebt«, ihr Denken »dreht sich um sie«. Erinnern wir uns daran, dass die Yanomami nicht nur die Großzügigkeit und den nichtmerkantilen Tausch von Gütern aufs Höchste schätzen, sondern auch allen Besitz der Toten zerstören.43
Und dann trifft er den Nagel auf den Kopf: »Die Weißen […] schlafen viel, aber sie träumen nur von sich selbst.« Dies ist bis heute vielleicht das grausamste und präziseste Urteil über die zentrale anthropologische Charakteristik des »Volks der Ware«. Die epistemische Abwertung des Traumes der Weißen geht Hand in Hand mit ihrer solipsistischen Selbstfaszination – ihrer Unfähigkeit, die verborgene Menschlichkeit der nichtmenschlichen Existierenden zu erkennen – und ihrem so lächerlichen wie unheilbaren ›fetischistischen‹ Geiz, ihrer Chrysophilie. Kurzum, die Weißen träumen von dem, was keinen Sinn hat.44 Anstatt von dem Anderen zu träumen, träumen wir von Gold.
Es ist interessant zu bemerken, dass es einerseits aus psychoanalytischer Sicht etwas zutiefst Stichhaltiges in Kopenawas Diagnose über das abendländische, onirische Leben gibt – seine Traumdeutung dürfte jedem an Freud und Marx geschulten Denker zur Ehre gereichen – und dass sie uns andererseits mit unserer eigenen falschen Münze etwas heimzahlt: Um die anthropologische Charakteristik der »animistischen« Völker zu definieren, haben sich die Modernen immer auf die These berufen, dass Erstere sich eine narzisstische Projektion des Egos auf die Welt zuschulden kommen ließen – Freud war, wie man weiß, einer der bekanntesten Befürworter dieser These. Beim Verstehen jener, die wir Animisten nennen, sind wir es im Gegenteil, die Modernen, die beim Betreten des Raums der Exteriorität und der Wahrheit – dem Traum – nur zwanghafte Reflexe und Simulakren unserer selbst sehen können, anstatt uns der Unheimlichkeit des Handels mit der Unendlichkeit an gleichzeitig verständlichen und radikal anderen im Kosmos verstreuten Vermittlungen zu öffnen. Die Yanomami oder die Politik des Traums gegen den Staat: nicht unser »Traum« von einer Gesellschaft gegen den Staat, sondern der Traum, so wie er geträumt wird in einer Gesellschaft gegen den Staat.
Wir haben dieses Vorwort mit der komplexen Beziehung zwischen Der Sturz des Himmels und Traurige Tropen begonnen. Kehren wir also zu Letzteren zurück, indem wir uns an eine bekannte Episode erinnern, in der Lévi-Strauss seinen Dialog mit Luís de Sousa Dantas schildert, dem brasilianischen Botschafter in Paris, am Tag vor seinem Aufbruch nach São Paulo, damals, im Jahr 1934. Im Laufe eines feierlichen Abendessens fragt der junge zukünftige Professor der Universität São Paulo den Botschafter des Landes, in das er reisen würde, nach den Índios in Brasilien. Woraufhin er, perplex und konsterniert, aus dem Munde des Diplomaten hört:
Indianer? Ach, verehrter Herr, das sind Lichter, die alle erloschen sind. Ja, ein sehr trauriges, sehr beschämendes Kapitel der Geschichte meines Landes. […] Als Soziologe können Sie in Brasilien viele aufregende Dinge entdecken, aber die Indianer, die schlagen Sie sich aus dem Kopf, Sie werden keinen einzigen mehr antreffen … (Lévi-Strauss, 1955, 51 [1978, 40 f.])
Ich bin fest davon überzeugt, dass Luís de Sousa Dantas wirklich nicht wusste, dass es noch Índios gab in dem von ihm repräsentierten Land – eine genauso beschämende Ignoranz wie die Geschichte der Massaker, die von dem armen Botschafter erwähnt wurden.45 Und natürlich hat Lévi-Strauss, wie man weiß, Índios in Brasilien getroffen. Wenn er heute ankommen würde, fände er noch viel mehr; denn Stand jetzt, achtzig Jahre später, gibt es nicht nur immer mehr Índios in Brasilien, sondern sie haben längst auch ihre eigenen Botschafter, in Persönlichkeiten wie Raoni, Mário Juruna, Ailton Krenak, Alvaro Tukano, Marçal de Sousa, Angelo Kretã und so vielen mehr – unter ihnen, il va sans dire, Davi Kopenawa.
Der Sturz des Himmels ist, de facto, ein beispielhaft diplomatisches Dokument. Der ethnografische Pakt, von dem Albert spricht, ist von dem ›schamanischen Pakt‹ ununterscheidbar, der auf jeder Seite von Davis Erzählung durchschimmert. »Für uns ist Politik etwas anderes« – besinnen wir uns auf diesen, dem obigen Zitat von Davi entnommenen Satz. Wie Albert in seinem Postskriptum festhält, schließt die enunziative Struktur dieses hochkomplexen Buchs eine Pluralität an Positionen mit ein: die des Erzählers, der auf verschiedene Register in verschiedenen Momenten seiner Erzählung zurückgreift; die seines indigenen Schwiegervaters, der ihn gewissermaßen vor den Weißen gerettet hat, indem er ihn in den Schamanismus initiierte; die der xapiri, von denen der Erzähler spricht und die durch seinen Mund sprechen; die des weißen Dolmetschers, der auf Yanomami sprechend zwischen der Sprache des Erzählers, den zahlreichen Ausdrücken auf Portugiesisch, die dessen Diskurs skandieren, und dem Französischen navigiert, in das er die Erzählung übersetzt … In Wirklichkeit sind diese »Worte eines Yanomami-Schamanen« – Untertitel von Der Sturz des Himmels – mehr als das: Sie sind schamanische Yanomami-Worte, sie sind eine schamanisch-politische Performance, in anderen Worten eine kosmopolitische oder kosmisch-diplomatische Performance (»Für uns ist Politik etwas anderes«), in der ontologisch heterogene Sichtweisen verglichen, übersetzt, ausgehandelt und bewertet werden. Der Schamanismus ist hier die Fortsetzung der Politik mit denselben Mitteln. Der Sturz des Himmels ist eine schamanische Séance, eine politische (Ab)Handlung und ein Kompendium der Yanomami-Philosophie, die – wie man vielleicht von aller amazonischen Philosophie sagen könnte – im Wesentlichen ein spekulativer Onirismus ist, in dem das Bild die ganze Kraft des Begriffs besitzt und die aktive ›extrospektive‹ Erfahrung der halluzinatorischen ultrakörperlichen Reise den Ort der asketischen und meditativen Introspektion einnimmt.
Viele anthropologische Studien gewännen an ungeahnter Bedeutung und Relevanz, wenn sie sich einer schamanischen Séance ›unterziehen‹ würden, wie sie in Der Sturz des Himmels





























