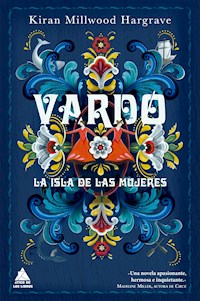6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Straßburg, im glühend heißen Sommer 1518: Mitten in der Stadt beginnt eine Frau zu tanzen. Tagelang, ohne Unterbrechung. Hunderte folgen ihrem Beispiel und die Obrigkeit ruft verzweifelt den Notstand aus. Außerhalb der Stadtgrenze spürt die schwangere Lisbet noch nichts von dem Aufruhr. Doch als ihre Schwägerin Nethe aus der Verbannung auf den Hof zurückkehrt, beginnt auch unter Lisbets Füßen der Boden zu beben. Was verbirgt Nethe? Welche Sünde hat sie begangen, für die sie sieben Jahre lang Buße tat? Lisbet gerät in ein tückisches Netz aus Täuschung und heimlicher Leidenschaft – und tanzt schon bald selbst zu einer unheilvollen Melodie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Roman
Straßburg, im glühend heißen Sommer 1518: Mitten in der Stadt beginnt eine Frau zu tanzen. Tagelang, ohne Unterbrechung. Hunderte folgen ihrem Beispiel und die Obrigkeit ruft verzweifelt den Notstand aus. Außerhalb der Stadtgrenze spürt die schwangere Lisbet noch nichts von dem Aufruhr. Doch als ihre Schwägerin Nethe aus der Verbannung auf den Hof zurückkehrt, beginnt auch unter Lisbets Füßen der Boden zu beben. Was verbirgt Nethe? Welche Sünde hat sie begangen, für die sie sieben Jahre lang Buße tat? Lisbet gerät in ein tückisches Netz aus Täuschung und heimlicher Leidenschaft – und tanzt schon bald selbst zu einer unheilvollen Melodie.
»Eine außergewöhnlich atmosphärische und originelle Geschichte.« The Sunday Times
Zur Autorin
Kiran Millwood Hargrave, geboren 1990, ist eine preisgekrönte britische Lyrikerin und Autorin von Romanen, Theaterstücken und Kinderbüchern. Kiran gewann den Waterstones Children’s Book Prize und den British Book Award für das Children’s Book of the Year. »Vardø. Nach dem Sturm« war ihr erster Roman für Erwachsene und ein Sunday-Times-Bestseller. Nun folgt ihr neuestes Buch »Der Tanz der Frauen« in deutscher Übersetzung. Mit ihrer Familie lebt die Autorin in Oxford direkt am Fluss.
KIRAN MILLWOOD HARGRAVE
DER TANZ DER FRAUEN
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Fahrner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitathinweis: Zitate auf Seite 7 [>>] allesamt übersetzt von Stefanie Fahrner.
Das dritte Zitat aus: »A Meadow«, from STAY, ILLUSION: POEMS by Lucie Brock-Broido, copyright © 2013 by Lucie Brock-Broido.
Used by permission of Alfred A. Knopf, an imprint of the Knopf Doubleday Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. All rights reserved.
Copyright © 2022 by Kiran Millwood Hargrave
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel
The Dance Tree bei Picador, London
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Antje Nissen
Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München
Umschlagmotiv: © Index Fototeca/Bridgeman Images;
Shutterstock (Phatthanit; Master1305; KathySG; Alenarbuz)
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-30525-3V001
www.diana-verlag.de
Für Katie und Daisy, die uns Mut machten, als wir die Last alleine nicht mehr schultern konnten
Ihre zerbrechlichen Körper sind wie die stärksten Windstöße, und die Wege der Schöpfung, so zahllos sie auch sind, sagen uns, dass nichts und niemand entbehrlich ist.
aus: The Beehive Metaphor von Juan Antonio Ramírez
Manchmal erlebt der Körper eine Offenbarung, weil er alle anderen Möglichkeiten verworfen hat.
aus: Fugitive Pieces von Anne Michaels
Als ich dieses Spektakel sah, wollte ich leben fürEinen Augenblick für einen Augenblick. Wie unelegant es auch sein mochte,Es war, wie es hätte sein können, lebendig zu sein, aber auf zärtliche Weise.Eine Sache. Eine Sache. Nur eine Sache:Sag mir, dass daEine Wiese ist, danach.
aus: »A Meadow« von Lucie Brock-Broido
Straßburg, 1518
Keine tanzt
Sie hat gehört, dass es Brot auf dem Marktplatz gibt. Vielleicht war das gelogen, oder vielleicht sind die Laibe so verschimmelt, dass sie ungenießbar sind, aber Frau Troffea ist das egal. Allein die Hoffnung darauf ist so nahrhaft wie alles andere, was sie in den letzten Monaten zwischen die Zähne bekommen hat. Sie ist zusammen mit den anderen Pilze sammeln gegangen, hat Hasenfallen in den Wäldern ausgelegt wie die Zigeuner. Umsonst. Selbst die Tiere sind nach dem Hungerwinter und diesem brütend heißen Sommer ausgehungert. Sie fand einen Vogel, der aus dem Nest gefallen war, brachte ihn nach Hause und kochte ihn in der Asche ihres Feuers, biss sich durch seine weichen, zersplitternden Knochen, so lange, bis ihr Zahnfleisch wund und ihr Mund voller Eisen und Salz war.
Ihr Mann weiß nicht, wie sehr sie leidet, hat anscheinend nie Hunger gekannt. Er ist sehnig geworden, Muskeln winden sich um seine Arme wie Seile. Aber sie trägt den Hunger in sich wie ein Kind, und er wächst und saugt und füllt ihren Bauch, bis sie sich verkrampft, weil sie das volle Gewicht seiner nagenden Leere spürt.
Sie hat angefangen, an Lederresten zu kauen. Sie hat begonnen, an ihren Haarspitzen zu saugen, und betrachtet die streunenden Hunde mit plötzlichem Interesse. Neuerdings sieht sie weiße Lichter vor sich in der Luft hängen, die sie mit dem Finger durcheinanderwirbeln kann.
Doch Frau Troffea hat noch nicht den Verstand verloren, und während sie durch ihre Stadt taumelt, schmiedet sie einen Plan. Wenn das Brot verbrannt ist, kann sie es in den Fluss tauchen, bis es weich wird. Wenn es verdorben ist, haben die anderen es vielleicht liegen lassen. Wenn es kein Brot gibt oder alles schon weg ist, kann sie ihre Taschen mit Steinen füllen und ins Wasser gehen, wie es einige bereits getan haben. Man sah, wie Frauen ihre Babys hineinwarfen, damit sie ihre anderen Kinder ernähren konnten. Sie hätte dasselbe getan, wenn ihre Kinder das Säuglingsalter überlebt hätten. Jener Sohn, der das geschafft hat, ist vor langer Zeit als Verräter gehängt worden. Samuel, einer von Hunderten, die verurteilt wurden anstelle ihres Anführers Joß Fritz, der nach jedem neuen Aufstandsversuch so schnell und spurlos im Schwarzwald verschwand wie der Schnee im Sommer.
Die Armenhäuser sind überfüllt, die Friedhöfe auch. Das Ende der Welt ist nahe, auf den Straßen und in den Kirchen wird es verkündet. Geiler, der lautstarke Prediger des Straßburger Münsters, ist seit acht Jahren tot, aber seine Worte sind auf Wände geschmiert und hallen von den Kanzeln des Münsters wider: Es gibt keinen unter uns, der gerettet werden kann. Der Komet, der um die Jahrhundertwende seinen feurigen Schweif hinter sich herzog und sie verdammte, wird aus seinem Krater gehoben und auf einen Altar gelegt, aber es ist zu spät.
Sie betet im Gehen, obwohl ihr Rosenkranz schon lange nicht mehr da ist. Die Tonperlen hatten zwischen ihren Zähnen gekracht wie Vogelknochen.
Frau Troffea wirbelt einen Lichtfaden durch ihre Finger, weich wie Lammwolle. Schweiß läuft ihr über die Lippen und den Rücken, tränkt den stinkenden Stoff ihres Kleides. Die Sonne hat ihr die Fußsohlen verbrannt, als sie mittags vor einem Wirtshaus eingeschlafen war. Ein alkoholisches Getränk kann sie sich kaum leisten, aber nun ist wenigstens davon genug da, denn der verdorbene Weizen taugt nur noch für Bier. Ihr Mann hat die ganze Nacht nicht nach ihr gesucht. Ihre Füße scheuern auf dem Kopfsteinpflaster, und es tut gut, sie wieder zu spüren. Die Blasen machen Platz für frische Haut.
Ihr Weg führt sie über den Pferdemarkt, der entstanden war, als Straßburg noch ein anderes Zentrum hatte. Damals hatte er am Stadtrand gelegen. Jetzt gibt es Beschwerden aus der Kathedrale über den Geruch, aber Frau Troffea mag ihn: säuerlich und durchdringend bedeckt er ihre Zunge. Sie öffnet den Mund, füllt ihre Lunge damit an.
Sie ist gewachsen wie ein riesiges Tier, diese Stadt. In ihrer Jugend war sie fett vor lauter Reichtum, und dann kamen die Flöhe angekrochen. Der Handel ist schon lange zurückgegangen, aber trotzdem sieht man jeden Tag neue Gesichter, darunter auch dunkle, ganz so, als wären die Teufel schon da. Sie überfluten das Krankenhaus mit ihrem Dreck. Das Heilige Römische Reich ist in einen Kampf mit den osmanischen Türken verwickelt und kämpft um ihre Seelen. Sie kann nicht lesen, weiß aber, dass es Schmähschriften über sie gibt, über die Türken, die ihr Reich, ihre Heimat bedrohen. Sie sind der Feind, aber sie kommen trotzdem und behaupten, vor denselben Horden zu fliehen, die für sie kämpfen.
Frau Troffea ist auf der Hut, was solche Lügen angeht.
Sie verbringt ihre Tage damit, nach den Ungläubigen Ausschau zu halten, entdeckt sie sogar in der Kirche, obwohl dort heiliger Weihrauch brennt, dessen Schwaden so dick sind, dass einem die Kinnlade verkrampft. Sie untersucht ihren Körper jede Nacht auf Bisse und Anzeichen von Dämonen, findet aber nur Knochen, die sich unter dem schwindenden Fleisch verhärtet haben.
Der Marktplatz ist totenstill und schwankt vor ihren Augen. Sie durchkämmt die abgeschlossenen Stände, den staubigen Boden, die Gitter, die mit dem von der Hitze festgebackenen Dreck verstopft sind. Sie riecht die Süße und die Scheiße ihrer Stadt, die unter der unerbittlichen, gesegneten, verfluchten Sonne brät. Ihr schwirrt der Kopf, während sie sucht, mit den Händen im Dreck gräbt, die dicke Erde handvollweise wegschiebt. Sie murmelt ein Gebet wie eine Beschwörung – vielleicht lässt Gott ja Brot vom Himmel fallen? Aber nichts außer Hitze fällt auf ihren Rücken, ihre Waden, ihre verbrannten Fußsohlen, und sie wundert sich wieder, warum ihr Mann nicht gekommen ist, um nach ihr zu suchen.
Sie weint, aber sie schämt sich dafür nicht. Die Lichtranken umschwirren sie wie Fliegen, himmlisch und schwelgend, und umwickeln sie mit ihren weichen Fäden und Gespinsten. Ihre Hände sind voller Erde und Kot, ihre Fingernägel jucken so sehr, dass sie sie am liebsten ausreißen würde.
Das Licht kitzelt sie unter dem Kinn.
Frau Troffea legt den Kopf in den Nacken, blickt in die Sonne, bis sich ihre Augen mit Weiß füllen. Das Licht umwirbelt sie wie eine Wolke und schüttelt sie sanft wie ein vom Wind bewegtes Segel. Sie hebt einen Fuß, dann den anderen. Sie wiegt sich in den Hüften. In ihrer Ekstase öffnet sie die Lippen.
Unter dem blauen, brennenden Himmel hebt Frau Troffea die Hände und tanzt.
1
Lisbet streckt den Fuß, stemmt ihn gegen den hölzernen Bettrahmen, bis der Krampf nachlässt. Ihre Augen sind verklebt mit Schlaf, sie reibt ihn weg. Sie könnte noch eine Stunde länger liegen bleiben in der Stille des frühen Morgens, aber die Zeit ist kostbar und begrenzt. Heute kommt Hennes Schwester Agnethe aus den Bergen zurück, und alles wird anders werden.
Henne hat ihr den Rücken zugewandt, das Baumwollunterhemd so durchnässt, dass es fast durchsichtig wirkt, die Haut am Hals rosig, unter dem Haaransatz eine sternförmig hervortretende Narbe, wo ein Wundarzt ein Muttermal herausgeschnitten hat, das nicht aufhören wollte zu wachsen. Sie könnte ihre Hand zwischen seine Schulterblätter drücken, die Arbeit seines wie ein Bienenkorb summenden Atems spüren – aber das geht nicht, die Entfernung zwischen ihnen ist zu groß. Anfangs hat sie ihn immer berührt: Ihre Hände lagen auf seiner Stirn, zupften etwas Spreu aus seinem Haar. Manchmal küsste sie ihn auch heimlich hinter dem Rücken seiner Mutter. Diese Zärtlichkeiten sind jetzt vorbei.
Ihre Zehen verkrampfen sich wieder, und sie richtet sich mit einem Seufzer auf. Sie haben das Laken längst abgeworfen, schwitzen auf dem Stroh wie Pferde, ein Rinnsal läuft ihr den Rücken hinab. Am liebsten will sie ihr Nachthemd ausziehen, durch den Wald zum Fluss hinunter gehen und sich wie ein Schwein im Schlamm wälzen.
Sie rappelt sich auf, geht zum Fenster. Ein paar Bienen summen schläfrig an den Fensterläden vorbei, und sie fragt sich, ob die Tierchen sie ohne das schützende Baumwollgewand und das Weidengeflecht vor dem Gesicht erkennen, in ihrem süßen Schweiß ihren eigenen Honig riechen können.
Das Licht selbst erscheint wie gebündelt und dicht vor Hitze. Agnethe wird von ihrer Buße in einen düsteren Sommer zurückkehren. Kein Luftzug bewegt die mit Tierhäuten bespannten Fensterläden, nichts rührt sich, außer den Bienen und dem Schmerz in ihrem Bein, der sich wie mit Dornen bestückt bis in den Fuß hinunter ausbreitet. Sie nimmt die Unterlippe zwischen die Zähne, beißt gerade fest genug zu, um einen Schmerzreiz auszulösen. Damit will sie ihre Aufmerksamkeit von dem Bein fortlenken. In ihr regt sich das Kind, und sie sieht, wie flinke Schatten unter ihrem Nachthemd zucken wie Elritzen. Ist es noch da? Gut.
Sie faltet die Hände unter die Wölbung, die in letzter Zeit zu groß geworden ist, um sie an ihrer breitesten Stelle zu umschließen. Noch zwei Monate. So weit ist sie noch nie gekommen. Sie streicht mit dem Daumen über die straffe Haut und geht auf und ab, bis es ihr nicht mehr so vorkommt, als liefe sie auf heißen Glasscherben. Sie schafft acht Runden durch die Kammer, bis die Matratze raschelt.
»Lisbet?«
Sie geht weiter auf und ab.
»Lisbet. Bleib stehen.«
»Es ist heiß.«
Sie kann nur das Funkeln seiner Augen erkennen, seine Zähne, wenn er redet.
»Möchtest du ein Bier?«
»Nein.«
»Du solltest dich hinlegen. Dich ausruhen.«
Sie knirscht mit den Zähnen. Das hat sie in ihren früheren Schwangerschaften versucht, obwohl seine Mutter anderer Meinung war, wollte, dass sie vor der Entbindung aufstand und sich bewegte, um den Prozess voranzutreiben und sie zu stärken. Henne setzte sich beim ersten und zweiten Mal über den Wunsch seiner Mutter hinweg, und Lisbet verbrachte die Tage damit, wie eine Adlige im Bett zu liegen oder am Küchentisch zu sitzen, während er sie streichelte und beruhigte und ihr Milchknödel mit Honig in den Mund steckte.
Sie waren voller Hoffnung gewesen damals, und selbst nach dem sechsten Mal hatten sie von den Frauen in der Kirche schlimmere Geschichten gehört. Und jetzt sind fünf Jahre vergangen seit den Milchknödeln, und sie hat nichts Lebendiges vorzuweisen.
Sophey gibt ihr die Schuld, das merkt Lisbet deutlich. Immer wieder nennt sie Lisbet faul, obwohl sie sich um die Bienen kümmert, und erzählt ihrer Schwiegertochter, dass sie vor Heinrichs Geburt auf dem Feld gearbeitet und vor Agnethes Geburt Kühe gemolken hat.
»Deshalb hat Henne starke Schultern und Nethe starke Arme.«
Agnethe. Nethe. Der Name klingt beinahe mystisch in Lisbets Ohren, mythisch wie jene starken Arme oder das Kinn, das sie angeblich mit ihrem Bruder gemein hat. Schon bald wird Lisbet sehen, ob das alles wahr ist. Sophey und Henne erzählten in den ersten Jahren nur spärlich von Agnethe, und alle Fragen, die Lisbet stellte, wurden beiseitegewischt. Lisbet hatte immer das Gefühl, einen Raum zu betreten, den eine andere, kostbarere Person gerade verlassen hatte, ganz so, als suchte Henne nach einer Frau, um den Platz am Tisch zu füllen, den Agnethe hinterlassen hatte. Alles Vorboten: ihre Geburt unter dem Schweif des Kometen, ihre Ankunft kurz nach Agnethes Abreise, ihr mit dem Wahnsinn ihrer Mutter durchtränktes Blut. Eine Biene stößt an den Fensterladen. Sie tippt zurück.
Sogar Ida, die so gut darin war, Lisbet vom ersten Moment an das Gefühl zu vermitteln, dazuzugehören, streift nur die Grenzen der Wahrheit über Agnethe und gibt ihr keine Antwort, die über die Fakten hinausgeht. »Sie ist in einem Nonnenkloster auf dem Odilienberg und tut Buße.«
»Aber ihr wart Freundinnen«, beharrt Lisbet. Sie hat das Gefühl, als drückte sie auf einen blauen Fleck, wappnet sich gegen den Neid bei dem Gedanken, dass Ida eine andere Freundin so sehr liebt, wie sie Lisbet liebt. »Du musst doch wissen, weshalb sie dorthin gegangen ist?«
Aber Ida, trotz ihrer großen Augen und ihrer kindlichen Fröhlichkeit eine Meisterin der Zweideutigkeit, führte Lisbet immer am Thema vorbei und hin zu anderem Klatsch – Furmanns neueste Taktlosigkeit, Sebastian Brants Spielschulden –, bis Lisbet ihre Fragen vergaß und Agnethe sich wieder in einen Schatten verwandelte, der immer vager wurde.
Sieben Jahre Buße. Lisbet hat versucht, die Tiefen eines solchen Satzes auszuloten, seine besondere Schwere zu erfassen. Sie fragt sich, was sich ändern wird, wenn eine weitere Person im Haus ist. Agnethe ist nicht die Präsenz, für die Lisbet all die Jahre gebetet hat. Sie waren sich sicher, dass ein Kind geboren würde, lange bevor Agnethes Buße vorüber war, vielleicht gleich zwei oder drei wie bei Ida, die kleinen Gesichter sauber geputzt, die winzigen Fingernägel voller Bienenwachs. Lisbet schließt die Augen bei dieser Vorstellung, ein Geräusch entweicht ihr, jedes verlorene Kind ist eine leere Grube in ihrem Körper und ihrem Herzen. In die Lücke am Tisch wird eine erwachsene Frau treten, die von irgendeiner Sünde, die niemand aussprechen wird, reingewaschen ist.
Henne setzt sich stöhnend auf. Sie kann sehen, wie er sich in dem schwachen Licht, das durch einen Spalt zwischen den Fensterläden hereinfällt, die Augen reibt, seine Haut wirkt crèmefarben in der Dunkelheit.
»Schlaf weiter«, sagt sie schroffer als beabsichtigt.
Er wirft die zerknüllten Laken von den Füßen und steht auf. Seine Gestalt wird kompakter in der Dunkelheit. Sie hat seine Robustheit schon immer gemocht, seinen quadratischen Körper von der Arbeit im Wald, die Narben von Bienenstichen an seinen Handgelenken, noch aus der Zeit, bevor sie ihn kannten und ihm vertrauten. Sie begehrt ihn immer noch, obwohl er seine Pflicht nach jeder gescheiterten Geburt mit geschlossenen Augen erfüllt. Jetzt sieht er, dass sie ihn beobachtet, und wendet sich ab, um sich anzuziehen.
Sie öffnet die Fensterläden und wedelt die Biene zurück ins Freie. Die Bäume bedecken alles und reichen bis an die Grenze ihres ausgelaugten Hofes, wo so viele Wurzeln in einem endlosen Kampf klein gehackt und beseitigt werden müssen. Über ihnen steht bereits Licht, violett wie die Streifen auf ihrem Bauch. Die Morgendämmerung kommt direkt in ihre Schlafkammer, aber sie haben nie Zeit dafür, sie genauer zu betrachten.
Etwas Schweres landet auf ihren Schultern: Hennes Arm, er legt ihr ein Tuch um. Seit Tagen, vielleicht Wochen, ist diese Berührung das höchste der Gefühle gewesen. Schnell zieht er den Arm wieder zurück. Sie schüttelt das Tuch ab, fängt es auf und legt es über einen Stuhl.
»Es ist zu heiß.«
Er seufzt. Es gab eine Zeit, in der er sogar ihre Klagen charmant fand. Dann kicherte er, nannte sie Schatzi und Süße. Hatte sie nicht just an diesem Fenster gestanden, frisch verheiratet, und über die Kälte geklagt, als er ihr zum ersten Mal ein Baby gemacht hatte? Wenn sie lange genug hier steht, wird er sich vielleicht daran erinnern, wird sie umarmen. Sie hört ihn in den Topf pissen. Das Baby bewegt sich.
Sie wartet, bis er fertig ist, bevor sie sich umdreht. Ihr Bauch schlägt gegen den Fensterrahmen. »Ich gehe raus.«
Er hält den Nachttopf in der Hand. »Ich komme mit.«
Sie schüttelt den Kopf und schlüpft in ihr dünnstes Kleid. Es stinkt vom ständigen Tragen. Sie spürt das vertraute Summen in sich, den Wunsch, zu den Bienen und zu ihrem Baum zu gehen, dort mit ihren Babys allein zu sein, bevor der Tag beginnt. »Was, wenn Agnethe ankommt?«
Seine Schultern versteifen sich, und sie hört das Stocken in seinem Atem. Er macht sich Sorgen wegen der Rückkehr seiner Schwester. Früher hätte sie ihn vielleicht fragen können, warum. Jetzt liegt zwischen ihnen eine riesige Kluft, an deren Ränder sie sich nur zögerlich wagt.
»Sie wird erst in einigen Stunden hier sein. Es ist gefährlich, vor Tagesanbruch den Berg hinabzusteigen, und die Abtei ist einen Tagesritt entfernt.«
Er hat seine Holzschuhe schon angezogen, bevor sie ihre über die geschwollenen Zehen gezwängt hat. Wenn sie auf ihren Knöchel drückt, bleibt die Vertiefung, als wäre ihr Körper frischer Lehm, der kürzlich aus dem Boden geholt wurde. Er öffnet die Tür, sie durchqueren lautlos das dunkle Haus und gehen hinaus auf den Hof.
Die Luft bleibt wie Staub an ihr haften, und sie folgt Henne widerstrebend. Er leert den Nachttopf aus, wirft den Hühnern das letzte alte Brot zu, als sie am Stall vorbeigehen.
Die Hunde liegen träge in der Mitte des ungepflasterten Hofes. Fluh, die Kleine, ist neu und wild und kläfft jedes Mal, wenn sie Lisbet sieht, ganz so, als wäre sie in einer Köderfalle gefangen. Ulf, der Wolfshund mit dem verfilzten Fell, ist friedfertiger. Er kam als Welpe zu ihnen, nicht lange nach ihrer Ankunft, und springt nicht an ihr hoch oder verbeißt sich in ihren Rock.
Fluh scharrt die Erde auf und gräbt sich tiefer hinein, aber Ulf stemmt sich auf die Pfoten und trabt los, holt sie ein, als sie das Tor öffnen, an den summenden Kegeln der Bienenkörbe mit ihren erwachenden Insekten vorbeikommen und den Wald betreten.
Der Boden scheint nur aus Schatten zu bestehen, und Lisbet hebt die Füße, als würde sie waten. Die Fliegen sammeln sich um ihre Ohren, aber in diesem Hitzedunst kann sie sich nicht dazu durchringen, ihr Haar zu öffnen. Kein Geräusch ist zu hören außer dem Knacken der spröden Blätter, die schon früh von den Bäumen gefallen sind, und ihrem abgehackten Atem.
Henne geht ein Stück voraus, leicht seitwärts gedreht, um sich dem schmalen Pfad anzupassen. Er fragt sie nicht, welchen Weg sie gehen sollen: Er führt ganz einfach, und sie folgt ihm. Jetzt streckt er die Hand nach hinten aus, und sie fragt sich, ob es ihm wohl etwas ausmachte, wenn sie sie nähme. Aber dann senkt er die Hand auf Ulfs Kopf, und sie legt sich stattdessen ihre eigene auf den Bauch.
Sie kämpfen sich den steilen Hang nach oben zu einem Vorsprung, der in diesem zerfurchten Teil der Welt einem Aussichtspunkt wohl am nächsten kommt. Sie stellt sich vor, wie sie unter Gottes Daumen als Samen niedergedrückt werden, unwiderruflich und tief, und geht schneller, überholt Henne. An klaren Vormittagen, wenn der Wind den Dunst, der meistens über Straßburg schwebt, beiseiteschiebt, kann sie jede Kerbe auf dem Turm des Liebfrauenmünsters erkennen.
»Lisbet?« Henne steht neben ihr, seine Hüfte stößt an ihre. »Mach langsam.«
Sie versucht ihm zu sagen, dass es ihr gut geht, aber eine plötzliche Schwäche strömt ihren Rücken hinab, gesegnet kalt.
»Vorsicht.« Endlich legt er seine Hand um ihre Taille. Sie lehnt sich an ihn, bis die kleinen Funken, die in ihrem Blickfeld herumspringen, verschwunden sind. Immer noch hält er sie fest, und sie schließt die Augen. Ein Seufzen entweicht ihren Lippen, er lässt sie los, als hätte sie aufgeschrien. Sie stolpert, fängt sich dann wieder. »Komm, wir gehen nach Hause.«
Sie sind noch mehr als ein Dutzend Schritte vom Gipfel entfernt. In den ersten Monaten ihrer Ehe ist sie ihn oft hinaufgerannt und war schon wieder zurück, bevor Sophey bemerkte, dass sie weg war und ihre Hausarbeit vernachlässigte. Sie fühlt sich unbehaglich und angespannt, wünscht sich, sie wäre allein gekommen, hätte sich mehr Zeit genommen und wäre noch zum Baum gegangen. Aber jetzt ist die Sonne aufgegangen, und Sophey wird aufgestanden sein und sich auf Agnethes Rückkehr vorbereiten. Lisbet lässt sich von Henne klaglos zurück zum Hof führen. Bei den Bienenkörben macht sie Anstalten, ihre Hand auf das Tor zu legen, aber er stupst sie weiter.
»Ich werde mich schon darum kümmern.«
»Sie brauchen frisches Wasser …«
»Ich weiß«, sagt er in plötzlicher Erregung. »Das sind meine Bienen, Lisbet.«
Es sind nicht deine, denkt sie, und nicht meine.
Schon blickt Henne an ihr vorbei auf seine Aufgaben, auf seinen Tag, so konzentriert, dass er die Frau in ihrem staubigen Hof erst bemerkt, als Lisbet ihn am Arm fasst. Ihr Kopf ist so beschäftigt mit Agnethe, dass sie die Besucherin im Geiste einen oder zwei Köpfe größer macht, ihre Schultern verbreitert, Hennes Mund und Kinn über die feinen Gesichtszüge legt, über die bei ihrem Anblick bereits ein Lächeln huscht.
Aber dann kommt sie näher, mit ihrem goldenen Haar, das das Morgenlicht einfängt, einen Korb in den schlanken Händen. Es ist Ida.
»Guten Morgen, Ida.«
»Heinrich.« Ida erwidert Hennes knappes Nicken, aber ihre Augen sind über ihn hinweg auf Lisbet gerichtet. Niemand sieht sie so direkt an wie Ida, und das ist ein weiterer Grund, sie zu lieben. Henne geht zu den Bienenkörben. Man sollte denken, dass durch ihre gemeinsame Kindheit eine gewisse Leichtigkeit zwischen ihm und Ida herrschen würde. Tatsächlich aber steht etwas Hartes zwischen ihnen, wie der Kern einer Frucht. Vielleicht ist es Plater – Lisbet verabscheut Idas Ehemann so sehr, wie sie Ida anbetet.
Ida küsst Lisbets gerötete Wangen, den Atem süß von wilder Pfefferminze, die Lippen weich und trocken.
»Wie geht es dir heute Morgen?«, fragt Ida, und ihr Blick wandert auf mittlerweile vertraute Art von Lisbets Bauch hin zu ihrem Gesicht.
»Ganz gut«, sagt Lisbet, und die Sorgenfalte zwischen Idas Augenbrauen löst sich auf. Es gab so viele Tage, an denen Lisbet nur unter Tränen antworten konnte; inzwischen betrachtet sie jeden Tag des Schmerzes als einen weiteren Triumph.
»Schön«, sagt Ida und drückt ihre wunderbar kühle Hand auf Lisbets. »Sieh mal, was ich dir mitgebracht habe.«
Sie führt Lisbet zu dem Holzstapel, den Henne aufgeschichtet und im dampfenden Hof zum Trocknen zurückgelassen hat, und Lisbet sinkt dankbar auf das Holz, während Ida sich neben sie hockt, den Korb zwischen ihnen. Mit einer schwungvollen Bewegung zieht sie das Tuch zurück und enthüllt einen Sack voller Mehl, weiß wie frisch gefallener Schnee.
»Ein Geschenk für dich«, sagt Ida, »weil dir der Roggen nicht zugesagt hat.«
»Das kann ich doch nicht annehmen …«
»Fühl mal«, sagt Ida, und ihre Augen leuchten vor Freude.
»Meine Hände sind dreckig«, sagt Lisbet. In letzter Zeit sehen ihre Hände allerdings auch im sauberen Zustand einfach furchtbar aus, übersät mit Bienenstichen, angeschwollen von der Hitze. Sie will ihre nicht neben Idas legen, die so schlank und gepflegt wie die eines Neugeborenen sind. Aber Ida ergreift Lisbets heiße Finger und schaufelt eine Handvoll Mehl in ihre Handfläche. Es ist weich wie Blütenblätter, leicht und fein wie Staub.
»Mein Vater hat es extra für dich doppelt gemahlen«, erklärt Ida.
Zu ihrer Beschämung steigen Lisbet Tränen in die Augen, und sie schluckt den Kloß hinunter, der sich in ihrem Hals festgesetzt hat.
»Du dumme Gans«, sagt Ida lachend und wischt Lisbet die Wangen ab. »Du weißt sicher noch, dass ich in meinen letzten Monaten genauso war. Wie eine Regenwolke. Alles, was wir tun können, um dir Linderung zu verschaffen, ist uns eine Freude. Ich kann mir gut vorstellen, wie du dich bei dieser Hitze fühlst.«
»Mir geht es ganz gut«, sagt Lisbet scharf und schüttet das Mehl vorsichtig zurück in den Sack. Dieser Satz ist alles, was sie ihrer Freundin anbieten kann, wenn die fragt, wie es ihr geht.
Lisbet achtet darauf, nicht zu klagen, denn Gott könnte ja zuhören und beschließen, ihr auch dieses Baby zu nehmen. Das ist eine der vielen Abmachungen, die sie mit sich selbst getroffen hat. Sie balanciert sie alle so fein aus wie den Korb zwischen ihnen. Ida ist frei von solchen Bedenken: Sie hat jedes ihrer Kinder ohne einen einzigen Krampf oder eine Blutung ausgetragen, fordert das Schicksal und den Teufel heraus, ohne großartig darüber nachzudenken. Aber sie ist nicht Lisbet, die mit den offenkundigen Beweisen ihrer eigenen Verfluchtheit lebt, der auswendig gelernten Litanei: der Komet, Mutter, die Babys. So ein Trümmerhaufen. So viel Blut.
»Natürlich geht es dir gut«, sagt Ida und schubst Lisbet aus ihrem Selbstmitleid heraus. »Du musst das Mehl mit ganz frischem Wasser vermischen, und schau – mein Vater hat dir auch eine Prise Salz mitgegeben.«
»Das ist zu viel.«
»Lisbet, nichts ist zu viel für dieses Baby. Es wird bald zur Welt kommen, gesund und munter.«
Lisbet beißt sich fest in die Innenseiten ihrer Wangen. Sie hasst es, wenn Ida solche Dinge sagt. Sie kann das doch nicht wissen – niemand außer Gott weiß es.
»Und du musst darauf bestehen, dass das Brot nur für dich ist«, plappert Ida weiter. »Nicht für Henne oder Sophey.«
»Oder Agnethe«, fügt Lisbet hinzu. »Es wird anstrengend werden, das Brot vor allen zu verbergen.«
Die Knöchel von Idas Fingern, die den Korbgriff umfassen, färben sich weiß. »Kommt sie heute nach Hause?«, fragt sie betont leichthin, obwohl Lisbet weiß, dass sie die Antwort kennt.
»Heute Nachmittag«, sagt Lisbet. »Bist du extra so früh gekommen? Um sie zu sehen?«
»Natürlich nicht«, sagt Ida und errötet auf charmante Art. »Du weißt doch, dass wir keine Freundinnen sind.«
»Ich weiß gar nichts, denn du erzählst mir nie etwas.«
»Da gibt es nichts zu erzählen.«
»Ist es denn etwas so Schreckliches?«, fragt Lisbet. Sie weiß, dass sie schamlos klingt, aber das ist ihr egal. Es ist ihre letzte Chance, etwas über Agnethe zu erfahren, bevor sie sie kennenlernt. »Ich meine das, was sie getan hat?«
»Ich habe es dir schon hundertmal gesagt«, erwidert Ida, die sich bereits wieder unter Kontrolle hat. Ihre Hände lockern sich auf dem Weidengeflecht, ihre Wangen sind wieder bleich. »Ich weiß nichts über die Sünde von Ne… Agnethe. Jetzt ist sie sowieso reingewaschen. Sieben Jahre Buße – damit ist sie wieder unschuldig. Du darfst sie nicht danach fragen.«
Lisbet seufzt und verlagert ihr Gewicht. Sie will nicht mit Ida streiten, nicht mit ihrem Geschenk neben sich und in der Sonne, die das Holz unter ihnen so schnell aufheizt wie ihren Kopf.
»Danke«, sagt sie. »Bitte richte Mathias und deinem Ehemann meinen Dank aus.«
Ida schnaubt. »Glaubst du, mein Mann hatte etwas damit zu tun? Seine Pflichten binden ihn die meiste Zeit über an Straßburg.«
Ida tut das nicht leid, und Lisbet kann es ihr nicht verübeln. Plater ist nach der letzten Revolte zum Büttel und damit zum Vollstrecker des Rates der Einundzwanzig ernannt worden, zuständig für die härteren Angelegenheiten der Geschäfte des Rates in der Stadt und ihrer Umgebung. Mit eigenen Augen haben Ida und Lisbet bei ihren Almosengaben zersplitterte Türen in den Armenvierteln gesehen, und das Gefängnis am Fluss wird schon wieder vergrößert. Lisbet ist nicht die Einzige, die bemerkt hat, dass Plater Freude an seiner düsteren Arbeit hat.
»Da fällt mir etwas ein«, sagt Ida. »Er wird euch heute besuchen.«
»Plater?«
»Ja«, antwortet Ida. »Das hat er meinem Vater gesagt.«
»Wann denn?«
»Heute Nachmittag.«
»Vielleicht möchte er ja die Büßerin sehen.«
Ein Anflug von etwas huscht über Idas Gesicht. »Sie täte gut daran, ihm aus dem Weg zu gehen.«
»Wie meinst du das?«
»Sag Heinrich Bescheid, ja? Dass er kommt.«
»Natürlich«, sagt Lisbet. Wenn Ida derartig kurz angebunden ist, ist sie so uneinnehmbar wie eine verschlossene Kiste. Da ist nichts zu machen. Bevor ihre Freundin aufstehen kann, ergreift Lisbet ihre Hand. »Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst …«
»Was sitzt ihr hier faul herum?«
Idas Hand schließt sich krampfhaft um Lisbets. Sie blinzeln ins Licht. Plötzlich steht Sophey Wiler vor ihnen. Im hellen Gegenlicht erscheint ihre schmale Figur wie ein Strichmännchen, löst sich beinahe auf an der Stelle, an der sie die Hände in die Hüften stemmt. Eine Zornesfalte spaltet ihr Gesicht wie eine Narbe.
»Sophey«, sagt Ida und springt auf. »Wie geht es …«
»Ich habe zu tun«, sagt Sophey. »Was macht ihr hier so früh?«
»Sie hat mir ein Geschenk mitgebracht«, erklärt Lisbet, die von dem niedrigen Holzstapel kaum hochkommt. Zu spät erinnert sie sich an Idas Anweisung, das feine Mehl mit niemandem zu teilen, aber schon greift Sophey mit ihrer knotigen Hand nach dem Korb. Ida übergibt ihn ihr demütig, und Sophey schnüffelt am Inhalt.
»Vermissen deine Kinder ihre Mutter nicht?«
»Ich wollte mich gerade verabschieden«, sagt Ida. Sie ist genauso eingeschüchtert von Sophey wie alle anderen – niemand ist immun gegen ihre Macht. Ohne ein weiteres Wort dreht Sophey sich um und schreitet in die Küche.
»Sie ist immer so unhöflich zu dir«, sagt Lisbet.
»Sie ist zu allen unhöflich«, sagt Ida und zuckt mit den Schultern. »Und heute sind alle angespannt. Sogar Sophey Wiler ist sicherlich nervös, weil ihre Tochter zurückkehrt.«
»Das nehme ich auch an.«
Sie zieht Lisbet vorsichtig auf die Füße, küsst sie noch einmal auf die Wange und streichelt sanft ihren Bauch. »Pass gut auf das Kleine auf.«
»Pass du auf dich auf«, gibt Lisbet zurück und blickt ihrer schmächtigen Freundin nach, die vom Hof eilt. Hinter ihr sieht sie Henne bei den Bienen, wie er sich von Korb zu Korb bewegt, eine rauchende Schale in der Hand wie das Weihrauchfass eines Priesters. Er ist zu weit weg, als dass sie den Rosmarin riechen könnte, aber sie trägt ihn trotzdem in den Kleidern und im Haar. Das Ziehen in ihrer Brust spürt sie so intensiv, als wäre ihre Sehnsucht ein zwischen ihr und den Bienenstöcken gespannter Faden. Ihre Anziehung zu den Bienen kann man als übernatürlich bezeichnen, und wenn sie ihren Pflichten nachgeht, fühlt sie eine Art Neuordnung ihrer selbst, wie Himmelskörper, die sich zu Glück bringenden Sternbildern fügen. Sogar Sophey sieht das, obwohl sie es niemals offen zugeben würde.
Als Lisbet den Hof zum ersten Mal erblickte, fand sie ihn malerisch, mit seinen drei massiven Gebäuden, die ein offenes Quadrat bilden, das auf die Bienenkörbe und den dahinter liegenden Wald hinausgeht. Sie malte sich aus, wie Kinder im Staub des gepflegten Gartens spielten und an ihrem Rockzipfel hingen. Überall würde Lärm herrschen, Tränen und Lachen: die herrlichen Geräusche des Lebens und der Not.
Seit sie die Armenhäuser besucht hat, weiß sie, dass sie einen Lebensstandard pflegen, der in dieser Gegend als großer Komfort gilt. Bienen, eine Küche und drei Schlafkammern obendrein. Aber ihr Hof fühlt sich gleichzeitig leer und beengt an, und selbst im gleißenden Licht der Sonne erscheint er ihr irgendwie düster. Eingezwängt. Freude bereiten ihr nur die Bienen und ihr Baum: Ersteres hat Henne ihr geschenkt, Letzteres sie sich selbst.
»Lisbet!« Sopheys Stimme ist nicht bloß eine Aufforderung, sondern ein Befehl. Lisbet seufzt, kehrt den Bienen und dem verlassenen Hof den Rücken und geht hinein.
2
Sophey steht da wie ein Prophet mit Stab, den Besen in der Hand. Sie streckt ihn Lisbet hin.
»Die Kammer muss gefegt werden.«
Lisbet braucht nicht nachzufragen, welche sie meint. Es gibt Hennes Kammer, Sopheys Kammer, die Küche und die Kammer. Agnethes Kammer. Diese wurde verschlossen wie ein Grab. Lisbet hat in ihrem halben Jahrzehnt im Haus nur ein paarmal mitbekommen, wie die Tür geöffnet wurde. Einmal, um eine Amsel zu befreien, die durch die Fensterläden hereingeflogen war und sich anscheinend das Genick brechen wollte, und ein anderes Mal, als Plater kam, um Steuern auf ihre Türen und Fenster zu erheben, und sie so langsam zählte, dass sie sich fragte, ob er minutenweise bezahlt wurde. Sie können den Platz eigentlich nicht entbehren, haben aber die unausgesprochene Vereinbarung, dass Agnethes Kammer gemieden werden soll – ganz so, als wäre die Tür eine undurchdringliche Wand –, bis die Bewohnerin aus den Bergen zurückkehrt.
Unsicher nimmt Lisbet den Besen entgegen.
»Ich kümmere mich um die Brote«, sagt Sophey und wendet sich bereits ab. »Vergiss nicht, die Laken auszuklopfen.«
Als sie so auf der Schwelle steht und die abgestandene Luft riecht, während der Staub durch einen Spalt in den Fensterläden wirbelt, kommt es Lisbet vor, als wäre Agnethe bloß einen Moment weggegangen. Die Laken sind zerknittert, das Kissen ist eingedrückt, der Hocker in der Zimmerecke etwas verschoben, fast so, als wäre er leicht angestoßen worden, als seine Benutzerin sich erhob. Daneben steht eine breite Schale. So eine musste Lisbet in den ersten Monaten nach ihrer Ankunft für Sophey auf dem Markt erstehen. Vielleicht ist alles von Agnethes Sünde befleckt, und jeder einzelne Gegenstand muss die siebenjährige Buße abwarten, bevor auch er angefasst und reingewaschen werden kann.
Die Schale ist von einer feinen Staubschicht überzogen, das Wasser darin längst eingetrocknet. Doch als Lisbet sie anhebt, glaubt sie, den Geist eines Duftes einzufangen, kräuterig und süß wie Idas Atem. Daneben liegt ein Kamm aus vergilbtem Knochen, mit dick verfilzten, langen blonden Haaren, glänzend und brüchig. Lisbet wischt die Schale aus und stellt sie wieder an ihren Platz, zupft die Haare aus dem Kamm und öffnet die Fensterläden, um das grobe Gewirr nach draußen fallen zu lassen. Lisbet und Henne teilen ihre Aussicht mit Agnethe: Sie sehen direkt nach Osten, wo einige Bäume stehen. Vom Licht erhellt, verliert der Raum seine sorglose Verlassenheit und wirkt ein wenig trauriger.
Mit staubigen Fingern zieht Lisbet die Laken ab und fegt den Boden, findet kleine weiche Federn der Amsel sowie leere Schneckenhäuser, deren glitzernde Spuren durch die trockene Hitze nunmehr ein stumpfes Glänzen sind. Sie wischt sie weg, steckt Federn und Schneckenhäuser ein. Sie legt das Kissen zurück, dreht es so, dass der Abdruck unten liegt. Dabei verschiebt sich etwas unter dem Stoff und raschelt. Lisbet betrachtet die Nähte des Kissenbezugs, aber sie sind mit feinen Stichen gefertigt; weder sie noch Sophey, die beide unter geschwollenen Fingern leiden, können da im Moment etwas ausrichten.
Sie kann Sophey und Henne in der Küche sprechen hören. Sie schiebt ihren Fingernagel gegen den Faden, aber er schließt bündig mit dem Stoff. Lisbet zieht erst sanft, dann fester, und der ordentlich vernähte Faden gibt nach. Sie hakt ihren Finger in das Kissen hinein und durchsucht das Stroh, bis sie etwas Raues spürt, verknotet mit etwas Weichem. Sie zieht es heraus, und auf das Laken fällt eine blonde Haarlocke, die mit einem ungefärbten Seidenband zusammengebunden ist.
Lisbet hält sie in ihrer Handfläche, die Sonne spaltet sie in Licht und Schatten. Sie ist fast schwerelos, wirkt so grob wie die Strähnen, die sie aus dem Kamm gezogen hat. Die Farbe passt zwar zu diesem Gewirr und sogar zu Hennes Haar, doch Lisbet ist sich sicher, dass die Locke nicht von einem der Wiler-Geschwister stammt. Die Art, wie sie zusammengebunden, aufgehoben, verborgen wurde: alles zärtlich und unerlaubt wie die Bänder, die Lisbet am Tanzbaum angebracht hat.
»Lisbet?«
Sie erschrickt, lässt das Andenken fast fallen und faltet es sorgfältig in ihren Rock hinein, als sie sich zu Henne umdreht, der am Türpfosten lehnt und den Rahmen fast vollständig ausfüllt.
»Ich habe Hunger«, sagt er und gähnt, was seine Stimme seltsam verzerrt. Er hat gute Zähne, gerade aufgereiht und fest wie Grabsteine. Lisbet betastet die Lücken in ihrem Zahnfleisch mit der Zunge, zehn schwarze Löcher. Bei fast jedem verlorenen Baby hat sich ein Backenzahn gelöst und wurde dann von dem Wundarzt gezogen.
»Ich komme«, sagt sie und lauscht seinem schweren Schritt, dem leisen Kratzen der Bank auf alten Binsen. In ihrer Eile hat sie das feine Arrangement des Andenkens durcheinandergebracht, und sie richtet es so ordentlich wie möglich wieder her, bevor sie es an seinen Platz zurückschiebt. Agnethe soll alles so vorfinden, wie sie es verlassen hat.
Die heimkehrende Büßerin trifft am frühen Nachmittag ein. Sie ist ähnlich groß wie ihr Bruder, groß wie das gebückte Pferd, auf dem sie seit der Morgendämmerung von der Abtei auf dem Kamm des Odilienbergs hierhergeritten ist. Die ist nur dreimal so weit von ihrem Hof entfernt wie Straßburg, aber von einem solchen Ruf umweht, dass Lisbet das Gefühl hat, sich in der Gegenwart eines Wesens aus einer anderen Welt zu befinden.
Agnethe Wilers Auftritt ändert wenig an dieser Fantasie. Abgesehen von ihrer Größe, die sie ohne jede Rechtfertigung vor sich herträgt, ist da noch die Sache mit ihrem Kopf, der glatt rasiert ist wie eine geschälte Zwiebel und mit vielen Kerben und Narben vom wiederholten Scheren bedeckt. Farblich changiert die Haut vom Braun der älteren Partien bis hin zu neuem Rosa. Am groben Kragen ihres Gewandes blüht sogar frisches Rot. Als sie absteigt, den Kopf vor ihrer Mutter senkt und die Hände vor dem Körper faltet, erkennt Lisbet, dass sie ähnlich vernarbt sind wie die Kopfhaut. Sophey fasst ihre Tochter mit verkrümmten Fingern am Kinn und hebt ihren Kopf an. Agnethes Gesicht ist hohl an den Wangen, als wären sie hineingeschnitzt.
Und trotzdem sieht sie gut aus, das kann Lisbet nicht leugnen. Hennes Gesichtszüge wirken glatter an ihr, und selbst die Augen mit den ausgezupften Wimpern, den rosafarbenen und verkrusteten Lidern, dienen nur dazu, ihr Blau reiner zu zeigen, wie Perlen, die sich auf der dicken Zunge einer Auster präsentieren. Hätte sie so blondes und langes Haar wie Ida, könnte sie es vielleicht mit ihrer Schönheit aufnehmen. So aber fällt sie in eine eigene Kategorie, die seltsamste Frau, die Lisbet je gesehen hat.
»Hast du Hunger?«, fragt Sophey zur Begrüßung der Tochter, die sie seit über einem halben Jahrzehnt nicht mehr gesehen hat. Agnethe nickt, demütig in jeder Geste, doch Lisbet hält sie nicht für unterwürfig. Sie strahlt Stärke aus, obwohl sie versucht, sie zu unterdrücken.
Nichts ist verborgen, was nicht offenbar werden soll.
Es war eine von Geilers Lieblingspassagen, die von Sophey nachgeplappert und wie ein Speer auf Lisbet geschleudert wurde, etwa, wenn ein Fuchs ein Huhn schnappte oder als die Hofkatze krampfte und in Lisbets Armen starb. Doch als Lisbet Agnethe betrachtet, erkennt sie darin eine neue Bedeutung: keine Anklage, sondern eine Absichtserklärung.
Ohne ein weiteres Wort dreht Sophey sich um und geht hinein. Henne tritt vor und umarmt seine Schwester kurz, stößt sein Kinn an ihre hohle Wange, bevor er die Zügel des erschöpften Pferdes nimmt und es in den Schatten des Stalls führt, zu dem langen Trog, an dem auch das alte Maultier trinkt. Lisbet und Agnethe beobachten Henne, keine von beiden ist bereit, die Stille zu brechen, die sich über sie gelegt hat. Lisbet nimmt an, dass das Maultier nun zum Schlachter gebracht werden wird, jetzt, da sie das Pferd zurückhaben. Das uralte Tier hat geschwollene Knie und Wunden auf dem Rücken, die sich nicht mehr schließen wollen, sooft Lisbet sie auch mit Honig behandelt.
Sie wirft einen Blick auf ihre Schwägerin. Ihre Augen wirken aus der Nähe noch verblüffender, und ihr Blick ist klar und direkt. Lisbets Zunge regt sich in ihrem trockenen Mund.
»Hallo, Schwägerin«, sagt Agnethe. Ihre Stimme ist leise und heiser vom Nichtgebrauch. »Ich hoffe, es geht dir gut.«
Lisbet nickt. Sie weiß, dass sie die Frage erwidern sollte, aber angesichts von Agnethes vernarbtem und nacktem Kopf und ihren eingefallenen Wangen fühlt sie sich ohnmächtig. Dann tritt Henne zwischen sie, und sie folgen ihm hinein.
Auf dem blank gescheuerten Holz des Tisches dampfen Eier, ihre Schalen sind gesprenkelt. Lisbets Magen knurrt bei diesem Anblick und beim Duft des Brotes. Sophey hat es am Vormittag mit Idas Geschenk gebacken, zuvor ist der Teig in der Sonne schnell aufgegangen. Henne nimmt Platz, und Lisbet lässt sich dankbar auf die Bank fallen, bevor ihr einfällt, dass sie und Agnethe sich die Sitzgelegenheit jetzt teilen müssen.
Sie rutscht ein Stück, ihr Rock verfängt sich an den Splittern, die von den Kratzspuren der längst verendeten Tigerkatze stammen. Sie löst ihn, und Agnethe setzt sich vorsichtig neben sie, den Rücken kerzengerade. Lisbets Bauch bringt es mit sich, dass zwischen ihnen und dem Tisch fast ein halber Meter Luft liegt, aber Agnethe scheint das nichts auszumachen. Sie beugt ihren langen, sehnigen Hals, um zu beten. Lisbet entdeckt ältere, tiefere Narben, die unter der Rückseite ihres Gewandes verschwinden und wie abgeschnittene Flügel von ihrer Wirbelsäule ausgehen. Henne hüstelt, dann faltet auch Lisbet die Hände. Sophey spricht das Gebet, und alle stimmen in ihr Amen ein.
Sobald sie Brot und Eier verteilt haben, muss Lisbet ihren Hunger zügeln. Sie könnte das Doppelte, ja das Dreifache essen, würde den ganzen Teller von Henne schaffen, aber Sopheys grimmige Freude an ihrer Völlerei bremst sie. Sophey reißt das knusprige Brot in Stücke, um den Verbrauch besser überwachen zu können. Neben ihr hebt Agnethe das noch dampfende Ei an, hält es, als wäre es ein kühler Flusskiesel, und schält es, vorsichtig an der Innenhaut entlang. Das Ei kommt ganz und perfekt zum Vorschein. Lisbet weiß, dass es ihr wehtun muss, kann sehen, wie sich ihre blassen Fingerspitzen verdunkeln.
»Na, das ist ja ein neuer Trick«, bemerkt Sophey. »Du warst noch nie besonders sorgfältig. Haben sie dir auf dem Berg etwa beigebracht, Eier zu schälen?«
Agnethe lächelt schwach, die Augen auf ihre Tätigkeit gerichtet. Lisbet bemerkt, dass sie sich ein spitzes Stück Eierschale unter den Fingernagel schiebt.
Sophey schnaubt. »Haben sie dir dort auch das Schweigen beigebracht? Früher hat sie nie den Mund gehalten.«
Agnethe drückt ihren Fingernagel nach unten, und Lisbet sieht am Rande Blut aufsteigen, aber ihr Gesichtsausdruck ändert sich nicht.
»Nun denn«, sagt Sophey in die Stille hinein. »Nun denn.«
Sie schlägt ihr eigenes Ei auf, und Lisbet macht es ihr nach und stellt fest, dass das Eigelb kalkig und blass ist. Sie haben Glück, dass die Hühner überhaupt Eier legen – was sie zu geben haben, wird in letzter Zeit immer dürftiger. Sie denkt sehnsüchtig an das Salz, das Ida mitgebracht hat, aber Sophey hat es zusammen mit der Münze und dem Seidenstück, einst Agnethes Mitgift, irgendwo versteckt.
Agnethe bricht ihr Brot zögerlich. Sie steckt es schnell in den Mund, fast so, als könne es ihr entrissen werden. Lisbet hört ein leises Grollen der Lust aus Agnethes langer Kehle. Sie stopft sich etwas Brot in ihren eigenen Mund. Es schmeckt so gut, wie es riecht.
»Das Mehl ist feiner, als wir es gewohnt sind«, bemerkt Henne. »Zu Ehren von Agnethes Rückkehr?«
»Ein Geschenk«, erklärt Lisbet. »Von Ida.«
Plötzlich hört sie ein würgendes Geräusch neben sich. Lisbet dreht sich um und sieht, wie Agnethe eine Hand vor den Mund presst und sich ruckartig vom Tisch erhebt, wobei sie die Bank und Lisbet darauf fast umwirft.
»Nethe«, sagt Sophey warnend. Während alle Blicke auf sie gerichtet sind, senkt Agnethe die Hand, kaut, bis das Brot Brei sein muss, und schluckt schließlich mit großer Anstrengung.
Sophey nickt, anscheinend zufrieden. Lisbets Herz schlägt absurd schnell, ganz so, als wäre sie es gewesen, die von Sopheys hartem Blick getroffen wurde.
Schweigend essen sie weiter. Hennes Gesicht ist gezwungen ausdruckslos, aber Lisbet kennt ihn gut genug, um seine Anspannung in dem leichten Hochziehen seiner Schultern zu erkennen. Sie hat ihren Vorsatz vergessen, langsam zu essen, und ihr Teller ist schon halb leer, als Agnethe ihren von sich wegschiebt.
»Haben sie dir in der Abtei erlaubt, Essen zu verschwenden?«, fragt Sophey scharf. Agnethe lässt nicht erkennen, dass sie sie gehört hat, doch sie führt das Ei an den Mund und nimmt jetzt winzige Bissen davon. Als Sopheys Aufmerksamkeit sich wieder ihrem eigenen Essen zugewandt hat, packt Agnethe den Rest des Brotes und legt es blitzschnell auf ihren Schoß, außer Sichtweite ihrer Mutter. In einem weiteren Wimpernschlag reicht sie es seitlich an Lisbet weiter, die die immer noch dampfende Kruste dankbar entgegennimmt.
Als Zeichen ihres Dankes stupst Lisbet mit dem Knie Agnethe an, jetzt sind sie Verbündete. Agnethes Bein fühlt sich kühl und fest wie Marmor an, aber dann zieht sie es zurück und beendet den Kontakt so schnell, wie Lisbet ihn begonnen hat.
Agnethe steht auf, um den Tisch abzudecken, und Lisbet schließt sich ihr an. Sie nimmt Hennes Teller und trägt ihn zur Tür, um die Krümel nach draußen zu werfen. Sie stößt sie mit dem Ellbogen auf, doch sie klemmt. Lisbet drückt fester, und von der anderen Seite her ruft jemand.
Das Hindernis ist plötzlich nicht mehr da, und Lisbet spürt, wie sie zu fallen droht. Sie wappnet sich für den Sturz, ergibt sich bereits dem Schmerz, dem Blut, dem fatalen Nachgeben ihres Bauches, einem weiteren Band im Baum, nimmt dabei wahr, wie Holz aufeinanderschlägt, wie der Mann – denn es war eine Männerstimme, die auf der anderen Seite etwas rief – zur Seite ausweicht, um nicht von ihrer Masse zerquetscht zu werden, und dann, wie kalte, dünne Finger mit der Stärke von Draht sie unter der Achselhöhle und um die Rippen packen und ihrer Kehle ein erschrockenes Keuchen entlocken.
Agnethe zieht Lisbet hoch, holt die Bank mit dem Fuß heran und senkt Lisbet sanft darauf nieder. Schnaufend zieht sie Lisbets Rock gerade, denn er ist hochgerutscht und hat den dunklen Flaum ihrer Waden entblößt. Der ganze Vorgang hat nur Sekunden gedauert. Der Teller, den Agnethe fallen ließ, um Lisbet zu retten, rollt immer noch klappernd weiter.
»Nun, das war vielleicht ein Willkommensgruß.«
Ein schwerer Fuß stoppt den Teller. Lisbet erkennt den Mann an seiner Stimme, an seinen robusten Stiefeln mit dicken Sohlen und weichem Kalbsleder, die ihm aus den Außenbezirken des Imperiums geschickt wurden, und an seinem Geruch: Leder von seinem Wams, das er selbst an den heißesten Tagen trägt, versehen mit dem Wappen der Einundzwanzig, Rauch aus seiner Pfeife und Schweiß. Sie riecht das alles manchmal an Ida, obwohl sie weiß, dass ihre Freundin sich jedes Mal, nachdem sie den Beischlaf vollzogen haben, mit fanatischer Sorgfalt wäscht, ganz so, als könnte sie sich seine Plage von der Haut scheuern.
Henne erhebt sich. »Plater.«
Lisbet beißt sich auf die Lippe – sie hat vergessen, ihren Mann vor seinem Besuch zu warnen.
»Wiler«, entgegnet Plater. Er ist ein großer Mann in seinen Stiefeln, von der Größe her Henne und Agnethe ebenbürtig, wenn auch schmächtiger gebaut als die beiden, mit einem fast mädchenhaft schönen Mund und dichtem Haar in der Farbe von Kupfer. Tatsächlich hat er wunderschönes Haar. Seine Tochter, die es geerbt hat, strahlt einen hypnotisierenden Zauber aus, der Passanten zum Stehenbleiben zwingt, aber Plater verleiht es einen unnatürlichen Glanz, der fast schon teuflisch erscheint.
»Sophey.« Er nickt der Bäuerin zu.
»Und die junge Wiler.« Das gilt Lisbet, die sofort die Augen senkt und wie immer den Hass in sich spürt, den sie teils von Ida übernommen und teils selbst kultiviert hat. Der Raum hat sich zusammengezogen mit seiner Ankunft.
»Und …« Er verweilt in der Pause, und Lisbet wird plötzlich bewusst, wie still Agnethe geworden ist, fast wie ein Hase im Visier eines Fuchses. Sie zittert nicht einmal, aber sie ist Lisbet so nahe, dass die ihr stoßweises Atmen hören kann, als Plater sie mit seinem grünäugigen Blick anstarrt. »Agnethe Wiler, aus den Bergen zurückgekehrt.«
Ein leises Geräusch entweicht Agnethe, so schwach, dass Lisbet es als Einzige hört, und wieder denkt sie an einen Hasen, der sein Leben aushaucht, wenn die Kiefer zuschnappen.
»Sie ist es nicht mehr gewohnt, mit ihrer Stimme umzugehen«, sagt Sophey. Vielleicht soll das eine Verteidigung ihrer Tochter sein, aber der weniger wohlwollende Teil von Lisbet denkt, dass es eher eine Ehrerbietung gegenüber dem Mann des Rates ist. Sophey ist, wie Ida einmal festgestellt hat, allen gegenüber unhöflich, aber Autorität – und die einzige Autorität, die sie über ihrer eigenen ansiedelt, ist diejenige Gottes und damit die der Kirche und der Einundzwanzig – macht sie so unterwürfig, wie eine derart stahlharte Frau nur sein kann.
»Natürlich«, sagt Plater. Seine Aufmerksamkeit ist so intensiv auf Agnethe gerichtet, dass Lisbet überrascht ist, dass sie unter diesem Gewicht nicht auf die Knie sinkt. In seinem Blick liegt etwas Abstoßendes. Lisbet würde es lüstern nennen, wäre es nicht mit Abscheu gepaart. Sein Blick schweift über Agnethes vernarbten Kopf, ihre Schlüsselbeine, ihre Hände, die an ihren Seiten zu Fäusten geballt sind. Er hat etwas Übernatürliches an sich, strahlt eine solche Bedrohung aus, dass er beinahe glüht. Der unbegreifliche Gedanke, dass Ida neben diesem Mann liegt, schockiert sie aufs Neue. »Du bist also fast geheilt?«
»Fast?«, wiederholt Lisbet, aus ihrem Schweigen aufgeschreckt. »Sieben Jahre sind vergangen.«
»Sie muss im Münster beten«, sagt Plater. »So lautete die ursprüngliche Entscheidung. Es fehlt noch ein abschließendes Bittgebet in ihrer Heimatstadt.«
Agnethe nickt knapp. »Das habe ich nicht vergessen«, sagt sie mit angespannter Stimme.
»Es spricht!«, ruft Plater. »Die Priester können dich also bald erwarten?«
»Morgen«, erwidert Agnethe.
»Du kannst sicher sein, dass sie ihre Buße vollenden wird«, sagt Henne erregt. »Wir kennen das Gesetz, wir hätten schon dafür gesorgt.«
»Er meint nur, dass Ihr Euch nicht die Mühe hättet zu machen brauchen, uns persönlich aufzusuchen«, sagt Sophey und wirft ihrem Sohn einen scharfen Blick zu.
»Deshalb bin ich nicht hier«, sagt Plater mit übertriebener Überraschung, ganz so, als wolle er andeuten, dass Agnethe so weit unter seiner Würde ist, dass sie für ihn praktisch unsichtbar ist. Als hätte er sie seit seiner Ankunft nicht angestarrt wie ein Beutetier. »Ein Glas Bier, wenn ich bitten darf, Agnethe.«
»Warum bist du dann hier?«, fragt Henne, und Sophey zischt ihm eine Warnung zu. Henne behandelt Plater wie den Jungen, mit dem er sich als Kind die Knie aufgeschürft hat, und nicht so, wie er es sollte: als den Mann nämlich, der mit der Macht der Einundzwanzig spricht. Henne weigert sich zu vergessen, dass Plater der Sohn eines Arbeiters ist, der sich nur durch seine Bereitschaft auszeichnet, seine Hände im Austausch gegen parfümiertes Wasser zu beschmutzen, um sie wieder reinzuwaschen.
»Ich habe einen Brief, Wiler«, sagt Plater und holt ihn aus seiner Brusttasche, noch versiegelt. Lisbet erkennt, dass das Pergament durchweicht ist, befleckt von seinem Schweiß. »Möchtest du vor die Tür gehen?«
»Das ist der Hof meiner Mutter«, sagt Henne. »Wenn sie mithören will, soll sie es nur tun.«
»Soll ich ihn dir vorlesen?«
»Auch ich habe das Lesen gelernt«, sagt Henne und geht um den Tisch herum, um sich das Schreiben zu schnappen, wobei er in der Hast das Siegel zerbricht. Lisbet späht auf die Buchstaben, obwohl sie natürlich nicht über seinen Namen – Heinrich Wiler – hinaus lesen kann, der oben in ordentlicher, geneigter Schreibschrift prangt. Sie erkennt, dass das Siegel aus ihrem eigenen Wachs besteht, ungefärbt und unvermischt: das tiefste, reinste Gold. Es erfüllt sie mit Stolz, wenn sie ihre Produkte bei der Verwendung in der Kirche oder bei den Einundzwanzig selbst beobachtet. Sebastian Brant, der Syndikus der Stadt, bestellt es extra, das ist eine hohe Ehre. Aus Hennes gereizter Reaktion schließt Lisbet nun, dass der Brief keine guten Nachrichten bringt.
»Tatsächlich ist es eine Vorladung«, erklärt Plater, der seine Freude über ihre Bestürzung kaum verbergen kann. Ohne ein Wort des Dankes nimmt er Agnethe den Bierbecher ab, und sie zieht schnell ihre Hand zurück.
»Vor Gericht?«, fragt Sophey verwirrt.
»Nach Heidelberg«, sagt Henne. »Wir müssen unsere Rechte an unserem Land verteidigen.«
Heidelberg. Die Stadt, in der der Papst gefangen gehalten wurde. Dort befinden sich eine Art Gericht und außerdem eine Universität. Es sind mehrere Tagesritte nach Heidelberg, aber bis jetzt haben sie noch keinen Grund gehabt, dorthin zu reisen.
»Du musst dich der Anschuldigung stellen, dass deine Bienen von dem Land stehlen, das nur Gott gehört.«
»Wir alle gehören Gott«, sagt Henne, und Lisbet legt sanft eine Hand auf seine feste Taille. »Was soll also diese Anschuldigung?«
Plater gestikuliert und verschüttet dabei Bier auf den Boden. Er zeigt zu den ordentlich eingezäunten Bienenkörben, die sich vom Hof bis zum Wald erstrecken, zum Schuppen und zum Hühnerstall. Das Haus scheint durch seine Aufmerksamkeit noch baufälliger geworden zu sein. »Wo sind deine Wildblumen, Wiler? Wo ist der Nektar, der deine Bienen ernährt, das Wachs so süß macht?«
»Im Wald«, sagt Henne. »So wie seit eh und je. Wir haben Genehmigungen, so wie andere, die ihr Vieh auf den Feldern weiden lassen müssen …«
»Warst du in letzter Zeit im Wald? Es ist dir vielleicht entgangen, aber der Sommer ist brutal dieses Jahr.« Lisbet umfasst Henne fester. »In der Wildnis vertrocknen Blumen oder wachsen erst gar nicht. Und im Osten, beim Kloster, gibt es zwei Dutzend Morgen Kornblumen und Mohnblumen, die täglich gegossen werden.«
Jetzt wird es Lisbet klar, und zwar so deutlich, als hätte sie den Brief selbst gelesen. Es geht um eine alte Behauptung, die etwa alle zwei Jahre neu erhoben wird, nämlich dass sie den Mönchen in Altdorf alles gestohlen hätten, von den Bienen bis zum Honig. Tatsächlich sind die Mönche selbst Diebe, die den Fluss umleiten, um damit ihre Felder zu bewässern, und so alle flussabwärts berauben.
»Das ist längst geklärt«, sagt Henne. »Meine Frau hat die zusätzlichen Bienenkörbe beigesteuert. Sie hat nämlich die Waldbienen für unsere Bienenstöcke gewonnen.«
»Hier geht es nicht um die Bienen«, sagt Plater. »Bist du dir sicher, dass ich es dir nicht vorlesen soll?«