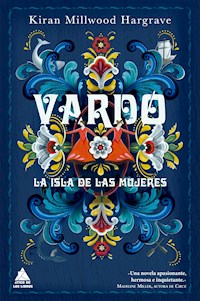5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vardø, Norwegen am Weihnachtsabend 1617. Maren sieht einen plötzlichen, heftigen Sturm über dem Meer aufziehen. Vierzig Fischer, darunter ihr Vater und Bruder, zerschellen an den Felsen. Alle Männer der Insel sind ausgelöscht – und die Frauen von Vardø bleiben allein zurück.
Drei Jahre später setzt ein unheilvoller Mann seinen Fuß auf die abgelegene Insel. In Schottland hat Absalom Cornet Hexen verbrannt, jetzt soll er auf Vardø für Ordnung sorgen. Ihn begleitet seine junge norwegische Ehefrau. Ursa findet die Autorität ihres Mannes aufregend und hat zugleich Angst davor. Auf Vardø begegnet sie Maren und erkennt in ihr etwas, das sie noch nie zuvor erlebt hat: eine unabhängige Frau. Doch für Absalom ist Vardø nur eins - eine Insel, die von Gott verlassen wurde und die er von teuflischer Sünde befreien muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Vardø, Norwegen am Weihnachtsabend 1617. Maren sieht einen plötzlichen, heftigen Sturm über dem Meer aufziehen. Vierzig Fischer, darunter ihr Vater und Bruder, zerschellen an den Felsen. Alle Männer der Insel sind ausgelöscht – und die Frauen von Vardø bleiben allein zurück.
Drei Jahre später setzt ein unheilvoller Mann seinen Fuß auf die abgelegene Insel. In Schottland hat Absalom Cornet Hexen verbrannt, jetzt soll er auf Vardø für Ordnung sorgen. Ihn begleitet seine junge norwegische Ehefrau. Ursa findet die Autorität ihres Mannes aufregend und hat zugleich Angst davor. Auf Vardø begegnet sie Maren und erkennt in ihr etwas, das sie noch nie zuvor erlebt hat: eine unabhängige Frau. Doch für Absalom ist Vardø nur eins – eine Insel, die von Gott verlassen wurde und die er von teuflischer Sünde befreien muss.
Über die Autorin
Kiran Millwood Hargrave wurde 1990 in Surrey geboren. Schon in ihrem ersten Jahr an der Universität begann sie Lyrik zu verfassen und veröffentlichte drei Gedichtbände und ein Theaterstück. Ihre Kinderbücher wurden in England sofort zu Bestsellern, sie gewann den Waterstones Children’s Book Prize und den British Book Award für das Children’s Book of the Year. »Vardø. Nach dem Sturm« ist ihr erster Roman für Erwachsene. Mit ihrem Mann Tom und der Katze Luna lebt die Autorin in Oxford direkt am Fluss.
KIRAN
MILLWOOD
HARGRAVE
VARDØ
Nach dem Sturm
Roman
Aus dem Englischen
von Carola Fischer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Kiran Millwood Hargrave
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel
The Mercies bei Picador, London
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Diana Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Antje Nissen
Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik & Typografie, Christian Otto
unter Verwendung eines Motives
von Trevillion Images © Magdalena Russocka © Zoltan Toth
Herstellung: Gabriele Kutscha
Satz: Leingärtner, Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-641-24946-5V002
www.diana-verlag.de
Im Namen des Königs
Jeder Zauberer oder Gläubige, der Gott sowie sein heiliges Wort und das Christentum opfert und einen Bund mit dem Teufel eingeht, soll mit dem Tode bestraft und auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden.
Aus dem Dänisch-Norwegischen Trolddom
(Zauberei) Dekret von 1617,
1620 in Finnmark in Kraft getreten
Sturm
Vardø, Finnmark,
nordöstliches Norwegen
1617
Letzte Nacht hat Maren geträumt, dass ein Wal auf den Felsen vor ihrem Haus gestrandet war.
Sie kletterte die Klippen zu seinem wogenden Körper hinunter, blickte ihm direkt ins Auge, schlang ihre Arme um den großen, stinkenden Leib. Mehr konnte sie nicht für ihn tun.
Die Männer kamen die schwarzen Felsen hinuntergehastet wie dunkle, flinke Insekten, glänzend und gestählt mit langen Messern und Sensen. Sie begannen die Klingen zu schwingen und zu schneiden, noch bevor der Wal tot war. Er bockte, und alle zerrten verbissen, als würden sie Netze über einem Fischschwarm festziehen, während ihre Arme – lang und stark – um ihn griffen, so groß und heftig war ihre Umarmung, bis sie nicht mehr wusste, ob sie ein Trost oder eine Bedrohung für ihn war und es ihr gleich war, bis ihr Auge nur noch sein Auge ansah, ohne zu blinzeln. Schließlich blieb er still liegen, sein Atem verflüchtigte sich, während sie hackten und sägten. Sie roch den Tran, der schon in den Lampen brannte, lange bevor er aufhörte, sich zu regen, lange bevor sich die leuchtende Bewegung seines Auges unter ihrem Blick trübte.
Sie versank zwischen den Felsen, bis sie auf dem Meeresgrund stand. Die Nacht über ihr war dunkel und mondlos, die Wasseroberfläche von Sternen gezeichnet. Sie ertrank und tauchte keuchend wieder aus dem Schlaf auf, Rauch in der Nase und in der dunklen Kehle. Der Geschmack von brennendem Fett haftete unter ihrer Zunge und würde nicht mehr fortgespült werden.
1
Der Sturm kommt heran wie ein Fingerschnipsen. So werden sie in den darauffolgenden Monaten und Jahren davon sprechen, wenn er nicht mehr nur ein Schmerz hinter ihren Augen und ein ersticktes Schluchzen tief in ihren Kehlen ist. Wenn er sich endlich in Geschichten einfügt. Selbst dann erzählt er nicht, wie es wirklich war. Es gibt Arten, wie Worte hinunterfallen: Zu schnell geben sie eine Form, leichtfertig. Und was Maren sah, besaß keine Anmut und keine Leichtigkeit.
An jenem Nachmittag ist das beste Segel wie ein Laken auf ihrem Schoß ausgebreitet, mamma und Diinna sitzen an seinen Enden. Ihre kleineren, geschickteren Finger nähen mit kleineren, ordentlicheren Stichen die Risse, die der Wind geschlissen hat, während Maren Flicken auf die Löcher setzt, die durch die Befestigung des Stoffs am Mast entstanden sind.
Neben dem Feuer liegt ein Stapel Heidekraut zum Trocknen, das ihr Bruder Erik im Mittelgebirge auf dem Festland geschnitten und heimgebracht hat. Morgen, nach dem Sturm, wird mamma ihr drei Handvoll für ihr Kissen geben. Sie wird das Heidekraut auseinanderreißen, Moos dazutun und alles in den Überzug stopfen, der Honigduft beinahe Übelkeit erregend nach Monaten des schalen Geruchs nach Schlaf und ungewaschenen Haaren. Sie wird es zwischen die Zähne nehmen und schreien, bis ihre Lungen den süßlichen Geschmack nach Erde pfeifend ausatmen.
Jetzt bemerkt sie etwas, hebt den Kopf und blickt zum Fenster hinaus. Ein Vogel, dunkel in der Dunkelheit, ein Geräusch? Sie steht auf, um sich zu strecken, die Bucht zu beobachten, flaches Grau und dahinter das offene Meer, die Wellenkämme glitzern wie zerbrochenes Glas. Die Boote heben sich vage durch die zwei kleinen Lichter ab, Bug und Heck, ein spärliches Flackern.
Sie glaubt, sie könne pappas und Eriks Boot von den anderen unterscheiden, das zweitbeste Segel fest an den Mast geschlagen. Die ruckartige Bewegung, das Anhalten und sofortige Ansetzen ihres Ruderns, mit dem Rücken zum Horizont, wo die Sonne lauert, jetzt seit einem Monat außer Sicht und auch noch für einen weiteren. Die Männer werden die konstanten Lichter von Vardøs Häusern sehen, verloren in ihrem eigenen Meer schwach erleuchteten Landes. Sie sind schon weit draußen hinter Hornøya Eiland, beinahe an dem Ort, wo früher am Nachmittag der Fischschwarm gesichtet wurde, den ein Wal in helle Aufregung versetzt hatte.
»Er wird weitergezogen sein«, sagte pappa. Mamma hat große Angst vor Walen. »Sich vollgefressen haben, bis Erik es mit seinen dünnen Gräten geschafft hat, uns dorthin zu bringen.«
Erik neigte nur den Kopf, damit mamma ihn küssen und seine Frau Diinna einen Daumen auf seine Stirn pressen konnte, denn die Sámi sagen, dass dadurch ein Faden gesponnen wird, der die Männer draußen auf See wieder nach Hause holt. Einen Moment lang legte er seine Hand auf ihren Bauch, und die Wölbung zeichnete sich deutlich unter ihrem Oberteil ab. Sie schob seine Hand weg, entschieden, aber sanft.
»Es ist noch zu früh. Lass das.«
Später wird Maren sich wünschen, sie wäre aufgestanden und hätte sie beide, pappa und Erik, auf die rauen Wangen geküsst. Sie wird sich wünschen, sie hätte sie in ihren zusammengenähten Seehundfellen zum Wasser gehen sehen, der weit ausholende Schritt des Vaters und Erik schlurfend hinterdrein. Wünschen, dass sie überhaupt etwas gefühlt hätte über ihren Weggang, etwas anderes als Dankbarkeit für die Zeit allein mit mamma und Diinna, die Ungezwungenheit mit den anderen Frauen.
Denn mit zwanzig und ihrem ersten Heiratsantrag drei Wochen zuvor betrachtete sie sich endlich als eine von ihnen. Dag Bjørnsson war dabei, aus dem zweiten Bootshaus seines Vaters ein Heim für sie beide zu bauen, und noch vor Winterende wäre es fertig und sie verheiratet.
Im Inneren, erzählte er ihr, während sein heißer, kratziger Atem keuchend an ihr Ohr drang, würde es eine gute Feuerstelle und eine eigene Speisekammer geben, sodass er nicht mit seiner Axt durch das Haus laufen müsste wie pappa. Das böse Glitzern, selbst in pappas behutsamen Händen, ließ die Galle in ihr hochsteigen. Dag wusste das, und es war ihm wichtig.
Er war blond wie seine Mutter, mit feinen Gesichtszügen, die andere Männer für Schwäche hielten, aber ihr war das gleich. Sie hatte nichts dagegen, dass sein breiter Mund ihren Hals streifte, als er ihr von dem Laken erzählte, das sie für das Bett weben sollte, das er ihnen bauen würde. Und obwohl sie nichts bei seinem zögerlichen Streicheln ihres Rückens fühlte, zu zart und zu weit oben, als dass es durch ihr blaues Winterkleid hindurch viel bedeutete, rief dieses Haus, das ihres sein würde – diese Feuerstelle und dieses Bett –, ein Pochen in ihrem Unterleib hervor. Nachts presste sie ihre Hände auf die Stellen, wo sie die Wärme spürte, die Finger kalte Stäbe über ihren Hüften und taub genug für die Illusion, nicht ihre eigenen zu sein.
Nicht einmal Erik und Diinna haben ihr eigenes Haus: Sie wohnen in dem schmalen Raum, den Marens Vater und ihr Bruder an die Rückseite ihrer Außenwand angebaut haben. Ihr Bett füllt die gesamte Breite aus, drückt sich direkt an Marens, nur die Trennwand dazwischen. In ihren ersten gemeinsamen Nächten legte sie die Arme um den Kopf, atmete das moderige Stroh ihrer Matratze ein, hörte jedoch nicht einmal einen Atemzug. Es war ein Wunder, als Diinnas Bauch sich rundete. Das Baby würde zur Welt kommen, wenn der Winter gerade vorüber wäre, und dann wären sie zu dritt in diesem schmalen Bett.
Später wird sie denken: Vielleicht hätte sie auch nach Dag Ausschau halten sollen.
Doch stattdessen holte sie das beschädigte Segeltuch, breitete es über ihren Knien aus und sah nicht auf, bis der Vogel oder das Geräusch oder die Veränderung in der Luft sie zum Fenster riefen, um die über das dunkle Meer gleitenden Lichter zu beobachten.
Ihre Arme knacken: Sie legt einen vom Nähen rauen Finger an den anderen und schiebt ihn unter den wollenen Ärmelaufschlag, spürt, wie sich die Härchen aufstellen und die Haut darunter sich zusammenzieht. Die Boote rudern noch, immer noch gleichmäßig in dem flimmernden Licht, flackernde Lampen.
Dann erhebt sich das Meer, und der Himmel schwenkt nach unten aus, und grünliches Licht schlingt sich über alles, blitzartig wird die Dunkelheit zu einer leuchtenden, schrecklichen Helligkeit. Mamma wird ans Fenster geholt von dem Licht und dem Lärm. Das Meer und der Himmel stoßen zusammen wie ein sich spaltender Berg, sodass sie es durch ihre Sohlen im ganzen Körper spüren kann, während Marens Zähne sich in ihrer Zunge vergraben und heißes Salz ihre Kehle hinunterläuft.
Und dann sind sie beide vielleicht am Schreien, aber es ist kein Laut zu hören, bis auf das Meer und den Himmel, und alle Bootslichter sind verschlungen, und die Boote blitzen auf, und die Boote wirbeln herum, die Boote fliegen, drehen sich, sind verschwunden. Maren stürzt nach draußen in den Wind, vornübergebeugt wegen ihrer augenblicklich durchnässten Röcke. Diinna ruft sie zurück, während sie die Tür hinter sich zuzerrt, damit das Feuer nicht ausgeht. Der Regen ist eine Last auf ihren Schultern, der Wind schleudert sie zurück, die Hände, fest zusammengepresst, greifen nichts. Sie schreit so laut, dass ihr Hals noch tagelang wehtun wird. Um sie herum stürzen sich andere Mütter, Schwestern, Töchter in das Unwetter: dunkle, regennasse Gestalten, unbeholfen wie Seehunde.
Der Sturm lässt nach, bevor sie den Hafen erreicht, zweihundert Schritte von zu Hause, seine leere Mündung klafft zum Meer hin. Die Wolken ziehen nach oben, die Wellen senken sich, alles bleibt an seinem Horizont, sanft wie eine sich niederlassende Vogelschar.
Die Frauen von Vardø sammeln sich an der ausgehöhlten Seite ihrer Insel, und obwohl einige von ihnen noch schreien, klingt Schweigen in Marens Ohren. Vor ihr ist der Hafen glatt gestrichen wie ein Spiegel. Ihr Kiefer sitzt in seinen eigenen Gelenken fest, von ihrer Zunge tröpfelt warmes Blut ihr Kinn hinunter. Ihre Nadel ist in das Gewebe zwischen Daumen und Zeigefinger eingefädelt, die Wunde ein exakter roter Kreis.
Während sie hinsieht, erleuchtet ein letzter Blitzstrahl die hassenswert ruhige See, und aus der Dunkelheit steigen Riemen und Ruder empor und ein ganzer Mast mit sorgsam verstauten Segeln, wie ein entwurzelter Unterwasserwald. Von ihren Männern ist nichts zu sehen.
Es ist Heiligabend.
2
Über Nacht wird die Welt weiß. Schnee häuft sich auf, Schnee füllt die Fenster und die Türöffnungen. Die Kirche bleibt dunkel an diesem Weihnachten, diesem ersten Tag danach, ein Loch zwischen den erleuchteten Häusern, das Licht schluckt.
Drei Tage lang werden sie eingeschneit, Diinna in ihrer schmalen Kammer, Maren ebenso unfähig vom Bett aufzustehen wie mamma. Sie essen nur altes Brot, das ihnen wie Steine im Magen liegt. Für Maren fühlt sich die Nahrung in ihr so fest an und ihr Körper drumherum so unwirklich, dass sie in ihrer Vorstellung nur von mammas alten Broten auf der Erde festgehalten wird. Wenn sie nichts isst, wird sie zu Rauch werden und sich im Dachgesims ihres Hauses sammeln.
Sie hält sich selbst zusammen, indem sie ihren Bauch füllt, bis er schmerzt, und indem sie so viel wie möglich von sich in die Wärme des Feuers rückt. Überall, wo es sie berührt, ist sie real. Sie hebt ihre Haare, um ihr schmutziges Genick herzuzeigen, spreizt ihre Finger, damit die Wärme zwischen ihnen leckt, sie hebt ihre Röcke, sodass ihre Wollstrümpfe zu sengen und zu stinken beginnen. Da und dort und dort. Ihre Brüste, ihr Rücken und zwischen ihnen ihr Herz sind in ihrem Winterleibchen gefangen, eng zusammengeschnürt.
Am zweiten Tag geht, zum ersten Mal seit Jahren, das Feuer aus. Pappa hat es immer entfacht, und sie haben es nur in Gang gehalten, haben es nachts mit Asche bedeckt und jeden Morgen die Kruste zerbrochen, um sein heißes Herz atmen zu lassen. Innerhalb von Stunden sind ihre Decken mit einer Frostschicht überzogen, obwohl Maren und ihre Mutter im selben Bett schlafen. Sie sprechen nicht miteinander, sie kleiden sich nicht aus. Maren wickelt sich in pappas alten Seehundfellmantel. Das Fell ist nicht ordentlich abgehäutet und stinkt ein wenig nach verfaultem Fett.
Mamma trägt Eriks Mantel aus der Zeit, als er noch ein Kind war. Sie hat stumpfe Augen wie ein geräucherter Fisch. Maren versucht sie dazu zu bewegen, etwas zu essen, aber ihre Mutter rollt sich nur auf ihre Bettseite und seufzt wie ein Kind. Maren ist dankbar für die weiße Leere am Fenster, denn so ist das Meer außer Sicht.
Diese drei Tage sind ein Abgrund, in den sie stürzt. Sie beobachtet, wie pappas Axt in der Dunkelheit blinkt. Ihre Zunge wird dick und belegt, die weiche Stelle, auf die sie während des Sturms gebissen hat, schwammig und geschwollen, mit etwas Hartem in der Mitte. Sie beißt darauf herum, und das Blut macht sie durstiger.
Sie träumt von pappa und Erik, wacht schweißnass auf, mit frierenden Händen. Sie träumt von Dag; als er den Mund öffnet, ist er voller Nägel für ihr gemeinsames Bett. Sie fragt sich, ob sie und ihre Mutter hier sterben werden, ob Diinna schon tot ist, ob das Baby aber noch in ihrem Bauch strampelt, immer langsamer. Sie fragt sich, ob Gott zu ihnen kommen und ihnen befehlen wird zu leben.
Beide stinken sie, als Kirsten Sørensdatter sie am dritten Abend freischaufelt. Kirsten hilft ihnen, Holz aufzuschichten und endlich das Feuer wieder anzuzünden. Als sie den Weg zu Diinnas Tür freiräumt, sieht Diinna beinahe wütend aus, das Fackellicht fängt den matten Schein ihrer gespitzten Lippen ein, die Hände fest an die Seiten ihres geschwollenen Bauchs gepresst.
»Kirke«, sagt Kirsten zu ihnen allen. »Es ist Sabbat.«
Selbst Diinna, die nicht an ihren Gott glaubt, widerspricht nicht.
Erst als sie alle in der Kirche versammelt sind, begreift Maren: Fast alle ihre Männer sind tot.
Toril Knudsdatter zündet die Kerzen an, jede einzelne, bis der Raum so hell strahlt, dass Marens Augen brennen. Sie zählt stumm. Früher gab es dreiundfünfzig Männer, jetzt sind ihnen nur dreizehn geblieben: zwei im Arm gehaltene Babys, drei Alte, der Rest sind Jungen, noch zu klein für die Boote. Sogar den Pfarrer haben sie verloren.
Die Frauen sitzen in ihren angestammten Bankreihen, zwischen ihnen Lücken, wo ihre Ehemänner und Söhne saßen, aber Kirsten beordert sie nach vorn. Alle bis auf Diinna gehorchen, dumpf wie eine Herde. Sie besetzen drei der sieben Bankreihen in der Kirche.
»Schiffbrüche hat es schon früher gegeben«, sagt Kirsten. »Wir haben überlebt, wenn Männer ertrunken sind.«
»Aber noch nie so viele«, sagt Gerda Folnsdatter. »Und nie war mein Mann unter ihnen. Niemals deiner, Kirsten, oder Sigfrids. Niemals Torils Sohn. Sie alle …«
Sie fasst sich an den Hals, verstummt.
»Wir sollten beten oder singen«, schlägt Sigrid Jonsdatter vor, und die anderen blicken sie böse an. Sie waren drei Tage lang eingeschlossen, und das Einzige, was sie sich wünschen, worüber sie sprechen können, ist der Sturm.
Die Frauen von Vardø, sie alle, suchen nach Zeichen. Der Sturm war eines. Die Leichen, die erst noch angespült werden, betrachten sie als ein weiteres. Doch jetzt spricht Gerda von der einzelnen Seeschwalbe, die sie über dem Wal kreisen gesehen hat.
»In Form einer Acht«, sagt sie, ihre roten Hände ziehen Bögen durch die Luft. »Einmal, zweimal, dreimal, sechs Mal habe ich gezählt.«
»Acht mal sechs hat keine besondere Bedeutung«, sagt Kirsten geringschätzig. Sie steht neben der Kanzel mit dem geschnitzten Sockel von Pastor Gursson. Ihre großen Hände liegen darauf, und der breite Daumen, der die geschnitzten Formen entlangfährt, ist das einzige Anzeichen ihrer Nervosität oder Trauer.
Ihr Ehemann ist unter den Ertrunkenen, und all ihre Kinder wurden begraben, bevor sie atmeten. Maren mag sie, hat viele Arbeiten mit ihr zusammen erledigt, aber jetzt sieht sie Kirsten so wie die anderen sie schon immer gesehen haben: als eine Frau abseits der anderen. Sie steht nicht hinter der Kanzel, aber es könnte so sein: Sie betrachtet sie mit dem Blick eines Geistlichen.
»Der Wal aber«, sagt Edne Gunnsdatter, dicke Schwellungen im Gesicht vom Weinen, die wie Prellungen aussehen. »Er schwamm mit der Unterseite nach oben. Ich habe seinen weißen Bauch zwischen den Wellen glänzen gesehen.«
»Er war am Fressen«, sagt Kirsten.
»Er hat die Männer geködert«, sagt Edne. »Er hat den Fischschwarm sechs Mal in die Nähe von Hornøya getrieben, um sicherzugehen, dass wir das sehen.«
»Ich habe das gesehen«, sagt Gerda und bekreuzigt sich. »Ich habe das auch gesehen.«
»Hast du nicht«, erwidert Kirsten.
»Ich habe das Blut gesehen, das Mattis vor einer Woche auf den Tisch gehustet hat«, sagt Gerda. »Es ließ sich nicht wegschrubben.«
»Ich kann das für dich abschmirgeln«, sagt Kirsten sanft.
»Der Wal war falsch«, sagt Toril. Ihre Tochter schmiegt sich so fest an ihre Seite, dass sie mit Torils berühmten ordentlichen Nadelstichen an ihrer Hüfte festgemacht sein könnte. »Wenn es stimmt, was Edne sagt, wurde er gesandt.«
»Gesandt?«, fragt Sigfrid, und Maren sieht, wie Kirsten ihr in dem Glauben, eine Verbündete gefunden zu haben, einen dankbaren Blick zuwirft. »Ist so etwas möglich?«
Aus den hintersten Reihen der Kirche dringt ein Seufzer, und der ganze Raum wendet sich Diinna zu, aber sie neigt ihren Kopf nach hinten, die Augen geschlossen, die braune Haut ihres Halses schimmert golden im Kerzenlicht.
»Der Teufel wirkt auf finstere Weise«, sagt Toril. Ihre Tochter drückt ihr Gesicht unter die Schulter ihrer Mutter und schreit angsterfüllt auf. Maren fragt sich, welche Angst Toril in den vergangenen drei Tagen ihren zwei Kindern eingeflößt hat, die noch am Leben sind. »Seine Macht steht über allem, nur nicht über der von Gott. Er könnte so etwas gesandt haben. Oder es könnte gerufen worden sein.«
»Schluss damit.« Kirsten bricht das Schweigen, bevor es tiefer werden kann. »Das hilft nichts.«
Maren möchte ihre Gewissheit mit ihr teilen, aber sie muss immerzu an die Gestalt, an das Geräusch denken, das sie zum Fenster gehen ließ. Sie hatte gedacht, es sei ein Vogel gewesen, aber jetzt taucht das Wesen bedrohlich groß und schwerfällig vor ihr auf, fünf Flossen und mit der Unterseite nach oben. Unnatürlich. Man kann es unmöglich davon abhalten, in die Ecke ihres Sichtfelds einzudringen, auch nicht im heiligen Licht der Kirche.
Mamma erwacht, wie aus dem Schlaf, obwohl sich die Kerzen in ihren starren Augen widerspiegeln, seit sie sich hingesetzt haben. Als sie spricht, kann Maren den Tribut hören, den das Schweigen ihrer Stimme abverlangt.
»In der Nacht, als Erik geboren wurde«, sagt mamma, »war ein roter Lichtpunkt am Himmel.«
»Ich erinnere mich«, sagt Kirsten leise.
»Und ich«, sagt Toril. Und ich, denkt Maren, obwohl sie erst zwei war.
»Ich folgte ihm über den Himmel, bis er ins Meer fiel«, sagt mamma, die Lippen bewegt sie kaum. »Das ganze Wasser leuchtete rot. Er war gezeichnet – von dem Tag an war es bestimmt.« Sie stöhnt und bedeckt das Gesicht mit den Händen. »Ich hätte ihn niemals aufs Meer hinaus lassen sollen.«
Ihre Worte rufen eine neue Welle des Wehklagens hervor. Nicht einmal Kirsten kann etwas dagegen tun. Die Kerzen flackern, als ein kalter Windstoß in den Raum weht und Maren sich gerade rechtzeitig umdreht, um Diinna aus der Kirche eilen zu sehen. Alles, was Maren sagen könnte, während sie den Arm um mamma legt, wäre nur ein schwacher Trost: Für ihn gab es nichts anderes als das Meer.
Vardø ist eine Insel, der Hafen ist wie ein an einer Seite abgebissenes Stück Land, die anderen Ufer sind zu hoch oder zu felsig, um dort Boote zu Wasser zu lassen. Maren kannte Netze, bevor sie Schmerz kannte, Wetter, bevor sie Liebe kannte. Im Sommer sind die Hände ihrer Mutter mit den Sternchen von Fischschuppen gesprenkelt, Fischleiber werden zum Salzen und Trocknen aufgehängt wie weiße Stoffwindeln oder andernfalls in Rentierfelle gewickelt und vergraben, um zu verfaulen.
Pappa sagte immer, dass das Meer ihrem Leben Gestalt gebe. Sie haben immer von seiner Gunst gelebt, und lange schon sterben sie draußen auf dem Meer. Doch durch den Sturm ist es ein Feind geworden, und kurz wird darüber gesprochen, wegzugehen.
»Ich habe Angehörige in Alta«, sagt Gerda. »Dort gibt es genug Land und Arbeit.«
»Ist der Sturm nicht bis dorthin gekommen?«, fragt Sigfrid.
»Wir werden es bald erfahren«, sagt Kirsten. »Ich denke, aus Kiberg werden wir Nachricht bekommen, sicherlich hat der Sturm dort auch gewütet.«
»Meine Schwester wird mich benachrichtigen«, sagt Edne und nickt. »Sie hat drei Pferde, und es ist nur ein Tagesritt.«
»Und eine raue Überfahrt«, sagt Kirsten. »Das Meer ist noch stürmisch. Wir müssen ihnen Zeit lassen.«
Maren hört zu, während die anderen von Varanger, oder noch fremdartiger, Tromsø reden, als ob irgendjemand von ihnen sich ein Leben in der Stadt, so weit weg von hier, vorstellen könnte. Es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit darüber, wer die Rentiere zum Transport nutzen darf, denn sie gehörten Mads Petersson, der zusammen mit Torils Mann und Sohn ertrunken ist. Toril scheint zu glauben, dass sie deshalb über ihnen steht, doch als Kirsten verkündet, dass sie sich um die Herde kümmern werde, erhebt niemand Einwände. Maren kann sich nicht vorstellen, Feuer zu machen, ganz zu schweigen davon, den Winter über eine Herde reizbarer Tiere zu hüten. Wahrscheinlich denkt Toril das Gleiche, denn sie lässt ihren Anspruch so schnell fallen, wie sie ihn erhoben hat.
Schließlich gerät die Unterhaltung ins Stocken, versiegt dann ganz. Nichts ist beschlossen, außer dass sie auf Nachricht aus Kiberg warten oder jemanden hinschicken werden, wenn sie bis Ende der Woche nichts hören.
»Bis dahin ist es am besten, wenn wir uns täglich in der kirke treffen«, sagt Kirsten, und Toril nickt eifrig, ausnahmsweise einverstanden. »Wir müssen aufeinander aufpassen. Die Schneefälle scheinen weiterzuziehen, aber man weiß nie.«
»Haltet nach Walen Ausschau«, sagt Toril, und das Licht fällt auf ihr Gesicht, sodass Maren die Kieferknochen unter der Haut mahlen sehen kann. Sie sieht unheilvoll aus, und Maren möchte lachen. Sie beißt sich auf die weiche Stelle ihrer Zunge.
Niemand spricht mehr davon, fortzugehen. Während sie den Hügel hinunter heimwärts läuft und mamma sich so fest an ihren Arm klammert, dass es wehtut, fragt sich Maren, ob die anderen Frauen sich auch so fühlen wie sie: an diesen Ort gebunden, mehr denn je. Wal oder kein Wal, ein Zeichen oder keines, Maren war die Zeugin des Todes von vierzig Männern. Jetzt ist etwas in ihr an dieses Land gefesselt, so gefesselt, dass sie gefangen ist.
3
Neun Tage nach dem Sturm, kurz nach dem Jahreswechsel, werden die Männer zu ihnen gebracht. Beinahe vollständig, beinahe alle. Ausgebreitet wie Opfergaben in der kleinen schwarzen Bucht oder andernfalls hochgetrieben von der Flut bis zu den Felsen unter Marens Haus. Sie müssen klettern, um sie zu holen, und benutzen dazu die Seile, die Erik fest verknotet hat, um die Eier aus den Vogelnestern in der Felswand zu klauben.
Erik und Dag sind unter den Ersten, die zurückkommen, pappa unter den Letzten. Pappa hat einen Arm verloren, Dag ist verbrannt, eine schwarze Linie zieht sich von seiner linken Schulter bis zum rechten Fuß, was mamma zufolge bedeutet, dass er vom Blitz getroffen wurde.
»Es muss schnell gegangen sein«, sagt sie, ohne ihre Bitterkeit zu verbergen. »Es muss leicht gewesen sein.«
Maren presst die Nase gegen die Schulter und atmet sich selbst ein.
Ihr Bruder sieht aus, als schliefe er, doch seine Haut ist von diesem schrecklichen grünen Licht erfüllt, das sie schon von anderen Leichen kennt, die die Flut angetrieben hat. Ertrunken. Nicht so leicht.
Als Maren an der Reihe ist, die Klippen hinunterzuklettern, birgt sie Torils Sohn, der wie Treibholz an den scharf gezackten Felsen hängt. Er ist in Eriks Alter, und sein Körper rutscht in seinen Knochen herum wie zerlegtes Fleisch in einem Sack. Maren streicht ihm das dunkle Haar aus dem Gesicht, nimmt einen Seetangfaden von seinem Schlüsselbein. Edne und sie müssen ihn an Taille, Rippen und Knien zusammenschnüren, damit sein Körper nicht auseinanderfällt, als er zu seiner Mutter hinaufgezogen wird. Maren ist froh, dass sie Torils Gesicht nicht sehen kann, als sie zu ihrem Jungen gebracht wird. Obwohl sie die Frau nicht mag, stechen ihre Totenklagen wie winzige Nadeln in Marens Brust.
Der Boden ist zu hart, um die Toten zu begraben, deshalb einigen die Frauen sich darauf, dass sie vorerst im ersten Bootshaus von Dags Vater bleiben, wo die Kälte sie ebenso gefroren hält wie den Grund. Es wird noch Monate dauern, bis sie die Oberfläche aufbrechen und ihre Männer beerdigen können.
»Wir können das Segel als Leichentuch verwenden«, sagt mamma, nachdem Erik in den Bootsschuppen gebracht wurde. Sie betrachtet das geflickte Segel, das in der Mitte auf dem Boden liegt, als ob Erik bereits darunter wäre. Es liegt genau an der Stelle, wo sie es zwei Wochen zuvor fallen gelassen haben. Maren und mamma sind im weiten Bogen drumherum gegangen, keine von ihnen mochte es anfassen, doch nun hebt Diinna es auf und schüttelt den Kopf.
»Verschwendung«, sagt sie, und Maren ist froh: Sie kann den Gedanken nicht ertragen, dass ihr Vater und ihr Bruder mit einem weiteren Teil des Meeres am Körper unter die Erde gebracht werden. Diinna faltet das Segel mit flinken Bewegungen und legt es auf ihren Bauch, in ihrer Entschlossenheit entdeckt Maren etwas von dem lachenden Mädchen, das im letzten Sommer ihren Bruder geheiratet hat.
Doch einen Tag, nachdem Dag und Erik zurückgebracht wurden, verschwindet Diinna. Mamma ist außer sich, dass sie fortgegangen ist, um ihr Kind bei ihrer Sámi-Familie aufzuziehen. Sie sagt schlimme Dinge, von denen Maren weiß, dass sie sie nicht so meint. Sie nennt Diinna eine Lappin, eine Hure, eine Wilde, Dinge, die Toril oder Sigfrid sagen könnten.
»Ich habe es immer gewusst«, schluchzt mamma. »Ich hätte nie zulassen dürfen, dass er eine Lappin heiratet. Sie sind nicht loyal, sie sind nicht wie wir.«
Maren kann sich nur auf die Zunge beißen und mamma den Rücken reiben. Es ist wahr, dass Diinna ihre ganze Kindheit hindurch umhergezogen ist, und selbst im Winter unter wechselnden Sternen gelebt hat. Ihr Vater ist ein noaidi, ein angesehener Schamane. Bevor die Kirche sich fest in Vardø etabliert hatte, gingen ihr Nachbar Baar Ragnvalsson und viele andere Männer zu dem noaidi und baten um einen Zauber gegen das schlechte Wetter. Das hat erst vor Kurzem aufgehört, seit neue Gesetze solche Handlungen verbieten, doch Maren sieht immer noch die kleinen Knochenfiguren auf den meisten Türschwellen, die, wie die Sámi sagen, vor Unglück schützen sollen. Pastor Gursson hat stets darüber hinweggesehen, obwohl Toril und ihresgleichen ihn gedrängt haben, härter gegen solche Bräuche vorzugehen.
Maren weiß, dass Diinna nur aus Liebe zu Erik eingewilligt hat, in Vardø zu leben, aber sie glaubt nicht, dass Diinna einfach so gehen würde, nicht wenn sie schon so viele Menschen verloren haben. Nicht mit Eriks Baby in ihrem Bauch. Sie würde nicht so grausam sein, dass sie ihnen den letzten Teil von ihm wegnimmt.
Noch in der gleichen Woche erhalten sie Nachricht aus Kiberg. Ednes Schwager teilt mit, dass sie dort, abgesehen von zahlreichen im Hafen vertäuten Booten, nur drei Männer verloren haben. Als die Frauen sich in der Kirche versammeln, um die Nachricht zu hören, wächst ihrer aller Unbehagen.
»Warum haben sie nicht gefischt?«, fragt Sigfrid. »Hat man in Kiberg den Schwarm nicht gesehen?«
Edne schüttelt den Kopf. »Den Wal auch nicht.«
»Er war also uns gesandt worden«, flüstert Toril, und ihre Angst verbreitet sich in raunenden Wellen über die Bankreihen.
Das Gespräch ist zu ungezwungen für einen heiligen Ort, voller Omen und Ausschmückungen, doch niemand kann der Gelegenheit zu klatschen widerstehen. Ihre Worte sind wie Schlingen, an die sie Tatsachen hängen können, die sich bei jedem Erzählen fester zusammenziehen. Vielen von ihnen scheint es egal zu sein, was wahr ist und was nicht, sie brauchen nur dringend einen Grund, eine gewisse Ordnung, um ihr Leben umzustellen, selbst wenn sie von einer Lüge herrührt. Dass der Wal mit der Unterseite nach oben schwamm, steht jetzt außer Frage, und obwohl Maren versucht, sich gegen die schleichende Angst zu stemmen, die das Gerede mit sich bringt, kann sie sich nicht wie Kirsten behaupten.
Kirsten ist in Mads Peterssons Haus gezogen, um die Rentiere besser versorgen zu können. Maren blickt sie an, wie sie unerschütterlich neben der Kanzel steht. Sie haben kaum miteinander gesprochen, seit Kirsten sie aus dem Schnee freigeschaufelt hat, haben nur ein paar Trauerworte ausgetauscht, als ihre bereits verwesenden Männer aus dem Meer gezogen wurden. Maren nimmt sich vor, mit ihr zu sprechen, als die Zusammenkunft in der Kirche sich dem Ende zuneigt, doch Kirsten ist schon aus der Tür und läuft mit großen Schritten auf ihre neue Heimstätte zu, gegen den Wind gebeugt.
Diinna ist zurück an dem Tag, als sie pappa finden. Das Erste, was Maren von ihrer Rückkehr mitbekommt, ist Geschrei beim Bootshaus, und während sie hinläuft, stellt sie sich alles Mögliche vor: ein neuer Sturm, obwohl sie selbst sehen kann, dass der sonnenlose Himmel ruhig ist, oder ein Mann, der noch lebend gefunden wurde.
Eine Schar Frauen ist an der Tür, Sigfrid und Toril vorn, die Gesichter wutverzerrt. Vor ihnen steht Diinna mit einem anderen Sámi: ein kleiner, stämmiger Mann, der die Frauen kühl ansieht. Es ist nicht Diinnas Vater, aber er hat eine Schamanentrommel an der Hüfte. Diinna und der Mann halten ein zusammengerolltes Stück silberglänzenden Stoffs in ihren Händen. Als Maren näher kommt, schwindelig von der Anstrengung des Laufens, sieht sie, dass es Birkenrinde ist.
»Was ist los?«, fragt sie Diinna, und Toril antwortet.
»Sie will sie da drin begraben.« Ihre Stimme klingt beinahe hysterisch. Spucke bespritzt ihr Kinn. »So wie sie es machen.«
»Macht keinen Sinn, Stoff zu benutzen, nicht für so viele«, sagt Diinna. »Das hier ist …«
»Ich will das nicht in der Nähe meiner Jungen haben.« Toril keucht heftiger als Maren und sieht die Trommel an, als wäre sie eine Waffe. Sigfrid Jonsdatter nickt zustimmend, während Toril weiter wettert. »Und auch nicht in der Nähe meines Ehemannes. Er ist ein frommer Mann, und ich werde euch nicht zu ihm lassen.«
»Ich kann mich nicht erinnern, dass du etwas gegen meine Hilfe einzuwenden hattest, als noch ein Baby in dir wachsen sollte«, sagt Diinna.
Toril legt ihre Hand flach auf ihren Bauch, obwohl ihre Kinder schon lange geboren sind. »So etwas habe ich nicht getan.«
»Ich weiß genauso gut wie alle anderen hier, dass du das getan hast, Toril«, sagte Maren, unfähig, angesichts dieser Lüge still zu bleiben. »Und du auch, Sigfrid. Viele von euch sind zu ihr gekommen oder zu ihrem Vater.«
Toril verengt die Augen zu Schlitzen. »Ich würde niemals zu einem lappischen Zauberer gehen.«
Allgemeines Fauchen. Maren macht einen Schritt nach vorn, aber Diinna hält sie mit ihrem ausgestreckten Arm zurück.
»Ich sollte ein Loch in deine Zunge machen, Toril. Vielleicht würde dann etwas von dem Gift abfließen.« Jetzt ist Toril an der Reihe zurückzuweichen. »Und es ist keine Zauberei, und es ist auch nicht für eure Söhne und Männer.«
Diinna dreht sich zu Maren. Sie ist wunderschön in dem bläulichen Licht, das markante Gesicht, die vollen Wimpern. »Es ist für Erik.«
»Und meinen Vater.« Marens Stimme bricht. Sie kann es nicht ertragen, die beiden zu trennen, und pappa hat Diinna geliebt, war stolz auf die Verbindung von seinem Sohn und der Tochter eines noaidi gewesen.
»Ist er zurückgekommen?« Maren nickt, und Diinna fasst sie an der Schulter. »Und für Baar Ragnvalsson natürlich auch. Wir werden bei ihnen wachen. Und bei allen anderen, die das ebenfalls möchten.«
»Und wird deine Mutter glücklich darüber sein?«, fällt Toril über Maren her, aber sie ist zu erschöpft, um mehr zu tun, als nur zu nicken, und der Kopf auf dem Hals fühlt sich schwer an.
Schließlich einigt man sich darauf, dass alle Männer von denen, die sich die Sámi-Riten wünschen, ins zweite Bootshaus gebracht werden, das einmal Marens Heim werden sollte. Nur zwei Männer werden gleich nach Erik und pappa dorthin getragen: der arme Mads Petersson, der keine Familie hat, die für ihn sprechen könnte, und Baar Ragnvalsson, der häufig im Mittelgebirge verschwand und Sámi-Kleidung trug.
Das zweite Bootshaus wäre ein schönes Heim gewesen. Allein der Eingangsbereich des Schuppens ist so groß wie Diinnas und Eriks Kammer, und der Hauptraum konkurriert mit dem im Haus von Dags Vater, dem größten im Dorf. Die Bretter für ihr Bett liegen dort, bereit, dass Dags sorgsame Hände sie zusammenbauen.
Sie nehmen das Holz für ihr Feuer und legen ihren Vater und Erik auf den nackten Boden. Maren muss Dag in dem ersten Bootshaus zurücklassen: Seine Mutter, Fru Olufsdatter, hat kein Wort mit ihr gesprochen, ist nicht gewillt, sie anzusehen.
Hastig greift Maren nach einer Locke von Eriks gefrorenen Haaren und verstaut sie sorgfältig in ihrer Rocktasche. Nachdem sie Diinna und den noaidi in dem stillen Raum zurückgelassen hat, läuft sie um das erste Bootshaus herum. Sie sieht, dass eine der Frauen ein Kreuz über die Tür genagelt hat, und es fühlt sich weniger wie ein Segen für jene drinnen als eine Abwehr derer draußen an.
Als sie nach Hause kommt, schläft mamma, den Arm über die Augen gelegt, als weiche sie vor einem Albtraum zurück.
»Mamma?« Maren möchte ihr von dem noaidi erzählen und dem zweiten Bootshaus. »Diinna ist zurück.«
Keine Antwort. Mamma scheint kaum zu atmen, und Maren widersteht dem Drang, ihre Wange über den Mund der Mutter zu halten, um zu sehen, ob sie noch lebt. Stattdessen holt sie die Locke aus ihrer Tasche, hält sie vor das Feuer. Es kräuselt Eriks feines Haar. Sie macht einen Schnitt in ihr Kissen und legt die Locke zu dem Heidekraut.
Jeden Tag nach der Kirche geht Maren zu dem zweiten Bootshaus, aber sie kann sich nicht dazu durchringen, dort wie Diinna und der Mann mit der Trommel zu schlafen. Er spricht kein Norwegisch und verrät ihr auch keine einfache Version seines Namens, deshalb nennt Maren ihn Varr, wachsam, denn das klingt ein bisschen wie der Anfang des Namens, den er ihr nennt, bevor der Rest auf ihrer ungeübten Zunge verloren geht.
Jedes Mal, wenn sie ihren Vater und Erik besucht, wartet sie draußen und lauscht Varr und Diinna, wie sie zusammen in ihrer Sprache sprechen. Stets verstummen sie in dem Moment, wenn sie ihre Hand an die Tür legt, und Maren hat das Gefühl, als ob sie sie bei etwas Unanständigem gestört hätte oder auch bei etwas sehr Privatem. Das Gefühl, dass sie etwas zerbrochen hat und ihre Ungeschicktheit sich auf ihre bloße Anwesenheit gründete.
Maren spricht Norwegisch mit Diinna, und Diinna übersetzt für Varr, ihre Sätze sind immer kürzer, als ob sie bessere und exaktere Wörter für das haben, was Maren zu sagen versucht. Wie muss das sein, zwei Sprachen im Kopf, im Mund zu haben? Wenn man eine wie ein dunkles Geheimnis tief in der Kehle verstecken muss? Diinna hat immer zwischen Vardø und anderen Orten gelebt, hin und wieder in der Nähe, seit Maren ein Kind war, dann lief sie neben ihrem schweigsamen Vater her, der kam, um Netze zu reparieren oder Zauber auszusprechen.
»Wir lebten hier«, erzählte Diinna Maren damals, als Maren noch etwas Angst vor ihr hatte: ein Mädchen in Hosen und einem mit Bärenfell gesäumten Mantel, Fell, das sie selbst gehäutet und angenäht hatte.
»Ist das euer Land?«
»Nein.« Der Tonfall des Mädchens war so streng wie ihr Blick.
Manchmal kann Maren die Trommelschläge hören, regelmäßig wie ein Herzschlag, und in diesen Nächten schläft sie leichter ein, obwohl die strikten Kirchgängerinnen viel deswegen murren. Diinna erzählt ihr, dass die Trommel den Weg für die Seelen frei mache, damit sie sich ordentlich von den Körpern lösten und keine Angst hätten. Aber Varr spielt nie, wenn Maren in der Nähe ist. Das Instrument ist breit wie ein Trog, die Haut straff über eine flache Schale aus hellem Holz gespannt. Seine Oberfläche ist von kleinen Mustern durchsetzt: Ein Rentier mit Sonne und Mond im Geweih, in der Mitte Männer und Frauen, deren Hände wie Glieder einer Kette ineinandergreifen, und im unteren Teil schlängelt sich ein Knäuel von scheußlichen Beinahe-Menschen, Beinahe-Bestien über den Boden.
»Ist das die Hölle?«, fragt sie Diinna. »Und das der Himmel, und wir sind in der Mitte?«
Diinna übersetzt nicht für Varr. »Es ist alles hier.«
4
Als der Winter seinen Griff um Vardø lockert und ihre Vorratskammern beinahe leer sind, hievt die Sonne sich näher zum Horizont hin. Wenn Diinnas und Eriks Baby zur Welt kommt, werden die Tage lichtdurchflutet sein.
Maren spürt, wie ein beklommener Rhythmus Vardø erfasst, ihre eigene Zeit nimmt Gestalt an. Kirche, Bootshaus, Hausarbeit, Schlafen. Obgleich die Linien zwischen Kirsten und Toril, Diinna und den anderen allmählich deutlicher gezogen werden, halten sie zusammen wie Männer in einem Ruderboot. Eine Nähe, die aus der Not heraus geboren wurde: Sie brauchen einander mehr denn je, vor allem seit die Nahrungsmittel knapp werden.
Sie bekommen Getreide aus Alta, ein wenig tørrfisk aus Kiberg. Manchmal halten Seemänner im Hafen, rudern mit Seehundfellen und Waltran ans Ufer. Kirsten scheut sich nicht, mit ihnen zu reden, und macht gute Geschäfte, aber den Frauen gehen die Dinge aus, die sie tauschen könnten, und es ist offensichtlich, dass sie keine Hilfe erhalten werden, wenn die Zeit kommt, die Saat auszubringen.
Maren nutzt ihre wenige freie Zeit am Tag, um die Landzunge abzulaufen, wo sie und Erik als Kinder spielten und wo sich nun das kümmerliche Heidekraut nach einem sonnenarmen Winter allmählich erholt. Bald schon wird es kniehoch sein, und die Luft wird so süß von seinem Duft sein, dass ihre Zähne schmerzen.
Nachts ist die Trauer schwerer zu bewältigen. Als sie zum ersten Mal eine Nadel in die Hand nimmt, stellen sich die Härchen auf ihrem Arm auf, und sie lässt sie fallen, als wäre sie glühend heiß. Ihre Träume sind düster und voller Wasser. Sie sieht Erik in verstöpselten Flaschen gefangen und das klaffende, vom Meer ausgespülte Loch, wo der Arm ihres Vaters war: seine weißen, weißen Knochen. Der Wal kommt auch meistens vor, der dunkle Rumpf seines Körpers stürzt durch ihre Gedanken und hinterlässt nichts Gutes, nichts Lebendes in seinem Kielwasser. Manchmal verschluckt er sie ganz und gar, und manchmal ist er gestrandet und sie liegt neben ihm, Auge an Auge, sein Gestank in ihrer Nase.
Maren weiß, dass auch mamma Albträume hat. Doch sie bezweifelt, dass ihre Mutter mit Salz auf der Zunge aufwacht, dass der Meeresdunst ihren Atem sprenkelt. Manchmal fragt sich Maren, ob sie diejenige war, die dieses Leben über sie gebracht hat, weil sie sich Zeit allein mit Diinna und mamma gewünscht hatte. Denn wenngleich Kiberg nahe ist und Alta nicht sehr weit entfernt, ist kein Mann gekommen, um sich bei ihnen niederzulassen. Maren wollte Zeit mit Frauen, und jetzt verbringt sie alle ihre Tage mit ihnen.
Die Vorstellung keimt in ihr auf, dass Vardø für immer so weitermachen könnte: ein Ort ohne Männer, der dennoch überlebt. Die Kälte lockert ihren Griff, und im Gegenzug werden die Leichen weich. Sobald der Boden wurzeltief aufgetaut ist, werden sie ihre Toten beerdigen, und vielleicht könnten einige Gräben mit zugeschüttet werden.
Maren sehnt sich nach dem Gefühl von Erde unter ihren Fingernägeln, dem Gewicht eines Spatens in ihrer Hand, danach, dass Erik und pappa endlich ruhen, in ihren Leichentüchern aus silberglänzender Birke. Jeden Tag überprüft sie das Gemüsebeet vor ihrem Haus, kratzt mit den Fingernägeln über den Erdboden.
Vier Monate nach dem Sturm, an dem Tag, an dem ihre Hand in die Erde sinkt, rennt sie in die Kirche, um den anderen mitzuteilen, dass sie endlich graben können. Doch die Worte bleiben ihr im Hals stecken: Ein Mann steht auf der Kanzel.
»Das ist Pastor Nils Kurtsson«, sagt Toril mit ehrfürchtiger Stimme. »Er wurde aus Varanger geschickt. Gott sei gelobt, wir wurden schließlich doch nicht vergessen.«
Der Geistliche richtet seine blassen Augen auf Maren. Er ist schmächtig wie ein Junge.
Von ihrem angestammten Platz verdrängt, rutscht Kirsten in die Bank neben Maren und mamma und beugt sich am Ende des Gottesdienstes vor, um Maren ins Ohr zu flüstern.
»Ich hoffe, seine Predigten sind nicht so schwach wie sein Kinn.«
Doch das sind sie, und Maren denkt, dass er etwas Schreckliches getan haben muss, um nach Vardø versetzt zu werden. Pastor Kurtsson ist kraftlos, offensichtlich ist er das Leben am Meer nicht gewöhnt. Er hat keine tröstenden Worte für ihre besonderen Heimsuchungen und scheint ein wenig Angst vor dem Raum voller Frauen zu haben, die jeden Sabbat seine Kirche füllen. Nach dem letzten Amen läuft er hastig in sein Haus nebenan.
Die Kirche ist wieder ein heiliger Ort, daher gehen die Frauen dazu über, sich mittwochs im Haus von Dags Vater zu treffen, wo Fru Olufsdatter zu einem Flüstern in den Räumen ihres zu großen Hauses geschrumpft ist. Das Geschwätz ist das gleiche, doch die Frauen sind vorsichtiger. Wie Toril sagte, sind sie nicht vergessen worden, und Maren ist sicher, dass nicht nur sie allein Unbehagen darüber verspürt, was das bedeuten könnte.
In der Woche seiner Ankunft setzt der Pfarrer ein Schreiben mit der Bitte um zehn Männer aus Kiberg auf, Ednes Schwager ist unter ihnen, und Maren befällt ein unerwarteter Neid, als sie kommen, um die Toten endlich zu begraben. Sie brauchen zwei Tage, um die Gräber zu schaufeln, und da die Dunkelheit abnimmt, arbeiten sie bis tief in die Nacht. Sie sind laut und lachen zu viel für ihre Aufgabe. Sie schlafen in der Kirche und stützen sich auf ihre Spaten, um den vorbeilaufenden Frauen nachzublicken. Maren hält ihren Kopf gesenkt und läuft dennoch stündlich an der Stelle vorbei, um ihren Fortschritt zu beobachten.
Die Gräber liegen auf der Ostseite der Insel, ein dunkles Loch neben dem anderen, so viele, dass sich Maren der Kopf dreht. Die Erde ist daneben aufgehäuft, und während Maren aus sicherer Entfernung zuschaut, stellt sie sich den Schmerz in ihren Armen vor, der Geschmack nach Erde wie eine Münze in ihrem Mund, und der Schweiß bricht ihr aus den Poren. Nach allem, was die Frauen gesehen haben, nachdem sie ihre Männer von den Felsen aufgesammelt haben und den ganzen Winter über sie gewacht haben, fühlt es sich nicht richtig an zuzusehen, wie jemand anderer die Gräber schaufelt. Maren denkt, dass Kirsten ihrer Ansicht wäre, aber sie will nicht viel Aufhebens machen. Sie will, dass pappa und ihr Bruder unter die Erde kommen, dass der Winter vorbei ist und die Männer aus Kiberg verschwinden.
Am Morgen des dritten Tages werden ihre Männer aus dem ersten Bootshaus getragen, sie riechen schon ein wenig, die Bäuche geschwollen in ihren gewebten Leichentüchern, die Toril genäht hat. Sie werden neben die offenen Gräber gelegt, schneeweiß gegen die frisch umgegrabene Erde.
»Keine Särge?«, fragt ein Mann und zupft an einem Leichentuch.
»Vierzig Tote«, sagt ein anderer. »Eine Menge Arbeit für ein Dorf voller Frauen.«
»Ein Leichentuch bedeutet mehr harte Arbeit als ein Sarg«, sagt Kirsten kühl, und Torils Wangen röten sich vor Überraschung. »Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie meinen Mann nicht anrühren würden.«
Kirsten sitzt an der Grabkante, und bevor Maren begreift, was sie da tut, hat sie sich fallen lassen, sodass nur noch ihr Kopf und ihre Schultern herausragen, mit ausgestreckten Armen.
Die Männer verständigen sich lautlos untereinander, also packt Kirsten selbst ihren Mann, verschwindet aus dem Blickfeld, während sie ihn herunterhebt. Im nächsten Moment sieht man, wie sie sich hinaufzieht, ihre bestrumpften Beine blitzen auf, als sie aus dem Grab klettert.
Toril schüttelt missbilligend den Kopf und dreht sich weg, und einer der Männer lacht, doch Kirsten nimmt nur eine Handvoll von dem Erdhaufen und lässt sie auf ihren Mann fallen. Dann geht sie geradewegs an Maren vorbei, nah genug, dass Maren die Tränen auf ihren Wangen sehen kann. Maren sollte die Hand nach ihr ausstrecken, etwas sagen, doch ihre Zunge fühlt sich so nutzlos wie ein Kieselstein an.
»Also hat sie ihn wirklich geliebt«, murmelt mamma, und Maren muss sich eine Antwort verkneifen. Jeder Narr hatte sehen können, dass Kirsten ihren Mann liebte. Sie hatte die beiden oft gesehen, wie sie zusammen spazieren gingen und wie Freunde gemeinsam lachten. Er nahm sie mit auf die Felder und manchmal auch mit aufs Meer hinaus. Wenn sie am Tag des Sturms mit ihm hinausgefahren wäre, wären die Frauen von Vardø noch verlorener, als sie es jetzt schon sind.
Pastor Kurtsson tritt vor, um das Grab zu segnen. Sein Kinn ist angespannt, und Maren vermutet, dass ihm Kirstens Mutbezeugung vor diesen Männern peinlich ist. »Gottes Gnade sei mit dir«, skandiert er mit seiner schwankenden Stimme und sagt nicht viel mehr über den Mann, den er nie gekannt hat.
»Das hätte Kirsten nicht tun sollen.« Diinna taucht neben Maren auf und beobachtet den Pfarrer. Ihre Hand ruht auf ihrem Bauch. Das Baby kann jeden Tag zur Welt kommen, und Kummer schnürt Maren die Kehle zu: Ihr Bruder unter die Erde gebracht, noch bevor sein Kind atmet. Plötzlich hat sie den Wunsch, den Arm auszustrecken und Diinna zu berühren, ihren warmen Bauch mit dem Baby im Inneren zu fühlen, doch nicht einmal die alte Diinna hätte das toleriert. Diese neue Diina ist so hart wie Stein, und Maren wagt nicht zu fragen.
Keine andere Frau mischt bei der Beerdigung ihrer Angehörigen mit. Die Männer arbeiten methodisch: Zwei reichen eine Leiche hinunter zu zweien im Grab. Die Familien treten vor, um Erde zu streuen, Pastor Kurtsson segnet das Grab, es wird zugeschaufelt. Keine Wehklagen, niemand fällt auf die Knie. Die Frauen sind müde, blutleer, erledigt. Toril betet unentwegt, die Worte steigen und fallen im Wind.
Der Zyklus wiederholt sich, bis es Zeit ist, das zweite Bootshaus zu räumen, und beim Anblick der silberglänzenden Leichentücher aus Birke hebt Pastor Kurtsson eine blasse Augenbraue. Mamma zupft an pappas Birkenhülle herum, blickt erst zum Geistlichen und dann zu Maren.
»Vielleicht sollten wir Toril fragen …«
»Ich habe keinen Stoff mehr übrig«, sagt Toril.
»Ich habe ein Segel …«
»Auch keinen Faden«, sagt Toril, dreht ihnen den Rücken zu und geht nach Hause, ihren Sohn und ihre Tochter im Schlepptau. Sigfrid folgt ihr, und Gerda. Maren ist sicher, dass Diinna, mamma und sie sich selbst überlassen sein werden, wenn ihre Toten an der Reihe sind, doch die anderen Frauen bleiben da und sehen zu, wie erst Mads, dann pappa, anschließend Erik und zuletzt Baar ins Grab hinuntergelassen und zugeschaufelt werden.
An diesem Abend, nachdem die Männer aus Kiberg weggegangen sind, läuft Maren mit Eriks Haarlocke in der Rocktasche zu den Gräbern, in der Absicht, sie dort mit ihm zu begraben. Sie hat beschlossen, dass die Locke ein makabres Andenken ist, dass vielleicht sie es ist, die ihre Träume vergiftet und das Meer in sie eindringen lässt. Die Nächte sind nicht länger winterdunkel, und in der Düsterheit erscheinen ihr die Gräber wie eine Walherde am Horizont, buckelig und bedrohlich. Sie stellt fest, dass sie nicht näher hingehen kann.
Sie weiß, was dort ist: heiliger Boden, von einem Mann Gottes gesegnet, der nichts mehr als die Überreste ihrer Männer birgt. Doch hier, mit dem Wind, der durch die offenen Kanäle der Insel pfeift, und den erleuchteten Häusern im Rücken, scheint es genauso verhängnisvoll, darauf zuzulaufen, wie von einer Klippe zu springen. Sie stellt sich vor, wie sie sich aufbäumen und hinuntersausen, und die Welt unter ihren Füßen scheint zu wanken. In ihrer Verwirrung lockert sie den Griff um Eriks Haarlocke. Der Wind zupft sie von ihren trägen Fingern und wirbelt sie fort.
Später in der Nacht weckt ein Türgeräusch Maren auf. Mamma liegt wie eine Schnecke in ihrem Haus zusammengerollt auf den Decken und haucht übel riechenden Atem in ihr Gesicht. Sie hat darauf bestanden, dass sie weiter das Bett teilen, obwohl Maren dann schlechter schläft.
Maren setzt sich auf, ihr ganzer Körper zittert, als sich die Tür schließt. Sie kann niemanden sehen, sie kann nur jemanden spüren. Ächzen erklingt, eine schnelle Abfolge von beinahe tierischen Atemzügen. Es hört sich an, als würde eine Handvoll Erde verschluckt werden.
»Erik?«
Sie fragt sich, ob sie ihn zu sich gerufen hat, ihn mit ihren Träumen und Gebeten herbeibeschworen hat, und die Vorstellung macht ihr solche Angst, dass sie schnell über ihre Mutter zu pappas Axt klettert. Dann vernimmt sie Diinnas leisen Schrei, eine Schmerzenswelle zwingt sie in die Knie, und Maren kann ihre Umrisse erkennen. Ein Geist würde keine Tür öffnen, schilt Maren sich selbst, und eine Axt würde dagegen auch nicht helfen.
»Ich hole Fru Olufsdatter.«
»Die nicht«, bringt Diinna schwer atmend hervor. »Du.«
Sie führt Diinna zu ihrem Kaminvorleger. Mamma ist wach und entfacht das Feuer, bringt Decken und erhitzt Wasser, holt einen Lederriemen für Diinna zum Draufbeißen, macht besänftigende Geräusche.
Sie benötigen den Riemen nicht – bis auf ihr Keuchen macht Diinna kaum Lärm. Sie klingt wie ein mit Füßen getretener Hund: Sie winselt und beißt sich auf die Lippe. Maren bleibt bei ihrem Kopf, und mamma zieht ihr die Unterwäsche aus. Die Sachen sind nass, und der ganze Raum riecht nach Diinnas Schweiß. Er bricht ihr aus allen Poren, und Maren wischt mit einem Tuch über ihre Stirn, versucht, nicht auf den dunklen Hügel zwischen Diinnas Beinen zu sehen, wo die Hände ihrer Mutter geschickt hantieren. Noch nie hat sie die Geburt eines Kindes miterlebt, nur von Tieren, die oft schon tot waren. Sie versucht, die Gedanken an schlaffe Zungen, die zwischen weichen Kinnbacken heraushängen, zu verdrängen.
»Es ist schon fast da«, sagt mamma. »Warum hast du uns nicht früher geholt?«
Diinna ist ganz benommen vor Schmerzen, doch sie flüstert: »Ich habe an die Wand geklopft.«
Maren tupft ihr das Gesicht ab und wispert in Diinnas Ohr, froh über die Nähe, die Diinnas Schmerzen ihnen ermöglichen, wie in alten Zeiten. Bald treffen die Strahlen, die durch das dünne Gewebe der Vorhänge vor dem Fenster fallen, auf den Feuerschein, und sie werden alle in ein nebliges weißes Licht getaucht. Maren fühlt sich in Meeresdunst eingehüllt, während sich Diinna an sie klammert, als wäre sie ein Anker, der sie in den Gezeiten des Schmerzes festhält. Maren drückt einen Kuss auf ihre Stirn und schmeckt Salz.
Als es endlich Zeit ist zu pressen, zappelt Diinna wie ein Fisch an Land, ihr Körper krümmt sich auf dem Boden. »Halt sie fest«, sagt mamma, und Maren gibt ihr Bestes, obwohl sie nie stärker als Diinna gewesen ist und nicht hoffen kann, dass es jetzt anders sein wird. Sie sitzt hinter Diinna, damit diese sich an sie lehnen kann, und spricht besänftigend an ihrem Hals. Marens eigene Tränen treffen sich mit Diinnas, als sie noch einmal eine heftige Wehe erfasst und endlich ein durchdringender Schrei als Antwort auf das Klagen zwischen ihren Beinen ertönt.
»Ein Junge.« In mammas Stimme klingt helle Freude und ein Anflug von Schmerz. »Ein Junge. Darum habe ich gebetet.«
Diinna fällt zurück, und Maren bringt sie behutsam zu Boden. Maren hält sie in den Armen, küsst ihre Wangen, lauscht dem Weinen des Babys, dem Klappern von Metall, als ihre Mutter eine Klinge zur Hand nimmt, um die Nabelschnur durchzuschneiden, und dann mit einem Lappen das Blut aufwischt. Diinna klammert sich an sie, weint heftiger, ihre Körper zittern, feucht, erschöpft, bis mamma Maren mit ihrem Ellbogen zur Seite stupst und Diinna das Baby auf die Brust legt.
Er ist winzig, zerknittert, voller schleimiger Nachgeburt. Seine Wimpern sind dunkel auf seinen weißen Wangen. Maren erinnert sich an ein Vogeljunges, das aus seinem Nest auf das bemooste Dach gestoßen wurde, die Haut so dünn, dass sie das Zucken seines Auges unter dem geschlossenen Lid sehen konnte, der Herzschlag ließ seinen ganzen Körper erbeben. Sobald sie es berührt hatte, daran dachte, es zurück in sein Nest zu bringen, hörte es auf, sich zu bewegen.
Wenn er schreit, ziehen sich seine schmalen Schultern nach oben, sein kleiner Mund regt sich. Diinna zieht ihr Nachthemd nach unten, legt ihre dunkle Brustwarze in seinen Mund. Vernarbtes Gewebe ziert ihr eines Schlüsselbein, eine Verbrennung, die, soweit Maren weiß, von einem Topf mit kochendem Wasser herrührt, obwohl sie sich nicht erinnern kann, wer ihn geworfen hat. Sie möchte auch diese Stelle küssen, die Haut glätten.
Mamma hat Diinna sauber gemacht. Sie weint, richtet sich auf, um sich an Diinnas anderer Seite auszustrecken, legt eine Hand dorthin, wo Diinnas Hand auf seinem Rücken ruht. Maren zögert nur noch einen kurzen Moment, bevor auch sie eine Hand dort hinlegt. Er ist überraschend warm und riecht nach frischem Brot und sauberen Tüchern. Ihre Brust zieht sich zusammen, schmerzt vor Verlangen.
3. Juni 1618
An den sehr verehrten Mr. Cornet,
ich schreibe Ihnen in zwei Angelegenheiten.
Zunächst möchte ich Ihnen für Ihren großmütigen Brief vom 12. Januar dieses Jahres danken. Ihre Glückwünsche weiß ich in höchstem Maße zu schätzen. Meine Ernennung zum Lensmann über Finnmark ist eine große Ehre und, wie Sie es so treffend ausdrücken, eine Gelegenheit, unserem Herrgott in diesem geplagten Landstrich zu dienen. Des Teufels Atem stinkt hier, und es gibt eine Menge Arbeit zu erledigen. König Christian IV. setzt sich für eine Konsolidierung der Position der Kirche ein, doch Hexengesetze wurden erst im vergangenen Jahr erlassen, und obwohl sie die Dämonologie zum Vorbild haben, sind sie doch höchst ungenügend im Vergleich mit dem, was unser König James in Schottland und auf den Äußeren Hebriden durchgesetzt hat. In meinem Lensmann-Bezirk wurden sie noch nicht einmal erlassen. Natürlich werde ich diesen Missstand beheben, wenn ich meinen Posten dort nächstes Jahr antrete.
Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Wie Sie sicher wissen, bewundere ich zutiefst Ihre Handhabung des Kirkwellprozesses gegen die Hexe Elspeth Reoch, die Kunde davon ist sogar bis zu uns vorgedrungen. Wie ich damals schrieb: Während der Geck Coltart alles öffentliche Lob erntete, ist mir bewusst, wie sehr Sie ihn unterstützt haben und dass es Ihrem beherzten Handeln zu verdanken war, dass der Vorfall zu einem frühen Zeitpunkt aufgedeckt wurde. Genau diese Zügigkeit ist in Finnmark erforderlich: Männer, die der Lehre der Dämonologie so weit zu folgen vermögen, dass sie »jene, die ein Malefizium ausüben, erkennen, überführen und hinrichten können«.
Ich biete Ihnen demzufolge einen Platz an meiner Seite an, um diese besonderen Übel auszurotten. Viele dieser Schwierigkeiten rühren von einem Teil der lokalen Bevölkerung her, die hier in Finnmark heimisch ist – ein Wandervolk, Lappen genannt. In gewisser Weise ähneln sie den Zigeunern, nur dass ihre Zauber sich mit dem Wind und anderem Wetter befassen. Wie bereits erwähnt, wurde die Gesetzgebung gegen ihre Hexerei schon eingeführt, aber nur wenig durchgesetzt.
Sie sind ein Mann der Orkney-Inseln, ich muss Ihnen nichts über die Eigentümlichkeiten von Witterungen oder Jahreszeiten erzählen, die es an einem Ort wie diesem gibt. Doch ich muss Sie warnen, die Situation ist ernst. Seit dem Sturm von 1617 (Sie werden sich erinnern, darüber wurde sogar in den Zeitungen von Edinburgh berichtet: Ich war damals selbst auf See, und der Sturm reichte bis nach Spitsbergen und Tromsø) wurde Weibervolk sich selbst überlassen. Die barbarische Bevölkerung der Lappen durchmischt sich mit den Weißen. Im Wesentlichen müssen wir gegen ihre Zauberei und ihre Magie vorgehen. Ihre Wetterzauber sind sogar von Seemännern gefragt. Aber ich glaube, dass wir mit Ihnen und einer kleinen Anzahl weiterer fähiger, gottesfürchtiger Männer die Dunkelheit sogar hier, in dem ewig dunklen Winter, zurückschlagen können. Selbst in Finnmark, am Rande der Zivilisation, müssen Seelen gerettet werden.
Natürlich würden Sie für Ihre Mühen entschädigt werden. Ich denke daran, Sie in einer geräumigen Wohnstatt in Vardø zu etablieren, nahe der Burg, wo der Sitz meiner Macht sein wird. Nach fünf Jahren hier würde ich Ihnen ein Empfehlungsschreiben ausstellen, das Sie zu allen Aufgaben befähigt, die Sie anzustreben wünschen.
Vielleicht sollten Sie dieses Angebot für sich behalten: Ich habe keinen Zweifel, dass Coltart es herausbekommen würde, aber er ist nicht von dem Schlag Mann, den ich brauche.
Denken Sie darüber nach, Mr. Cornet, ich erwarte Ihre schriftliche Antwort.
John Cunningham (Hans Køning)
Lensmann über den Bezirk Vardøhus
5
Als ihr Neffe geboren wird, ist Marens Körper etwas, das sie mit Mühe, Mitleid und einer Art Abscheu trägt. Er ist hungrig, ungehorsam. Wenn sie steht, ist es, als hätte sie Blasen zwischen den Knochen, und sie platzten in ihren Ohren.
Kummer nährt nicht, obwohl er einen ausfüllt. Das haben sie ignoriert, doch als Kirsten Sørensdatter um Erlaubnis bittet, in der Kirche sprechen zu dürfen, volle sechs Monate nach dem Sturm, sieht Maren es an der schlaffen Haut um ihr Kinn und an mammas stark hervortretenden Adern auf ihren Armen. Vielleicht bemerken die anderen das auch, denn sie sitzen nicht mehr eingesunken da, wie wenn sie einer Predigt lauschen, sondern richten sich gerade auf und blicken sie aufmerksam an.
»Es wird sich nicht ändern, wenn wir noch länger warten«, fängt Kirsten an, als setzte sie eine Unterhaltung fort. Sie zieht die Stirn über ihren kleinen blauen Augen kraus. »Unsere Nachbarn sind gut zu uns gewesen, aber wir alle wissen, dass Gefälligkeit nicht ewig währt. Wir müssen für uns selbst sorgen.« Kirsten richtet sich auf: Sie beginnen zu verstehen. »Das Eis ist getaut, wir haben die Mitternachtssonne und vier seetüchtige Boote. Es ist Zeit, auf Fischfang zu gehen. Wir brauchen zwanzig Frauen, vielleicht genügen auch sechzehn. Ich bin dabei.« Sie sieht sich um. Ihr Blick im Kerzenschein ist durchdringend.
Maren erwartet, dass einige der anderen, Sigfrid oder Toril oder vielleicht Pastor Kurtsson, etwas sagen, einen Einwand erheben. Doch auch der Pfarrer ist schmaler geworden, und er hatte schon vorher nur herzlich wenig Speck auf den Rippen. Es ist vernünftig, was Kirsten sagt, wie kurz sie sich auch fassen mag. Marens Hand fährt zusammen mit zehn anderen in die Höhe. Als sie die Hand hebt, hat sie das gleiche taumelnde Gefühl, wie wenn sie sich gegen den Wind lehnt, und sie spürt, wie es nachlässt, sobald sie das Gleichgewicht wiederfindet. Mamma sieht sie an und sagt nichts.
»Sonst niemand mehr? So haben wir nur Mannschaften für zwei Boote«, sagt Kirsten. Die Frauen senken die Blicke und rutschen in den Bankreihen hin und her.
Sie dachten, es wäre entschieden. Doch obwohl der Pfarrer in der Kirche keine Einwände macht, überbringt Toril am nächsten Mittwoch die Nachricht, dass Pastor Kurtsson seine Stimme wiedergefunden und einen Brief geschrieben hat.
»Wie schlau von ihm«, sagt Kirsten, ohne von ihrer Arbeit aufzublicken: Sie fertigt ein Paar Handschuhe aus Seehundfell an, um die Riemen besser fassen zu können, vermutet Maren.
»An den Mann, der bald Vardøhus übernehmen soll«, sagt Toril, und da hält sogar Kirsten inne und blickt auf.
»Die Festung? Hier?«, fragt Sigfrid und bekommt bei dem Gedanken leuchtende Augen. »Bist du sicher?«
»Kennst du noch eine andere?«, fährt Toril sie an, aber Maren kann die Frage nachvollziehen. Die Festung steht schon ihr ganzes Leben lang leer.
Nicht nur Maren, auch Diinna und mamma haben ihre Arbeit niedergelegt. Die drei Frauen waren dabei, ein altes Netz zu flicken, Diinna hatte es sich auf den Schoß gelegt, unter Baby Erik in seinem Tragetuch. Sie neigt den Kopf so weit nach unten, dass sie wie eine Vogelmutter aussieht, die ihre Jungen füttert.