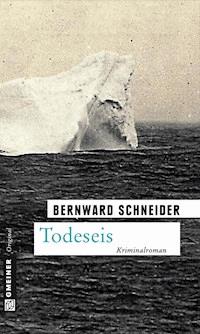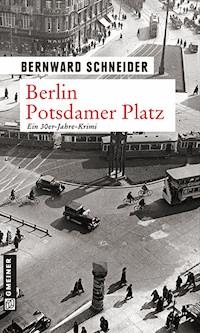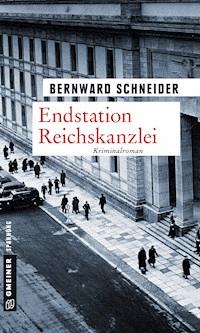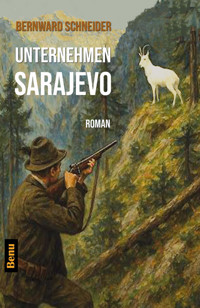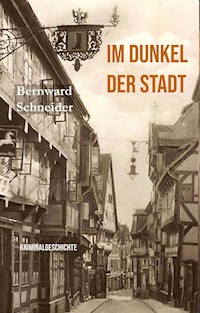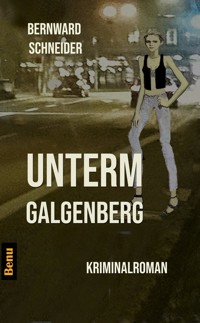Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Anwalt Eugen Goltz
- Sprache: Deutsch
Man schreibt das Jahr 1936 und in Deutschland sind die Nationalsozialisten an der Macht. Im »Mandarin«, einer Bar des Berliner Westens, begegnet der Anwalt Eugen Goltz der schönen Irene Varo, einer Frau ohne Moral, die bei der Verfolgung ihrer Interessen keine Rücksicht kennt. Auf der Suche nach einer verschwundenen Freundin verstrickt sich Goltz immer tiefer in die Fangnetze von Irene und ihren Mordgesellen, und am Ende weiß er nicht mehr, ob er ein Opfer des Bösen oder selbst ein Teufel geworden ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernward Schneider
Der Teufel des Westens
Kriminalroman
Impressum
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Dominika Sobecki
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild– Harry Croner
ISBN 978-3-8392-5384-7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1. Kapitel
Unvermutet beschlich mich das Gefühl, in eine Falle gelockt worden zu sein. Hinter den Lichtkegeln der Laternen, auf die ich durch die Windschutzscheibe meines Wagens blickte, war alles dunkel. Zu meiner Linken lag der Landwehrkanal. Sein Wasser schimmerte tückisch, wie stets in der Nacht. An dem hohen Gebäude zu meiner Rechten, vor dem ich mit laufendem Motor gehalten hatte, war kein Licht zu erkennen, auch nicht oben hinter den Fenstern von Lenis Wohnung.
Langsam rollte ich wieder an und sah im Weiterfahren, dass das Gitter des Tors, welches auf den Hinterhof des Gebäudes am Tirpitz-Ufer führte, offen stand. An der nächsten Straßenecke bog ich ab, fuhr an den Bordstein und stieg aus dem Wagen.
Mit hochgeschlagenem Mantelkragen, der mich davor schützen sollte, erkannt zu werden, schritt ich auf dem Bürgersteig zurück in die Richtung, aus der ich gekommen war. Unter dem finsteren Torbogen hindurch gelangte ich ans Ende der gepflasterten Einfahrt. Hohe Mauern ragten ringsherum wie steinerne Skelette in den schwarzen Himmel hinauf. Eine Hofbeleuchtung brannte nicht.
Die Finsternis brachte die Umrisse der größeren Gegenstände auf dem Gelände nicht völlig zum Verschwinden. Ich erkannte zwei Autos, die auf dem Hof geparkt waren, das eine stand nahe an dem Haus. Irgendwo dort in der Nähe musste sich der Hintereingang befinden.
Langsam bewegte ich mich auf das Gebäude zu.
Es war ein Mercedes 130, der bei der Mauer stand, Lenis Auto, von dem ich wusste, dass sie es von ihrem geschiedenen Mann, einem reichen Autohändler, bekommen hatte. Die Wohnung im obersten Stockwerk hatte sie auch von ihm. Alimente bekam sie keine, sie verdiente als Tänzerin ihr Geld.
Die Stille um mich herum schien mein Missbehagen Lügen zu strafen, trotzdem blieb ich stehen. Irgendjemand schien mich zu belauern, Schatten vor den drohenden Mauern. Leni war keine Frau, die es einem leicht machte, ihr zu vertrauen.
Ihr rätselhafter Anruf lag noch keine halbe Stunde zurück. Sie hatte mir nicht gesagt, was sie zu dieser mitternächtlichen Stunde von mir wollte, nur dass es eilig sei und mich besser niemand sehen sollte, wenn ich das Gebäude von hinten betrat. Die Sache war eher unheimlich als geheimnisvoll.
Aus der Dunkelheit der Septembernacht traten plötzlich die Umrisse einer Gestalt hervor. Eisige Kälte griff nach mir. Die Person hatte hinter dem Mercedes gestanden. Sie kam näher und um das Fahrzeug herum, dann erkannte ich sie, und der Schreck verschwand.
»Endlich bist du da«, sagte Leni leise.
Sie trug einen Mantel und hielt dessen Kragen mit den Händen zusammengedrückt, um den nackten Hals vor der kühlen Witterung zu schützen. Sie hatte halblange, blonde Haare, ein schmales Gesicht und schön geschnittene dunkelblaue Augen. Ihre anmutigen bloßen Unterarme sprangen hell aus den Ärmeln des Mantels hervor. Sie war ein reizendes Geschöpf, ein quälend reizendes Geschöpf, und das war auch der tiefere Grund, weshalb ich mich sofort auf den Weg gemacht hatte, als sie mich am Telefon zu sich gerufen hatte. Ich hatte ein Wiedersehen mit ihr herbeigesehnt, doch nun, da es soweit war, hielt sich meine Freude in Grenzen. Nichts war umsonst, dachte ich; eine Frau wie Leni hatte ihren Preis.
»Ich stecke in einer schlimmen Sache drin«, raunte sie mir zu und gab mir einen flüchtigen Kuss.
»Bei dir rechne ich immer mit dem Schlimmsten.«
Sie warf mir einen warnenden Blick zu. Eine Weile durchforschten ihre Augen die Dunkelheit hinter mir, als sei sie unschlüssig, wie sie sich weiter mir gegenüber verhalten sollte.
»Umso besser«, sagte sie und zwang sich zu einem Lächeln. »Mach dich trotzdem auf einiges gefasst.«
Durch den Kellereingang kamen wir in das Innere des Gebäudes. Es war das erste Mal seit drei Jahren, dass ich das Haus am Tirpitz-Ufer betrat. Damals hatte das Tirpitz-Ufer noch Königin-Augusta-Straße geheißen.
Der geräumige Lift, den wir bestiegen, bewegte sich in einem schwarzen Gitterkleid nach oben und verursachte kaum Geräusche. Es war ein elegantes Haus mit gut betuchten Mietern.
Leni öffnete die Wohnungstür und führte mich durch den Flur in einen Raum, dessen Fenster zum Landwehrkanal lagen, durch die schweren Vorhänge drang kein Licht nach draußen. Auf einem Schreibtisch stand eine kleine Lampe, die ein schwaches, orangefarbenes Licht verbreitete.
Der Schein der Lampe fiel auf eine regungslose Gestalt, die in einem rotledernen Sessel neben dem Schreibtisch saß. Die Augen des Mannes waren weit geöffnet und schienen im Licht zu glänzen, sie blickten mich starr an.
Eine Weile stand ich stumm da und starrte zurück.
»Er hat sich erschossen«, murmelte Leni.
Der Tote war in den Dreißigern, mit kurzem blondbraunen Haar und einem Gesicht, das bis zu diesem Tag wohl recht attraktiv gewesen war. An der Schläfe war eine saubere, kleine Einschusswunde zu erkennen.
Ich ging um den Stuhl herum. Auch auf der anderen Seite des Kopfes befand sich eine Verletzung, wahrscheinlich die Austrittswunde. »Wer ist das?«
»Michail Sapoznik, ein Mitarbeiter der russischen Botschaft. Wir waren befreundet.«
»Warum hat er sich erschossen?«
Leni zuckte mit den Achseln. »Ich war nicht dabei, als er es tat. Ich hatte meinen Auftritt im ›Mandarin‹. Als ich gegen Mitternacht nach Hause kam, saß er da – genauso wie er jetzt dasitzt. Ich habe nichts verändert und weder ihn noch etwas in seiner Nähe angefasst.«
Ich konnte riechen, dass irgendetwas nicht stimmte. »Auch wenn du nicht dabei warst, könntest du wissen, warum er es tat.«
»Ich weiß nur, dass er Angst hatte. Wahrscheinlich war das der Grund. Er ist aus dem Leben geflohen.«
»Vor wem hatte er Angst?«
»Neulich gab er an, er hätte das Gefühl, von zwei Agenten des sowjetischen Geheimdienstes beschattet zu werden. Stalin, so erzählte er mir, führt Säuberungsaktionen durch. Schon eine ganze Reihe von Diplomaten ist von ihm in die Sowjetunion zurückgerufen worden, um wegen Hochverrats vor Gericht gestellt und hingerichtet zu werden. Er befürchtete, dass ihm bald das gleiche Schicksal blühte. Er konnte es wohl einfach nicht mehr ertragen, mit dieser Aussicht zu leben.«
Die Pistole lag neben dem Stuhl. Ich ging in die Hocke, um sie zu betrachten. Es war eine kleinkalibrige Waffe, wie viele Offiziere sie als Privatwaffen benutzten. Der Lauf sah aus, als sei kürzlich damit geschossen worden. Ich suchte den Boden ab und entdeckte die Patronenhülse.
»Warum hat er sich ausgerechnet in deiner Wohnung erschossen?«
»Das hätte ich ihn auch gern gefragt.«
»Wie ist er hereingekommen?«
»Er kam am frühen Abend, später bin ich fort und habe ihn hier allein gelassen.«
»Hat niemand aus dem Haus den Schuss gehört?«
Sie zuckte die Achseln. »Es ist ein solides Haus mit dicken Mauern, und selbst wenn – hier geht jeder seine eigenen Wege.«
»Auch wenn geschossen wird?«
»Gerade dann! Vielleicht war auch nichts zu hören.«
»Kein schlechter Ort, um sich zu erschießen, was? Wenn er ein Mann mit Charakter wäre, hätte er es trotzdem nicht in deiner Wohnung getan.«
»Vielleicht habe ich ihn falsch eingeschätzt.« Sie schaute zum Fenster. »Nachdem ich Michail gefunden hatte, dachte ich, jetzt ist alles aus. Eine Stunde habe ich im Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen und überlegt, was ich tun soll. Schließlich dachte ich an dich und fasste wieder Mut.«
Ich richtete mich auf. »Worauf hast du gewartet? Warum hast du nicht die Polizei gerufen?«
»Ich kann mich nicht an die Polizei wenden. Du musst mir helfen, ihn wegzuschaffen.«
Ich starrte sie an. »Das ist doch Unsinn! Wenn er sich selbst erschossen hat, hast du nichts zu befürchten.«
»Sie werden versuchen, mir einen Strick aus der Sache zu drehen«, sagte Leni. »Es gibt ein paar Leute, die schon sehnsüchtig auf eine Gelegenheit warten, um mich aufs Schafott zu bringen.«
Sie wich ein wenig zurück, als sie meinen finsteren Blick bemerkte.
»Wer will dich aufs Schafott bringen? Der russische Geheimdienst?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wenn man Michail bei mir findet, bin ich geliefert.«
Ich trat vor sie und fasste sie bei beiden Schultern. »Hör mal zu, meine Schöne! Wenn ich dir helfen soll, einen Toten wegzuschaffen, musst du mir schon einen plausiblen Grund dafür nennen.«
Sie schüttelte mich ab. »Ich habe mich mit Leuten eingelassen, denen ich nicht gewachsen bin«, erwiderte sie. »Was ich vorhabe, ist die einzige Chance, mein Leben zu retten.«
»Was sind das für Leute?«
»Besser, du weißt es nicht. Ich kann dir nur so viel verraten, dass sie es verstehen, die Gestapo für ihre Zwecke einzuspannen.«
Das Telefon stand auf dem Sekretär. Ich ließ Leni los, trat hin und nahm den Hörer ab. »Wenn du die Polizei nicht anrufst, mache ich es.«
Sie sprang mich an wie eine Katze und riss mir den Hörer aus der Hand. »Idiot! Hau ab! Ich habe dich nicht gerufen, damit du meine Schwierigkeiten noch größer machst! Ich dachte, du bist ein Anwalt! Einen Denunzianten brauche ich nicht!«
»Ich bin Anwalt, kein Leichenbestatter.«
Sie legte den Hörer aus der Hand und machte ein paar Schritte von mir weg, dann wandte sie mir eine Weile den Rücken zu, bevor sie sich wieder zu mir herumdrehte.
»Ich weiß, was du denkst«, sagte sie und verschränkte die Arme vor der Brust. »Du denkst, dass ich eine Frau bin, die Männern nur Probleme macht.«
»Ich denke, dass du eine sehr schöne Frau bist, die den Männern sehr große Probleme macht. Als wir uns vor ein paar Wochen im ›Ciro‹ zufällig trafen, habe ich schon gewusst, dass ich Probleme bekommen würde, wenn ich mich von dir verführen lasse. Ich habe es trotzdem getan, denn ich konnte meinen Wunsch, dich zu vögeln, einfach nicht bezwingen. Dafür zahle ich jetzt die Zeche.«
Sie lächelte. »War es nicht ein reizendes Wochenende, das wir in deiner Wohnung verbracht haben? Wir haben es so oft gemacht, als wollten wir in zwei Tagen nachholen, worauf wir in den drei Jahren davor verzichtet haben. Ich habe es sehr genossen.«
»Trotzdem frage ich mich jetzt, ob es wirklich ein Zufall war, dass wir uns im ›Ciro‹ begegnet sind.«
»Was willst du damit sagen?«
Ich sah zu dem Toten. Etwas Gelöstes war in seinen Augen. Er schien nicht traurig darüber zu sein, dass er es hinter sich hatte. Beinahe beneidete ich ihn. »Hast du ihn erschossen?«
Sie zuckte mit keiner Wimper. »Nein!«
»Du lügst mich an, damit ich dir helfe!«
»Nein!«
»Woher kanntest du ihn?«
»Aus dem ›Mandarin‹, wo ich arbeite.«
»Hattest du ein Verhältnis mit ihm?«
Sie zuckte unwirsch mit den Schultern. »Blöde Frage.«
»Nein, blöde Antwort. Hat der Tod dieses Mannes etwas mit Liebe und Eifersucht zu tun?«
Sie funkelte mich an. »Rede keinen Quatsch! Er war kein dummer Junge mehr. Wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich Michails Selbstmord verhindert.«
Mein Blick wanderte weiter und blieb an dem Schrankregal hinter Leni hängen. Ich suchte nach einem Hinweis, der mir helfen würde, die Situation richtig einzuschätzen. Gern hätte ich das hellere Deckenlicht angeschaltet, um besser sehen zu können. Aber es schien nicht ratsam zu sein, selbst wenn man das Licht von außen schlecht sehen konnte, und wahrscheinlich hätte ich dann auch nicht mehr erkannt.
Leni musterte mich. »Komm her«, sagte sie. Ihr Blick war unruhig. Irgendetwas schien ihr nicht zu gefallen.
Neben mir an der Wand stand der Schreibtisch, dessen oberste Schublade nicht vollständig geschlossen war. Ein kleiner, ganz schmaler Spalt war im Holz zu sehen.
Ich zog die Schublade unter der Ablage des Sekretärs auf und erblickte eine Pistole. Fast hätte ich sie angefasst, aber dann zog ich die Hand schnell wieder zurück.
»Was hast du?«, fragte Leni. Ohne dass ich es gemerkt hatte, war sie neben mich getreten.
Es war eine kleine Walther-Pistole, eine, die gut in eine Damenhandtasche passte.»Gehört sie dir?«
Sie schaute mich gleichmütig an. »Ja, es ist meine.«
Als ich mein Taschentuch in der Hand hatte, nahm ich die Waffe vorsichtig aus der Schublade und öffnete sie. Sie war geladen. Aber nicht nur das. Der Lauf roch, als ob er abgefeuert worden war. Ich nahm die andere Hand zu Hilfe, zog das Magazin heraus und zählte die Patronen. Eine fehlte. »Jetzt ist mir klar, weshalb man dir nicht glauben würde, dass er Selbstmord begangen hat. Du hast es getan! Mit deiner eigenen Pistole.«
Sie starrte auf die Waffe. »Unsinn! Ich war es nicht.«
»Mit dieser Pistole ist kürzlich geschossen worden. Ich wäre nicht erstaunt, wenn sich herausstellte, dass die Kugel, die deinen Besucher getötet hat, aus dieser Waffe stammt.«
Abrupt drehte sie sich fort, trat zu dem Toten und deutete mit der Hand neben den Sessel, wo die andere Waffe lag. »Und was ist damit? Wie will man denn feststellen, mit welcher Pistole geschossen wurde?«
»Ein Waffenexperte wird vermutlich herausfinden können, aus welcher Waffe die tödliche Kugel stammt. Wir haben die Patronenhülse, und die Kugel wird man finden, wenn man danach sucht, wo auch immer die steckt.«
Ihr schönes Gesicht war eine Spur bleicher geworden. Ich legte die Walther in die Schublade zurück.
»Man versucht, mir die Sache anzuhängen. Ich habe geahnt, dass etwas faul war. Es ist, wie ich sagte. Sie wollen, dass mich der Henker holt.«
»Vermutlich zu Recht!«
»Hör auf! Warum hätte ich ihn erschießen sollen?«
»Willst du damit sagen, dass einer der Leute, denen du angeblich nicht gewachsen bist, ihn erschossen hat?«
»Es muss so sein: Sie haben eine Pistole, aus der geschossen wurde, neben ihn gelegt, damit ich keinen Verdacht schöpfe, dass meine Pistole die Tatwaffe war, und die Polizei sie bei mir findet. Es war richtig, nicht die Polizei zu rufen.«
»Woher wussten sie von deiner Pistole?«
»Sie wussten es eben!«
»Mir kommt das seltsam vor.«
»Was ist daran seltsam? Dass eine Frau wie ich zu ihrem Schutz eine Pistole besitzt, ist doch selbstverständlich. Davon abgesehen – wenn ich es gewesen wäre, die ihn erschossen hat, hätte ich meine Pistole nicht in die Schublade gelegt, sondern in den Kanal geworfen.«
»Das hattest du sicher auch vor, ja! Du bist bloß noch nicht dazu gekommen.«
»Warum hätte ich warten sollen, ich hatte doch eine Stunde Zeit?«
Das klang zwar logisch, hieß aber nicht, dass es keine Erklärung dafür gab. Ich versuchte auch nicht, eine Erklärung zu finden. Mein Schweigen machte ihr klar, dass sie meine Zweifel an ihrer Geschichte nicht ausgeräumt hatte.
»So glaub mir doch, Eugen!«, rief sie und schluchzte plötzlich auf. »Man will mir schaden! Michail ist in meiner Wohnung – und er ist tot! Er muss weg!«
»Warum haben Sie nicht dich, sondern ihn erschossen, wenn sie dir schaden wollen?«
»Sie sind Spieler, so einfach machen sie sich das nicht.«
»Wie sind sie hereingekommen?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Michail muss sie hereingelassen haben. Wahrscheinlich haben sie an der Tür geklingelt und er hat gedacht, dass ich es bin.«
Schräg über dem Toten hing ein venezianischer Spiegel an der Wand. Dass es ein venezianischer Spiegel war, durch den jemand von der anderen Seite in das Zimmer blicken konnte, ohne selbst gesehen zu werden, wusste ich von meinen früheren Besuchen bei Leni. Damals hatte ich auf der anderen Seite gestanden und hatte Leni von dem kleinen Nebenraum dahinter beobachten können, während sie sich mit einem Liebhaber traf, der Böses gegen sie im Schilde führte. Ich wusste nicht, wie viele Liebhaber sie hatte, aber gewiss mehr als einen, in dieser Hinsicht war sie extrem – aber nicht nur in dieser Hinsicht, wie sich einmal mehr zeigte.
»Gemeinsam können wir es schaffen«, sagte sie. »Wenn du mir nicht hilfst, besteige ich das Schafott. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.«
»Und wenn ich dir helfe, steige ich mit dir hinauf.«
»Nein, im Gegenteil: Wenn du mir nicht hilfst, sind die Chancen dafür größer.«
Es war die Art von weiblicher Logik, gegen die noch nie ein Mann angekommen war. »Willst du mir drohen?«
»Ach, Unsinn.«
Ich sah zu dem Spiegel. Der Gedanke, es könne sich dahinter jemand aufhalten, der uns zusah und uns belauschte, war so mächtig, dass ich kurz entschlossen aus dem Zimmer ging und im Flur die Tür aufmachte, die hinter den Spiegel führte. Es war niemand da.
»Es war nur zu meiner Sicherheit«, sagte ich, als ich zu Leni zurückgekehrt war.
»Traust du mir wirklich zu, dass ich dich reinlegen will?«
»Es wäre nicht das erste Mal, dass du mich hereinlegst.«
»Fühlst du dich jetzt besser?«
»Nicht viel besser, nur ein wenig.«
Sie trat zu dem Schreibtisch mit der offen stehenden Schublade.
»Ich gehe jetzt hinunter und werfe die Pistole in den Kanal«, sagte sie. »Dann ist die wenigstens weg.«
Wenn man ihr wirklich eine Falle gestellt hatte, schien es merkwürdig, dass noch keine Polizei aufgetaucht war. Andererseits war denkbar, dass ihre Gegner davon ausgingen, Leni würde die Schritte, die sie dem Schafott näher brächten, selbst in die Wege leiten, indem sie die Polizei verständigte.
»Es wird nicht reichen, die Pistole beiseitezuschaffen. Wenn eine Untersuchung ergeben sollte, dass die Kugel, die Michail tötete, nicht aus der Waffe stammt, die neben ihm liegt, hast du ein Problem.«
Sie sah mich an. »Das ist doch mein Reden! Deshalb muss der arme Michail auch in den Kanal. Hilfst du mir nun?«
Hatte ich eine Wahl? Lenis Geschichte überzeugte mich nicht, aber ich konnte sie auch nicht widerlegen. Wenn sie selbst den Mord begangen hatte, war es merkwürdig, dass es zwei Pistolen gab, wenngleich sie die Sache auch inszeniert haben könnte, um mich hereinzulegen. War sie nicht die Mordschützin, rechneten ihre Gegner gewiss nicht damit, dass sie es tatsächlich schaffen könnte, die Leiche heimlich zu entsorgen. Dann verhielt sie sich richtig, und dann war keine Zeit zu verlieren; der Tote und die falsche Pistole waren dann womöglich nur der erste Schritt, dem in Kürze ein zweiter folgen könnte, um sie des Mordes zu überführen.
»Eine Leiche beseitigt man nicht so leicht wie ein altes Möbelstück.«
»Doch, genauso muss man es machen, wie mit einem alten Möbel. Es ist sogar noch leichter. Michail ist kein großer und schwerer Mann.«
»Wie bekommen wir ihn in den Wagen?«
»Ich besitze einen großen Koffer, einen Schrankkoffer mit Rollen, darin bekommen wir ihn im Fahrstuhl nach unten. Um diese Zeit werden wir niemandem im Haus begegnen.«
Ohne ein weiteres Wort verschwand sie aus dem Zimmer, und als sie kurz darauf zurückkehrte, schob sie das Stück, von dem sie gesprochen hatte, neben den Sessel des Toten.
Was für ein Zufall, dachte ich, dass eine zarte Person wie sie einen solch voluminösen Koffer besaß.
»Es ist der Koffer für meine Kleider, wenn ich verreisen muss«, sagte sie, weil sie sich wohl dachte, dass sie mir besser eine Erklärung für den Besitz dieses Prachtstücks geben sollte.
»Und wenn uns jemand sieht?«
»Ich nehme alles auf mich. Aber wir werden es schaffen.« Sie legte den Koffer auf den Boden und klappte ihn auf. Es war wirklich ein Riesending, dachte ich, aber es würde gehen.
»Hilfst du mir nun?« Sie wartete, beobachtete mich.
Eigentlich konnte es nur schiefgehen, dachte ich. Aber ich saß bereits mit im Boot; Leni im Stich zu lassen, kam nicht in Betracht.
»Da ich nun schon einmal hier bin, wird mir kaum etwas anderes übrig bleiben, als dir zu helfen«, sagte ich. »Immerhin haben wir eine Chance. Sie werden nicht damit rechnen, dass du versuchst, dich der Leiche zu entledigen.«
»Frechheit siegt, das ist meine Devise, mit der ich stets weit gekommen bin«, sagte sie. »Wo bringen wir ihn hin?«
»Wir können ihn nicht in den Kanal werfen. Wer sich erschießt, springt hinterher nicht ins Wasser; er muss in einen Park oder besser noch in einen Wald. Finden werden sie ihn sowieso, egal, ob er im Wasser liegt oder im Wald.«
»Und die Pistolen?«
»Deine Pistole legen wir neben ihn, die andere muss weg! Bleibt nur zu hoffen, dass das Projektil, das in oder durch seinen Kopf gegangen ist, wirklich aus deiner Waffe stammt. Ist die Pistole irgendwo auf deinen Namen registriert?«
»Nein.«
»Los, dann greifen wir es an. Ich brauche Taschentücher für die Pistolen.«
Der Krieg war lange her, aber mit Waffen hatte ich Erfahrung. Ich nahm Lenis Walther und drückte sie dem Toten in die Hand, um seine Fingerabdrücke darauf zu platzieren, bevor ich die Waffe vorsichtig zusammen mit der Patronenhülse in eines der Tücher wickelte, die Leni mir gebracht hatte. Ich legte die Pistole in den Koffer und verstaute die andere in meiner Jackentasche; dann trat ich neben den Sessel und fasste den Toten kurz entschlossen unter den Armen. Leni ging zwischen seinen Beinen in die Hocke und hakte die Arme unter seine Knie.
Es klappte besser als erwartet, den Mann in das Behältnis zu legen, der Koffer schien geradezu für ihn angefertigt zu sein. Leni schlug den Kofferdeckel zu und schloss die Schnallen; dann stellten wir den Koffer auf seine Rollen und schoben ihn aus dem Zimmer in den Flur.
Leni legte ihr Ohr an das Holz und horchte durch die geschlossene Tür nach draußen. Doch da war nichts, nichts als Schweigen in einem leeren Haus, das bis auf zwei unheimliche Gestalten im obersten Stockwerk von allen Menschen und allen guten Geistern verlassen schien.
Sie glitt in den Flur und ich folgte ihr, und dann ging es mit dem Koffer weiter bis zu dem Lift, in dem ausreichend Platz für uns und unser Gepäckstück war. Schweigend fuhren wir in die Tiefe hinab, und als der Lift im Keller zum Stehen kam, schoben wir unsere Fracht vorsichtig die wenigen Treppenstufen hinunter und dann weiter durch den Hinterausgang ins Freie.
Der Wagen war eine kleine zweitürige Limousine. Leni öffnete die Fahrertür, klappte die Sitze nach vorn und dann unternahmen wir es, den Koffer mit vereinter Anstrengung auf die Rückbank des Wagens zu hieven.
»Ich habe noch eine schwarze Plane zum Darüberlegen«, flüsterte sie, »dann wirkt alles dezenter und der Koffer fällt nicht weiter auf.«
Sie verschwand in den Keller und kam kurz darauf mit der Plane zurück.
»Am besten fahren wir in den Grunewald«, sagte sie. »Es passiert fast täglich, dass dort jemand Schluss macht.«
»Grunewald und Selbstmord, ja, das passt. Geht zwar durch die halbe Stadt, ist aber nicht zu ändern. So machen wir es!«
Leni kletterte hinter das Steuer, und nachdem ich mich neben sie gesetzt hatte, ließ sie den Motor an. Sie warf mir einen aufmunternden Seitenblick zu. »Viel Glück, Eugen.«
»Danke, Leni, das wünsche ich dir auch.«
Die Scheinwerfer des Mercedes suchten sich ihren Weg über den asphaltierten Hof, an dessen Seiten hoch die Mauern aufragten, dann trafen sie auf die Durchfahrt zur Straße und verschmolzen kurz darauf mit dem Licht der Lampen am Tirpitz-Ufer.
2. Kapitel
Leni jagte den Mercedes am Ufer entlang, auf der Suche nach einer Stelle, an der wir uns der überzähligen Pistole entledigen konnten.
»Fahr nicht so schnell!«, rief ich ihr zu. »Sonst stoppen uns noch die Schupos. Außerdem kann ich nicht sehen, wo wir am besten anhalten können.«
Während sie durch den westlichen Teil des Tiergartens fuhr, drosselte sie die Geschwindigkeit. Hinter der Kanalbrücke am Zoologischen Garten gab ich ihr ein Zeichen und sie stoppte den Wagen am Straßenrand.
Ich stieg aus, überquerte die Fahrbahn und trat an einen Baum auf der Böschung, um zu pinkeln. Dann nahm ich die Pistole aus der Tasche, beförderte sie in den Kanal und kehrte zügig zum Wagen zurück.
Leni bog in die Budapester Straße ein und fuhr weiter nach Westen, bis wir hinter dem Zoobahnhof und der Gedächtniskirche den lichterglitzernden Kurfürstendamm erreichten. Trotz der vorgerückten Stunde war hier die Nacht schillernd und lebendig. Berlins Prachtstraße, die zur Kaiserzeit auf Bismarcks Anregung nach dem Vorbild der Pariser Champs-Élysées angelegt worden war, hatte sich einen sagenhaften Ruf als Straße der Eleganz, der Erotik und des Lasters erworben. Das vertraute Glitzern der gefälligen Leuchtreklamen gab mir ein Stück Sicherheit.
»Du hast vorhin die Gestapo erwähnt«, sagte ich, während wir über den Lichterboulevard weiter nach Westen rollten. »Was hat die Gestapo mit deinen Problemen zu tun?«
»Wenn es der russische Geheimdienst nicht war, könnte es die Gestapo gewesen sein, die Michail auf dem Gewissen hat.«
»Wie kommst du darauf?«
»Michail Sapoznik war nicht nur ein Diplomat, sondern auch ein Spion.«
»Es ist eine Binsenweisheit, dass viele Diplomaten auch Spione sind. Weder die Gestapo, noch der SD, noch der deutsche Geheimdienst hätten ihn deshalb erschossen.«
»Du kennst sie nicht.«
»Doch! Ich kenne sie – es sind deutsche Beamte, Polizeibeamte, so machen sie es nicht, auch die SD-Beamten gehen anders vor. Sie klingeln höflich an der Tür, wie deutsche Beamte das eben tun, selbst dann, wenn sie kommen, um einen ins KZ zu bringen. Nun gut, nichts bleibt, wie es war, mag sein, dass du sie besser kennst als ich.«
Sie warf mir einen schnellen Seitenblick zu. »Für wen hältst du mich?«
»Als ich dir vor drei Jahren begegnete, hattest du enge Verbindungen zu Offizieren von Gestapo und SS. Du bist eine schöne Tänzerin, die in Kreisen verkehrt, in denen vielerlei Nachrichten kursieren. Ich brauche nur eins und eins zusammenzählen.«
»Natürlich höre ich zu, wenn Männer mir etwas erzählen. Ich habe einen großen Bekanntenkreis und bekomme so manches mit. Aber ich entscheide selbst darüber, welche Informationen ich weitergebe.«
»Das glaubt jeder Informant, es ist aber Unsinn.«
»Du irrst! Ich habe Freunde in der SS, aber ich habe dort auch Gegner. Man weiß nie, wer am Ende die Oberhand behält. Daher muss ich eine Auswahl treffen.«
»Hast du dir die Gestapo zur Vertrauten gewählt?«
»Nein, Gott bewahre, aber die Gestapo ist nicht mein größtes Problem.«
Wir überquerten den Lehniner Platz, und Leni deutete auf ein Tanzlokal auf ihrer Seite hinter dem Fenster. »Das ›Mandarin‹, in dem ich arbeite, seitdem ich nicht mehr an der ›Scala‹ bin.«
Ich schaute hin, sah nur noch das Leuchtgesims über dem Eingang, dann waren wir schon an dem Vergnügungspalast vorübergerollt.
»Wer kann einem größere Probleme machen als die Gestapo?«, wollte ich wissen.
»Einige Herren, die im ›Mandarin‹ verkehren und noch mächtiger als die Gestapo sind. Meine Freunde stehen mit der Gestapo in Verbindung und haben mehr Macht, als ich für möglich gehalten hätte.«
»Wer hat dich auf Michail Sapoznik angesetzt?«
»Ich habe in den letzten Jahren viele Kontakte gepflegt. So mancher ist auf mich aufmerksam geworden. Dazu gehören auch die Russen. Im ›Mandarin‹ verkehrt ein internationales Publikum. Es gehört zu meinen Aufgaben, auf Annäherungsversuche zu reagieren, und sei es, um Falschinformationen zu verbreiten oder Gegenspionage zu betreiben.«
»Hast du Sapoznik mit Informationen versorgt?«
»Ich habe Michail gemocht und versucht, ihm zu helfen, damit er seinen Leuten etwas vorweisen kann.«
»Du hast also geheime Informationen an ihn weitergegeben?«
»Das wirft man mir vor, ja.«
»Wer wirft es dir vor?«
Konzentriert sah sie nach vorn. »Lass uns später darüber sprechen«, sagte sie.
Am schwarzen Himmel über den hohen Dächern war zwischen unruhigen Wolkenfeldern der Mond zu sehen. Der Kurfürstendamm lag hinter uns, und die steinerne Stadtlandschaft war wieder ein schwarzes, von Irrlichtern durchsetztes Schattenreich, das mir nicht verlässlich, sondern unter der friedlichen Oberfläche unruhig erschien. Seitdem die Fahrt begonnen hatte, wurde ich das Gefühl nicht los, dass irgendetwas sich unserem Vorhaben in den Weg stellen würde.
Über die Koenigsallee ging es an vornehmen Villen vorbei in Richtung Grunewald, und wir waren nicht mehr weit vom Forst entfernt, als das Befürchtete geschah. Es war hinter einer unübersichtlichen Kurve, als plötzlich grelle Lichter die Nacht durchzuckten, sodass der Wagen, der in einiger Entfernung vor uns fuhr, abbremsen musste und hielt.
»Ach du Scheiße«, sagte Leni, trat auf die Bremse und brachte unseren Mercedes ein paar Meter hinter dem Wagen vor uns zum Stehen.
Einige Momente lang blieb mein Kopf völlig leer. Es war die Art von atemloser Leere, die man erlebt, bevor man begreift, dass das Unglaubliche unvermeidlich ist und kurz davor steht sich zu ereignen. Es dauerte eine Weile, bis ich den Grund des Geschehens vor meinen Augen als real akzeptierte, und noch einige Augenblicke länger, bis ich erkannte, dass es vor der Straßensperre, auf die wir zugerollt waren, keine Möglichkeit zum Ausweichen für uns gab.
»Ruhig bleiben«, murmelte Leni. »Erst mal sehen, was die wollen. Keine Angst, wir kommen da schon durch.«
Ungefähr 20 Meter vor uns stand eine grüne Minna quer auf der Straße, sodass nur eine schmale Lücke zum Durchfahren blieb. Am Straßenrand sah ich zwei weitere Wagen, die anscheinend der Kripo gehörten, außerdem erblickte ich zwei Verkehrspolizisten in weißen Jacken auf ihren Motorrädern. Schwarze Uniformen sah ich keine, aber das war nur ein schwacher Trost. Wenn in Deutschland die Dinge ins Rollen kamen, dann rollten sie bis dahin, wo sie immer endeten: Irgendwann kamen die Schwarzuniformierten ins Spiel, ganz egal, womit es begonnen hatte.
In meinen Gedanken arbeitete es. War man uns schon auf der Spur? Doch wie hätte jemand in Voraus wissen sollen, was wir unternehmen und wohin wir uns wenden würden? Falls die Sache mit uns zu tun hatte, konnte es dafür nur die Erklärung geben, dass es sich um ein abgekartetes Spiel handelte, in dem Leni keine Unbeteiligte war.
Ihre Gesichtszüge waren unbewegt, konzentriert sah sie nach vorn. Nur in ihren Augen hatte es zu glimmen begonnen, und auch hinter ihrer Stirn arbeitete es, das konnte ich sehen. Ich wusste, dass sie riskante Situationen letztlich als eine Herausforderung empfand. Und wenn ich ihr tief in meinem Inneren auch zürnte, dass sie mich in eine solche Lage gebracht hatte, so war es doch beruhigend zu spüren, dass sie nicht kopflos reagierte. Nein, dachte ich, meine Verdächtigungen griffen zu weit. Sie war nicht weniger überrascht worden als ich.
Es waren sechs Uniformierte, die um die oder nahe bei der grünen Minna standen. Zwei von ihnen waren mit langen Taschenlampen ausgerüstet, mit denen sie ins Innere der Wagen leuchtete, die vor der provisorischen Sperre hielten. Zwei andere hatten Pistolen in der Hand. Ein fünfter schrieb in einen Notizblock, und der sechste war der Boss, ein schon älterer, vierschrötiger Mann, der eben von der geöffneten Fahrertür des Autos vor uns zurücktrat und einen Blick in unsere Richtung warf.
Winzige Schweißperlen traten auf meine Stirn, als der Wagen vor uns das Zeichen bekam, weiterzufahren und man uns zuwinkte, an die Sperre zu kommen. Leni kurbelte die Seitenfensterscheibe herunter und fuhr ein Stück vor.
Der vierschrötige Mann, der das Kommando zu haben schien, trat an das offene Fenster. Er trug eine weiße Schirmmütze und war älter als seine Kollegen. Unter der Mütze lugte silbernes Haar hervor. Sein rotes, fleischiges Gesicht trug einen Ausdruck stoischer Gelassenheit, und seine eng sitzende schwarze Dienstlederjacke betonte seine kräftige Gestalt. Er wirkte auf mich wie ein Straßenpolizist in New York, wie ich ihn vor ein paar Wochen in einem amerikanischen Kinofilm gesehen hatte, und ganz genauso benahm der Mann sich dann auch. Er riss nicht den Arm hoch, sondern legte seine Hand zum Gruß an die Mütze, was jedoch nicht wie ein Akt der Höflichkeit wirkte, sondern wie eine Demonstration von Macht.
»Eine reizende junge Dame am Steuer«, hörte ich ihn sagen. »Na so was! Heil Hitler und einen schönen guten Abend.«
»Heil Hitler«, gab Leni zurück.
»Da würde ich doch gern den Führerschein der jungen Dame sehen«, sagte Silberhaar.
Die Tatsache, dass eine Frau hinter dem Steuer saß, schien den Mann von Überlegungen, die sich ihm sonst in kriminalistischer Hinsicht hätten aufdrängen können, abzulenken. Leni war eine exzellente Fahrerin, aber auch in Berlin dachten noch viele Leute, dass eine Frau nicht hinter das Steuer eines Autos gehörte.
Leni öffnete das Handschuhfach und hielt ihm das Dokument unter die Nase.
»Helene Ravenov«, las er laut vor, und der Mann mit dem Notizblock, der neben ihn getreten war, kritzelte den Namen auf sein Papier.
»Der Wagen gehört dem Herrn Gemahl?«, fragte Silberhaar und richtete den Blick auf mich.
»Nein, mir selbst, Herr Wachtmeister«, antwortete Leni, bevor ich mich räuspern konnte. »Mein Mann hat ihn mir geschenkt.«
»Oho!«, sagte Silberhaar und trat einen Schritt von dem Fenster zurück, bevor er einen schrägen Blick am Wagen entlang warf, dann trat er wieder vor. »Wo soll es denn hingehen mit dem guten Stück?«
Noch ungewöhnlicher als eine Frau hinter dem Steuer war es, dass eine Frau ein Auto ihr Eigen nannte.
Leni warf ihm ein entzückendes Lächeln zu. Das Lächeln sah ich zwar nicht, las es aber am Gesicht des Polizisten ab, in dem es sich spiegelte.
»Ach wissen Sie, Herr Wachtmeister, ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein. Der Herr neben mir ist nicht mein Mann, sondern ein Freund. Ich bin eine geschiedene Frau und … nun, wir waren tanzen, sind nun aber müde und möchten ins Bett.«
»Aha, ich verstehe«, sagte Silberhaar, und sein Grinsen wurde breiter. »Ein nächtliches Abenteuer zu zweien.«
Silberhaar musterte mich ziemlich unverhohlen, und während ich das Gefühl hatte, den Strahl der Taschenlampe in meinem Nacken zu spüren, hoffte ich inständig, dass mir meine Furcht und mein schlechtes Gewissen nicht zu ausdrücklich ins Gesicht geschrieben standen. Was er sah, ließ ihn aber wohl weniger an das schlechte Gewissen eines Straftäters als an das eines heimlichen Geliebten denken oder daran, was mich vor ihm auszeichnete, dass eine Frau wie Leni sich mit mir auf ein Verhältnis einließ.
»Na, meinetwegen, wir sind ja alle aufgeklärte Berliner«, meinte er. »Wenn der Herr mir aber noch seinen Namen nennen könnte. Und einen Ausweis bitte.«
Ich nannte meinen Namen, reichte ihm meinen Anwaltsausweis, und der zweite Beamte kritzelte etwas auf sein Papier. Der Mann mit der Stabtaschenlampe kam auch ins Bild, und ich fühlte, wie eine eisige Kälte mir das Rückenmark heraufkroch, als ich registrierte, wie der Strahl seiner Funzel durch das Innere des Wagens glitt.
»Was ist denn passiert, Herr Wachtmeister?«, fragte Leni, bevor jemand fragen konnte, was sich unter der Plane auf der Rückbank befand.
Silberhaars Miene veränderte sich nicht. Ausdruckslos starrte er zum offenen Fenster herein. Doch offenbar sah er etwas in Lenis Augen, das ihn gewogen stimmte, denn schließlich spähte er schnell zu seinem Kollegen hinüber und befand anscheinend, dass noch Zeit für eine Antwort war. Er lehnte einen Arm leicht gegen den oberen Fensterrand, neigte den Kopf ein Stück tiefer und sagte zu ihr: »In der Kantstraße konnte ne alte Frau nicht schlafen, hat in ihrer Wohnung am Fenster gesessen, und da sieht sie, wie der Mercedes des alten Juweliers von gegenüber vorfährt, mit zwei Herren in seiner Begleitung. Nach einer halben Stunde kommen die beiden Kerle ohne den Mann wieder raus und fahren in seinem Wagen davon. Sie hatte einen Telefonapparat und hat gleich zum Hörer gegriffen, aber leider kam für den Herrn Juwelier jede Hilfe zu spät.«
»Mein Gott, wie entsetzlich«, sagte Leni, »ich dachte, so etwas gibt es heutzutage gar nicht mehr.«
»Tja, die neue Zeit«, brummte Silberhaar, »aber alles kann der Führer auch nicht richten. Noch nicht! Keine Sorge, wir werden die Kerle kriegen, da bin ich ganz sicher, und dann marschieren sie schnurstracks zum Schafott und verlieren ihre Köpfe. Das ist mal ganz sicher.« Er tippte mit dem Finger an die weiße Mütze, freundlicher als beim ersten Mal. »Wünsche noch eine angenehme Nacht – die Dame, der Herr!«
Silberhaar verschwand aus meinem Blickfeld, als Leni die Scheibe hochkurbelte, ohne Verzug den Wagen startete und stark beschleunigte. Kurz darauf rasten wir mit unserem unbeachtet gebliebenen Gepäckstück am Grunewald entlang.
»Um sich bei einer Frau noch Schlimmeres vorzustellen, als dass sie Auto fährt und einen Liebhaber hat, fehlt ihm die Fantasie«, sagte Leni und lächelte.
Eine schöne Frau konnte sich manches erlauben, was bei einem Mann nicht durchgehen würde, dachte ich, und verspürte so etwas wie Dankbarkeit für die Art, mit der Leni auf die Situation reagiert hatte.
»Was hättest du gesagt, wenn er gefragt hätte, was sich unter der Plane befindet?«
»Na, ein Kleiderkoffer natürlich, den ich von meiner Schneiderin geholt habe. Stimmt doch auch! Er hätte unter die Plane geblickt, den Koffer gesehen und mir geglaubt.«
»Besser, dass wir es nicht darauf ankommen lassen mussten.«
Sie lachte. »Die Feuerprobe haben wir bestanden. Jetzt geht nichts mehr schief. Wir haben es geschafft!«
»Dass er unsere Namen notiert hat, gefällt mir nicht. Wer weiß, wen die wirklich gesucht haben. Juwelenräuber? Möglich, kommt mir aber spanisch vor.«
»Wahrscheinlich suchen sie Kommunisten, die nen Bombenanschlag planen«, sagte Leni. »Aber egal, wir passten so oder so nicht ins Bild.«
»Trotzdem sollten wir einen Bogen nach Westen schlagen und eine Stelle suchen, die nördlich von hier liegt. Falls dann jemand eine direkte Verbindungslinie zwischen deiner Wohnung und dem Fundort der Leiche zieht und der Polizist sich an uns erinnert, liegt die Koenigsallee, wo er uns kontrollierte, nicht auf dem Weg.«
»Spielt das eine Rolle? Sind wir deshalb weniger verdächtig? Aber meinetwegen, wenn du dann ruhiger schlafen kann, machen wir es so.«
An der nächsten Kreuzung bog Leni ab. Die Straße, auf die wir gerieten, führte an einer Wohnsiedlung vorbei und dann durch den Wald zum Teufelssee, und von dort ging es weiter in Richtung auf das Reichssportfeld zu und nach Norden zurück.
»Irgendwo hier müssen wir den armen Kerl loswerden«, sagte Leni, »sonst sind wir gleich wieder zwischen den Häusern.«
Ich kurbelte mein Fenster hinunter und spähte in die Nacht hinaus. Wolken trieben vom Wind bewegt über den Himmel. Die frische Luft tat gut und roch angenehm nach Wald.
»Da vorne, den Forstweg nehmen wir«, sagte Leni, die die Geschwindigkeit des Wagens verlangsamt hatte. Kurz darauf bog sie in einen holperigen Weg ein, der in den Wald eine Schneise schlug. Ein gutes Stück von der Straße entfernt hielt sie an und schaltete die Lichter aus, und ich stieg ins Freie, um die nähere Umgebung zu erkunden.
Alles war ruhig, kein Mensch war in der Nähe. Der Mond, der zwischen den Wolken erschien, gab etwas Licht. »Die Luft ist rein«, sagte ich zu Leni, die ihre Tür geöffnet hatte.
Sie kletterte aus dem Wagen und klappte die Sitze vor, dann schoben und zerrten wir das Behältnis mit vereinten Kräften aus dem Fahrzeug und bis an den Wegesrand. Leni öffnete die Schnallen, dann stellten wir den Koffer auf, sodass der tote Michail herausrollte.
Ich legte den Koffer in den Wagen zurück, streifte mir die Handschuhe über und holte die Waffe.
»Weiter in den Wald«, sagte ich.
»Sie finden ihn sowieso«, entgegnete Leni.
»Wir könnten Reifenspuren verursacht haben. Heute Morgen hat es geregnet. Wenn die Polizei schlau ist, stellt sie eine Verbindung her.«
»Ich werde den Wagen morgen waschen, wenigstens ein paar Eimer Wasser über die Reifen kippen«, sagte Leni. »Mehr können wir nicht tun. Ich glaube nicht, dass die Russen auf eine eingehende Untersuchung drängen werden. Die Polizei ist vermutlich unser geringstes Problem.«
Trotzdem bestand ich darauf, den Toten weiter in den Wald zu schleppen. Es wurde eine schweißtreibende Angelegenheit, aber es ging.
Als wir ihn abgelegt hatten, überlegte ich, wie es aussehen musste, damit glaubhaft war, dass Michail sich selbst erschossen hatte. Ich arrangierte den Körper in einer Lage, die zu einem Selbstmord passte. Dann nahm ich die Pistole aus dem Koffer, machte mir klar, wohin sie gefallen hätte sein müssen, wenn sich der Mann den Schuss in die Schläfe gesetzt hätte, und deponierte sie dort zusammen mit der Patronenhülse.
»Deine Freunde werden wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass man die Leiche nicht in deiner Wohnung, sondern im Grunewald findet«, sagte ich, als wir wieder beim Auto waren. »Und dass dir jemand geholfen haben muss, werden sie natürlich auch wissen.«
»Sie werden nichts überstürzen«, sagte Leni, »es bleibt nichts, als auf ihren nächsten Schachzug zu warten, und ich habe vor, ihn zu kontern, wenn er kommt.«
Ich konnte nur hoffen, dass Leni mich nicht verraten würde. Es war eine schwache Hoffnung. Im Nachhinein schien es mir fast der genehmere Fall zu sein, wenn nicht ihre ominösen Freunde, sondern sie selbst für Michail Sapozniks Tod verantwortlich wäre. Zwar wusste ich nicht, weshalb sie ihn hätte erschießen sollen, aber ihre augenfällige Sorglosigkeit, kaum dass der Tote sich nicht mehr in ihrer Wohnung befand, hätte mir, wenn ich ihr übel gesonnen gewesen wäre, als ein Indiz dafür gelten können, dass sie mich belogen hatte.
»Du hast Mut«, sagte ich, »keine Ahnung, woher du ihn nimmst.«
Mehr war nicht zu tun. Wir kehrten zum Waldrand zurück und traten unverzüglich die Rückfahrt an.
»Ich würde heute Nacht gern bei dir bleiben«, sagte Leni. »In meiner Wohnung fühle ich mich nicht sicher.«
Hätte sie es nicht gesagt, hätte ich selbst den Vorschlag gemacht. Wenn ich schon in der Patsche saß, wollte ich wenigstens wissen, warum. Ich musste ihr auf den Zahn fühlen und herausbekommen, was tatsächlich geschehen war, und wenn ich die Wahrheit aus ihr herausprügelte.
Eine Zeitlang kreuzten wir auf den Straßen, die den dunklen Forst durchschnitten, schließlich passierten wir die Deutschlandhalle und bewegten uns wieder stadteinwärts. Leni steuerte den Wagen am Westkreuz vorbei nach Norden und nahm dann die großen Straßen. Über die Bismarckstraße und die Charlottenburger Chaussee ging es schnurgerade nach Osten durch den Tiergarten und das Brandenburger Tor hindurch. Von der Allee Unter den Linden fuhr sie die Friedrichstraße hinunter, die nicht so mondän wie der Berliner Westen, aber einer der Hauptanziehungspunkte des Nachtlebens war. Auch zu dieser Stunde hatten viele Lokale noch nicht geschlossen. Hinter dem Belle-Alliance-Platz ging es über den Kanal und dann um ein paar Ecken, bevor Leni den Wagen vor dem Gebäude parkte, in dem sich meine Wohnung befand.
3. Kapitel
Wir stiegen die Treppen hinauf und hängten die Mäntel an die Garderobe. Ich machte eine Flasche Wein auf und stellte sie mit zwei Gläsern zusammen auf den Tisch.
Leni trug ein ärmelloses schwarzes Chiffonkleid, in dem sie ganz reizend und mehr nackt als angezogen aussah. Ihr Anblick brachte mich sofort auf andere Gedanken, doch ich beschloss, meinem Vorsatz treu zu bleiben.
»Ich habe dir geholfen, den Toten fortzuschaffen«, sagte ich, nachdem ich Wein eingeschenkt hatte und wir in den Sesseln saßen. »Nun bist du dran! Wer hat Sapoznik getötet? Vor wem hast du Angst?«
Sie sah sich wie hilfesuchend um. »Ich will dir nicht ausweichen, Eugen, aber ich kann dir keine Namen nennen.«
»Dann versuch es ohne Namen! Weshalb musste der Russe sterben?«
Sie griff zu ihrem Glas und trank einen Schluck Wein. »Sicher erinnerst du dich noch an den Bankier Arnheim?«
»Arnheim?« Einen Moment lang war ich überrascht. »Natürlich, auf seiner Cocktailparty haben wir uns kennengelernt.«
»Er ist tot, wie du sicher weißt.«
»Ja, irgendjemand hat ihn erschossen.«
Wenn es eine Verbindung zwischen Arnheim und den Geschehnissen dieser Nacht gab, hatte meine Ahnung mich nicht getrogen. Leni hatte mich zwar nicht in eine Falle gelockt, aber es hatte mit meiner ganz persönlichen Vergangenheit zu tun, weshalb sie sich gerade an mich um Hilfe gewandt hatte, ohne mir den Grund dafür zu nennen.
»Er war ein übler Zeitgenosse«, sagte sie, »aber diejenigen, die seinen Platz eingenommen haben, sind noch schlimmer als er.«
»Mit seinem Namen verbindet sich für mich mehr als nur die Erinnerung an diese Cocktailparty«, erwiderte ich. »Er war ein Schurke, mit dem man reden konnte.«
Bei dem Gedanken an ihn stürzte die ganze alte Geschichte regelrecht auf mich ein: Arnheims Auftrag vom Herbst 32, als er mich gebeten hatte, nach New York zu reisen, um die Modalitäten der Scheidung von seiner Ehefrau Florence zu regeln, die ihn verlassen und in ihre amerikanische Heimat zurückgekehrt war. Der Tod von Florence und Arnheims dubiose Rolle in der okkulten Gesellschaft der »Brüder und Schwestern vom Licht«, deren Machenschaften in der Nacht des Reichstagsbrandes zu meiner Verhaftung geführt hatten. Arnheims Intrigen hatten mir mächtig zugesetzt, doch dann war es plötzlich vorbei gewesen; im Sommer 34 hatte er sich verkalkuliert und seinen Fehler mit einer tödlichen Pistolenkugel in den Kopf quittiert.
»Dass Arnheim vor zwei Jahren von einer jungen Frau erschossen wurde, kam nicht von ungefähr«, sagte Leni. »Arnheim hatte eine große Schwäche für schöne Frauen. Auch auf mich hatte er ein Auge geworfen. Damals – Anfang 33 – lebte ich schon von Hermann, meinem Mann, getrennt. Ich verkehrte in Arnheims Haus und hatte eine Liaison mit ihm. Nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, waren sie alle Feuer und Flamme, die ganze Clique. Arnheim konnte einfach den Mund nicht halten, wenn er mit einer schönen Frau ins Bett wollte, er musste sich immer wichtigmachen. Ich selbst war hellwach, wenn er zu plaudern begann, insbesondere, als er davon sprach, dass die Nationalsozialisten mächtige Unterstützung aus dem Ausland hätten. Bald würde etwas passieren, meinte er im Februar 33, und erst dann würde Hitler in Deutschland eine radikal neue Politik beginnen. Du weißt, von welchem Ereignis ich spreche.«
Sie konnte eigentlich nicht wissen, wer Arnheim erschossen hatte, überlegte ich. Es sei denn, einer der wenigen, die davon wussten, hatte es ihr gesagt. Offiziell war Arnheim eines der Opfer, die in der »Nacht der langen Messer«, wie man den Röhm-Putsch im Volksmund auch nannte, ihr Leben gelassen hatten – doch in Wahrheit hatte ein junges Mädchen die Schüsse auf ihn abgegeben, um Rache für den Mord an ihrem Geliebten zu nehmen, den Arnheim auf dem Gewissen hatte. Wer wusste davon? Wer außer mir und meinem Schwager Rudolf Mantiss?
»Du meinst vermutlich den Reichstagsbrand«, erwiderte ich. »Gehörte Arnheim nicht auch zu denen, die schon eine ganze Zeit vor Ausbruch des Feuers wussten, dass der Reichstag brennen würde?«
Leni starrte eine Weile vor sich hin. »Beim Reichstagsbrand geriet mehr in Brand als nur dieses Gebäude. Das Ereignis wird in seiner Bedeutung unterschätzt. Es lässt mich nicht los, ich muss immer wieder daran denken. Es war die Initialzündung, es fiel damit eine Entscheidung mit unabsehbaren Folgen. Der Reichstagsbrand hat eine Tür geöffnet.«
»Für mich nicht. Mir hat er alle Türen verschlossen. In jener Nacht hat man mich verhaftet. Von dem Tag an war alles anders. Welche Tür soll der Brand geöffnet haben?«
»Eine Tür, die man nie hätte öffnen dürfen. Die Tür, durch die das Böse ins Land gekommen ist. Die Folgen des Brandes werden das Land ins Verderben stürzen, am Ende vielleicht die ganze Welt.«
»Greifst du nicht ein bisschen weit?«
»Die Brandstifter haben den Teufel hereingelassen«, sagte sie und rieb sich die Augen. »Der Reichstagsbrand war der erste Schritt auf einem Weg, der uns alle ins Unheil stürzen wird.«
»Wen meinst du mit den Brandstiftern? Arnheim und seine damaligen Freunde bei der SA?«
Sie sah erneut eine Weile vor sich hin. »Arnheim war eigentlich nur eine Randfigur, er war nur wichtig, weil er Verbindungen besaß. Ich denke nicht an die SA und weniger an Arnheim als an seine Bank. Zu jener Zeit, also im Februar und März 33, kam sehr viel Geld aus dem Ausland auf den Konten der Nazis bei der Delbrück Bank an.«
»Von wem kam das Geld?«
»Aus London und New York. Vor allem aus New York.«
»Von amerikanischen Geldgebern?«
»Es kam von deutschen und amerikanischen Unternehmen, auf Umwegen, aber eigentlich kam es praktisch allein von den Amerikanern, denn die waren Mehrheitsgesellschafter auch in den deutschen Unternehmen.«