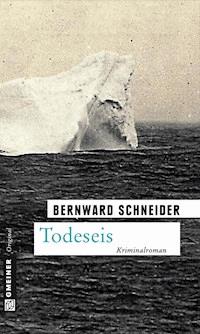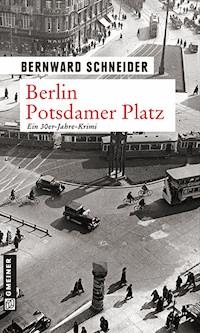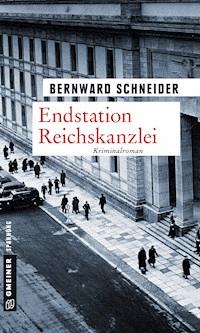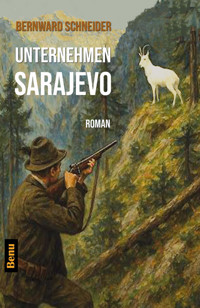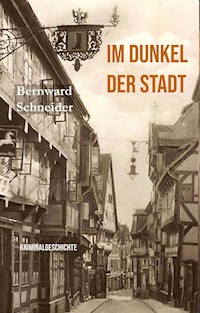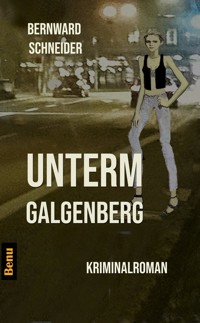Titel
Bernward Schneider
Spittelmarkt
Ein Berliner Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Dieses Buch wurde vermittelt durch
die Literaturagentur erzähl:perspektive, München
(www.erzaehlperspektive.de).
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/Korrekturen: Daniela Hönig /
Doreen Fröhlich, Sven Lang, Katja Ernst
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: Getty Images
ISBN 978-3-8392-3560-7
1
Kaum hatte ich die Brücke über den Landwehrkanal betreten, da merkte ich, dass ich verfolgt wurde. Sofort war mir klar, dass ich keine Möglichkeit mehr zum Ausweichen besaß. Die Dämmerung war vorangeschritten, die Lichter der Stadt griffen gierig nach dem Himmel. Nicht weit entfernt toste der abendliche Verkehr, Busse, Straßenbahnen, vereinzelt waren noch Passanten auszumachen. Allerdings sollte mir das nichts nützen. Zur falschen Zeit am falschen Ort war ich meinen Verfolgern ausgeliefert und auf mich selbst gestellt.
»So spät dran heute Abend, Herr Rechtsanwalt?«, hörte ich eine säuselnde Stimme. Sowie ich zur Seite blickte, sah ich das höhnische Grinsen eines Mannes, der nun zu meiner Linken aufgeschlossen hatte und auf dessen hageres Rattengesicht der Halbschatten einer Schirmmütze fiel. Der Mann war einen halben Kopf kleiner als ich, besaß aber eine erkennbar kräftige und drahtige Gestalt. Er war mir völlig unbekannt.
»Die Leute haben Probleme und ich selbst viel zu tun«, sagte ich im Bemühen, unverbindlich zu bleiben, während wir nebeneinander her auf das andere Ende der Brücke zuschritten. »Leider kann ich mich nicht an Ihren Namen erinnern.«
»Das musst du auch nicht«, antwortete der drahtige Mann mit dem Rattengesicht, »es reicht doch, dass ich dich kenne.«
Wahrscheinlich wäre es sogar besser gewesen, ich wäre auf der Brücke stehen geblieben, denn nachdem wir das andere Ufer erreicht hatten, tauchte zu meiner rechten Seite der andere Typ auf, den ich unterbewusst irgendwie schon gewittert hatte, ein echter Brecher, größer und breiter als sein Kumpan, ein Strolch mit Bürstenhaarschnitt und einem grobflächigen Gesicht.
Im nächsten Moment wurde mein rechter Arm mit brachialer Gewalt gepackt und herumgerissen, und ehe ich mich versah, hatten mich die beiden Typen die Böschung hinter der Brücke hinuntergezerrt. Ich kam ins Rutschen und stolperte nach vorn, doch meine Begleiter hielten mich fest. Sobald sie mich wieder zu voller Größe aufgerichtet hatten, standen wir zu dritt im Dunkel unter der Brücke. Dabei presste der Große mithilfe seines dicken Arms meinen Hals und meinen Kopf so fest gegen die Mauer, dass mir die Luft zum Atmen wegblieb.
Der Drahtige hatte mit einem Mal ein Messer in der Hand, dessen Klinge in dem sich im Kanalwasser spiegelnden Licht so tückisch glitzerte wie das schwarze Nass in seinem Hintergrund.
»He«, protestierte ich, als der Druck des Armes auf meinen Hals etwas nachließ, »nicht so stürmisch. Man kann über alles reden.«
»Kann man, muss man aber nicht!«, lächelte das Rattengesicht unangenehm.
Der Schein der Laternen am gegenüberliegenden Ufer reichte nicht so weit, dass es die gespenstische Szene hätte erhellen können, in der ich so plötzlich der Mittelpunkt war, und mich beschlich der Gedanke, dass meine Leiche wahrscheinlich nicht die einzige wäre, die man am nächsten Morgen aus dem Kanal fischen würde, falls die Sache hier nicht noch eine gute Wendung für mich nahm.
»Ich weiß, dass wir in miesen Zeiten leben, versuchte ich mich zu retten. »Und Sie mögen es glauben oder nicht – auch den Anwälten geht es hierzulande gerade ziemlich schlecht. Trotzdem spende ich gern, was ich bei mir habe. Die Börse befindet sich in der Gesäßtasche. Wenn Sie einverstanden sind, hole ich sie …«
Das Messer des Drahtigen bewegte sich weiter in Richtung meines Halses, und dann ließ der Typ mich den kalten Stahl der Klinge an meiner Kehle spüren. »Wer sagt denn, dass wir dein Geld wollen, Herr Rechtsanwalt?«, grinste er. »Vielleicht pfeifen wir ja auf dein bisschen Knete und nehmen uns lieber dein bisschen Leben.«
»Von meinem bisschen Leben haben Sie doch nichts«, versuchte ich zurückzugeben –, mit einer Stimme, die nur mehr ein Krächzen war. »Es ist besser, wir finden eine Lösung, die beiden Seiten dienlich ist.«
»So dämlich kann nur ein Anwalt quatschen«, spottete der Drahtige und drückte die Messerspitze einen Millimeter tiefer in meine Haut. »An was für eine Lösung hast du gedacht?«
»Ich könnte mehr Geld beschaffen«, sagte ich aufs Geratewohl, aber ehe ich dazu kam, meinen Plan weiter zu entwickeln, spürte ich schon den scharfen Schmerz eines Schnitts, und als das Rattengesicht das Messer unmittelbar vor meine Augen führte, sah ich trotz der Dunkelheit, dass Blut von der Spitze tropfte.
»Judenblut?«, wollte er ebenso leise wie bedrohlich wissen.
Ich schüttelte den Kopf.
»Glück gehabt – aber das rettet dich noch nicht«, sprach er, ließ jedoch das Messer sinken.
Langsam wurde mir klar, dass die Sache hier kein unglücklicher Zufall war. Die beiden mussten einen Auftraggeber haben, der sie auf mich angesetzt hatte, sodass sie mir nahe meiner Wohnung hatten auflauern können. Diese Erkenntnis bestärkte mich allerdings in der Hoffnung, dass Aussicht bestand, die Sache lebend zu überstehen, wenn ich bloß keinen Fehler beging.
Ich fragte: »Was muss ich tun?«
»Immer die richtige Entscheidung treffen«, sagte der Drahtige heiser in seiner spöttischen Art, während sein Kumpan, der ein paar Schritte zurückgetreten war und dessen Gesicht ich noch nicht hatte studieren können, nachhaltig schwieg. »Triffst du die falsche Entscheidung –«, er begann wieder mit dem Messer zu hantieren, »so verlässt dich auch dein letztes bisschen Glück!«
»Falsche Entscheidung? Ich verstehe nicht …«
Anstelle einer Erklärung blickte der Drahtige nun zu seinem urwüchsigen Kumpan. Der trat vor und schlug mir kommentarlos seine rechte Faust in den Bauch. Ich stürzte zu Boden und rang nach Luft. Der Schläger packte mich sofort mit den Quadrathänden und stellte mich wieder auf die Füße.
»Du verstehst nicht?«, hakte das Rattengesicht nach.
Endlich schaffte ich es, etwas zu sagen. »Doch, ja doch, natürlich, ich verstehe!«
»Gut so! Du hast eine schnelle Auffassungsgabe«, bemerkte der Strolch. »Hoffentlich bleibt sie dir erhalten! Das hoffst du doch auch?«
Ich nickte. »Ja, gewiss!«
»Wenn also jemand zu dir kommt und will, dass du als Anwalt etwas für ihn tust. Was machst du dann?«
Ich erwiderte nichts, worauf der Drahtige den Kopf wieder zur Seite wandte. Bevor er etwas tun konnte, erwiderte ich schnell: »Was man von mir verlangt.«
Er lächelte. »Rrrichtig! Und fang gleich morgen damit an, hörst du! Falls du es wieder vergessen solltest«, er hob das Messer, warf es wie ein Jongleur in die Luft und fing es am Griff wieder auf, »kommen wir uns dein Arierblut holen – und diesmal nehmen wir uns davon mehr als bloß ein paar Spritzer, verlass dich drauf!«
Er klappte das Messer zusammen, machte seinem Kumpan ein Zeichen, der holte aus und hieb mir zum Abschied ein weiteres Mal die kräftige Faust in den Bauch.
Ich sackte zusammen und kam erst wieder hoch, als ich das Gefühl hatte, fast schon erstickt zu sein. Während ich mit dem Rücken gegen die Brückenmauer lehnte und keuchend auf das Lichterglitzern des schwarzen Wassers starrte, hatten sich die beiden Schurken längst davongemacht. Die Börse mit dem Geld hatten sie mir gelassen.
Der Auftrag, nach New York zu reisen, erreichte mich eine Woche nach dem Vorfall am Landwehrkanal. Auftraggeber war Philipp Arnheim, Chef der Berliner Delbrück Bank.
Wir saßen in meinem Büro, als wir über die Sache sprachen. Außer Philipp Arnheim und mir war Johannes Haller zugegen, mein Seniorpartner in der Anwaltskanzlei, dessen langjähriger Mandant Arnheim war.
»Am liebsten wäre ich selbst nach New York gereist, aber Florence will mich nicht sehen«, bedauerte der Bankier. »Zu Ihnen, Herr Goltz, schrieb sie mir, hätte sie Vertrauen. Sie haben freie Hand, was eine Scheidungsregelung angeht – mit einer einzigen Ausnahme: Florence muss das Dokument zurückgeben, das sie mir entwendet hat; doch wie sie mir bereits in ihrem Brief mitteilte, ist sie dazu bereit.«
Arnheim war ein schlanker, selbstbewusster Mann, dem seine hervortretenden Wangenknochen und die bräunliche Haut, die sich über den glatt rasierten Schädel spannte, ein leicht exotisches Aussehen gaben. Er trug einen dunklen Anzug und ein feines Hemd mit Manschetten, seine herausragende Stellung war ihm nicht anzusehen; das Gebaren des Eigners einer großen Bank hätte man sich irgendwie formeller und nicht so salopp wie das seinige vorgestellt.
»Warum schickt Florence das Dokument denn nicht mit der Post?«, fragte ich ihn.
»Nein! Das ist viel zu unsicher! Ich brauche einen vertrauenswürdigen Kurier«, erwiderte Arnheim. »Und dieser Kurier müssen Sie sein, Herr Goltz!«
»Um was für eine Art von Dokument handelt es sich denn?«
Der Bankier winkte ab. »Es handelt sich um den Brief eines ausländischen Partners, eher privater Natur, der auf keinen Fall an die Öffentlichkeit gelangen darf, insbesondere soll Fairchild in New York, unser wichtigster Geschäftspartner in den Vereinigten Staaten, ihn nicht in die Hände bekommen.«
»Wir können es uns nicht leisten, das Angebot unseres treuen Freundes in den Wind zu schlagen«, schaltete sich Haller ein und richtete den eindringlichen Blick seiner kleinen bebrillten Augen auf mich. Er war ein Mann von 60 Jahren und untersetzter Gestalt, in seinem steifen Auftreten der Prototyp eines deutschen Geschäftsmannes. »Soviel ich weiß, beherrschen Sie doch ein ganz ausgezeichnetes Englisch, Herr Goltz!«
Haller hatte natürlich recht. An der Sache hing eine ganze Menge Geld, und das Jahr 1932 war bisher kein gutes Jahr gewesen. Mehr als je zuvor waren wir auf Arnheims lukrative Mandate angewiesen. Es sprach nichts dagegen, dass ich die Reise unternahm – das Einzige, was mich störte, war der Umstand, dass ich ungern Interessen vertrat, die gegen Florence Arnheim gerichtet waren. Ich kannte Florence besser als ihren Ehemann. In einem Scheidungsverfahren hätte ich daher lieber sie als ihren Gatten vertreten.
Arnheim sah mich aufmunternd an. »Also, sagen Sie schon zu, mein lieber Herr Goltz, dass Sie für mich diese kleine Reise unternehmen werden! Ich habe rein vorsorglich eine Schiffspassage für die übernächste Woche reservieren lassen. Können Sie das einrichten?«
Es gab sowieso keine Möglichkeit, das Mandat abzulehnen. Und ehrlicherweise wollte ich es auch nicht. Obwohl ich das unbestimmte Gefühl hatte, dass Arnheim mir irgendetwas verschwieg, verspürte ich plötzlich Reiselust und das Bedürfnis, dem grauen Alltag einmal für zwei, drei Wochen zu entfliehen.
»Gut! Abgemacht!«, sagte ich. »Übernächste Woche! Sie können die Passage für mich buchen.«
Arnheim und Haller strahlten bis über beide Ohren, als hätten sie gerade in der Lotterie das große Los gezogen, und Arnheim drückte mir vor Freude die Hand. »Sie werden bald sehen, dass ich Ihnen nicht zu viel versprochen habe«, erklärte er. »Der Atlantik ist dem Reisenden nie günstiger als um diese frühherbstliche Jahreszeit. Die Reise wird ganz und gar unvergesslich für Sie werden.«
Mit Letzterem sollte er richtig liegen, ebenso mit seiner Prognose in Bezug auf das Wetter. Im Übrigen würde alles ganz anders kommen, als es sich zunächst den Anschein gab. So manches Mal sollte ich mich fragen, wie mein Leben wohl verlaufen wäre, hätte ich an diesem Tage eine andere Entscheidung gefällt.
»Ich nehme Sie beim Wort«, verabschiedete ich ihn. Arnheim wünschte mir angenehme Tage und versprach, mir die nötigen Reiseunterlagen und Dokumente rechtzeitig vor der Abfahrt ins Büro bringen zu lassen.
So kam es, dass ich noch am selben Abend in der Buchhandlung um die Ecke einen Baedeker-Reiseführer für New York erstand. Keine zwei Wochen später stieg ich am Lehrter Bahnhof in Berlin in einen Zug, der mich nach Bremerhaven brachte.
2
Ich bestieg die ›Bremen‹, das Vorzeigeschiff des Norddeutschen Lloyd, einen Ozeanliner mit zwei Schloten und fünf Signalhörnern, der schon bei Einbruch der Dämmerung unter voller Beleuchtung an der Columbuskaje von Bremerhaven lag. Das Schiff strahlte Kraft und Seetüchtigkeit aus, ließ jedoch Grazie und Schönheit gänzlich vermissen, und je länger ich vom Land aus den Liner betrachtete, umso mehr verstärkte sich in mir der Eindruck, dass dieser Dampfer trotz seines lang gestreckten niedrigen Profils ein untersetztes, nahezu boshaftes Aussehen besaß.
Die ›Bremen‹ sollte Deutschland am Abend verlassen. Nachdem ich meine Kabine bezogen, mein Gepäck verstaut und mich etwas ausgeruht hatte, begab ich mich an Deck, um die Abfahrt des großen Schiffes zu verfolgen.
Auf der Columbuskaje hatte eine Musikkapelle Aufstellung genommen. Matrosen zogen die Landungsstege ein. Zwischen den Menschen, die unten standen und denen oben, wechselten Rufe, Wünsche und Abschiedsgrüße hin und her. Zudem gab es vielerorts Tränen. Da sich das Ablegemanöver in die Länge zog, wechselte ich zur Seeseite hinüber, wo es stiller zuging, indessen die dahinter liegende See dunkel und unruhig war. In der Ferne erblickte ich Lichter, unbewegte, die man wohl einem Leuchtturm oder einer anderen befestigten Hafenanlage zuordnen musste.
Es dauerte nicht lange, da wurde meine Aufmerksamkeit auf ein Paar gelenkt, das ein Stück entfernt an der Bordwand stand: eine junge Frau und ein junger Mann, beide in leichte Mäntel gehüllt. Obwohl ich kaum mehr als ihre Umrisse sah, gewann ich den Eindruck, sie beide besäßen anmutige, geschmeidige Gestalten, und sobald die Frau gleich darauf den Kopf in meine Richtung drehte und der Mond ihre Züge erhellte, da war ich überrascht und fühlte mich unversehens in eine ferne Vergangenheit versetzt. Diese Frau sprach etwas in mir an, das im Unterbewusstsein schlummerte. In ihrer Schönheit erinnerte sie mich an eine Pharaonenprinzessin oder etwas in dieser Art; eine Frau, mehr Engel als Mensch, jedenfalls etwas ganz Besonderes.
Gelassen nahm die Schöne den Blick von mir und wandte die Augen wieder ihrem Begleiter zu. Auch ich starrte von Neuem auf die dunkle See hinaus, damit ich nicht neugierig oder aufdringlich wirkte. Sobald ich einen weiteren Blick riskiert hatte, war das Paar verschwunden, trotz der Kürze des ganzen Eindrucks war mir, als hätte ich soeben etwas völlig Neues und noch nie Dagewesenes erlebt.
Kurz darauf stieß die ›Bremen‹ ein Signal aus allen fünf Hörnern gleichzeitig aus. In majestätischer Ruhe trat der Liner seinen Weg aus dem Hafenbecken hinaus an, während ich zusehen konnte, wie die Wasserfläche zwischen Schiff und Land immer größer wurde, die winkenden Menschen am Kai immer kleiner. Die Lichter von Bremerhaven verblassten allmählich.
Meine Kabine war ein angenehmer, mit hellem Kirschholz möblierter Raum, dessen runde Fenster Ausblick auf das Meer gewährten. Draußen schimmerte silbernes Mondlicht auf den sanften, nachtschwarzen Wellen. Der tanzende Widerschein des Wassers erfüllte mich trotz seiner Stille mit einer gewissen Unruhe, ein Vorbote meines beginnenden Aufbruchs ins Ungewisse.
Ich ging bald schlafen, und sowie ich am nächsten Morgen nach dem Frühstück über Deck spazierte, lag der Atlantik in hellem Sonnenschein, außerdem war die Luft, wie mir einige Mitreisende mit gewichtiger Miene versicherten, für die Jahreszeit ganz außergewöhnlich mild.
Mehrere Stunden verbrachte ich mit der Besichtigung des Schiffes und erforschte die vier durchgehenden Decks, die Halbdecks im Rumpf und die weiteren Decks, die es in den Aufbauten des Mittelschiffs gab. Im Innern des Ozeanriesen entdeckte ich ein Schwimmbad, außerdem ein ägyptisches Dampfbad sowie einen Turnsaal, in dem moderne mechanische Geräte auf sportliche Benutzer warteten. Ich versuchte mich an sämtlichen Geräten, drehte ein paar Runden im kalten Wasser und schwitzte zwischendurch unter den gleichgültigen Augen einer hölzernen Sphinx vor mich hin. Dann endlich fühlte ich, wie die Anspannung der vergangenen Tage und Wochen, die ich mit an Bord geschleppt hatte, langsam von mir abzufallen begann.
Den Nachmittag brachte ich in einem der vielen Gesellschaftsräume mit Lesen zu. Ich hatte mir Schopenhauers ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹ als Reiselektüre zugedacht und mir außerdem den ›Old Surehand‹ von Karl May ins Reisegepäck gesteckt, weil ich auch etwas Leichteres zur Entspannung benötigte. Die Aussicht auf diese Reise nach Amerika hatte die Träume meiner Jugend neu belebt, und zu meiner Zufriedenheit stellte ich fest, dass mich ein Buch, das ich nun nach mehr als 30 Jahren ein zweites Mal las, erneut zu fesseln vermochte.
Das Schiff erreichte an diesem Tag die französische Stadt Cherbourg, die aus der Ferne einem malerischen Fischerdorf glich. Nachdem dort die französischen Passagiere zugestiegen waren, nahm der Liner endgültig Kurs auf den Atlantik.
Ein Stück westlich von Cherbourg steigerte die ›Bremen‹ ihre Geschwindigkeit in geradezu dramatischer Weise, als wollte sie demonstrieren, dass sie zu Recht das blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung trug und ein weiterer Geschwindigkeitsrekord im Bereich des Möglichen lag. Da sich die Weiten des Atlantiks von ihrer freundlichsten Seite präsentierten, bestand nach der übereinstimmend bekundeten Meinung vieler Passagiere gute Aussicht, dass die ›Bremen‹ die Strecke nach New York binnen vier Tage hinter sich bringen würde.
Das fantastische Sonnenwetter dauerte auch den zweiten Reisetag über an. Die See war ruhig, der Atlantik ergreifend grün, und als Mensch vom flachen Lande, der nicht wusste, wie schnell sich auf dem Meer die Großwetterlage verändern konnte, mochte ich wohl glauben, dass das angenehme Wetter für den Rest der Reise gesichert war. Die Reisenden und das Bordpersonal hatten alle gute Laune. Auch deshalb versprach die Fahrt nach Westen ein durchgehend entspanntes Vergnügen zu werden.
Bei den Mahlzeiten saß ich mit einer gewissen Frau von Tryska am Tisch, die am ersten Reisetag beim Mittagessen auf der Suche nach einem freien Platz an meinen Tisch geeilt gekommen war. Sie war eine korpulente Frau Ende 50 und die Witwe eines rheinischen Fabrikanten, deren Tochter in Cleveland, Ohio, verheiratet war. Bereits nach zwei Tagen besaß ich einen vollständigen Überblick über ihr Leben, das mir trotz seiner Höhen und Tiefen nicht so interessant erschien, um es im Gedächtnis zu behalten. Immerhin erreichte sie mit ihrer lockeren und kumpelhaften Art, dass ich in einer für mich ungewohnt offenen Weise über meine Person, meinen Beruf und – in dem Umfang, in dem es mir meine anwaltliche Verschwiegenheitspflicht erlaubte – auch über den Anlass meiner Reise in die Vereinigten Staaten Auskunft gab.
»Ich bin oft in der Hauptstadt«, sagte Frau von Tryska am Abend des zweiten Reisetages, während wir bei Hummersuppe, Seezungenfilet in zerlassener Butter mit Kartoffeln und Waldorfsalat beieinander saßen. »Wo befindet sich denn Ihre Kanzlei?«
»In Berlin Mitte, nahe Unter den Linden«, erwiderte ich vage, kam aber nicht umhin, ihr die genaue Adresse der Kanzlei zu nennen, worauf sie in der Art mancher Touristen aus der Provinz, die den Einheimischen gern wissen lassen, wie gut sie sich in dessen Heimatstadt auskennen, erklärte: »Wenn ich in der Hauptstadt bin, logiere ich im Aranerhof; der liegt auch in der Friedrichstadt, nahe dem Spittelmarkt, kaum mehr als 500 Meter von Ihrer Kanzlei entfernt.«
Wir waren beim Dessert angelangt. Während ich nur noch mit halbem Ohr dem nicht versiegen wollenden Redefluss meiner Tischnachbarin zuhörte, schweifte mein Blick über die Tischreihen und ich erkannte ganz in der Nähe die Frau vom Abend der Abreise.
Es war nicht wie so oft, wenn der zweite Blick ernüchternd wirkte; nein, diese Frau war die Schönheit in Vollendung und verkörperte geradezu ein fleischgewordenes Ideal.
Ihr schmales Gesicht war von dichten kastanienfarbenen Locken umrahmt; sie hatte dunkelgrüne Augen, eine klassisch gerade Nase und einen sinnlichen Mund. Das graue Kostüm, das sie kleidete, wirkte unauffällig, doch hätte sie Säcke tragen können und darin nicht weniger anziehend gewirkt. Der strahlend durchscheinende makellose Teint, die schlanken langgliedrigen Hände mit den eleganten Gelenken, die aus den Ärmeln ihrer Kostümjacke vorsprangen und bereits das Ebenmaß der bedeckten Teile ihres Körpers ahnen ließen, ihre Haltung, ja, schon die Art, wie sie Messer und Gabel bewegte, die Grazie, die sich auf die angemessene und leichteste Weise jeder ihrer Bewegungen und Stellungen mitteilte, sodass sie der natürliche Ausdruck aller ihrer Absichten war, weckten den sehnsüchtigen Wunsch in mir, noch viel mehr von ihr zu sehen.
Sie war mindestens 20 Jahre jünger als der Mann, der ihr gegenübersaß. Dieser war zu meiner Gewissheit nicht derselbe Mann, mit dem ich sie vor dem Ablegen des Schiffes an der zur See gelegenen Bordwand gesehen hatte. Seine Erscheinung war eigentlich nicht bemerkenswert, sondern erregte mein Interesse nur, weil er gewissermaßen am Glanz seiner Begleiterin partizipierte. Das Gesicht des Mannes erschien mir vertraut, obwohl ich es nirgendwo zuordnen konnte. Er hatte die 50 überschritten und besaß markante und fein geschnittene Züge, auf denen der erste Schatten gut verlebter Jahre lag. Er wirkte so groß wie wohlbeleibt, letzteres jedoch nicht von der Anlage her, sodass man annehmen konnte, er wäre ein leidenschaftlicher und guter Esser und Trinker.
»Ich gebe ja zu, dass sie gut aussieht«, raunte neben mir am Tisch Frau von Tryska, »aber Sie brauchen die Ärmste doch nicht so anzustarren, als hätten Sie sie in Gedanken bereits ausgezogen.«
»Entschuldigen Sie!«, sagte ich und wandte den Blick ab. »Sie haben natürlich vollkommen recht, mich zu tadeln, allerdings wüsste ich nicht, wie man sie anders anschauen sollte.«
Frau von Tryska nahm meine flapsige Bemerkung mit einem Lächeln auf und beugte sich ein Stück vor. »Kennen Sie ihn nicht?«
»Wen? Sie meinen den Herrn? Nein!«
»Es ist der Filmschauspieler Gustav Helmholtz.«
Ich sah wieder hin und blieb eine Weile still. »Richtig, jetzt, wo Sie es sagen.«
Und ohne dass ich sie fragen musste, fügte sie mit einem beiläufigen Achselzucken, aber mit bedeutungsvoll blitzenden Augen hinzu: »Sie kenne ich nicht. Doch keine Sorge! Ich werde schon herausbekommen, wer sie ist. Lassen Sie mich nur machen!«
3
Die Brise, die am nächsten Tag über das Sonnendach strich, war beinahe warm, und so ließ ich mir vom Decksteward einen Liegestuhl zuweisen und vertiefte mich in Schopenhauers Meisterwerk. Obwohl ich es bei einem Buch wie diesem nicht erwartet hatte, stieß ich bald auf eine Stelle, die mich ausgiebig an meine formvollendete Mitreisende denken ließ; die Stelle nämlich, an der sich der Philosoph dazu herablässt, mit kenntnisreicher Tiefe das Verhältnis von Schönheit und Nacktheit auszuloten. Mit trefflicher Begründung verbreitet er, dass einem schönen Körper eigentlich nur die leichteste, wenn nicht sogar keine Bekleidung angemessen sei, dass ein schöner Mensch, wenn er innerlich ganz wahr empfände, am liebsten wohl nackt oder zumindest fast nackt gehen müsste – und eingedenk des Beispiels, das ich vor meinem inneren Auge hatte, konnte ich nicht umhin, dem Verfasser gefühlsmäßig beizupflichten.
Ich legte das Buch zur Seite und blickte aufs Meer hinaus, über dem der Horizont einen vollkommenen Anblick bot. Unter dem leuchtenden Himmel dehnte sich die ungeheure Größe des klaren, grünen Ozeans bis in unerreichbare Ferne. Sonderbar schattenhafte Gestalten flanierten vor dem Hintergrund der Weite und des blendend weißen Sonnenlichts an mir vorüber wie Gestalten eines Traums, von dem ich nicht wusste, ob er nicht vielleicht doch wirklich war.
Irgendwann gegen Mittag wurde am Horizont der weiße Körper eines Ozeanriesen sichtbar, der an Größe und Gestalt der ›Bremen‹ glich und dessen Anblick die Passagiere, die sich an Deck tummelten, immer mehr in Bann zu ziehen begann; denn das Schiff schien es darauf angelegt zu haben, Jagd auf die ›Bremen‹ zu machen, um sie auf offener See zu überholen.
Eine wachsende Anzahl von Passagieren hatte sich eingefunden, um das Schauspiel mit anzusehen, das es draußen auf dem Meer zu beobachten gab. Auch ich selbst stand schließlich an der Reling, um mich von dem Ereignis in der Ferne ablenken zu lassen.
»Es ist die ›Normandie‹, ein französisches Schiff«, sagte jemand unmittelbar neben mir. Der Sprecher war ein schmaler, etwa 60-jähriger Mann mit unauffälligen, freundlichen Zügen.
»Wetten Sie mit mir um ein Glas Kognak?«, fragte ich ihn. »Ich sage, sie schafft es und wird uns schlagen.«
»Einverstanden! Ich halte dagegen. Der Angriff wird abgewehrt!«
Langsam und stetig holte die ›Normandie‹ auf, doch immer, wenn sie kurz davor war, mit der ›Bremen‹ auf gleiche Höhe zu ziehen, schien diese Luft zu holen und sich noch einmal kräftig ins Zeug zu legen, so als hätten die Heizer im Bauch des Schiffes Anweisung erhalten, ihr Letztes zu geben, um eine Niederlage zu verhindern.
»Es wird wohl eine Weile dauern, bis feststeht, wer der Sieger ist«, verkündete der kleine Mann an meiner Seite. »Ich heiße übrigens Wolfrath. Ernst Wolfrath.«
»Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Wolfrath«, entgegnete ich und stellte mich ihm vor. Während sich der Wettkampf in die Länge zog, kamen wir ins Plaudern. So erfuhr ich, dass mein neuer Bekannter ein Professor der Altphilologie und Geschichte aus Heidelberg war. Irgendwann ging er wieder, um einen Spaziergang zu machen, währenddessen ich zu meinem Liegestuhl und dem Buch zurückkehrte.
Es war bereits Nachmittag, als die Französin unserem Dampfer abermals gefährlich nahe kam. Obschon viele Passagiere an der Reling die ›Bremen‹ lauthals zu neuerlicher Anstrengung anfeuerten, zog die französische Königin der Meere schließlich um eine Länge an ihr vorbei.
»Möchten Sie den Kognak gleich oder später?«, fragte mich Herr Wolfrath, nachdem ich ihn kurz darauf an der Stelle, wo er mich eine Stunde zuvor verlassen hatte, wieder getroffen hatte.
»Wenn es Ihnen recht ist, erst heute Abend; aber vielleicht werde ich derjenige sein, der die Zeche bezahlen muss. Sehen Sie: Die ›Bremen‹ hat noch nicht aufgegeben.«
Der Wettkampf war tatsächlich noch nicht entschieden, und bald ertönten erneut die Hurrarufe der Mitreisenden, als die ›Bremen‹ mit ihrem etliche Seemeilen entfernten Hochseekonkurrenten wieder auf gleiche Höhe zog. Fast eine Stunde lang schienen die Schiffe um die Führung zu kämpfen, bevor die ›Bremen‹ vor ihrer Konkurrentin einen klaren Vorsprung gewann und die Französin um eine deutliche Länge zurückfiel. Erst am späten Nachmittag wurde die Konkurrentin nach achtern hin deutlich kleiner, und nachdem die Dämmerung eingesetzt hatte, verschwand sie schließlich vollständig hinterm Horizont.
Beim Abendessen sagte Frau von Tryska zu mir: »Gewiss erinnern Sie sich an die liebreizende Dame von gestern Abend, nach der ich im Moment vergeblich Ausschau halte.«
»Allerdings«, bemerkte ich in einem um Leichtigkeit bemühten Ton, da sie eine wichtigtuerische Pause einlegte.
»Sie hat ein Verhältnis mit ihm – mit Gustav Helmholtz.«
»Ich habe es mir gedacht«, sagte ich, was ja auch stimmte, aber trotzdem fühlte ich einen leisen Stich.
Frau von Tryska nahm einen Löffel von ihrem Dessert. »Sie begleitet ihn zu Dreharbeiten in Hollywood. Seine Frau musste zu Hause bleiben. Er hat sie wegen ihr verlassen.«
»Woher haben Sie denn diese Informationen?«
»Eine Dame, die ich hier an Bord kennengelernt habe, erzählte mir davon. Sie weiß es aus der Berliner Illustrierten, in der vor einiger Zeit darüber berichtet wurde.«
»Wenn es in der Zeitung stand, muss es ja stimmen.«
Sie zuckte die Achseln. »Es wird schon wahr sein. Und wie sollte es sich auch anders verhalten, nicht wahr? Ich kenne sogar ihren Namen. Sie heißt Irene Varo. Und von Berufs wegen ist sie Tänzerin und Artistin.« Sie beugte sich ein Stück vor und flüsterte verschwörerisch: »Sie und ihr Partner sollen in einem Berliner Varieté eine akrobatische Nummer geturnt haben, bei der sie beide nackt gewesen sind.«
Ich konnte nicht verhindern, dass mich ein heißes Gefühl ergriff. »Ach, tatsächlich? Hm! Auch der Mann?«
Frau von Tryska grinste. »In Berlin gibt es Lokale, in denen ist alles möglich. Das muss ich Ihnen bestimmt nicht erzählen.«
»Ja«, brummte ich, »davon habe ich gehört.«
Die Bar, in der ich am Abend mit Professor Wolfrath zusammentraf, lag im Zwischendeck. Einige Paare bewegten sich dort zu den amerikanisch klingenden Rhythmen und Melodien einer kleinen Tanzkapelle über ein gläsernes Parkett. Die Wände der Bar waren mit Tropenholz ausgeschlagen. Die Spiegelflächen, die in einigen Abständen das Holzmuster unterbrachen, verdoppelten die Palmengewächse, die davor in Kübeln standen, sowie auch die Reihe der mit schwarzem Leder bezogenen schmalen Armsessel und den dazugehörigen Tischchen, die am Boden festgeschraubt waren.
»Noch zwei Hennessy?«, fragte der junge Kellner in weißer Livree, der nicht weniger adrett wirkte als die Erste-Klasse-Passagiere, die er zu bedienen hatte.
»Ja, bitte«, sagte Wolfrath, der neben mir am Tresen saß. Sobald die Gläser kamen, erkundigte ich mich nach dem Ziel seiner Reise.
»Ich bin auf dem Weg nach Boston«, antwortete er, »wo ich ein paar Vorträge zu halten habe. Vorher verbringe ich zwei Tage in New York.«
Mir fiel ein, dass ich von Florence Arnheim, die ich in New York besuchen sollte, einmal gehört hatte, dass ihr Vater Professor der Geschichte gewesen war und dass die Familie ursprünglich aus Boston stammte. Ich erinnerte mich allerdings nicht daran, wie der Geburtsname von Florence lautete, sodass es mir im Moment nicht möglich war, Wolfrath zu fragen, ob er die Familie kannte.
»Sie müssen ein berühmter Wissenschaftler sein, wenn man Sie sogar zu einer Vortragsreihe nach Amerika eingeladen hat«, wollte ich von ihm wissen.
»Ich habe es weniger meinem Ansehen als meinen guten Kontakten nach drüben zu verdanken, dass man mich herbittet«, sagte der Professor in einer Bescheidenheit, die zu ihm passte. »Aber die Reise kommt mir gelegen. Ich bin froh, dass ich Deutschland für eine Weile verlassen kann.«
»Das geht mir nicht anders«, erwiderte ich.
Kaum hatte ich es gesagt, ging mir auf, dass die Bemerkung des kleinen Professors wohl in einem ganz anderen Sinne gemeint gewesen war, als es meine eigenen leicht dahin gesprochenen Worte zum Ausdruck brachten.
»Und welchen Grund haben Sie selbst, froh darüber zu sein, Deutschland verlassen zu können?«, fragte Professor Wolfrath leise.
»Nun, ich wollte nur sagen, dass ich die Annehmlichkeiten einer Reise im Verhältnis zum grauen Alltag meiner Berufstätigkeit sehr zu schätzen weiß«, erwiderte ich vorsichtig.
Der Professor starrte eine Weile verloren in Richtung des Tanzparketts, dann sah er wieder zu mir und sagte: »Am 6. November wird in Deutschland gewählt. Werden Sie bis dahin in die Heimat zurückgekehrt sein?«
»Ganz sicher! Allerdings habe ich meine Reisepläne nicht auf diese Wahlen abgestellt. Man wird des Wählens allmählich müde.«
»Das sollten Sie nicht sagen!«, entfuhr es dem Professor in einem Tonfall, dessen Heftigkeit mich aufblicken ließ. »Die Leute müssen sich der radikalen Kräfte unbedingt erwehren. Viel zu viele scheinen zu fühlen wie Sie. Das ist mit ein Grund, weshalb ich denke, es wäre das Beste, Deutschland auf Dauer zu verlassen.«
»Sie fürchten ernstlich den Ausgang der Wahlen? Was soll sich denn ändern? Diese Wahlen werden bestimmt nichts Neues bringen.«
»Oh doch!«, entgegnete Wolfrath. »Herrn Hitler als Reichskanzler zum Beispiel.«
»Das ist ausgeschlossen!«, entgegnete ich. »Die Nationalsozialisten haben ihre besten Zeiten längst hinter sich. Sie können keine Mehrheit im Reichstag bekommen, verlassen Sie sich drauf!«
»Darf ich Sie an etwas erinnern? Wir leben inzwischen in der Zeit der Präsidialkabinette«, sagte der Professor. »Auch ohne eine Mehrheit kann Herr Hitler Reichskanzler werden, wenn der greise Hindenburg sich dem Druck gewisser Kräfte beugt und ihn zum Präsidialkanzler ernennt. Und diese Gefahr ist umso größer, je mehr Stimmen die Hitlerpartei erlangt.«
»Hindenburg wird ihn nicht ernennen, glauben Sie mir. Er hat das erst kürzlich mit aller Entschiedenheit abgelehnt.«
»Ich traue dem Präsidenten nicht. Ihm nicht, und erst recht nicht den windigen Ratgebern des alten Mannes.«
Eine Zeit lang herrschte Schweigen zwischen uns.
»Wovor haben Sie Angst?«, wollte ich wissen. »Einmal unterstellt, es käme wirklich so, wie Sie befürchten.«
»Ich bin immerhin Inhaber eines Lehrstuhls«, stellte der Professor fest, »und obwohl inzwischen getauft: Ich bin gebürtiger Jude.«
Obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, merkte ich, dass ich etwas auf Distanz zu ihm ging. »Als jüdischer Inhaber eines Lehrstuhls kann man sicher mit Anfeindungen rechnen«, sagte ich im Bewusstsein, dass er in den Augen der Antisemiten ein Jude blieb, auch wenn er hundertmal übergetreten war. »Allerdings wird auch bei den Nationalsozialisten nichts so heiß gegessen wie gekocht!«
»Viel heißer, als man kochen kann, mein Lieber!«, sagte der Professor leise. »Wenn es nur der Lehrstuhl wäre, würde ich mir weniger große Sorgen machen.«
»Wir leben in einem zivilisierten Land«, äußerte ich und dachte mit zugeschnürter Kehle an mein Erlebnis mit den beiden Strolchen am Landwehrkanal. »Jedenfalls – sofern Sie an Pogrome denken, kann ich Ihnen versichern, dass derlei Dinge in Deutschland völlig undenkbar sind.«
»Die Zivilisation ist kein Zustand, der ein für alle Mal festgeschrieben wäre«, widersprach mir der Professor. »Es hat schon stärker gefestigte Zivilisationen als Deutschland gegeben, die schließlich in der Barbarei untergegangen sind.«
»Sie sehen zu schwarz, Herr Professor«, entgegnete ich, »wahrscheinlich haben Sie sich als Historiker zu lange mit dem Untergang alter Kulturen beschäftigt. Worüber werden Sie in Boston sprechen? Ich hoffe, es geht nicht um den Untergang Deutschlands?«
Der Professor rang sich ein Lächeln ab. »Nein – höchstens am Rande. Vereinfacht gesagt, wird sich meine Vortragsreihe damit beschäftigen, wie schon Kunst und Archäologie des Altertums und Mittelalters dem Bestreben des Menschen Ausdruck gaben, sich aus irdischen Verstrickungen zu lösen und zu höheren Formen der Selbstbewusstheit hin zu befreien.«
»Interessant«, sagte ich. »Das bringt mich auf eine Frage! Was denken Sie: Haben die geistigen Fähigkeiten des Menschen in der Aufeinanderfolge der Generationen zugenommen oder sind sie verkümmert?«
»Inzwischen sind diese Fähigkeiten nahezu verschwunden«, konstatierte der Professor. »Wir leben in einer Zeit des immer schneller voranschreitenden geistigen Verfalls, und wenn wir nicht sehr aufpassen, mag sich am Ende ein Abgrund auftun, in dem wir alle versinken werden.«
Die Bar hatte sich allmählich gefüllt, sodass inzwischen am Tresen wie auf der Tanzfläche ein regelrechtes Gedränge herrschte. Und sowie ich meinen Blick in die entgegengesetzte Richtung über die Gesichter der Menschen auf der anderen Seite des ovalen Tresen schweifen ließ, entdeckte ich auf Barhockern weit in der Ecke den Schauspieler Gustav Helmholtz und neben ihm die Artistin Irene Varo.
»Noch habe ich etwas Hoffnung, dass es nicht die Deutschen sein werden, die der Menschheit das Tor zur Hölle öffnen«, merkte Wolfrath an. »Aber Sie wissen: Die Hoffnung stirbt zuletzt.«
Mein Herz begann schneller zu klopfen und mein Interesse an der Unterhaltung mit Wolfrath ließ deutlich nach, bis ich gar nicht mehr mitbekam, was er als Nächstes sagte.
Das Gesicht auf der anderen Seite des Tresens war unzweifelhaft eines aus der Vergangenheit, denn solche Gesichter, so ging es mir durch den Sinn, gab es heutzutage eigentlich nicht mehr. Die holde Gelassenheit seines Ausdrucks, die klaren, grünen Augen, die gerade abfallende Nase und der liebliche Mund, schließlich die edle anmutige Haltung des Körpers: All dies schien aus der begnadeten Hand eines florentinischen Künstlers auf ein Renaissancegemälde geworfen zu sein.
»Noch ein Bier oder einen Hennessy?«, erkundigte sich der junge Kellner.
»Ja, bitte – beides«, gab ich zur Antwort.
Sie unterhielt sich mit dem Schauspieler, doch war es hauptsächlich Helmholtz, der sprach. Hin und wieder konnte ich seine brummige Stimme hören, vor allem in den Momenten, wenn er bei dem Kellner, der ihn wie einen Stammgast behandelte, eine Bestellung aufgab. Auch Helmholtz trank Hartes, und das in kurzen Abständen. Die Schöne an seiner Seite nippte derweil an einem Gläschen Wein; sie schien am Alkohol kein großes Interesse zu haben.
»Ist das dort drüben nicht der Filmschauspieler Helmholtz?«, fragte Wolfrath, dem mein abschweifendes Interesse nicht entging.
»Ja. Man erzählt sich, er sei zu Dreharbeiten nach Hollywood unterwegs.«
»Eigenartig«, sagte Wolfrath, senkte den Blick und starrte stumm auf sein Glas. »Nun, es mag wohl ein Zufall sein.«
Vielleicht hätten sich ein paar Dinge anders entwickelt, wenn ich nachgefragt hätte, was er damit meinte; allein: Ich tat es nicht.
Wolfraths Interesse kehrte wieder zu unserem Thema zurück, und er erzählte mir von der Weisheit der Menschen früherer Zeiten. Bisweilen erwiderte ich etwas, das ich kurz darauf aber wieder vergaß.
Die anmutige Artistin musste gespürt haben, dass ihr mein uneingeschränktes Interesse galt, denn als ich erneut hinübersah, drehte sie jäh den Kopf und schaute einen Moment lang unverwandt in mein Gesicht.
Ich versuchte zu lächeln, hoffte inständig, dass es keine Grimasse war und schwebte auf Wolke sieben, nachdem sie zurücklächelte. Ein heller Sonnenstrahl durchglühte meine sehnsüchtige Seele. Am liebsten wäre ich zu ihr hingegangen und hätte sie angesprochen, doch ich wusste, dass man so etwas nicht überstürzen durfte. Gerade einer solchen Frau musste man sich behutsam nähern.
Es verging eine Viertelstunde, ohne dass es mir gelang, einen weiteren Blickkontakt mit den meergrünen Augen der Schönen herzustellen. Irgendwann sah ich, wie Helmholtz die Rechnung bezahlte. Kurz darauf standen die beiden von ihren Barhockern auf und schritten auf den Ausgang zu.
An der Tür hielt die schöne Artistin einen Moment lang inne und sah in den Raum zurück, so als wollte sie all die bewundernden Blicke in sich aufnehmen, die ihren eleganten Schritten nachgefolgt waren. Das zarte Lächeln, das dabei ihre Lippen umspielte, schickte sie nuanciert, dennoch überdeutlich auch in meine Richtung, ehe ihre federnde Gestalt noch vor der des Schauspielers zum Deck hinaus verschwand.
4
Am nächsten Tag nahm ich mir die Zeit, einen Blick in die Unterlagen zu werfen, die mir Philipp Arnheim in Berlin kurz vor Antritt meiner Reise übergeben hatte. Mit Ausnahme einer Aufstellung aller wichtigen persönlichen Daten der Arnheims enthielten sie an hervorgehobener Stelle den Hinweis auf den entwendeten Brief, dessen Rückgabe Bedingung für den Abschluss einer Vereinbarung über die Folgen der Scheidung war. In den Unterlagen befand sich auch ein Brief von Philipp Arnheim an seine Frau, der in einem verschlossenen Umschlag steckte, und für den Arnheim mir aufgetragen hatte, ihn nur persönlich an Florence zu übergeben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!