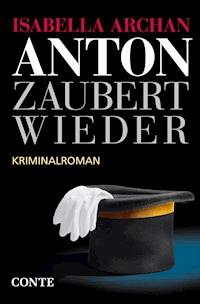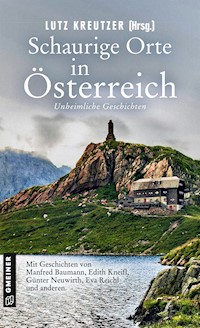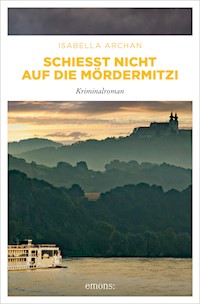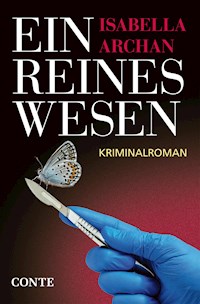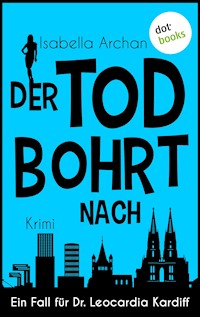
4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Dr. Leocardia Kardiff
- Sprache: Deutsch
Der Tod beißt kräftig zu: Die rasante Krimikomödie »Der Tod bohrt nach« von Isabella Archan jetzt als eBook bei dotbooks. Zahnarztbesuch mit tödlichen Nebenwirkungen … Das Leben ist ungerecht: Während sich ihre Töchter auf House-Partys vergnügen, muss Zahnärztin Leo nächtlichen Notdienst schieben. Doch als ein aufgeregter Patient in ihre Praxis stolpert und etwas von einer jungen Frau in Gefahr stammelt, wird aus der öden Nachtschicht schnell der Auftakt einer neuen Verbrecherjagd für die Hobby-Ermittlerin im weißen Kittel! Gemeinsam mit dem verboten attraktiven Hauptkommissar Jakob Zimmer wagt sich Leo in die Abgründe der Kölner Escort-Szene vor … und erkennt schon bald, dass es all ihren Spürsinn brauchen wird, um diese Nuss zu knacken! »Witzig und spannend zugleich geschrieben, mit Wendungen, die den Krimi fast schon zur Screwballkomödie werden lassen«, urteilt der Österreichische Rundfunk. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der humorvolle Köln-Krimi »Der Tod bohrt nach« von Isabella Archan ist der dritte Band ihrer Reihe humorvoller Krimis um Dr. Leocardia Kardiff – die Zahnärztin mit Spritzenphobie. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Zahnarztbesuch mit tödlichen Nebenwirkungen … Das Leben ist ungerecht: Während sich ihre Töchter auf House-Partys vergnügen, muss Zahnärztin Leo nächtlichen Notdienst schieben. Doch als ein aufgeregter Patient in ihre Praxis stolpert und etwas von einer jungen Frau in Gefahr stammelt, wird aus der öden Nachtschicht schnell der Auftakt einer neuen Verbrecherjagd für die Hobby-Ermittlerin im weißen Kittel! Gemeinsam mit dem verboten attraktiven Hauptkommissar Jakob Zimmer wagt sich Leo in die Abgründe der Kölner Escort-Szene vor … und erkennt schon bald, dass es all ihren Spürsinn brauchen wird, um diese Nuss zu knacken!
»Witzig und spannend zugleich geschrieben, mit Wendungen, die den Krimi fast schon zur Screwballkomödie werden lassen«, urteilt der Österreichische Rundfunk.
Über die Autorin:
Isabella Archan, 1965 in Graz geboren, lebt als Schauspielerin und Autorin humorvoller Kriminalromane in Köln. Neben Theaterengagements ist sie immer wieder in Rollen in Film und Fernsehen zu sehen, u. a. im »Tatort« und in der »Lindenstraße«. Ihre »MordsTheater«-Lesungen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre humorvolle Krimireihe um die Hobbyermittlerin Dr. Leocardia Cardiff: »Tote haben kein Zahnweh«, »Auch Killer haben Karies« und »Der Tod bohrt nach«.
Die Website der Autorin: www.isabella-archan.de
Die Autorin bei Facebook: www.facebook.com/archankrimis/
Die Autorin auf Instagram: www.instagram.com/isabella_archan/
***
eBook-Neuausgabe Februar 2023
Copyright © der Originalausgabe 2018, Emons Verlag GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von Adobe Stock/SimpLine
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-584-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Tod bohrt nach«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Isabella Archan
Der Tod bohrt nach
Kriminalroman
dotbooks.
Es möchte manch einer beißen, wenn er nur Zähne hätte.
Deutsches Sprichwort
Teil I
GEHEN SIE LANGSAM, ABER DENKEN SIE SCHNELL
Kapitel Eins
Dietrich wollte nicht zum Mörder werden.
Trotzdem ließ er zwei weitere Tabletten aus dem Röhrchen auf das Küchenbord gleiten.
Als er sie mit einem Buttermesser zermalmte, hörte sich das Geräusch in der stillen Küche wie das Kratzen eines Fingernagels auf Holz an. Die Gänsehaut auf seinen Armen kam zurück, trotz der warmen Temperaturen. Es knarrte hinter ihm, und mit einem Stöhnen wirbelte er herum.
Niemand war da. Er drehte eine schnelle Runde durch die Wohnung, blieb an der Eingangstür stehen und sah durch den Türspion nach draußen. Der immer gleiche Blick auf die graue Mauer gegenüber erwartete ihn, der Hausflur war verlassen.
Dietrich kehrte in die Küche zurück.
Er versuchte sich zu erinnern, wie viele Tabletten er bereits im Wein aufgelöst hatte. Drei Medikamentenröhrchen standen vor ihm, unterschiedlich in ihrer Zusammensetzung, aber alle drei als Beruhigungs- und Einschlafhilfe gedacht. Rezeptpflichtig. Im Laufe der Jahre hatte er so viel von dem Zeug gehortet, dass er zusammen mit den Antipsychotika einen Verkaufsstand hätte eröffnen können.
Bei seinem Selbstversuch letzte Woche hatte er zehn genommen, und er war bereits nach wenigen Minuten weggetreten gewesen. Erst vier Stunden später war er auf dem Teppich seines Wohnzimmers wieder zu sich gekommen. Er hatte sich eingenässt, ohne es zu bemerken, und hatte hinterher noch zwei Tage gebraucht, bis die leicht halluzinogene Wirkung in seinem Hirn vollkommen abgeklungen war.
Warum also jetzt die mögliche Überdosis, die zum Tod führen konnte?
Andererseits musste er um jeden Preis verhindern, dass sie zu früh erwachte. Außer Gefahr musste sie dann schon sein, das hatte absolute Priorität.
Wieder ein Geräusch.
Es war jemand hinter ihm.
Dietrich schnappte nach Luft.
Für Sekunden war er nicht fähig, sich zu bewegen. Er fühlte den Hauch eines fremden Atems, konnte die Klinge eines Messers an seinem Hals spüren, wie sie angesetzt wurde zu einem schnellen und blutigen Schnitt. Als sich seine Starre wieder löste, drehte er sich wie ein Derwisch in einem Tanz mehrmals im Kreis. Am Ende musste er sich an der Kühlschranktür festhalten.
Nur er, Dietrich, außer ihm war keiner da. Doch die Zeit lief.
Sollte er noch weitere Tabletten zerteilen?
Nein, es war genug. Er schraubte alle drei Röhrchen zu und stellte sie auf die Ablage. Das grobkörnige Häufchen kam in das Weinglas, danach rührte Dietrich mit Schwung um, bis kein einziger Klumpen mehr zu sehen war.
Sie sollte schlafen, vergessen, in Sicherheit gebracht werden. Nach ihrem Erwachen würde sie in Dietrich ihren Retter und nicht ihren Feind sehen.
Und wenn sie bei seinem Versuch, ein Held zu werden, starb?
Dietrich seufzte. Dann hatte er es zu tragen wie ein Mann.
Er würde sie auf Rosen betten und in den Armen halten. Begraben und an ihrem Grab Wache halten. Trösten würde ihn der Gedanke, dass sie auch dann befreit, erlöst, vor einer dunklen Zukunft bewahrt worden war. Anders zwar als geplant, aber wer war er schon, dass er das Schicksal, das sie alle vor sich hertrieb, durchschauen wollte oder konnte. Er würde ihr Bild wie eine Fahne vor sich hertragen und sie in seinem Herzen unsterblich machen.
Diese Phantasie gab ihm die Sicherheit und den Mut zurück, sein Vorhaben durchzuziehen.
Warum heute?
Weil sich die Schlinge mit der ersten Hitzewelle des beginnenden Sommers enger zuzog. Um sie beide. Seit die heißen Tage und Nächte begonnen hatten, fühlte er die nahende Bedrohung mehr denn je.
Gestern hatte er in ihrer Wohnung nach dem Rechten gesehen. Eine Weile hatte er auf ihr Bett gestarrt, sich vorgestellt, sie würde darin schlafen. Wie Schneewittchen in ihrem gläsernen Sarg.
Nachmittags war er noch draußen in der Stadt gewesen. Zuerst mitten in der Menge harmloser Passanten, die in Shorts und Sandalen unterwegs waren, die Mädchen in superkurzen Röcken. Es roch selbst in der Innenstadt nach Sonnenöl und Pommes frites. Er hatte sich ein Eis am Stiel gegönnt. In den Lokalen am Rhein stapelten sich unter Sonnenschirmen fröhliche Mitmenschen, der Lärmpegel war hoch und das Lachen schrill gewesen.
Doch dann war die Szenerie gekippt, und er hatte gesehen, wie sich eine ganze Gruppe an einem der Tische nach ihm umgedreht hatte. Da hatte er es gewusst.
Dietrich hatte das Eis fallen gelassen und war losgerannt. Einmal hatte er sich umgesehen und einen Mann in einem Anzug bemerkt, der eine Botschaft in sein Handy tippte. Sie waren demnach überall.
Dietrich war nach Hause zurückgefahren, sich hektisch in der Straßenbahn umsehend. So viele mögliche Beobachter, so viele Bedrohungen. Sein Magen hatte rumort, und ihm war klar geworden, dass für sie beide höchste Gefahr bestand. Mehr noch für sie. Kaum zurück in seinen vier Wänden, hatte er mit den Vorbereitungen begonnen.
Würde er sie tragen können?
Er testete das geschätzte Gewicht mit seiner einzigen großen Balkonpflanze, die er samt dem Übertopf ins Zimmer hievte und in den Teppich einrollte. Dietrich hob die Testkonstruktion an und hoch. Er durchquerte damit das Wohnzimmer, bis sie ihm aus den Händen fiel und ein großes Stück von der Keramik abbrach. Noch dazu war der Teppich voller Erde, und er musste ihn mühsam abbürsten. Seinen Staubsauger hatte er vor einigen Wochen entsorgt, nachdem ihm ein bedrohlich brummender Ton unter den Sauggeräuschen aufgefallen war.
Was, wenn er auch sie fallen lassen würde? Nein, er schüttelte den Kopf, niemals. Sie war weicher und leichter als ein dummer Keramiktopf, und die Liebe würde ihn stark machen.
Er brachte die Pflanze zurück auf den Balkon, damit einem Beobachter von außerhalb nichts Ungewöhnliches auffallen würde. Dabei sah er zu den Fenstern ihrer Wohnung hin, die rechter Hand von seiner Behausung lag, auf derselben Höhe, im anderen Teil des winkelförmigen Wohnkomplexes. Nichts regte sich dort, noch war sie nicht da. Er hätte es außerdem über den Lautsprecher gehört.
Er drehte eine Runde durch alle Zimmer, lauschte an der Haustür, sah durch den Spion. Nichts. Nur die graue Mauer gegenüber.
Er ließ gegen seine sonstigen Gewohnheiten sein Balkonfenster weit geöffnet, und der heiße Atem der Stadt strömte in seine Wohnung, ließ ihn schwitzen und schwerer atmen.
Er hatte letzte Nacht von der Liebe geträumt, auch vom Liebemachen, aber nicht mit ihr. Sie war zu kostbar, um berührt zu werden, zu zerbrechlich. Er hatte sich zu einer Frau aus einer Talkrunde vom Donnerstagabend im Fernsehen gelegt, doch bevor der Akt vollzogen war, war er mit klopfendem Herzen hochgeschreckt. Jemand war in sein Schlafzimmer gekommen, er hatte sich die Decke über den Kopf gezogen und den Rest der Nacht erstarrt vor Angst wach gelegen. Mit dem Tageslicht war auch der unheimliche Besucher verschwunden, und Dietrich hatte sich in seinem Entschluss bestärkt gefühlt.
Sie war in Gefahr. Kein Zögern mehr. Verschleppen und erretten. Der Schurke und der Superheld sein, dem zweigesichtigen Gott Janus gleich.
Er kratzte sich am Kopf, rieb sich die Schläfen, zerwühlte sein Haar. In seiner jetzigen Gestalt hatte er wahrlich nichts Göttliches an sich. Kurz und dick. Halbglatze. Schmerbauch. Unbedeutend. Alleinstehend. Zu wenig Frührente, um sich Liebe zu kaufen, zu viel verbleibendes Testosteron, um frei von Sehnsucht zu sein. Dazwischen so viel Nettigkeit, so viel Hilfsbereitschaft und diese eine Prise Wagemut.
Diese Jahre, diese Ängste, dieses Leben.
Dietrich nahm ein Ticken aus dem Schrank wahr. Er riss die Türen auf, aber außer seinen Hemden und Hosen konnte er nur einen Weberknecht sehen, der über den oberen Rand der Ablage kletterte. Er griff mit Zeigefinger und Daumen nach einem der Beine, doch das Spinnentier war zu flink.
Ob sie Angst vor Spinnen hatte? Dort, wo sie in Sicherheit wäre, gab es jede Menge davon. Wenn sie es von ihm verlangte, würde er alle töten.
Ein Gedanke huschte durch seinen Kopf. Wenn sie an seiner Mischung starb, müsste er ins Gefängnis. In eine Zelle. An einen viel düstereren Ort als sein Zuhause und die Stadt um ihn herum. Er beschloss, im Falle ihres Todes sich selbst das Leben zu nehmen. Erschießen war immer möglich, die letzten drei Patronen in der Tokarew mussten reichen. Oder sich erhängen mit einem ihrer Gürtel? Sich eine eigene Mischung zubereiten mit allem an Medikamenten, die sich bei ihm stapelten?
Wieder in der Küche, hob er das Glas an. Nichts unterschied die rote Farbe des Weins darin von dem zweiten, aus dem er selbst trinken wollte. Sie würde keinen Verdacht schöpfen, vor allem, wenn er den ersten Schluck nahm.
Er musste sich den Platz merken, den Standort. Im linken Glas hatte er die Tabletten aufgelöst, links von der Spüle aus gesehen. Immer links, denn das war Dietrichs Führungshand, damit schrieb er, mit dem linken Fuß machte er jeden Morgen seinen ersten Schritt aus dem Bett. In das andere Glas, rechts, hatte er nur Wein gegossen, puren Rebensaft. Sonst nichts.
In dem Moment wurden über den Lautsprecher, den er mit dem Abhörgerät verbunden hatte, Geräusche übertragen.
Sie war nach Hause gekommen. Er musste sofort nachsehen. Ob sie allein zurückgekehrt war. Ob sie müde aussah. Welches T-Shirt sie trug und welche Ohrringe.
Dietrich war mit wenigen Schritten im Wohnzimmer. Wenn er sie an der Kamera mit Teleobjektiv heranzoomte, war sie zum Greifen nahe.
Sein Herz machte einen Sprung. Gott, wie wundervoll sie war. Wie schön und zerbrechlich zugleich.
Fasziniert von ihrem neuen gelben Sommerkleid stand er eine Weile einfach nur da, bewunderte zeitvergessen ihre Schönheit.
Hatten ihre Eltern ihr das Kleid zum Geburtstag geschenkt, oder hatte sie es sich selbst gekauft? Er hätte es ihr schenken sollen, nicht das Buch, das hübsch verpackt hinter den Weingläsern wartete.
Schließlich riss er sich von ihrem Anblick los und kehrte in die Küche zurück. Er musste weitermachen, sie würde bald klingeln, er hatte einen Zettel mit der Einladung an ihre Tür geklebt.
Der nächste Schock folgte. Es hatte jemand die Küche betreten, während er im Wohnzimmer auf seinem Beobachtungsposten gewesen war.
Dietrich keuchte. Die drei Tablettenröhrchen auf der Ablage waren verschoben worden. Der Besucher von gestern Nacht fiel ihm ein, und diesmal war die Gänsehaut überall auf seinem Körper.
Was war noch anders? Die Gläser? Der Wein? Er war sich plötzlich nicht mehr sicher.
Links, im linken Glas hatte er die Tabletten aufgelöst. Links, immer links.
Oder hatte er sich vorhin umentschieden und das Pulver in das rechte Glas eingerührt?
Dietrich holte sich einen der Küchenstühle, stellte sich darauf und beugte sich von oben über beide Gläser. Er starrte auf die roten Oberflächen. Dann stieg er wieder herunter, konzentrierte sich aus nächster Nähe auf den Inhalt, ob er Reste oder Klümpchen oder irgendeinen Unterschied sehen konnte. Aber alles wirkte genau gleich, selbst die Menge an Wein schien in beiden Gläsern die gleiche zu sein.
Sein Plan schwenkte in ein Katastrophenszenario um. Was, wenn sie beide tranken und er umfiel?
Wenn er k. o. ging, seine Blase wieder losließ und er sich vor ihr anpisste wie ein dummer kleiner Junge, der das erste Mal ohne Windeln durch die Welt lief?
Aus seiner Lautsprecherbox hörte er ein starkes Husten und vergaß für Sekunden seine Befürchtungen. Der Laut hatte sich zu dunkel und rau angehört, um von ihr zu stammen. Hatte sie in den letzten zwei Minuten Besuch bekommen? War der unheimliche Besucher jetzt bei ihr, und Dietrich kam zu spät, um sie zu retten. Die Waffe? Wo war die Waffe?
Er hielt inne. Nein, so ein Ablauf war nicht in seinem Sinn, sie musste in ihm den Helden, nicht einen Amokläufer sehen.
Langsam fasste er sich wieder. Andere Phantasien meldeten sich.
Sie war über das Wochenende bei den Eltern gewesen, das wusste er, aber hatte sie dort an ihrem Geburtstag einen anderen getroffen? Einen ehemaligen Schulkameraden, einen Freund des Vaters, einen Cousin dritten Grades oder einfach einen Mann im Zug, im Bus, auf der Straße? Dieser andere war ihr nach Köln gefolgt und hustete sich jetzt die Seele aus dem Leib. Ein Rivale um die Gunst seiner Angebeteten. Einer, der groß war, schlank, der einen Job hatte.
Plötzlich konnte sich Dietrich nicht mehr an seinen früheren Beruf erinnern. Was hatte er gemacht? Etwas verkauft? Oder eingekauft?
Es hatte keinen Sinn, sich zu quälen, die Erfahrung hatte gezeigt, dass ihn irgendwann das Wissen wieder einholen würde. Seine Vergangenheit war für den Moment ausgelöscht. Umso mehr zählte die Zukunft mit ihr. Umso mehr musste er ihr Retter sein.
Dietrich atmete auf. Im Appartement gegenüber stand nur sie, inzwischen hatte sie sich umgezogen. Sie trug eine leichte Leinenhose und ein blaues T-Shirt und hustete ein zweites Mal.
»Arme, süße Liebste, du hast dich mitten in diesen heißen Frühsommertagen erkältet? Wärst du wohl besser hiergeblieben und hättest auf deinem Balkon ein Buch gelesen und dir dazu eine Zitronenlimonade gemixt.«
Er hielt sich die Hand vor den Mund. Hatte er laut gesprochen?
Sein nächster Gedanke jagte ihm einen neuen Schreck ein. Was, wenn sie keinen Rotwein trinken wollte bei den Temperaturen? Dietrich hatte keinen Weißen zu Hause, auch keine Zitronen, und überhaupt, was, wenn sie nicht kommen würde, den Zettel übersehen hatte?
Er gab sich selbst eine Ohrfeige. Seine Finger berührten seine schweißnasse Wange, und das Klatschen hörte sich wie ein Schlag mit einem feuchten Tuch an.
»Ruhig bleiben und die Dinge laufen lassen, dann zupacken!«
Wer hatte das gesagt?
Niemand. Jedermann.
»Dietrich, hör auf!«
Er schniefte.
Zurück zum Wein.
Nach der zweiten Unterbrechung war es Dietrich überhaupt nicht mehr möglich, festzustellen, welches Glas nun einen möglichen Totenkopf auf druck als Warnhinweis verdient hätte. Das brachte ihn unvermutet zum Schmunzeln.
Die Vorstellung, dass sie in seine Arme niedersinken würde wie in einem Theaterstück, bereitete ihm plötzlich Freude. All seine Ängste waren wie weggepustet.
»Aber Stille. Was für ein Licht bricht aus jenem Fenster hervor? Es ist der Osten, und Julia ist die Sonne ‒«
Dietrich begann, die Balkonszene aus Shakespeares »Romeo und Julia« nachzuspielen. Wie immer verlor er sich darin, tänzelte durch die Küche, gab mit einem hohen Fiepen den Part der holden Julia und mit einem gedämpften männlichen Timbre den Romeo. In einem Anfall von Euphorie stieg er noch einmal auf den Küchenstuhl, um die Flöhe des Balkons zu simulieren, dann sprang er nach unten, wechselte Stimme und Rolle.
Am Ende der Szene verbeugte er sich schweißtriefend vor einem imaginären Publikum. Gleich würde er sich noch unter die Dusche stellen, eine Viertelstunde blieb ihm, wenn sie die Zeitangabe auf seiner Einladung einhielt. Er wollte gut riechen.
Dietrich holte sich ein sauberes, leeres drittes Glas aus dem Regal, füllte Wasser ein und trank gierig. Durst und aufkommender Hunger, Gelüste, die er immerhin sofort stillen konnte. Er griff zu den Nusskeksen, die auf einem Teller neben den beiden gefüllten Weingläsern lagen, und biss zu.
Vor dem Schmerz kam das Knacken. Es schallte lauter in die stille Küche hinein als alle Geräusche davor. Dietrich zuckte zusammen und krümmte sich, doch bereits in der Bewegung nach unten setzte ein Stechen in seinem Mund ein, ein Ziehen, ein heller Schmerz, der wie ein hoher Ton zu sirren begann. Er ließ den angebissenen Keks fallen, hob schützend beide Hände vor den Mund und rannte gebückt ins Badezimmer.
Eine Weile stand er vor dem Waschbecken und wagte nicht, sich aufzurichten, um den Schaden im Spiegel zu begutachten. Die erste Schmerzfolge begann sich in ein lautes Pochen zu verwandeln. Dietrich fühlte, dass sich Flüssigkeit in seiner Mundhöhle zu sammeln begann. Er musste etwas tun, sich die Katastrophe ansehen.
Schließlich war sein Mund voll wie ein prall gefüllter Wasserschlauch, und er musste sich über das Waschbecken beugen und ausspucken.
Hell. Rot.
Blut.
Er spürte, wie er schwankte.
Nicht nur Blut, auch der inzwischen breiige Rest des Nussplätzchens und dazwischen ein harter kleiner Klumpen waren im Becken zu sehen. Dietrich griff danach, bevor er den Wasserhahn aufdrehte und Blut und Keksbrei in den Ausguss spülte.
Mit der freien Hand schaufelte er Wasser in seinen Mund, der Schmerz heulte mit ihm auf, und er spuckte noch mal aus. Wieder Blut, aber kein Brei mehr. Seine Spucke wurde rosa, beim dritten Mal kam klares Wasser heraus. Aber das Pochen schwoll zu einem Kreischen an, es fühlte sich an, als würde ein glühender Draht seine Mundhöhle durchziehen.
Unter Tränen wusch er den Klumpen ab und hielt eine seiner Kronen zwischen den Fingern. Oder war es ein richtiger Zahn, einer seiner verbliebenen gesunden Zähne? Genau konnte er es in seiner Panik nicht erkennen. Er fuhr mit dem Finger über die Zahnreihe, ganz zart, aber nicht vorsichtig genug. Der Schmerz an der neu entstandenen Lücke brachte ihn zum Heulen, und Rotz quoll aus seiner Nase.
Er riss sich Toilettenpapier ab, schnäuzte sich und wischte sich Augen und Wangen wieder trocken. Dann sah er endlich hoch, und sein leichenblasses Gesicht im Spiegel über dem Waschbecken kam ihm fremd vor. Er öffnete seinen Mund ganz weit wie zu einem Gähnen und sah es. Ein Stumpf vorn, links unten, anstelle des Eckzahns. Der Stummel sah aus wie ein grotesker Zwerg, der zwischen den anderen Beißerchen hockte. Und fehlte nicht daneben, am Schneidezahn selbst, auch ein Stück?
In Dietrichs Kopf machte sich eine eigenartige Leere breit, er konnte nicht fassen, was er sah, konnte nicht begreifen, was ihm geschehen war, wollte nicht einsehen, dass der Abend nun eine völlig andere Wendung genommen hatte.
Es klingelte.
»Nein.« Dietrich schluchzte jetzt. »Nein, nein, nein und nein.«
Er stand unschlüssig da, unfähig zu entscheiden, was er als Nächstes tun sollte.
Stehen bleiben hieße, dass sich nichts, aber auch gar nichts von seinen Heldenträumen heute erfüllen würde. Aber wer wusste denn, wie viel Zeit ihr noch blieb? Wie nahe waren ihnen die Verfolger, die ihn gestern in der Stadt beobachtet hatten?
Morgen würde er seine Liebste nicht zu sich bitten können, da war sie eingeladen bei ihrer Freundin Malu. Die Zeit lief ihm davon. Was tun?
Das nächste Klingeln nahm ihm die Entscheidung ab und brachte ihn in die Gänge. Er musste sich zusammenreißen, er musste öffnen, er durfte keine Schwäche zeigen. Diese Gelegenheit war zu wichtig, um sie vorbeiziehen zu lassen.
Sein Spiegelbild war immer noch kreidebleich. Zuerst legte er die Krone vorsichtig am Beckenrand ab. Dann gab er sich zwei weitere schnelle Ohrfeigen, um Röte auf seine Wangen und Schwung in seinen Kreislauf zu bekommen. Er jaulte vor Schmerzen auf. Später, wenn alles erledigt war, würde er die Stelle kühlen und ein Schmerzmittel nehmen. Mit etwas Glück und strikter Beherrschung würde er verhindern, dass sie sein Malheur bemerkte, bis alles vorbei war.
Er rannte los, heraus aus dem Bad, um die Ecke, den Flur entlang. Er riss die Tür auf.
Da war sie, seine ganz persönliche Julia, sein Schneewittchen, mit ihren dunklen langen Haaren, den roten Lippen, dem scheuen Blick. Bereit, von ihm errettet zu werden. Tot oder lebendig.
»Hallo, Herr Möwe. Habe Ihre Nachricht gelesen.« Sie hielt den Zettel in der Hand. »Und hier bin ich.«
Ihre Stimme ein Engelschor, ihr Lächeln eine Welle der Schönheit.
»Geht es Ihnen gut, Herr Möwe?«
Er nickte und nickte immer weiter. Ihm schwindelte, ob wegen ihr oder der Schmerzen, konnte er nicht mehr unterscheiden. Die Hitze war jetzt auch in ihm, stieg in seinem Kopf höher und höher, baute einen Turm und sperrte sein Denken in der obersten Kammer ein.
Außen musste die Szene aber weitergegangen sein. Denn sie war an ihm vorbei in den Flur gelangt. Panik übertrumpfte den Schmerz, denn sie durfte auf keinen Fall in das Wohnzimmer sehen oder es gar betreten. Nicht um alles in der Welt. Ein schneller Blick zur Seite zeigte ihm jedoch, dass er die Zimmertür geschlossen hatte, wann, das wusste er nicht mehr, aber er schickte ein Stoßgebet zum Himmel.
Sie ging wie immer geradeaus weiter, und dann waren sie in der Küche.
Er hob das Päckchen hoch, das er für sie vorbereitet hatte.
»Das wäre nicht nötig gewesen, lieber Herr Möwe.«
Doch, dachte Dietrich, alles für dich, nur für dich, meine süße Liebste.
So gern hätte er sie aufgefordert, es sofort zu öffnen, hatte er ihr doch den Bildband über Kanada besorgt, den sie sich gewünscht hatte. Was für ein Zufall, würde er sie sagen hören und ihr Lächeln bewundern.
Sie hob ihrerseits eine Papiertüte hoch. »Ich habe Ihnen ein paar weiße Schokokugeln von zu Hause mitgebracht, Herr Möwe. Für Ihre nette Nachbarschaftshilfe. Fürs Blumengießen. Meine Mutter macht sie immer selbst, und sie schmecken einfach köstlich. Am besten gekühlt bei der Hitze. Bitte schön.«
Sag Dietrich zu mir, wollte er sagen, stattdessen nickte er erneut. Selbst in all seinem Elend hätte er auf eine dieser Kugeln gebissen, wenn sie es von ihm verlangt hätte. In diesem Augenblick war er kein seelisch verkrüppelter Kerl mehr, sondern Romeo, der vor Liebe und Sorge hätte bersten können. Sieh mich, dachte er weiter, sieh mein inneres Heldenstrahlen und schau nicht auf den zu kurz geratenen, übergewichtigen Frührentner Dietrich Möwe.
Der Moment war gekommen.
»Zuerft n’ Ffflu…n’ Schluuuck. Ja?« Die Realität versetzte ihm nun eine Ohrfeige. Er merkte, dass ihm das Zahnmissgeschick das Sprechen fast unmöglich machte. Etwas war in seiner Mundhöhle angeschwollen. Dazu roch er den Schweiß unter seinem Hemd, er hatte sich nicht geduscht, er stank wie ein Omelett, das zu lange in der Sonne gelegen hatte.
»Ist wirklich alles in Ordnung, Herr Möwe?«
Sein gesamter Plan konnte immer noch scheitern. Er zwang sich zu einem Lächeln, ohne die Zähne zu zeigen, und nickte ihr immer weiter und weiter zu, einem Wackeldackel gleich.
Sie zögerte, nahm aber das Glas, das er ihr anbot, sah sich den Wein an.
Sie wollte nicht trinken, sondern das Getränk wieder abstellen. Das durfte er nicht zulassen. Jetzt oder nie.
»Proft! Auf Ihren Geburtftaach!« Er prostete ihr zu.
Doch mitten in der Bewegung hielt Dietrich inne. Es war wie eine Woge, eine Riesenwelle, ein Tsunami, der ihn überrollte. Hatte sie nun das Glas mit den aufgelösten Tabletten? Ja oder nein? Links oder rechts? Oder würde er gleich Umfallen? Am Ende sogar sein Leben lassen?
Was sollte er tun?
Da fiel ihm wieder Romeo ein, der im Angesicht des Todes seiner Julia das Gift ohne zu zögern getrunken hatte. Ja, auf Leben oder Tod, dachte er und leerte sein Glas in einem Zug.
Als der Alkohol auf seinen Zahnstummel traf, wünschte sich Dietrich sogar, dass er den versetzten Wein erwischt hatte und schnell daran sterben würde.
Kapitel Zwei
Ich bin kein Fan von nächtlichen Notdiensten. Wirklich nicht.
Aber heute Abend gibt es einen, den ich geradezu enthusiastisch angenommen habe: den Papa-geht-leider-nicht-Bereitschaftsdienst.
Was für ein tolles Wort für Scrabble, auch wenn hier die Mitspieler lautstark ihr Veto einlegen würden.
Schade, dass meine Töchter aus dem großen Spielealter heraus sind.
Es ist ungerecht. Wenn die Kinder klein sind, dann lässt man sie gewinnen, um Heulereien zu vermeiden, sind sie jedoch später endlich so weit, dass man seine eigenen Siegchancen ausspielen kann, dann wollen sie auf keinen Fall mehr die Abende mit Mama bei einem Brettspiel verbringen.
Lieber machen sie Party. Crazy und great, wie Luise sagen würde.
Heute gibt es eine solche Party bei Nathalies Freund Vinzenz. Nein, nicht Linus, der sie entjungfert hatte. Diese Sache hat sich schneller erledigt, als ich Zeit hatte, endlich mein Verhütungsgespräch mit ihr zu führen. Ein paar Tränen sind geflossen, und dann stand Vinzenz, der rothaarige Schlaksige mit den silbernen Turnschuhen, vor unserer Haustür und hat sie abgeholt.
Vinzenz’ Eltern haben ein riesiges Haus in Rodenkirchen, nahe dem Rhein, und er wird in zwei Monaten, wenn er endlich seinen Führerschein hat, sofort ein eigenes Auto bekommen. Gefällt mir nicht, kommt mir alles zu verblendet reich vor, aber immerhin ist Vinzenz höflich und gibt nicht an, eher das Gegenteil.
Die ganze Klasse ist bei ihm eingeladen, auch Luise geht mit ihrem Freund Nils hin. Beide Mädels sind zurzeit mit festen Freunden unterwegs, und sie sind erwachsener geworden, oft erwachsener als ich.
Hoffentlich wird die Party lahm und langweilig, denn ein wenig in Sorge bin ich immer. Der Wochenendnotdienst ist auch dafür eine gute Ablenkung.
Hätte ich keine Bereitschaft gehabt, hätte ich heute Abend meinen Vater, Dr. Gerwald Hubertus, dem ich meinen zweiten Vornamen, Huberta, verdanke, treffen müssen. Da meine Mutter, Agathe, mir ihren Nachnamen, Kardiff, vermacht hat, wollte er damit ein Teil meines Lebens bleiben. Ich verschweige dieses Huberta allerdings vor der Welt, so gut es geht.
Er und seine zweite Frau wollten mich unbedingt besuchen kommen. Man hätte sich ewig lange nicht gesehen, und überhaupt gäbe es so vieles zu bereden. »Man« ‒ kein »wir« oder »du und ich«, nur man.
Nein, man hat keine Lust. Man mag nicht.
Ich, Leocardia Huberta, will nicht.
Nicht ohne meine Töchter, die immer ein Gesprächsthema mit Opa zu haben scheinen. Und nicht mit seiner Gemahlin, die ohne Punkt und Komma quatscht, nicht einmal Luft holen habe ich sie gesehen in ihren endlosen Monologen. Ich bin zwar froh, dass Papa mit jemandem zusammen ist, der sich um ihn kümmert, aber bitte, bitte keinen ganzen Abend mit meiner Stiefmutter.
Bei so einem Zusammentreffen würde ich noch dazu endlich die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und von meinem neuen Freund erzählen müssen. Sie würde mich löchern und Papa mir mit seinen Kommentaren den letzten Nerv rauben.
Ich höre meinen Vater schon wortwörtlich fragen: Leocardia, wenn dein neuer Freund schon an der Quelle sitzt, könnte er doch meinen letzten Strafzettel zerreißen, oder? ‒ Nein, Papa, dafür ist mein Liebster nicht zuständig. ‒ Gott, was macht er denn dann? ‒ Mein Freund, der ist zwar Polizist, aber Mordermittler, Hauptkommissar Jakob Zimmer.
Endlich sind meine Gedanken an einer schönen Aussicht angekommen.
Jetzt ein Zwischenstopp.
Jakob und ich sind ein Paar. Wir sind zusammen. Er und ich. Der Hauptkommissar und die Zahnärztin. Titel einer neuen TV-Serie, erste Staffel.
Unfassbar, dass wir es doch noch geschafft haben.
Auch vor mir selbst muss ich diese Tatsache öfter wiederholen, denn nach dem unendlich langen Hin und Her und den seltenen Dates mit unsicherem Ausgang haben wir tatsächlich die nächste Stufe erklommen. Eindeutig mit Langzeitbeziehungstendenz. Wieder ein Wort für Scrabble, diesmal völlig legitim.
Beziehung mit allem Drum und Dran. Gemütliche Kuschelabende, kleine und größere Reibereien, Koordination im Alltagsleben und natürlich Sex.
Herrlich. Crazy und great.
Ich prickle bei dem Gedanken an Jakob. Wenn ich an ihn denke, grinse ich selbst während einer Behandlung lasziv. Gut, dass keiner meiner Patienten es durch den Mundschutz sehen kann.
Heute Nacht ist Jakob allerdings ebenso beruflich unterwegs wie ich, er hat eine Einsatzbesprechung mit seinem Team, jagt sozusagen böse Buben.
Seine Mutter Stefanie liebt solche Formulierungen, sie ist bekennender Jerry-Cotton-Fan und sieht in ihrem Sohn den Ermittler ohne Furcht und Tadel. Ich mag sie, und auch diese Tatsache ist etwas Besonderes, denn bisher waren meine Erfahrungen mit Schwiegermüttern eher traumatisch. Die Mutter meines Exmannes hieß Hella und war die Hölle. Ihr Sohn war der Traumprinz und hätte als begnadeter Künstler etwas Besseres abbekommen können als eine schnöde Zahnärztin. Dass ich ihrem Johannes seinen Lebensunterhalt zum Teil heute noch finanziere, hat sie nie interessiert.
Die edle Helga, Mutter meines letzten Lovers Magister Heinz Leerbaum, wollte immer nur, dass er zu seiner Ehefrau zurückkehrt, die angeblich nicht so verrückt und anspruchsvoll war wie ich. Nun, das hat sie erreicht.
Hella und Helga, das Teufelsschwiegermonsterduo.
Stefanie Zimmer ist einfach nur nett. Bodenständig und direkt, wie ihr Sohn. Ich glaube, meinem Jakob ist es ein wenig unangenehm, dass ich mich mit seiner Mutter so gut verstehe.
Mein Jakob. Klingt nach mehr. In meinem Alter sehnt man sich nach einer Beziehung, in der man miteinander alt werden könnte.
Gott, jetzt verwende ich auch schon dieses »man«.
Ich bin inzwischen fünfundvierzig, und es war leichter als gedacht. Superleicht. Ich bin über diese Altersstufe hinausgeflogen, in den Armen meines Lieblingsermittlers, und habe mich wie fünfundzwanzig gefühlt.
Na ja, in Wahrheit habe ich an diesem Geburtstag lange gearbeitet und nebenbei mit mir und der Lebenszahl gehadert, habe mir in der Mittagspause einen Badeanzug im Internet bestellt, weil ich nie mehr bauchfrei tragen wollte. Dazu eine Kaftanbluse, um die nackten Arme zu überdecken.
Erst nach Praxisschluss, als mir meine Angestellten ein Ständchen gesungen haben, begann der erfreuliche Teil. Anschließend war ich mit meinen Töchtern essen, später kam Jakob dazu, und wir haben mit Champagner angestoßen. Somit lief der Ausklang dieses Tages immerhin bestens. Allerdings habe ich spätnachts eine Liste mit Dingen erstellt, die ich bis zu meinem Fünfzigsten unbedingt noch erleben will, Drachenfliegen und Wildwasserpaddeln stehen auch darauf.
Schluss damit, Konzentration auf das Hier und Jetzt.
Patienten ‒ Notdienst ‒ Praxisarbeit.
Meine Zahnarzthelferinnen haben gestern den Eingangsbereich neu dekoriert. Britti Poster, allen voran, fand das Ambiente beim Eintreten zu kühl, zu streng. Nun hängt dort eine Bilderreihe mit niedlichen Katzen und Hunden, als ob wir eine Tierarztpraxis wären. An der Anmeldung vorn stehen oben drei muschelartige Porzellangebilde, und unter der Theke leuchtet eine Lichterkette in Rosa. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Gerda Horst, meine Empfangsdame, die gern Bulldogge genannt wird, weil sie es immer schafft, sich selbst gegen die unangenehmsten Patienten durchzusetzen, damit einverstanden war. Ich gehe davon aus, dass Britti, Greta und die anderen Helferinnen sie überredet oder einfach überstimmt haben.
Mal sehen, wie die Patienten es finden.
Aber in meinen Behandlungsräumen bleibe ich die alleinige Stylingexpertin. Ich entscheide über die Bilder an den Wänden und die jeweiligen Farben.
Still ist es.
Eigentlich sollte ich nicht allein hier sein.
Mein neuer Kollege Olaf Jansen stellt sich meistens gern für Notdienste zur Verfügung. Der junge Mann ist ein Glücksgriff. Freundlich, kompetent und bei den Helferinnen seit seinem ersten Arbeitstag der stolze Hahn im Korb. Sie kichern immer, wenn er ihnen Anweisungen gibt, und selbst die noch immer etwas traumatisierte Britti plappert in seiner Gegenwart wieder so viel und so schnell wie vor ihrer letzten Katastrophe.
Aber an alles, was damit verknüpft ist, werde ich heute nicht denken. Ich habe mir bei nächtlichen Notdiensten ausschließlich mordfreie Gedanken verordnet.
Apropos. Mein neuer Zahnarzt ist bei der Beerdigung seiner Uroma. Ein natürlicher Tod, traurig, aber immerhin weit und breit kein Killer in Sicht.
Bisher ein ungewohnt entspannter Abend.
Nur drei Schmerzgeplagte, die sich an einem Olivenkern eine Plombe ausgebissen, einen schmerzenden Weisheitszahn und eine stressbedingte Kiefersperre hatten. Seit einer halben Stunde kein neuer Notfall. Ein seltenes Phänomen während eines Wochenendbereitschaftsdienstes. Fast zu ruhig für mich.
Ich werde meine Töchter nerven und ihnen eine Nachricht schicken, fragen, wie die Party denn so läuft. Oder ich sende Jakob drei küssende Smileys in seine Besprechung hinein.
Nein, ich halte das Schweigen um mich herum einfach aus. In meinem Kopf plappere ich ja sowieso ohne Punkt und Komma.
Ohnehin wird jede Minute einer meiner Stammpatienten auftauchen.
Herr Weninger, der Gute.
Er hat sich vorhin telefonisch angemeldet. Immer wieder mit entzündeten tiefen Zahnfleischtaschen geschlagen, aber auch immer bereit, sich dabei ohne Spritze behandeln zu lassen. Was nicht nötig wäre, denn meine Spritzenphobie halte ich relativ gut im Zaum. Vielleicht wird auch dieses Problem mit meiner Hypnosetherapie und meinem neuen, stabilen Verhältnis mit Jakob irgendwann ganz aus meinem Leben verschwinden.
Ich beginne in der leeren Praxis zu pfeifen.
Es hört sich befremdlich an.
Besser versuche ich es mit Summen.
Genauso seltsam.
Es klingelt an der Eingangstür. Ich zucke zusammen.
Es ist nicht Herr Weninger.
Stattdessen steht ein rundlicher kleiner Mann vor der Tür. Er hält sich einen Eisbeutel an seinen Mund.
»Find Fie Zahnäftin?«
Klar, wer sonst würde an einem Samstagabend kurz vor dreiundzwanzig Uhr die Tür einer Zahnarztpraxis öffnen? Ich stelle mich vor.
»Muff ich waten?« Er wechselt die Hand am Eisbeutel und wippt auf seinen Füßen. Er scheint es eilig zu haben.
»Sie sind im Moment der Einzige, Behandlungsraum vier. Dort nehme ich auch Ihre Personalien auf.«
Sofort rennt der kleine Mann an mir vorbei Richtung Büro.
»Nein, Sie müssen nach links.«
Er wendet, rennt wieder los, bekommt die Drehung nicht ganz hin und stößt mit dem Kopf gegen die Stehlampe, die neben der Garderobe steht. Es ist das erste Mal, dass so etwas passiert, und ich muss insgeheim schmunzeln.
Ungerührt setzt der Mann seinen Lauf fort. »If hab’f total eilig!«
Schon ist er im Gang, schwankt etwas, während er auf die Türnummern sieht, und verschwindet in der Vier. Ich muss mich beeilen, um ihn einzuholen. Im Zimmer sitzt er bereits auf dem Zahnarztstuhl und hat sich selbst das Dentallätzchen umgelegt. Mein Patient scheint eine ältere und molligere Ausgabe von Flash zu sein. Immer noch hat er den Eisbeutel an der Lippe.
Ich setze mich auf den Drehstuhl neben ihn. Er wendet seinen Kopf in meine Richtung und macht seinen Mund auf.
»Na, Sie haben es aber wirklich eilig, Herr …?«
»Möwe. Wie der berühmte Vogel auf dem Roman, nur mit anderem Vornamen. Alfo nicht die Möwe Jonathan, fondern Dietrich. Dietrich Möwe.«
Ich lache. Er nicht. Keinen Funken Humor strahlt er aus, nur Dringlichkeit und etwas Angst. Außerdem stinkt er ziemlich nach Schweiß.
»Ich muff nach Haufe zurück. So fnell wie möglich. Ef geht um Leben. Und Tod.«
Wieder lache ich, und er wirft mir einen Blick zu, der auch etwas Tödliches in sich trägt.
»Ich wäre nicht hier, wenn dieffffe Fmerzen …« Er stöhnt auf, presst den Eisbeutel fester an seine Backe. »… nicht foooo riefig wären. Ich fterbe gleich, Frau Doktorrr, aber fie könnte auch schon tot sein.«
Ich kann seinem Gebrabbel nicht folgen. Was meint er damit? Wer soll denn bitte schön tot sein?
»Herr Möwe, geben Sie mir bitte den Eisbeutel und dann erzählen Sie mir, was passiert ist.«
Er drückt mir den Beutel in die Hand. Jetzt sehe ich, dass er recht unorthodox gebastelt wurde. Das Plastik ist ein Luftpolster von einer Paketverpackung, und die Eiswürfel scheinen von einem zerstückelten Speiseeis am Stiel zu stammen.
»Können Fie daf einfrieren, damit ich ef fpäter wieder mitnehmen kann? Bitte? Ich hab mir meine Krone aufgebiffen und ein Ftück Zahn dazu.«
Seine untere Lippe ist tatsächlich auf Pflaumengröße angeschwollen. Es sieht wie ein frischer Kinnhaken aus.
»Mach ich gern, Herr Möwe.«
»Danke, Frau Doktor. Tot ift tot, wiffen Fie!«
Ich bräuchte Britti Poster an meiner Seite, sie versteht jeden Patienten, egal, welches Kauderwelsch er redet.
Ich nehme ihm seine Kreation ab und gehe damit ins Pausenzimmer, wo ein Kühlschrank steht. Als ich ihn öffne, höre ich ein Stöhnen und dann einen Laut, der wie ein Pfeifen klingt, aus dem Behandlungsraum.
Jetzt fühle auch ich mich gehetzt. Warum ist der Mann so außer sich? Was ist ihm geschehen? Und warum meint er, dass jemand tot sein könnte?
Leo, stopp.
Die Ameisen in meinem Hirn rennen los, und ich muss ihnen sofort Einhalt gebieten. Ich schüttle vehement den Kopf, um mir selbst ein klares »Nein« und »Aus« zu signalisieren, dann kehre ich rasch in die Vier zurück.
Dietrich Möwe ist auf dem Zahnarztstuhl in sich zusammengesunken. Sein Kopf hängt seitlich schief, eine Speichelspur glitzert über seiner geschwollenen Lippe. Er ist in Ohnmacht gefallen.
Hatte ich mich nicht eben erst beschwert, wie ruhig es heute Nacht ist?
Kapitel Drei
Als ihr neuer Patient keine Minute später wieder zu sich kam, atmete Leo erleichtert auf.
Sie hatte seinen Puls gefühlt und ihn zugleich mit lauter Stimme angesprochen. Wäre der Mann nicht so schnell aus seiner Ohnmacht erwacht, hätte sie den Notruf gewählt. Sicher war sicher.
Seine Augenlider hatten kurz geflattert, dann hatte er zu husten begonnen, als hätte er sich verschluckt. Schließlich hatte er seine Umgebung wieder wahrgenommen und sich klar äußern können, als Leo ihn erneut nach seinem Namen und seinem Missgeschick befragte. Er erzählte in einer hohen Geschwindigkeit, aber etwas leichter verständlich von der beim Zubeißen abgebrochenen Zahnkrone, dazu noch von Blut und Schmerzen. Dabei sah er sich mehrmals um, als würde er jemanden hinter sich vermuten.
Leo holte das Blutdruckmessgerät. Sie wollte sichergehen, dass die Werte des Patienten nicht immer noch zu niedrig waren. Um die Lage weiter zu beruhigen, begann sie im Anschluss, seine Patientendaten aufzunehmen.
Er saß angespannt im Zahnarztstuhl, und sein dicker Bauch hob und senkte sich in schnellem Rhythmus. Eines seiner kurzen Beine hatte er angewinkelt, das andere bewegte er nervös hin und her.
Als Leo ihm seine Versichertenkarte zurückgab, zitterten seine Finger. In der nächsten Sekunde schlug er sich selbst unsanft auf die Wange und schrie dabei auf. Es klatschte.
Leo sah ihn überrascht an. »Was war das denn, Herr Möwe?«
»Daf mache ich immer fo, wenn ef mir flecht geht.«
Ihr blieb für einen Moment der Mund offen stehen. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf einen Patienten traf, der sich, wie sie selbst, hin und wieder kleine Ohrfeigen gab? Sie war immer noch dabei, sich diese eigenwillige Angewohnheit abzugewöhnen, aber in wirklich chaotisch-stressigen Momenten half es ihr. Dem Patienten anscheinend auch.
Trotz der Gemeinsamkeit blieb der merkwürdige Eindruck, den der Mann auf Leo machte.
»So, Herr Möwe. Jetzt lassen Sie uns endlich nachsehen, ob es noch Rettung gibt.«
Dietrich Möwe stöhnte erneut heftig. »Keine Rettung mehr. Allef zu fpät, wenn Fie nicht schneller machen. Ich habe mir daf Teil aufgebiffen und im Taxi auf der Fahrt hierher verloren.«
»Vielleicht könnten wir nachfragen, ob der Taxifahrer Ihre Krone gefunden hat, wenn Sie die Nummer des Wagens noch wissen?«
»Nein, nein. Weitermachen. Ich hab schreckkkkliche Schmerzen. Die Schmerztablette hat bereitf aufgehört zu wirken. Schreckkkklich, verftehen Fie? Defhalb bin ich doch hier. Keine weitere Verfögerung mehr, um Gottef willen.«
Er lehnte sich zurück und machte den Mund derart weit auf, dass Leo sein Zäpfchen sehen konnte. »Nicht ganz so weit, Herr Möwe, das ist nicht nötig. Drehen Sie bitte den Kopf zu mir.«
Sie überlegte, ob eine Behandlung nach dem Ohnmachtsanfall wirklich zu rechtfertigen war, entschied sich aber dafür. Wenn der Mann solche Schmerzen litt, musste sie ihn auf der Stelle versorgen. Leo schob sich den Mundschutz über das Gesicht und zog ihre rosa Latexhandschuhe über, griff nach Sonde und Mundspiegel.
»Rofa Handschuhe? Rofa?«, fragte er skeptisch.
»Bitte nicht mehr sprechen. Ich sehe mir die Sache an.«
Die Sache war eindeutig.
Am Dreier links unten, also am Eckzahn, war das Missgeschick sofort erkennbar. Dort musste die abgebrochene Krone gewesen sein, von der der Patient erzählt hatte. Jetzt sah man nur mehr den abgeschliffenen Stumpf. Dazu einen Einriss am Zahnfleisch. Aber auch der Zweier, der linke der unteren Vorderzähne, hatte etwas abbekommen. Die Schneidekante war abgesplittert. Kein Wunder, dass der Mann solche Schmerzen hatte.
»Herr Möwe, auf was um Gottes willen haben Sie denn gebissen? Wollten Sie Superman spielen und haben Stahlbonbons gekaut?«
Für einen Moment hatte Leo vergessen, dass der Mann offenbar keinen Funken Humor hatte. Kaum war sie mit den Instrumenten aus seinem Mund heraus, hob Dietrich Möwe seinen Kopf hoch.
»Ich wollte einen völlig normalen Kekf effen. Nuffkekf. Und ich bin nicht Fuperman oder der Fledermaufmann oder fonft etwaf in der Art. Oder meinen Fie, bei meiner Figur könnte ich abheben?«
Leo dachte an eine Hummel, die trotz ihres Eigengewichts gegen alle Physik fliegen konnte, aber sie schwieg. Auch dieses Bonmot würde der nervöse Herr Möwe nicht amüsant finden. Stattdessen atmete sie einmal ein und aus und zog eine der für den Notdienst vorbereiteten Spritzen auf. Ihre Phobie zuckte nur kurz auf wie ein Aufstoßen nach einem üppigen Essen, aber nicht mehr.
Dietrich Möwes Augen hingegen wurden groß. Er hob abwehrend die Hand. »Kann ich auch ohne? Totale Angfffft!«
Leo schüttelte den Kopf. »Herr Möwe. Ich werde Ihren Stumpf am Eckzahn heute Nacht einer gründlichen Wurzelbehandlung unterziehen. Als Erstversorgung. Auf den ersten Blick scheint der Zahn noch zu retten zu sein. Der Schneidezahn nebenan hat eine Absplitterung erlitten, die werde ich versuchen abzuschleifen. Ohne Spritze ist das einfach nicht möglich.«
Der Patient zögerte. Doch dann seufzte er tief, lehnte sich ergeben wieder zurück und ließ Leo mit ihrer Arbeit beginnen. Er wimmerte laut, als Leo ihm die Spritze setzte.
»So, Herr Möwe, das wäre schon mal erledigt. Während wir auf die Betäubung warten, erzählen Sie mir doch, was Sie den Abend über bis zu Ihrem Missgeschick gemacht haben.«
Leos Versuch, eine Konversation zu beginnen, scheiterte völlig. Dietrich Möwe wurde wieder kreidebleich, er schnaubte, keuchte. Leo sah die nächste Ohnmacht kommen. »Bitte, bleiben Sie bei mir, Herr Möwe. Sonst rufe ich den Notarzt.«
»Fie find doch Ärftin. Ärffftin! Wofu noch jemanden anrufen?« Sein überraschend lauter Tonfall passte nicht zu seinem kalkweißen Gesicht. »Ich hab keine Feit, keine Feit mehr. Fie hat keine Feit mehr.«
»Ganz ruhig, Herr Möwe. Alles ist gut. Atmen Sie. Langsam und regelmäßig. Ein und aus. So ist es gut. Noch einmal. Und weitermachen. Wir schaffen das.«
»Fie erinnern mich an eine bestimmte Politikerin.«
Jetzt musste Leo grinsen, sie zog sich den Mundschutz unters Kinn, damit der Mann ihr Lächeln sehen konnte. Die Stimmung entspannte sich etwas. Es hätte für Leo nun die Möglichkeit bestanden, das Thema zu wechseln, aber dafür war ihre Neugier zu groß.
»Entschuldigen Sie, wenn ich nachfrage, aber Sie haben vorhin davon geredet, dass jemand tot sein könnte. Habe ich Sie richtig verstanden? Wer ist damit gemeint, Herr Möwe? Soll ich mich um noch jemanden kümmern? Wartet auf Sie jemand, der krank ist? Soll ich jemanden verständigen?«
Dietrich Möwe packte Leo am Unterarm. »›O wackrer Apotheker! Dein Trank wirkt schnell. ‒ Und fo im Kuffe fterb ich.‹«
»Was?«
»Romeof letzte Worte. Bevor er daf Gift trinkt.«
Leo fasste ihrerseits den Mann am Handgelenk und schob seine Hand von ihrer weg. Dieser Patient war eine Tüte voller Seltsamkeiten, aber Angst hatte sie vor ihm nicht. Im Notfall würde sie sich gegen den klein gewachsenen, untrainierten Mann wehren können. Er würde sie höchstens mit seinem Kugelbauch umstoßen.
»Worauf wollen Sie hinaus, Herr Möwe? Entweder Sie haben eine Art Humor, die ich einfach nicht verstehe, oder Sie wollen mir mitteilen, dass tatsächlich jemand aus Ihrem Umfeld in Gefahr ist. Sollte es Letzteres sein, bitte reden Sie.«
Der Patient schnaubte wieder, berührte mit Vorsicht seine geschwollene Lippe. »Allef taub. Ich bin bereit. Bitte fangen Fie an und beeilen Fie fich.«
Sein Kopf ging nach hinten und sein Mund auf. Keine weitere Erklärung mehr, damit musste sich Leo abfinden. Sie bedeckte ihr halbes Gesicht wieder mit dem Mundschutz, setzte dem Mann den Sauger in den Mund und bereitete das Instrument vor.
»Fünfzig zu fünfzig ftanden die Chancen, Frau Doktor.« Seine Stimme bekam ein Tremolo.
Leo hielt inne. Dietrich Möwe hatte sich im Zahnarztstuhl unvermutet kerzengerade aufgerichtet und hielt den Sauger jetzt in seiner erhobenen Hand. Sein Blick war auf das Bild an der Wand im Behandlungsraum vier gerichtet. Darauf tanzten ein Zahn und eine Zahnbürste Ringelreihen. Beide hatten lustige Gesichter aufgemalt und dünne Hände, an denen sie sich hielten.
»Ef war in ihrem Glas. In ihrem. Fie ist umgefallen, ich hab sie auf gefangen.« Seine Aussprache war mit einem Mal fast wieder klar. »Wenn ich vollkommen ehrlich bin, hätte ich mir gewünscht, dass es doch mich selbst getroffen hätte. Fie ist so wunderschön und zart, so unberührt, so still. Schneewittchen ist fie, oh ja.«
Leo nahm das kleine Schauspiel, das ihr Patient seit seinem Eintreffen lieferte, nur noch verwundert zur Kenntnis. Vielleicht war eine solche Inszenierung eine merkwürdige Art des Mannes, mit seiner Angst umzugehen.
Als Zahnärztin hatte Leo im Laufe der Jahre alle nur erdenklichen Szenen in ihrer Praxis erlebt. Noch früher hatte ihr Vater oft von absurden Vorkommnissen mit seiner zahnwehgeplagten Klientel erzählt.
Ihr fiel »Zorro« ein, ein Angstpatient mit einer Vorliebe für Süßkram jeder Art, der sich immer wenn er auf dem Stuhl Platz nehmen musste, eine schwarze Schlafmaske über seine obere Gesichtshälfte gezogen hatte. Nur damit hatte er sich bereit gefühlt, die Behandlung zu überstehen. Das Skurrile daran war, dass diese Schlafmaske um die Augen herum Sehschlitze hatte, die »Zorro« selbst hineingeschnitten hatte, um doch jederzeit die Möglichkeit zu haben, der Behandlung zu folgen.
Am Ende waren das ängstlich-eilige Gehabe und verwirrende Gerede von Dietrich Möwe vielleicht auch nur ein Spleen.
Schon redete er weiter. »Wissen Fie, Frau Doktor, was das Flimmste ist?« Eine einzelne Träne lief über seine Wange. Er schien nicht Leo, sondern die tanzenden Figuren auf dem Bild anzusprechen.
»Dass fie denken könnte, ich wäre ein Monster.« Seine Stimme wurde klein und brüchig. »Dass fie glauben könnte, ich hätte ihr Böses angetan, dabei will ich fie nur erretten. Annika, meine liebfte Annika.«
Leo hatte keine Ahnung, was sie antworten sollte, und auch der Patient schwieg mit einem Mal.
Ein schriller Ton zerriss die Stille. Dietrich Möwe und Leo zuckten beide heftig zusammen.
Es war die Türglocke. Herr Weninger oder ein anderer Notfall. Hoffentlich kein zweiter Paranoiker. Vielleicht kamen ja sogar die Herren in den weißen Kitteln, um Herrn Möwe abzuholen und ihn an den Ort zurückzubringen, von wo er ausgebüxt war.
Leo fasste den Mann an der Schulter, nahm ihm den Sauger aus der Hand und drückte seinen Oberkörper sanft gegen die Stuhllehne.
»Ich muss öffnen, Herr Möwe. Leider bin ich heute Nacht allein beim Notdienst. Bitte lehnen Sie sich zurück. Ich bin in wenigen Augenblicken wieder bei Ihnen. In der Zeit hat die Betäubung gänzlich eingesetzt, und wir können loslegen.«
Während Leo den Gang entlanghastete, sprangen ihre Gedanken hin und her. Einerseits war sie froh, nicht mehr allein mit dem seltsamen Herrn Möwe zu sein, andererseits hätte sie ihn gern weiterplappern lassen, hätte gern herausgefunden, ob er nur Schwachsinn erzählte oder wirklich eine Annika im näheren Umfeld des Mannes in Gefahr war.
Diesmal war es tatsächlich Herr Weninger.
»Frau Dr. Kardiff, es tut mir so leid, dass ich Sie stören muss, aber das Stechen und Klopfen geht nun schon über Stunden, und morgen ist Sonntag. Da müsste ich in die Zahnklinik zu einem mir fremden Arzt, und das geht überhaupt nicht. In den Krankenhäusern sind nur Schlächter angestellt. Unerfahrene junge Buben, die auf die hilflosen Notfallpatienten losgelassen werden.«
Wie immer redete Herr Weninger viel, wenn er aufgeregt war. Das war seine Art der Stressbewältigung, allerdings klangen seine Sätze logisch.
»Dafür bin ich doch hier, Herr Weninger. Bitte, kommen Sie herein. Und nehmen Sie im Wartezimmer Platz, eine Behandlung läuft noch.«
In genau diesem Moment wurde Leo von hinten angerempelt. Erschrocken wirbelte sie um ihre Achse.
Dietrich Möwe stand hinter ihr, das Dentallätzchen noch um den Hals. Seine wenigen dünnen Haare standen ihm am Hinterkopf zu Berge, und er hatte hektische rote Flecken im Gesicht. Mit der geschwollenen Lippe dazu sah er wie ein Zwerg aus einem der Hobbit-Filme aus.
»Ich muff mich entschuldigen, aber ich muff zurück. Muff lof, muff fie vom Tode befreien. Muff fie retten!«
Sein komisches Sprechen hatte sich wieder verstärkt. Leo und auch Herr Weninger sahen den kleinen dicken Mann perplex an.
»Herr Möwe, bitte gehen Sie zurück.«
»Kein Feit, keine Feit mehr. Meine Schmerzen find weg, und ich muff einfach lof! Auf dem Weg!«
»Dass die Schmerzen weg sind, kommt nur von der Betäubungsspritze, Herr Möwe. Wenn die Wirkung nachlässt, spüren Sie alles wieder wie vorhin. Bitte, gehen Sie ins Behandlungszimmer.«
Leo versuchte den Patienten aufzuhalten, doch der Mann drückte sich an ihr und Herrn Weninger vorbei und war schneller auf der ersten Treppenstufe im Flur, als man ihm bei seiner Fülle zugetraut hätte.
»Ich komme Montag, Frau Doktor, Montagmorgen werde ich der Erfte fein. Grofef Ehrenwort.«
Er hastete die Treppe nach unten und war wie der Blitz um die erste Biegung und aus Leos und Herrn Weningers Blickfeld verschwunden.
»Leben oder Tod, Tod oder Leben. Frau Doktor, dann Montag!«, schrie er durch das nächtliche Treppenhaus.
Leo machte vier Schritte an Herrn Weninger vorbei in den Flur bis zur Treppe hin. »Herr Möwe, warten Sie. Hallo! Herr Möwe.« Sie rief jetzt ebenfalls laut. Es gab einen Nachhall wie ein Echo.
Dietrich Möwe war nicht mehr zu sehen, nur noch seine Schritte zu hören, am Ende die Eingangstür unten.
Herr Weninger kam zu Leo an den Treppenabsatz.
»Was war das denn?«
»Eine fliehende Möwe«, antwortete Leo, ohne es komisch zu meinen.
Kapitel Vier
»Jakob, Schatz?«
Sie kuschelten vor dem Fernseher.
Immer noch wollte Leo sich kneifen, wenn die Idylle zwischen dem Hauptkommissar und ihr zu perfekt schien. Konnte es tatsächlich sein, dass sie nach allen ihre vorherigen verkorksten und komplizierten Beziehungen endlich den Mann ihres Lebens gefunden hatte?
Wie meistens in den letzten Wochen war Jakob zu Leo nach Junkersdorf gekommen. Die Gründe waren einfach, in ihrem Haus gab es mehr Platz, mehr Kuschelecken, und Leo wollte die Mädchen abends nicht zu oft allein lassen. Jakob war es recht, er hatte ohnehin zu wenig Zeit, seine Junggesellenwohnung in Deutz ständig für eine Besucherin chaosfrei zu halten.
Sie fuhr ihm mit der Hand durch sein dunkelblondes Haar, das immer kreuz und quer zu stehen schien.
»Magst du noch ein Glas Wein, Leo?«
Leo. Er nannte sie nie bei einem Kosenamen, sprach aber sein Leo so liebevoll aus, dass es wie Musik in ihren Ohren klang.
Unter seinem T-Shirt fühlte sie seinen durchtrainierten Oberkörper und dachte mit leichtem Schwindel an ihr intimes Zusammensein. Was lange währt, wird endlich gut. Dieses Sprichwort passte. Der Sex war nicht nur gut mit Jakob, sie konnte sich nicht erinnern, bei ihren Männern davor je Spaß und Leidenschaft in einer so wundervollen Kombination erlebt zu haben. Leo zählte im Kopf die Monate, seit sie offiziell ein Paar waren. Sechs. Nein, sieben.
Ihr schoss durch den Kopf, dass es sich mit dem siebten Monat vielleicht ähnlich wie mit dem verflixten siebten Jahr verhalten könnte, aber da sie davon noch nie gehört hatte, schob sie den Gedanken außer Reichweite. Sie war nie abergläubisch gewesen, vermied es jedoch, an einem Freitag, den 13., etwas Wichtiges zu planen.
Im Fernsehen lief der »Tatort«, und zu Leos Erstaunen hatte sich Jakob als Fan geoutet.
»Natürlich ist bei Weitem nicht alles wie in der realen Polizeiarbeit, aber die Fälle sind interessant. Und ich mag die Kommissare«, hatte er ihr erklärt.
Schnell hatte sich der »Tatort«-Abend zu einem festen sonntäglichen Ritual zwischen ihnen entwickelt. Sie rätselten mit, und Jakob landete mit seinen Mördertipps wesentlich weniger Treffer als Leo. Eben betrat Harald Krassnitzer die Szene, griesgrämig wie immer, der Wiener »Tatort« war an der Reihe.
»Hey, ihr zwei!« Nathalie tauchte in der Tür zum Wohnzimmer auf.
Sie war bereits im Pyjama. Die Party am Vorabend war zwar nach den Angaben beider Mädchen unsagbar dröge gewesen, aber Luise und Nathalie waren trotzdem bis spätnachts geblieben. Beide hatten ihrer Mutter geschworen, keinen Alkohol getrunken zu haben.
»Wollt ihr mit uns gucken? Eine Leiche gibt es schon.« Jakob hob die Hand und winkte Leos Tochter zu.
Er hatte sich von Anfang an um die Zwillinge bemüht, und sie zeigten ihm ihre Zuneigung, indem sie sich genauso lässig verhielten wie Leo gegenüber.
»Nö. Lulu muss noch was für die Schule vorbereiten, und ich helfe ihr dabei. Danach hauen wir uns direkt aufs Ohr. Nacht, Jakob. Nacht, Leo.«
»Hatte ich nicht gestern gesagt, ihr dürft nur auf die Party, wenn alle Hausaufgaben erledigt sind?«
Nathalie gähnte, ohne die Hand vorzuhalten. »Leo, bleib cool. Ist nur ein Projekt. Freiwillig. Mach dir keinen Kopf.«
Mit diesen Worten verschwand sie wieder.
»Ich sehne mich nach dem Wort ›Mama‹, ehrlich.« Wie öfter war Leo unschlüssig, ob sie aufstehen und nach oben gehen sollte, um die beiden zurechtzuweisen. »Freiwilliges Projekt, das klingt mir nach einer faulen Schwindelei.«
Jakob lachte. »Wenn du mich als Kriminalbeamten fragst, glaube ich deinen Töchtern. Dass man mit Projekten seine Noten aufbessern kann, das gab es auch schon zu meiner Schulzeit.«
»Du stellst dich also gegen mich und meine dürftigen Versuche, zwei freche Teenager zu erziehen.«
»Deine zwei sind tolle Kinder, finde ich. Wein oder nicht, das war doch die Frage.«
»Nein, keinen Wein. Darf ich dich stattdessen kurz etwas fragen?«
Seit gestern Nacht hatte Leo darüber nachgedacht. Nicht nur über den seltsamen Dietrich Möwe und seine sonderbaren, beängstigenden Aussagen, sondern auch darüber, ob sie ihrem Liebsten davon erzählen, ihn womöglich sogar bitten sollte, sich über den Patienten zu informieren. Auch vielleicht über diese Annika, von der er die ganze Zeit gefaselt hatte.
Jetzt gleich. Bevor der »Tatort« im TV Fahrt aufnahm.
»Im Notdienst gestern. Da war so ein Kerl.«
»Auch Kerle müssen zum Zahnarzt.« Jakob gab ihr einen Kuss mitten in ihre blonden Locken, seine Lippen kitzelten sie. »Findest du, dass ich dem Darsteller ähnlich bin?«
Leo unterbrach ihre eigenen Gedanken. »Dem Kommissar Eichner?«
»Eisner heißt er, Leo, Moritz Eisner. Ja, meine Kollegen ziehen mich damit manchmal auf.«
Mit seinem Team, Hauptkommissarin Birgit von Zeh, Hauptkommissar Luis Fahrenz und Kommissar Per Kowalski, hatte Jakob einen fast schon familiären Umgang, das wusste Leo. Sie scherzten und neckten sich, doch im Ernstfall würde jeder von ihnen für die anderen durchs Feuer gehen.
Leo gewöhnte sich nur langsam an die Allgegenwart der drei, bemühte sich aber, sie alle zu mögen. Jakob hatte sich an das Familienleben der Kardiffs ja ebenso angepasst, obwohl er bisher mit Kindern nichts am Hut gehabt hatte. Wobei ‒ Kinder stimmte wirklich nicht mehr, Luise und Nathalie waren sechzehn. Die jungen Damen fanden die neue Beziehung ihrer Mutter zu einem Mordermittler der Kölner Kripo mega, groovy und cool. Mehr Zustimmung ging nicht.
»Nein, Jakob, finde ich nicht. Moritz Eisner ist älter und untrainierter als du, zumindest sieht er so aus. Außerdem ist er muffiger, als du es je warst.«
»Danke.« Noch ein Kuss, und Leo fühlte die Wärme in ihrem Herzen. »Was wolltest du mich fragen?«
»Vergiss es, nach dem Krimi dann.«
»Jetzt komm schon. Da war ein Kerl, und weiter?«
Leo holte tief Luft. »Da war ein seltsamer Notfallpatient in meiner Praxis. Erst wurde er ohnmächtig, dann hat er von einer weiblichen Person gefaselt, die tot sein könnte. Ich habe darüber nachgedacht, der Sache vielleicht nachzugehen.«
»Was meinst du mit ›der Sache nachgehen‹?«
Sein sanfter Ton hatte unwillkürlich eine Strenge angenommen, die Leo nur zu gut kannte. Ihre Neugierde hatte die aufkeimende Liebe zwischen ihr und Jakob öfter auf die Probe gestellt, auch der Umstand, dass sie sich während zweier Mordermittlungen kennen- und lieben gelernt hatten, bei denen Leos Schnüffeleien sie beide Male fast das Leben gekostet hatten.
Jakob hatte demnach guten Grund, einen skeptischen Ton anzuschlagen. Trotzdem fühlte sich Leo leicht beleidigt, weil sie sich in den letzten Monaten wirklich in nichts, aber auch gar nichts eingemischt hatte, was nur ansatzweise nach einem Verbrechen ausgesehen hatte. Wäre Jakob gestern Nacht dabei gewesen, würde er jetzt nicht diesen scharfen Unterton in seine Frage legen.
»Ich meinte damit, ob ich vielleicht bei dem Mann anrufen und nachfragen sollte oder du mir als Ermittler einen Ratschlag geben könntest. Auf keinen Fall wollte ich von der Couch hochspringen und meinen eigenen Tatort inszenieren. Also nur keine falschen Schlüsse, Herr Hauptkommissar.«
Leo rutschte auf der Couch einen halben Meter von Jakob weg. Er sah sie irritiert an, nahm die Fernbedienung und stellte den Ton aus. »Sei nicht empfindlich, ich wollte nicht böse klingen. Erzähl's mir.«
»Nach dem Film. Wir verlieren sonst den Faden.«
Jakob schüttelte den Kopf. »Raus damit. Du platzt sonst, und ich kann mich ohnehin nicht mehr auf die Handlung konzentrieren. Also, wie wir Bullen gern sagen: Schieß los!«
Leo musste schmunzeln. Ein Streit nach ihrer anstrengenden Notdienstnacht wäre vor dem Start in die neue Woche einfach ekelhaft gewesen. Noch dazu brannte ihr die Geschichte tatsächlich unter den Nägeln. Sie gestand sich ein, dass sie den ganzen Abend bereits darauf gelauert hatte, Jakob von Dietrich Möwe zu berichten.
Kaum waren die Schleusen geöffnet, sprudelte die Geschichte wie ein Wasserfall aus ihr heraus. Jakob schenkte sich Wein nach, unterbrach sie nicht.
»… und dann hat er beim Davonlaufen geschrien, dass er Montag wiederkommt«, endete sie nach weniger als fünf Minuten. »Hätte ich dich nicht besser sofort verständigen sollen?«
»Quatsch. Wenn du jedes Mal die Kavallerie rufst, wenn ein Patient im Taumel seiner Schmerzen oder unter einer Betäubung Unsinn redet, könnte ich gleich einen Mann bei dir als Dauergast abstellen.«
»Du meinst, all sein Gerede hat nichts zu bedeuten?« Ihr Unmut kehrte zurück. Es kam nicht alle Tage vor, dass sich ein Patient so äußerte, und schon gar nicht hatte ihr jemals ein Mensch auf dem Zahnarztstuhl von einem möglichen Verbrechen erzählt.
Abgesehen von diesen Umständen hatte Leo sich von ihrem Freund und Geliebten mehr Aufmerksamkeit erhofft. Oder ging ihre Phantasie wieder einmal mit ihr durch?
»Deine Phantasie geht mal wieder mit dir durch, Leo.«