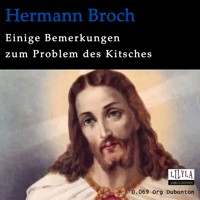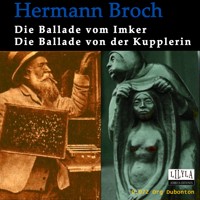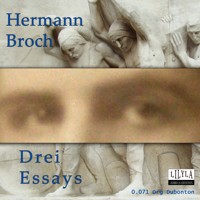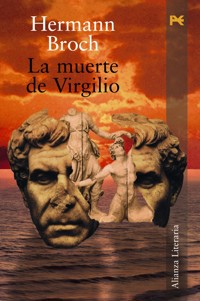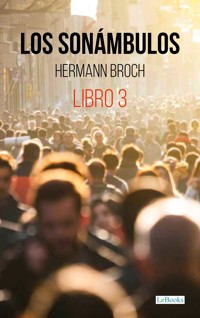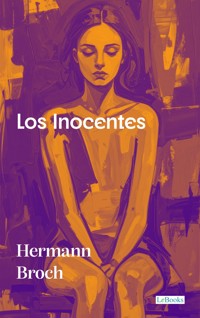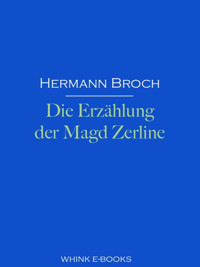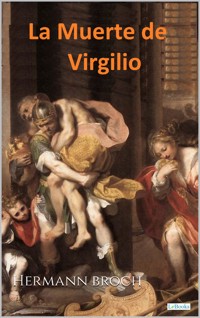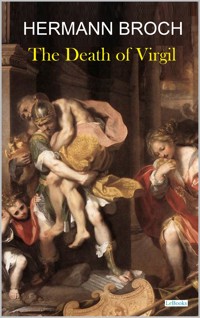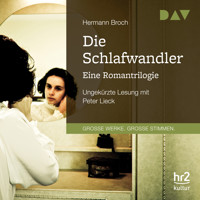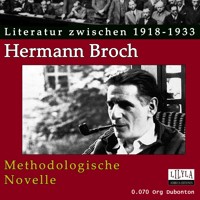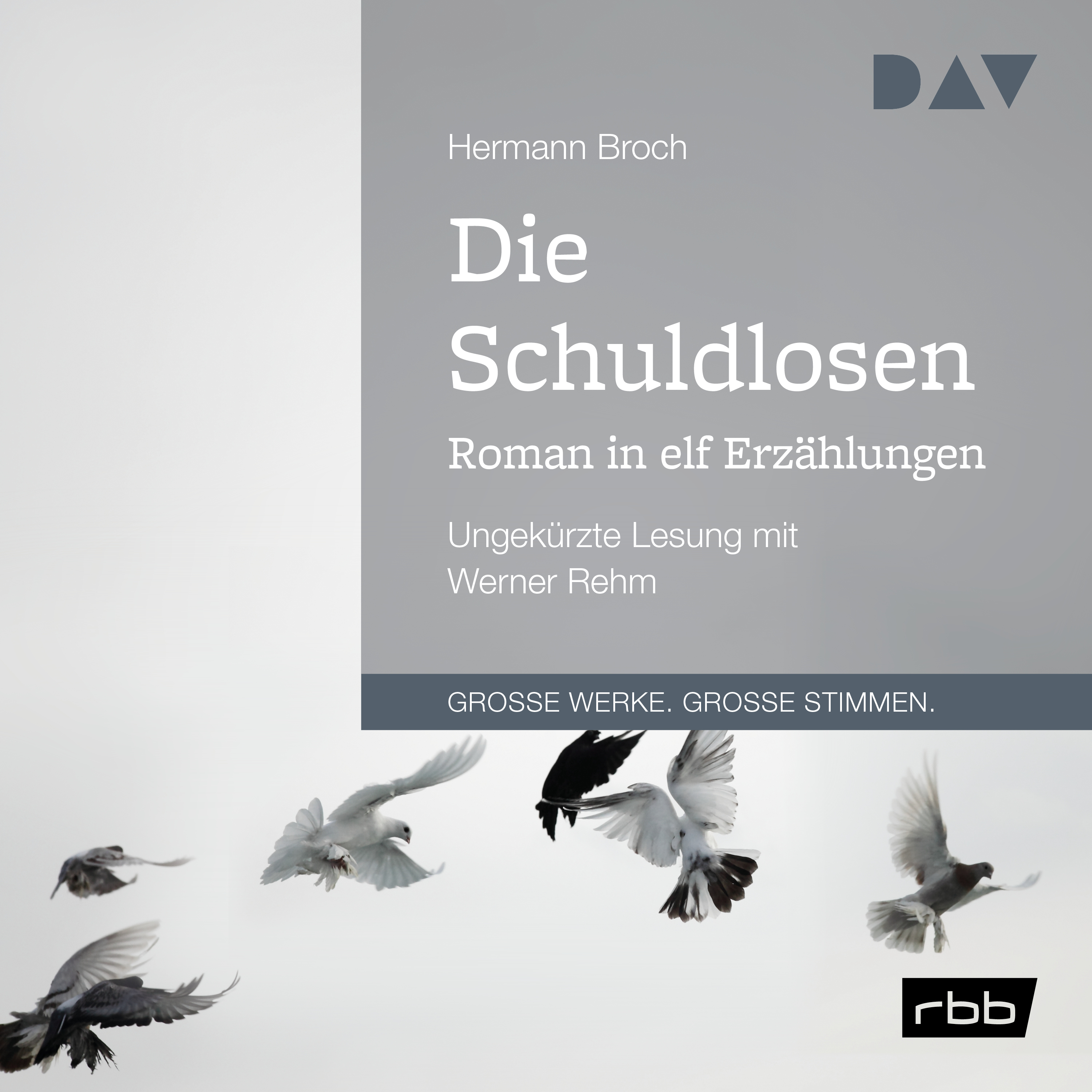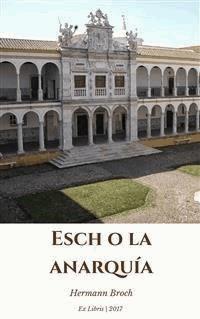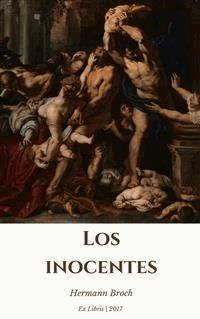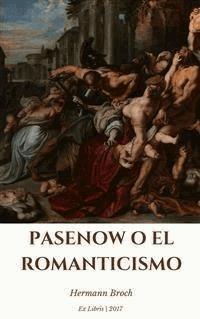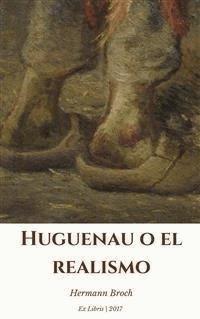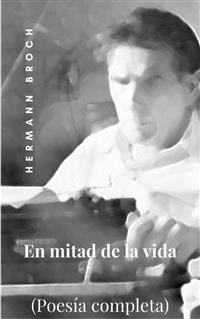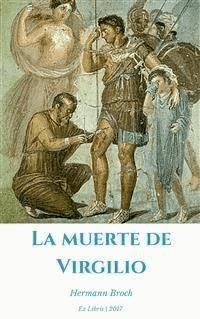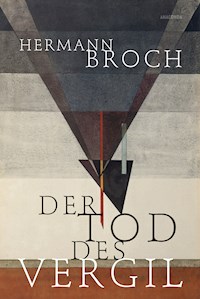
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der antike römische Dichter Vergil, Schöpfer der »Äneis«, durchlebt seine letzten Stunden auf Erden und darin noch einmal in höchster Intensität sein geistiges Ringen mit den Sinnfragen künstlerischer Existenz, das ihn zu letztgültigen Gedanken zu Literatur und Leben führt. Dieser im US-amerikanischen Exil geschriebene und 1945 erschienene Roman ist ein filigran gearbeitetes Epos über die Möglichkeiten und Grenzen der Kunst. Mit ihm hat der Österreicher Hermann Broch ein Monument der literarischen Moderne geschaffen, das in seinem gestalterischen Erfindungsreichtum seinesgleichen sucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 762
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hermann Broch
Der Tod des Vergil
Roman
Anaconda
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Wassily Kandinsky (1866–1944), »Descent« (1925), Private Collection, Foto © Lefevre Fine Art Ltd., London / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN 978-3-641-29230-0V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
I Wasser – Die Ankunft
II Feuer – Der Abstieg
III Erde – Die Erwartung
IV Äther – Die Heimkehr
In Memoriam Stephen Hudson
… fato profugus … VERGIL: AENEIS 1, 2
… Da iungere dextram,
da, genitor, teque amplexu ne subtrahe nostro.
Sic memorans largo fletu simul ora rigabat.
Ter conatus ibi collo dare bracchia circum,
ter frustra comprensa manus effugit imago,
par levibus ventis volucrique simillima somno.
VERGIL: AENEIS, VI, 697–702
Lo duca ed io per quel cammino ascoso
Entrammo a ritornar nel chiaro mondo;
E, senza cura aver d’alcun riposo,
Salimmo su, ei primo ed io secondo,
Tanto ch’io vidi delle cose belle
Che porta il ciel, per un pertugio tondo;
E quindi uscimmo a riveder le stelle.
DANTE: DIVINACOMMEDIA, INFERNO XXXIV, 133–139
Wasser – Die Ankunft
Stahlblau und leicht, bewegt von einem leisen, kaum merklichen Gegenwind, waren die Wellen des adriatischen Meeres dem kaiserlichen Geschwader entgegengeströmt, als dieses, die mählich anrückenden Flachhügel der kalabrischen Küste zur Linken, dem Hafen Brundisium zusteuerte, und jetzt, da die sonnige, dennoch so todesahnende Einsamkeit der See sich ins friedvoll Freudige menschlicher Tätigkeit wandelte, da die Fluten, sanft überglänzt von der Nähe menschlichen Seins und Hausens, sich mit vielerlei Schiffen bevölkerten, mit solchen, die gleicherweise dem Hafen zustrebten, mit solchen, die aus ihm ausgelaufen waren, jetzt, da die braunsegeligen Fischerboote bereits überall die kleinen Schutzmolen all der vielen Dörfer und Ansiedlungen längs der weißbespülten Ufer verließen, um zum abendlichen Fang auszuziehen, da war das Wasser beinahe spiegelglatt geworden; perlmuttern war darüber die Muschel des Himmels geöffnet, es wurde Abend, und man roch das Holzfeuer der Herdstätten, sooft die Töne des Lebens, ein Hämmern oder ein Ruf von dort hergeweht und herangetragen wurden.
Von den sieben hochbordigen Fahrzeugen, die in entwickelter Kiellinie einander folgten, gehörten bloß das erste und das letzte, beides schlanke, rammspornige Penteren, der Kriegsflotte an; die übrigen fünf, schwerfälliger und imposanter, zehnruderreihig, zwölfruderreihig, waren von der prunkvollen Bauart, die der augusteischen Hofhaltung ziemte, und das mittlere, prächtigste, goldglänzend sein bronzebeschlagener Bug, goldglänzend die ringtragenden Löwenköpfe unter der Reling, buntbewimpelt die Wanten, trug unter Purpursegeln feierlich und groß das Zelt des Cäsars. Doch auf dem unmittelbar hinterdrein folgenden Schiffe befand sich der Dichter der Äneis, und das Zeichen des Todes stand auf seine Stirne geschrieben.
Der Seekrankheit ausgeliefert, von ihrem ständig drohenden Ausbruch in Spannung gehalten, hatte er den ganzen Tag hindurch nicht gewagt sich zu rühren, indes, wenn auch gefesselt an sein Lager, das mittschiffs für ihn aufgeschlagen war, er fühlte nunmehr sich, oder richtiger seinen Körper und sein körperliches Leben, das er schon seit vielen Jahren kaum mehr als sein eigenes anzuerkennen vermochte, wie ein einziges nachtastendes, nachkostendes Erinnern an die Entspannung, von der er mit einem Male durchflutet gewesen, als die stillere Küstenzone erreicht worden war, und diese flutende, beruhigt beruhigende Müdigkeit wäre vielleicht eine geradezu vollkommene Beglückung geworden, hätte sich nicht, ungeachtet der heilsam kräftigen Meeresluft, neuerdings der plagende Husten eingestellt, die Erschlaffung durch das allabendliche Fieber, die allabendliche Beängstigung. So lag er da, er, der Dichter der Äneis, er, Publius Vergilius Maro, er lag da mit herabgemindertem Bewusstsein, beinahe beschämt ob seiner Hilflosigkeit, beinahe erbost ob solchen Schicksals, und er starrte in das perlmutterne Rund der Himmelsschale: warum nur hatte er dem Drängen des Augustus nachgegeben? Warum nur hatte er Athen verlassen? hingeschwunden war nun die Hoffnung, es werde der heilig heitere Himmel Homers hold die Fertigstellung der Äneis begünstigen, hingeschwunden jegliche Hoffnung auf das unermesslich Neue, das hernach hätte anheben sollen, die Hoffnung auf ein kunstabgewandtes, dichtungsfreies Leben der Philosophie und der Wissenschaft in der Stadt Platons, hingeschwunden die Hoffnung, das ionische Land je noch betreten zu dürfen, oh, hingeschwunden war die Hoffnung auf das Wunder der Erkenntnis und auf die Heilung in der Erkenntnis. Warum hatte er darauf verzichtet? Freiwillig? Nein! es war wie ein Befehl der unabweislichen Lebensgewalten gewesen, jener unabweislichen Schicksalsgewalten, die niemals völlig verschwinden, mögen sie auch zeitweise ins Unterirdische, Unsichtbare, Unerlauschbare tauchen, dennoch ungebrochen gegenwärtig als unerforschliche Drohung der Mächte, denen man sich niemals entziehen kann, denen man sich stets zu unterwerfen hat; es war das Schicksal. Er hatte sich vom Schicksal treiben lassen, und das Schicksal trieb ihn dem Ende zu. War dies nicht stets die Form seines Lebens gewesen? hatte er jemals anders gelebt? hatte ihm die perlmutterne Schale des Himmels, hatte ihm das lenzliche Meer, hatte ihm das Singen der Berge und das, was schmerzend in der Brust ihm sang, hatte der Flötenton des Gottes ihm je etwas anderes bedeutet als ein Geschehnis, das wie ein Gefäß der Sphären ihn bald aufnehmen sollte, um ihn ins Unendliche zu tragen? Ein Landmann war er von Geburt, einer, der den Frieden des irdischen Seins liebt, einer, dem ein schlichtes und gefestigtes Leben in der ländlichen Gemeinschaft getaugt hätte, einer, dem es seiner Abstammung nach beschieden gewesen wäre, bleiben zu dürfen, bleiben zu müssen, und den es, einem höheren Schicksal gemäß, von der Heimat nicht losgelassen, dennoch nicht in ihr belassen hatte; es hatte ihn hinausgetrieben, hinaus aus der Gemeinschaft, hinein in die nackteste, böseste, wildeste Einsamkeit des Menschengewühles, es hatte ihn weggejagt von der Einfachheit seines Ursprunges, gejagt ins Weite zu immer größer werdender Vielfalt, und wenn hierdurch irgendetwas größer oder weiter geworden war, so war es lediglich der Abstand vom eigentlichen Leben, denn wahrlich, der allein war gewachsen: bloß am Rande seiner Felder war er geschritten, bloß am Rande seines Lebens hatte er gelebt; er war zu einem Ruhelosen geworden, den Tod fliehend, den Tod suchend, das Werk suchend, das Werk fliehend, ein Liebender und dabei doch ein Gehetzter, ein Irrender durch die Leidenschaften des Innen und Außen, ein Gast seines Lebens. Und heute, fast am Ende seiner Kräfte, am Ende seiner Flucht, am Ende seiner Suche, da er sich durchgerungen hatte und abschiedsbereit geworden war, durchgerungen zur Bereitschaft und bereit, die letzte Einsamkeit auf sich zu nehmen, den innern Rückweg zu ihr anzutreten, da hatte das Schicksal mit seinen Gewalten sich nochmals seiner bemächtigt, hatte ihm nochmals die Einfachheit und den Ursprung und das Innen verwehrt, hatte den Rückweg ihm wieder abgebogen, verbogen zum Weg in die Vielfalt des Außen, hatte ihn rückgezwungen zu dem Übel, das sein ganzes Leben überschattet hatte, ja es war als hätte das Schicksal nur noch eine einzige Schlichtheit für ihn übrig – die Schlichtheit des Sterbens. Über ihm knarrten die Rahen in den Tauen, dazwischen dröhnte es weich in der Segelleinwand, er hörte das gleitende Schäumen des Kielwassers und den silbernen Guss, der mit jedem Herausheben der Ruder zu sprühen begann, er hörte deren schweres Kreischen in den Dollen und den klatschenden Wasserschnitt ihres Wiedereintauchens, er spürte den weich-gleichmäßigen Vorstoß des Schiffes im Takte der vielhundertfachen Rudermasse, er sah die weißbesäumte Strandlinie vorbeigleiten, und er gedachte der angeketteten stummen Knechtsleiber im stickig-zugigen, stinkenden, donnernden Schiffsrumpf. Der nämliche dumpf donnernde, silberumsprühte Rucktakt tönte von den beiden Nachbarschiffen herüber, von dem nächsten und übernächsten, einem Echo gleichend, das sich über alle Meere hin fortsetzte und von allen Meeren her beantwortet wurde, denn überall fuhren sie so, beladen mit Menschen, beladen mit Waffen, beladen mit Korn und Weizen, beladen mit Marmor, mit Öl, mit Wein, mit Spezereien, mit Seide, beladen mit Sklaven, allüberall die Schifffahrt, die tauscht und handelt, unter den vielen Verderbtheiten der Welt eine der ärgsten. Hier freilich wurden nicht Waren, sondern Fressbäuche befördert, die Leute des Hofstaates: das gesamte Hinterschiff bis zum Heck hin war für ihre Ernährung in Anspruch genommen, seit dem frühen Morgen erscholl es dort von Essgeräuschen, und immer noch umstanden Scharen von Esslustigen den Gastraum, lauernd, dass daselbst ein Triklinenplatz frei werde, gewärtig, sich im Kampfe mit Nebenbuhlern darauf zu stürzen, gierig, sich endlich selber hinzulegen, um ihrerseits mit dem Tafeln beginnen oder wiederbeginnen zu dürfen; die Aufwärter, leichtfüßige, elegant herausgeputzte Burschen, nicht wenig Hübschlinge unter ihnen, jetzt jedoch verschwitzt und zerhetzt, kamen nicht zu Atem, und ihr ewig lächelnder Vorsteher, mit dem kalten Blick in den Augenwinkeln und den höflich trinkgeldgeöffneten Händen, trieb sie dahin und dorthin, eilte selber deckauf und deckab, weil neben dem Betriebe des Gelages nicht minder für jene gesorgt werden musste, welche – wundersam genug – bereits gesättigt schienen und sich nun auf andere Weise vergnügten, manche umherwandelnd, die Hände vor dem Bauch oder hinter dem Gesäße gefaltet, manche hingegen mit weitausholenden Gesten diskutierend, manche auf ihren Ruhebetten schlummernd oder schnarchend, das Gesicht von der Toga bedeckt, manche beim Brettspiel sitzend, sie mussten unaufhörlich umsorgt und umhegt werden, mit kleinen Imbissen, welche die Decks entlang auf großen Silberplatten herumgereicht und ihnen angeboten wurden, bedacht auf einen Hunger, der sich jeden Augenblick frisch anmelden konnte, bedacht auf eine Fressgier, deren Ausdruck ihnen allen, den Wohlgenährten ebensosehr wie den Hageren, den Langsamen wie den Behänden, den Wandelnden wie den Sitzenden, den Wachenden wie den Schlafenden unverlöschbar und unverkennbar ins Gesicht eingezeichnet war, mitunter eingemeißelt, mitunter eingeknetet, scharf oder weich, bösartiger oder gutmütiger, wölfisch, fuchsig, katzig, papageiig, pferdig, haiig, immer aber einem grässlichen, irgendwie in sich beschlossenen Genusse zugekehrt, süchtig nach einem unstillbaren Haben, süchtig nach einem Schachern um Waren, Geld, Stellen und Ehren, süchtig nach der geschäftigen Untätigkeit des Besitzes. Überall gab es einen, der etwas in den Mund steckte, überall schwelte Begehrlichkeit, schwelte Habsucht, wurzellos, schlingbereit, allesverschlingend, ihr Brodem flackerte über das Deck hin, wurde im Rucktakte der Ruder mitbefördert, unentrinnbar, unabstellbar: das ganze Schiff war von Gier umflackert. Oh, sie verdienten es, einmal richtig dargestellt zu werden! Ein Gesang der Gier müsste ihnen gewidmet werden! Doch was sollte dies schon nützen?! nichts vermag der Dichter, keinem Übel vermag er abzuhelfen; er wird nur dann gehört, wenn er die Welt verherrlicht, nicht jedoch, wenn er sie darstellt, wie sie ist. Bloß die Lüge ist Ruhm, nicht die Erkenntnis! Und wäre es da denkbar, dass der Äneis eine andere, eine bessere Wirkung vergönnt sein sollte? Ach, man wird sie preisen, weil noch alles, was er geschrieben hatte, gepriesen worden war, weil auch aus ihr lediglich das Genehme herausgelesen werden wird, und weil weder die Gefahr noch die Aussicht bestand, dass Mahnungen gehört werden könnten; ach, es war ihm verwehrt, sich etwas vorzutäuschen oder vortäuschen zu lassen, nur allzu gut kannte er dieses Publikum, dem die schwere, die erkenntniserleidende und eigentliche Arbeit des Dichters genauso wenig Beachtung abringt wie die bitterniserfüllte, bitterschwere der Ruderknechte, dem die eine wie die andere genau das nämliche gilt: ein gebührender Tribut für den Nutznießer, als Tributgenuss empfangen und hingenommen! Dabei waren es keineswegs nur Schmarotzer, die da um ihn herumfaulenzten und schmatzten, mochte auch der Augustus so manche dieser Art in seiner Umgebung dulden müssen, nein, viele von ihnen hatten schon allerlei Verdienstliches und Ersprießliches geleistet, aber von dem, was sie sonst waren, hatten sie mit einer geradezu genießerischen Selbstentblößung während der Reiseuntätigkeit das meiste abgestreift, und ungebrochen war ihnen bloß ihr blinder Hochmut in dämmerhafter Gier, in giererfülltem Dahindämmern geblieben. Unten, in der Dämmerhaftigkeit des Unten, da arbeitete Schub um Schub, großartig, wild, viehisch, untermenschlich die gebändigte Rudermasse. Die dort unten verstanden ihn nicht und kümmerten sich nicht um ihn, die hier oben behaupteten, dass sie ihn verehrten, ja, sie glaubten es sogar, indes, wie immer dem auch war, gleichgültig ob sie aus geschmäcklicher Verlogenheit seine Werke zu lieben vermeinten, oder ob sie, nicht minder verlogen, ihm als Freund des Cäsars ihre Ergebenheit bekundeten, er, Publius Vergilius Maro, er hatte nichts mit ihnen gemein, obschon das Schicksal ihn in ihren Kreis getrieben hatte, sie ekelten ihn an, und hätte nicht, den Sonnenuntergang vorbegrüßend, die Küstenbrise zu wehen begonnen, hätte sie nicht den Stank des Gelages und der Küche vom Schiffe weggeblasen, es hätte die Seekrankheit ihn neuerlich angefallen. Er vergewisserte sich, dass der Koffer mit dem Manuskript der Äneis unberührt neben ihm stand, und in das tiefsinkende westliche Gestirn blinzelnd, zog er den Mantel bis unters Kinn; er fror.
Von Zeit zu Zeit lüstete es ihn, sich doch nach der lärmenden Menschenhorde da hinten umzuwenden, beinah neugierig, was sie noch alles treiben würden; allein er tat es nicht, und es war besser es nicht zu tun, ja es deuchte ihm mehr und mehr, dass solche Umwendung geradezu verboten wäre.
So lag er ruhig. Die erste Vordämmerung überspannte klar den Himmel, überspannte zart die Welt, als man bei Brundisiums schmaler, flussartiger Einfahrt anlangte; kühler, doch auch milder war es geworden, der Salzhauch mischte sich mit der satteren Luft des Landes, in dessen Kanal die Schiffe, eines nach dem andern die Fahrgeschwindigkeit verlangsamend, nun eindrangen. Eisengrau, bleifarben wurde das poseidonische Element, von keiner Welle mehr gekräuselt. Auf den Zinnen der Kastelle links und rechts des Kanales waren dem Cäsar zu Ehren Truppen der Besatzung aufgestellt, vielleicht auch als erster Geburtstagsgruß, denn zum Wiegenfeste kehrte der Octavianus Augustus heim; in zwei Tagen, ja wahrhaftig, schon am übernächsten Tage sollte es in Rom gefeiert werden, und dreiundvierzig Jahre wurde nun der Octavian, der dort vorne fuhr. Raukehlig flogen die Heilrufe der Mannschaften von den Ufern auf, die Fahnenträger an den Flügeln der Manipeln stießen zu den Rufen knapp und gedrillt das rote Vexillum hoch, um es hernach vor dem Herrscher zu senken, schräg die Stange gegen den Boden gehalten, kurzum, was hier stattfand, war die kräftig nüchterne Begrüßungsveranstaltung, wie sie das Militärreglement vorschrieb, reglement-richtig in ihrer soldatischen Rauheit, und sie war trotz alledem merkwürdig sanft, merkwürdig abendhaft; fast hätte man es als verträumt bezeichnen können, so sehr und so überaus klein verflatterten die Rufe in der Größe des Lichtes, so sehr und so überaus herbstlich verwelkte das Fahnenrot, überschattet von dem zum Grau abglühenden Firmamente. Größer als die Erde ist das Licht, größer als der Mensch ist die Erde, und nimmermehr vermag der Mensch zu bestehen, insolange er nicht heimatwärts atmet, heimkehrend zur Erde, irdisch heimkehrend zum Lichte, auf der Erde irdisch das Licht empfangend, nur durch sie vom Lichte empfangen, Erde, die zum Lichte wird. Und niemals ist die Erde von innigerer Lichtnähe, das Licht von vertrauterer Erdnähe als in der anhebenden Dämmerung der beiden Nachtgrenzen. Noch schlummerte die Nacht in den Tiefen der Gewässer, aber mit winzig lautlosen Wellen begann sie emporzusickern, überall im Spiegel des Meeres, ununterscheidbar das Oben und Unten, tauchten die sammetstummen Wellen des Nachthintergrundes auf, die Wellen der zweiten Unendlichkeit, der gebärend sprießenden Überunendlichkeit, und sachte begannen sie das Glitzernde mit Stille zu überhauchen. Das Licht kam nicht mehr von oben, es hing in sich selber, und in sich selber hängend leuchtete es zwar noch, aber es beleuchtete nichts mehr, sodass auch die Landschaft, über der es hing, auf ein seltsames Eigenlicht beschränkt schien. Grillengezirpe, myriadenhaft, dennoch in einem einzigen anhaltenden Ton, durchdringend, dennoch still vor Gleichmäßigkeit, weder anschwellend, noch abschwellend, erfüllte mit seinem Schwirren das dämmernde Land; endlos. Unterhalb der Befestigungen, herab bis zum steinigen Ufer, waren die Hänge mit spärlichem Gras bewachsen, und so karg dieses auch war, das Sprießende war Frieden, war Nachtstille, war Wurzeldunkelheit, war Dunkel der Erde, ausgebreitet unter dem scheidenden Licht. Dann wurde der Bestand zusammenhängender und pflanzenreicher, voller in der Farbe, und sehr bald war auch Buschwerk darein eingesprengt, während auf den Hügelkuppen, droben zwischen bäuerlichen Steinwallgevierten, sich die ersten Ölbäume zeigten, grau wie das hauchdünne Nebelgestrahle der dichter werdenden Dämmerung. Oh, unbändig wurde da der Wunsch, die Hand nach diesen, ach so sehr entfernten Ufern auszustrecken, in die Dunkelheit der Gebüsche zu greifen, das erdentsprossene Laub zwischen den Fingern zu spüren, es festzuhalten für immerdar –, der Wunsch zuckte in seinen Händen, zuckte in den Fingern vor unzügelbarem Begehren nach dem grünen Blattwerk, nach den geschmeidigen Blattstängeln, nach den scharf-milden Blatträndern, nach dem harten lebendigen Blattfleisch, er spürte es sehnend, wenn er die Augen schloss, und es war eine geradezu sinnliche Sehnsucht, sinnlich einfältig und zupackend wie die männliche Grobknochigkeit seiner Bauernfaust, sinnlich auskostend und empfindungsreich wie deren schmalfesselige, beinahe weibliche Feinnervigkeit; oh, Gras, oh, Laub, oh, Rindenglätte und Rindenrauheit, Lebendigkeit des Sprießens, vielfältige, in sich verzweigte und körperlich gewordene Erddunkelheit! oh, Hand, fühlende, tastende, aufnehmende, einschließende Hand, oh, Finger und Fingerspitze, rau und zart und weich, lebendige Haut, oberste Oberfläche der Seelendunkelheit, aufgeschlossen in den erhobenen Händen! Stets hatte er dieses seltsame, beinahe vulkanische Pulsieren in seinen Händen gespürt, stets hatte ihn Ahnung um ein seltsames Eigenleben seiner Hände begleitet, eine Ahnung, der es ein für alle Mal verboten war, die Schwelle des Wissens zu überschreiten, gleichsam als lauerte trübe Gefahr in solchem Wissen, und wenn er seiner Gewohnheit gemäß, wie er es auch jetzt tat, an dem Siegelring drehte, der feingearbeitet und fast ein wenig unmännlich ob solcher Feinarbeit auf dem Finger seiner Rechten saß, so war es als könnte er damit jene trübe Gefahr bannen, als könnte er damit die Sehnsucht der Hände beschwichtigen, als könnte er sie damit zu einer Art Selbstzügelung bringen, abdämpfend ihre Angst, die sehnsüchtige Angst von Bauernhänden, die nie mehr den Pflug, nie mehr das Saatgut fassen durften und daher das Unfassbare zu fassen gelernt hatten, die ahnende Angst von Händen, deren Formwillen, beraubt der Erde, nichts geblieben war als ihr Eigenleben, im unerfasslichen All, gefährdet und gefährdend, so tief ins Nichts greifend und von seiner Gefährlichkeit ergriffen, dass die Angstahnung, gewissermaßen über sich selber gehoben, zu einem übermächtigen Bemühen wurde, zum Bemühen, die Einheit des menschlichen Lebens festzuhalten, die Einheit menschlicher Sehnsucht zu bewahren, um solcherweise ihren Zerfall in eine Vielfalt einzelhaft sehnsuchtskleiner und kleinsehnsüchtiger Teilleben zu verhüten, denn unzureichend ist die Sehnsucht der Hände, unzureichend ist die Sehnsucht des Auges, unzureichend ist die Sehnsucht des Hörens, denn zureichend allein ist die Sehnsucht des Herzens und des Denkens in ihrer Gemeinsamkeit, die sehnsüchtige Ganzheit des unendlichen Innen und Außen, schauend, lauschend, erfassend, atmend in doppelveratmeter Einheit, denn ihr allein ist es vergönnt, die trüb hoffnungslose Blindheit angstvoller Vereinzelung zu überwinden, allein in ihr begibt sich die zweifache Entfaltung aus den Erkenntniswurzeln des Seins, und dies ahnte er, dies hatte er stets geahnt – oh, Sehnsucht desjenigen, der immer nur Gast ist, immer nur Gast sein darf, oh, Sehnsucht des Menschen –, dies war sein ahnendes Lauschen, sein ahnendes Atmen, sein ahnendes Denken stets gewesen, einverlauscht, einveratmet, eingedacht in das flutende Licht des Alls, in das unerreichbare Wissen um das All, in die niemals vollendbare Annäherung an des Alls Unendlichkeit, unerreichbar sogar ihr äußerster Saum, sodass die sehnsüchtig begehrende Hand nicht einmal an diesen zu rühren wagt. Doch Annäherung war es trotzdem, Annäherung blieb es, und atmendes, wartendes Lauschen blieb sein Denken, lauschend in den zwiefachen Abgrund der poseidonischen und vulkanischen Sphären, vereinigt sie beide, weil sie gemeinsam von Jupiters Himmel überwölbt sind. Aufgetan und gleitend war das Dämmerlicht, war das Atembare, so gleitend wie das Flutende, in das die Kiele tauchten, flüssiges Bad des Innen und Außen, flüssiges Bad der Seele, das Atembare fließend aus dem Diesseitigen ins Jenseitige, aus dem Jenseitigen ins Diesseitige, enthüllte Pforte des Wissens, nimmermehr dieses selber, dennoch schon Wissensahnung, Ahnung um den Eingang, Ahnung um den Weg, dämmernde Ahnung dämmerhafter Fahrt. Vorne am Bug sang ein Musikantensklave; vermutlich hatte die dort versammelte Gesellschaft, deren Lärm von der Stille des Abends aufgesogen war, den Knaben zu sich beschieden, heimkehrahnend selbst sie, und nach einer kurzen Pause für das Stimmen der Leier sowie nach einem kurzen, kunstgerechten Zuwarten war es aufgeklungen, wurde es herbeigeweht, das namenlose Lied des namenlosen Knaben, mild strahlend das Lied, hauchschwebend wie die Farben eines Regenbogens im Nachthimmel, mild strahlend das Saitenspiel, elfenbeinzart, Menschenwerk das Lied, Menschenwerk das Saitenspiel, aber über den menschlichen Ursprung hinaus menschenentfernt, menschenentlöst, leidenentlöst, Sphärenluft, die sich selber singt. Es wurde dunkler, die Gesichter wurden undeutlicher, die Ufer verblassten, das Schiff wurde undeutlicher, lediglich die Stimme blieb, sie wurde klarer und beherrschender, als wollte sie das Schiff und den Takt seiner Ruder lenken, vergessen der Ursprung der Stimme und trotzdem lenkende Stimme eines Sklavenknaben; wegweisend war das Lied, ruhend in sich selbst und eben darum wegweisend, eben darum ewigkeitsgeöffnet, denn nur das Ruhende ist zur Wegweisung imstande, nur das Einmalige, das aus dem Fluss der Dinge herausgegriffen, nein, herausgerettet ist, öffnet sich zur Unendlichkeit, nur das Festgehaltene – ach, war ihm selber jemals solch wahrhaft wegweisende Festhaltung gelungen? – nur das wahrhaft Festgehaltene, und sei es nur ein einziger Augenblick aus dem Meere der Jahrmillionen, wird zur zeitlosen Dauer, wird zum richtunggebenden Gesang, wird Führerschaft; oh, ein einziger Lebensaugenblick, geweitet zur Ganzheit, geweitet zum Kreise des Ganzheiterkennens, unendlichkeitsgeöffnet; hoch über dem strahlenden Liede, hoch über der strahlenden Dämmerung atmete der Himmel, dessen klarherbe Herbstessüße seit Jahrhunderttausenden sich unverändert wiederholt hatte und noch Jahrhunderttausende unverändert sich wiederholen wird, einmalig trotzdem in seinem Hier und Jetzt, und seiner Kuppel heller Seidenglanz war von der Stille der anbrechenden Nacht überhaucht.
Das Lied führte, allerdings nicht mehr sehr lange; die Fahrt zwischen den Ufern des Eingangskanals war bald zu Ende, und das Lied erlosch in der allgemeinen Unruhe, die sich an Bord entwickelte, als sich die innere Hafenbucht auftat, schwarzglänzend schon ihr bleierner Spiegel, und die im Fächerhalbkreis um das Becken gelagerte Stadt mit ihrer Lichtermenge, im Dämmernebel sternhimmelgleich schimmernd, sichtbar wurde. Jäh war es warm geworden. Das Geschwader hielt an, um das Schiff des Cäsars an die Spitze zu lassen, und nun – auch dieses Geschehen unter der weichen Unabänderlichkeit des Herbsthimmels hätte als unendliche Einmaligkeit festgehalten werden müssen – begann ein vorsichtiges Manövrieren, um ohne Fährlichkeit zwischen den allseits verankerten Booten, Seglern, Fischkuttern, Tartanen und Transportschiffen sich hindurchzulotsen; je weiter man kam, desto schmäler wurde die freie Fahrrinne, desto gedrängter die Masse der Schiffsleiber ringsum, desto dichter das Gewirr der Maste und der Taue und der gerefften Segel, tot in ihrer Starrheit, lebendig in ihrer Ruhe, ein sonderbar finsteres, verkreuztes und verworrenes Wurzelwerk, das düster aus der glänzenden ölig-dunklen Wasserfläche emporwuchs zu des Himmels unbewegter Abendhelle, ein schwarzes Spinnengewebe aus Holz und Hanf, gespenstisch sich in den Wassern unten spiegelnd, gespenstisch oben durchzuckt von dem wilden Geflacker der zum Willkomm allerwärts auf den Verdecken johlend geschwungenen Fackeln, gespenstisch durchleuchtet von dem Lichterprunk auf dem Hafenplatze: in der Reihe der Hafenhäuser war Fenster um Fenster erleuchtet, bis hinauf zu den Dachgeschossen, erleuchtet war eine Osteria neben der andern unter den Kolonnaden, quer über den Platz zog sich ein fackeltragendes Doppelspalier von Soldaten, funkelnd die Helme, Mann an Mann, welche offenbar den Weg von der Landungsstelle in die Stadt freizuhalten hatten, fackelbeleuchtet waren die Zollschuppen und Zollämter an den Molen, es war ein funkelnder Riesenraum, vollgestopft mit Menschenleibern, ein funkelnder Riesenbehälter für ein ebenso gewaltiges wie gewalttätiges Warten, erfüllt von einem Rauschen, das Hunderttausende von Füßen schleifend, schlurfend, tretend, scharrend auf dem Steinpflaster erzeugten, eine brodelnde Riesenarena, erfüllt von einem auf- und abschwellenden schwarzen Summen, von einem Tosen der Ungeduld, das aber plötzlich verstummte und in Spannung erstarrte, als das Kaiserschiff, nur noch von einem Dutzend Ruder getrieben, mit sanfter Wendung den Kai erreichte und an der vorbestimmten Stelle – dort erwartet von den Stadtwürdenträgern in der Mitte des militärischen Fackelkarrees – beinahe lautlos anlegte; da freilich war der Augenblick gekommen, den das dumpf brütende Massentier erwartet hatte, um sein Jubelgeheul ausstoßen zu können, und da brach es los, ohne Pause und ohne Ende, sieghaft, erschütternd, ungezügelt, furchteinflößend, großartig, geduckt, sich selbst anbetend in der Person des Einen.
Dies also war die Masse, für die der Cäsar lebte, für die das Imperium geschaffen worden war, für die Gallien hatte erobert werden müssen, für die das Partherreich besiegt, Germanien bekämpft wurde, dies war die Masse, für die des Augustus großer Frieden geschaffen wurde und die für solches Friedenswerk wieder zu staatlicher Zucht und Ordnung gebracht werden sollte, zum Glauben an die Götter und zur göttlich-menschlichen Sittlichkeit. Und dies war die Masse, ohne die keine Politik betrieben werden konnte und auf die auch der Augustus sich stützen musste, soferne er sich zu behaupten wünschte; und natürlich hatte der Augustus keinen andern Wunsch. Ja, und dies war das Volk, das römische Volk, dessen Geist und dessen Ehre er, Publius Vergilius Maro, er, ein echter Bauernsohn aus Andes bei Mantua, zwar nicht geschildert, wohl aber zu verherrlichen versucht hatte! Verherrlicht und nicht geschildert, das war der Fehler gewesen, oh, und dies hier waren die Italer der Äneis! Unheil, ein Schwall von Unheil, ein ungeheurer Schwall unsäglichen, unaussprechbaren, unerfasslichen Unheils brodelte in dem Behälter des Platzes, fünfzigtausend, hunderttausend Münder brüllten das Unheil aus sich heraus, brüllten es einander zu, ohne es zu hören, ohne um das Unheil zu wissen, dennoch gewillt, es in höllischem Gebrüll, in Lärm und Geschrei zu ersticken und zu übertäuben; welch ein Geburtstagsgruß! Wusste bloß er allein darum? Steinschwer die Erde, bleischwer die Flut, und hier war der Dämonenkrater des Unheils, aufgerissen von Vulcanus selber, ein Lärmkrater am Rande des poseidonischen Bereiches. Wusste der Augustus nicht, dass dies keine Geburtstagsbegrüßung war, sondern etwas ganz anderes? Ein Gefühl gequältesten Mitleides stieg in ihm auf, eines Mitleides, das ebensowohl dem Octavianus Augustus wie den Menschenmassen hier galt, ebensowohl dem Herrscher wie den Beherrschten, und es war von dem Gefühl einer nicht minder gequälten und eigentlich unerträglichen Verantwortung begleitet, über die er sich kaum Rechenschaft geben konnte, nur noch gerade wissend, dass sie mit einer Last, wie sie der Cäsar auf sich genommen hatte, wenig Ähnlichkeit aufwies, vielmehr eine Verantwortung ganz anderer Art war, denn unerreichbar jeder staatlichen Maßnahme, unerreichbar jeder noch so großen irdischen Gewalt, vielleicht sogar den Göttern unerreichbar war dieses dämmerig brodelnde, unbekannt geheimnisvolle Unheil, und keinerlei Massengeschrei vermochte es zu übertäuben, eher noch die schwache Seelenstimme, welche Gesang heißt und mit des Unheils Ahnung doch auch schon das erweckende Heil verkündet, erkenntnisahnend, erkenntnisträchtig, erkenntnisweisend jedes wahre Lied. Die Verantwortung des Sängers, seine Erkenntnisverantwortung, die zu tragen und zu erfüllen er trotzdem für ewig unfähig bleibt –, oh, warum war es ihm nicht erlaubt gewesen, über die Ahnung hinaus vorzudringen hin zum echten Wissen, von dem allein das Heil zu erwarten sein wird?! Warum hatte ihn das Schicksal gezwungen, hierher zurückzukehren?! Hier war nichts als Tod, nichts als Tod und Abertod! Mit entsetzensvoll geöffneten Augen hatte er sich halb aufgerichtet, jetzt fiel er auf das Lager zurück, übermannt von Grauen, von Mitleid, von Jammer, von Verantwortungswillen, von Hilflosigkeit, von Schwäche; nicht Hass war es, was er gegen die Masse empfand, nicht einmal Verachtung, nicht einmal Abneigung, so wenig wie eh und je wollte er sich vom Volke absondern oder gar sich über das Volk erheben, aber es war etwas Neues in Erscheinung getreten, etwas, das er bei all seiner Berührung mit dem Volke niemals hatte zur Kenntnis nehmen wollen, obwohl überall, wo er gewesen, gleichgültig ob in Neapel oder in Rom oder in Athen, mehr als genug Gelegenheit hierzu gegeben war, und das sich nun hier in Brundisium überraschend aufdrängte, nämlich des Volkes Unheilsabgründigkeit in ihrem ganzen Umfang, des Menschen Absinken zum Großstadtpöbel und damit die Verkehrung des Menschen ins Gegenmenschliche, bewirkt durch die Aushöhlung des Seins, durch des Seins Verwandlung zum bloßen Gierleben der Oberfläche, verlustig seines Wurzelursprunges und von diesem abgeschnitten, sodass nichts anderes mehr als das gefährlich abgelöste Eigenleben eines trüben schieren Außen vorhanden bleibt, unheilschwanger, todesschwanger, oh, schwanger eines geheimnisvoll höllischen Endes. War es dies, was das Schicksal ihn hatte lehren wollen, da er zurückgezwungen worden war in die Vielfalt, zurück in den Kessel grausam aufgewühlter Diesseitigkeit? war dies die Rache für seine frühere Blindheit? niemals hatte er das Massenunheil in solcher Unmittelbarkeit erfahren; jetzt war er gezwungen, es zu sehen, es zu hören, bis in die letzten Wurzelgründe seines eigenen Seins zu erfahren, denn die Blindheit ist selber ein Teil des Unheils. Wieder und immer wieder erscholl das unfrohe Jubelgebrüll der Selbstbetäubung; Fackeln wurden geschwungen, Befehle durchhallten das Schiff, dumpf flog ein vom Lande hergeschleudertes Tau auf die Deckplanken, und das Unheil lärmte, und die Qual lärmte, und der Tod lärmte, es lärmte das unheilsträchtige Geheimnis, unentdeckbar, dennoch unverhüllt überall gegenwärtig. Inmitten des Getrappels vieler eiliger Füße lag er still, seine Hand hielt den einen Henkel des ledernen Manuskriptkoffers fest umklammert, damit ihm dieser nicht etwa entrissen werde, doch müde des Lärmes, müde des Fiebers wie des Hustens, müde der Reise, müde des Kommenden, stellte er sich vor, dass diese Ankunftsstunde leichtlich auch zu seiner Sterbestunde werden könnte, und fast war es ein Wunsch, obwohl oder weil er genau spürte, dass die Zeit hierfür noch nicht gekommen war, ja, fast war es Wunsch, obwohl oder weil es ein verwunderlich verwildertes, verwunderlich lärmendes Sterben gewesen wäre, es erschien ihm nicht unannehmbar und eben fast wünschenswert, denn gezwungen in die Feuerhölle zu schauen, gezwungen sie zu hören, wurde sein Herz zum Wissen um das unterweltlich Schwelende des Untermenschlichen gezwungen.
Nun, so verlockend es gewesen wäre, sich schwindenden Sinnes davontragen zu lassen, um sich so dem Gelärm zu entziehen, sich dem Gejohle der Menge zu verschließen, dem vulkanischen und unterirdischen, das ohne Unterlass, als wollte es nimmer enden, trägwellig über den Platz herflutete, es war solche Flucht verboten, geschweige denn dass sie bis ins Sterben führen durfte, denn überstark war das Geheiß, jedes kleinste Teilchen der Zeit, jedes kleinste Teilchen des Geschehens festzuhalten und der Erinnerung einzuverleiben, als könnte es mit dieser durch alle Tode hindurch für alle Zeiten aufbewahrt werden; er klammerte sich an das Bewusstsein, er klammerte sich daran mit der Kraft desjenigen, der das Bedeutsamste seines irdischen Lebens nahen fühlt und voller Angst ist, dass er es versäumen könnte, und das Bewusstsein, wachgehalten von der wachen Angst, gehorchte seinem Willen: nichts entging ihm, weder die vorsorglichen Gesten und der leere Zuspruch des glattgesichtig-jungen, überaus geschniegelten Hilfsarztes, der auf Befehl des Augustus nun an seiner Seite war, noch die stur befremdeten Gesichter der Träger, die eine Sänfte an Bord gebracht hatten, um ihn, den Kranken und Kraftlosen, wie eine gebrechliche und vornehme Ware abzuholen; er vermerkte alles, er musste alles festhalten, er vermerkte den eingekerkerten Blick ihrer Augen, er vermerkte die mürrischen Knurrtöne, mit denen die vier Männer sich verständigten, als sie die Last auf die Schultern hoben, er vermerkte den angriffswilden, bösartigen Schweißgeruch ihrer Körper, aber es entging ihm auch nicht, dass sein Mantel liegen geblieben war und von einem recht kindlich aussehenden, dunkellockigen Knaben, der raschen Zusprunges das Kleidungsstück aufgerafft hatte, ihm nun nachgetragen wurde. Freilich war der Mantel weniger wichtig als der Manuskriptkoffer, dessen beide Träger er knapp neben die Sänfte beordert hatte, indes, ein kleines Stück der Wachsamkeit, zu der er sich, gegen alle eindämmerungssüchtigen Müdigkeitsanwandlungen, verpflichtet fühlte und selbst verpflichtete, konnte auch dem Mantel zugutekommen, und er fragte sich, woher der Knabe, der ihm verwunderlich vertraut und bekannt dünkte, wohl aufgetaucht sein mochte, da er ihm während der ganzen Reise nicht aufgefallen war: es war ein etwas unhübscher, bäuerisch tapsiger Bursche, sicherlich kein Sklave, sicherlich keiner der Aufwärter, und wie er dort, sehr jungenhaft, die hellen Augen in dem bräunlichen Gesicht, an der Reling stand, wartend, weil es überall Stauungen gab, warf er von Zeit zu Zeit verstohlen einen Blick zur Sänfte herauf, sanft und belustigt und schüchtern wegschauend, sobald er sich hierbei beobachtet fühlte. Augenspiel? Liebesspiel? sollte er, ein Kranker, da nochmals in das schmerzliche Spiel töricht lieblichen Lebens hineingezogen werden, er, ein Hingestreckter, nochmals hineingezogen in das Spiel der Aufgerichteten? oh, in ihrer Aufgerichtetheit wissen sie nicht, wie sehr der Tod ihren Augen und ihren Gesichtern einverwoben ist, sie lehnen es ab, dies zu wissen, sie wollen nur das Spiel ihrer Anlockungen und ihres Ineinanderverstrickens weiter spielen, das Spiel ihres Vor-Kusses, töricht-lieblich Auge ins Auge gesenkt, und sie wissen nicht, dass alles Hinliegen zur Liebe stets auch ein Hinliegen zum Tode ist; aber der unabänderlich Hingestreckte weiß darum, und fast schämt er sich, einstmals selber aufgerichtet einhergeschritten zu sein, einstmals selber – wann war es? war es vor unvordenklichen Zeiten, war es erst vor Monaten? – an dem lieblich dämmerigen, lieblich blinden Lebensspiele teilgenommen zu haben, ja, und fast ist ihm die Verachtung, mit der ihn die Spielverstrickten bedenken, weil er nunmehr ausgeschlossen ist und hilflos daliegt, fast ist sie ihm wie ein Lob. Denn nicht süße Verlockung ist die Wahrheit des Auges, nein, erst mit seinen Tränen wird es sehend, erst im Leide wird es zum sehenden Auge, erst mit seinen eigenen Tränen wird es von denen der Welt erfüllt, wahrheitserfüllt vom Vergessenheits-Nass allen Seins! Oh, erst im Erwachen unter Tränen wird das Diesseits-Sterben, in dem die Spielverstrickten sich befinden und an dem sie hängen, zum todeserschauenden, alles-erschauenden Leben. Und eben darum sollte auch der Knabe – wessen Züge trug er doch? waren es die einer unvordenklichen oder einer jüngsten Vergangenheit? –, ebendarum sollte er lieber den Blick abwenden und nicht ein Spiel fortsetzen wollen, das als Zeitvertreib nicht mehr an der Zeit war; allzu unstimmig war es, dass dieser Blick über die eigene Todesverwobenheit hinwegzulächeln vermochte, allzu unstimmig war es, dass er zu einem Hingestreckten heraufgesandt wurde, dessen Auge nicht mehr Antwort geben konnte, ach, nicht mehr geben wollte, allzu unstimmig war das Törichte, das Liebliche, das Schmerzliche inmitten einer Lärm- und Feuerhölle, die von blindem Getriebe starrte, menschdurchhetzt, menschheitserschlafft. Drei Brücken waren vom Schiff zum Kai hinüber gelegt worden, die heckseitige den Fahrgästen vorbehalten, freilich das plötzlich ungeduldig gewordene Gedränge bei weitem nicht aufnehmend, hingegen die zwei anderen für die Waren- und Gepäckentladung bestimmt, und während die hierzu befohlenen Sklaven in langer Schlangenreihe, oftmals wie Hunde paarweise mit Halsringen und Verbindungsketten aneinandergekoppelt, vielfarbenes Volk entwürdigten Blickes, menschlich noch und doch nicht mehr menschlich, nur noch bewegte und gehetzte Kreatürlichkeit, Gestalten in Hemdfetzen oder halbnackt, schweißglänzend im rohen Fackelscheine, oh, entsetzlich, oh, grässlich, während sie so auf dem mittleren Stege an Bord liefen, um auf dem bugseitigen das Schiff wieder zu verlassen, den Leib unter der Last der Kisten, Säcke und Koffer nahezu rechtwinklig abgebogen, während all das geschah, schwangen die beaufsichtigenden Schiffsmeister, von denen je einer an den Kopfenden der beiden Planken stand, auf gut Glück die kurze Geißel über die vorbeiziehenden Leiber, ohne Wahl und einfach drauflos, hinschlagend mit der sinnlosen, kaum mehr grausamen Grausamkeit uneingeschränkter Macht, bar jedes eigentlichen Zweckes, da die Leute ohnehin hasteten, was ihre Lungen hergaben, kaum mehr wissend, wie ihnen geschah, ja sich nicht einmal mehr duckten, wenn der Riemen aufklatschte, sondern eher noch dazu grinsten; ein kleiner schwarzer Syrer, den es beim Erreichen des Decks gerade getroffen, stopfte gleichmütig und des Striemens auf seinem Rücken nicht achtend, die Lappen zurecht, die er dem Halsring unterlegt hatte, damit es ihm die Schlüsselbeine möglichst wenig aufscheuere, und er feixte bloß, feixte auf zu der emporgehobenen Sänfte: »Komm mal runter, großer König, komm runter, kannst auch mal versuchen, wie’s unsereinem schmeckt!« –, ein nochmaliges Ausholen der Geißel war die Antwort, indes da hatte der Kleine, derselben schon gewärtig, einen flinken Satz getan, die Verbindungskette straffte sich jäh, und der Schlag sauste auf die Achsel des durch den Ruck vorwärtsgerissenen Kettengenossen, eines stämmigen, rothaarig filzbärtigen Parthers, der gleichsam erstaunt den Kopf drehte und auf der zugewandten Gesichtshälfte inmitten missfarbenen Narbengewirres, er war wohl ein Kriegsgefangener, rot und blutig und starrend ein ausgeschossenes, ausgerissenes, ausgestochenes Auge zeigte, starrend und bei aller Blindheit richtig überrascht, denn bevor er noch von der vorwärtsdrängenden, kettenklirrenden Reihe weitergestoßen worden war, hatte es ihm, offenbar weil es schon in einem abging, nochmals um den Kopf gepfiffen und ihm das Ohr mit einem blutigen Schnitt gespalten. Dies alles hatte nur einen kurzen Herzschlag lang gedauert, nichtsdestoweniger lang genug, um den Herzschlag aussetzen zu lassen: schmachvoll war es, hinzublicken und nicht den leisesten Versuch eines Eingreifens zu unternehmen, unfähig und vielleicht sogar unwillig zu solchem Eingreifen, schmachvoll war es selbst noch dieses Geschehen festhalten zu wollen, schmachvoll eine Erinnerung, in die selbst dieses noch für ewig eingeschrieben werden sollte! Erinnerungslos hatte der kleine Syrer gefeixt, erinnerungslos, als gäbe es nichts als eine verwüstete, vergewaltigte Gegenwart, ohne Zukunft und daher auch ohne Vergangenheit, ohne Nachher und darum auch ohne Vorher, als wären die beiden Verketteten niemals Knaben gewesen, spielend in den Gefilden der Jugend, als gäbe es in ihrer Heimat keine Berge, keine Matten, keine Blumen und nicht einmal einen Bach, der des Abends im fernen Tal lauscht und rauscht –, oh, schmachvoll war es, der eigenen Erinnerung nachzuhängen, sich um sie zu bemühen und sie zu pflegen! Oh, Erinnerung, unverlierbare, Erinnerung voll des Weizengewoges, voll der Felder, voll des knisternd rauschenden, kühlwandigen Waldes, voll der Jugendhaine, augentrunken am Morgen, herzenstrunken am Abend, aufzitterndes Grün und verzitterndes Grau, oh, Wissen um die Herkunft und um die Rückkehr, Gepränge der Erinnerung! Doch gegeißelt der Besiegte, jubelbrüllend der Sieger, steinern der Raum, in dem es geschieht, brennend das Auge, brennend die Blindheit –, für welch unauffindbares Sein galt es da noch sich wach zu erhalten? für welche Zukunft galt da noch das unsägliche Bemühen um Erinnerung? in welche Zukunft sollte Erinnerung da noch eingehen? gab es da überhaupt noch Zukunft?
Die Brückenplanken wippten steif, als die Sänfte im gemessenen Gleichschritt der Träger darüber hin befördert wurde; unten schwappte bedächtig das schwarze Wasser, eingeengt zwischen dem schwarzen schweren Schiffskörper und der schwarzen schweren Kaimauer, das schwerflüssige glatte Element, sich selbst ausatmend, Unrat ausatmend, Abfälle und Gemüseblätter und verfaulte Melonen, alles was da unten herumsuppte, schlaffe Wellen eines schweren süßlichen Todeshauches, Wellen eines verfaulenden Lebens, des einzigen, das zwischen den Steinen bestehen kann, lebend nur noch in der Hoffnung auf die Wiedergeburt aus seiner Verwesung. So sah es dort unten aus; hier oben hingegen lagen die makellos gearbeiteten, vergoldeten und verzierten Tragstangen der Sänfte auf den Schultern von Lasttieren in Menschengestalt, menschlich gefütterten, menschlich redenden, menschlich schlafenden, menschlich denkenden Lasttieren, und in dem makellos gearbeiteten, geschnitzten Sänftensessel, dessen Lehne und Seitenteile mit goldblechernen Sternen geschmückt waren, ruhte ein makelbehafteter Kranker, in dem die Verwesung bereits lauernd hauste. Dies alles war von äußerster Unstimmigkeit, in all dem barg sich das versteckte Unheil, die Starrheit eines Geschehens, das vollkommener ist als der Mensch, obwohl er selber es ist, der die Mauern baut, der schnitzt und hämmert, den Geißelstrang flicht und Ketten schmiedet. Unmöglich, sich davor zu verschließen, unmöglich war es, zu vergessen. Und was immer man vergessen wollte, in stets erneuter Wirklichkeitsgestalt war es wieder da, kam es wieder zurück, als neue Augen, als neuer Lärm, als neue Geißelhiebe, als neue Starrheit, als neues Unheil, jedes für sich seinen Eigenraum fordernd, eines das andere in furchtbarer Berührung einengend und bezwingend, und doch höchst seltsam und unstimmig alles miteinander verwoben. Unstimmig wie die Berührung der Dinge untereinander, war auch der Zeitablauf geworden; die einzelnen Zeitabschnitte wollten nicht mehr zueinander passen: niemals noch war das Jetzt so eindeutig vom Vorher geschieden gewesen; eine tiefeinschneidende Kluft, durch keinen Steg überbrückbar, hatte dieses Jetzt zu etwas Selbständigem gemacht, hatte es von dem Vorher, von der Seereise und allem, was vorangegangen war, unweigerlich abgetrennt, hatte ihn von dem ganzen vorangegangenen Leben abgeschieden, und doch hätte er, im leisen Schaukeln der Sänfte, kaum anzugeben gewusst, ob die Fahrt noch währte, oder ob man sich wirklich schon an Land befand. Über ein Meer von Köpfen schaute er, über einem Meere von Köpfen schwebte er, umgeben von Menschenbrandung, freilich bisher nur an ihrem Rande, da die ersten Versuche zur Überwindung solch wogenden Widerstandes bisher allesamt gescheitert waren. Hier beim Anlegeplatz der Begleitschiffe war die polizeiliche Ordnung eben weit weniger straff als drüben beim Augustusempfang, und mochte es auch einigen Fahrgästen geglückt sein sich mit eiligem Anlauf dorthin durchzuschlagen, sodass sie sich dem feierlichen Zuge, welcher sich innerhalb der Absperrung bildete und den Cäsar in die Stadt und zum Palast hinaufbringen sollte, noch anschließen konnten, so wäre derlei für den Sänftentransport schlechterdings unmöglich gewesen; der kaiserliche Diener, den man der kleinen Eskorte zur Begleitung, zur Führung und sozusagen zur Bewachung beigegeben hatte, war zu bejahrt, zu beleibt, zu weichlich und wohl auch zu gutmütig, um sich zu einem gewaltsamen Durchbruch aufzuraffen, er war machtlos, und weil er machtlos war, musste er sich auf Klagen gegen die Polizei beschränken, die diese Pöbelansammlungen zuließ und ihm doch wenigstens eine anständige Bedeckung hätte beistellen müssen, und so wurde man schließlich recht ziellos über den Platz hingepufft und fortgetrieben, zeitweise auch bewegungslos eingekeilt, im stockenden Zickzack, einmal dahin, einmal dorthin geschoben und herumgestoßen. Dass der Knabe mitgekommen war, erwies sich da als unverhoffte Erleichterung; als wäre ihm, und dies war äußerst seltsam, von irgendwoher Kenntnis um die Wichtigkeit des Manuskriptkoffers geworden, achtete er darauf, dass dessen Träger sich stets knapp neben der Sänfte hielten, und während er, immerzu selber daneben und den Mantel über die Schulter geworfen, keinerlei Abdrängung zuließ, blinzelte er manchmal mit helldurchsichtigen Augen belustigt und verehrungsvoll herauf. Von den Häuserfronten und aus den Gassen strömte brütende Schwüle entgegen, sie kam in breiten queren Wogen angeflutet, immer wieder von dem nicht enden wollenden Geschrei und Gerufe, vom Summen und Brausen des atmenden Massentieres zerspellt, dennoch unbewegt; Wasseratem, Pflanzenatem, Stadtatem: ein einziger schwerer Brodem des in Steinquadern eingezwängten Lebens und seiner verfaulenden Scheinlebendigkeit, Humus des Seins, verwesungsnah und unermesslich aufsteigend aus den überhitzten Steinschächten, aufsteigend zu den kühlsteinernen Sternen, mit denen die innerste, zu tiefmilder Schwärze abdunkelnde Himmelsschale sich zu bedecken begann. Aus unerschließbaren Tiefen sprießt das Leben empor, durch das Gestein sich zwängend, sterbend schon auf diesem Wege, sterbend und verwesend und erkaltend schon in seinem Aufsteigen, im Aufsteigen auch schon ein Sich-Verflüchtigen, aber aus unerschließbaren Höhen sinkt das Unabänderliche steinkühl herab, ein sinkender, dunkelleuchtender Hauch, bezwingend mit seiner Berührung, erstarrend zum Gestein der Tiefe, oben wie unten das Steinerne, als wäre es die letzte Wirklichkeit der diesseitigen Welt –, und zwischen solchem Strom und Gegenstrom, zwischen Nacht und Gegennacht, rotglühend unten, klarflimmernd oben, in dieser verdoppelten Nächtlichkeit schwebte er auf seiner Sänfte, als wäre sie eine Barke, eintauchend in die Wellenkämme des Pflanzlich-Tierischen, emporgehoben in den Hauch des Unabänderlich-Kühlen, vorwärtsgetragen zu Meeren von so großer Rätselhaftigkeit und Unbekanntheit, dass es wie Rückkehr war; denn Welle um Welle, die großen Flächen, die sein Kiel bereits durchfurcht hatte, Wellenflächen der Erinnerung, Wellenflächen der Meere, sie waren nicht durchsichtig geworden, nichts in ihnen hatte sich zur Bekanntheit enthüllt, bloß das Rätsel war geblieben, und rätselerfüllt reichte die Vergangenheit über ihre Ufer hin bis in die Gegenwart herein, sodass er inmitten des harzigen Fackelqualmes, inmitten des brütenden Stadtdunstes, inmitten des wildtierhaften, dunkelatmigen Körperbrodems, inmitten des Platzes und seiner Unbekanntheit, unverwischbar unverkennbar des Meeres Geruch und das groß-unvergängliche Sein des Meeres spürte: hinter ihm lagen die Schiffe, die seltsamen Vögel der Unbekanntheit, noch klingen Kommandoworte von dorther herüber, dann das ruckweise Knarrknirschen einer Holzwinde, dann ein tieftönend singender Beckenschlag, der wie ein letzter Nachhall des ins Meer gesunkenen Tagesgestirnes weitertönt, und dahinter ist der großflächige Wind der See, ist ihre billionenhaft weißgekrönte Unruhe, das Lächeln Poseidons, stets bereit in brüllendes Gelächter umzuschlagen, wenn der Gott seine Pferde antreibt, und hinter der See, aber zugleich sie umschließend, sind die meeresbespülten Länder, sie alle, die er durchschritten hatte, über deren Gestein, über deren Humus er gegangen war, teilnehmend am Pflanzlichen und Menschlichen und Tierischen, verwoben dem allen, ohnmächtig vor so viel Unbekanntheit, unfähig sie zu bewältigen, einverwoben und einverirrt in das Geschehen und in die Dinge, einverwoben-einverirrt in die Länder und in deren Städte, wie sehr ist dies alles versunken und trotzdem nahe, Dinge, Länder, Städte, wie liegen sie alle hinter ihm, um ihn, in ihm, wie sehr sind sie sein eigen, besonnt und schattentief, rauschend und nächtlich, bekannt und rätselhaft, Athen und Mantua und Neapel und Cremona und Mailand und Brundisium, ach, und Andes –, alles wurde herbeigetragen, es war hier, umbrandet vom Lichterwust des Hafenplatzes, umatmet vom Unatembaren, umgrölt vom Unverständlichen, vereinigt zu einer einzigen Einheit, in der die Ferne mühelos zur Nähe wurde, die Nähe zur Ferne, und ihn, den Darüberhinschwebenden, umgeben von Wildheit, zu mühelos schwebender Wachheit werden ließ; das unterweltlich Schwelende vor seinen Augen und in seinem Wissen, wusste er zugleich sein Leben, wusste es vom Strom und Gegenstrom der Nacht getragen, in der sich Vergangenheit und Zukunft kreuzen, er wusste es hier an diesem Verkreuzungspunkt in der feuergetauchten, feuerumflossenen Gegenwart des Uferplatzes, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Meer und Land, er selber in der Mitte des Platzes, als hätte man ihn zum Mittelpunkt seines eigenen Seins, zum Kreuzungspunkt seiner Welten, zu seinem Weltmittelpunkt bringen wollen, schicksalsbestimmt. Doch es war nur Brundisiums Hafenplatz.
Und selbst, wenn es der Weltmittelpunkt gewesen wäre, es wäre erst recht hier kein Bleiben gewesen; immer mehr Volk strömte aus den Gassen, deren Mündungen mit freudig-feurigen Transparenten überwölbt waren, auf den Platz heraus, und immer mehr wurden die Träger nun von der Platzmitte wieder abgedrängt, sodass es überhaupt keine Möglichkeit mehr gab, das Soldatenspalier und den Augustuszug, der sich unter Fanfaren bereits in Bewegung gesetzt hatte, von hier aus zu erreichen. Nicht wenig war da auch noch der Lärm angeschwollen, da ja nun auch die Musik überschrien, überjohlt, überpfiffen werden musste, und mit dem steigenden Lärm stieg desgleichen die Gewaltsamkeit und Rücksichtslosigkeit des Schiebens und Drängens, das schier zum Selbstzweck und zur Eigenbelustigung wurde, allein, bei all dieser Gewaltsamkeit, es schien sich die Mühelosigkeit und Leichtigkeit der schwebenden Wachheit, die ihn selber umfangen hielt, dem ganzen Platze mitgeteilt zu haben, gleichsam wie eine zweite Beleuchtung, welche sich zu der ersten, augensichtbaren dazugesellt hat und, ohne an ihrer harten, schattenverflackernden Grellheit etwas zu ändern, sie eher sogar noch vertieft, trotzdem aber einen zweiten Seinszusammenhang in der sichtbaren Dinggegenwart aufdeckt, den traumwachen Seinszusammenhang der Ferne, der jedweder Nähe, selbst der handgreiflichsten und unmittelbarsten, noch innewohnt. Und als sollte diese fernleichte Selbstverständlichkeit eines zweiten Zusammenhanges auch noch bewiesen werden, befand sich der Knabe nun plötzlich an der Spitze der Eskorte, ohne dass man recht gewahr geworden, wann dies geschehen war, und, gleichsam wie im Spiele, leicht eine Fackel schwingend, die er offenbar dem Nächstbesten abgenommen hatte, benützte er sie als Waffe, um damit einen Weg durch die Menge zu bahnen: »Platz für den Vergil!«, schrie er dazu den Leuten fröhlich ins Gesicht, »Platz für eueren Dichter!«, und wenn die Leute vielleicht auch nur auswichen, weil da einer getragen wurde, der zum Cäsar gehörte, oder weil ihnen die fieberglänzenden Augen in dem gelbdunklen Gesicht des Kranken unheimlich waren, so hatte man es doch dem kleinen Führer zu verdanken, dass ihre Aufmerksamkeit überhaupt erregt und hierdurch ein Vorwärtskommen schlecht und recht ermöglicht wurde. Freilich, es gab Verknäulungen, gegen die weder mit der spitzbübischen Gelassenheit des jungen Mantelträgers, noch mit seinen Fackelbränden etwas auszurichten war, und bei diesen Stockungen nützte auch nichts das unheimliche Aussehen des kranken Mannes, im Gegenteil, jedes Mal steigerte sich dann das anfänglich bloß abwehrend gleichgültige Wegschauen zu einem offenen Widerwillen gegen den unheimlichen Anblick, zu einem halb scheuen, halb angriffslustigen Geraune, es wurde zu einer nahezu bedrohlichen Stimmung, für die ein Spaßvogel, ebenso wohlgelaunt wie übelwollend, in dem Rufe: »Ein Zauberer, der Zauberer vom Cäsar!«, den richtigen Ausdruck fand. »Versteht sich, du Tölpel«, schrie der Junge zurück, »so einen Zauberer hast du überhaupt noch nicht in deinem dummen Leben gesehen; unser größter, unser allergrößter Zauberer ist er!« Ein paar Hände mit ausgestreckten Fingern, die vor dem bösen Blick schützen sollten, flogen auf, und eine weißgeschminkte Hure, blonde Perücke schiefsitzend auf ihrem Schädel, kreischte zur Sänfte hin: »Gib mir einen Liebeszauber!« – »Ja, zwischen die Beine, und kräftig«, ergänzte mit nachahmender Fistelstimme ein gänserichähnlicher, sonnverbrannter Bursche, offenbar ein Matrose, und erwischte mit seinen blautätowierten Armen die vergnügt-zärtlich Aufquietschende beidhändig von hinten, »so’nen Zauber kriegst auch von mir gut und gerne geliefert; den kannst bekommen!« – »Platz für den Zauberer, Platz da!«, kommandierte der Junge, puffte mit dem Ellbogen resolut den Gänserich zur Seite und schwenkte, schnell-entschlossen und einigermaßen überraschend, nach rechts gegen den Platzrand hin ab; willig folgten die Träger mit dem Manuskriptkoffer, etwas weniger willig der Wächter-Diener, es folgte die Sänfte und die übrigen Sklaven, gleichsam sie alle von unsichtbarer Kette hinter dem Knaben hergezogen. Wohin führte da der Knabe? aus welcher Ferne, aus welcher Erinnerungstiefe war er aufgetaucht? von welcher Vergangenheit, von welcher Zukunft wurde er bestimmt? von welch geheimnisvoller Notwendigkeit? und aus welch vergangenem, zu welch künftigem Geheimnis wurde er selber da getragen? war es nicht weit eher ein ständiges Schweben in unermesslicher Gegenwart? Um ihn herum waren die Fressmäuler, die Brüllmäuler, die Gesangmäuler, die Staunmäuler, die geöffneten Mäuler in den verschlossenen Gesichtern, sie alle waren geöffnet, waren aufgerissen, zahnbesetzt hinter roten und braunen und blassen Lippen, mit Zunge bewehrt, er sah hinab auf die moosig-wolligen Rundköpfe der Tragsklaven, sah von seitwärts ihre Kiefer und die finnige Wangenhaut, er wusste von dem Blute, das in ihnen schlug, von dem Speichel, den sie zu schlucken hatten, und er wusste manches von den Gedanken, die in diesen ungefügen, ungelenken, ungezügelten Fress- und Muskelmaschinen zwar verloren, dennoch ewiglich unverlierbar, zart und dumpf, durchsichtig und dunkel, sickernd Tropfen um Tropfen, fallen und vergehen, die Tropfen der Seele; er wusste um die Sehnsucht, die selbst in der schmerzlich wüstesten Brunst und Fleischlichkeit nicht zur Ruhe kommt, ihnen allen eingeboren, dem Gänserich ebenso sehr wie seiner Hure, unaustilgbare Sehnsucht des Menschen, die sich niemals vernichten, höchstens ins Bösartige und Feindliche abbiegen lässt, dennoch Sehnsucht bleibend. Entrückt, dennoch unaussprechlich nahe, schwebend vor Wachheit, dennoch allem Dumpfen vermengt, sah er die Stumpfheit der samenspritzenden und samentrinkenden, gesichtslosen Leiber, ihre Schwellungen und ihre Gliedhärten, er sah und hörte die Verborgenheiten in dem Auf und Ab ihrer Zufallsbrunst, den wilden, stumpf-kriegerischen Jubel ihrer Vereinigungen und das blöd-weise Verwelken ihres Alterns, und fast war es, als würde ihm dies alles, dieses ganze Wissen durch die Nase zugemittelt werden, eingeatmet mit dem betäubenden Dunst, in dem das Sichtbare und Hörbare eingebettet war, eingeatmet mit dem vielfältigen Dunst der Menschentiere und ihres täglich zusammengesuchten, täglich durch sie hindurchgekauten Futters, indes jetzt, da man sich endlich einen Weg zwischen den Leibern erkämpft hatte, und die Menge, gleich den zum Platzrande hin spärlicher werdenden Lichtern, endlich schütterer wurde, um dunkelheitsversickernd sich schließlich ganz zu verlaufen, wurde ihr Geruch, mochte er auch noch immer nachschwelen, von dem glatten glitzerigfauligen Gestank der Fischmarktstände abgelöst, die hier den Hafenplatz begrenzten, stillverlassen zu dieser Abendstunde. Süßlich, nicht minder faulig, schlug sich auch noch der Geruch des Obstmarktes hinzu, voll von Gärungshauch, ununterscheidbar geworden der Duft der rötlichen Trauben, der wachsgelben Pflaumen, der goldenen Äpfel, der unterirdisch schwarzen Feigen, vermengt und ununterscheidbar geworden vor gemeinsamer Verwesung, und die Steinplatten des Pflasters glänzten schlüpfrig von feucht Zertretenem und Verschmiertem. Sehr fern war nun der Mittelpunkt des Platzes dahinten, sehr fern die Schiffe am Kai, sehr fern das Meer, sehr fern, wenn auch nicht endgültig verloren; das Menschengeheul dort war nur noch ein fernes Brummen, und von der Fanfarenmusik war nichts mehr zu hören.
Mit großer Sicherheit, als wie von genauester Ortskenntnis gelenkt, hatte der Knabe seine Gefolgschaft durch das Budenwerk hindurchgesteuert, um nun in das Gebiet der Warenspeicher und Werftanlagen einzudringen, das mit düster unbeleuchteten Gebäuden sich unmittelbar an das Marktgelände anschloss und, in der Dunkelheit kaum erkennbar, höchstens erfühlbar sich von hierab weithin ausdehnte. Und da wechselte nochmals der Geruch: man roch das ganze Schaffen des Landes, man roch die ungeheuren Lebensmittelmengen, die hier vorbereitet waren, vorbereitet zum Austausch innerhalb des Reichsgebietes, immer aber dazu bestimmt, ob da oder dort, sich nach Kauf und Verkauf zuletzt durch die Menschenkörper und deren Eingeweideschlangen hindurchzuschlacken, und man roch die trockene Süße des Getreides, dessen Feimen vor den schwarzen Silos sich häuften, wartend, dass sie hineingeschaufelt würden, man roch die staubige Trockenheit der Kornsäcke, der Weizensäcke, der Hafersäcke, der Dinkelsäcke, man roch die säuerliche Milde der Öltonnen und Ölkufen, und ebenso die beizende Herbheit der Weinlager, die sich die Kais entlang hinerstreckten, man roch die Zimmermannswerkstätten, die Massen der irgendwo im Dunkeln aufgestapelten Eichenstämme, deren Holz niemals stirbt, man roch ihre Rinde, aber nicht minder den geschmeidigen Widerstand ihres Stammkernes, man roch die zubehauenen Blöcke, in denen noch die Axt steckt, wie sie der Werkmann nach Arbeitsschluss zurückgelassen hat, und neben dem Geruch der schöngehobelten neuen Schiffsplanken, neben dem der Hobelscharten und der Sägespäne, roch man den müden des ausgebrochenen, weißlichgrünen, glitschig-modrigen, muschelbesäten alten Schiffsholzes, das in großen Haufen hier des Verbrennens harrte. Der Kreislauf des Schaffens. Ein unendlicher Friede atmete aus der duftgeschwängerten Arbeitsnächtlichkeit, der Friede eines werkenden Landes, der Friede von Äckern, von Weinbergen, von Wäldern, von Ölhainen, der bäuerliche Friede, aus dem er selber, der Bauernsohn, hervorgegangen war, der Friede seines steten Heimwehs und seiner erdgebundenen, erdzugekehrten, irdisch-steten Sehnsucht, der Friede, dem seit jeher sein Gesang gegolten hatte, oh, sein Sehnsuchtsfrieden, unerreichbar. Und als sollte diese Unerreichbarkeit sich auch hier widerspiegeln, als müsste allüberall alles zum Bild seines Selbst werden, war auch dieser Friede hier zwischen den Steinen eingezwängt, war gebändigt und missbraucht zum Ehrgeiz, zum Nutzen, zur Verkäuflichkeit, zur Hetzjagd, zur Außenweltlichkeit, zur Verknechtung, zum Unfrieden. Innen und Außen sind das nämliche, sind Bild und Gegenbild, und doch noch nicht die Einheit, die das Wissen ist. Überall fand er sich selber, und wenn er alles festhalten musste, aber auch festhalten konnte, wenn es ihm gelang, die Weltenvielfalt zu erhaschen, zu der es ihn verpflichtet hatte, zu der es ihn drängte, traumwach an sie hingegeben, mühelos ihr angehörend, mühelos sie besitzend, so war dem so, weil sie von Anbeginn an, ja, noch vor allem Erspähen, Erlauschen, Erfühlen, sein Eigen gewesen war, weil Erinnern und Festhalten niemals etwas anderes als selbst-erinnertes Eigen-Ich ist, erinnertes Eigen-Einst, ein Einst, in dem er den Wein getrunken, das Holz betastet, das Öl geschmeckt haben musste, ehe es noch Öl, Wein und Holz gegeben hatte, das ungekannt Wiedererkannte, weil die Fülle der Gesichter und Ungesichter, samt ihrer Brunst, samt ihrer Gier, samt ihrer Fleischlichkeit, samt ihrer habsüchtigen Kälte, samt ihrem tierhaft körperlichen Sein, aber auch samt ihrer großen nächtlichen Sehnsucht, weil sie allesamt, mochte er sie je gesehen haben oder nicht, mochten sie je gelebt haben oder nicht, ihm einverleibt waren von seinem Urbeginn an, als der chaotische Ur-Humus seines eigenen Seins, als seine eigene Fleischlichkeit, als seine eigene Brunst, als seine eigene Gier, als sein eigenes Ungesicht, aber auch als seine eigene Sehnsucht: und hatte sich seine Sehnsucht im Verlaufe seiner irdischen Wanderung auch sehr gewandelt und sich dem Erkennen zugekehrt, so sehr, dass sie zuletzt, schmerzlicher und schmerzlicher geworden, kaum mehr Sehnsucht, ja, kaum mehr Sehnsucht nach der Sehnsucht zu nennen war, und war dies auch vom Schicksal vorbestimmt gewesen, von Anbeginn an, als ein Hinausgetriebensein und als eine Abgeschiedenheit, unheilsträchtig jenes, heilsbeglückend dieses, beides jedoch fast untragbar für ein menschliches Wesen, es war trotzdem geblieben, unverlierbar das Eingeborene, unverlierbar des Seins Ur-Humus, der Boden des Erkennens und Wiedererkennens, aus dem die Erinnerung gespeist wird und zu dem sie zurückkehrt, Schutz vor Glück wie Unglück, Schutz vor dem Untragbaren, eine letzte Sehnsucht, so sehr Sehnsucht, dass sie schier körperlich in jedem Streben nach Erinnerungstiefe, und sei es die erkenntnisreifste, ein für alle Mal und für ewig mitschwingt. Wahrlich, es war eine körperliche Sehnsucht und unauslöschbar. Er hielt die Finger ineinander verkrampft, er spürte den Ring, der sich hart in Haut und Fleischflachsen drückte, er spürte steinhart die Knochen seiner Hand, er spürte sein Blut, er spürte die Erinnerungstiefe seines Körpers, die Schattentiefe der Fernvergangenheit eins geworden mit ihrem gegenwartsnahen, gegenwartserhellenden Leuchten, und er erinnerte sich der Knabenzeit in Andes, er erinnerte sich des Hauses, der Stallungen, der Speicher, der Bäume, er erinnerte sich der hellen Augen in dem immer lachbereiten stets ein wenig sonnverbrannten Gesicht der Mutter, die dunkellockig im Hause schaffte – oh, sie hieß Maja, und kein Name hätte sommerlicher klingen können, keinen gab es, der besser zu ihr gepasst hätte –, und er erinnerte sich, wie sie mit ihrem fröhlichen Gewerk alles um sie herum erwärmte, unerschütterlich in ihrer heiteren Unermüdlichkeit, auch wenn sie dem Großvater, der in der Stube saß, ständig zu Diensten sein musste, ständig von ihm zu irgendeiner Handreichung gerufen wurde, oder wenn sie, nicht weniger häufig, den Alten und sein wütendes, markerschütterndes, kindererschreckendes Geschrei zu beschwichtigen hatte, dieses beschwichtigungssüchtige Geschrei, das anzustimmen er bei keiner Gelegenheit unterließ, besonders wenn Vieh- und Getreidepreise zur Frage standen und er, der halb freigebige, halb knauserige, weißhaarige Magus Polla unfehlbar, ob Kauf oder Verkauf, sich von den Händlern übertölpelt glaubte; ach, wie erinnerungsstark war dieser Lärm, wie erinnerungsmild die Ruhe, die dann immer wieder von der Mutter mit einer beinahe belustigten Fröhlichkeit dem Hause zurückgegeben worden war, und er erinnerte sich des Vaters, der erst mit der Heirat zum richtigen Bauern hatte werden können und dessen einstmaliger Töpferberuf dem Sohn gering gedeucht hatte, obwohl es sehr schön gewesen war den abendlichen Erzählungen von der Arbeit an den bauchigen Weinfässern und edelgeschwungenen Ölkrügen, die der Vater verfertigt hatte, zu lauschen, den Erzählungen von dem lehm-formenden Daumen, von den Spachteln und von der surrenden Drehscheibe, und von der Kunst des Brennens, schönen Erzählungen, unterbrochen von manchem alten Töpferlied. Oh, Gesichter der Zeit, verharrend in der Zeit, oh, Gesicht der Mutter, erinnert als Jugendgesicht und dann immer verflüchtigt und vertieft, sodass es im Tode schon jenseits alles Gesichtlichen, ja fast wie ewige Landschaft gewesen war, oh, Gesicht des Vaters, unerinnert am Anfang und dann immer weiter gewachsen ins Lebensmenschliche, ins Ebenbildhafte, bis es im Tode zum unverlierbaren Menschenantlitz geworden war, gebildet aus hartem, braunsteifem Lehm, gütig stark im letzten Lächeln, unvergessbar. Oh, nichts vermag zur Wirklichkeit zu reifen, das nicht in der Erinnerung verwurzelt ist, oh, nichts ist dem Menschen erfassbar, das ihm nicht von Anfang an beigegeben wäre, überschattet von den Gesichtern seiner Jugend. Denn immer steht die Seele an ihrem Anfang, sie steht zur Erwachensgröße ihres Anfanges, selbst das Ende hat für sie die Würde des Beginns; kein Lied geht verloren, das je die Saiten ihrer Leier berührt, und zu ewig erneuter Bereitschaft aufgetan, bewahrt sie in sich jegliches Tönen, mit dem sie je aufgeklungen. Unvergänglich ist es, stets kommt es wieder, auch hier war es wieder vorhanden, und er sog die Luft ein, um den kühlen Geruch der irdenen Krüge und der aufgestapelten Tonnen, der leicht und schwarz manchmal aus den geöffneten Schuppentüren herausquoll, zu erhaschen und in seine wehen Lungen einzuatmen. Hernach musste er freilich husten, als hätte er etwas Unzuträgliches oder Verbotenes getan. Die Nagelschuhe der Träger trabten indessen weiter, sie klappten auf Steinboden, knirschten auf Kiesboden, die Fackel des jungen Führers, der mitunter sich umwandte, um zu der Sänfte heraufzulächeln, glimmte und leuchtete voran, man kam jetzt recht tüchtig ins Marschieren und recht rasch vorwärts, zu rasch für den im bequemeren Hofdienst ergrauten und beleibt gewordenen, bejahrten Diener, der nun hintendrein nachwatschelte und vernehmlichst seufzte; es ragte das Gewirr der Magazins- und Silodächer mit vielerlei Formen teils spitz, teils flach, teils schwachschräg zum sterndichten, wenn auch noch nicht vollnächtlichen Himmel empor, Krane und Gestänge warfen drohende Schatten unter dem vorüberziehenden Lichte, man kam an leeren und beladenen Karren vorbei, ein paar Ratten kreuzten den Weg, ein Nachtfalter verirrte sich auf die Sänftenlehne und blieb daran haften; sachte wollte sich neuerlich Müdigkeit und Schlaf melden, sechs Beine hatte der Falter und sehr viele, wenn nicht gar unbestimmbar viele das Trägergespann, dem die Sänfte, dem er selber mitsamt dem Falter als vornehm-gebrechliche Warenlast anvertraut war, schon wollte er sich umwenden, um vielleicht doch noch die Anzahl der hinter ihm befindlichen Tragsklaven sowie die ihrer Beine feststellen zu können, allein, ehe er noch dies bewerkstelligen konnte, war man in einen engen Durchlass zwischen zwei Schuppen gelangt, und gleich danach stand man höchst überraschenderweise wieder vor den Stadthäusern, stand vor dem Eingang einer ziemlich steil ansteigenden, sehr schmalen, sehr verwitterten, sehr wäschebehangenen Mietskasernengasse: tatsächlich, man stand, denn der Knabe hatte die Träger, die ja sonst wahrscheinlich weitergetrottet wären – und tatsächlich, nun waren es ihrer wieder nur vier wie ehedem – kurzerhand in ihrem Marsche aufgehalten, und gerade diese plötzliche Unterbrechung, vereint mit dem unerwarteten Anblick, wirkte wie Wiedersehensfreude, wirkte derart überraschend und verblüffend, dass sie allesamt, Herr und Diener und Sklave, laut herauslachten, umso mehr, als der Knabe, angefeuert von ihrem Lachen, sich leicht verbeugte und mit einer stolzen Weisegeste zum Einzug in die Gasse einlud.