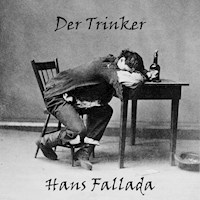
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hierax Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hans Fallada bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein Kleinbürger säuft sich ins Verderben. In nur knapp zwei Wochen schrieb Fallada seinen – wie viele meinen – persönlichsten Roman nieder, während er wieder einmal im Gefängnis einsaß, weil er seine Frau im Suff misshandelt hatte. Im Lichte des unbarmherzigen Nazi-Regimes und der sich abzeichnenden Kriegsniederlage zeichnet der Autor hier leicht erkennbar seine eigene Geschichte auf. Der schwer alkoholabhängige, kleine Unternehmer Erwin Sommer befindet sich auf dem absteigenden Ast: Der Teufelskreis aus Suff, wirtschaftlichem Niedergang und permanenter Existenzangst hat ihn erfasst. Als er für unzurechnungsfähig erklärt und schließlich in eine "Heilanstalt" eingewiesen wird, erkennt er, dass die Schrecken draußen nichts sind gegen die Tyrannei der Ärzte, Paragrafen und Pfleger. »Solange ich schreibe, vergesse ich die Gitter vor dem Fenster« [Fallada] Keiner konnte die Abgründe des Menschen so beschreiben wie Fallada in seiner schnörkellosen Prosa. Ungekürzte und kommentierte Ausgabe Null Papier Verlag
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Fallada
Der Trinker
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe
Hans Fallada
Der Trinker
Ungekürzte und kommentierte Ausgabe
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Aufbau-Verlag, Berlin, 1944/50 (312 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962813-20-8
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Hans Fallada bei Null Papier
Jeder stirbt für sich allein
Der Trinker
Wer einmal aus dem Blechnapf frisst
Ein Mann will nach oben
Kleiner Mann – was nun?
Der eiserne Gustav
Bauern, Bonzen und Bomben
Wolf unter Wölfen
Anton und Gerda
Der Alpdruck
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
1
Ich habe natürlich nicht immer getrunken, es ist sogar nicht sehr lange her, dass ich mit Trinken angefangen habe. Früher ekelte ich mich vor Alkohol; allenfalls trank ich mal ein Glas Bier; Wein schmeckte mir sauer, und der Geruch von Schnaps machte mich krank. Aber dann kam eine Zeit, da es mir schlecht zu gehen anfing. Meine Geschäfte liefen nicht so, wie sie sollten, und mit den Menschen hatte ich auch mancherlei Missgeschick. Ich bin immer ein weicher Mensch gewesen, ich brauchte die Sympathie und Anerkennung meiner Umwelt, wenn ich mir das auch nicht merken ließ und stets sehr selbstbewusst und sicher auftrat. Das Schlimmere war, dass ich das Gefühl bekam, auch meine Frau wende sich von mir ab.
Es waren zuerst unmerkliche Zeichen, Dinge, die ein anderer ganz übersehen hätte. Zum Beispiel vergaß sie, mir bei einem Geburtstag in unserem Hause Kuchen anzubieten; ich esse zwar nie Kuchen, aber früher bot sie mir trotzdem stets welchen an. Und dann war einmal drei Tage lang ein Spinnweb in meinem Zimmer über dem Ofen. Ich ging alle Zimmer ab, aber in keinem gab es ein Spinnweb, nur in meinem. Ich wollte eigentlich abwarten, wie lange sie es so treiben würde mir zum Ärger, aber am vierten Tage hielt ich es nicht mehr aus und sagte es ihr. Darauf wurde das Spinnweb entfernt. Ich sagte es ihr natürlich ziemlich scharf. Ich wollte mir um keinen Preis merken lassen, wie sehr ich unter diesen Kränkungen und meiner Vereinsamung litt.
Aber es blieb nicht dabei. Bald kam die Sache mit dem Fußabtreter. An jenem Tage hatte ich Schwierigkeiten auf meiner Bank gehabt, zum ersten Male hatten sie mir eine Geldauszahlung verweigert; es hatte sich wohl herumgesprochen, dass ich Verluste erlitten hatte. Der Bankvorsteher, ein Herr Alf, tat sehr liebenswürdig, sprach von vorübergehenden Schwierigkeiten und erbot sich sogar, mit seiner Zentrale wegen eines Sonderkredits für mich zu telefonieren. Ich lehnte das natürlich ab, ich war lächelnd und sicher wie immer gewesen. Aber ich hatte gut gemerkt, dass er mir dieses Mal nicht wie sonst meist eine Zigarre angeboten hatte, dieser Kunde lohnte ihm das wohl nicht mehr.
Sehr niedergedrückt ging ich durch einen schwer herabrauschenden Herbstregen nach Hause. Ich war noch gar nicht in eigentlichen Schwierigkeiten; es war nur eine gewisse Stagnation in meinen Geschäften eingetreten, die zu jenem Zeitpunkt mit einigem Elan sicher noch zu überwinden gewesen wäre. Aber gerade diesen Elan vermochte ich nicht aufzubringen, ich war zu niedergedrückt von all dem stummen Missfallen, dem ich begegnete.
Als ich nach Hause kam (wir wohnen etwas vor der Stadt in eigener Villa, und die Straße dorthin ist noch nicht ausgebaut), wollte ich vor der Tür meine schmutzigen Schuhe reinigen, doch gerade heute fehlte der Fußabtreter. Ärgerlich schloss ich auf und rief ins Haus nach meiner Frau. Es dunkelte schon, aber nirgends sah ich Licht, und Magda kam auch nicht. Ich rief wieder und wieder, aber nichts erfolgte. Ich befand mich in einer höchst fatalen Situation: Ich stand im Regen vor der Tür meiner eigenen Villa und konnte nicht ins Haus, wollte ich nicht Vorplatz und Diele ärgerlich beschmutzen, und das alles, weil meine Frau vergessen hatte, den Fußabtreter hinauszulegen, und zu einer Zeit nicht zur Stelle war, wo ich, wie sie genau wusste, von der Arbeit heimkam.
Schließlich musste ich mich überwinden: Ich ging vorsichtig auf Zehenspitzen ins Haus. Als ich mich auf einen Stuhl in der Diele setzte, um die Schuhe auszuziehen, und dafür Licht machte, sah ich, dass all meine Vorsicht nichts genützt hatte: Auf dem zartgrünen Dielenteppich waren die hässlichsten Flecke entstanden. Ich habe Magda immer gesagt, dass solch ein empfindliches Resedagrün nichts für die Diele sei, aber sie hatte ja gemeint, wir beide seien ja wohl alt genug, ein bisschen aufzupassen, und die Else (unser Dienstmädchen) benütze ja sowieso den Hintereingang und sei gewohnt, im Hause auf Pantoffeln zu gehen. Ich zog sehr ärgerlich meine Schuhe aus, und gerade als ich den zweiten auszog, sah ich Magda, die eben aus der Tür kam, die die Kellertreppe verdeckt. Der Schuh entglitt mir und fiel mit Poltern auf den Teppich, einen weiteren abscheulichen Fleck machend.
»Pass doch ein bisschen auf, Erwin!«, rief Magda sehr ärgerlich. »Wie der schöne Teppich wieder aussieht. Kannst du dir nicht angewöhnen, die Füße ordentlich abzutreten?!«
Die offene Ungerechtigkeit in diesem Vorwurf empörte mich, aber noch hielt ich an mich. »Wo in aller Welt hast du bloß gesteckt?«, fragte ich, sie noch immer anstarrend. »Ich habe mindestens zehnmal nach dir gerufen!«
»Ich war bei der Zentralheizung im Keller«, sagte Magda kühl. »Aber was hat das mit meinem Teppich zu tun?«
»Es ist ebenso gut mein Teppich wie der deine«, antwortete ich erregt. »Ich habe ihn wirklich nicht gerne beschmutzt. Aber wenn kein Abtreter vor der Tür liegt …!«
»Es liegt kein Abtreter vor der Tür? Natürlich liegt er vor der Tür!«
»Es liegt keiner davor!«, rief ich mit Nachdruck. »Bitte, überzeuge dich selbst!«
Aber sie dachte gar nicht daran, vor die Tür zu gehen. »Wenn Else eben vergessen hat, ihn hinzulegen, so hättest du die Schuhe gut auf dem Vorplatz ausziehen können! Jedenfalls hättest du nicht den einen Schuh hier mit solchem Plumps auf den Teppich zu werfen brauchen!«
Ich sah sie, stumm vor Ärger, nur empört an. »Ja«, sagte sie, »da schweigst du. Wenn man dir Vorwürfe macht, schweigst du. Aber mir machst du ständig Vorwürfe …«
Ich fand keinen rechten Sinn in diesen Worten, aber ich sagte doch: »Wann habe ich dir Vorwürfe gemacht?«
»Eben erst«, antwortete sie rasch. »Einmal, weil ich auf dein Rufen nicht gekommen bin, und ich musste doch nach der Heizung sehen, weil Else heute ihren freien Nachmittag hat. Und dann, weil der Abtreter nicht vor der Tür liegt. Aber ich kann doch unmöglich bei all meiner Arbeit auch noch jede Kleinigkeit, die Else zu tun hat, kontrollieren.«
Ich nahm mich zusammen. Ich fand im stillen, Magda hatte in allen Punkten unrecht, aber laut sagte ich: »Wir wollen uns nicht streiten, Magda. Ich bitte dich, mir zu glauben, dass ich die Flecke nicht mit Absicht gemacht habe.«
»Und du glaube mir«, antwortete sie, noch immer ziemlich scharf, »dass ich dich weder mit Absicht habe rufen noch mit Absicht habe warten lassen.«
Ich schwieg dazu. Bis zum Abendessen hatten wir uns beide wieder ziemlich in der Gewalt, eine ganz vernünftige Unterhaltung kam sogar zustande, und plötzlich hatte ich den Einfall, eine Flasche Rotwein, die mir irgendjemand mal geschenkt hatte und die seit Jahren im Keller stand, heraufzuholen. Ich weiß wirklich nicht, wieso ich auf diese Idee kam. Vielleicht löste das Gefühl unserer Aussöhnung bei mir den Gedanken an etwas Festliches wie Trauung oder Taufe aus. Magda war auch ganz überrascht, lächelte aber beifällig.
Ich trank nur anderthalb Glas, obgleich mir an diesem Abend der Wein nicht sauer schmeckte. Ich kam sogar in eine heitere Stimmung und brachte es fertig, Magda allerlei vom Geschäft, das mir so viel Sorgen machte, zu erzählen. Natürlich sprach ich kein Wort von diesen Sorgen, sondern ich log im Gegenteil meine Misserfolge in Erfolge um. Magda hörte mir so interessiert wie schon lange nicht zu. Ich hatte das Gefühl, dass die Entfremdung zwischen uns völlig geschwunden war, und in der Freude darüber schenkte ich Magda hundert Mark, damit sie sich etwas recht Hübsches kaufen könnte: ein Kleid oder einen Ring oder wonach sonst ihr Herz stand.
2
Ich habe mich später oft gefragt, ob ich an diesem Abend wohl völlig betrunken gewesen bin. Natürlich bin ich das nicht gewesen, davon hätten sowohl Magda als auch ich etwas gemerkt, und doch habe ich an diesem Abend den ersten Rausch meines Lebens gehabt. Ich schwankte nicht, ich lallte nicht. Das hatten diese anderthalb Glas muffigen Rotweins selbst bei einem so nüchternen Menschen wie mir nicht bewirken können, aber doch hatte mir der Alkohol die ganze Welt verwandelt. Er spiegelte mir vor, dass es keine Entfremdung und keinen Streit zwischen Magda und mir gegeben hätte, er verwandelte meine geschäftlichen Sorgen in Erfolge, in solche Erfolge, dass ich sogar hundert Mark zu verschenken hatte, keine beträchtliche Summe gewiss, aber in meiner Lage war schließlich keine Summe ganz unbeträchtlich.
Als ich am nächsten Morgen erwacht war und alle Geschehnisse von dem vergessenen Fußabtreter bis zum verschenkten Hundertmarkschein an meinem geistigen Auge vorüberziehen ließ, da wurde mir erst klar, wie schmählich ich an Magda gehandelt hatte. Ich hatte sie nicht nur über meine geschäftliche Lage getäuscht, nein, ich hatte diese Täuschung auch noch durch ein Geldgeschenk untermauert, um sie noch glaubhafter zu machen, etwas, das juristisch wohl »Betrug« genannt werden würde. Aber das Juristische war ganz gleichgültig, das Menschliche allein war wichtig, und das Menschliche an dieser Sache war einfach furchtbar. Ich hatte zum ersten Mal in unserer Ehe Magda wissentlich betrogen – und warum? Warum in aller Welt?! Für gar nichts – ich hätte ja von all diesen Dingen wunderbar schweigen können, wie ich bisher von ihnen geschwiegen hatte. Niemand zwang mich zum Sprechen. Niemand? Doch ja, der Alkohol hatte mich dazu gebracht.
Als ich das erst einmal erkannt hatte, als ich in vollem Umfange erfasst hatte, welch Lügner der Alkohol ist und wie er dazu aus ehrlichen Menschen Lügner macht, schwor ich mir zu, nie wieder einen Tropfen Alkohol zu trinken und auch auf das ab und zu bisher genossene Glas Bier zu verzichten.
Aber was sind Vorsätze, was sind Entwürfe? Ich hatte mir ja auch an diesem Morgen der Ernüchterung zugeschworen, wenigstens die gestern Abend zwischen Magda und mir aufgekommene wärmere Stimmung zu nützen und es nicht wieder zu einer Entfremdung oder gar zu einem Streit kommen zu lassen. Und doch vergingen nicht viele Tage, und wir stritten uns schon wieder. Es war eigentlich völlig unbegreiflich: Vierzehn Jahre unserer Ehe waren praktisch ohne jeden Streit vergangen, und jetzt im Fünfzehnten war es, dass wir nicht mehr ohne Streiten leben konnten. Manchmal schien es mir geradezu lächerlich, über was für Dinge alles wir miteinander in Streit gerieten. Es schien, als müssten wir uns zu bestimmten Zeiten streiten, ganz gleich warum. Auch das Streiten scheint wie ein Gift zu sein, an das man sich rasch gewöhnt und ohne das man bald nicht mehr leben kann. Zuerst bewahrten wir natürlich ängstlich die Form, wir suchten möglichst sachlich beim Streitgegenstand zu bleiben und alles persönlich Kränkende zu vermeiden.
Auch legte uns die Anwesenheit unseres kleinen Hausmädchens Else Hemmungen auf. Wir wussten, sie war neugierig und trug alles weiter, was sie erfuhr. Damals wäre es mir noch unaussprechbar schrecklich gewesen, wenn irgendjemand in der Stadt von meinen Sorgen und unseren Streitereien erfahren hätte. Nicht sehr viel später freilich war es mir vollkommen gleichgültig geworden, was die Menschen von mir dachten und sprachen, und, was das Schlimmere war, ich hatte auch alle Scham vor mir selbst verloren.
Ich habe gesagt, dass Magda und ich uns an fast täglichen Streit gewöhnten. Freilich waren das eigentlich nur Quengeleien, kleine Sticheleien um ein Garnichts, etwas, das die zwischen uns immer wieder auftauchenden Spannungen ein wenig erleichterte. Auch das war eigentlich ein Wunder, aber kein schönes: Viele Jahre hatten Magda und ich eine ausgesprochen gute Ehe geführt. Wir hatten uns aus Liebe geheiratet, damals waren wir alle beide sehr kleine Angestellte gewesen, jeder mit einem Handköfferchen, so waren wir zusammengelaufen. Ach, die herrliche entbehrungsreiche Zeit unserer ersten Ehejahre – wenn ich heute daran zurückdenke! Magda war eine wahre Haushaltskünstlerin, manche Woche kamen wir mit zehn Mark aus, und es kam uns vor, als lebten wir dabei wie die Fürsten.
Dann kam die wagemutige, von immerwährender Anspannung erfüllte Zeit, da ich mich selbstständig machte, da ich mit Magdas Hilfe mein eigenes Geschäft aufbaute. Es glückte – o du lieber Himmel, wie uns damals alles glückte! Wir brauchten nur etwas anzufassen, unseren Fleiß und unseren Eifer einer Sache zuzuwenden, und schon gelang sie, blühte auf wie eine gut gepflegte Blume, trug uns Früchte … Kinder blieben uns versagt, sosehr wir uns nach ihnen auch sehnten. Magda hatte einmal einen Umschlag,1 von da an war es mit allen Aussichten auf Kinder vorbei. Aber wir liebten uns darum nicht weniger. Viele Jahre unserer Ehe waren wir immer wieder frisch verliebt ineinander. Ich habe nie eine andere Frau als Magda begehrt. Sie machte mich vollkommen glücklich, und mit mir ist es ihr wohl auch nicht anders gegangen.
Als dann das Geschäft lief, als es jenen Umfang erreicht hatte, der ihm durch die Größe unserer Stadt und unseres Landkreises gegeben war, einen Umfang, über den hinaus eine Erweiterung nur durch völlige Änderung all unserer Lebensumstände und durch Wegzug von unserer Vaterstadt möglich war, als also das brennende Interesse etwas zu erlahmen begann, kam als Ersatz der Erwerb des eigenen Grundstücks vor der Stadt, der Bau unserer Villa, die Anlage unseres Gartens, die Einrichtung, die uns nun für den Rest unseres Lebens begleiten sollte – alles Dinge, die uns wieder eng aneinanderbanden und uns die Abkühlung, die in unserer Ehebeziehung eingetreten war, nicht merklich werden ließen. Wenn wir uns nicht mehr so wie früher liebten, wenn wir nicht mehr so oft und heiß nacheinander begehrten, so empfanden wir das nicht als einen Verlust, sondern als etwas Selbstverständliches: Wir waren eben allgemach alte Eheleute geworden, was uns geschah, geschah allen, war etwas Natürliches. Und, wie gesagt, die Kameradschaft beim Planen, Bauen, Einrichten ersetzte uns das Verlorene vollkommen, aus Liebesleuten waren wir Kameraden geworden, wir entbehrten nichts.
Zu jener Zeit hatte sich Magda schon ganz von der tätigen Mithilfe in meinem Geschäft freigemacht, ein Schritt, den wir beide damals als selbstverständlich ansahen. Sie hatte jetzt eine größere eigene Haushaltung; der Garten und ein bisschen Federvieh erforderten auch Pflege, und der Umfang des Geschäftes gestattete ohne Weiteres die Einstellung einer neuen Hilfskraft.
Später sollte sich zeigen, wie verhängnisvoll sich das Ausscheiden Magdas aus meinem Betrieb auswirken sollte. Nicht nur, dass wir dadurch wiederum ein gut Teil unserer gemeinsamen Interessen verloren, auch stellte sich heraus, dass ihre Mithilfe eigentlich unersetzlich war. Sie war bei Weitem aktiver als ich, unternehmungslustiger, auch war sie viel geschickter als ich im Umgang mit den Menschen und vermochte sie auf eine leichte, scherzhafte Weise gerade dahin zu bekommen, wo sie die Leute haben wollte.
Ich war das vorsichtige Element in unserer Gemeinschaft, die Bremse gewissermaßen, die eine zu gewagte Fahrt hemmte und sicherte. Im Geschäftsverkehr selbst hatte ich die Neigung, mich möglichst zurückzuhalten, mich niemandem aufzudrängen und nie um etwas zu bitten. Es war demnach unvermeidlich, dass nach Magdas Ausscheiden die Geschäfte erst einmal im alten Gleis weitergingen, dass wenig Neues dazukam und dass dann allmählich, ganz langsam, Jahr um Jahr, ihr Umfang zurückging.
Über alle diese Dinge bin ich mir freilich erst viel später klar geworden, zu spät, als es schon nichts mehr zu retten gab. Damals, als Magda ausschied, war ich eher etwas erleichtert: Ein Mann, der seine Firma allein vertritt, genießt bei den Menschen ein größeres Ansehen als der, dem die Frau in alles hineinreden kann.
Fehlgeburt <<<
3
Erst, als unsere Streitereien begannen, merkte ich, wie fremd Magda und ich uns in den Jahren geworden waren, da sie ihre Hauswirtschaft besorgte und ich den Geschäften vorstand. Die ersten Male empfand ich wohl noch etwas wie Scham über unser Sichgehenlassen, und wenn ich merkte, dass ich Magda verletzt hatte, dass sie gar mit verweinten Augen umherging, schmerzte mich das fast so sehr wie sie selbst, und ich gelobte mir Besserung. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles, und ich fürchte beinahe, er gewöhnt sich am raschesten, in einem Zustand von Erniedrigung zu leben.
Es kam der Tag, da ich beim Anblick von Magdas verweinten Augen mir nicht mehr Besserung gelobte, sondern mit einer von erschrockenem Staunen untermischten Befriedigung mir sagte: ›Diesmal habe ich es dir aber ordentlich gegeben! Immer gewinnst du mit deiner raschen Zunge doch nicht die Oberhand über mich!‹ Ich fand es schrecklich, dass ich so empfand, und doch fand ich es richtig, es befriedigte mich, so zu empfinden, so paradox dies auch klingen mag. Von da an war es nur ein kleiner Schritt bis dahin, wo ich sie bewusst zu verletzen suchte.
In jenem äußerst kritischen Zeitpunkt unserer Beziehungen waren die Lebensmittellieferungen für die Gefängnisverwaltung wie alle drei Jahre neu ausgeschrieben. Wir haben in unserem Ort – gerade nicht zum Entzücken seiner Einwohner – das Zentralgefängnis der Provinz liegen, das ständig etwa fünfzehnhundert Häftlinge in seinen Mauern birgt. Seit neun Jahren hatten wir diese Lieferungen schon, Magda hatte sich seinerzeit sehr darum bemüht, sie zu erhalten. Bei den beiden späteren Vergebungen hatte sie immer nur einen kurzen Höflichkeitsbesuch bei dem entscheidenden Oberinspektor der Verwaltung gemacht, und der Zuschlag war uns ohne Weiteres zugefallen.
Ich sah diese Lieferung für einen so selbstverständlichen Teil meines Geschäftes an, dass ich auch diesmal kein weiteres Aufheben von der Sache machte: Ich ließ das alte Angebot, dessen Preisgestaltung sich nun schon seit neun Jahren bewährt hatte, abschreiben und einreichen. Ich überlegte auch einen Besuch bei dem entscheidenden Oberinspektor, aber alles lief ja in seinen eingelaufenen Bahnen; ich wollte nicht aufdringlich erscheinen, ich wusste, der Mann war mit Arbeit überlastet – kurz, ich hatte mindestens zehn gute Gründe, den Besuch zu unterlassen.
Danach traf es mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel, als mich ein Schreiben der Gefängnisverwaltung mit wenigen dürren Worten dahin unterrichtete, dass mein Angebot abgelehnt und dass die Lieferungen einer anderen Firma zugeschlagen worden seien. Mein erster Gedanke war der: dass nur Magda nichts davon erfährt! Dann nahm ich meinen Hut und eilte zu dem Oberinspektor, jetzt den Besuch zu machen, der drei Wochen früher sinnvoll gewesen wäre.
Ich wurde höflich, aber kühl aufgenommen. Der Oberinspektor bedauerte, dass die alte Geschäftsverbindung nun unterbrochen sei. Er habe aber gar nicht anders handeln können, da ein Teil der von mir genannten Preise längst überholt gewesen sei, mal nach der höheren, mal nach der niedrigeren Seite hin. Im Ganzen gleiche es sich wohl etwa aus, aber mein Angebot habe nun eben auf die maßgebenden Herren – ich möge seine Offenheit verzeihen – einfach einen schlechten Eindruck gemacht, als sei es meiner Firma ganz gleichgültig, ob sie den Zuschlag erhalte oder nicht. Ich erfuhr weiter, dass eine ganz junge, mit allen Mitteln aufstrebende Firma, die mir schon einige Male Ärger bereitet hatte, auch dieses Mal wieder als Sieger aus dem Rennen hervorgegangen war. Zum Schluss drückte der Oberinspektor noch in aller Höflichkeit die Hoffnung aus, in drei Jahren wieder mit meiner Firma in die alte Verbindung treten zu können, und ich war entlassen.
Ich wusste, ich hatte mir in dem Gefängnisbüro nichts von meiner Bestürzung, ja meiner Verzweiflung über diesen Fehlschlag anmerken lassen; ich hatte meine Erkundigung halb mit Höflichkeit, halb mit Neugier nach dem Namen des glücklichen Gewinners frisiert. Als ich aber wieder draußen vor den schweren Eisentoren des Gefängnisses stand, als der letzte Riegel rasselnd hinter mir zugeschoben war, sah ich in den hellen Sonnenschein dieses wunderbaren Frühlingstages wie jemand, der soeben aus einem schweren Traum erwacht ist und noch nicht weiß, ob er nun wirklich wach ist oder ob er noch immer unter dem Albdruck des Traumes seufzt. Ich seufzte noch unter ihm, umsonst hatte das eiserne Gittertor mich zur Freiheit entlassen, ich blieb gefangen in meinen Sorgen und Misserfolgen.
Es war mir jetzt unmöglich, in die Stadt und auf mein Kontor zu gehen, vor allem aber musste ich mich erst sammeln, ehe ich vor Magda trat – ich ging fort von der Stadt und den Menschen, ich ging in die Felder und Wiesen hinaus, immer weiter fort, als könnte ich mir und meinen Sorgen entlaufen. Ich habe aber an diesem Tage nichts von dem frischen Smaragdgrün der jungen Saaten gesehen, nicht habe ich das eilige Glucksen der Bäche und die Trommelwirbel der Lerchen in der blaugoldenen Luft gehört: Ich war grenzenlos allein mit mir und meinem Missgeschick. Mein Herz war so übervoll davon, dass nichts anderes mehr hineinkonnte.
Ich war mir ganz klar darüber, dass dies für mein Geschäft nicht mehr ein kleiner Fehlschlag war, der mit einem achselzuckenden Bedauern hingenommen werden konnte: Die Lieferung der Nahrungsmittel für fünfzehnhundert Menschen war selbst bei bescheidenem Nutzen ein so wesentlicher Teil meines Umsatzes, dass es nicht ohne einschneidende Veränderungen meines ganzen Betriebes hingenommen werden konnte. An einen Ersatz für diesen Ausfall war bei dem Mangel ähnlicher Gelegenheiten in unserer bescheidenen Provinzstadt nicht zu denken. Äußerste Tatkraft hätte die Zahl der Einzelgeschäfte um einige Dutzend steigern können, aber ganz abgesehen davon, dass dies noch lange keinen Ersatz für den Ausfall bedeutete, fühlte ich mich gerade jetzt zu dieser äußersten Tatkraft ganz unfähig. Aus irgendwelchen Gründen war ich schon seit fast einem Jahr unfrisch. Immer mehr neigte ich dazu, den Dingen ihren Lauf zu lassen und mich nicht zu sehr zu erregen. Ich war ruhebedürftig – warum, weiß ich nicht. Vielleicht wurde ich früh alt.
Es war mir klar, dass ich mindestens zwei Angestellte würde entlassen müssen, aber auch das berührte mich nicht einmal so sehr, obwohl ich wusste, wie sehr darüber geschwätzt werden würde. Nicht das Geschäft bekümmerte mich im Augenblick, sondern Magda. Immer wieder war mein Hauptgedanke, meine Hauptsorge: dass bloß Magda nichts davon erfährt! Wohl sagte ich mir, dass ich auf die Dauer die Entlassung von zwei Angestellten und den Verlust der Lieferungen überhaupt nicht vor ihr verbergen konnte. Aber ich log mir vor, dass alles darauf ankomme, dass sie nicht gerade jetzt davon erführe, dass ich in einigen Wochen vielleicht doch den einen oder anderen Ersatz gefunden haben könnte.
Dann hatte ich wieder einen hellen Augenblick. Ich blieb stehen, stieß mit dem Fuß energisch gegen einen Stein im Staube des Weges und sagte zu mir: ›Da Magda doch davon erfahren wird, ist es besser, sie erfährt es durch mich als durch anderer Leute Mund, und es ist wiederum besser, sie erfährt es heute als irgendwann. Mit jedem Tag, den du dies aufschiebst, wird das Geständnis schwerer. Schließlich habe ich kein Verbrechen begangen, sondern nur eine Nachlässigkeit.‹ Wieder stieß ich mit dem Fuß gegen den Stein: ›Ich werde Magda einfach bitten, mir wieder im Geschäft zu helfen. Das versöhnt sie mit meinem Misserfolg und bringt mir und dem Betrieb nur Nutzen. Ich bin wirklich nicht sehr frisch und kann eine Hilfskraft gut gebrauchen …‹
Aber diese hellen Augenblicke gingen schnell vorüber. Ich hatte stets so viel auf die Achtung der Leute und vor allem auf die Magdas gegeben. Ich hatte stets peinlich darauf gesehen, dass ich als der Chef respektiert wurde. Ich konnte es auch jetzt, gerade jetzt, nicht übers Herz bringen, von dieser Würde ein Jota abzulassen und mich gerade vor Magda zu demütigen. Nein, ich war entschlossen, die Lage selbst zu meistern, komme, was wolle. Ich mochte mir auch nicht von einer Frau helfen lassen, mit der ich mich fast täglich zankte. Es war klar vorauszusehen, dass sich diese Zänkereien bis ins Kontor fortsetzen würden – sie würde dort auf ihrem Willen beharren, ich würde widersprechen, sie würde mir meine Misserfolge vorwerfen – o nein, unmöglich!
Wieder stampfte ich mit dem Fuß auf, aber diesmal in den Staub des Weges. Ich sah hoch. Ich hatte keine Ahnung, wohin mich meine Füße getragen hatten, so sehr war ich in meine Sorgen versponnen gewesen. Ich stand in einem Dorf, nicht übermäßig weit von meiner Vaterstadt entfernt, einem Dorf, das wegen einiger reizender Birkenwäldchen und eines Sees ein beliebter Frühlingsausflugsort meiner Mitbürger ist. Aber an diesem Wochentagvormittag gab es hier noch keine Ausflügler, dafür ist man bei uns daheim zu fleißig. Ich stand gerade vor dem Gasthof, und ich spürte, dass ich Durst hatte.
Ich trat in die niedrige, weite, aber dunkle Schankstube ein. Ich hatte sie immer nur erfüllt von vielen Städtern gesehen, die frühlingshaft hellen Kleider der Frauen hatten den Raum heller gemacht und ihm trotz seiner Niedrigkeit etwas Beschwingtes gegeben. Denn wenn die Städter hier waren, hatten die Fenster offengestanden, auf den Tischen lagen dann bunte Decken, und überall gab es in hohen Vasen helle Sträuße von Birken. Jetzt war der Raum dunkel, auf den Tischen lag gelblich-bräunliches Wachstuch, es roch stickig, denn die Fenster waren fest verschlossen.
Hinter der Theke stand ein junges Mädchen, dessen Haar schlecht zurechtgemacht und dessen Schürze schmutzig war, es flüsterte eifrig mit einem jungen Kerl, der nach seiner kalkbespritzten weißen Kleidung ein Maurer zu sein schien.
Mein erster Impuls war der, umzukehren. Aber mein Durst und mehr noch das Gefühl, sofort wieder meinen Sorgen ausgeliefert zu sein, ließen mich stattdessen an die Theke treten. »Geben Sie mir was zu trinken, irgendwas, das den Durst löscht«, sagte ich.
Ohne aufzusehen, ließ das Mädchen Bier in ein Glas laufen, ich sah zu, wie der Schaum über den Rand troff. Das Mädchen schloss den Bierhahn, wartete einen Augenblick, bis der Schaum sich gesetzt hatte, und ließ noch einen Schuss Bier nachlaufen. Dann schob es mir, wiederum ohne ein Wort, das Glas über den stumpfen Zink zu. Es machte sich wieder an sein Flüstern mit dem Maurerburschen, bisher hatte es mich noch nicht mit einem Blick angesehen.
Ich hob das Glas zum Munde und trank es bedächtig, Schluck für Schluck, ohne einmal abzusetzen, leer. Es schmeckte frisch, prickelnd und leicht bitter, und indem es meinen Mund passierte, schien es in ihm etwas von einer Helle und Leichtigkeit zu hinterlassen, die vorher nicht in ihm gewesen war.
›Geben Sie mir noch einmal von dem‹, wollte ich sagen, besann mich aber anders. Ich hatte vor dem jungen Menschen ein helles, kurzes, gedrungenes Glas stehen sehen, das man bei uns eine »Stange« nennt und in dem gewöhnlich Korn ausgeschenkt wird. »Ich möchte auch solch eine Stange«, sagte ich plötzlich. Wie ich, der ich mein Lebtag keinen Schnaps getrunken, der ich immer eine tiefe Abneigung gegen den Geruch von Schnaps gehabt habe, dazu kam, weiß ich nicht zu sagen. In jenen Tagen änderten sich alle Gewohnheiten meines Lebens, geheimnisvollen Einflüssen war ich ausgeliefert, und genommen war mir die Kraft, ihnen zu widerstehen.
Zum ersten Male sah mich jetzt das Mädchen an. Langsam hob es die etwas körnigen Lider und blickte mich mit hellen, wissenden Augen an. »Mit Schnaps?«, fragte es.
»Mit Schnaps«, sagte ich. Das Mädchen griff nach einer Flasche, und ich überlegte mir, ob mich je in meinem Leben ein weibliches Wesen schon einmal so schamlos wissend angeschaut hätte. Dieser Blick schien bis auf den Grund meines Mannestums dringen zu wollen, als möchte er erfahren, was ich als Mann gelte; ich empfand ihn wie etwas Körperliches, etwas schmerzlich süß Beleidigendes, als sei ich nackt ausgezogen worden von diesen Augen.
Das Glas war gefüllt, es wurde zu mir über den Zink geschoben, die Lider hatten sich wieder gesenkt, das Mädchen wandte sich an den Burschen; mein Urteil war gesprochen. Ich hob das Glas, zögerte – und schüttete den Inhalt in einem plötzlichen Entschluss in die Mundhöhle. Es brannte atemraubend, dann verschluckte ich mich, zwang die Flüssigkeit aber doch die Kehle hinunter. Ich fühlte sie brennend und beizend hinunterrinnen – und in meinem Magen entstand ein plötzliches Gefühl von Wärme, einer wohltuenden, heiteren Wärme.
Dann musste ich mich am ganzen Leibe schütteln. Der Maurer sagte halblaut: »Die sich so schütteln, das sind die Schlimmsten«, und das Mädchen lachte kurz. Ich legte eine Mark auf den Zink und verließ ohne ein weiteres Wort die Gaststätte.
Der Frühlingstag empfing mich mit sonniger Wärme und leichtem, seidenfeinem Wind, aber als ein Verwandelter kehrte ich in ihn zurück. Aus der Wärme in meinem Magen war eine Helligkeit in meinen Kopf emporgestiegen, mein Herz pochte frei und stark. Jetzt sah ich das Smaragdgrün der jungen Saaten, jetzt hörte ich die Lerchenwirbel im Blau. Meine Sorgen waren von mir abgefallen. ›Es wird sich alles schon einmal regeln‹, sagte ich mir heiter und schlug den Weg heimwärts ein. ›Warum sich jetzt schon drum plagen?‹ Ehe ich in die Stadt kam, kehrte ich noch in zwei weiteren Gasthäusern ein und trank in jedem noch solch ein Stängchen, um die rasch verfliegende Wirkung wiederzuholen und zu verstärken. Mit einem leichten, aber nicht unangenehmen Benommenheitsgefühl langte ich zu Hause gerade zur rechten Zeit für das Mittagessen an.
4
Ich war mir klar darüber, dass ich vor meiner Frau nun nicht nur den Fehlschlag in den Lebensmittellieferungen, sondern auch mein Trinken verheimlichen musste. Aber ich fühlte mich im Augenblick der ganzen Welt so überlegen, dass ich überzeugt war, dies würde mir nicht die geringste Schwierigkeit machen. Ich verweilte länger als sonst im Badezimmer und wusch mich nicht nur besonders sorgfältig, sondern putzte mir auch lange und gründlich die Zähne, um jeden Alkoholgeruch zu vertreiben. Ich wusste noch nicht, welche Haltung ich Magda gegenüber einnehmen sollte, aber ein dunkles Gefühl warnte mich davor, zu gesprächig zu sein – wofür ich eine starke Neigung verspürte –, besser würde vielleicht eine ruhige Pose gehaltenen Ernstes sein.
Die Suppe war schon aufgefüllt, und Magda erwartete mich bereits, als ich eintrat. Ich gab ihr flüchtig die Hand und machte ein paar Bemerkungen über das herrliche Frühlingswetter. Sie stimmte mir zu und erzählte einiges von den jetzt dringenden Bestellarbeiten im Garten, auch bat sie mich, ihr heute Abend eine bestimmte Gemüsesämerei, deren Fehlen sie eben erst bemerkt habe, aus der Stadt mitzubringen. Ich sagte ihr prompteste Erledigung zu, und so kamen wir ohne jede Fährnis über die Suppe. Ich merkte wohl, dass mich Magda ab und zu prüfend, beinahe mit stummer Frage von der Seite ansah, aber in dem Gefühl, dass mir unmöglich etwas angemerkt werden konnte und dass alles vorzüglich ging, beachtete ich diese Blicke nicht. Übrigens erinnere ich mich, dass ich an diesem Mittag die Suppe mit besonderem Appetit aß.
Else räumte die Teller ab und flüsterte dabei meiner Frau irgendeine Küchenfrage zu, durch die Magda veranlasst wurde, aufzustehen und mit Else in die Küche zu gehen, wohl um irgendetwas abzuschmecken oder zu tranchieren. Ich blieb allein im Speisezimmer, auf den Fleischgang wartend. Ich dachte an nichts Besonderes, ich war von einer heiteren Zufriedenheit erfüllt, das Leben gefiel mir. Keine Ahnung hatte ich von dem, was ich nun sofort tun würde.
Plötzlich – mir selbst überraschend – stand ich auf, schlich eilig auf den Zehenspitzen zur Anrichte, öffnete die untere Tür, und richtig – da stand noch die Rotweinflasche, die wir an jenem verhängnisvollen Novemberabend, als unsere Streitereien begannen, angetrunken hatten! Ich hob sie gegen das Licht: Sie war, wie ich es nicht anders erwartet hatte, noch halb gefüllt. Ich hatte keine Zeit zu verlieren, jeden Augenblick konnte Magda zurückkommen. Mit den Nägeln zog ich den ziemlich weit in den Hals getriebenen Korken heraus, setzte die Flasche an den Mund und trank, trank aus der Flasche wie ein alter Säufer! (Aber was sollte ich tun? Für die Benutzung eines Glases war keine Zeit, ganz abgesehen davon, dass ein benutztes Glas eine verräterische Spur gewesen wäre.) Ich nahm drei, vier sehr kräftige Schlucke, hielt die Flasche wieder gegen das Licht und sah, dass in ihr nur ein schäbiger Rest war. Ich trank auch ihn aus, verkorkte die Flasche wieder, schloss die Anrichtentür ab und schlich an meinen Platz zurück.
In mir wogte es, mein Magen, gereizt durch die plötzliche starke Alkoholzufuhr, machte einige krampfhafte Bewegungen, vor meinen Augen lag eine Art feuriger Nebel, und Stirn und Hände waren schweißnass. Ich hatte gewaltig zu tun, bis zur Rückkehr Magdas einigermaßen wieder meiner Herr zu werden. Dann saß ich mit einem Gefühl angenehmer Hingegebenheit an meinen Rausch zu Tisch, und nur die Notwendigkeit, wenigstens pro forma etwas zu essen, machte mir Schwierigkeiten. Mein Magen schien ein sehr zerbrechliches Ding, dabei jederzeit bereit, sich zu empören; jeden einzelnen Bissen musste ich ihm mit äußerster Vorsicht zuführen und bedauerte dabei, durch diese aus äußeren Rücksichten gebotene Nahrungszufuhr den still wirken wollenden Rausch zu stören.
Daran, dass es vielleicht gut wäre, ein paar Worte mit Magda zu wechseln, dachte ich überhaupt nicht. Dafür beschäftigte mich ein anderes Problem, das mir plötzlich schwere Sorgen bereitete. Wohl stand die Rotweinflasche wieder verkorkt in der Anrichte, aber bei der Genauigkeit, mit der Magda ihren Haushalt führte, musste sie binnen Kurzem ihre Leere merken. Unmöglich konnte ich das zulassen, ich musste rechtzeitig dagegen Vorkehrungen treffen. Aber wie unglaublich schwierig das war!
Die beste Lösung würde sein, gleich heute Nachmittag eine andere Flasche Rotwein zu kaufen, etwa die Hälfte fortzuschütten und sie an die Stelle der ausgetrunkenen zu stellen. Aber wann sollte ich das tun, wie kam ich an das Büfett, da ich doch den Nachmittag über im Geschäft sein musste, und da Magda und ich den Abend stets gemeinsam verbrachten, sie mit einer Handarbeit, ich mit meinen Zeitungen beschäftigt – wann? Und wo blieb ich mit der leeren Flasche? Würde ich denn überhaupt einen Wein gleicher Marke zu kaufen bekommen? Erinnerte sich Magda der Sorte, der Art des Etiketts? Am besten würde es sein, etwa um Mitternacht heimlich aufzustehen, das Etikett der alten Flasche vorsichtig abzulösen und auf die volle aufzukleben! Aber wenn mich Magda dabei überraschte! Und hatten wir überhaupt Leim im Hause? Ich würde in meiner Aktentasche welchen aus dem Büro einschmuggeln müssen!
Je länger ich darüber nachdachte, um so komplizierter wurde die ganze Angelegenheit, eigentlich war sie schon ganz unlösbar. Es war eine sehr einfache Sache gewesen, die Flasche leer zu trinken, aber ich hätte vorher daran denken sollen, wie schwierig es sein würde, den Zustand wie vorher herzustellen. Wenn ich die Flasche einfach zerbräche und vorgäbe, ich hätte sie beim Suchen nach irgendwas umgestoßen? Aber es war kein Wein mehr in ihr, der hätte ausfließen können! Oder konnte ich es wagen, sie einfach halb mit Wasser zu füllen, und die eigentliche Nachfüllung auf einen späteren Tag verschieben?
Es ging immer wirrer in meinem Kopf zu, nicht nur das Essen, auch Magda hatte ich ganz und gar über meinen Gedanken vergessen. So schrak ich völlig zusammen, als sie mich mit echter Besorgnis in der Stimme fragte: »Was ist mit dir, Erwin? Bist du krank? Hast du Fieber – du siehst so rot aus?«
Ich griff gierig nach diesem Rettungsanker und sagte ruhig: »Ja, ich glaube wirklich, ich bin nicht ganz in Ordnung. Ich glaube, ich lege mich am besten einen Augenblick hin. Ich habe – ich habe solchen Blutandrang im Kopf …«
»Ja, Erwin, das tu. Lege dich gleich ins Bett. Soll ich Dr. Mansfeld anrufen?«
»Ach, Unsinn!«, rief ich ärgerlich. »Ich will mich nur eine Viertelstunde auf das Sofa legen, ich werde gleich wieder in Ordnung sein. Ich muss dann auch sofort ins Geschäft.«
Sie geleitete mich wie einen Schwerkranken zum Sofa, half mir, mich hinzulegen, und legte eine Decke über mich. »Hast du Ärger im Geschäft gehabt?«, fragte sie ängstlich. »Sage mir doch, was dich bedrückt, Erwin. Du bist ganz verändert!«
»Nichts, nichts«, sagte ich, plötzlich ärgerlich. »Ich weiß nicht, was du willst. Ein bisschen Schwindel oder Blutandrang – und gleich soll etwas mit dem Geschäft sein! Prima geht es mit dem Geschäft, einfach prima!«
Sie seufzte leise. »Also dann schlaf gut, Erwin!«, sagte sie. »Soll ich dich wecken?«
»Nein, nein, nicht nötig. Ich wache von selbst auf – in einer Viertelstunde oder so …«
Damit war ich endlich allein; ich legte den Kopf zurück, und der Alkohol floss nun in ungehemmter freier Welle ganz durch mich hindurch, mit einer samtenen Schwinge bedeckte er alle meine Sorgen und Kümmernisse, selbst den kleinen, ganz frischen Ärger, dass ich Magda so unnötig einen »prima« Gang der Geschäfte vorgelogen hatte, schwemmte er fort. Ich schlief … Ich schlief? Nein, ich war ausgelöscht. Ich war nicht mehr …
5
Es fängt schon an zu dämmern, als ich erwache. Ich werfe einen erschrockenen Blick auf die Uhr: Es ist zwischen sieben und acht Uhr abends. Ich lausche in das Haus, nichts rührt sich. Ich rufe erst leise, dann lauter: »Magda!« Aber sie kommt nicht. Ich stehe mühsam auf. Ich fühle mich am ganzen Körper zerschlagen, mein Kopf ist dumpf und meine Mundhöhle trocken und pelzig. Einen Blick werfe ich in das Speisezimmer nebenan: Kein Abendbrottisch ist gedeckt, und dies ist die Stunde, zu der wir sonst nachtmahlen. Was ist los? Was ist geschehen, während ich schlief? Wo ist Magda?
Nach einigem Überlegen taste ich mich nach der Küche hin; das Gehen fällt mir schwer, es ist, als seien alle meine Glieder steif und verbogen, sie bewegen sich so schwer in ihren Gelenken.
Ich habe halb erwartet, auch die Küche leer und halbdunkel zu finden, aber in ihr brennt das Licht, und am Tisch steht Else, mit irgendeiner Plätterei beschäftigt. Sie sieht erschrocken auf, als ich hereinkomme, und ihr Gesichtsausdruck wird auch nicht zutraulicher, als sie sieht, dass ich es bin. Ich kann mir wohl denken, dass ich etwas wüst aussehe. Plötzlich habe ich das Gefühl, am ganzen Körper schmierig zu sein. Ich hätte zuerst ins Badezimmer gehen müssen, früher hätte ich mich nie so gehen lassen.
»Wo ist meine Frau, Else?«, frage ich.
»Die gnädige Frau ist in die Stadt gegangen«, antwortet Else, mit einem kurzen, fast ängstlichen Aufblicken zu mir.
»Aber es ist Abendbrotzeit, Else!«, sage ich vorwurfsvoll, obwohl ich nicht die geringste Neigung habe, jetzt ein Abendessen einzunehmen.
Else zuckt erst die Achseln, dann sagt sie, wieder mit einem raschen Aufblick: »Es ist vom Geschäft angerufen worden; ich glaube, Ihre Frau ist ins Geschäft gegangen …«
Ich schlucke mühsam, ich fühle, wie mein Mund trocken geworden ist. »Ins Geschäft?«, murmele ich. »O du lieber Gott! Was will denn meine Frau im Geschäft, Else?«
Sie zuckt die Achseln. »Ich weiß doch nicht, Herr Sommer«, sagt sie, »die gnädige Frau hat mir nichts gesagt.« Sie besinnt sich, dann setzt sie hinzu: »Die haben gleich nach drei angerufen, und seitdem ist Ihre Frau fort …«
Über vier Stunden ist Magda also schon im Geschäft – ich bin verloren. Wieso ich verloren bin, weiß ich nicht, aber dass ich’s bin, das weiß ich. Ich werde schwach in den Knien, ich stolpere ein paar Schritte vorwärts und lasse mich schwer auf einen Küchenstuhl fallen. Den Kopf werfe ich auf den Küchentisch. »Es ist aus und vorbei, Else«, stöhne ich, »ich bin verloren. Ach, Else …«
Ich höre, wie sie mit einem erschrockenen Laut das Plätteisen aufsetzt, dann kommt sie zu mir gegangen und legt die Hand auf meine Schulter. »Was ist denn, Herr Sommer?«, fragt sie. »Ist Ihnen nicht gut?«
Ich sehe sie nicht, ich hebe das Gesicht nicht aus dem Schutz meines Armes, ich schäme mich vor diesem jungen Ding meiner hervorquellenden Tränen. Es ist ja alles aus und vorbei, alles verloren, Firma, Ehe, Magda – ach, hätte ich nur heute Mittag nicht auch noch den Rotwein ausgetrunken, davon ist erst alles so schlimm geworden, ohne das wäre Magda nie ins Geschäft gegangen. (Flüchtiger Nebengedanke: Das mit der leeren Rotweinflasche muss ich auch noch in Ordnung bringen!)
Else schüttelt mich leicht an der Schulter. »Herr Sommer«, sagt sie, »lassen Sie sich doch nicht so gehen! Legen Sie sich noch einen Augenblick hin, und ich mache Ihnen unterdes sofort Abendessen.«
Ich schüttele den Kopf. »Ich will kein Abendessen, Else! Meine Frau müsste jetzt hier sein, es ist doch Zeit …«
»Oder«, sagt Else überredend, »wollen Sie hier bei mir in der Küche ein bisschen essen, Herr Sommer?« Selbst etwas bedenklich: »Wo Ihre Frau doch fort ist …«
Dieser ganz unerhörte Vorschlag hat gerade durch seine Neuheit etwas Bestechendes. Hier in der Küche bei Else essen – was Magda wohl dazu sagen würde? Ich hebe den Kopf und sehe Else zum ersten Mal richtig an. Ich habe sie noch nie so angesehen, für mich war sie immer nur ein dunkler Schatten meiner Frau in den hinteren Regionen des Hauses. Jetzt sehe ich, dass Else ein recht nettes dunkelhaariges Mädchen von etwa siebzehn Jahren und etwas robuster Schönheit ist. Sie hat unter einer hellen Bluse eine volle Brust, und bei dem Gedanken, wie jung diese Brust ist, fühle ich eine Welle von Hitze über mich laufen.
Aber dann besinne ich mich. All dies ist unmöglich, schon mein Sich-vor-Else-Gehenlassen eben war ganz unmöglich. »Nein, Else«, sage ich und stehe auf. »Es ist sehr nett von dir, dass du mich ein wenig trösten willst, aber ich gehe jetzt besser auch ins Geschäft. Sollte ich meine Frau verfehlen, sage ihr bitte, ich sei auch ins Geschäft gegangen.« Ich wende mich zum Gehen.
Plötzlich wird es mir schwer, aus der Küche und von diesem freundlichen Mädchen fortzugehen. Ich stehe da noch einen Augenblick unter der Tür und sehe sie an. Es fällt mir auf, wie blass ihr Gesicht ist und wie gut die dunklen, hochgeschwungenen Augenbrauen dazu passen. »Ich habe viele Sorgen, Else«, sage ich unvermittelt, »und ich habe keinen, Else, der mir beisteht.« Ich wiederhole mit Nachdruck: »Keinen und keine, Else, du verstehst mich?!«
»Ja, Herr Sommer«, antwortet sie leise.
»Ich danke dir, Else, dass du so nett zu mir warst«, sage ich noch und gehe. Erst als ich mich im Badezimmer zurechtmache, fällt mir ein, dass ich soeben Magda verraten habe. Verraten und betrogen. Betrogen und belogen. Aber gleich zucke ich die Achseln: Recht so! Immer tiefer hinab. Immer schneller hinein. Nun gibt es doch kein Halten mehr!
6
Vorsichtig ging ich den Weg zu meinem Geschäft, vorsichtig, denn ich wollte es um jeden Preis vermeiden, Magda auf der Straße zu treffen. Dann stand ich auf der anderen Straßenseite im Schatten einer Einfahrt und sah zu den fünf Parterrefenstern meiner Firma hinüber. Zwei, mein Chefbüro, waren erleuchtet, und manchmal sah ich auf den Milchglasscheiben die Schattenrisse zweier Gestalten: Magdas und die meines Buchhalters Hinzpeter. ›Sie machen Bilanz!‹, sagte ich mir mit einem tiefen Erschrecken, und doch war diesem Erschrecken ein Gefühl der Erleichterung beigemischt, weil ich nun die Führung des Geschäftes in den tatkräftigen Händen Magdas wusste. Das sah ihr so recht ähnlich, sofort nach dem Erfahren der schlimmen Nachrichten sich volle Klarheit zu verschaffen, die Bilanz zu ziehen!
Mit einem tiefen Seufzer wandte ich mich ab und ging durch die Stadt hindurch, aus ihr hinaus, aber nicht meinem Heim zu. Was sollte ich auf dem Büro, was in meinem Heim? Die Vorwürfe noch aufsuchen, die mir notwendig gemacht werden mussten, eine Rechtfertigung versuchen, dort, wo nichts zu rechtfertigen war? Nichts von alledem – und indem ich wieder in das langsam immer dunkler werdende Land hinauswanderte, wurde mir mit schmerzhafter Gewissheit klar, dass ich ausgespielt hatte. Ich hatte, endgültig, meine Stellung und meinen Sinn im Leben verloren, und ich fühlte nicht die Kraft in mir, eine neue zu suchen oder gar um die verlorene zu kämpfen. Was sollte ich noch? Wozu lebte ich noch? Da ging ich dahin, wanderte fort von Kontor, Frau, Vaterstadt, ließ das alles hinter mir – aber ich musste doch einmal wieder heimkehren, nicht wahr? Ich musste mich Magda gegenüberstellen, ihre Vorwürfe anhören, mich mit Recht Lügner und Betrüger schelten lassen, musste zugeben, dass ich versagt hatte, auf eine schmähliche und feige Art versagt!
Unerträglich war dieser Gedanke, und ich fing an, mit dem Gedanken zu spielen, gar nicht wieder heimzukehren, in die weite Welt hinauszugehen, irgendwo im Dunkel unterzutauchen, in einem Dunkel, in dem man auch untergehen konnte – ohne Nachricht, ohne letzten Ruf. Und während ich mir das alles – in leichter Rührung über mich selbst – ausmalte, wusste ich doch, dass ich mir etwas vorlog, nie würde ich den Mut haben, ohne Zureden, ohne die Geborgenheit des heimischen Herdes zu leben. Nie würde ich auf das gewohnte weiche Bett verzichten können, die Ordnung des Heims, die pünktlichen nahrhaften Mahlzeiten! Ich würde heimkehren zu Magda, all meinen Ängsten zum Trotz, diese Nacht noch würde ich heimkehren, in mein gewohntes Bett – nichts da von einem Leben draußen im Dunkel, von einem Leben und einem Sterben in der Gosse!
›Aber‹, sagte ich mir dann wieder und beschleunigte meinen eiligen Schritt noch, ›aber was ist denn eigentlich los mit mir? Ich bin doch früher ein leidlich tatkräftiger und unternehmungslustiger Mensch gewesen. Ein wenig schwach war ich stets, aber das habe ich so gut zu verbergen gewusst, dass es bis heute wohl nicht einmal Magda gemerkt hat. Woher kommt die Schlaffheit, die mich seit einem Jahr immer stärker befällt, die mir Glieder und Hirn lähmt, die aus mir, einem immer leidlich anständigen Menschen, einen Betrüger an seiner Frau macht, der den Busen seines Hausmädchens mit befriedigter Lüsternheit betrachtet! Der Alkohol kann es nicht sein, ich trinke ja erst seit heute Schnaps, und die Schlaffheit liegt schon so lange über mir. Was ist es nur?‹
Ich riet hin und her. Ich dachte daran, dass ich soeben die Vierzig überschritten hatte; ich hatte einmal etwas von den »Wechseljahren des Mannes« reden hören – aber ich wusste von keinem Mann meiner Bekanntschaft, der beim Überschreiten der Vierzig sich so verändert hatte wie ich mich. Dann fiel mir mein liebloses Dasein ein. Ich hatte immer nach Anerkennung und Liebe gedürstet, in aller gebotenen Heimlichkeit natürlich, und ich hatte sie in einem reichen Maße gefunden, sowohl bei Magda wie bei meinen Mitbürgern. Und nun hatte ich sie allmählich verloren. Ich wusste selbst nicht, wie das alles gekommen war. Hatte ich diese Liebe und diese Anerkennung verloren, weil ich schlaff geworden war, oder war ich schlaff geworden, weil mir diese Aufmunterungen gefehlt hatten? Ich fand auf alle diese Fragen keine Antwort: Ich war es nicht gewohnt, über mich nachzudenken.
Ich ging immer schneller, ich wollte endlich dorthin kommen, wo es Frieden vor diesen quälenden Fragen gab. Endlich stand ich wieder vor meinem Ziel, vor demselben Dorfgasthaus, das ich auch an diesem verhängnisvollen Vormittag aufgesucht hatte; ich sah durch die Fenster der Wirtsstube nach jenem Mädchen mit den blassen Augen aus, das mein Mannestum nach einem schamlosen Blick so gering eingeschätzt hatte. Ich sah es sitzen unter dem trüben Schein einer einzigen kleinen Glühbirne, mit irgendeiner Näherei beschäftigt. Ich sah es lange an, ich zögerte, und ich fragte mich, warum ich gerade es aufgesucht hatte, in einem Gefühl schmerzender, wollusterfüllter Selbsterniedrigung. Und auch auf diese Frage fand ich keine Antwort.
Aber ich war all dieses Fragens müde, ich lief fast den Plattenweg zum Gasthof hinauf, tastete im dunklen Flur nach der Klinke, trat rasch ein, rief mit verstellter Munterkeit: »Da bin ich, mein schönes Kind!« und warf mich in einen Korbsessel neben sie. All das, was ich eben getan hatte, glich so wenig dem, was ich sonst zu tun pflegte, wich so sehr von meiner früheren Gesetztheit, meinem gemessenen Benehmen ab, dass ich mir selbst mit einem unverhohlenen Staunen zuschaute, ja mit einer fast ängstlichen Betretenheit, wie man vielleicht einem Schauspieler zuschaut, der eine sehr gewagte Rolle übernommen hat, von der ganz und gar nicht sicher ist, dass er sie auch überzeugend zu Ende spielen kann.
Das Mädchen sah von seiner Näherei auf, einen Augenblick waren die hellen Augen auf mich gerichtet, die Spitze ihrer Zunge erschien rasch im Mundwinkel. »Ach, Sie sind es!«, sagte es dann bloß, und in diesen vier Wörtchen lag wiederum ihr Urteil über meine Person.
»Ja, ich bin es, meine Holde!«, sagte ich eilig mit jener mir so fremden Zungengeläufigkeit und Anmaßung. »Und ich möchte gerne wieder eins oder zwei oder auch fünf Ihrer so vorzüglichen Stängchen trinken, und wenn Sie es mögen, trinken Sie mit mir.«
»Ich trinke nie Schnaps«, sagte das Mädchen mit kühler Abwehr, stand aber auf, ging an die Theke, holte ein kleines Glas und eine Flasche und schenkte mir am Tisch ein. Sie setzte sich und stellte die Flasche auf den Boden neben sich. »Übrigens«, sagte sie dann, ihre Näherei wieder aufnehmend, »schließen wir in einer Viertelstunde.«
»Umso schneller werde ich trinken«, sagte ich, setzte das Glas an und trank es aus. »Wenn Sie aber keinen Schnaps trinken«, fuhr ich fort, »so will ich auch gern eine Flasche Wein oder auch Sekt, wenn es so etwas hier gibt, für Sie bezahlen. Es soll mir nicht darauf ankommen.«
Sie hatte unterdes mein Glas wieder gefüllt, und wieder leerte ich es auf einen Zug. Schon hatte ich alles Vergangene und vor mir Liegende vergessen, ich lebte nur dieser Minute, diesem spröden und doch wissenden Mädchen, das mich mit so offenkundiger Verachtung behandelte.
»Sekt haben wir schon«, sagte sie, »und ich trinke ihn auch gerne. Ich mache Sie aber darauf aufmerksam, dass ich mich weder betrinken werde noch wegen einer Flasche Sekt ins Bett bringen lasse.« Jetzt sah sie mich wieder an, mit einem vollen schamlosen Blick begleitete sie ihre schamlosen Worte.
Ich musste meine Rolle weiterspielen. »Wer denkt an so etwas, meine Hübsche?«, rief ich unbekümmert. »Holen Sie sich Ihren Sekt. Sie sollen ihn unbelästigt in meiner Gegenwart austrinken dürfen. Sie sind«, sagte ich stärker, nachdem ich wieder getrunken hatte, »für mich wie ein Engel von einem anderen Stern, ein böser Engel, den mir mein Schicksal in den Weg gesandt hat. Es genügt mir, Sie anzuschauen.«
»Anschauen kostet nichts«, sagte sie mit einem kurzen Auflachen, das böse klang. »Sie sind mir ein seltsamer Heiliger, aber ich denke, ich erfahre noch heute Abend, warum Sie so – aufgeregt sind.« Damit schenkte sie mir wieder ein und stand auf, den Sekt zu holen.
Diesmal blieb sie länger fort. Sie zog die Vorhänge vor die Fenster, dann ging sie aus dem Haus, und ich hörte sie die Läden, dann die Haustür schließen. Während sie wieder durch die Gaststube ging, sagte sie im Vorübergehen zu mir: »Ich habe schon geschlossen, es kommt doch keiner mehr. Und die Wirtsleute liegen auch schon im Bett.« Dies sagte sie im Vorübergehen, blieb dann stehen und sagte mit spöttischer Betonung: »Aber deswegen brauchen Sie sich keine Hoffnungen zu machen!«
Ehe ich noch antworten konnte, war sie wieder gegangen. Ich nutzte die Zeit ihrer Abwesenheit, mir ganz schnell zwei, drei Gläser hintereinander aus der Flasche einzuschenken.
Dann kam sie zurück, mit einer goldgeköpften Flasche in der Hand. Sie stellte ein Spitzglas vor sich auf den Tisch, löste den Draht geschickt mit einigen Biegungen und drehte den Korken aus der Flasche, ohne es knallen zu lassen. Der weiße Schaum troff über den Rand, sie goss rasch ein, wartete einen Augenblick und goss wieder ein. Dann hob sie das Glas zum Mund. »Ich trinke nicht auf Ihr Wohl«, sagte sie, »denn dann möchten Sie mit mir anstoßen, und für den Augenblick haben Sie genug getrunken.«
Ich widersprach ihr nicht. Mein ganzer Körper war tatsächlich so von Trunkenheit erfüllt, dass sie wie ein schwärmendes Bienenvolk in ihm zu summen schien: Keine Stelle war frei von ihr.
Sie setzte das Glas ab, sah mich mit eingekniffenen Augen an und fragte spöttisch: »Nun, wie viel Schnäpse haben Sie sich in meiner Abwesenheit eingeschenkt? Fünf? Sechs?«
»Nur drei!«, antwortete ich und lachte. Ich kam überhaupt nicht auf die Idee, mich zu schämen, vor diesem Mädchen vergingen einem solche Gefühle vollständig. »Wie heißt du übrigens?«
»Willst du öfter kommen?«, fragte sie dagegen.
»Vielleicht«, antwortete ich etwas verwirrt. »Wieso?«
»Wozu willst du sonst meinen Namen wissen? Für die halbe Stunde, die wir hier noch sitzen, reicht ›kleine Hübsche‹ oder wie du sonst sagst, vollkommen …«
»Also sag deinen Namen nicht«, rief ich, plötzlich gereizt. »Wie egal mir das ist!«
Ich griff zur Flasche und schenkte mir wieder ein. Schon jetzt war mir klar, dass ich völlig betrunken war und dass ich nicht mehr weitertrinken durfte. Dennoch blieb der Hang weiterzutrinken stärker. Das farbige Gespinst in meinem Hirn verlockte mich, die nie betretenen dunklen Dickichte in meinem Innern reizten meinen Fuß; ferne rief leise nach mir eine Stimme, ich wusste nicht, was, jedenfalls Lockung …
»Ich weiß nicht, ob ich öfter hierherkommen werde«, sagte ich hastig. »Ich kann dich nicht ausstehen, ich hasse dich, und trotzdem bin ich heute Abend zu dir zurückgekehrt. Heute früh habe ich den ersten Schnaps meines Lebens getrunken, du hast ihn mir eingeschenkt, du hast dich mit ihm eingeschlichen in mein Blut, vergiftet hast du mich! Du bist wie der Geist des Schnapses: schwebend, trunken machend, feil …« Ich sah sie an, atemlos, selbst am meisten überrascht von diesen Worten, die aus mir sich hinausschleuderten, ich wusste nicht woher …
Sie saß mir gegenüber. Ihre Näherei hatte sie nicht wieder aufgenommen. Die Beine ohne Strümpfe in roten Schuhen hatte sie übergeschlagen, und den Rock ein wenig von den Knien zurückgeschoben. Die Beine waren etwas derb, aber lang und schön gefesselt. An der rechten Wade sah ich ein fast pfenniggroßes, braunes Muttermal – das schien mir schön. In der Hand hielt sie eine Zigarette, sie blies den Rauch breit durch die fest geschlossenen Lippen, ohne Zwinkern sah sie mich an. »Nur weiter, Väterchen«, sagte sie, »du entwickelst dich … nur weiter …«
Ich versuchte, nachzudenken. Wovon hatte ich eben noch geredet? Das Verlangen, sie zu umarmen, sie zu betasten, wurde fast übermächtig in mir. Aber ich lehnte mich fest in meinen Korbsessel zurück, ich klammerte mich mit meinen Händen an die Lehnen. Plötzlich hörte ich mich dann wieder sprechen. Ich sprach ganz langsam und sehr deutlich, und doch war ich atemlos vor Erregung. »Ich bin ein Kaufmann«, hörte ich mich sagen. »Ich hatte ein recht gutes Geschäft, aber jetzt stehe ich vor dem Bankrott. Sie werden mich auslachen, alle, alle, meine Frau zuerst … Ich habe viele Fehler gemacht, Magda wird sie mir alle vorhalten. Du weißt doch, Magda ist meine Frau …?«
Sie sah mich unverwandt an, mit ihrem sehr weißen, wie gepuderten Gesicht, das etwas Gedunsenes hatte; hoch und gewölbt standen in ihm über den fast farblosen Augen die dunklen Brauen.
»Aber ich kann noch Geld herausziehen, aus dem Geschäft, ein paar Tausend Mark. Ich täte es schon, um Magda zu ärgern. Magda will das Geschäft retten. Ist sie mehr als ich? Ich könnte das Geschäft verkaufen, ich weiß auch schon, an wen, es ist eine junge Firma. Er würde mir zehn-, vielleicht auch zwölftausend Mark dafür geben, wir würden auf Reisen gehen … Warst du schon einmal in Paris?«
Sie sah mich an, keine Zustimmung oder Verneinung war auf ihrem Gesicht zu lesen.





























