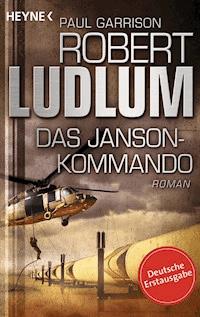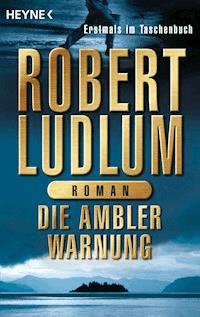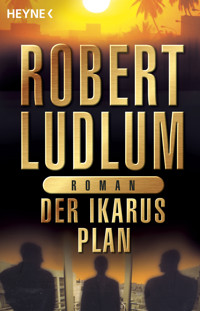8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein Amerikaner im besetzten Paris. Keiner weiß, dass er für den Geheimdienst arbeitet. Was für ihn bisher weitgehend ein Spiel war – mit schönen Frauen, Partys und vielen interessanten Freunden – ist auf einmal tödlicher Ernst. Er wird enttarnt und steht plötzlich alleine da: ohne Kontakte, ohne Plan und ohne Auftrag und mit nur einer einzigen Möglichkeit zur Flucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 806
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelThe Tristan Betrayalbei St. Martin’s Press
Copyright © 2003 by Myn Pyn LLC
Copyright © 2005 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
Herstellung: Helga Schörnig
ISBN 978-3-641-09009-8V002
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
MOSKAU, AUGUST 1991
Die lang gestreckte, schwarze Limousine mit schussfesten Scheiben mit Polykarbonateinlage, mit Reifen, die auch ohne Luftdruck rollten, und einer High-Tech-Panzerung aus Keramikmaterial und doppelt gehärteten Panzerplatten aus Flussstahl wirkte schockierend fehl am Platz, als sie in den Bittsewsky-Forst südwestlich der Großstadt rollte. Dies war ein urzeitliches Gebiet, noch heute Urwald, dicht mit Birken- und Espenbeständen bewachsen, die mit Tannen, Ulmen und Ahornen durchsetzt waren. Diese Wildnis kündete von umherstreifenden Jägern der Steinzeit, die dieses von Gletschern geformte Gebiet durchstreift hatten und inmitten einer von Zähnen und Krallen blutroten Natur mit handgeschnitzten Wurfspeeren auf Mammutjagd gegangen waren. Im Gegensatz dazu kündete der gepanzerte Lincoln Continental von einer ganz anders gearteten Zivilisation mit andersartiger Gewalt, von einer Ära der Heckenschützen und Terroristen, die mit Sturmgewehren und Splitterhandgranaten bewaffnet waren.
Moskau war eine belagerte Stadt. Es war die Hauptstadt einer Supermacht, deren Zusammenbruch unmittelbar bevorstand. Kommunistische Hardliner bildeten eine Verschwörung und schickten sich an, Russland den Reformkräften wieder zu entreißen. Zehntausende von Soldaten füllten die Stadt und waren bereit, auf die Einwohner Moskaus zu schießen. Kolonnen aus Panzern und gepanzerten Mannschaftstransportern rasselten den Kutusowsky-Prospekt und die Minskoje-Chaussee entlang. Panzer riegelten das Moskauer Rathaus, Fernsehsender, Zeitungsredaktionen und das Parlamentsgebäude ab. Der Rundfunk sendete nur noch die Dekrete der Verschwörer, die sich als Staatskomitee für den Notstand bezeichneten. Nach Jahren des Fortschritts in Richtung Demokratie war die Sowjetunion drauf und dran, wieder in die Fänge der dunklen Mächte des Totalitarismus zu geraten.
Hinten in der Limousine saß ein alter Mann, silberhaarig, mit gut geschnittenen, aristokratischen Gesichtszügen. Es war Botschafter Stephen Metcalfe, eine Ikone des amerikanischen Establishments, der Berater von fünf Präsidenten seit Franklin D. Roosevelt, ein märchenhaft reicher Mann, der sein Leben in den Dienst seines Landes gestellt hatte. Botschafter Metcalfe war freilich pensioniert und trug diesen Titel nur noch ehrenhalber, doch er war von einem alten Freund, der im engsten Führungskreis der Sowjetmacht eine hohe Position bekleidete, dringend nach Moskau gerufen worden. Sein Freund und er hatten sich seit Jahrzehnten nicht mehr persönlich getroffen; ihre Freundschaft war ein streng gehütetes Geheimnis, das niemand in Moskau oder Washington kannte. Dass sein russischer Freund mit dem Decknamen »Kurwenal« auf einem Treffen in dieser gottverlassenen Gegend bestanden hatte, war beunruhigend, aber dies waren beunruhigende Zeiten.
Der nachdenkliche und sichtlich nervöse Alte stieg erst aus seiner Limousine, als er die Gestalt seines Freundes, des Drei-Sterne-Generals, erkannte, der nun, von seiner Beinprothese stark behindert, auf ihn zuhumpelte. Als der Amerikaner sich in Bewegung setzte, suchte er mit erfahrenem Blick den Wald ab, und dann hatte er das Gefühl, das Blut gefriere ihm in den Adern.
Er entdeckte einen Beobachter zwischen den Bäumen. Einen zweiten, einen dritten Mann! Überwachung. Der Russe mit dem Decknamen Kurwenal und er waren entdeckt worden!
Das konnte für sie beide eine Katastrophe bedeuten!
Metcalfe wollte seinem alten Freund etwas zurufen, wollte ihn warnen, aber dann sah er in der Spätnachmittagssonne den glitzernden Reflex auf dem Objektiv eines Zielfernrohrs. Scharfschützen! Ein Hinterhalt!
Der alte Botschafter warf sich in panischer Angst herum und trabte zu der gepanzerten Limousine zurück, so schnell es seine arthritischen Gelenke zuließen. Er war ohne Leibwächter gekommen; er verzichtete stets auf diese Begleiter. Er hatte nur seinen Fahrer, einen unbewaffneten Marineinfanteristen, den die Botschaft ihm gestellt hatte.
Plötzlich stürmten von allen Seiten Männer auf ihn zu. Schwarz uniformierte Gestalten mit schwarzen paramilitärischen Baretten und schussbereit gehaltenen Maschinenpistolen. Als sie ihn umzingelten, begann er sich zu wehren, aber er war kein junger Mann mehr, wie er sich auch heute wieder sagen musste. War dies eine Entführung? Wurde er als Geisel genommen? Er rief heiser nach seinem Fahrer.
Die Schwarzuniformierten führten Metcalfe zu einer weiteren gepanzerten Limousine, einem russischen SIL. Er stieg verängstigt in den Fond. Dort saß bereits der Drei-Sterne-General.
»Was zum Teufel soll das?«, krächzte Metcalfe, dessen Panik nun nachließ.
»Ich muss mich aufrichtig bei Ihnen entschuldigen«, antwortete der Russe. »Wir leben in gefährlichen und unruhigen Zeiten, und ich durfte nicht riskieren, dass Ihnen etwas zustößt – auch hier draußen in den Wäldern nicht. Dies sind meine Männer, allein mir unterstehend, für Terroristenabwehr ausgebildet. Sie sind viel zu wichtig, als dass Sie irgendwelchen Gefahren ausgesetzt werden dürften.«
Metcalfe schüttelte dem Russen die Hand. Der achtzigjährige General war weißhaarig, aber sein Profil war noch immer raubvogelhaft. Er nickte dem Fahrer zu, und der Wagen setzte sich in Bewegung.
»Ich danke Ihnen, dass Sie nach Moskau gekommen sind – auch wenn meine dringende Aufforderung Ihnen rätselhaft vorgekommen sein muss.«
»Ich konnte mir denken, dass sie mit dem Staatsstreich zusammenhängt«, sagte Metcalfe.
»Die Dinge entwickeln sich rascher als erwartet«, sagte der Russe halblaut. »Die Verschwörer haben sich die Zustimmung des Mannes gesichert, der als dirischor – Dirigent – bekannt ist. Vielleicht ist’s schon zu spät, die Machtergreifung zu verhindern.«
»Meine Freunde im Weißen Haus beobachten die Ereignisse mit großer Sorge. Aber sie fühlen sich zur Untätigkeit verdammt – der National Security Council scheint sich darüber einig zu sein, dass eine Intervention einen Atomkrieg auslösen könnte.«
»Eine berechtigte Sorge. Diese Männer wollen die Regierung Gorbatschow unbedingt stürzen. Sie schrecken vor nichts zurück. Sie haben die Panzer in den Straßen Moskaus gesehen – die Verschwörer brauchen jetzt nur noch den Befehl zum Losschlagen zu geben. Gegen die Zivilbevölkerung. Das gibt ein Blutbad. Tausende werden umkommen! Aber der Angriffsbefehl ergeht erst, wenn der dirischor zustimmt. Alles hängt von ihm ab – er ist der Dreh- und Angelpunkt.«
»Aber er gehört nicht zu den Verschwörern?«
»Nein. Wie Sie wissen, ist er der perfekte Insider: ein Mann, der die Schalthebel der Macht unter Geheimhaltung und im Verborgenen betätigt. Er gibt niemals eine Pressekonferenz; er bleibt stets im Dunkeln. Aber er sympathisiert mit den Verschwörern. Ohne seine Unterstützung muss ihr Staatsstreich fehlschlagen. Mit seiner Unterstützung ist ihnen der Erfolg sicher. Und dann wird Russland wieder eine stalinistische Diktatur – und die Welt steht neuerlich am Abgrund eines Atomkriegs.«
»Warum haben Sie mich hergerufen?«, fragte Metcalfe. »Und warum gerade mich?«
Als der General sich ihm zuwandte, glaubte Metcalfe, in seinem Blick Angst zu erkennen. »Weil Sie der Einzige sind, dem ich traue. Und weil Sie der Einzige sind, der eine Chance hat, ihn zu erreichen. Den dirischor.«
»Und weshalb sollte der dirischor auf mich hören?«
»Ich denke, das wissen Sie«, sagte der Russe gelassen. »Sie können den Lauf der Geschichte ändern, mein Freund. Schließlich wissen wir beide, dass Sie’s schon einmal getan haben.«
Teil Eins
Kapitel Eins
PARIS, NOVEMBER 1940
Die Lichterstadt war in Dunkelheit versunken.
Seit die Deutschen vor einem halben Jahr in Frankreich eingefallen waren und Paris unter ihre Kontrolle gebracht hatten, wirkte die herrlichste Stadt der Welt einsam und verzweifelt.
Die Seinekais waren menschenleer. Der Triumphbogen, der Place de l’Étoile – diese berühmten leuchtenden Wahrzeichen, die einst den Nachthimmel erhellt hatten – waren jetzt finster. Über dem Eiffelturm, auf dem einst die französische Trikolore geflattert hatte, wehte jetzt eine Hakenkreuzfahne.
Paris war still geworden. Auf den Straßen waren kaum noch Privatautos oder Taxis unterwegs. In den meisten Grandhotels hatten sich die Deutschen einquartiert. Verschwunden waren der allabendliche Trubel, das Lachen von Nachschwärmern und Zechern. Verschwunden waren auch die Vögel – Opfer der großen Benzinbrände in den ersten Tagen der deutschen Besetzung.
Die meisten Pariser blieben nachts zu Hause: Die Besatzer, die Ausgangssperren, die ihnen auferlegten neuen Bestimmungen und die Wehrmachtssoldaten, die in ihren graugrünen Uniformen mit Bajonetten und Pistolen am Koppel auf den Straßen patrouillierten, hatten die Menschen eingeschüchtert. Eine ehemals stolze Stadt war in Hunger, Angst und Verzweiflung versunken.
Selbst die aristokratische Avenue Foch, die mit schönen weißen Steinfassaden gesäumte breiteste, prächtigste der Pariser Avenuen, wirkte windgepeitscht und öde.
Mit einer einzigen Ausnahme.
Ein hôtel particulier, eine Privatvilla, lag in hellstem Lichterglanz. Aus seinem Inneren drang leise Musik: ein Orchester, das Swing spielte. Das Klirren von Porzellan und Kristall, heitere Stimmen, sorgloses Lachen. Dies war eine Insel der glitzernden Privilegien, und sie wirkte vor dem düsteren Hintergrund umso strahlender.
Das Hôtel du Châtelet war das luxuriöse Domizil von Comte Maurice Léon Philippe du Châtelet und seiner Gattin, der legendären, umschwärmten Gastgeberin Marie-Hélène. Der Comte du Châtelet war nicht nur ein ungeheuer reicher Industrieller, sondern auch ein Minister der mit den Deutschen kollaborierenden Vichy-Regierung. Vor allem war er jedoch für seine Abendgesellschaften bekannt, die mit dazu beitrugen, tout Paris über die trüben Tage der Besatzungszeit hinwegzuhelfen.
Eine Einladung zu einer Gesellschaft im Hôtel du Châtelet war ein Objekt des sozialen Neides – wochenlang erstrebt, mit Spannung erwartet. Vor allem heutzutage war es wegen der Rationierungen und der Lebensmittelknappheit fast unmöglich, echten Kaffee oder Butter oder Käse zu bekommen, und nur Leute mit sehr guten Verbindungen Fleisch oder Frischgemüse kaufen konnten. Eine Einladung zum Cocktail bei den Châtelets bedeutete eine Gelegenheit, sich richtig satt zu essen. Hier in dieser Luxusvilla wies nichts darauf hin, dass man in einer Stadt lebte, die bittere Not litt.
Die Party war bereits in vollem Gange, als ein Diener einen weiteren, ungewöhnlich späten Gast eintreten ließ.
Der neue Gast war ein blendend aussehender junger Mann Ende zwanzig mit schwarzer Mähne, großen braunen Augen, die schalkhaft zu blitzen schienen, und einer Adlernase. Er war groß und breitschultrig, dabei aber sportlich schlank. Als er dem Butler seinen Mantel gab, nickte er lächelnd und sagte: »Bonsoir, Patrick, merci beaucoup.«
Er hieß Daniel Eigen, lebte seit etwa einem Jahr mehr oder weniger ständig in Paris und gehörte zu den Stammgästen von Partys in besten Kreisen, in denen er allgemein als reicher Argentinier und höchst begehrenswerter Junggeselle bekannt war.
»Ah, Daniel, mon cheri«, gurrte Marie-Hélène du Châtelet, die Gastgeberin, als Eigen den überfüllten Ballsaal betrat. Das Orchester spielte einen neuen Song, den er als »How High the Moon« erkannte. Die Comtesse du Châtelet hatte ihn quer durch den halben Saal entdeckt und begrüßte ihn jetzt mit dem Überschwang, den sie normalerweise für sehr reiche oder sehr mächtige Leute reservierte – beispielsweise für den Herzog und die Herzogin von Windsor oder den deutschen Militärgouverneur von Paris. Die Gastgeberin, eine attraktive Frau Anfang fünfzig, deren tief dekolletiertes schwarzes Abendkleid von Balenciaga viel von ihrem üppigen Busen sehen ließ, war offensichtlich in ihren jungen Gast vernarrt.
Als Daniel Eigen sie auf beide Wangen küsste, zog sie ihn einen Augenblick an sich und sagte auf Französisch mit halblauter, selbstbewusster Stimme: »Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten, mein Lieber. Ich hatte schon Angst, Sie würden nicht aufkreuzen.«
»Und eine Gesellschaft im Hôtel du Châtelet versäumen?«, fragte Eigen. »Halten Sie mich für übergeschnappt?« Er hielt eine in Goldpapier gewickelte kleine Schachtel hoch, die er hinter seinem Rücken versteckt gehalten hatte. »Für Sie, Madame. Der letzte in ganz Frankreich erhältliche Flakon.«
Die Gastgeberin strahlte, als sie die Schachtel entgegennahm, hastig das Goldpapier abriss und einen quadratischen Kristallflakon mit einem Parfüm von Guerlain herauszog. Ihr stockte der Atem. »Aber … aber Vol de Nuit gibt es nirgends mehr zu kaufen!«
»Sie haben Recht«, sagte Eigen lächelnd. »Zu kaufen gibt’s das nirgends.«
»Daniel! Sie sind zu liebswürdig, zu aufmerksam! Woher wussten Sie, dass das mein Lieblingsparfüm ist?«
Er zuckte bescheiden mit den Schultern. »Ich habe meinen eigenen Nachrichtendienst.«
Madame du Châtelet runzelte die Stirn, dann drohte sie ihm scherzhaft mit dem Finger. »Und das nach allem, was Sie getan haben, um uns den Dom Pérignon zu besorgen. Sie sind wirklich zu großzügig. Jedenfalls bin ich froh, dass Sie hier sind – blendend aussehende junge Männer wie Sie muss man heutzutage mit der Lupe suchen, cheri. Sie werden einigen meiner weiblichen Gäste verzeihen müssen, wenn sie unverzüglich in Ohnmacht fallen. Das sind dann die, die Sie noch nicht erobert haben.« Sie senkte erneut die Stimme. »Yvonne Printemps ist mit Pierre Freynay hier, aber anscheinend ist sie wieder mal auf dem Kriegspfad, also nehmen Sie sich in Acht.« Sie sprach von einem berühmten Musical-Star. »Und Coco Chanel ist mit ihrem neuen Liebhaber da, diesem Deutschen, mit dem sie im Ritz wohnt. Sie zieht wieder mal über die Juden her … das wird allmählich langweilig.«
Eigen nahm sich eine Champagnerflöte von dem Silbertablett, das ihm ein livrierter Diener anbot. Er sah sich in dem großen Ballsaal mit seinem alten Parkettboden, der aus einem großen château stammte, seinen weiß-golden getäfelten Wänden, an denen in regelmäßigen Abständen Gobelins hingen, und dem dramatischen Deckengemälde um, das von demselben Künstler stammte, der später die Decken von Versailles ausgemalt hatte.
Aber die Ausgestaltung des Saals interessierte ihn weniger als die Gäste. Als sein Blick über die Anwesenden hinwegglitt, erkannte er ziemlich viele Leute. Darunter die üblichen Berühmtheiten: die Sängerin Edith Piaf, die für jedes Konzert zwanzigtausend Franc bekam, Maurice Chevalier und alle möglichen Filmstars, die jetzt bei der von Goebbels geleiteten deutschen Filmgesellschaft Continental unter Vertrag standen und Filme drehten, die den Deutschen genehm waren. Die übliche Ansammlung von Schriftstellern, Malern und Musikern, die keine dieser seltenen Gelegenheiten ausließen, nach Herzenslust zu schlemmen und zu trinken. Und die üblichen französischen und deutschen Bankiers und Industriellen, die Geschäfte mit den Nazis und ihrem Marionettenregime in Vichy machten.
Zuletzt gab es die deutschen Offiziere, die heutzutage aus dem Leben der Pariser Gesellschaft nicht mehr wegzudenken waren. Alle waren im kleinen Gesellschaftsanzug erschienen; viele trugen ein Monokel und hatten schmale Schnurrbärte wie ihr Führer. General Otto von Stülpnagel, der deutsche Militärgouverneur. Otto Abetz, der deutsche Botschafter in Frankreich, mit seiner jungen französischen Gattin. Der ältliche General Ernst von Schaumburg, Kommandant von Groß-Paris, der wegen seines Bürstenhaarschnitts und seiner preußischen Manieren als rocher de bronze bekannt war.
Eigen kannte sie alle. Er traf sie regelmäßig in Salons wie diesem, aber noch wichtiger war, dass er den meisten von ihnen schon so manchen Dienst erwiesen hatte. Die deutschen Herrscher über Frankreich tolerierten den so genannten schwarzen Markt nicht nur – sie brauchten ihn wie alle anderen Menschen auch. Wie sollten sie sonst Cold Cream oder Gesichtspuder für ihre Frauen oder Geliebten bekommen? Wo sonst gab es eine Flasche anständigen Armagnacs? Selbst die neuen Herren Frankreichs litten unter kriegsbedingten Entbehrungen.
Deshalb war ein Schwarzmarkthändler wie Daniel Eigen immer gefragt.
Er spürte eine Hand auf seinem Arm und erkannte sofort die mit Diamanten besetzten Finger seiner ehemaligen Geliebten Agnès Vieillard. Obwohl ihn ein kalter Schauer durchlief, drehte er sich um und setzte ein strahlendes Lächeln auf. Sie hatten sich seit Monaten nicht mehr gesehen.
Agnès war eine zierliche, attraktive Frau mit leuchtend roter Mähne, deren Ehemann Didier ein erfolgreicher Unternehmer, Munitionsfabrikant und Rennstallbesitzer war. Kennen gelernt hatte Daniel die bildhübsche, aber ein bisschen nymphomanische Agnès auf dem Rennplatz Longchamp, wo sie eine eigene Loge hatte. Sie hatte sich dem gut aussehenden, reichen Argentinier als »Kriegerwitwe« vorgestellt. Ihr Mann war damals in Vichy, wo er die Marionettenregierung beriet. Ihre Affäre – leidenschaftlich, aber kurz – hatte bis zur Rückkehr ihres Mannes nach Paris angedauert.
»Agnès, ma cherie! Wo hast du gesteckt?«
»Wo ich gesteckt habe? Ich habe dich seit dem Abend im Maxim’s nicht mehr gesehen.« Sie wiegte sich kaum merklich im Takt des Songs »Imagination«, den das Orchester leicht verjazzt spielte.
»Ah, das weiß ich noch gut«, sagte Daniel, der sich kaum daran erinnern konnte. »Ich hatte schrecklich viel zu tun … Entschuldigung.«
»Viel zu tun? Du hast doch gar keinen Job, Daniel«, sagte sie vorwurfsvoll.
»Nun, mein Vater wollte immer, dass ich mir eine nützliche Beschäftigung suche. Aber wie soll ich das machen in einem besetzten Land?«
Agnès machte kopfschüttelnd ein finsteres Gesicht und versuchte, ihr unwillkürliches Lächeln zu verbergen. Sie sprach ihm ins Ohr. »Didier ist wieder mal in Vichy. Und auf dieser Gesellschaft gibt’s einfach zu viele boches. Warum flüchten wir uns nicht in den Jockey Club? Im Maxim’s sind heutzutage auch zu viele boches.« Sie flüsterte, denn Plakate in der Metro drohten jedem, der die Deutschen »boches« nannte, strenge Strafen an. Die Deutschen reagierten außerordentlich empfindlich auf französischen Spott.
»Oh, ich habe nichts gegen die Deutschen«, sagte Daniel, weil er das Thema wechseln wollte. »Sie sind ausgezeichnete Kunden.«
»Die Soldaten … wie nennt man sie, die haricots verts? Sie sind solche Bestien! Mit so miserablen Manieren! Auf der Straße ist keine Frau davor sicher, von ihnen begrapscht zu werden.«
»Man muss ein bisschen Mitleid mit ihnen haben«, sagte Eigen. »Der arme deutsche Soldat fühlt sich als Welteroberer, aber keine Französin würdigt ihn auch nur eines Blicks. Das ist einfach unfair.«
»Aber wie soll man sie sich vom Leib halten?«
»Am besten erzählst du ihnen einfach, du seist Jüdin, mon chou. Das schreckt sie ab. Oder du starrst ihre großen Füße an – das macht sie immer verlegen.«
Abermals musste sie wider Willen lächeln. »Aber wie sie im Stechschritt die Champs-Élysées hinuntermarschieren!«
»Glaubst du, dass der Stechschritt einfach ist?«, fragte Daniel. »Versuch’s mal selbst – dann landest du auf deinem hübschen Popo.« Er sah sich verstohlen um, suchte ein Mittel, Agnès zu entkommen.
»Stell dir vor, neulich habe ich Göring auf der Rue de la Paix aus seinem Wagen steigen gesehen. Er hat seinen albernen Marschallstab getragen – den nimmt er bestimmt mit ins Bett! Er ist in Cartier’s verschwunden, und der Geschäftsführer hat mir später erzählt, dass er für seine Frau eine Halskette für acht Millionen Franc gekauft hat.« Sie tippte mit dem Zeigefinger an Daniels gestärkte weiße Hemdbrust. »Siehst du, er kauft seiner Frau französischen Schmuck, nicht deutschen. Die boches kritisieren ständig unsere Dekadenz, aber hier bewundern sie genau das.«
»Nun, für Herrn Meier ist das Beste gerade gut genug.«
»Meier? Wie meinst du das? Göring ist kein Jude.«
»Du weißt doch, dass er gesagt hat: ›Ich will Meier heißen, wenn auch nur ein feindliches Flugzeug über Deutschland erscheint.‹«
Agnès lachte. »Nicht so laut, Daniel«, flüsterte sie wie auf der Bühne.
Eigen legte ihr kurz einen Arm um die Taille. »Ich muss hier mit einem Gentleman sprechen, doucette. Wenn du mich also bitte entschuldigst …«
»Du meinst, dass dein Auge auf eine andere Schöne gefallen ist«, sagte Agnes vorwurfsvoll, während sie übertrieben schmollend lächelte.
»Nein, nein«, versicherte Eigen ihr lachend. »Hier geht’s wirklich nur um Geschäfte.«
»Nun, Daniel, mein Schatz, du könntest mir wenigstens ein bißchen echten Kaffee besorgen. Ich kann diesen Muckefuck nicht mehr ertragen!« Sie verwendete das deutsche Wort. »Zichorie, geröstete Bucheckern! Tust du’s, Schätzchen?«
»Selbstverständlich«, sagte er. »Sobald die nächste Lieferung eintrifft. Ich erwarte sie in ein paar Tagen.«
Aber als er sich von Agnès abwandte, rief ihn eine strenge Männerstimme an. »Herr Eigen!«
Dicht hinter ihm stand eine kleine Gruppe von deutschen Offizieren, aus deren Mitte ein hünenhafter SS-Standartenführer, was dem Rang eines Obersts entsprach, mit glatt zurückgekämmtem Haar herausragte. Der Offizier trug eine Schildpattbrille und in sklavischer Imitation seines Führers einen schmalen Schnauzbart. Standartenführer Jürgen Wegmann hatte entscheidend dazu beigetragen, dass Eigen eine Service-public-Genehmigung erhielt, mit der er einen der wenigen gegenwärtig in Paris zugelassenen Privatwagen fahren durfte. Der städtische Verkehr warf riesige Probleme auf. Da nur Ärzte, Feuerwehrleute und aus unerfindlichen Gründen auch prominente Schauspieler und Schauspielerinnen eigene Wagen fahren durften, war die Metro – viele Stationen waren ohnehin geschlossen – auf geradezu groteske Weise überfüllt. Und da es kein Benzin gab, fuhren auch keine Taxis.
»Herr Eigen, diese Upmanns … die waren strohtrocken.«
»Tut mir Leid, das hören zu müssen, Herr Standartenführer. Haben Sie sie in einem Humidor aufbewahrt, wie ich Ihnen geraten habe?«
»Ich habe keinen Humidor.«
»Dann muss ich Ihnen einen besorgen«, sagte Eigen.
Einer der Offiziere, ein wohlbeleibter SS-Gruppenführer mit rundem Gesicht, ein Generalmajor namens Johannes Koller, kicherte halblaut. Er hatte seinen Kameraden einen Packen sepiabrauner französischer Postkarten gezeigt. Jetzt steckte er sie rasch in die Brusttasche seiner Uniformjacke zurück, aber Eigen sah noch, womit er sein Publikum erfreut hatte: mit altmodischen Aktaufnahmen von statuenhaften Frauen, die, nur mit Strapsen und Seidenstrümpfen bekleidet, alle möglichen lasziven Posen einnahmen.
»Bitte. Sie waren trocken, als ich sie bekommen habe. Ich glaube nicht einmal, dass sie aus Kuba waren.«
»Sie waren aus Kuba, Herr Standartenführer. Auf den Oberschenkeln einer kubanischen Jungfrau gerollt. Hier, rauchen Sie zur Abwechslung eine von diesen.« Der junge Mann griff in sein Smokingjackett und zog ein Samtetui mit mehreren Zigarren in Zellophanhüllen heraus. »Romeo y Julietas. Angeblich Churchills Lieblingsmarke.« Er zwinkerte dem Deutschen zu, als dieser eine Zigarre aus dem Etui zog.
Ein Diener bot ihnen Kanapees auf einem Silbertablett an. »Gänseleberpastete, Messieurs?«
Koller griff rasch zu und schnappte sich gleich zwei. Daniel nahm eines.
»Danke, nicht für mich«, erklärte Wegmann dem Diener und den Umstehenden demonstrativ. »Ich esse kein Fleisch mehr.«
»Heutzutage nur schwer zu bekommen, nicht wahr?«, fragte Eigen.
»Darum geht’s nicht«, stellte Wegmann fest. »Je älter ein Mann wird, desto konsequenter sollte er sich vegetarisch ernähren, wissen Sie.«
»Ja, Ihr Führer ist auch Vegetarier, nicht wahr?«, sagte Eigen.
»Ganz recht«, bestätigte Wegmann stolz.
»Obwohl er manchmal ganze Länder verschlingt«, fügte Eigen gelassen hinzu.
Der SS-Offizier funkelte ihn an. »Sie scheinen alles beschaffen zu können, Herr Eigen. Vielleicht könnten Sie etwas gegen die Papierknappheit in Paris unternehmen.«
»Ja, die muss euch Bürokraten zum Wahnsinn treiben. Was tun Schreibstubenhengste ohne Papier?«
»Heutzutage ist alles von minderer Qualität«, sagte Gruppenführer Koller. »Heute Nachmittag musste ich einen ganzen Bogen Briefmarken ausprobieren, um eine zu finden, die sich auf den Umschlag kleben ließ.«
»Gibt’s bei euch immer noch Briefmarken mit Hitlers Kopf darauf?«
»Ja, natürlich«, sagte Koller unwirsch.
»Vielleicht leckt ihr die falsche Seite an?«, fragte Eigen augenzwinkernd.
Der SS-Gruppenführer lief vor Verlegenheit rot an und räusperte sich umständlich, aber bevor ihm eine Antwort einfiel, fuhr Eigen fort: »Sie haben natürlich völlig Recht. Die Franzosen können einfach keine deutsche Qualitätsarbeit liefern.«
»Das war wie ein echter Deutscher gesprochen«, sagte Wegmann anerkennend. »Auch wenn Ihre Mutter Spanierin war.«
»Daniel«, sagte eine tiefe Altstimme. Er drehte sich erleichtert um, weil sie ihm die Chance gab, von den deutschen Offizieren wegzukommen.
Angesprochen hatte ihn eine stattliche Mittfünfzigerin, die ein mit Volants besetztes weites Blumenkleid trug, in dem sie ein wenig wie ein tanzender Zirkuselefant aussah. Madame Fontenoy hatte ihr unnatürlich schwarzes Haar, in das ein weißer Streifen Hermelinfell eingeflochten war, hoch aufgesteckt. Dazu trug sie riesige goldene Ohrringe, die Daniel als Louisdore, alte 22-karätige Goldmünzen, erkannte. Die schweren Münzen zogen ihre Ohrläppchen herunter. Als Gattin eines Vichy-Diplomaten war sie selbst eine prominente Gastgeberin. »Pardon«, sagte sie zu den deutschen Offizieren, »aber ich muss Ihnen den jungen Daniel entführen.«
Madame Fontenoys Arm umfasste die Taille einer schlanken jungen Frau Anfang zwanzig in einem schulterfreien schwarzen Abendkleid: eine Schönheit mit jettschwarzem Haar und leuchtend graugrünen Augen.
»Daniel«, sagte Madame Fontenoy, »ich möchte Sie mit Geneviève du Châtelet, der reizenden Tochter unserer Gastgeber, bekannt machen. Zu meinem Erstaunen habe ich gehört, dass ihr euch nicht kennt – sie ist bestimmt die einzige unverheiratete Pariserin, die Sie noch nicht kennen. Geneviève, das hier ist Daniel Eigen.«
Als die junge Frau ihre schmale, langfingrige Hand ausstreckte, blitzte in ihren Augen eine Warnung auf. Sie war einzig und allein für Daniel bestimmt.
Daniel ergriff ihre Hand. »Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte er mit einer angedeuteten Verbeugung. Gleichzeitig tippte sein Mittelfinger sanft an die Handfläche der jungen Schönheit und bestätigte so ihr stummes Warnsignal.
»Monsieur Eigen kommt aus Buenos Aires«, erklärte die Matrone der jungen Frau, »aber er hat ein Apartment auf der Rive Gauche.«
»Oh, sind Sie schon lange in Paris?«, fragte Geneviève du Châtelet mit stetigem Blick, ohne sonderliches Interesse.
»Lange genug«, sagte Eigen.
»Lange genug, um sich auszukennen«, ergänzte Madame Fontenoy mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Ich verstehe«, sagte Geneviève du Châtelet zweifelnd. Plötzlich schien sie quer durch den Saal jemanden zu erkennen. »Ah, da ist meine Großtante Benoîte. Entschuldigen Sie mich bitte, Madame Fontenoy.«
Als die junge Frau sich verabschiedete, ruhte ihr Blick auf ihm und glitt dann bedeutungsvoll in Richtung Korridor. Daniel verstand dieses Signal sofort und nickte kaum merklich.
Nach endlos langen zwei Minuten leeren Geplauders mit Madame Fontenoy entschuldigte auch Daniel sich. Zwei Minuten mussten reichen. Er bahnte sich seinen Weg durch die dicht gedrängte Menge, nickte allen, die seinen Namen riefen, lächelnd zu und bedeutete ihnen wortlos, er könne leider nicht stehen bleiben, weil er anderswo erwartet werde.
Ein kurzes Stück den prächtigen Flur entlang lag die ebenso prächtige Bibliothek. Die Wände und Bücherschränke bestanden aus roten chinesischen Lackarbeiten; auf den Regalen standen lange Reihen ledergebundener Bände, die nie gelesen wurden. Der Raum war leer, die im Ballsaal herrschende Kakophonie war hier nur als leises, fernes Murmeln zu hören. Im rückwärtigen Teil der Bibliothek saß Geneviève, in Aubusson-Kissen zurückgelehnt, auf einem Diwan: hinreißend in ihrem schwarzen Abendkleid, über dem die Haut ihrer bloßen Schultern makellos leuchtete.
»Oh, Gott sei Dank!«, flüsterte sie drängend. Sie sprang auf, lief zu Daniel und schlang ihm die Arme um den Hals. Er küsste sie lange und leidenschaftlich. Nach einer Minute löste sie sich aus seiner Umarmung. »Ich war so froh, als du heute Abend gekommen bist. Ich hatte schreckliche Angst, du könntest etwas anderes vorhaben.«
»Wie kannst du so was sagen?«, protestierte Daniel. »Würde ich eine Gelegenheit verpassen, dich zu sehen? Du redest Unsinn.«
»Das liegt nur daran, dass du so … so diskret bist, so darauf achtest, dass meine Eltern nichts von uns erfahren. Jedenfalls bist du jetzt hier. Gott sei Dank! Diese Leute sind so langweilig. Ich dachte, ich müsste sterben. Alle reden nur von Essen, Essen, Essen.«
Eigen streichelte die cremeweißen Schultern seiner Geliebten, ließ die Fingerspitzen bis zur Wölbung ihrer Brüste hinabgleiten. Er roch den Duft des Parfüms Shalimar, das er ihr geschenkt hatte. »Gott, wie sehr du mir gefehlt hast«, murmelte er.
»Wir haben uns fast eine Woche lang nicht gesehen«, sagte Geneviève. »Warst du in dieser Zeit auch artig? Nein, warte … sag lieber nichts. Ich kenne dich, Daniel Eigen.«
»Du kannst immer durch mich hindurchsehen«, sagte Eigen leise.
»Ach, ich weiß nicht recht«, sagte Geneviève mit kokett geschürzten Lippen. »Du bist ein Mann mit vielen Schichten, glaube ich.«
»Vielleicht könntest du ein paar von mir abschälen«, sagte Daniel.
Geneviève machte ein schockiertes Gesicht, aber das war reine Koketterie, und sie beide wussten es. »Nicht hier, wo jeden Augenblick jemand reinkommen kann.«
»Nein, du hast Recht. Komm, wir gehen irgendwohin, wo uns keiner stört.»
»Ja, in den Salon im ersten Stock. Dorthin verirrt sich niemand.«
»Außer deiner Mutter«, sagte Daniel Eigen kopfschüttelnd. Ihm war eben etwas eingefallen. »Wir gehen ins Arbeitszimmer deines Vaters. Dort können wir hinter uns absperren.«
»Aber mein Vater bringt uns um, wenn er uns dort erwischt!«
Daniel nickte trübselig. »Ah, ma cherie, du hast sicher Recht. Ich fürchte, wir sollten wieder zu den anderen gehen …«
Geneviève schüttelte erschrocken den Kopf. »Nein, nein, nein!«, sagte sie. »Ich … ich weiß, wo er einen Nachschlüssel aufbewahrt. Komm, wir müssen uns beeilen!«
Er folgte ihr aus der Bibliothek, durch die Tür, hinter der eine schmale Dienstbotentreppe in den ersten Stock hinaufführte, dann einen langen, schwach beleuchteten Korridor entlang, bis sie vor einer kleinen Nische mit einer Marmorbüste von Marschall Petain Halt machte. Daniels Herz jagte. Er war im Begriff, etwas Gefährliches zu tun, und Gefahr empfand er immer als stimulierend. Er hatte Spaß daran, gefährlich zu leben.
Geneviève griff hinter die Büste, holte mit einer raschen Bewegung den Nachschlüssel hervor und sperrte damit die Doppeltür zum Arbeitszimmer ihres Vaters auf.
Die schöne junge Geneviève ahnte natürlich nicht, dass Daniel schon im Arbeitszimmer ihres Vaters gewesen war. Während ihrer geheimen Rendezvous hier im Hôtel du Châtelet sogar schon mehrmals – mitten in der Nacht, wenn sie schlief, ihre Eltern verreist waren und die Dienstboten Urlaub bis zum nächsten Morgen hatten.
Das private Arbeitszimmer von Comte Maurice Léon Philippe du Châtelet war ein sehr maskuliner Raum, in dem es nach Leder und Pfeifentabak roch. Hier gab es Vitrinen mit einer Sammlung alter Spazierstöcke, mehrere Louisquinze-Sessel in dunkelbraunem Leder und einen massiven, reich geschnitzten Schreibtisch mit wohlgeordneten Stapeln von Schriftstücken. Auf dem Kaminsims stand eine Bronzebüste, vermutlich ein berühmter Verwandter.
Während Geneviève die Doppeltür absperrte, umrundete Daniel den Schreibtisch, überflog die dort gestapelten Dokumente und suchte aus der persönlichen und dienstlichen Korrespondenz den wichtigsten Stapel heraus. Ein Blick genügte, um ihm zu zeigen, dass die Depeschen aus Vichy streng geheime militärische Fragen betrafen.
Aber bevor er mehr tun konnte, als die interessantesten Stapel zu identifizieren, war Geneviève mit dem Abschließen der Türen fertig und kam zu ihm gelaufen.
»Dort drüben!«, sagte sie atemlos. »Auf dem Ledersofa.«
Eigen wollte seinen Platz am Schreibtisch jedoch nicht verlassen. Er drängte sie sanft nach oben gegen die Schreibtischkante, während seine Hände über ihren Körper glitten, die schlanke Taille umschlossen und dann die kleinen, straffen Gesäßbacken umfassten, die sie sanft kneteten. Gleichzeitig küsste er ihren Hals, ihre Schultern, den Ansatz ihrer Brüste.
»Oh Gott«, keuchte sie. »Daniel …« Ihre Augen waren geschlossen.
Eigen ließ seine Fingerspitzen über den mit Seide bedeckten Spalt zwischen ihren Gesäßbacken gleiten und liebkoste Geneviève dann sanft zwischen den Beinen. Das lenkte sie so ab, dass sie nicht merkte, wie seine Rechte ihr Gesäß verließ, hinter ihrem Rücken nach einem bestimmten Papierstapel griff und geschickt die oberste Lage abhob.
Mit dieser Gelegenheit hatte er nicht gerechnet. Er würde improvisieren müssen.
Er schob die Dokumente lautlos in den Seitenschlitz seines Jacketts. Während sie im Seidenfutter des Smokings verschwanden, griff seine Linke nach Genevièves Rückenreißverschluss und öffnete ihn, bevor er mit beiden Händen das Oberteil ihres Abendkleids herabstreifte, um die dunkelbraunen Brustwarzen mit schmetterlingshaft leichten Zungenberührungen liebkosen zu können.
Das im Futter seines Smokings steckende steife Papier raschelte leicht, als er sich bewegte.
Plötzlich erstarrte er, hielt den Kopf schief.
»Was gibt’s?«, flüsterte Geneviève mit weit aufgerissenen Augen.
»Hast du das gehört?«
»Was?«
»Schritte. Ganz nahe.« Daniel hörte außergewöhnlich gut, und da er sich in mehr als einer Beziehung in einer kompromittierenden Situation befand, war er umso wachsamer.
»Nein!« Sie wich zurück, fummelte am Oberteil des Abendkleids herum und zog es über ihren Busen hoch. »Bitte, Daniel, zieh mir den Reißverschluss zu! Wir müssen hier raus! Wenn uns jemand hier drin überrascht …«
»Pssst«, sagte er. Draußen näherten sich zwei Personen, das erkannte er jetzt, nicht nur eine. Auf dem Marmorboden des Korridors hallende Schritte ließen auf zwei Männer schließen. Die Schritte echoten, wurden lauter, kamen näher.
Während Geneviève durch den Raum zu der abgesperrten Tür schlich, konnte Daniel jetzt ihre Stimmen hören. Die beiden Männer sprachen Französisch, aber einer hatte einen deutschen Akzent. Eine der Stimmen, die des Franzosen, war dröhnend tief; Daniel identifizierte sie eindeutig als die Stimme von Genevièves Vater. Aber die andere … Gehörte sie General von Stülpnagel, dem deutschen Militärbefehlshaber von Frankreich? Er war sich seiner Sache nicht ganz sicher.
Geneviève griff wie betäubt nach dem Schlüssel – um was zu tun? Um in dem Augenblick aufzusperren, in dem ihr Vater Besuch mitbrachte? Daniel berührte ihre Hand, hielt sie davon ab, den Schlüssel umzudrehen. Stattdessen zog er ihn geräuschlos aus dem Schloss.
»Dorthin«, flüsterte er. Dabei zeigte er auf die Tür in der Rückwand des Arbeitszimmers. Als er diesen Raum das letzte Mal betreten hatte, war er durch diese Tür hereingekommen. Vielleicht glaubte Geneviève jetzt, er habe die Tür gerade erst entdeckt – obwohl sie in ihrer Panik vermutlich keinen klaren Gedanken fassen konnte.
Sie nickte und lief zur anderen Tür. Als sie dort angekommen war, knipste sie das Licht aus, sodass der Raum in tiefer Dunkelheit lag. Daniel bewegte sich trotzdem mühelos weiter; er hatte eine klare Vorstellung davon, wie das Arbeitszimmer eingerichtet war und wo Hindernisse standen.
Geneviève schnappte erschrocken nach Luft, als sie merkte, dass die andere Tür ebenfalls abgesperrt war. Aber Daniel hatte den Schlüssel mitgebracht. Hätte er das nicht getan, hätten diese wenigen vergeudeten Sekunden bedeutet, dass sie ertappt worden wären. Er sperrte rasch auf. Die Tür klemmte ein wenig, als er sie aufstieß; sie wurde nur selten benützt. Er schob Geneviève vor sich her auf einen schmalen, dunklen Flur hinaus, schloss die Tür hinter sich und verzichtete darauf, sie abzusperren. Da der Schlosszylinder leicht rostig war, bestand die Gefahr, dass die beiden Männer dieses Geräusch hören würden.
Er konnte hören, wie der Haupteingang des Arbeitszimmers aufgesperrt wurde und die beiden Männer, die weiter miteinander sprachen, eintraten.
Genevièves Hand umklammerte Daniels Arm. Spitze Fingernägel bohrten sich wie Krallen in den Seidenstoff seines Smokingärmels. Vielleicht hörte sie das Rascheln der steifen Papiere im Jackettfutter, doch sie schien es nicht zu beachten. »Was tun wir jetzt?«, flüsterte sie.
»Du gehst über die Personaltreppe in die Küche hinunter und mischst dich wieder unter die Gäste.«
»Aber die Dienstboten …«
»Die wissen nicht, woher du kommst und warum du die Personaltreppe benützt hast. Und außerdem sind sie diskret.«
»Aber wenn du mir wenige Minuten später folgst … !«
»Das darf ich natürlich nicht. Sie würden zwei und zwei zusammenzählen, und dann wärst du erledigt.«
»Aber wohin willst du?« Sie flüsterte etwas zu laut.
»Mach dir meinetwegen keine Sorgen«, sagte er. »Ich komme bald nach. Wenn deine Mutter dich fragt, wohin ich verschwunden bin, hast du natürlich keine Ahnung.« Weil Geneviève nicht die klügste Frau war, die Daniel je kennen gelernt hatte, hielt er’s für nötig, ihr das alles zu erläutern.
»Aber wohin …?«, begann sie.
Er legte ihr einen Finger auf die Lippen. »Geh jetzt, ma cherie.«
Als Geneviève sich abwenden wollte, berührte er nochmals ihre Schulter. Sie drehte sich um, und er küsste sie rasch auf die Lippen. Dann zog er das Oberteil ihres Abendkleids zurecht, beobachtete, wie sie die Treppe hinunterging, und hastete anschließend selbst nach oben. Da seine Schuhe Gummisohlen hatten, die heutzutage fast schwerer zu bekommen waren als Ledersohlen, bewegte er sich fast lautlos.
Sein Verstand arbeitete auf Hochtouren, analysierte die bisherigen Ereignisse und versuchte, einen Fluchtplan auszuarbeiten. Er hatte gewusst, dass er Geneviève heute Abend begegnen würde, aber er hatte nicht mit einer Chance gerechnet, ins Arbeitszimmer ihres Vaters einzudringen – eine Chance, die er sich auf keinen Fall hatte entgehen lassen dürfen. Aber nachdem er nun einen dicken Stapel Papier in sein Jackett gestopft hatte, war es keine gute Idee, in einen übervollen Ballsaal zurückzukehren, in dem jemand mit ihm zusammenstoßen, das Rascheln hören und die entwendeten Dokumente bei ihm finden konnte.
Diese Gefahr ließ sich allerdings umgehen. Er konnte in der Garderobe seinen Mantel suchen, indem er vorgab, er habe darin sein Feuerzeug vergessen. Bei dieser Gelegenheit konnte er die Schriftstücke in die Innentasche seines Mantels stecken. Aber dabei riskierte er, gesehen zu werden, weil es vermutlich eine Garderobenfrau gab.
Belanglos war dieses Risiko jedoch im Vergleich zu der weit gefährlicheren Möglichkeit, dass durch seine Rückkehr in den Ballsaal entdeckt wurde, dass er mit Geneviève im Arbeitszimmer ihres Vaters gewesen war. Die Personaltreppe führte direkt in die Küche, die er vor den Augen der Dienstboten wenige Minuten nach Geneviève durchqueren würde. Zweifellos würden sie zwei und zwei zusammenzählen. Solche Leute waren keineswegs diskret, wie er Geneviève versichert hatte, und sie kannte die Wahrheit vermutlich ebenfalls: Dienstboten gierten nach Klatsch über solche Heimlichkeiten.
Eigen scherte sich nicht um Geflüster und Klatsch und Gerüchte. Was kümmerte es ihn, wenn Marie-Hélène du Châtelet erfuhr, dass er heimlich mit ihrer Tochter geknutscht hatte? Nein, es war die Kette von Enthüllungen, die ihm Sorgen machte, denn er konnte bis ganz an ihr Ende sehen. Irgendwann würde der comte merken, dass bestimmte, für die nationale Sicherheit überaus wichtige Papiere aus seinem Arbeitszimmer verschwunden waren, und er würde sofort seine Frau, seine Tochter und das Personal zur Rede stellen. Anschuldigungen würden hin und her fliegen. Vielleicht um die Ehre des Personals zu retten, würde eine der Köchinnen berichten, sie habe gesehen, wie der junge Herr direkt aus dem Arbeitszimmer die Treppe heruntergekommen sei.
Und dann wäre Eigen der Hauptverdächtige gewesen, selbst wenn der Hausherr sich nicht sicher sein konnte, dass Daniel die Papiere entwendet hatte. Und seine Tarnung – sein größtes Kapital – wäre dahin gewesen. Das durfte er unter keinen Umständen riskieren.
Natürlich gab es noch andere Wege, auf denen er das Haus verlassen konnte. Beispielsweise konnte er auf der Personaltreppe in den zweiten oder dritten Stock hinaufsteigen und über einen der zweifellos dunklen Flure zu einer der anderen Treppen gehen. Über diese konnte er auf den Hinterhof gelangen, der früher als Abstellplatz für Kutschen gedient hatte und jetzt in einen kleinen Park umgewandelt worden war. Diese Fläche auf der Rückseite des Hauses war von einem hohen Holzzaun mit verschlossenem Tor umgeben. Daniel konnte über den Zaun klettern, aber er war sich sicher, dass er von einem der auf den Park hinausführenden Fenster des Ballsaals aus gesehen werden würde. Ein Mann im Smoking, der durch den Park rennt und über den Zaun klettert … Nein, er würde todsicher entdeckt werden.
Es gab nur einen sicheren Weg, das Hôtel du Châtelet zu verlassen.
Eine Minute später hatte er das Dachgeschoss erreicht, in dem sich die Dienstbotenzimmer befanden. Hier waren die Decken niedrig und schräg, und der Fußboden bestand nicht mehr aus Marmor, sondern aus knarrenden alten Fichtenbrettern.
Um diese Zeit hatte er das Dachgeschoss für sich allein; das gesamte Personal war unten beschäftigt. Der junge Mann hatte die Gegebenheiten im Voraus erkundet – nicht etwa, weil er damit rechnete, irgendwann aus dem Haus flüchten zu müssen, durchaus nicht, sondern weil er sich stets einen Notausgang offen halten wollte. Das war seine bewährte Arbeitsweise, die ihm schon mehrmals das Leben gerettet hatte.
Er wusste, dass es hier eine Möglichkeit gab, aufs Dach hinauszuklettern, und da dieses kleine Palais mit anderen Stadthäusern eine lange Gebäudereihe bildete, musste es zahlreiche Fluchtwege geben.
Das Hôtel du Châtelet hatte ein Mansardendach mit Dachgauben, in die Sprossenfenster eingesetzt waren. Ein Blick genügte, um ihm zu zeigen, dass alle aufs Dach hinausführenden Fenster in den Personalzimmern auf der Vorderseite des Gebäudes lagen. Obwohl es unwahrscheinlich war, dass die Dienstboten ihre Zimmer abschließen würden, atmete er erleichtert auf, als sich gleich die erste Tür öffnen ließ.
Das Zimmer war winzig und mit Bett, Kommode und Kleiderschrank sehr spärlich möbliert. Erhellt wurde es von blassem Mondschein, der durch staubige Fensterscheiben hereinfiel.
Er lief ans Fenster, zog dabei den Kopf ein, um ihn sich nicht an der Dachschräge anzuschlagen, und packte den Fenstergriff. Diese Fenster wurden anscheinend nicht oft geöffnet. Unter Aufbietung seiner ganzen Kraft gelang es ihm jedoch, erst einen Flügel und dann den zweiten aufzureißen.
Während eiskalte Nachtluft hereinströmte, sah er hinaus und fand bestätigt, was er vor einigen Tagen festgestellt hatte, als er sich das Hôtel du Châtelet von außen angesehen hatte. Das Fenster führte direkt auf ein geteertes Steildach hinaus, das ungefähr drei Meter weit zu einer Dachbrüstung abfiel. Die Brüstung, ein hoher, reich verzierter Steinwall, würde ihn vor den Blicken etwaiger Passanten schützen. Zumindest solange er sich auf dem Dach dieses Gebäudes bewegte.
Die benachbarten Gebäude, die in anderen Varianten des Empirestils erbaut waren, hatten keine Dachbrüstungen. Nun, er würde nehmen müssen, was er an Deckung finden konnte.
Der Teer auf dem Dach war im Lauf vieler Jahre in der Sommerhitze blasig und faltig geworden. Jetzt war er eisglatt und mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Dieser Untergrund konnte tückisch sein.
Daniel würde mit den Füßen voraus hinausklettern müssen, was nicht leicht sein würde, weil die Abendkleidung seine Bewegungsfreiheit einschränkte. Und seine Schuhe mit Gummisohlen eigneten sich zwar gut dafür, durch Häuser zu schleichen, aber sie waren keine Kletterstiefel. Der Ausflug über die Dächer würde nicht leicht werden.
Er packte den Oberrand des Fensterrahmens, schwang die Beine hoch und machte gleichzeitig ein Hohlkreuz, damit sie über die Fensterbank ins Freie glitten. Seine Schuhabsätze rutschten ab, sobald sie das vereiste Teerdach berührten. Statt den Fensterrahmen loszulassen, umklammerte er ihn weiterhin und baumelte nun halb drinnen, halb draußen. Dabei scharrte er mit den Absätzen über den Teer, bis er so viel Eis weggekratzt hatte, dass eine raue Oberfläche frei wurde, die ihm etwas Halt bot.
Aber er konnte dem Steildach nicht genug trauen, um den Fensterrahmen loszulassen. Links von der Dachgaube ragte in ungefähr einem Meter Entfernung ein hoher gemauerter Schornstein auf. Daniel nahm die rechte Hand vom Fensterrahmen und drehte seinen Körper über den linken Fuß so auf den Bauch, dass er sich an dem Schornstein festhalten konnte, ohne das Fensterbrett schon loszulassen.
Das Mauerwerk unter seiner Hand fühlte sich kalt und rau an. Die Rauheit war jedoch gut. Der Mörtel zwischen den Ziegeln war alt und so bröselig, dass er seine Fingerspitzen in die Spalten schieben und sich am Schornstein festklammern konnte. Als er den Körper versteifte und ein labiles Gleichgewicht fand, konnte er auch die linke Hand vom Fensterbrett nehmen, rasch umgreifen und sich nun mit beiden Händen am Schornstein festhalten.
Daniel schob die Füße nacheinander über das vereiste Dach und scharrte mit den Schuhen, bis er wieder eine Fläche geschaffen hatte, auf der er sicheren Halt hatte. Dadurch kam er so nahe an den Schornstein heran, dass er ihn umarmen konnte wie ein Kletterer einen Felspfeiler. Obwohl er zum Glück durchtrainiert war, musste er alle Kraft aufwenden, um sich an dem Schornstein hochzuziehen, während er mit den Absätzen einen neuen Standplatz aus dem Eis scharrte.
Er wusste, dass Einbrecher im vorigen Jahrhundert oft auf diese Weise von einem Stadthaus zum anderen gelangt waren. Da er diese Methode schon mehrmals selbst angewandt hatte, wusste er, dass sie viel schwieriger war, als sie aussah. Und er bezweifelte, dass ein Einbrecher jemals so dämlich oder selbstmörderisch gewesen wäre, um auf diese Weise im Eis und Schnee eines Pariser Winters herumzuklettern.
Daniel kletterte ein Stück weit den Schornstein hinauf, bis er die niedrige Mauerbrüstung erreichte, die dieses Dach von dem des Nachbarhauses trennte. Er stellte erleichtert fest, dass das Dach vor ihm nicht geteert, sondern mit halbrunden Tonziegeln gedeckt war. Auch sie konnten eisglatt sein, aber ihre gewellte Oberfläche würde wenigstens gewissen Halt bieten. Wie sich dann zeigte, konnte er auf den Ziegeln verhältnismäßig leicht nach oben laufen. Der Dachfirst dieses Hauses lief nicht spitz zu, stellte er fest, sondern bildete einen gut einen halben Meter breiten Steg. Daniel erkletterte ihn, machte ein paar vorsichtige Schritte und merkte, dass der Steg gut begehbar war. Nun konnte er das Dach auf dem First überqueren, indem er über den Steg balancierte und dabei leicht schwankte, als sei er auf einem Hochseil unterwegs.
Tief unter ihm lag die Avenue Foch: dunkel und verlassen, die Straßenbeleuchtung war wegen der angeordneten Stromrationierung ausgeschaltet. Daniel war sich bewusst, dass jeder, der auf dem für ihn sichtbaren Straßenstück unterwegs war, auch ihn hätte sehen können, weil hier keine Dachbrüstung die Sicht versperrte.
Und es gab weitere Möglichkeiten, entdeckt zu werden. Jeder, der in einem der gegenüberliegenden Gebäude aus einem Fenster in einem der oberen Stockwerke sah, würde ihn sehen. Und die Leute waren heutzutage ungewöhnlich wachsam, weil sie überall Spione und Saboteure witterten. Niemand, der nachts einen Mann auf einem Dach herumklettern sah, würde zögern, La Maison – die Préfecture de Police – anzurufen. Dies war die Zeit der anonymen Denunziationen, in der Franzosen sich gegenseitig mit einer Anzeige bei der deutschen Kommandantur drohten. Deshalb war die Gefahr, dass Daniel entdeckt wurde, durchaus real.
Er bewegte sich so schnell, wie er gerade noch riskieren durfte, bis er die niedrige Brandmauer erreichte, die dieses Dach vom nächsten trennte. Wie das Hôtel du Châtelet hatte das Nachbarhaus ein Mansardendach, das jedoch in Schiefer gedeckt war. Auch sein First war als Steg – wohl für den Schornsteinfeger – ausgebildet, aber viel schmaler als der vorige, er maß höchstens dreißig Zentimeter.
Daniel balancierte über den First, indem er jeweils den linken Fuß vorschob und den rechten nachzog. Bei einem erneuten Blick auf die Avenue unter ihm überkam ihn Angst, aber dann konzentrierte er sich auf die Wichtigkeit seines Auftrags, und der kleine Anfall von Panik verflog.
Nach etwa einer halben Minute war die nächste Trennmauer erreicht. Sie war merklich dicker als die anderen, weil in ihr tönerne Entlüftungsrohre und Kaminzüge verliefen. Aus einigen Zügen quoll Rauch, der bewies, dass die Hausbewohner zu den Glücklichen gehörten, die es behaglich warm hatten, weil sie Kohle verbrennen konnten. Er griff nach einem Entlüftungsrohr, das sich kalt anfühlte, zog sich daran hoch und bemerkte dabei etwas Interessantes.
Auf der Rückseite des Stadthauses ragte die Brandmauer ein gutes Stück in den Hinterhof hinein. Ungefähr einen Meter von der Dachtraufe entfernt waren in die Mauer Eisensprossen eingelassen, die bis auf den dunklen Hof hinunterführten. Diese Sprossen benützte der Schornsteinfeger offenbar als Leiter, wenn die Kaminzüge gekehrt werden mussten.
Im ersten Augenblick war Daniel ratlos. Die Sprossen waren zu weit entfernt. Er konnte nicht, auf der Mauer stehend, versuchen, sich zwischen den Kaminzügen hindurchzuschlängeln, denn dafür war sie nicht breit genug. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als zu den Tonröhren hinaufzugreifen und sich mit baumelnden Beinen wie ein Affe von einer zur anderen weiterzuhangeln. Die Röhren waren zum Glück stabil und von so geringem Durchmesser, dass er sich an jeder gut festhalten konnte.
So hangelte Daniel sich einige Minuten lang weiter, bis er die senkrecht in die Tiefe hinabführenden Eisensprossen erreicht hatte. Während er nach der obersten Sprosse griff, landeten seine Füße schon zwei Sprossen tiefer. Nun konnte er wie auf einer Leiter hinuntersteigen – anfangs langsam, dann immer schneller, je näher er dem Erdboden kam.
Unten blieb er einen Augenblick auf dem verlassenen Hinterhof stehen. Die Hoffenster des Stadthauses waren dunkel. Der Rauch aus den Kaminen zeigte, dass dieses Haus bewohnt war, aber seine Bewohner schliefen wohl schon. Daniel ging langsam, geräuschlos über den gepflasterten Hof. In den hohen Holzzaun war ein Tor eingelassen, das wie erwartet abgesperrt war. Im Vergleich zu seiner Dachartistik war dies ein harmloses Hindernis, kaum der Rede wert. Er erkletterte den Zaun, sprang drüben hinunter und fand sich auf einer Gasse wieder, die parallel zur Avenue Foch verlief.
In diesem Teil der Stadt kannte Daniel sich gut aus. Er unterdrückte den Drang, loszurennen, und schlenderte die Gasse entlang, bis er eine schmale Seitenstraße erreichte. Unterwegs überzeugte er sich davon, dass die Papiere noch im Futter seines Jacketts steckten.
Auch diese Straße war dunkel, unheimlich menschenleer.
Er kam an den unbeleuchteten Fenstern einer Buchhandlung vorbei, die einem Juden gehört hatte, bis die Deutschen den Besitzer enteignet hatten. Auf dem großen weißen Werbebanner über dem alten Firmenschild stand zwischen Hakenkreuzen in Frakturschrift das Wort FRONTBUCHHANDLUNG. Früher war dies eine elegante Buchhandlung für fremdsprachige Literatur gewesen; jetzt war sie auf andere Weise fremdsprachig, weil sie ausschließlich deutsche Bücher verkaufte.
Spuren der deutschen Besatzer waren überall zu erkennen, aber seltsamerweise hatten sie keines der berühmten Wahrzeichen, keines der geliebten Bauwerke dem Erdboden gleichgemacht. Die Nazis hatten nicht versucht, das Paris, das jeder kannte, zu zerstören. Stattdessen wollten sie es einfach annektieren – und sich Europas Kronjuwel aneignen. Aber die Art und Weise, wie die Deutschen Paris ihren Stempel aufgedrückt hatten, wirkte seltsam schluderig und provisorisch. Wie das Werbebanner mit dem Wort FRONTBUCHHANDLUNG, das hastig über dem in Stein gehauenen Namen der Buchhandlung angebracht worden war. All der viele weiße Stoff ließ sich augenblicklich wieder entfernen. Als wollten sie vermeiden, dass ihr neues Juwel Kratzer bekam. Als sie erstmals versucht hatten, auf dem Eiffelturm die Hakenkreuzfahne zu hissen, hatte der Wind sie zerfetzt, sodass sie eine andere Fahne hatten herbeiholen müssen. Selbst Hitler hatte die Stadt wie ein verlegener Tourist nur für ein paar Stunden besucht. Er hatte nicht einmal dort übernachtet. Paris wollte sie nicht haben, das wussten sie sehr wohl.
Deshalb schlugen sie überall ihre Plakate an. Daniel sah sie an den Mauern der Gebäude, an denen er vorbeikam – alle so hoch angeklebt, dass man sie kaum lesen konnte, aber das hatte seinen Grund: Brachten die Deutschen sie niedriger an, wurden ihre dämlichen Plakate unweigerlich abgerissen oder beschmiert. Aufgebrachte Pariser bekritzelten sie mit Sprüchen wie »Tod den boches!« oder »Gott segne England!«
Er sah ein Plakat, auf dem ein beleibter Winston Churchill grinsend seine Zigarre rauchte, während neben ihm eine Mutter mit einem mageren, schreienden Säugling auf dem Arm stand. »Seht ihr, wie unsere Kinder unter der Blockade leiden?«, fragte die Inschrift. Damit war die britische Seeblockade gemeint, aber jeder wusste, dass das Unsinn war. Obwohl dieses Plakat so hoch hing, hatte jemand daraufgekritzelt: »Wo sind unsere Kartoffeln?« Alle waren zornig, denn fast die gesamte französische Kartoffelernte ging nach Deutschland; das war die Wahrheit.
Ein weiteres Plakat, diesmal nur mit Text: Êtes-vous en règle? Sind Ihre Papiere in Ordnung? Oder: Sind Sie in Ordnung? Für den Fall, dass man von französischen gendarmes oder irgendeinem fonctionnaire kontrolliert wurde – die waren schlimmer als die deutschen Soldaten –, musste man ständig seine Kennkarte, seine carte d’identité, mitführen.
Der junge Mann hatte stets seine Papiere bei sich. Sogar in mehrfacher Ausfertigung. Mit unterschiedlichen Namen, unterschiedlichen Nationalitäten. Sie ermöglichten ihm die raschen Wechsel, zu denen er oft gezwungen war.
Schließlich erreichte er sein Ziel, ein altes, fast baufälliges Klinkergebäude in einem Allerweltsviertel. An einer schmiedeeisernen Halterung baumelte ein verblasstes Holzschild: LE CAVEAU, der Keller. Das Schild bezeichnete eine Kellerbar, zu der einige abgetretene Ziegelstufen hinunterführten. Das Verdunklungsrouleau des einzigen kleinen Fensters war heruntergezogen, aber auf beiden Seiten leckte Licht heraus.
Daniel sah auf seine Armbanduhr. Es war nach Mitternacht, kurz nach Beginn der Ausgangssperre, die ces messieurs – die Deutschen – über Paris verhängt hatten.
Diese Bar hatte jedoch nicht geschlossen. Die gendarmes und die Deutschen sahen darüber hinweg, dass sie bis spätnachts geöffnet blieb. Schmiergelder waren gezahlt, die richtigen Leute waren geschmiert, kostenlose Drinks waren serviert worden.
Er stieg die wenigen Stufen hinunter und zog dreimal an einem altmodischen Klingelzug. Von drinnen war zu hören, wie das Klingelzeichen die Kakophonie aus Stimmen und lauter Jazzmusik übertönte.
Sekunden später erschien ein Lichtpunkt in dem Spion in der Mitte der massiven Holztür, deren Füllung schwarz abgesetzt war. Das Licht schien zu flackern, als jemand ihn in Augenschein nahm, dann ging die Tür nach innen auf, um ihn einzulassen.
Die Bar war tatsächlich ein caveau – unebener, von Rissen durchzogener Steinboden, klebrig von verschütteten Getränken; wasserfleckige, ungestrichene Ziegelwände; niedrige Decke. Die Luft war blau von Tabakqualm und stank nach Schweiß, abgestandenem Rauch – noch dazu von billigem Tabak – und schlechtem Fusel. Aus dem Radio kam blechern scheppernde Musik. An der verkratzten Theke saßen sechs oder sieben ungehobelt aussehende Arbeiter und eine Frau, vermutlich eine Prostituierte. Sie alle sahen ihm entgegen – vage neugierig und feindselig zugleich.
Der Barkeeper, der ihn eingelassen hatte, begrüßte ihn. »Lange nicht mehr gesehen, Daniel«, sagte Pasquale, ein hagerer, alter Mann, so verwittert wie seine Bar. »Aber ich freue mich immer, wenn du vorbeischaust.« Er grinste und ließ dabei ungleichmäßige, von Tabak verfärbte braune Zähne und zwei Goldzähne sehen. Dann brachte er sein Gesicht mit der lederartigen Haut dicht an Daniels heran. »Gibt’s noch immer keine Gitanes?«
»Ich denke, dass ich morgen, spätestens übermorgen welche reinbekomme.«
»Wunderbar. Sie kosten immer noch unter hundert Franc, oder etwa nicht?«
»Über hundert.« Daniel senkte die Stimme. »Für andere. Für dich gibt’s einen speziellen Barkeeper-Rabatt.«
Der Alte kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Wie viel?«
»Für dich kostenlos.«
Pasquale lachte herzhaft, ein rasselndes Raucherlachen. Eigen konnte sich nicht vorstellen, was für merde der Barkeeper normalerweise rauchte. »Dein Preis ist in Ordnung«, sagte er und kehrte an seinen Platz hinter der Theke zurück. »Möchtest du einen Drink?«
Eigen schüttelte den Kopf.
»Schottischen Whisky? Einen Cognac? Musst du mal telefonieren?« Er deutete auf die Telefonzelle am Ende der Theke, deren Scheibe herausgebrochen war – von Pasquale als Warnung für seine Gäste, ihre Zunge zu hüten. Selbst hier, wo Fremde keinen Zutritt hatten, konnte man nicht wissen, ob man belauscht wurde.
»Nein, danke. Ich gehe nur mal aufs Klo.«
Pasquale zog eine Sekunde lang die Augenbrauen hoch; dann nickte er, weil er verstanden hatte. Er war ein raubeiniger, streitsüchtiger Kerl, aber zugleich vorbildlich diskret. Er wusste, wer in Wirklichkeit seine Miete zahlte, und er hasste die Deutschen ebenso wie alle anderen. Zwei seiner geliebten Neffen waren im Kampf gegen sie gefallen. Aber er sprach niemals über Politik. Er tat seine Arbeit, servierte seine Drinks, und damit hatte es sich.
Als Eigen die Theke entlangging, hörte er jemanden knurren: »Espèce de sans-carte!« Kartenloser Kerl – der übliche Schimpfname für Schwarzhändler. Der Mann hatte anscheinend mitbekommen, worüber Daniel und Pasquale gesprochen hatten. Nun, das ließ sich nicht ändern.
Am Ende des langen, schmalen Raums, wo Eigen im Halbdunkel kaum noch etwas erkennen konnte, führte eine Tür auf eine baufällige Holztreppe hinaus. Ihre Stufen ächzten und knarrten, als er die Treppe hinunterstieg. Der Fäkaliengestank war überwältigend, obwohl irgendein rücksichtsvoller Gast die Tür zum Klosett, auf dem es bestimmt noch schlimmer stank, geschlossen zurückgelassen hatte.
Statt jedoch auf die Toilette zu gehen, öffnete Eigen die Tür einer Besenkammer. Er trat ein, stieg über Eimer, Mopps und alle möglichen Gerätschaften hinweg. An der Rückwand hing ein Besen mit kurzem Stiel. Er packte den Stiel – der in Wirklichkeit fest an der Wand montiert war – und zog ihn in einem Linksbogen herab. Als er gleichzeitig gegen die Wand drückte, die sich in Angeln bewegen ließ, schwang sie wie eine Tür auf.
Nun betrat er einen weiteren dunklen Raum mit knapp zwei mal zwei Metern Fläche, in dem es nach Staub und Schimmel roch. Über sich konnte er Schritte hören, als einer der Gäste seinen Platz an der Theke wechselte. Direkt vor sich hatte er eine Stahltür, die erst vor kurzem schwarz gestrichen worden war.
Auch hier gab es eine Klingel, die allerdings weit neuzeitlicher als Pasquales Klingelzug war. Er drückte zweimal auf den Klingelknopf, machte eine kurze Pause und klingelte dann erneut.
Hinter der Tür erklang eine barsche Stimme. »Oui?«
»Ich bin’s, Marcel«, sagte der als Daniel Eigen bekannte Mann.
Die Stimme fragte auf Französisch weiter: »Was wollen Sie?«
»Ich habe gute Ware, die Sie vielleicht interessieren wird.«
»Zum Beispiel?«
»Ich kann Ihnen Butter besorgen.«
»Woher?«
»Aus einem Lager an der Porte des Lilas.«
»Wie viel?«
»Zweiundfünfzig Franc das Kilo.«
»Das ist zwanzig Franc mehr als der amtliche Preis.«
»Ja, aber der Unterschied ist, dass ich sie Ihnen wirklich besorgen kann.«
»Ah, ich verstehe.«
Eine kurze Pause, dann öffnete die Stahltür sich erst mit einem mechanischen Klicken, dann mit dem Zischen von Druckluft.
Ein kleiner, gepflegter junger Mann mit rosigem Gesicht, schwarzer Cäsarenfrisur und Hornbrille empfing den Besucher mit einem schiefen Lächeln.
»Sieh da, sieh da, Stephen Metcalfe persönlich«, sagte er mit Yorkshire-Akzent. »Aufgedonnert wie zu einer Theaterpremiere. Was hast du für uns, Kumpel?«
Kapitel Zwei
Stephen Metcalfe – alias Daniel Eigen, alias Nicolas Mendoza, alias Eduardo Moretti, alias Robert Whelan – schloss die Tür hinter sich und überzeugte sich davon, dass sie ganz verriegelt war. Zur besseren Schalldämmung saß die Stahltür in einer dicken Gummidichtung.
Natürlich war der gesamte Raum, in dem er jetzt stand, mit modernsten technischen Mitteln schallgedämmt. Tatsächlich war es ein doppelwandiger Raum innerhalb eines Raums, der auf Stahlplatten und einer fünfzehn Zentimeter dicken Gummischicht ruhte und von ihnen umgeben war; selbst die Luftschächte waren mit Gummi und Glasfasermaterial isoliert. Der niedrige Raum war aus neuen Hohlblocksteinen gemauert, die im typischen Grau der U.S. Army gestrichen waren.
Von dem frischen grauen Anstrich war jedoch nicht viel zu sehen, weil alle Wände mit kompliziert aussehenden Konsolen zugestellt waren. Sogar Metcalfe kannte nicht einmal die Hälfte dieser Geräte, obwohl er mindestens einmal pro Woche vorbeikam. Aber er kannte die Kurzwellen-Funkgeräte Mark XV und Paraset, Fernschreiber, Telefone mit automatischer Verschlüsselung, die Chiffriermaschine M-209 und Drahtspeichergeräte.
Die Konsolen wurden von zwei jungen Männern bedient, die Kopfhörer trugen und sich Notizen auf Schreibblöcken machten, während ihre Gesichter im unheimlichen grünen Widerschein runder Kathodenstrahlröhren leuchteten. Sie trugen Baumwollhandschuhe, mit denen sie Einstellknöpfe drehten, um Frequenzen zu kalibrieren. Die von atmosphärischen Störungen überlagerten Morsezeichen des Funkverkehrs, den sie überwachten, wurden von Antennen empfangen, die das Gebäude – das einem französischen Sympathisanten gehörte – vom Keller bis zum Dach durchzogen.
Bei jedem Besuch in der »Höhle«, wie diese geheime Funkzentrale genannt wurde – niemand wusste, ob sie ihren Spitznamen der Bar Le Caveau über ihr oder der Tatsache verdankte, dass sie einer elektronischen Schatzhöhle glich –, war Metcalfe wieder von der Vielzahl der hier stehenden Geräte beeindruckt. Sie alle waren in Teilen über französische Häfen eingeschmuggelt oder mit Fallschirmen abgeworfen worden und standen selbstverständlich auf der Verbotsliste der deutschen Militärbehörden. Schon der Besitz eines einfachen Kurzwellenempfängers konnte einen vor ein Erschießungskommando bringen.
Stephen Metcalfe gehörte zu der Hand voll Agenten, die in Paris für ein angloamerikanisches Spionagenetzwerk arbeiteten, von dessen Existenz nur einige mächtige Männer in Washington und London wussten. Metcalfe kannte nur wenige der anderen Agenten. So funktionierte das Netzwerk: Jeder Teil war von den anderen abgeschottet; alles war in Zellen unterteilt. Keine Zelle wusste, was die übrigen Zellen zu irgendeinem Zeitpunkt taten. Sicherheitserwägungen diktierten dieses Verfahren.
Hier in der Höhle überwachten und betrieben drei junge Funker und Kryptografen geheime Funkverbindungen mit London, mit Washington und mit einem weit verzweigten Netz aus Geheimagenten in Paris und weiteren Großstädten im besetzten Frankreich und in ganz Europa. Die Männer – zwei Engländer und ein Amerikaner – gehörten zu den Besten; sie waren vom Royal Corps of Signals in Thames Park bei Oxford und danach in der Special Training School 52 ausgebildet worden. Qualifizierte Funker waren heutzutage Mangelware, und die Briten waren den Amerikanern auf dem Ausbildungssektor weit voraus.
Ein auf die BBC eingestelltes Radio lief leise: Auch der Rundfunk wurde aufmerksam überwacht, weil er vor den Abendnachrichten verschlüsselte Meldungen in Form eigenartiger »persönlicher Mitteilungen« brachte. Auf dem kleinen Klapptisch in der Mitte des Raums wartete eine nicht zu Ende gespielte Partie Schach. Abends herrschte immer Hochbetrieb, weil die Frequenzen dann am wenigsten überlastet waren, sodass Funksprüche am leichtesten gesendet und empfangen werden konnten.
An den Wänden hingen Europakarten, genaue Frankreichkarten und ein großer Stadtplan von Paris mit allen Arrondissements. Dazu kamen Seekarten, topografische Karten, Tabellen der Schiffsbewegungen in Marseille und detaillierte Pläne von Marinestützpunkten. Trotzdem gab es selbst in diesem Raum eine persönliche Note: Zwischen den Karten und Plänen hing ein Life-Titelbild mit Rita Hayworth, und ein weiterer Ausschnitt aus einer Illustrierten zeigte Betty Grable im Badeanzug.
Derek Compton-Jones, der Mann mit dem rosigen Gesicht, der Metcalfe die Tür geöffnet hatte, ergriff seine Hand und schüttelte sie kräftig. »Freut mich, dass du heil und gesund zurückgekommen bist, Kumpel«, sagte er feierlich.
»Das sagst du jedes Mal«, erwiderte Metcalfe, um ihn aufzuziehen. »Als wärst du enttäuscht.«
»Verdammt noch mal!«, schnaubte Compton-Jones. Er wirkte verlegen und empört zugleich. »Hast du mitgekriegt, dass wir uns mitten im Krieg befinden?«
»Im Ernst?«, fragte Metcalfe. »Wenn ich’s mir recht überlege, sind dort draußen wirklich auffällig viele Uniformen herumgelaufen.«
Einer der beiden Männer, die auf der anderen Seite des Raums mit Kopfhörern vor ihren Konsolen saßen, sah sich nach Compton-Jones um und bemerkte müde: »Wenn er seinen Willy in der Hose behielte, würde er vielleicht merken, was außerhalb der Schlafzimmer passiert, in denen er sich überwiegend herumtreibt.« Die näselnde Stimme und der britische Upper-Class-Akzent gehörten Cyril Langhorne, einem erstklassigen Kryptografen.
Sein Kollege Johnny Betts aus Pittsburg, ein ausgezeichneter Funker, schaltete sich ein und sagte knapp: ›Roger‹!«
»Ha«, sagte Langhorne. »Für Stephen hier ist alles ›Roger‹, was einen Rock anhat.«
Compton-Jones lachte errötend. Metcalfe lachte gutmütig mit, dann sagte er: »Ich denke, ihr Eierköpfe müsstet öfter aus eurem Loch heraus. Ich sollte euch mal ins Eins-Zwo-Zwo mitnehmen.« Alle wussten, dass er von dem berühmten Bordell mit der Adresse 122 Rue de Provence sprach.
»Auf diesem Gebiet bin ich versorgt«, prahlte Compton-Jones. »Ich hab jetzt eine feste Freundin.« Er zwinkert den anderen zu und ergänzte: »Ich treffe mich später mit ihr, wenn ich die neue Ladung Ersatzteile abgeholt habe.«
»Ist das deine Vorstellung von einer tiefen Penetration Frankreichs?«, fragte Langhorne.