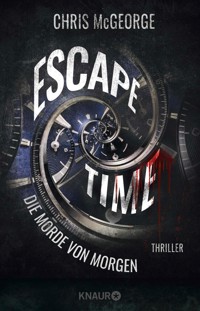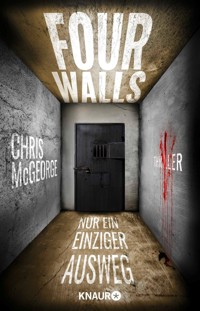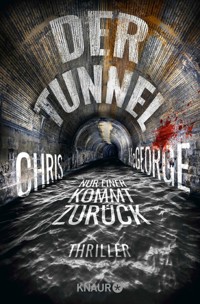
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Am Ende dieses Tunnels wartet kein Licht … Sechs Freunde fahren mit dem Boot in Englands längsten Kanaltunnel, doch nur einer kehrt wieder zurück: ein wendungsreicher Thriller mit einem finster-atmosphärischen Schauplatz. Seit Jahren versucht der Schriftsteller Robin Ferringham, das Verschwinden seiner großen Liebe Samantha zu verarbeiten. Da erhält er einen kryptischen Anruf: Ein junger Gefängnisinsasse namens Matthew bittet Robin um Hilfe – dafür bietet er Informationen über Sam. Robin recherchiert den Fall und findet heraus, dass Matthew und seine Freunde vor einem Jahr mit dem Boot in Englands längsten Kanaltunnel gefahren sind. Als das Boot wieder auftauchte, waren alle bis auf Matthew verschwunden. Er ist der einzige Verdächtige – doch er erinnert sich an nichts. Wenn Robin etwas über Sams Verbleib erfahren will, dann muss er dem Geheimnis des finsteren Tunnels selbst auf den Grund gehen … In Chris McGeorges zweitem Thriller »Der Tunnel« wird Englands längster Kanaltunnel zu einer tödlichen Falle – und zum beklemmend-atmosphärischen Schauplatz für ein wendungsreiches Spiel mit der Wahrheit. »Ein Thriller mit Suchtpotential: beängstigend, spannend, mitreißend.« krimi-couch.de Entdecken Sie auch die anderen Thriller von Chris McGeorge: - Escape Room - Nur drei Stunden - Four Walls - Nur ein einziger Ausweg - Escape Time - Die Morde von morgen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Chris McGeorge
Der Tunnel – Nur einer kommt zurück
Thriller
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Sind Sie bereit für einen Boots-Trip ohne Wiederkehr?
Willkommen im Standedge-Tunnel, Englands längstem Kanaltunnel: mit dem Boot befahrbar, finster, klaustrophobisch – und das perfekte Setting für einen Thriller voller überraschender Twists!
Sechs junge Leute, seit Jahren beste Freunde, fahren mit dem Boot in Englands längsten Kanal-Tunnel: ein echtes Abenteuer in beklemmender Dunkelheit. Als das Boot nach über zwei Stunden am anderen Ende des Standedge-Tunnels wieder auftaucht, sind fünf der Freunde verschwunden. Der sechste, Matthew, ist bewusstlos.
Natürlich behauptet Matthew, nicht zu wissen, was sich in der Finsternis des Tunnels zugetragen hat. Doch niemand kennt Standedge so gut wie er, der dort Führungen für Touristen anbietet. Und möglicherweise war die Freundschaft der sechs schon längst nicht mehr so unschuldig wie zu Kindertagen …
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Dank
Für die Verschollenen und
die Gefundenen …
1
Sein Handy auf dem Tisch summte, entschuldigend sah Robin zu dem Mann vor ihm auf. Der schien davon überhaupt keine Notiz zu nehmen, sondern blickte nur mit leerer Miene zu Robin und wartete.
Robin widmete das Buch einer »Vivian«, kritzelte seinen Standardspruch unter den Namen und unterschrieb schwungvoll. Er klappte das Buch zu und schob es dem Mann hin. Der ergriff es, grunzte etwas, was sich wie Zustimmung anhörte, und eilte zur Kasse. Hoffentlich wusste Vivian seine Widmung mehr zu würdigen, dachte sich Robin.
Er unterdrückte ein Seufzen und sah genau in dem Augenblick zu seinem Handy, als es aufhörte zu summen. Auf dem Sperrbildschirm ploppte eine Nachricht auf und informierte ihn über einen Anruf von einer unbekannten Nummer, anschließend ging der Bildschirm in den Schlafmodus. Wahrscheinlich nur seine Schwester auf ihrem Telefon in der Chirurgie.
Er sah sich um. Die Signierstunde lief ziemlich schleppend. Robin saß exakt in der Mitte der Buchhandlung Waterstones in Angel, Islington, an einem runden Tisch, auf dem sich Exemplare von Ohne sie stapelten. Bei seiner Ankunft, etwa eine halbe Stunde vorher, war der Stapel noch lächerlich hoch gewesen. Jetzt war die Höhe etwas realistischer, aber nicht, weil so viel verkauft worden wäre. Robin hatte die meisten Bücher kurzerhand unter dem Tisch versteckt, damit der Stapel weniger bedrohlich wirkte. Trotzdem schienen sich die Kunden in alle Richtungen zu zerstreuen, wenn sie ihn erblickten – wie Büroklammern am falschen Ende eines Magneten.
Eine beherzte junge Waterstones-Angestellte, die sich als Wren vorgestellt hatte, kam voller Enthusiasmus auf ihn zu. Es schien ihr wirklich Spaß zu machen, ein gutes Buch mit einem Besitzer zusammenzubringen. Robin wünschte sich, er hätte nur halb so viel Energie wie sie, aber mittlerweile knackten seine Gelenke, die grauen Strähnen in den Haaren breiteten sich immer weiter aus, und allein bei der Vorstellung, einen Spaziergang zu unternehmen, kam er aus der Puste. Falten hatten sich an den üblichen Stellen in sein Gesicht gegraben, jeder Funke von Jugendlichkeit in den Augen war vor langer Zeit erloschen.
Oft fragte er sich, ob Samantha ihn überhaupt noch erkennen würde – würde sie beim Anblick des alten Knackers auf dem Sofa aufkreischen, wenn sie morgen ihre Wohnung betreten sollte? Manchmal musste er darüber lachen, manchmal brachte es ihn zum Weinen.
»Wie läuft es so?«, fragte Wren und betrachtete freudig den Bücherstapel. Robin setzte sich so hin, dass die Exemplare unter dem Tisch verdeckt wurden. Es war ihm egal, welches Bild er abgab, er wollte nur nicht, dass sich Wren schlecht fühlte. Es war ja nicht ihre Schuld, dass sich Ohne sie nicht verkaufte.
»Ganz gut«, sagte Robin. Zu einem positiveren Adjektiv konnte er sich nicht durchringen. Sein Handy summte. Ohne den Blick von Wren zu nehmen, griff er danach und lehnte den Anruf ab.
»Gut«, sagte sie. Ihr Blick huschte von ihm zum Handy und zurück, ihr Lächeln verlor ein wenig von seinem Glanz. »Also, wenn Sie was brauchen, Sie wissen ja, wo ich bin. Mal sehen, vielleicht kann ich ja ein paar Leute zu Ihnen rüberlotsen, wenn ich denke, sie könnten sich für das Buch interessieren.«
»Danke«, sagte Robin und lächelte umso mehr, je mehr ihr Lächeln schwand. »Das wäre toll.« Aber wie wollte sie denn sein Buch den bedauernswerten Kunden anpreisen?, überlegte er, als sich Wren umdrehte und nach vorn ging. Schließlich handelte es sich nicht unbedingt um eine tolle Geschichte. Das hatte er schon beim Verfassen gewusst. Im Grunde hatte er das ganze Projekt als therapeutische Übung angesehen und es in einer Schublade wegsperren wollen. Hätte er es doch bloß gemacht. Aber seine Zwillingsschwester Emma hatte ihn dazu überredet, das Manuskript einem Agenten zu geben, und so hatte alles seinen Lauf genommen. »Es ist unheimlich gut, Robin. Sie sehen das bloß nicht. Der Schmerz – echter, wahrer Schmerz kommt darin zum Ausdruck. Wahrlich lukullisch«, sagte Stan Barrows bei ihrem ersten Treffen in seiner in einem Hochhaus untergebrachten Agentur. Er hatte noch nie gehört, dass jemand Schmerz als lukullisch beschrieben hätte, so, als wollte der alte, smarte Gentleman seinen Kummer vor seinen Augen wie ein Steak zerschneiden.
Robin mochte Barrows nicht, aber der Agent beschaffte ihm einen guten Vertrag. Was nicht schlecht war, da seine Karriere als freiberuflicher Journalist ins Stocken geraten war. Eine neue Journalistengeneration nahm den alten Typen wie ihm die Artikel weg – Youngsters, die sich an eine Zeit ohne Internet gar nicht erinnern und einen Artikel raushauen und verkaufen konnten, bevor Robin überhaupt sein Textverarbeitungsprogramm gestartet hatte. Er brauchte also etwas. Daher unterschrieb er den Buchvertrag und versuchte sich vorzustellen, dass Sam zugestimmt hätte.
Jetzt, achtzehn Monate später, saß er hier und wusste immer noch nicht, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Er nahm eines der Bücher zur Hand. Das Cover hatte einen blassblauen Hintergrund, auf dem vier Fotos von Sam – in Polaroidanmutung – verteilt waren, als hätte jemand sie nachlässig hingeworfen. Sie überschnitten sich, im Zwischenraum waren in schwarzen Lettern der Titel und sein Name geprägt. Das oberste Foto zeigte Samantha als Baby, sie war ein halbes Jahr alt, saß auf einer Spielmatte und hielt eine Spielzeuglokomotive in der Hand. Auf dem zweiten war sie, sichtlich nervös, in Schuluniform am ersten Tag der weiterführenden Schule zu sehen. Das dritte Foto war ihr Abschlussfoto an der Universität Edinburgh – Master of Science in Psychologie, als Beste ihres Jahrgangs. Das letzte Foto stammte von ihrem Hochzeitstag – Robin und Samantha Ferringham, bis dass der Tod euch scheidet. Robin betrachtete das Buch nicht gern, aber das hatte nichts mit dem Cover zu tun – die Fotos waren vom Verleger ausgewählt worden, er hatte diese Aufgabe gern abgegeben. Er hatte dem Verlag einfach alle Fotos geschickt, die er hatte, und irgendwelche Mitarbeiter hatten sich die herzzerreißendsten ausgesucht – die, die sich gut verkaufen ließen.
Es wäre zu viel, wenn man sagte, er würde das Buch hassen – er war immer noch stolz, es geschrieben zu haben –, aber eigentlich wollte er es nicht mehr sehen. Es war die gegenständliche Verkörperung des Schmerzes, seines Schmerzes, des Schmerzes der …
Das vertraute Geräusch. Das Summen. Wieder sein Handy. Wieder die »unbekannte Nummer«. Das dritte Mal jetzt – was sollte das? Wenn es seine Schwester war, würde sie nicht ohne triftigen Grund anrufen – sie wusste, dass er beschäftigt war. Und wenn es nicht Emma war, wollte ihn jemand wirklich erreichen. Er ließ das Handy noch einige Male summen, dann sah er sich um – im Laden war immer noch wenig los – und ging ran.
»Hallo«, meldete er sich.
Er erwartete eigentlich, Emma zu hören, stattdessen kam das Krächzen einer schroffen weiblichen Roboterstimme. »Sie haben einen Anruf von einem Prepaid-Telefon von …« Die Stimme eines jungen Mannes unterbrach: »Matthew«, bevor der Roboter fortfuhr. »Insasse im Gefängnis Seiner Majestät New Hall. Nehmen Sie diesen Anruf auf einem Mobiltelefon entgegen, fallen möglicherweise weitere Gebühren an. Mit der Annahme dieses Anrufs erklären Sie sich bereit, dass das Gespräch überwacht und eventuell aufgezeichnet wird. Sind Sie mit diesen Bedingungen einverstanden, drücken Sie die 1.«
Robins Gedanken stoben in viele Richtungen auseinander. Jemand, ein »Matthew«, rief ihn aus einem Gefängnis an? Er kannte niemanden im Gefängnis – zum Teufel, er hatte noch nie einen Häftling gekannt, er kannte noch nicht mal jemanden, der dort arbeitete.
Es musste ein Irrtum sein, war sein erster Gedanke. Aber dann fiel ihm ein, dass diese Person ihn bereits dreimal hintereinander angerufen hatte. Und nach dem Roboter zu schließen, hatte er dafür bezahlt. Wer immer dieser Matthew sein mochte, er wollte wirklich mit ihm reden. Aber vielleicht hatte der arme Matthew bloß die falsche Nummer?
Die Roboter-Lady begann von Neuem: »Sie haben einen Anruf von einem Prepaid…« Robin unterbrach sie, indem er die 1 drückte. Er wartete.
Jeder Anschein, es könnte sich um einen Irrtum handeln, löste sich auf, als sich eine jugendliche Stimme meldete: »Spreche ich mit Mr Ferringham? Mr Robin Ferringham?«
Beunruhigt sah sich Robin um, als könnte er den Urheber des seltsamen Anrufs irgendwo entdecken. Aber nein – der Laden war fast so leer wie vorher, natürlich beobachtete ihn keiner.
Da stimmte etwas nicht. Er hatte seine Handynummer sorgsam gehütet. Das war einer der heilsamsten Ratschläge gewesen, die er von Stan Barrows jemals bekommen hatte. Ursprünglich hatte er in seinem Manuskript am Ende des Textes um Rückmeldungen gebeten und dazu seine Telefonnummer angegeben. »Nein«, hatte der Verleger gesagt und erst auf Nachfrage seine Antwort erläutert. »Leute, kranke Ärsche werden ihre Spielchen mit Ihnen treiben. Die haben ihren Spaß daran. Die rufen Sie ununterbrochen an und wollen Sie nur provozieren. Und das so lange, bis es ihnen auch gelingt.« Robin hielt zunächst dagegen, aber dann sagte Barrows etwas, was er nie vergessen würde. »Robin, gehören Sie nicht zu denen, die meinen, alle Menschen hätten die gleichen Moralvorstellungen wie man selbst.« Seitdem hatte er seine Privatnummer nirgends mehr angegeben – nicht in Online-Profilen, nicht auf Verträgen, noch nicht einmal bei Take-away-Bestellungen.
»Ich hab angerufen«, sagte der andere, fast, als wollte er Robin daran erinnern, dass er da sei.
»Wer hat Ihnen diese Nummer gegeben?«, fragte Robin so harsch, dass die einzige Kundin im Laden – eine alte Frau, die den Buchstaben M in der Krimiabteilung durchging – sich umsah. Für den Bruchteil einer Sekunde sah Robin ihr in die Augen, dann wandte er sich wieder ab. »Wer?«
»Ich hab angerufen.« Der junge Mann tastete nach Worten. »Ich hab nicht gedacht, dass Sie rangehen.«
Vielleicht hätte ich es nicht tun sollen, dachte Robin. »Sagen Sie mir, wer Ihnen diese Nummer gegeben hat, oder ich lege auf.«
Robin spürte etwas ganz tief in sich, eine Wut, wie er sie schon lange nicht mehr gekannt hatte. Er wusste nicht genau, warum, bis der andere sagte: »Sie hat sie mir gegeben. Sie heißt Samantha, hat sie gesagt.«
Robin packte so fest das Handy, dass sich die Kanten in seine Hand schnitten und seine Finger weiß wurden. Sam. Sam hatte irgendeinem Typen im Knast seine Nummer gegeben? Wann? Warum? Moment, nein – das war ein Troll-Versuch, ganz einfach. Dieser Matthew trieb ein Spiel mit ihm. Vielleicht rief er noch nicht mal aus einem Gefängnis an – vielleicht gehörte die Roboterstimme nur zu diesem dummen Streich, der darauf abzielte, dass er alle Vorsicht fahren ließ.
Robins Finger bewegte sich zum roten Knopf, obwohl er das Handy immer noch ans Ohr hielt. Dort verharrte er. Etwas hielt ihn zurück. Die Nummer – wie war dieser Matthew an seine Nummer gekommen? Und dann fiel ihm ein, was sein Kontakt bei der Polizei gesagt hatte. Alles aufschreiben, jedes Detail, mochte es noch so unscheinbar sein, damit die Polizei vielleicht den Idioten aufspüren konnte, der für den Telefonterror verantwortlich war. Obwohl dieses Gespräch eineinhalb Jahre zurücklag und der Polizeibeamte mittlerweile auch auf seine E-Mails nicht mehr antwortete.
Mit der freien Hand tastete er seine Taschen ab, fand seinen Signierstift, aber kein Blatt, auf das er schreiben könnte. Er sah sich suchend um, sein Blick fiel auf das Buch. Ohne groß nachzudenken, blätterte er die ersten Seiten um und fand die, auf der er gewöhnlich seine Widmung hinterließ. Er setzte den Stift an und schrieb »Gefängnis New Hall« und »Matthew« und fügte ein Fragezeichen an.
»Mit wem spreche ich?«, fragte er und versuchte, seine Gefühle im Zaum zu halten.
»Hat denn nicht …? Ich bin Matthew.« Matthew war jetzt den Tränen nah. Er klang nicht wie jemand, als hätte er seinen Spaß bei der Sache, aber Robin hatte ja keine Ahnung vom Geisteszustand eines Typen, der so durchgeknallt war, dass er so was machte.
»Den vollen Namen.«
Und jetzt begann Matthew tatsächlich zu schluchzen. Er klang wie ein verwundetes Tier. Robin ließ das nicht unberührt. Was lief hier ab?
Er versuchte es mit einer anderen Frage. »Wie haben Sie es geschafft, mich dreimal anzurufen?«
Damit drang er zu dem anderen durch. »Was?«
»Wenn Sie im Gefängnis sind, wie haben Sie mich da dreimal anrufen können? Sie haben nur einen Anruf.«
Matthew schniefte laut. »Ich … mein Anwalt hat das hingekriegt. Sie haben mich schon vor einiger Zeit verhaftet … und da sind Sie mir … Das ist jetzt nicht wichtig.«
»Doch, es ist wichtig.«
»Nein, wichtig ist – dass ich es nicht war, Mr Ferringham. Sie müssen mir glauben. Ich hab die anderen nicht umgebracht.«
»Was?«, rief Robin. »Wovon reden Sie?«
»Sie glauben, dass ich es war. Aber ich konnte es doch gar nicht gewesen sein. Meine Freunde.«
»Ich …« Robin verlor den Faden – da war etwas in der Stimme des jungen Manns. Etwas … Vertrautes.
»Wir sind durchgefahren. Wir sechs. Und ich war der Einzige, der wieder rausgekommen ist. Nur ich bin wieder rausgekommen.«
Worum ging es hier?
»Woher kennen Sie Samantha?«
»Sie müssen mir helfen, Mr Ferringham. Bitte, ich … bitte sagen Sie, dass Sie mir helfen.« Matthew weinte jetzt hemmungslos.
Robin schauderte. Er war nicht mehr wütend, sondern zutiefst beunruhigt. Er kam sich vor, als kommunizierte er mit einem Gespenst, als führte er ein Gespräch, das gar nicht sein konnte. »Es … es tut mir leid, aber ich kenne Sie doch gar nicht. Und wer immer Ihnen diese Nummer gegeben hat, es kann nicht die Person gewesen sein, die es Ihrer Aussage nach war, also werde ich jetzt auflegen.« Er hielt kurz inne. »Es tut mir leid.« Überrascht stellte er fest, dass dem wirklich so war.
Robin nahm das Handy vom Ohr und wollte den Anruf schon beenden, als Matthew so laut rief, dass es klang, als wäre er auf Lautsprecher. »Clatteridges … 19.30 Uhr, 18. August … 1996.«
Robin erstarrte. Mittlerweile zitterte er am ganzen Leib. Er sah auf das Telefon in seiner Hand, dann zum offenen Buch auf dem Tisch. Etwas fiel auf die aufgeschlagene Seite, er brauchte etwas, bis er es als Träne erkannte.
Er verdrängte den Schmerz. Und dann war die Wut wieder da. Erneut hielt er das Handy ans Ohr. »Wo zum Teufel haben Sie das gehört?« Es stand noch nicht mal im Buch, er hatte es absichtlich nicht erwähnt. Er hatte etwas für sich behalten wollen.
»Das hat sie gesagt. Sie hat gesagt, Sie würden mir nicht glauben. Also hat sie das gesagt, genau in diesem Wortlaut. Clatteridges. 18. August 1996.19.30 Uhr.«
Robin konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er hatte seine Hoffnung fest verpackt und verschlossen und sie ganz hinten im Schrank seiner Seele verstaut. Hoffnung war das schlimmste Gefühl, das Menschen in seiner Lage, Menschen, die zurückgelassen wurden, haben konnten. Und jetzt wühlte Matthew im Schrank und wollte genau dieses Gefühl hervorholen.
Er schloss die Augen, atmete langsam ein und aus, dachte nach. Es musste für alles eine Erklärung geben – ein Zufall oder so was. Mehr nicht. Denn etwas anderes …
»Sie hat mich angerufen«, sagte Matthew. Er klang jetzt ruhiger, so, als würde er einfach nur die Fakten aufzählen. »Mitten in der Nacht. Vor ein paar Jahren. Ich hab nicht gewusst, wer sie ist oder warum sie mich anruft, ich hatte keine Ahnung. Anfangs hab ich sie gar nicht verstanden. Ich dachte, sie wäre betrunken oder auf Drogen. Sie klang völlig verwirrt. Aber langsam hat alles irgendwie mehr Sinn ergeben. Sie hat mir ihren eigenen Namen genannt. Dann Ihren. Sie hat gesagt, ›Robin Ferringham ist der großartigste Mann, dem ich je begegnet bin‹. Der Einzige, dem man trauen kann. Robin Ferringham, hat sie gesagt, würde einen nie im Stich lassen.«
Das kann nicht sein. Es ist ein Trick. Nur ein beschissener Trick.
»Ich hab mich seit Ewigkeiten nicht mehr an den Anruf erinnert – ich glaube, ich hab mir eingeredet, alles bloß geträumt zu haben. Und dann steckt man mich hier rein, und ich hab nichts außer Zeit zum Nachdenken. Da ist es mir wieder eingefallen. Sie ist mir wieder eingefallen. Und ich hab mich an Sie erinnert.«
Ein Anruf mitten in der Nacht. Vor Jahren. Clatteridges. War das möglich – wirklich? »Ich glaube Ihnen nicht«, flüsterte Robin. Die genauere Formulierung wäre gewesen: »Ich kann Ihnen nicht glauben.«
»Können Sie sie nicht einfach fragen?«, sagte Matthew.
Robin stockte der Atem. »Samantha wird seit drei Jahren vermisst.«
Stille am anderen Ende der Leitung. Dann leise: »Was? Nein. Nein. Das ist nicht … Bitte, Mr Ferringham, Sie müssen …« Der Anrufer war nur noch undeutlich zu hören.
Robin sah auf sein Handy. Noch ein Balken Signalstärke. Er fluchte leise und hörte ein Räuspern. Er sah auf, mit einem Mal fiel ihm wieder ein, wo er sich befand. Dieselbe alte Frau, die das Krimiregal durchstöbert hatte, stand mit einem Exemplar von Ohne sie vor ihm. Das Buch sah reichlich zerlesen aus, ganz klar ihr eigenes Exemplar. Die Frau wollte ihm etwas sagen, aber Robin nahm das Handy wieder ans Ohr.
»Matthew«, sagte er. Da musste mehr sein, er brauchte Gewissheit. »Matthew.«
»Wenn Sie nicht …« Die Stimme wurde lauter, leiser, dazwischen verschwand sie ganz.
Robin stand auf. Die alte Frau sagte etwas. »Ich habe meinen ganzen Mut zusammengenommen, um mit Ihnen zu reden.« Aber Robin konnte sich nicht auf sie konzentrieren.
Er warf der Frau, die immer noch redete, ein »tut mir leid« zu und schob sich an ihr vorbei. »Matthew, sind Sie noch dran?«
»Bitte«, sagte die alte Frau hinter ihm, »Ihr Buch hat mein Leben verändert. Ich habe dadurch Frieden gefunden, nachdem meine Tochter … Bitte, könnten Sie es signieren?«
»Suchen Sie bitte … Standedge.« Dann war die Leitung tot.
»Matthew«, sagte Robin, obwohl er wusste, dass es zwecklos war. Er sah auf sein Handy. Der Anruf war beendet. Verloren sah er sich um.
»Alles in Ordnung?«, fragte die alte Frau.
Robin schob das Handy in seine Tasche. »Entschuldigen Sie, das war sehr unhöflich. Natürlich signiere ich Ihr Buch.« Sam hätte zugestimmt. Er redete mit der alten Frau fast eine halbe Stunde lang über ihre vermisste Tochter und wie man damit umgehen konnte. Nachdem sie fort war, schrieb er »Standedge« auf sein Exemplar und unterstrich es zweimal.
2
Wie in einem Nebel machte sich Robin auf den Weg zum Sushi-Lokal. Emma wartete bereits. Als er neben ihr Platz nahm und die Tragetasche auf den Tisch legte, runzelte sie die Stirn. »Ich dachte, du liest nicht mehr.«
Robin zog das Exemplar von Ohne sie heraus, in das er seine Notizen gekritzelt hatte. Wren hätte es ihm kostenlos überlassen, aber er hatte dafür gezahlt. Er wollte nicht, dass sie Schwierigkeiten bekam.
»Hast du nicht genug davon?«, lachte sie. Sie hatte recht – der Flur seiner Wohnung war zugestellt mit Belegexemplaren, Hardcover-Ausgaben und den Übersetzungen in andere Sprachen, sodass man nur mit Mühe durchkam.
»Ich hab was reingeschrieben.«
»Sind Bücher nicht dazu da?«, sagte Emma und lächelte. »Wie ist es gelaufen?«
»Gut.« Robin versuchte, nicht an das zu denken, was Matthew gesagt hatte. »Wie üblich, weißt du. Nicht viel los. Aber ich hab einige nette Leute kennengelernt. Hast du schon bestellt?«
Sie sprachen nicht viel beim Essen. Emma erzählte ein bisschen von ihrer Arbeit – sie hatte bereits Feierabend, am Samstag hatte die Praxis nur vormittags auf –, aber sie ging nicht sehr ins Detail über ihre Patienten. Am längsten ließ sie sich über Hypochonder aus, denen absolut nichts fehlte, die aber immer mehr zu werden schienen. Und die immer mehr um sich greifenden Internet-Diagnosen machten Emma das Leben schwer.
Robin schwieg, hörte ihr nur halb zu und stocherte in seinem Essen. Er aß etwas Lachs, das war alles, was er hinunterbrachte. Und dann – redete Emma mit ihm?
»Was ist los?«, sagte sie und starrte ihn mit einer Eindringlichkeit an, wie es nur Allgemeinärztinnen und Zwillingsschwestern schafften.
»Nichts.« Er wusste, dass es nicht funktionieren würde, aber er versuchte es trotzdem.
»Aha.«
Robin sah sich um, dann wieder zu ihr. »Hast du jemals von Standedge gehört?«
Sie dachte nach. »Nein, was ist das – eine Band?«
»Ich weiß es nicht.«
Sie musterte ihn. Sie war nur vier Minuten älter als er – aber wenn er so angestarrt wurde, fühlte es sich an, als ob diese vier Minuten einen gewaltigen Unterschied ausmachten. »Was ist passiert?«
Er sah weg. »Nichts.«
»Gut«, sagte sie, und ihr ganzes Verhalten änderte sich. »Willst du noch einen Kaffee, oder sollen wir die Rechnung verlangen?« Das war Subtext und paradoxe Intervention in einem. Manchmal hatte er das Gefühl, Emma würde sogar einem Hellseher Kopfschmerzen bereiten.
Robin knickte ein. Er schlug das Buch auf, zeigte ihr seine Notizen und erzählte von dem Gespräch mit Matthew. Mit Sam als Schlusspunkt.
Sie hörte aufmerksam zu und behielt ihre Gefühle für sich, bis sie die ganze Geschichte gehört hatte. Als Robin fertig war, schwieg sie. Nach einer kurzen Pause sagte sie: »Und das ist alles, was du hast …?« Sie vollführte eine Handbewegung.
Robin war fassungslos. »Hast du nicht gehört … Er hat Sam erwähnt. Er hat gesagt, er hat mit Sam gesprochen.«
Sie seufzte und betrachtete ihn traurig. »Das war doch bloß so eine billige Nummer, Robin. Dein erster Eindruck hat dich nicht getrogen. Er hat dich auf den Arm genommen. Irgendwie – keine Ahnung, wie – ist er an deine Nummer gekommen und hat sich einen Spaß mit dir erlaubt. Und es klingt so, als hätte er es in vollen Zügen genossen.«
»Du hast ihn nicht gehört, wie er von dieser Sache gesprochen hat. Diesem Standedge. Von seinen Freunden. Er klang … er klang, als hätte er etwas verloren. Als hätte er jemanden verloren.« Robin stolperte über das, was er sagen und zugleich nicht sagen wollte, weil es dann Wirklichkeit würde. »Er klang wie ich.«
»Robin …«
Er fiel ihr ins Wort. »Du erinnerst dich noch, als du mit dem Laptop zu mir in die Wohnung gekommen bist und mir gesagt hast, ich soll alles aufschreiben? Der Tag, an dem ich mit Ohne sie angefangen habe?«
»Du hast in der Küche gesessen und auf eine Flasche Jack Daniel’s gestarrt«, sagte Emma.
»Ja. Ich war verloren. Und du hast mir geholfen. Du hast mir geholfen, einen Weg zu finden. Matthew hat genauso geklungen wie ich an diesem Tag. Er ist ebenfalls verloren.«
»Und was?«, fragte Emma fast schnoddrig. »Sam hat ihn zu dir geführt?«
Robin hob die Hände. »Ich weiß es nicht – vielleicht. Ich … hab keine Ahnung.«
Emmas Handy klingelte. Sie sah aufs Display, bevor sie den Anruf ablehnte. »Ich muss los, aber wir unterhalten uns später noch mal. Lass nicht zu, dass dadurch wieder alte Wunden aufgerissen werden, Robin. Das war bloß irgendein Idiot, der sich auf deine Kosten lustig gemacht hat. Lass dich auf solche Spielchen nicht ein. Konzentrier dich auf andere Dinge. Triffst du dich nicht am Montag mit deinem Verleger?«
Robin verschwendete keinen Gedanken daran. Der Verleger wollte über das »zweite Buch« reden, genau wie Barrows. Das Geld aus Ohne sie war bald aufgebraucht. Sie wollten das nächste Projekt anleiern – sie konnten es kaum erwarten.
Emma stand auf. »Mit dir ist alles in Ordnung?«
»Klar«, sagte Robin. Als sie sich umwandte und gehen wollte, rief er ihr nach: »Noch was.« Sie drehte sich um. »Hab ich dir jemals vom Clatteridges erzählt?«
Emma zuckte mit den Schultern. »Nein, hast du nicht.« Dann war sie weg.
Robin wandte sich seinem Teller zu und betrachtete seine Notizen. Emmas Worte gingen ihm durch den Kopf – ein dummer Witz, ein Streich, ein Haufen Mist.
Aber was, wenn Emma sich täuschte?
3
Kurz nach ein Uhr kam Robin nach Hause. Noch immer schwirrte ihm Matthews Anruf durch den Kopf. Emmas Worte waren dagegen in den Hintergrund getreten, und das Buch mit den darin enthaltenen Rätseln brannte ihm in der Hand.
Er warf die Schlüssel auf den Küchentisch. Der Raum versank zwar nicht im Chaos, konnte aber auch nicht als sauber bezeichnet werden. Auf dem Abtropfgitter stand ein ordentlicher Stapel dreckigen Geschirrs, was Sam nie toleriert hätte. Seitdem sie nicht mehr da war, hatte er die Zügel schleifen lassen. Er putzte und räumte nur auf, wenn er Besuch erwartete, aber außer Emma kam niemand mehr. Seine Freunde waren auch Sams Freunde gewesen, irgendwie fühlte es sich aber falsch an, wenn er sich ohne sie mit ihnen traf. Offensichtlich ging es ihnen genauso, weil er mit den meisten seit einem Jahr nicht mehr gesprochen hatte.
Er schaltete den Wasserkocher ein, drehte sich zum Küchentisch und dem Laptop um, betrachtete ihn ein paar Sekunden und ließ sich davor nieder. Er klappte das Gerät auf. Emmas Stimme in seinem Hinterkopf riet ihm, es nicht zu tun, trotzdem rief er Google auf und gab das eine Wort ein, das ihn seit Stunden beschäftigte: Standedge. Er klickte auf »Suche«.
Standedge war der Name eines Kanaltunnels in Marsden, Huddersfield.
Huddersfield.
Das konnte kein Zufall sein.
Zum letzten Mal hatte er Sam hier in der Küche gesehen. Er hatte auf genau diesem Stuhl gesessen und wie jetzt über dem Laptop gebrütet. Das war am 28. August 2015 gewesen, um 13.15 Uhr. Er hatte den gesamten Vormittag damit verbracht, einen Artikel aufzupeppen. Er hatte die gesamte Nacht damit verbracht, einen Artikel aufzupeppen. Sam war mit ihrem Koffer in die Küche gekommen, aber er hatte noch nicht mal aufgesehen.
Dafür sah er jetzt auf. Die Küche war leer, fast glaubte er, in der Tür ihren Geist zu erkennen. Sie war auf dem Weg zum Bahnhof. Als Gastdozentin war sie viel unterwegs. Robin mochte es nicht, wenn sie fort war, war aber stolz auf sie und ihre Arbeit. Sie war gut darin. Die Universitäten rissen sich um sie.
An jenem Tag … war sie zur Uni in Huddersfield aufgebrochen. Sie hatte ihm einen Kuss gegeben – den er kaum wahrgenommen hatte – und ihm erneut eingeschärft, wie er sich um ihre Kakteen zu kümmern hatte, nachdem es ihm tatsächlich gelungen war, die letzten eingehen zu lassen.
Er sah von der leeren Tür zum Küchenfensterbrett, wo ihre Kakteen aufgereiht standen. Dieselben seit jenem Tag. In voller Pracht. Auf ihre Rückkehr wartend.
Huddersfield.
Was hatte das zu bedeuten? Hatte es überhaupt was zu bedeuten? Er wusste es nicht. Aber es war ein weiteres Puzzleteil. Nie und nimmer konnten die Zahl, der Name und Huddersfield Zufall sein.
Er suchte weiter.
Die erste Website, die er anklickte, war die des Standedge-Besucherzentrums. Der Standedge war der längste Kanaltunnel Englands und anscheinend ein beliebtes Touristenziel, das im Sommer geführte Touren auf Kanalbooten anbot. Hatte Matthew davon gesprochen – wir sind durchgefahren?
Die zweite von ihm aufgerufene Website handelte von der Geschichte des Tunnels, die er nur überflog. Er schien auf eine lange Vergangenheit zurückblicken zu können – erbaut worden war er innerhalb von sechzehn Jahren zwischen 1795 und 1811, hatte an die £ 16000 gekostet, war der tiefste und längste Kanal Großbritanniens und verband einen Ort namens Marsden mit einem namens Diggle. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte er sich mit Interesse darauf gestürzt, aber das alles war nicht das, wonach er suchte.
Er scrollte durch die übrigen Suchergebnisse, fand aber nichts Relevantes.
Also suchte er nach »Matthew Standedge«. Ihm wurden nahezu die gleichen Resultate geliefert.
Er suchte nach »Matthew Standedge Verschwinden« und fand mit dem dritten Ergebnis endlich, worauf er aus war.
Ein Artikel aus einer Lokalzeitung in Huddersfield. Je mehr er las, desto näher rückte er an den Bildschirm.
Das war es. Er schlug Ohne sie auf, riss die bekritzelte Seite heraus und klickte auf den Druckknopf seines Kugelschreibers.
Das Rätsel der Fünf vom Standedge
von Jane Hargreaves
Die Polizei steht vor einem Rätsel. Fünf junge Leute aus der umliegenden Gegend sind im längsten Kanaltunnel Großbritanniens verschwunden. Am 26. Juni 2018, um 14.31 Uhr, fuhren sechs Freunde und ein Bedlington-Terrier auf einem traditionellen Narrowboat von der Marsden-Seite in den Standedge-Kanaltunnel ein. Zwei Stunden und zwölf Minuten später kam das Boot auf der anderen Seite (der Diggle-Seite) mit nur einem Passagier und dem Terrier wieder heraus. Der junge Mann lag bewusstlos an Deck. Die anderen fünf Passagiere, Tim Claypath (21), Rachel Claypath (21), Edmund Sunderland (20), Prudence Pack (21) und Robert Frost (20) verschwanden spurlos im Tunnel. Der Überlebende Matthew McConnell (21) gibt an, nicht zu wissen, was mit seinen Freunden geschehen ist.
Besonders betroffen vom Verschwinden der Claypath-Zwillinge ist der örtliche Polizeichef DCI Roger Claypath, der als Vater seiner vermissten Kinder folgende Stellungnahme abgab: »Meine Frau und ich sind zutiefst bestürzt vom Verschwinden unserer Kinder und unternehmen alles, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir verfolgen eine Reihe von Spuren, im Moment weist aber einiges darauf hin, dass Matthew McConnell, den wir für einen Freund unserer Kinder gehalten haben, über die Mittel und das notwendige Wissen verfügt, um dieses abscheuliche Verbrechen zu begehen. Bekanntermaßen ist McConnell beim Canals and Rivers Trust angestellt und hat Kanaltouren geleitet, weshalb die Studenten unbegleitet den Tunnel passieren durften. Es ist davon auszugehen, dass er verschiedene Wege kennt, die aus dem Standedge-Kanal ins Freie führen. Noch bleibt allerdings der zeitliche Ablauf zu klären, wenn wir den genauen Hergang der Ereignisse bestimmen wollen. Wir bitten die Presse um Rücksichtnahme auf die Familien, die wie unsere von diesem entsetzlichen Verlust betroffen sind.«
McConnell wird im Moment im Anderson Hospital wegen einer Kopfverletzung behandelt (von der die Polizei vermutet, dass er sie sich selbst zugefügt hat). Sobald er dazu in der Lage ist, wird er in eine Haftzelle verlegt, währenddessen die Anklageschrift gegen ihn ausgearbeitet wird.
Die Leichen der fünf vermissten jungen Leute sind bislang nicht geborgen worden. Laut einer Aussage »befinden sich die Leichen nicht im Tunnel. Der Kanal ist vergeblich von Polizeitauchern abgesucht worden, bei allen Beteiligen schwindet allerdings zunehmend die Hoffnung. DCI Claypath lässt seine Einsatzkräfte rund um die Uhr arbeiten, damit so schnell wie möglich herausgefunden wird, was im Einzelnen geschehen ist – mag es noch so tragisch sein.«
Die Huddersfield Press bat den Canals and Rivers Trust um eine Stellungnahme. Dort wollte man den Vorfall nicht kommentieren, man sprach den betroffenen Familien aber das Beileid aus.
Robin sah zu seinen Notizen, die er sich während des Lesens gemacht hatte. Er hatte die Namen aufgeführt: Tim Claypath, Rachel Claypath, Edmund Sunderland, Robert Frost und Prudence Pack. Um McConnell hatte er einen Kreis gezeichnet. Matthew McConnell. Alles, was er las, passte zu dem, was der Anrufer gesagt hatte. Fünf junge Leute, Studenten, verschwanden im Tunnel, nur Matthew kam zurück.
Was hatte sich am 26. Juni diesen Jahres ereignet? Vor nicht einmal zwei Monaten? Warum zum Teufel hatte er nichts davon gehört? Ein solcher Vorfall musste doch für landesweite Schlagzeilen gesorgt haben, auch die überregionalen Zeitungen hätten darüber berichten müssen. Aber er hatte nichts davon mitbekommen – er hatte noch nicht einmal gewusst, was der Standedge war.
Er verließ die Website der Zeitung und stellte fest, dass alle anderen Suchergebnisse irrelevant waren. Nur ein Resultat zum Verschwinden von fünf jungen Menschen? Das kam ihm unwahrscheinlich vor.
Er suchte nach »Matthew McConnell Claypath Standedge Tunnel 26. Juni 2018«. Nur eine Seite mit Ergebnissen. Neben dem Zeitungsartikel, den er nun schon kannte, gab es einige wenige andere, die alle von einer einzigen Seite stammten. Er klickte auf den ersten Link, es öffnete sich eine Site, die aussah wie aus der Frühzeit des Internets. Oben in großen roten Buchstaben der Name: THEREDDOOR. Sofort hatte Robin ein mulmiges Gefühl (vermutlich warteten hier eine Million Viren auf ihn), aber der erste Artikel, den er anlas, schien mit nützlichen Informationen aufwarten zu können.
Das Verbrechen des Jahrhunderts –
McConnell plädiert auf unschuldig
von The Red Door17.07.18, 16.44 Uhr.
Matthew McConnell, der einzige Überlebende des Vorfalls im Standedge, hat bei seiner Verlegung vom Anderson Hospital ins Gefängnis New Hall erneut seine Unschuld beteuert. The Red Door (das einzige Medium, das bei seiner Ankunft in New Hall zugegen war [Hrsg.: Was ist da los?]) hat gehört, wie McConnell schrie, dass er unschuldig sei und sich an nichts erinnern könne, nachdem er am 26. Juni 2018 in den Tunnel einfuhr.
Leute, ihr wisst, ich hab nichts gegen einen guten mysteriösen Kriminalfall, aber für McConnell sieht es in der Tat nicht gut aus. Vieles spricht nämlich gegen ihn. Der Standedge-Tunnel, müsst ihr wissen, besteht im Grunde aus vier Röhren. Die miteinander verbundenen linken beiden (von Marsden aus gesehen) sind stillgelegt, durch den rechten führt eine zweigleisige Eisenbahnlinie, und der »mittlere« ist der Kanal. McConnell hat dort als Tourguide gearbeitet, das heißt, er kennt sich in den Röhren aus und findet sich mühelos darin zurecht. Dazu war er im Besitz der Schlüssel, um die großen Tore zu öffnen, mit denen die Tunneleingänge normalerweise versperrt sind. Außerdem haben zwei von McConnells Bekannten ausgesagt (ihr wisst schon, zwei von denen, die sich noch nicht in Luft aufgelöst haben), dass er von seinen Begleitern auf diesem letzten gemeinsamen Ausflug ziemlich genervt gewesen sei.
Trotzdem, das alles ist doch ziemlich krass. Einfach verrückt, wie McConnell sein Verbrechen abgezogen hat. Er hat alle umgebracht, hat die fünf Leichen an einen geheimen Ort gebracht, ist zurück zum Boot und hat hinter sich aufgeräumt, gerade noch rechtzeitig, um sich eins auf die Rübe zu meißeln und bewusstlos an Deck zusammenzubrechen, bevor das Boot am anderen Ende wieder aufgetaucht ist. Schon ziemlich abgefahren!
Es sei denn … McConnell ist möglicherweise unschuldig. Vielleicht sind Tim Claypath, Rachel Claypath, Pru Pack, Edmund Sunderland und Robert Frost einfach verschwunden. Und wer immer sie hat verflüchtigen lassen, hat auch McConnell ausgeknockt. Stoff zum Nachdenken.
Vielleicht sollte ich noch etwas recherchieren! Ach, wie liebe ich diesen Job.
Was meint ihr? Gebt unten eure Kommentare ab und abonniert den Red-Door-Feed, damit ihr immer up to date seid und in den Genuss von massenhaft verrückten Nachrichten kommt, so vielen, wie ihr gerade so verkraften könnt. Peace!
Der Artikel klang weniger seriös als der aus der Zeitung, die Informationen aber stimmten überein. Und es wurde berichtet, dass Matthew nach New Hall verlegt wurde – woher Matthew ihn angerufen hatte. Es konnte unmöglich alles erfunden sein.
Was Robin in diesen Artikeln nicht fand (und zweifellos auch nicht finden konnte), war Matthews Verbindung zu Sam. Wenn Matthew die Wahrheit sagte, hatte Sam ihn aus heiterem Himmel angerufen. Er kannte sie nicht. Seiner Aussage nach war sie »völlig verwirrt« gewesen. Warum hatte Sam nicht ihn angerufen? Wenn sie in Schwierigkeiten steckte, warum hatte sie dann nicht ihn angerufen?
Den restlichen Tag und Abend verbrachte Robin im Internet. Als Emma anrief, ging er nicht ran. Er druckte die wenigen Artikel aus, die er fand, und heftete sie in einen Ordner. Der Standedge-Vorfall schien eine Art Anomalie zu sein – ein ungewöhnliches Verbrechen, das unter dem Radar der landesweiten Nachrichten durchgerutscht war. Die meisten Informationen, die er fand, stammten von The Red Door, einer Site, die ihm immer seltsamer vorkam, je länger er sich darauf herumtrieb. Warum berichteten die seriösen Medien nicht darüber? Wenn er vertrauenerweckendere Artikel fand – von Zeitungen oder Websites –, waren die Angaben immer sehr kurz und sehr vage.
In einem der Red-Door-Artikel stieß er auf ein Gruppenfoto der vermissten Studenten. Sie standen vor dem Standedge-Kanaltunnel – Robin erkannte ihn von der Website des Besucherzentrums. Im Vordergrund Tim Claypath, das dominierende Kraftfeld auf dem Bild, um das alle anderen gruppiert waren. Er war jung, attraktiv, voller Leben. Seine Augen schienen sogar auf dem Bildschirm zu schimmern. Neben ihm seine Schwester Rachel. Robin brauchte keine Bildunterschrift, um das zu erkennen. Sie hatte die gleichen Augen wie ihr Bruder, das gleiche Feuer, das gleiche gute Aussehen. Neben den Claypath-Zwillingen sah er die drei anderen Studenten. Edmund Sunderland, groß und blond, stand neben Tim. Er starrte so durchdringend in die Kamera, dass sein Lächeln etwas Aufgesetztes hatte. Auf Rachels Seite befanden sich zwei weitere Personen, leicht einander zugewandt, als hätten sie sich noch unterhalten, kurz bevor das Foto gemacht wurde. Pru Pack und Robert Frost, deren strahlendes Lächeln von der unbändigen Freude kündete, einfach nur da sein zu dürfen. Wenn Robin raten müsste, würde er sagen, Pru und Robert hatten miteinander eine Beziehung und machten keinen Hehl daraus. Vor ihnen allen sprang noch ein grauer Bedlington-Terrier ins Bild und wurde etwas unscharf für die Ewigkeit abgelichtet. Laut Bildunterschrift war der Name des Hundes »Amygdala (Amy)«. Das Bild war am 26. Juni 2018 aufgenommen worden. Am Tag ihrer Fahrt in den Tunnel, am Tag, an dem diese Personen (ohne den Hund) verschwanden.
Robin betrachtete die Gesichter der fünf. Sein Blick wanderte über das Bild, bis er bemerkte, dass noch jemand abgebildet war. Hätte die Bildunterschrift nicht auf ihn hingewiesen, wäre er Robin nicht aufgefallen. Hinter Edmund Sunderland, einige Schritte entfernt, gleich neben dem Kanal, stand ein weiterer junger Mann, der nicht in die Kamera sah. Anders als die Übrigen in ihren schicken Hemden und Hosen und Kleidern trug er nur T-Shirt und Jeans und hatte die Hände in den Taschen vergraben. Er lächelte nicht – sein Gesichtsausdruck war, so weit zu erkennen, vollkommen leer, als würde ihm absolut nichts durch den Kopf gehen. Offensichtlich war ihm nicht bewusst, dass das Foto gemacht wurde. Laut Bildunterschrift handelte es sich dabei um »Matthew McConnell«.
Robin starrte ihn an, rückte näher heran, drehte das Bild, als würde ihm das helfen, an Edmund Sunderland vorbeizusehen. Irgendwas nagte an ihm, irgendwas, was ihm gerade nicht einfallen wollte. Er sah zu den über den gesamten Tisch verstreuten Artikeln, die er ausgedruckt hatte. Nach einigen Minuten hatte er es. In einem Red-Door-Artikel war erwähnt worden, dass Matthew von den anderen genervt gewesen sei. Dieses Bild schien genau das zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht hatten aber auch die anderen etwas gegen ihn gehabt. Matthew hatte ihm gegenüber am Telefon nichts davon erwähnt. Andererseits, wenn er im Gefängnis saß und wegen Mordes angeklagt war, wäre das etwas, worüber er vermutlich nicht als Erstes reden würde.
Robin kratzte sich am Kinn und spürte die Bartstoppeln, die seit dem Morgen gesprossen waren. Die Dämmerung setzte ein, er stand auf und machte das Licht an. Sein Blick fiel auf den Tisch. Ein einziges Chaos. Ohne dass er sonderlich viel herausgefunden hätte.
Er wusste nur, dass sich der Vorfall wirklich ereignet hatte. Matthew sagte die Wahrheit. Seine Freunde waren verschwunden. Und er war übrig geblieben. Er hatte nichts vom Hund erzählt, aber das schien kaum von Bedeutung zu sein. Seine Freunde waren fort – verschwunden. Sie fuhren in einen Tunnel hinein und kamen nicht mehr heraus.
Auf alle Fälle ein Rätsel – ein quälendes noch dazu. In einem der Artikel wurde erwähnt, wie lange die Fahrt gedauert hatte – zwei Stunden und zwölf Minuten. Zwei Stunden und zwölf Minuten an undokumentierten, ungesehenen und unbegreiflichen Ereignissen. Die einzige Verbindung in diese Welt, zu diesem Bruchstück an verlorener Zeit, war Matthew McConnell – es sei denn, der Hund würde in nächster Zeit zu reden beginnen.
Natürlich verdächtigte die Polizei Matthew. Natürlich war er verhaftet worden. Weil nach allem, was Robin an Fakten vorlagen, keine andere Möglichkeit bestand, außer dass Matthew seine Freunde umgebracht hatte. Nun stand die Polizei vor der Aufgabe, die Leichen zu finden. Daher würde sie Matthew unter Druck setzen, bis er alles erzählte, was er wusste.
Hielt er Matthew für schuldig? Oder für unschuldig? Ihm lagen viel zu wenige Fakten vor, um sich ein Urteil bilden zu können. Aber er war fasziniert. Sogar ungeachtet der Tatsache, dass er Fragen an Matthew hatte. Fragen über Sam.
»Führst du mich irgendwohin, Sam?«, flüsterte Robin.
Es kam keine Antwort. Abgesehen vom Verkehrslärm der Straße und dem Gejohle eines Passanten, der sich zweifellos an den Vorzügen des samstäglichen Alkoholgenusses erfreute (und noch nicht unter den Nachwirkungen litt).
Robin machte wieder das Licht aus und beschloss, ins Bett zu gehen.
Nachdem er kurz geduscht hatte, legte er sich auf die rechte Seite des Doppelbetts. Drei Jahre waren vergangen, aber immer noch hielt er sich an seine Seite, selbst wenn er sofort einschlief und zu keinem bewussten Gedanken mehr imstande war.
Er dachte an Matthew McConnell, daran, was er ihm erzählt, vor allem aber, wie er es erzählt hatte. Angenommen, Matthew hatte die Wahrheit gesagt, dann hatte Sam ihm erzählt, dass er, Robin, jemand sei, dem man trauen könne.
Warum hatte sie das einem völlig Fremden gesagt? Warum hatte sie Matthew angerufen?
Er lag eine halbe Stunde im Bett – an Schlaf war nicht zu denken. Eine Frage trieb ihn um: Wie konnten sechs Personen in einen Kanaltunnel fahren und nur einer wieder herauskommen?
Kurz dachte er an die Stimme des jungen Mannes, der ihn am Morgen angerufen und um Hilfe gebeten hatte, und ihm wurde klar, dass er jetzt – seit Stunden schon – wusste, was er ihm sagen würde.
Ja.
4
Ich weiß nicht, Robin. Das alles klingt sehr merkwürdig«, sagte sie am Telefon. »Der Typ manipuliert dich doch. Vielleicht willst du es nicht sehen. Aber er benutzt Sam, damit du dich zu Dummheiten hinreißen lässt.«
»Du hast nie vom Standedge-Tunnel gehört. Das hast du selbst zugegeben. Ich habe stundenlang zu dem Fall recherchiert. Es gibt ihn wirklich. Matthew gibt es wirklich. Das alles ist wirklich passiert.« Robin nahm das Telefon in die andere Hand, damit er seinen Rucksack am Riemen höher auf die Schulter ziehen konnte.
»Warum hab ich dann nie davon gehört?«
»Keine Ahnung. Vielleicht hat jemand dafür gesorgt, dass der Vorfall gegenüber den überregionalen Medien verschwiegen wurde.«
»Wir leben nicht mehr in den Neunzigern, Robin«, sagte sie mit einem eisigen Ton, der Robin sehr an ihre Mutter erinnerte. Ihre Mutter und Emma waren nie miteinander klargekommen – wahrscheinlich weil sie sich so ähnlich waren. Beide waren äußerst pragmatisch – die Welt war ihnen bloß ein Problem, das es zu lösen galt. Er liebte seine Schwester, manchmal sah sie in ihm aber eher ein Projekt und nicht den Bruder. »Die Dinge verbreiten sich im Internet – stündlich, minütlich. Ich verstehe nicht, warum wir noch nie davon gehört haben sollten.«
»Ich glaube, diese Red-Door-Website wird von so einer Art Whistleblower geführt. Soll ich dir den Link schicken?«
»Nein«, antwortete sie prompt. »Ich will nichts damit zu tun haben. Hör zu, soll ich zu dir kommen? Ich kann bald da sein. Dann reden wir darüber.«
»Du kannst nicht kommen«, beschied Robin brüsk.
Es folgte ein langes Schweigen. »Warum nicht?«, fragte Emma mit der Stimme ihrer Mutter.
Robin wollte gerade zu einer Erklärung ansetzen, in diesem Augenblick aber verkündete eine Lautsprecherdurchsage, dass ein Zug zur Abfahrt bereitstehe. In King’s Cross war so viel los, wie er es noch nie erlebt hatte. Fast-Food-Läden, Restaurants, Bars, alle voll mit Pendlern. Robin stand inmitten der Menge, die zur Abfahrtstafel hinaufblickte. Nach der Durchsage eilten an die zwanzig Personen zu den Bahnsteigen. Robin musste nichts sagen – Emma hatte alles schon mitgehört.
»Du fährst weg? Jetzt?«
»Ja«, sagte Robin.
»Was ist mit dem Treffen mit deinem Verleger?«
»Hab ich abgesagt.«
»Robin, was treibst du? Wirklich?«
»Ich tue das, was ich meinem Gefühl nach tun soll. Kannst du mich nicht einfach unterstützen?«
Emma seufzte. Und schwieg etwa eine Minute. Er wusste, was sie sich dachte – dass er verrückt war, dass das alles vergebliche Mühen waren. »Klar«, sagte sie, »aber sei bitte vorsichtig, Robin. Wenn das, was du herausgefunden hast, wirklich stimmt, dann ist dieser Typ vielleicht gefährlich.«
»Ich kann auf mich aufpassen«, entgegnete Robin und lächelte. »Bis bald.«
Er beendete das Gespräch und überlegte, ob Emma nicht doch recht hatte – ob er nicht einen schrecklichen Fehler beging.
Aber seine Überlegungen reichten nicht aus, um ihn davon abzuhalten, durch die Ticketschranke zu gehen, seinen Zug zu suchen und einzusteigen.
5
Samantha hätte ihn anrufen sollen, als sie in Huddersfield eingetroffen war. Das hatte sie auch getan. Aber Robin war nicht rangegangen. Er war immer noch so mit seinem blöden Artikel beschäftigt gewesen – über die Baugenehmigung eines neuen Hochhauses unmittelbar neben einem Wohngebiet, was sich irgendwie zur politischen Kontroverse des Jahrhunderts ausgewachsen hatte. So zumindest hatte es damals den Anschein gehabt. Das Gebäude wurde nie gebaut, man hatte nie wieder darüber gesprochen.
Er hätte rangehen sollen.
Wenn eine dreiunddreißigjährige gesunde Frau im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte vermisst wird, bedarf es einiger Anstrengung, damit einem überhaupt jemand zuhört. In dem Augenblick, als er zurückrief und sie sich nicht meldete – als es noch nicht einmal klingelte, sondern sich sofort die Mailbox einschaltete –, wusste er, dass sie in Schwierigkeiten steckte. Es brachte ihn fast um, zweiundsiebzig Stunden zu warten, bis er eine Vermisstenmeldung aufgeben konnte.
Auf der Polizeidienststelle wurde er zwischen vier Beamten herumgereicht, jeder gab sich gelangweilter als der vorherige. Er wiederholte seine Geschichte jedes Mal aufs Neue, und bei jedem Mal kam sie ihm realer vor. Er beantwortete ihre dämlichen Fragen – wann war ihm von der Universität mitgeteilt worden, dass Samantha nicht eingetroffen sei? Wann war ihm zum ersten Mal bewusst geworden, dass etwas nicht stimmte? Hatte sich Samantha bei ihrer Abreise anders als sonst verhalten? –, obwohl ihm diese Fragen alle schon vorher gestellt worden waren. Sie machten sich Notizen in zahllosen schwarzen Notizbüchern. Und spielten auf einen heimlichen Liebhaber an oder auf die noch üblere Möglichkeit, sie hätte sich einfach aus dem Staub gemacht.
An die unverschämt gelangweilten Erwiderungen der Polizisten musste Robin nun auch denken, als er zum ersten Mal mit Terrance Loamfield sprach, Matthews Pflichtverteidiger.
»Sie wurden auf die genehmigte Besucherliste von Mr McConnell gesetzt, Sie müssen sich am Tor ausweisen und bei Ihrer Ankunft in New Hall einige Formulare ausfüllen, das sollte es dann gewesen sein.«
Robin hatte das Handy am Ohr, während er sich in einem überfüllten Waggon nach Leeds befand, wo sein Anschlusszug wartete. Er stand im Gang – er hatte eine Sitzplatzreservierung, nur hatte der Zug keinen Waggon, in dem sein Sitzplatz gewesen wäre.
»Danke, Mr Loamfield.« Er hätte dem Anwalt gern weitere Fragen gestellt, fühlte sich dazu aber nicht in der richtigen Umgebung.
»Mr McConnell hat nicht nach meiner Anwesenheit bei Ihren Treffen verlangt. Darf ich fragen, in welcher Beziehung Sie zu Mr McConnell stehen?«