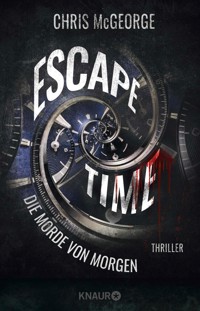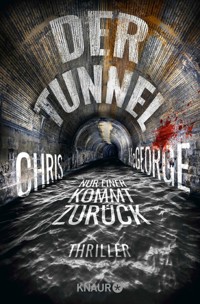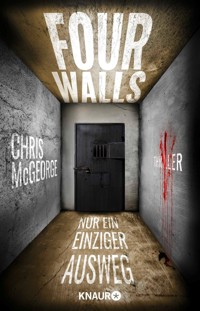
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine verschlossene Zelle. Ein kaltblütiger Mord. Und nur eine Verdächtige: Du »Four Walls – Nur ein einziger Ausweg« ist ein wendungsreicher Locked-Room-Thriller um eine junge Frau in einem immer unheimlicher werdenden High-Tech-Gefängnis. Lebenslänglich für einen brutalen Doppel-Mord, den sie nicht begangen hat: Cara Lockhart scheint in einem Alptraum festzustecken. Sie wird ins Hochsicherheits-Gefängnis »High Fern« gebracht, das als modernstes Frauen-Gefängnis Englands gilt. Hier gibt es keine Fenster, keinen Besuch, dafür High-Tech-Überwachung - und ungewöhnliche Freiheiten innerhalb der Mauern. Doch schon wenige Tage nach ihrer Ankunft reißen die Wärter Cara mitten in der Nacht brutal aus dem Schlaf: Die Frau auf der Pritsche neben ihr wurde mit einem Kopfschuss getötet. Die Zelle war die ganze Nacht verschlossen, auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen und von der Tatwaffe fehlt jede Spur - natürlich fällt der Verdacht auf Cara. Dabei ist sie sich sicher, auch in diesem Mord-Fall unschuldig zu sein. Aber wie soll sie das beweisen? Wer ist wirklich für die scheinbar unmögliche Tat verantwortlich? Und vor allem: Wer will ihr das Leben zur Hölle machen? Der englische Thriller-Autor Chris McGeorge liefert zum dritten Mal atemlose Spannung zum Miträtseln mit einem tollen Locked-Room-Setting. Entdecken Sie auch die anderen packenden Thriller von Chris McGeorge: - Escape Room – Nur drei Stunden - Der Tunnel – Nur einer kommt zurück
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Chris McGeorge
Four Walls – Nur ein einziger Ausweg
Thriller
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine verschlossene Zelle. Ein kaltblütiger Mord. Und nur eine Verdächtige. Oder?
»Four Walls – Nur ein einziger Ausweg« ist ein wendungsreicher Locked-Room-Thriller um eine junge Frau in einem immer unheimlicher werdenden High-Tech-Gefängnis.
Lebenslänglich für einen brutalen Doppel-Mord, den sie nicht begangen hat: Cara Lockhart scheint in einem Alptraum festzustecken. Sie wird ins Hochsicherheits-Gefängnis »High Fern« gebracht, das als modernstes Frauen-Gefängnis Englands gilt. Hier gibt es keine Fenster, keinen Besuch, dafür High-Tech-Überwachung - und ungewöhnliche Freiheiten innerhalb der Mauern.
Doch schon wenige Tage nach ihrer Ankunft reißen die Wärter Cara mitten in der Nacht brutal aus dem Schlaf: Die Frau auf der Pritsche neben ihr wurde mit einem Kopfschuss getötet. Die Zelle war die ganze Nacht verschlossen, auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen und von der Tatwaffe fehlt jede Spur - natürlich fällt der Verdacht auf Cara. Dabei ist sie sich sicher, auch in diesem Mord-Fall unschuldig zu sein. Aber wie soll sie das beweisen? Wer ist wirklich für die scheinbar unmögliche Tat verantwortlich? Und vor allem: Wer will ihr das Leben zur Hölle machen?
Der englische Thriller-Autor Chris McGeorge liefert zum dritten Mal atemlose Spannung zum Miträtseln mit einem tollen Locked-Room-Setting.
Entdecken Sie auch die anderen packenden Thriller von Chris McGeorge: Escape Room – Nur drei Stunden Der Tunnel – Nur einer kommt zurück
Inhaltsübersicht
Erster Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweiter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Dritter Teil
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Epilog
Danksagung
»Manchmal muss man einfach akzeptieren, wo man ist, und sich damit anfreunden, dass es kein Zurück mehr gibt zu dem, wo man einmal war, so schwer einem das auch fallen mag …«
ROBIN FERRINGHAM, Ohne sie
Es klingelte. Laut. Zu früh für den Wecker. Musste sein Handy sein.
Er schlug die Augen auf und fasste in der Dunkelheit hinüber. Ein 12–44. Unmöglich. Trotzdem, er musste reagieren.
Er stand auf, warf sich in seine Sachen, machte kurz das Fenster an. Eine Lawine. Hübsch. Er schaltete es wieder aus.
Er verließ das Schlafzimmer, legte seine Manschette um, während er durch den Gang zum Überwachungsraum ging.
Continell saß am Tisch, den Blick auf die Bildschirme gerichtet, neben ihr eine vergessene, halb leere Tasse Kaffee.
»Harper«, sagte Continell, als er sich über den Tisch beugte. Sie klang besorgt. »Eine der Manschetten ist tot. Kein Lebenszeichen mehr.«
»Von wem?«, fragte Harper.
»FE773 Barnard.«
»In Lockharts Zelle? Was ist auf A/V?«
Continell musste keine Knöpfe drücken. Alles war schon auf dem Bildschirm aufgerufen. Der Blick von oben auf eine Zelle, zwei Betten mit zwei schlafenden Frauen. Dann war nur noch Gekrissel zu erkennen.
»A/V ist für 12,3 Sekunden ausgefallen«, sagte Continell, »und dann …«
Ein Geräusch. Laut. Wie ein Knall, der das Gekrissel durchschnitt. Und sofort verstummte. Dann schaltete sich die Kamera wieder ein. Eine der Frauen schlief wie zuvor. Die andere lag quer über dem Bett, ihr Kopf baumelte über dem Boden. Flüssigkeit tropfte von ihrer Stirn. Harper war froh, dass die Kamera nur Schwarz-Weiß-Bilder zeigte.
»Was …?«, brachte er mühsam heraus. »Was ist passiert?«
»Dieses Geräusch«, sagte Continell. »Ich hab es gehört. Nicht bloß über den Bildschirm. Sondern richtig. Durch zwei Stockwerke. Ich glaube, es war ein Schuss.«
»Du hast die Aufzeichnungen der Tür überprüft?«
»Keiner ist rein oder raus. Keine Insassin. Kein Wärter. Schloss wurde nicht betätigt. Auf die Aufzeichnungen ist hundertprozentig Verlass, man kann sie nicht manipulieren.«
»Hundertprozentig?«
»Hundertprozentig.«
Ohne zu fragen, griff sich Harper Continells Kaffeetasse und trank den Rest. »Weck die anderen auf. Sie sollen sich fertig machen. 12–44.« Er wollte aus dem Raum.
»Wen soll ich alles wecken?«
Harper blieb an der Tür stehen. »Alle.«
Zehn Minuten später waren sie alle vor den Fahrstühlen. Alle in Schutzausrüstung, alle bewaffnet.
Sie stiegen ein. Fuhren zwei Stockwerke nach unten.
Harper ließ sie vor dem Eingang zur Abteilung anhalten. »Es ist das erste Mal, dass wir mit so was zu tun haben. Krotes hat den Schusswaffengebrauch abgesegnet, aber keiner ballert rum, solange es nicht absolut notwendig ist. Für alle gilt Zurückhaltung.«
»Müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Chef.« Anderson grinste und lud seine Schrotflinte durch. Warum zum Teufel hatte man dem eine Schrotflinte gegeben?
Die anderen wenigstens schienen vernünftiger zu sein. »Gut«, sagte Harper, »ich und Abrams übernehmen die Spitze. Truchforth und Anderson sichern nach hinten.«
Sie betraten die Abteilung durch die Doppeltüren und gingen hinunter in den Kessel. Die Gefangenen wachten auf, riefen durch die Zellentüren, stellten Fragen. Die Wärter achteten nicht darauf, sondern eilten zu der einen Zelle, derentwegen sie hier waren.
Harper atmete tief ein, nickte Abrams und den anderen zu. Dann hielt er seine Manschette hoch. Das Licht darauf wurde grün. Genau wie das Licht über der Zellentür.
Sie stürmten in die Dunkelheit. Der Schein von Abrams’ Taschenlampe traf Lockharts Gesicht. Die junge Frau schlief oder tat verdammt gut so, als würde sie noch schlafen. Dann fiel das Taschenlampenlicht auf die Blutlache am Boden, dann auf Barnards Gesicht. Ein Loch mitten in der Stirn. Ihre Augen standen offen. Für immer.
»Mein Gott«, sagte Harper.
Die Lichter gingen an, und sie sahen es alle.
Harper war wie erstarrt. Anderson und Abrams stürzten bereits zu Lockhart, weckten sie, legten ihr die Handschellen an. Sie murmelte, dass sie nicht wisse, was überhaupt los sei. Erst jetzt sah sie Barnard und murmelte, dass sie es nicht gewesen sei.
Irgendwas stimmte nicht.
Truchforth inspizierte die Zelle. Die Suche war schnell beendet. »Keine Waffe hier.«
Er hatte sich nur kurz umgesehen. Er konnte sich täuschen.
Lockhart wurde von dreien gepackt, aus der Zelle geschleift und ins Loch gebracht. Harper konnte sich nicht rühren. Reglos stand er da, sah sich um, dachte nach. Über …
»Harper.« Continell in seinem Ohr. »Ich hab mir die Aufzeichnung angesehen.«
Er sah zur Kamera hinauf.
»Für 12,3 Sekunden ist die Kamera ausgefallen«, sagte Continell. »Ich hab das Bild davor und danach, vor und nach der Unterbrechung, nebeneinandergestellt.«
»Und?«
Continell zögerte kurz, bevor sie antwortete. »Lockhart hat sich nicht bewegt. Nicht einen Millimeter. Die Bilder sind identisch.«
»Was sagst du da?«, fragte Harper.
Sie konnte sich die Antwort sparen. Harper dachte sich das Gleiche.
War es möglich, dass es Lockhart nicht gewesen war?
Erster Teil
Willkommen in North Fern
1
39 Tage zuvor …
Cara wurde mitten in der Nacht abgeholt – sie kamen in ihre Zelle und sagten ihr, sie solle ihre Sachen packen. Keine Zeit, um den anderen Lebewohl zu sagen. Keine große Verabschiedung. Nur zwei kalte Handschellen, dann wie im Delirium durch einen größtenteils schlafenden Zellenblock, angetrieben vom Finger des Wärters im Rücken, bis sie in der kalten Nachtluft im Hof stand. Ein Kastenwagen wartete. Daneben zwei weitere Strafgefangene mit jeweils eigenem Wärter. Die Wärter trugen SWAT-Westen.
Sie wurden alle drei in den Wagen gepackt, jede in eine eigene Box – die im Grunde nichts anderes war als eine Zelle im Wagen mit Gittertür. Von den Wärtern war nichts mehr zu sehen, sie nahmen irgendwo Platz, wo sie nicht im Blickfeld waren.
Keiner sagte ihr, wohin es ging. Sie fragte nicht.
So hatte die Reise begonnen. Es kam ihr so vor, als wäre das alles bereits einen Tag her.
Der Wagen fuhr mit gleichmäßigem Tempo. Waren sie auf einem Motorway? Wenn ja, wie lange schon? Warum darüber nachdenken, wenn es sowieso egal war?
Aus der Box nebenan war ein leises Schluchzen zu hören. Die Frau dort weinte. Seit Stunden schon – und so anhaltend, dass Cara es inzwischen fast vollständig ausgeblendet hatte. Es sei denn, das Schluchzen wurde lauter.
Wie jetzt, dazu waren noch einzelne Sätze zu verstehen: »Wohin fahren wir? Das dürfen Sie nicht. Man hätte mir erlauben müssen, meinen Sohn zu sehen, mit meiner Familie zu reden … Wohin fahren wir?«
Einige Sekunden Schweigen. Die zu einer Minute wurden. Zu zehn Minuten – die Frage hing in der Luft. Irgendwann setzte wieder das Schluchzen ein.
So blieb es dann. Für eine Stunde oder zwei.
Plötzlich bog der Wagen in eine scharfe Kurve, Cara wurde gegen die Wand geworfen, bald darauf wurde die Straße holpriger. Eine Stunde lang rumpelte der Wagen ohne Unterlass so weiter, bis sie sich wieder auf einer anscheinend befestigten Straße befanden. Kein Asphalt, dennoch eine glatte Fahrbahn. Sie waren definitiv nicht mehr auf dem Motorway.
Endlich hielten sie an. Mit einem entschiedenen Ruck blieb der Kastenwagen stehen.
»He, Fahrer?«, rief einer der Wärter und pochte gegen das Gitter – so hörte es sich an –, das sich zwischen der Fahrerkabine und dem Aufbau befand. »Wie sieht’s aus?« Keine Antwort.
Stattdessen verstummten der Motor und das Funkgerät. Dann nichts mehr.
Nervös sah sich Cara zwischen ihren vier weißen PVC-Wänden um und hoffte, irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, was hier los war. Natürlich fand sie nichts.
Von draußen waren Stimmen zu hören. Ein Tor, das geöffnet wurde. Der Motor sprang wieder an. Im niedrigen Gang fuhr der Wagen vielleicht fünfhundert Meter weiter. Dann nichts.
Cara spürte eine Ungeduld, wie man sie hatte, wenn ein Flugzeug gelandet war und das Anschnallzeichen einfach nicht erlöschen wollte. Als würde es immer den Bruchteil einer Sekunde zu lange leuchten, bis es endlich ausging.
Dann schwangen die Hecktüren auf. Mattes Sonnenlicht flutete in den Wagen, blinzelnd sah sie den Schatten des Fahrers.
»Wir sind da«, sagte er nüchtern. Nicht zu ihr.
Die beiden Wärter machten sich zu schaffen. Caras Box wurde als letzte aufgesperrt, anschließend wurden alle drei gleichzeitig aus dem Wagen geführt. Cara sprang nach unten. Sie befanden sich in einer umschlossenen Ladebucht. Hinter ihnen ging das große Rolltor nieder, hinter dem langsam, Zentimeter für Zentimeter, die Sonne verschwand. Als das Tor ganz unten war, hatte sie das dumpfe Gefühl, dass sie die Sonne nie wiedersehen würde.
Ihre Gefährtinnen schienen das Gleiche zu denken. Ihre Nachbarin im Wagen, die Schluchzende, weinte immer noch, Tränenspuren zogen sich über ihre Wangen. Erst jetzt wurde ihr klar, dass sie sie kannte. Aus New Hall – ihrem Trakt. Die andere Frau versuchte ihr Unbehagen zu verbergen, was ihr aber nicht ganz gelang. Sie wirkte tough – schwarze Haare, schwarze Mascara (die in New Hall einiges gekostet haben musste), ein Haarschnitt, der bei Caras Einlieferung nicht unbedingt als stylish gegolten hatte, es jetzt aber sein könnte – links ausrasiert, die übrigen langen Haare zur anderen Seite drapiert. Ihre Besorgnis konnte die Frau aber nicht verbergen. »Was geht hier ab?«, fragte sie.
Sonst wäre Cara diejenige gewesen, die den Mut hatte, den Mund aufzumachen. Jetzt erschien ihr das sinnlos. So war es auch. Es kam keine Antwort auf die Frage.
Wortlos drehte sich der Fahrer um und ging zu einer hohen roten Tür, die aussah wie der Eingang zu einem Bunker. Die Wärter schienen den Wink zu verstehen und gaben ihr und den beiden anderen Gefangenen ein Zeichen, dass sie ihnen folgen sollten.
Der Fahrer pochte gegen die Tür – ein lauter, durchdringender, in ihren Ohren dröhnender Schlag.
Nichts.
Cara sah sich um, ihr Blick fiel auf den Nächststehenden der seltsamen Gruppe. Der jüngere Wärter sah zu ihr, ihre Blicke trafen sich, bevor er sich schnell abwandte. Er schien vor etwas Angst zu haben – er zitterte sogar ein wenig. Warum hatte er Angst?
Zum ersten Mal spürte sie Unsicherheit.
Der Fahrer schien auf etwas zu warten, als würde er im Stillen einen Countdown runterzählen, bevor er noch mal an die Tür klopfte.
Endlich ging die Tür auf. Ein stämmiger Mann stand vor ihnen – schwarz, mit angegrautem Goatee. Sein Wärterpullover, auf dem der Name Harper eingestickt war, passte irgendwie nicht zu seiner muskulösen Statur. Er hatte ein Tablet bei sich, das in seinen Händen klein aussah. Er betrachtete der Reihe nach jeden Einzelnen von ihnen – sie mussten ein komisches Bild abgeben. »Wir haben FO112, NH597 und FE773?«
Cara spürte, wie der ältere Wärter hinter ihr nickte.
»Und wir haben neue Wärter … mal sehen, Dale Michael und John Anderson.«
Der ältere der beiden Wärter grunzte. »Na, danke.«
Harper seufzte. »Entspannen Sie sich, Mr Anderson, die werden Sie schon nicht auf Facebook zu ihren Freunden hinzufügen, was?«
Anderson grummelte etwas. Er klang nicht unbedingt erfreut.
Harper schien es egal zu sein. »Okay, die Strafgefangenen mir nach. Wärter, Sie folgen dem Fahrer zum Haupteingang.«
Hinter Cara setzte Bewegung ein. Sie drehte sich um. Michael, der jüngere Wärter, hatte sich mit dem Fahrer bereits abgewandt, Anderson allerdings rührte sich nicht. »Tut mir leid, meine Aufgabe lautet, die Gefangenen in ihre neuen Zellen zu bringen. Nicht zur Eingangstür. Ich habe einen Auftrag. Und den werde ich erfüllen. Ich kann die Frauen nicht einfach vor der Tür stehen lassen – sie sind gefährlich.«
Harper runzelte die Stirn. »Wenn Sie sich nicht an die hiesigen Regeln halten, darf ich Ihnen versichern, werde ich das auch nicht tun.«
Anderson sah ihn finster an, dann drehte er sich um und folgte Michael und dem Fahrer.
Harper sah ihnen hinterher. Gleich darauf tat er aber etwas Komisches, etwas, bei dem sich Cara in den kommenden Tagen fragte, ob sie es wirklich gesehen hatte. Er zwinkerte ihr zu und lächelte.
»Ladys, wenn Sie mir folgen möchten.«
»Auch die Wärter wurden hierherversetzt?«, fragte die Frau mit der Goth-Frisur, als sie Harper durch einen weißen Gang mit einem grässlichen grau gestreiften Teppichboden folgten.
»Die Wärter Anderson und Michael wurden ausgewählt, um beim Aufbau dieser neuen Einrichtung mitzuwirken, ja.«
»Was zum Teufel hat das zu bedeuten?«, flüsterte die Goth Cara ins Ohr.
Cara zuckte mit den Schultern.
Die andere Frau hatte aufgehört zu weinen, kaute jetzt aber auf einer Strähne ihrer kastanienbraunen Haare herum. Zum ersten Mal sah sie Cara in die Augen und machte dabei einen ebenso verwunderten Eindruck wie die anderen beiden.
Hinter der nächsten Ecke tauchte ein Tisch auf – dort standen zwei uniformierte Frauen, eine mittleren Alters, blond, die andere älter und schon leicht grau. Cara hatte keine Zeit, die Namen an ihren Pullovern zu lesen. Sie hatten ein Whiteboard und begannen, als die drei sich ihnen näherten, darauf herumzuschreiben.
»FO112?«, sagte die blonde Wärterin.
Fragend sahen sie sich an, bis Harper ihnen zu Hilfe kam. »Sie haben hier neue Identitäten. So sieht es das neue Programm vor. FO112 ist Moyley.«
Moyley – das war ihr Name, erinnerte sich Cara jetzt. Moyley war die Schluchzende, ihre Traktgenossin. Die Goth drehte sich um.
Die beiden Wärterinnen schrieben etwas auf das Whiteboard und sagten ihr, sie solle sich damit vor eine gestreifte Wand stellen. Sie machten ein Foto. Eine erkennungsdienstliche Aufnahme.
Alles ungefähr so wie bei Caras Einweisung in New Hall. Das übliche Willkommenstrallala. Nur war sie jetzt – »NH597«. »NH597. Lockhart. 12. Juni 2020.« Ein Mantra. Ein Talisman. Das war sie. Sie musste die Tafel hochhalten. Ein Foto wurde gemacht. Toll.
Als Nächstes wurde sie in eine Kabine gescheucht, noch bevor die Goth fotografiert wurde. Die ältere Grauhaarige überwachte sie, während ihr befohlen wurde, sich auszuziehen, was sie ohne zu zögern tat. Mittlerweile war ihr das in Fleisch und Blut übergegangen. Sie beugte sich nach vorn, die Wärterin tastete sie ab. Sie versuchte an nichts zu denken, während die andere in ihr herumwühlte.
Dann war es vorbei. Sie wurde angewiesen, sich umzudrehen, und man gab ihr neue Sachen zum Anziehen – ihre neue Garderobe. Sie bestand aus zwei T-Shirts, zwei Nylonhosen, BHs und Unterhosen, einem knisternden lila Pullover und einem Paar beigefarbener Leindwandschuhe.
»Okay«, sagte die Wärterin.
Cara wartete kurz, bis ihr klar wurde, dass es das gewesen war. Die Wärterin notierte sich etwas auf einem Block und starrte sie an. Mit einem Nicken deutete sie auf eine Tür hinter sich.
Cara ging hindurch. Es blieb ihr kaum etwas anderes übrig.
Sie stand in einem Befragungsraum, an einem Tisch saß ein Mann in einem weißen Kittel. »Ah, hallo, Miss Lockhart, ich bin Doktor Tobias Trenner. Ich muss Ihnen nur ein paar Fragen stellen.«
Sie nahm ihm gegenüber auf dem Stuhl Platz, eine Kamera auf einem Dreibein war auf sie gerichtet.
Dann begannen die Fragen, die wild zwischen Alltäglich-Banalem und abgedrehten Sachen hin und her sprangen. Auf »Ihr voller Name lautet Cara-Jane Lockhart, ja?« folgte »Haben Sie jemals daran gedacht, sich das Leben zu nehmen?«. Dann: »Wie viele Sexualpartner hatten Sie?« Und: »Ihnen ist durchaus klar, warum Sie hier sind? Sie sind im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte?« Bis dann eine absolut lächerliche Frage dem Ganzen die Krone aufsetzte: »Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft?«
Nach der aufgezeichneten Unterredung kam die grauhaarige Wärterin und führte Cara durch eine weitere Tür zu einem Tisch. Sie wurde mit einer Webcam fotografiert und anschließend aufgefordert, ihr Handgelenk auszustrecken. Ihr wurde ein Armband aus Metall umgelegt, das etwas dicker war als eine Handschelle. Mit einem Klicken schloss es sich um das Gelenk und sandte ein pulsierendes blaues Licht aus.
»Das ist Ihre Manschette«, sagte die Wärterin. »Das ist so was wie ein Ausweis, außerdem zeichnet sie Ihre Vitalfunktionen auf. Sie öffnet automatisch die Türen, für die Sie berechtigt sind, und verwehrt Ihnen jene, für die Sie keine Erlaubnis haben. Dazu besitzt sie einen Tracker, wir können also jederzeit sehen, wo Sie sich aufhalten. Sollten Sie es tatsächlich schaffen, irgendwohin zu kommen, wo Sie nicht sein sollten, wird das Licht an der Manschette rot. Dann haben Sie dreißig Sekunden, um dorthin zurückzugehen, wo Sie sein dürfen, bevor die Manschette einen Stromschlag aussendet, der dem eines Tasers ähnelt.«
Cara wollte schon »Was?« sagen, aber jemand kam ihr zuvor. Sie drehte sich um. Die Goth war hinter ihr hereingeführt worden.
Die Wärterin bat sie, das Handgelenk auszustrecken.
»Nein.«
Die Wärterin sagte nichts, sondern zog lediglich die Augenbrauen hoch.
Und die Goth, die einsah, dass sie mit ihrer Weigerung nicht weit kommen würde, hielt ihr das Handgelenk hin. Eine Manschette schloss sich um ihren Arm.
»Sie werden feststellen, dass es hier etwas moderner zugeht als in New Hall. Immerhin ist das Gefängnis das erste seiner Art.«
»Was soll das heißen?«, fragte die Goth.
Aber Cara war auf etwas anderes konzentriert. Auch die Wärterin hatte eine Manschette. Ebenfalls mit einem pulsierenden blauen Licht, genau wie ihre.
Wie aus dem Nichts tauchte Harper auf. Automatisch sah sie auf sein Handgelenk. Auch er trug eine Manschette. Die Wärter wurden also auch getrackt? »Sind die beiden fertig, Continell?«
Die Wärterin, Continell, nickte.
»Gut, dann nehm ich sie mit. Du und Abrams, ihr schafft es doch, uns dann Moyley zu bringen. Tobias lässt sich etwas Zeit mit ihr. Sie hat nah am Wasser gebaut.«
»Natürlich«, sagte Continell.
Mit einem knappen Nicken führte Harper Cara und die Goth durch eine weitere Tür in einen langen weißen Korridor. An dessen Ende erreichten sie eine schwarze Marmorwand mit drei Fahrstühlen. Es sah aus wie in einem Hotel und passte zu dem uneinheitlichen Eindruck, den das Gebäude von außen auf sie gemacht hatte.
Harper drückte auf den Knopf.
Die Türen links gingen auf, Harper wollte bereits rein, aber ein Wärter und eine Gefangene schoben sich heraus. Die Frau hatte große Augen, rotbraune verfilzte Haare, sie kaute auf dem Ärmel ihres Oberteils herum und gab einen seltsamen Ächzlaut von sich.
Der Wärter zerrte sie nach draußen. »Komm schon, Ray.«
»Aber er war es nicht«, sagte die als Ray Angesprochene.
»Ja, ja«, murmelte der Wärter. Er zog sie zur Seite und machte Harper und seinen Anvertrauten Platz.
»Es hat sich angehört wie er, aber er war es nicht«, rief Ray.
»Wir gehen zum Doc, der wird das dann schon klären.« Er schob sie in den Korridor hinein, schloss auf halber Länge eine weitere Tür auf und stieß sie hinein. »Los, komm.«
»Aber …«, sagte Ray, bevor die Tür geschlossen wurde und ihre Stimme nur noch gedämpft zu hören war.
Cara und die Goth sahen zu Harper. Er machte nicht den Eindruck, als wollte er etwas erklären.
Der Aufenthalt im Gefängnis war eben gewöhnungsbedürftig – manche kamen damit einfach nicht zurande. Cara hatte sich früher auch zu jenen gezählt – hatte geglaubt, sie würde verrückt werden, war auf und ab getigert, hatte vor sich hin gemurmelt, dass sie hier nichts verloren hatte und ihr Leben anders aussehen sollte. Die Tage waren lang, die Mahlzeiten ungenießbar, die Duschen demütigend. Aber … irgendwas geschah dann. Eines Tages wachte sie auf. Eines Tages wurde ihr bewusst, dass ihr nichts anderes übrig blieb, als weiterzumachen. Und das tat sie dann – und danach vergingen die Tage ein wenig schneller, die Mahlzeiten schmeckten etwas besser, die Duschen … nein, die Duschen waren wie vorher. Aber irgendwie, irgendwo hatte sie etwas Ruhe gefunden.
Sie hatte aufgegeben.
Sie konnte sich glücklich schätzen. Auch wenn es nicht mit dem Glücksgefühl verbunden war, das sie von früher kannte. Dieses Glücksgefühl war jetzt in Schmerz getaucht.
Harper führte sie in den Fahrstuhl und drückte auf den Knopf. Zehn Sekunden später, nach der sanftesten Aufzugfahrt, die sie jemals erlebt hatte, gingen die Türen auf. Es sah hier nicht viel anders aus als unten.
Ein weißer steriler Raum, mit weißen Fliesen und weißem Boden, dazu in der Mitte eine gegenwärtig unbesetzte Wärterstation. Harper führte sie daran vorbei zu einer Doppeltür.
Als Erstes traf sie der Lärm. Es klang wie in einem Hallenbad voller Kinder. Der Lärm war so gewaltig, so widerhallend, so alles überstrahlend, dass es schwerfiel, einen klaren Gedanken zu fassen. Wie ein gewaltiger Fischschwarm wogten und wandten sich einzelne Stimmen, verloren sich wieder, gingen in anderen auf und erzeugten ein einziges, unentwirrbares Getöse. Ein Geräusch, das ihr leider vertraut war – in New Hall war es genauso gewesen.
Cara war daher kaum überrascht, als sie, nachdem sie die Doppeltür durchquert hatte, von einem ebenso vertrauten Anblick begrüßt wurde. Sie befanden sich auf einer Metallbrüstung und sahen auf einen großen rechteckigen Innenhof hinab, der an jeder Seite von Zellen gesäumt war; in ihm eine kaum entwirrbare Menschenmenge.
Dort standen Frauen, saßen auf Plastikstühlen, beugten sich über Tische, waren in Brettspiele vertieft, fläzten auf einem zerschlissenen Sofa, verkrochen sich unter Tischen, lungerten auf den Metalltreppen.
Einige der Frauen unten im Kessel bemerkten schnell, dass sie Gesellschaft bekommen hatten, deuteten auf sie und grinsten dreckig. Andere starrten sie nur an. Wieder andere machten ihre Freundinnen auf sie aufmerksam. Bald sahen die meisten Frauen zu ihnen hinauf.
»Ho«, rief eine. »Neue.«
Weitere Köpfe drehten sich in ihre Richtung.
»Achten Sie nicht auf sie«, sagte Harper, während sich Cara beeilte, um auf dem Laufgang nicht den Anschluss zu verlieren. »Die meisten sind harmlos.« Sie waren an der nächsten Treppe angelangt, Harper war schon auf dem Weg nach unten. Darauf hätte Cara liebend gern verzichtet. Sie trat von der Treppe zurück, aber es legte sich eine Hand auf ihre Schulter. Die Hand der Goth.
»Ich hab kein Problem damit, Butcher, ich geh zuerst. Lass mich durch«, sagte sie und lächelte. Dann war sie schon auf der Treppe und nahm zwei Stufen auf einmal – als könnte sie es kaum erwarten.
Butcher.
Die Goth wusste, wer sie war.
Butcher. Die Schlächterin. Der Name, den man ihr in New Hall gegeben hatte. Ihr Ruf eilte ihr voraus. Und die Frauen unten würden ebenfalls wissen, wer sie war.
Trotzdem fand sie irgendwie die Kraft, langsam die Treppe hinunterzugehen. Harper war bereits unten, einige Frauen kamen auf ihn zu – riefen Unverständliches und gestikulierten Unverständliches.
»Meine Damen, ich bitte Sie. Es ist doch nicht das erste Mal, dass Sie Neue zu sehen bekommen.«
Harper bahnte sich seinen Weg, die Frauen wichen zurück. Die Goth und sie folgten und hielten sich so dicht wie möglich hinter Harper.
Einzelne Rufe waren zu hören, einige der Frauen erkannten Cara ebenfalls.
»Da ist die Butcher! Die verdammte Butcher.«
»Die passt ja hervorragend hier rein, die Butcher.«
»Vorsicht, die Butcher geht um. Und hat sogar Gefolge.«
»Die Butcher geht um heut in der Nacht«, begann eine Frau, die zwischen den vielen Gesichtern nicht auszumachen war, einen seltsamen Singsang. »Habt ihr schon eure Liebsten weggebracht?« Das Lied. Das Lied, das sie in New Hall alle gesungen hatten. »Wir sind vielleicht der letzte Dreck. Kinder sind …« Woher kannte die Frau es? War noch jemand aus New Hall hier?
»Halt den Mund«, erklang eine dröhnende Stimme.
Die Frauen verstummten und fuhren herum. Genau wie Cara und die Goth – es blieb ihnen kaum was anderes übrig. Eine Frau in Gefängniskleidung kam die Treppe herunter, die sie eben selbst benutzt hatten.
»Was zum Teufel ist hier los?«
Wieder wurde Cara an der Schulter gepackt, dann zog Harper sie beide durch die Menge.
»Ich lass mir nur kurz mal die Haare machen, und was muss ich sehen, wenn ich zurückkomme?«, rief die Frau. Sie war klein und stämmig und nahm immer nur eine Stufe. »Was ist los hier in meinem Revier?« Sie sang es fast wie eine Gospelsängerin.
Cara war es egal. Sie wollte nur so schnell wie möglich durch die Menge, und wenn die Neue die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich lenkte, sollte es ihr recht sein.
Es funktionierte. Problemlos folgten sie Harper zu einer weißen Tür links. Darüber war eine Lampe angebracht. Rot. Als Cara und die Goth sich ihr näherten, wurde sie grün.
»Nur Sie beide und die Wärter in dieser Abteilung haben Zutritt zu Ihrer Zelle«, sagte Harper. »Es ist Ihnen nicht erlaubt, die Zellen der anderen Gefangenen zu betreten. Anderen Gefangenen ist es nicht erlaubt, Ihre Zelle zu betreten. Entsprechend ist Ihnen erlaubt, zu bestimmten Tageszeiten andere Bereiche der Abteilung aufzusuchen – den Hof, den Speisesaal, die Wäscherei, den Duschraum und so weiter –, die jeweiligen Türen öffnen sich wie diese hier. Um zu gewährleisten, dass sich niemand an einem Ort aufhält, an dem er nichts zu suchen hat, schließen sich die Türen hinter Ihnen automatisch und können nicht offen gehalten werden. Auf diese Weise wissen wir zu jedem Zeitpunkt, wo sich die einzelnen Gefangenen aufhalten, und Sie sind voreinander geschützt. Irgendwelche Fragen?«
»Warum haben Sie eine Manschette?«, fragte Cara.
»Wir haben die Manschetten aus den mehr oder minder gleichen Gründen wie Sie«, sagte Harper und hielt das Handgelenk hoch. »Damit sperren wir Türen auf, damit werden unsere Vitalfunktionen überwacht. Aber wir haben auch Schlüsselkarten, die eine Art Generalschlüssel für den ungehinderten Zugang zu den Gemeinschaftsräumen sind.«
Cara und die Goth sahen sich an. Die Goth zuckte mit den Schultern. Es schien sie nicht zu beunruhigen. Aber Cara beunruhigte es. Als wären die Wärter ebenfalls Gefangene.
Kurz herrschte betretenes Schweigen.
Cara würde ganz sicher noch viele Fragen haben, im Moment wollte ihr aber keine einfallen.
»Alles, was Sie brauchen, sollten Sie hier vorfinden«, sagte Harper. »Auf Ihrem Bett ist ein Waschbeutel mit allem Nötigen. Und Ihre Kleidung haben Sie ja schon dabei, wie ich sehe.«
Cara betrachtete das unscheinbare Wäschebündel auf ihren Armen.
Harper sah auf seine Uhr. »Es ist halb vier. Sie müssen Hunger haben. Wir werden Sie heute von den anderen Insassinnen trennen, weil, na ja … Sie haben ja gesehen, wie groß die Aufregung war. Ich werde Ihnen was zu essen bringen lassen, sobald es was gibt, so gegen sechs. Morgen werden wir uns dann darum kümmern, Sie zu integrieren. Es ist nicht so schlecht hier, auch wenn es nicht so aussieht.« Harper wies sie in die Zelle. »Willkommen in North Fern.«
Sie traten durch die offene Tür. Harper blieb davor stehen. Die Tür ging zu. Das mechanische Schloss rastete ein.
Die Goth sah sich mit einem Seufzen um. »Was zum …«
Jetzt drehte sich auch Cara endlich um und musterte ihr neues Zuhause. Die Zelle war klein, gedrängt, aber nicht unerträglich. Es gab zwei schmale Betten, eines an jeder Längsseite – Kunststoffmatratzen und steife lila Decken –, beide gemacht, auf jedem Kopfkissen lag ein Waschbeutel. Zwischen den beiden Betten führte ein schmaler Gang zu einem gemeinsamen Nachttisch.
Als Letztes fand sich in der Zelle eine kleine Nische mit einer Toilette und einem Waschbecken, beides abgetrennt von einer hüfthohen Wand. Jeder normale Mensch hätte sich gesträubt, trotzdem stellte das noch einen Grad an Privatsphäre dar, der ihr seit einiger Zeit verwehrt geblieben war.
Aber das war noch nicht alles. Erst als Cara den Blick über die Wand schweifen ließ, fiel ihr auf, dass es kein Fenster gab. Sie war keineswegs klaustrophobisch, aber das Fehlen eines Fensters störte sie. Vielleicht störte sie aber auch nur, was anstelle des Fensters an der Wand angebracht war. Ein flacher rechteckiger Bildschirm hinter einer Glasscheibe zeigte eine grüne Hügellandschaft unter einem blauen Himmel – nicht unähnlich einem Desktop-Hintergrund am PC. Lichtstrahlen strömten vom Bildschirm in den Raum. Es fühlte sich nicht künstlich an, sondern wie ein ganz normales Fenster in einem ganz normalen Zimmer mitten am Nachmittag.
Das machte die Sache allerdings nicht besser, im Gegenteil, sie fühlte sich nur noch mieser.
Auch die Goth starrte gebannt darauf. »Na, ist das nicht hübsch?«, sagte sie und tippte gegen das Glas vor dem Bildschirm. »Auf jeden Fall ziemlich irre.« Sie setzte sich aufs rechte Bett, offensichtlich, um es für sich in Beschlag zu nehmen. Cara war es egal. »Alles in Ordnung mit dir?«, fragte die Goth.
Cara lächelte verhalten. »Mir geht’s gut.« Sie setzte sich aufs linke Bett – ihr Bett. Unter ihrem Gewicht gab es einen knarrenden Plastiklaut von sich. Es klang so bequem, wie es aussah.
»Wirklich?«, fragte die Goth. »Du zitterst nämlich.«
Cara hob die rechte Hand. Sie zitterte wirklich – sacht vibrierte die Hand wie zu einer lautlosen Melodie. Sie ballte sie zur Faust und legte sie zurück aufs Bett. »Es war ein langer Tag.« Hoffentlich klang das nicht nach lahmer Ausrede, auch wenn es das im Grunde war.
»Stimmt. Ich hätte sogar im Wagen schlafen können, wenn Moyley nicht so … zerflossen wäre.«
»Wir haben sie Niagara genannt«, sagte Cara. »Hat ständig vor sich hin geflennt.«
»Ach, ihr wart in derselben Abteilung? In New Hall.«
»Ja.«
»Sieht so aus, als wäre ich dann die Außenseiterin. Na ja, da ich weiß, wer du bist, sollte ich mich vielleicht mal vorstellen.« Die Goth streckte ihr über den Gang die Hand hin. Cara ergriff sie. »Ich bin Stephanie Barnard.«
2
Cara und Barnard unterhielten sich etwa eine halbe Stunde. In ihrem früheren Leben war Barnard Ökologin gewesen. Insgesamt hatte sie fünf Jahre in New Hall verbracht; warum, sagte sie nicht. Cara fragte nicht. Barnard erzählte von ihrer Familie, ihrem Ex-Freund, ihren Hunden und ließ Cara kaum zu Wort kommen. Cara war es recht so. Barnards Ton, ihre Blicke schienen anzudeuten, dass ihre Zellengenossin das sehr wohl wusste. Barnard tat alles, damit es ihr besser ging. Dafür war Cara ihr unendlich dankbar.
Während Barnard redete, betrachtete Cara ihre Manschette. Das pulsierende blaue Licht nervte sie bereits. Würde das Ding jetzt für immer an ihrem Handgelenk sein?
Irgendwann öffnete sich eine Klappe unten in der Tür, und zwei Tabletts wurden in die Zelle geschoben. Auf jedem eine Schale mit einer braunen Pampe, aus der ein Plastikgöffel ragte, dazu gab es einen Becher Wasser, einen harten Keks und eine Serviette.
Barnard sprang sofort auf und griff sich ihr Tablett. »Na endlich. Ich bin am Verhungern.«
Cara nahm sich ihres, wenn auch weniger begeistert. Beide hockten auf ihrem Bett. Cara stocherte in der grau werdenden braunen Pampe, die nach Eintopf aussah. Eine Soße mit Brocken undefinierbaren Fleisches und Scheiben von irgendwas Glitschig-Durchsichtigem.
Cara sah zu Barnard, die bereits vor sich hin mampfte. Auf ihrem Gesicht ein verzückter Ausdruck. »Als hätten sie gewusst, dass ich komme«, sagte sie mit vollem Mund. »Mein Lieblingsessen.«
»Was ist das?«, fragte Cara unbehaglich.
»Leber mit Zwiebeln«, antwortete Barnard. »Genau wie meine Großmutter sie gemacht hat. Perfekt.«
Cara drehte sich der Magen um. Sie sah in die Schale. Dort die Stückchen. Sie stieß eines an. Leber und Zwiebeln. Schon bei dem Gedanken, dass sie so etwas essen musste, wurde ihr schlecht. Trotzdem, sie hatte erstaunlichen Hunger. So gut es ging, spießte sie eines der Stückchen auf, schob es sich in den Mund und biss hinein, bevor sie es sich anders überlegen konnte. Sie kaute. Es schmeckte nach Fleisch und irgendwie nach Eisen. Sie schluckte.
»Na, siehst du«, sagte Barnard, die sie beobachtete. »Nicht so schlecht, oder? Und es macht dich stark.«
Cara gelang noch ein Lächeln, bevor ihr das Wasser in den Mund schoss und sie spürte, wie es sie hob. Sie schaffte es gerade noch zur Toilette, bevor sie ihren Mageninhalt in die Kloschüssel erbrach. Dann war alles draußen. Sie blieb noch ein paar Minuten vor der Schüssel knien, um auf Nummer sicher zu gehen. Schließlich, als sie überzeugt war, dass nichts mehr kommen würde, stand sie wacklig auf, spülte die Toilette und ging zum Becken, um sich das Gesicht zu waschen.
Als sie fertig war, sah sie zu Barnard, die ihre eigene, leere Schale in Händen hielt. »Heißt das jetzt, dass du deine nicht aufisst?«
Trotz allem musste Cara lachen. Barnard fiel mit ein. Das restliche Abendessen verlief in bester Stimmung. Barnard tauschte die Schale mit der Leber und den Zwiebeln gegen ihren Keks ein, und Cara musste feststellen, dass die Kekse, obwohl sie tatsächlich ziemlich altbacken waren, ihren Magen füllten, worauf es ihr ein bisschen besser ging.
Als sie fertig waren, stellten sie die Schalen auf den Boden. Bald darauf ging die Klappe wieder auf, Barnard schob sie durch. »Lob an den Koch«, sagte sie.
Der Wärter auf der anderen Seite schien es nicht witzig zu finden – er griff sich die Tabletts und knallte die Klappe wieder zu.
Barnard ließ sich mit einem spöttischen Grinsen aufs Bett fallen. »Wenn ich bloß ein Buch oder so hätte.« Sie richtete die Aufmerksamkeit auf den Nachttisch zwischen ihnen. Er hatte zwei Schubladen – vermutlich jeweils eine pro Strafgefangener –, darüber war an der Wand eine kleine Lampe angebracht. Sie legte einen Schalter um, das Licht ging an, dann schaltete sie es wieder aus.
Cara musste gähnen, während Barnard die Schubladen inspizierte. Wie lange war sie schon auf? Sie hatte nicht die geringste Ahnung. Sie wusste nur, dass sich ihr ganzer Körper nach Schlaf sehnte, gleichzeitig wusste sie auch, dass sie nicht schlafen konnte.
»Bingo«, kam es von Barnard. »Sieht mir nicht wie ein Pageturner aus, aber was soll’s?« Sie zog ein laminiertes Ringbuch heraus und hielt es hoch, damit Cara es sehen konnte. Das Bild eines sonnenbeschienenen grasbewachsenen Hügels – das gleiche Bild wie auf dem Bildschirm – und darunter in dicken schwarzen Buchstaben: »Willkommen in North Fern«. Ein Gefängnishandbuch.
Barnard lehnte sich zurück und begann zu lesen. Cara rutschte immer weiter auf dem Bett nach unten, bis ihr Kopf auf dem Kissen lag. Es war steinhart. Standard. Trotzdem, es stützte den Kopf. Das Bett war aufgeladen, Kunststofflaken und Kunststoffdecken. Feuerfest. Sie war daran gewöhnt. Woraus sie einen kleinen Trost zog. Obwohl es hier so anders war als in New Hall, fühlte sich das Bett genauso an.
Sie starrte an die Decke, lauschte den gedämpften Stimmen der Gefangenen und Wärter draußen im Kessel. Sie konnte nichts verstehen. Dennoch hatten die Stimmen seltsamerweise etwas Beruhigendes. Sie schloss die Augen …
TÄÄÄT.
Sie schreckte hoch.
Barnard zuckte zusammen. Cara wusste nicht, ob wegen des Geräusches oder ihrer Bewegung. »Immer mit der Ruhe, Lockhart«, sagte sie. Das Handbuch hatte sie anscheinend ausgelesen, es lag am Fußende ihres Betts.
»Wie lange hab ich …?«
»Eine Stunde, vielleicht eineinhalb«, sagte Barnard und griff sich das Handbuch. »Das musst du lesen. Da stehen komische Sachen drin. Wie zum Beispiel, dass es keine Besucher gibt.« Sie legte es auf den Nachttisch.
Aber Cara hörte ihr gar nicht richtig zu. Sie sah sich um und versuchte herauszufinden, woher das Geräusch gekommen war. Irgendwann fand sie einen kleinen Lautsprecher in der Ecke des Raums.
TÄÄÄT.
Cara runzelte die Stirn.
Barnard nickte. »Es gibt angenehmere Töne, was?«
In der Zelle war es jetzt dunkler. Sie brauchte etwas, bis ihr klar wurde, dass der Bildschirm hinter ihr und die Lichter um ihn herum abgeschaltet waren.
»Licht aus in fünf Minuten«, schallte es über den Lautsprecher.
Draußen wurde es lauter. Anscheinend hielten sich immer noch Frauen im Kessel auf. Die Durchsage war eine Warnung, sich jetzt in die Zellen zu begeben.
»Erste Nacht am neuen Ort«, sagte Barnard, die sich zumindest den Anschein von Abgebrühtheit gab. »Man muss das neue Bett erst einliegen, aber man weiß nie, wie es sein wird.«
Sie hatte recht. Cara musste an ihre erste Nacht in New Hall denken. Sie hatte gedacht, sie würde kein Auge zutun, weil es ohrenbetäubend laut war in ihrem Trakt. Anders als hier.
Barnard begann ihr Bett abzuräumen – sie gab ihre zusammengelegten Sachen in die obere Schublade neben sich und schlug die Kunststoffdecke zurück.
Cara tat es ihr nach, während sie nach wie vor auf die Geräusche außerhalb der Zelle lauschte. Allmählich kehrte Ruhe ein, alles wurde leiser, die Frauen verzogen sich in ihre Zellen, und Cara überlegte allen Ernstes, ob sie in dieser Stille überhaupt Schlaf finden würde.
Sie waren beide bereits unter ihrer Decke, als mit der nächsten Durchsage verkündet wurde, dass in einer Minute die Lichter ausgehen würden.
»Was ist das für ein Gefängnis, wenn es keine Besucher gibt?«, sprach Barnard gegen die Decke.
»Was?«
»In North Fern gibt es keine Besucher. Steht so im Handbuch. Nur Telefonate und Briefe.«
Cara starrte auf ihren eigenen kleinen Deckenabschnitt. Keine Besucher. Nicht dass sie das sonderlich berührt hätte – sie würde sowieso keinen Besuch bekommen. Aber die anderen? War das eine Hochsicherheitsanstalt? Es fühlte sich nicht so an. Trotzdem …
Barnard unterbrach ihre Gedanken, bevor sie mit ihr durchgingen. »Bringt nicht viel, sich jetzt darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir müssen uns mit genug anderen Sachen rumschlagen. Morgen ist auch noch ein Tag«, sagte sie entschieden. »Vielleicht war es ja ein Druckfehler oder so«, fügte sie, weit weniger entschieden, noch hinzu.
Cara nickte, ohne Barnard anzusehen. Sie hatte recht. Sie sollten sich darauf konzentrieren, zu schlafen.
»Gute Nacht«, sagte Cara.
»Gute Nacht.«
Wie aufs Stichwort erlosch das Licht an der Zellendecke. Zum Glück ging auch das verdammte Licht an ihren Manschetten aus. Sie waren in vollkommene Dunkelheit getaucht. Von den anderen Zellen war, gedämpft, ein überall widerhallendes Johlen zu hören, und in der nächsten Stunde entsponnen sich Gespräche, die von Zelle zu Zelle getragen wurden. Die Wichtigtuerinnen, genau wie in New Hall. Cara lag in der Dunkelheit, strampelte die Decke weg und wartete auf den Schlaf.
Es dauerte nicht lange, und das Lautgewirr dünnte sich aus, bis nur noch einzelne Stimmen auszumachen waren, dann völlige Stille. Genau das, wovor sie Angst gehabt hatte. Aber zu ihrer Überraschung spürte sie, dass ihr die Ruhe guttat. Sie drückte sich in das Kissen, schuf, so gut es ging, eine Mulde für den Kopf und schloss die Augen.
Bald darauf verlor die Welt ihre Festigkeit. Wurde dünn, durchscheinend. Und Cara fiel, tief, immer tiefer, in den Schlaf.
Wie immer träumte sie von ihnen.
3
TÄÄÄT.
Cara riss die Augen auf – schon jetzt hatte sie die Schnauze voll von dem Lautsprecher. Mit dem Lärm kam das grelle Licht. Ihre Manschette glühte. Es war Morgen. Sie war immer noch unglaublich müde. Außerdem lag ihr der giftige Nachgeschmack ihrer Albträume auf der Zunge. Sie stand auf, schlug die verschwitzte Decke zurück, die sie irgendwann in der Nacht wieder über sich gezogen hatte, und streckte den Rücken durch. Er tat weh, sie hatte nichts anderes erwartet. Ihr Handgelenk unter der Manschette juckte, aber sie kam nicht dran, um sich dort zu kratzen.
Barnard war bereits wach und saß auf dem Bett. Sie blätterte durch das Handbuch, das sie sich geschnappt hatte, sobald das Licht angegangen war. Cara erinnerte sich, was sie am Vorabend dazu gesagt hatte. Als sie sie gerade darauf ansprechen wollte, schlug jemand laut gegen die Zellentür.
»Sind Sie angekleidet?«, war eine vertraute Stimme zu hören. Sie zogen sich eilig an, und kaum war Cara fertig, ging die Tür auf. Harper stand vor ihnen. »Ich dachte, es ist vielleicht besser, wenn ich Sie heute zum Frühstück begleite.«
Draußen schlurften Frauen langsam zur gegenüberliegenden Seite des Kessels auf eine Doppeltür zu. Sie schienen sich nicht mehr für die Neuankömmlinge zu interessieren. Bei jeder Frau, die hindurchging, blinkte das Licht über dem Eingang grün.
Den Raum, der dahinterlag, hatte sich Cara sehr viel größer vorgestellt. Er sah aus wie eine Schulkantine: ein offener Raum mit Tisch- und Stuhlreihen. Vor den Edelstahlklappen an der hinteren Wand hatte sich bereits eine Schlange gebildet. Im Raum war es sehr viel heller als überall sonst. Die Decke, bemerkte Cara, als sie hinaufblickte, war großflächig mit Lampen bestückt, die ein beinahe natürliches Licht abstrahlten, ähnlich den Leuchten in ihrer Zelle.
Vier Wärter, allesamt Männer, waren gleichmäßig im Raum verteilt. Erstaunt entdeckte Cara Dale Michael aus dem Gefangenentransporter, der in einer Ecke dumpf vor sich hin stierte. Er hatte sie gar nicht bemerkt.
Als sie die Mitte des Raums erreichten, nickte Harper ihnen zu und begab sich zu den anderen Wärtern an der Wand.
Barnard reihte sich in die Schlange ein, Cara folgte ihr. Ihre Zellengenossin schien schon wieder Hunger zu haben; sehnsüchtig ging ihr Blick zum Anfang der Schlange. Den anderen Frauen schien es zum Glück ähnlich zu ergehen, denn keine würdigte Cara auch nur eines Blickes.
So wartete sie mit gesenktem Kopf. Als sie an der Reihe war, wurde ihr von einer Frau in Gefängniskleidung ein Tablett in die Hand gedrückt, darauf befand sich eine Schale mit Weetabix, ein schon leicht bräunlicher Apfel und eine Blechtasse mit Milch. Die Frau, in den Fünfzigern, über deren linke Wange sich eine frisch aussehende Narbe zog, die irgendwie gar nicht zu jemandem passen wollte, der einem das Essen servierte, starrte sie bloß ungerührt an.
Cara schloss zu Barnard auf, die den Blick über die Tische schweifen ließ. Die meisten waren vollständig besetzt, die Frauen dort hatten schon halb ihr Frühstück aufgegessen, nur an manchen Tischen gab es noch freie Plätze, wenige waren sogar komplett leer. Barnard schien es sich gründlich zu überlegen, wo sie Platz nehmen wollte.
»Wie am ersten Schultag«, murmelte sie. Cara stimmte ihr zu. Wo sie sich hinsetzten, würde vermutlich ausschlaggebend sein für ihren restlichen Aufenthalt in North Fern. So fühlte es sich jedenfalls an.
Auch Cara sah sich um und entdeckte ganz hinten, etwas abseits von den anderen, einen ihr bekannten roten Haarschopf. Die Frau dort hatte die Arme auf dem Tisch verschränkt und sah mit leerem Blick auf ihr Frühstück. Sie vermittelte den Eindruck – wenig überraschend –, als hätte sie gerade geweint.
Niagara – oder Moyley. Sie war in dieselbe Abteilung überstellt worden.
Barnard entdeckte sie ebenfalls und musste seufzen. »Die Heulsuse ist auch hier – wie schön. Nur sieht sie nicht so aus, als würde sie auf Gesellschaft Wert legen.«
Cara musste ihr zustimmen. Allerdings war es manchmal gerade dann, wenn man niemanden bei sich haben wollte, ganz besonders wichtig, dass einem jemand Gesellschaft leistete. »Sie braucht eine Freundin«, sagte sie.
Barnard rollte mit den Augen. »Wenn du meinst.«
Im Slalom schlängelten sie sich zwischen den Tischen zu ihr. Cara war bemüht, niemandem in die Augen zu schauen, bis sie Moyleys Tisch erreicht hatten. Dort standen sie dann etwas unbehaglich, während Moyley wie ein Häufchen Elend auf ihre Schale starrte und mit den Tränen kämpfte. Sie hatte sie noch nicht mal bemerkt.
Barnard räusperte sich laut.
Jetzt sah Moyley auf. Ihr gingen die tränenfeuchten Augen über. »Ihr«, sagte sie schließlich mit Blick auf Cara.
»Können wir uns dazusetzen?«, fragte Cara.
Moyley schien noch mehr in sich zusammenzufallen. »Du … du warst im Wagen.«
»Waren wir beide«, sagte Barnard und nahm Platz.
Cara folgte ihrem Beispiel. Moyley zuckte zusammen und sprang auf.
»Wie kannst du es wagen?«, rief sie und griff sich ihr Tablett. »Als ob ich irgendwas mit dir zu tun haben möchte. Du kotzt mich an.«
»Ich hab’s dir ja gesagt«, sagte Barnard zu Cara.
»Hoffentlich murksen sie dich ab!«, schrie Moyley und spuckte Cara ins Gesicht.
Cara zuckte zurück und wäre beinahe rückwärts vom Plastikstuhl gefallen.
Moyley sah sie nur an, bevor sie Richtung Ausgang trottete, wo sie fast mit einigen Frauen zusammenstieß, die sich dort unterhielten. Einige von ihnen hatten am Vortag zur Willkommensmeute gehört, wie Cara erkannte. Mit der Serviette wischte sie sich die Spucke von der Wange.
Barnard schien von allem wenig beeindruckt, weder von Moyleys Ausbruch noch von Caras Freundschaftsangebot. »Machen wir uns übers Frühstück her.«
Cara hatte nichts dagegen. Schweigend saßen sie nebeneinander, Cara trank ihre Milch und aß ihre Weetabix. Die eingeweichten Vollkornweizenkekse hatte sie noch nie sonderlich gemocht. Sie hoffte, sie würde unbehelligt bleiben und könnte Szenen wie am Vortag vermeiden. Sie kannte das alles zur Genüge, aber bei Neuankömmlingen war es eben immer schlimmer.
Sie musste an ihre Ankunft in New Hall denken. Nach dem Presserummel, den ihr Fall ausgelöst hatte, und dem öffentlichen Interesse hatte jeder im Gefängnis gewusst, wer sie war. Am Tag ihrer Einlieferung wäre es fast zu einem Aufstand gekommen, weshalb sie zu ihrem eigenen Schutz fast eine Woche lang auf der Krankenstation untergebracht wurde.
»Darf ich mich zu euch setzen, Ladys?« Die Stimme riss sie aus ihren Gedanken, die noch um New Hall kreisten. Damals war sie froh um die Krankenstation gewesen, denn als Nächstes hatte man sie mitten in der Nacht aufgeschlitzt – die Narbe auf ihrem Bauch pochte immer noch, wenn sie bloß daran dachte. Weshalb sie es vermied, daran zu denken.
Sie sah auf. Genau wie Barnard.
Vor ihnen stand die Frau, die am Tag zuvor die Treppe heruntergekommen war, jene Frau, die einige Autorität ausgestrahlt, die Frau, die sie gerettet hatte. Sie war um die fünfzig, untersetzt und hatte kurze, gelockte brünette Haare. Etwas Mütterliches haftete ihr und ihrem freundlichen Blick und sanften Wesen an – jemand, der in einer Gefängniskantine eigentlich nichts verloren hatte.
Barnard deutete auf den Platz ihnen gegenüber, wo die andere sich bereits niederließ. »Das kleine Spektakel gestern dürfte einen falschen Eindruck gemacht haben, daher dachte ich mir, ich rück mal einiges gerade. Und begrüße euch ganz herzlich.«
Cara sagte nichts. Die Frau hatte etwas – an der Oberfläche war sie so sanft wie eine Wolke, in ihrem Inneren aber brodelten Gewitter. Außerdem registrierten sie, dass es um sie herum in der Kantine stiller geworden war, so als würde jeder Vorgang an ihrem Tisch aufmerksam beäugt werden.
»Manche meiner Mädchen flippen ein bisschen aus, wenn Neue kommen.« Die Frau lächelte und sah von Barnard zu Cara. »Das versteht ihr sicherlich.« Dann, nach kurzer Pause: »Man hat angekündigt, dass du kommen wirst, Butcher. Ich hab’s nicht geglaubt. Du siehst gar nicht aus wie eine Schlächterin.«
»Nein, vermutlich nicht«, sagte Cara.
Die Frau streckte ihr über den Tisch die Hand hin. »Ich bin Minnie Marple.« Cara gab ihr die Hand. »Deinen Namen musst du mir nicht sagen, Miss Lockhart.« Dann streckte sie Barnard die Hand hin. »Und du bist …«
»Stephanie Barnard«, sagte Barnard, den Mund voller Weetabix. Sie machte keine Anstalten, Minnie die Hand zu geben, worauf diese ihre zurückzog. Für einen Moment wirkte Minnie enttäuscht. »Du bist nicht zufällig die Marple der Marple-Morde? Ich hab drüber gelesen.«
Minnie lächelte. »In den Zeitungen, ja. Kaum zu fassen, wie die Presse durchdreht, wenn es tatsächlich eine Mörderin gibt, die Miss Marple heißt. Na ja, Mrs Marple zum damaligen Zeitpunkt, aber das hat ja kaum jemanden interessiert. Mein alter Knast hatte auch seinen großen Tag, bevor ich hierherverlegt wurde. Vor zwei Monaten.«
»Du bist auch verlegt worden?«, fragte Cara.
»Na ja, wir sind alle Knackis, oder?«, sagte Minnie, schob ihre Schale weg und griff nach ihrem Becher. »Wir sind alle von irgendwo hierherverlegt worden. Schließlich ist dieser Bau jünger als mein Sohn.«
»Gab es einen Grund, warum du verlegt worden bist?«, fragte Cara, die nicht recht wusste, wie sie darauf reagieren sollte. »Mir hat man nämlich nichts gesagt.«
»Na, der Staat macht doch, was er will, oder? Gibt’s irgendwo zu viele miese Leute, verlegst du sie eben woandershin. Aber ja, bei mir, könnte man sagen, gab’s einen Grund. Meine Zellengenossin wollte mich um die Ecke bringen, also hab ich ihr den Spülkasten übern Schädel gezogen. Reine Notwehr, versteht sich. Ich wollte sie bloß ausknocken. Aber ich hab noch nie jemandem einen Spülkasten auf den Schädel gedonnert, da muss ich wohl ein bisschen zu fest zugeschlagen haben«, sagte Minnie knochentrocken. »Jetzt ist sie tot, und ich bin hier.«
Kurz sah Cara zu Barnard.
»Keine Sorge«, sagte Minnie mit einem Lachen, während Cara sie musterte. Minnie musste sehr viel älter sein als Cara, trotzdem hätte sie Cara jederzeit und mit Leichtigkeit überwältigen können, wenn ihr danach war. Bislang aber war sie von ausgesuchter Freundlichkeit. »Ich bin seitdem viel ruhiger geworden. Damals hatte ich eine Menge Ärger.«
»Du hast gesagt, du wärst erst seit zwei Monaten hier«, sagte Cara.
Minnie winkte ab. »Sieh dich um, Lockhart. Die Wände. Siehst du irgendwo Uhren oder irgendwas, was dir die Zeit anzeigen würde? Nein, siehst du nicht. Die Zeit ist in North Fern von genauso großer Bedeutung wie die Freiheit. Vor zwei Monaten könnte hier genauso gut vor fünf Jahren oder heute Morgen gewesen sein. Alles, was wir haben, sind Frühstück, Mittagessen, Tee und die sogenannte Illuminierung. Darum herum müssen wir unser Leben rumkriegen. Zwei Monate. Ein ganzes Leben. Völlig austauschbar. Besonders dann, wenn du die Erste hier warst.«
»Die Erste?«, fragte Barnard und leerte mit einer schwungvollen Bewegung des Löffels ihre Schale.
Minnie lächelte. »Na ja, North Fern ist ja eine tolle neue Einrichtung – jemand muss als Erstes kommen. Eine Weile lang waren nur ich und ein Wärter da. Die ganze Abteilung – nur wir beide. Die meiste Zeit war ich unbeaufsichtigt, was hätte ich schon anstellen können? Es gab nichts zu tun. Also bin ich überall rumspaziert und hab mich sozusagen mit den Geheimnissen des Orts vertraut gemacht. Mit den Stellen, an denen man was verstecken könnte, die von den Überwachungskameras nicht einsehbar sind, Stellen, wo man andere überfallen kann. Und schließlich, als die anderen kamen, war ich in der Lage, eine, na ja, gewisse Position einzunehmen.«
»Eine Position?«, fragte Cara.
»Ja. Die … der Matriarchin, um es mal so zu sagen.«
»Ah«, sagte Barnard und schob ihr Tablett von sich. »Darum geht’s also. Du bist die Mutter, und du bist da, um uns zu sagen, dass wir uns ordentlich benehmen sollen.«
Minnie kicherte. »Nein, nein – missversteht mich nicht. Ich bin hier, um euch einen Gefallen zu tun. Wenn ihr was braucht – irgendwas –, dann bin ich da, um euch die ersten Tage so schmerzfrei wie möglich zu gestalten. Und jetzt …«
»Wie schäbig, Minnie. Sogar für dich.« Die Worte hallten durch den Raum und ließen auch noch die letzten Gespräche verstummen.
Cara fuhr herum. Eine blonde Frau hatte sich von einer kleinen Gruppe gelöst, die sich in der Mitte des Raums gebildet hatte, und kam auf ihren Tisch zu. Einige Schritte dahinter folgte Moyley, die sich alles mit makabrer Faszination ansah.
»Willst du dich wirklich mit dieser Gesellschaft abgeben?«, fragte die andere Frau.
»Liza, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt«, blaffte Minnie und wurde ernst.
»Es ist der perfekte Zeitpunkt«, entgegnete die Blonde und blieb einige Schritte vor dem Tisch stehen. »Die Butcher, wie sie leibt und lebt. Und du lässt dich zum Frühstück bei ihr nieder.«
Cara lief es kalt über den Rücken. Sie kannte das Gefühl gut. Scham.
Liza hatte sich mittlerweile auf einen Stuhl gestellt und wandte sich jetzt an den gesamten Raum. »Eines nur. Nur eine Sache. Wir alle sind hier, weil wir gegen das Gesetz verstoßen haben. Aber manche haben mehr als das getan. Sie haben gegen die menschliche Natur gehandelt.«
Murmelnd stimmten die anwesenden Frauen zu. Alle hatten sich inzwischen zur Gruppe in der Mitte des Raums gesellt. Allmählich bemerkten auch die Wärter, was sich dort zusammenbraute. Cara sah sich um und entdeckte einen sichtlich nervösen Michael. Er näherte sich ihnen.
»Und eine von denen haben wir jetzt mitten unter uns«, verkündete Liza und deutete auf Cara. »Miss Cara Lockhart. Die kleine Miss Butcher. Was haltet ihr davon, Ladys? Wollen wir die gleiche Luft atmen wie so ein Abschaum?«
Von fast allen Frauen kam ein leises Nein. Außer von Moyley, die ihre Ablehnung lauthals herausposaunte. Die Wärter kamen näher.
»Wir alle hier haben lebenslänglich«, antwortete Minnie darauf ganz ruhig, ohne aufzustehen. »Wir sitzen alle unsere Strafe ab, wir sind alle am Arsch. Und sorry, wenn ich das so sage, aber wir sitzen alle im gleichen Boot, Liza.«