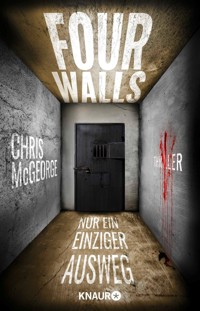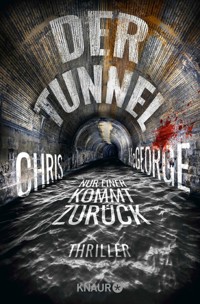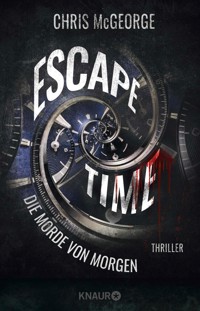
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kannst du der Zukunft entkommen? Rätselhaft, raffiniert und hochspannend: In dem neuen Thriller »Escape Time« hört Shirley Steadman einen Radiosender, der die Zukunft vorhersagt - und einen Mord ankündigt. Es beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit. Shirley Steadman kann kaum glauben, was sie da im Radio hört: lokale Nachrichten, harmlose Unfälle – aber das Datum ist das von morgen! Erst denkt die 70-Jährige noch, dem Piratensender, den sie zufällig entdeckt hat, sei ein Fehler unterlaufen. Doch am nächsten Tag ereignet sich alles exakt wie gemeldet. Kann es wirklich sein, dass jemand die Zukunft vorhersieht? Oder wird sie, die hin und wieder mit ihrem toten Sohn spricht, langsam verrückt? Fasziniert und beunruhigt zugleich schaltet Shirley den Sender immer häufiger ein. Doch dann berichtet der Nachrichtensprecher von einem Mord. Und Shirley ist die Einzige, die ihn verhindern kann … Trickreich spielt der britische Thriller-Autor Chris McGeorge mit der Frage, was passiert, wenn jemand die Zukunft vorhersagt: Scheinbar unerklärliche Ereignisse und zahlreiche Twists erzeugen einen Sog, der immer tiefer in den Thriller hineinzieht und einen atemlos die Seiten umblättern lässt, bis zum fulminanten Showdown. Entdecken Sie auch die anderen Escape-Thriller zum Miträtseln von Chris McGeorge: - Escape Room – Nur drei Stunden - Der Tunnel – Nur einer kommt zurück - Four Walls – Nur ein einziger Ausweg
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Chris McGeorge
Escape Time – Die Morde von morgen
Thriller
Aus dem Englischen von Karl-Heinz Ebnet
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Shirley Steadman kann kaum glauben, was sie da im Radio hört: lokale Nachrichten, harmlose Unfälle – aber das Datum ist das von morgen! Erst denkt die 70-Jährige noch, dem Piratensender, den sie zufällig entdeckt hat, sei ein Fehler unterlaufen. Doch am nächsten Tag ereignet sich alles exakt wie gemeldet. Kann es wirklich sein, dass jemand die Zukunft vorhersieht? Oder wird sie, die hin und wieder mit ihrem toten Sohn spricht, langsam verrückt? Fasziniert und beunruhigt zugleich schaltet Shirley den Sender immer häufiger ein. Doch dann berichtet der Nachrichtensprecher von einem Mord. Und Shirley ist die Einzige, die ihn verhindern kann …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
00.00
01.00
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
01.18
01.19
02.00
00.00 (Neuauflage)
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
03.00
00.00 (Reprise)
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
03.09
03.10
03.11
03.12
03.13
03.14
Epilog
Danksagung
Für jene, die ihren Weg aus der Dunkelheit gefunden haben.
We’ll meet half-past tomorrow
Beneath a joker’s dream.
We’ll forgive the world it’s unjust fun
And say what we really mean
Aus HALF-PAST TOMORROW, CHUTNEY AND THE BOYS (aus dem Album Half-Past Tomorrow, 1984)
00.00
Colm MacArthur
British Royal Navy – Operation Kingmaker (Minensuche)
50 Seemeilen vor der irakischen Küste
Freitag, 12. Oktober 2012
01.12 Uhr
Colm MacArthur hätte eine ganze Woche durchschlafen können. Vor lauter Müdigkeit war er kurz davor, einfach umzufallen. Die Augen waren schwer – er musste sich anstrengen, um sie überhaupt offen zu halten. Nur die kühle Brise im Persischen Golf hielt ihn wach, von dem, was man Willenskraft oder Pflichtgefühl nennen könnte, war schon lange nichts mehr übrig. Vor ihm erstreckte sich eine pechschwarze Nacht – eine Nacht, in der man jede Entscheidung in seinem Leben infrage stellte, die einen an diesen Punkt, genau an diesen Punkt geführt hatte.
Der Tag war anstrengend gewesen, angefüllt mit sinnloser Drecksarbeit, die dem Schiff aber angeblich zugutekam. Er hatte Böden geschrubbt, geputzt, Geschirr gespült – Arbeiten, die in keiner Werbebroschüre der Royal Navy aufgeführt waren. Das alles hatte er nur überstanden, weil ihm eine ungestörte Nacht in Aussicht gestellt worden war.
Deshalb hätte er seinen Freund und Begleiter auf dieser verfluchten Wache, Gabe Steadman, am liebsten über Bord geworfen, als er sie beide freiwillig für die Nachtschicht gemeldet hatte. Gabe hatte ihn aber schließlich überzeugt – sie hatten was wiedergutzumachen, nachdem ihre Craps-Runde unter Deck aufgeflogen war, schließlich sollte ihr Dienst irgendwann vielleicht wieder aus aufregenderen Tätigkeiten bestehen.
Die HMSAevum, das Schiff, das er seit einem Jahr als sein Zuhause bezeichnete, lag ruhig in der schwarzen, stillen Nacht. Neben dem Wind war nur das träge Plätschern des am reglosen Schiff vorbeiströmenden Wassers zu hören. Was kaum Colms Wachsamkeit erhöhte.
Colm und Gabe hatten sich das Deck aufgeteilt. Colm drehte auf der Backbordseite seine Runden, hatte in den drei Stunden, die sie bislang Wache schoben, aber kaum einen ganzen Durchgang geschafft. Er lehnte an der Reling, stierte hinab aufs dunkle Wasser und wusste nicht mal mehr, wie lange er hier schon so stand. Würde ein Vorgesetzter ihn so sehen, würde er sich einen Riesenärger einhandeln, aber die pennten ja alle unter Deck. Außerdem glaubte er nicht, dass dem Schiff irgendeine Gefahr drohte. Der Krieg gegen den Terror war vorbei – und sie hatten gewonnen. Sie waren nur noch das Aufräumkommando.
Gabe brachte für seinen Job anscheinend mehr Enthusiasmus auf. Wenn Colm sich anstrengte, konnte er Gabes Schritte an Deck hören, das er in Fünfzehn-Minuten-Runden auf und ab schritt, auf und ab.
Als hätte er ihn heraufbeschworen, ertönten auf der anderen Seite der Kapitänskabine Gabes Schritte. Colm richtete sich auf. Vielleicht sollte er sich besser wieder in Bewegung setzen. Er streckte sich, zog die Jacke fester um sich und stapfte los.
Dann glaubte Colm zu hören, dass Gabe stehen geblieben war – und etwas sagte.
Colm blieb ebenfalls stehen, lauschte. »Gabe?«
Nichts.
Wahrscheinlich hatte er sich das nur eingebildet.
Insgeheim machte er sich seit einiger Zeit Sorgen um Gabe. Sie waren zusammen aufgewachsen, oben im Nordosten Englands – unendlich weit entfernt. Er kannte Gabes Geschichte, er wusste, dass sein Freund sich nie zur Navy hatte melden wollen. Eine Weile war das für Gabe okay gewesen. Vier Jahre, um genau zu sein. Gabe schien sich damit abgefunden zu haben. Aber jetzt waren wieder diese Schatten in seinem Gesicht, war wieder das Stocken in seiner Stimme. Noch hielt er durch, aber etwas stimmte nicht mit ihm. Und das machte Colm Sorgen.
Vielleicht aber bildete er sich das alles auch nur ein – vielleicht musste er immer alles zu sehr hinterfragen. In Wirklichkeit kam Gabe mit der Navy wahrscheinlich besser zurecht als er selbst. Vielleicht projizierte er auf seinen Freund bloß die eigenen Probleme. Dem eigenem Spiegelbild konnte man ja schlecht Vorhaltungen machen. War er hier unglücklich?
Im Moment auf alle Fälle. Er hasste Nachtwachen, weil absolut nichts los war. Das Schiff lag still, die Luft war feucht, es gab noch nicht mal Eisberge, nach denen man Ausschau halten könnte. Und es war nicht sehr wahrscheinlich, dass man eine Mine sichtete – die waren eher unauffällig.
Wieder fielen Colm die Augen zu. Der Wind strich ihm übers Gesicht, als wollte er ihn in den Schlaf zwingen. Erneut lehnte er sich an die Reling, ließ sich mit dem ganzen Gewicht darauf fallen, spürte, wie er hinausglitt, hinaus und nach unten aufs …
Ein lautes Platschen. Von der anderen Schiffsseite. Das hatte er sich nicht eingebildet.
Colm riss die Augen auf. »Gabe?«, rief er. Schritte waren nicht mehr zu hören.
Vielleicht war nur was ins Wasser gefallen.
Aber wie? Alles war festgezurrt; es war eine ruhige Nacht (eine, in der er liebend gern durchgeschlafen hätte) – und das Schiff lag still.
»Gabe?«
Noch ein Platschen. Leiser.
Irgendetwas stimmte nicht.
Colm drehte sich um. In seinem Kopf eine Menge lächerlicher Vorstellungen, die sich vor allem um Piraten drehten, weniger um Haie.
Wo war Gabe?
Colm ging um die Kabine herum, überquerte die unausgesprochene Grenze zu Gabes Wachabschnitt. Er überblickte die gesamte Länge des Schiffs – nichts, niemand. Keine Piraten. Aber auch kein Gabe.
Etwas stimmte ganz und gar nicht.
Er sah zum Heck. Der Wind wurde stärker, ließ ihn frösteln. Es dauerte viel zu lange, bis sein Gehirn begriff, was er vor sich sah. »Gabe … was zum …?«
Gabe saß auf der Reling, die Beine baumelten über der Schiffsseite. Er hielt etwas in den Händen – etwas Großes, Schweres, um das eine Kette gewickelt war. Die sich hinunter zu seinem Knöchel schlängelte.
Gabe in seiner Navy-Uniform sah ihn an. Trotz seines kahl rasierten Schädels, auf dem sich das Mondlicht spiegelte, trotz seiner müden, alten Augen wirkte er für Colm irgendwie jünger. »Sollte nicht sein«, sagte Gabe. Und dann ließ er das Ding in seinen Händen los, irgendeinen Block, so schwer wie Colms Augenlider. Und Gabe wurde über die Schiffsseite nach unten gerissen. Ein lautes Platschen. Dann noch eins.
Colm sprang zur Reling. »Gabe!« Vor einer Sekunde war sein Freund noch hier gewesen. Er sah hinunter aufs Wasser. Sein Freund blickte zu ihm hinauf, bevor er in die Tiefe gerissen wurde. Es sah so aus, als würde Gabe lächeln.
Von jetzt an würde Colm MacArthur nie mehr gut schlafen.
01.00
Die Vergangenheit im Rauschen
01.01
Shirley Steadman
Chester-le-Street, Nordosten von England
Dienstag, 9. Februar 2021
19.05 Uhr
»Oh, meine Liebe, was für ein Anblick für meine müden Augen«, kam es von Harold, als sich ihm Shirley mit ihrem Ausweis und Klemmbrett näherte. Schon bei ihren letzten drei Besuchen auf der Station hatte Harold hier gelegen und sie ins Herz geschlossen – so wie sie ihn. Sie wusste nicht unbedingt, was ihm fehlte, trotz seines fixierten Arms, denn das Reden war ihm immer schwergefallen, immer kam er sofort außer Atem, als wäre er sein Leben lang bergauf gelaufen. »Jedes Mal, wenn ich dich sehe, siehst du jünger aus.«
»Harold«, erwiderte Shirley und klopfte lachend auf das Klemmbrett. »Ich bin kaum jünger als du.«
»Kann schon sein, meine Holdeste. Trotzdem siehst du aus, als wärst du keinen Tag älter als zwanzig«, gluckste er.
»Das reicht jetzt«, erwiderte Shirley in dem Befehlston, den sie sich bei der Erziehung ihrer Kinder angewöhnt hatte, und klickte mit ihrem Stift. »Was darf’s heute sein?«
»Hmmm …« Harold tat so, als müsste er erst nachdenken. Wahrscheinlich hätte er sich auch übertrieben am Kinn gekratzt, wenn sein Arm nicht in einer Schlinge gesteckt hätte. »Was von Bowie, ja. Das über den Typen im Weltraum.« Auch sein Gedächtnis war nicht mehr das beste. Aber das konnte Shirley ihm kaum vorwerfen – ihres hatte auch schon bessere Tage erlebt.
Shirley nickte und schrieb »Harold« und »Space Oddity« auf das Blatt auf dem Klemmbrett. »Ground Control to Major Tom?«
»Aye, genau«, rief Harold und stimmte auch schon den Refrain an.
Shirley lächelte und ließ ihn die Strophe zu Ende singen. »Wem ist es gewidmet?«, fragte sie.
»Na, dir natürlich«, kicherte Harold.
»Harold!«, wies Shirley ihn zurecht.
»Na gut. Dann eben meiner Frau.«
»Schon besser«, sagte Shirley und notierte es in der Widmungsspalte des Formulars. »Brauchst du Hilfe für die Kopfhörer, damit du zuhören kannst?«
»Aye, wenn du das machen könntest.«
Shirley ging ums Bett herum, darauf bedacht, keinem der Kabel oder Geräte zu nahe zu kommen. Der kleine Fernseher war zur Wand hin gedreht. Sie schwang ihn herum, löste den Kopfhörer – so einer, wie sie auch in Flugzeugen verteilt wurden – und setzte ihn Harold auf. Dann stellte sie das Gerät auf den Radiomodus und schaltete zum Kanal 5. »So. Ab Viertel nach acht bin ich auf Sendung.«
»Du bist ein Schatz, meine Holdeste«, sagte Harold und zwinkerte ihr zu.
Shirley lächelte, war allerdings auch ein wenig besorgt, nachdem sie gerade gesehen hatte, dass Harold am Tropf hing. Der Infusionsständer war letzte Woche noch nicht da gewesen. Irgendwas stimmte wirklich nicht mit ihm, er hatte nicht nur einen gebrochenen Arm.
Sie verabschiedete sich und verließ das Zimmer.
Die Patienten der Abteilung 14 hatten sich diesmal selbst übertroffen. Sonst waren sie dort nie besonders aufgeschlossen – es handelte sich um die Orthopädieabteilung, auf der meistens ältere Patienten lagen oder solche, die auf Radiowunschkonzerte keine große Lust hatten. Heute aber hatten sie ein buntes Potpourri an Titeln zusammengestellt. Klar, es wurden die alten Hits verlangt – ein Älterer mit einem Bein in der Schlinge hatte sich für seine Frau »My Way« gewünscht, eine junge Frau »Wannabe« von den Spice Girls für ihre Tochter, und eine Frau in Shirleys Alter wollte was von Vera Lynn, was sehr nett, aber auch sehr typisch war. Es gab aber auch einige ausgefallene Wünsche – einen Song über einen Baggerlader, von dem sie noch nie gehört hatte, dazu Rap von einem Childish Gambino (der Name war ihr geläufig, sie kannte aber kein einziges Stück von ihm) und noch etwas von einem Wise Kalifer (sie hoffte, den Namen richtig geschrieben zu haben). Sie war überzeugt, dass einige dieser Songs unanständige Ausdrücke beinhalteten, aber sie hatten ja die fürs Radio bearbeiteten Versionen auf Lager, es spielte also keine Rolle.
Am Ende ihrer Tour durch die Abteilung sah sie gewohnheitsmäßig bei der Schwesternstation vorbei und fragte dort nach, was sie hören wollten. Die Schwestern, mittlerweile alle jünger als ihre eigene Tochter, einigten sich nach kurzem Nachdenken auf »I gotta get out of this place«. Shirley lachte, als hätte sie diese Bitte zum ersten Mal gehört, und notierte es auf ihrem Klemmbrett. Sie dankte den Schwestern, verließ die Abteilung und ging langsam zu den Aufzügen. Dort stand sie dann, während ihr Finger schon vor den Knöpfen schwebte. Aber dann zog sie die Hand zurück. Sie musste an Marsha aus ihrer Stickgruppe denken, die von sich gesagt hatte, sie fühle sich immer so steif, weil sie sich nie körperlich betätige. So weit wollte Shirley es nicht kommen lassen. Also nahm sie die Treppe.
Eine Gruppe von Schwestern kam ihr im langen Korridor entgegen, unter ihnen, wie sie bestürzt feststellte, eine junge Frau mit roten Haaren. Callie. Sie wollte den Kopf schon wegdrehen, als sie aneinander vorübergingen, trotzdem trafen sich ihre Blicke. Und sofort war wieder das schlechte Gewissen da, das sie immer hatte, wenn sie Callie über den Weg lief. Shirley hoffte nur, wenigstens Callie würde sich freuen, sie zu sehen. Musste das immer so sein? Sie wusste, dass Callie im Krankenhaus arbeitete, aber irgendjemand da oben musste es auf sie abgesehen haben. Sie ließ sich damit mal wieder den ganzen Abend ruinieren – früher hatte sie gedacht, sie hätte es nicht anders verdient, in gewisser Weise dachte sie das immer noch, aber dann schob sie ihr schlechtes Gewissen beiseite und ging weiter.
Als sie im Studio eintraf, war sie leicht außer Atmen, ihre Beine pochten und würden morgen wieder schmerzen. Das konnte man dann fast als das Gegenteil vom Steifsein bezeichnen, und damit war es wohl wieder okay. Sie gab den Schlüsselcode ein, trat in den kleinen Raum, der in einem vergessenen Krankenhaustrakt lag, und hörte aus Studio eins Ken Vox’ vertraute Stimme.
In dem kleinen Raum hatte ein Inneneinrichter/Zauberer eine kleine Aufenthaltsecke mit Stühlen und einem Computer untergebracht, daneben einen abgetrennten Lagerbereich mit alten Vinylplatten und dazu noch zwei schalldichten Studios. Shirley ging zum Studio zwei, stellte auf dem Weg dorthin den Wasserkocher an und ließ sich in dem winzigen Kabuff nieder, hinter einem großen, teuren Mischpult mit Hunderten von Knöpfen und Schiebereglern – von denen jeder Mitarbeiter des Krankenhausfunks nur so an die fünf benutzte.
Sie sah durch die Glastrennscheibe zwischen den beiden Studios ins Studio eins. Natürlich war es leer. Ken Vox gehörte seit zwei Jahren nicht mehr zum Radioteam des Chester-le-Street Hospital. Er war von Metro Radio, einem »richtigen« Hörfunksender, übernommen worden. Aufgrund eines juristischen Hintertürchens durften sie hier allerdings immer noch seine alten aufgezeichneten Sendungen abspielen, die in Endlosschleife liefen, bis einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter live auf Sendung ging.
Früher hatte sich an den Dienstagabenden immer ein großes Team eingefunden – mittlerweile war nur noch Shirley übrig. Aber das war ihr egal.
Sie schaltete den Computer an und suchte sich die Hörerwünsche zusammen. Eine Viertelstunde und eine Tasse Tee später hatte sie alles gefunden (Wise Kalifer hieß richtig Wiz Khalifa, und viele der Songs kamen ihr als recht anstößig vor) und in das entsprechende Computerprogramm eingegeben. Sie schickte die Playlist ins Studio eins, wo sie weitermachen würde. Bevor sie auf Sendung ging, musste sie nur noch einen Song finden, der nicht auf dem Computer gespeichert war, den sie aber auf Vinyl hatten. Dafür blieben ihr vierzig Minuten, also schaltete sie den Wasserkocher wieder an und schlenderte zum Lagerbereich.
Regale voller Schallplatten säumten sämtliche Wände, außer die linke Seite, wo sich alte Geräte stapelten. Die LPs waren anhand kleiner Zettel alphabetisch geordnet. Wollte man erfahren, wo man sich innerhalb des jeweiligen Buchstabens befand, musste man die einzelnen Platten herausziehen – es war also auch immer ein kleines Ratespiel. Shirley griff in die obere Regalreihe und ging die Titel unter C durch.
Sie suchte eine LP der Rockband Charlie. Sie hatte nie von ihr gehört, und der Mann, der sie sich gewünscht hatte – sein Hals steckte in einer Stützkrause –, hatte ihr freudig kurz deren Geschichte erzählt. Eine UK-Band, in den Siebzigern gegründet, vier Mitglieder, zehn Alben, immer noch aktiv (anscheinend). Informationen, die sie nicht behalten würde – und die sie auch nicht behalten hätte, als ihr Gedächtnis noch besser gewesen war –, die aber auch mit ein Grund waren, warum sie den Job hier machte. Es gefiel ihr, wie Menschen innig an etwas festhielten, was ihr, Shirleys, Leben nie im Geringsten berührt hatte. Für sie war das immer auch eine Erinnerung daran, wie groß die Welt in Wirklichkeit war.
Nach einigen Fehlgriffen entdeckte sie schließlich Charlies Titelalbum, auf dem sich laut Computer der gewünschte Song befand. Zufrieden nahm sie die Platte heraus, legte sie aufs untere Regal und zog zur Hälfte die nächste Platte heraus, damit sie wusste, wo sie sie später wieder reinschieben musste.
Kurz hielt sie inne. Die nächste LP – Half-Past Tomorrow. Chutney and the Boys. Das vertraute Cover mit der ägyptischen Sphinx, die eine Siebzigerjahre-Sonnenbrille trug – dazu Chutney und ihre Boys darauf gruppiert, die mit ihren Gitarren abrockten. Sie hatte es lange nicht mehr gesehen.
Sie trat zurück und merkte, wie sie am ganzen Körper leicht zitterte. Unauslöschliche Erinnerungen kamen hoch. Gabe als Kind, auf seinem Bett auf und ab hüpfend, in den Händen einen Besen als Gitarrenersatz, und wie Chutney wild darauf herumklampfend. »Half-Past Tomorrow«, sein Lieblingslied, das er unaufhörlich spielte – seltsamerweise der einzige langsame Song auf dem Album, zu dem das wilde Gehampel gar nicht gepasst hatte.
Gabe.
Wie alles wohl wäre, wenn …?
Der Wasserkocher pfiff.
Shirley blinzelte die Vergangenheit fort.
Sie machte sich eine Tasse Tee und trug die Charlie-LP zum Computer im Eingangsbereich. Immer noch zu viel Zeit. Ken Vox quasselte vor sich hin und inszenierte sich in seinem herben Charme, der ihm einen richtigen Job als Radiomoderator eingetragen hatte. Sie hatte noch Zeit; Zeit für etwas, was ihr guttun würde.
Wieder ging sie ins Lager, diesmal aber nach links zu den ausrangierten Geräten. Sie griff sich den Karton ganz oben – wie sie es jede zweite Woche machte –, brachte ihn mitsamt ihrer Tasse ins Studio zwei, stellte ihn auf den Tisch und öffnete ihn. Darin befand sich ein alter Rundfunkempfänger, der wahrscheinlich viel größer war als jedes Gerät, das es im letzten Jahrhundert gegeben hatte.
Sie schaltete ihn an und schloss ihn, für einen besseren Sound, ans Studiomischpult. Sofort war das Studio von einem harten Rauschen erfüllt – einem Rauschen, wie man es bei modernen Radios gar nicht mehr zu hören bekam. Ein Gefühl von Wärme umfing sie, von Nostalgie und Sehnsucht – ein Gefühl, das einen aus der Gegenwart riss und in glücklichere Zeiten zurückkatapultierte. In den siebzig Jahren, die Shirley auf dem Buckel hatte, war ihr kein Geräusch so tröstlich erschienen wie das statische Rauschen im Frequenzbereich zwischen den einzelnen Radiostationen.
Sie drehte am Frequenzknopf, Stimmen erklangen und verstummten wieder. Tyneside auf 93,5, BBC Newcastle auf 95,4, Metro Radio und viele andere. Die Sender kamen und gingen. Am Ende der Skala schaltete sie auf das AM-Band um und begann von Neuem. Hier war sehr viel weniger los – AM-Stationen wurden zunehmend dichtgemacht, und die, die man noch empfangen konnte, waren oft nur BBC-Sender auf anderen Frequenzen. Aber sie suchte auch gar keinen Sender – sie suchte einen wunderbaren Abschnitt mit Rauschen.
Sie fand einen. Sie stülpte sich den durchgeschwitzten, am Mischpult angeschlossenen Kopfhörer über, lehnte sich zurück – und schloss die Augen.
Wenn man so lange gelebt hatte wie Shirley, musste man sich an den kleinen Dingen erfreuen. Und das hier war eines davon. Eine halbe Stunde Ruhe und Frieden zwischen dem Zusammentragen der Wünsche und ihrer Moderation; eine halbe Stunde, in der sie sich zurücklehnen, dem Rauschen zuhören konnte und in der sie gar nicht existierte. Sie bekam den Kopf frei: kein Bob, keine Deena und die Kids, kein Gabe – nur Rauschen.
An den kalten Abenden, wenn sie allein in diesem Studio saß, allein mit ihren Gedanken, dann war es leicht, in der Vergangenheit zu leben. Sieben Jahrzehnte hatte sie hinter sich, sieben Jahrzehnte an Entscheidungen, sieben Jahrzehnte voller Fehler und Missgriffe und Irrtümer – daran konnte so mancher zerbrechen. Ihr Körper verriet sie – die Treppenstufen, die sie sich hochgemüht hatte, dürften sie (wahrscheinlich) bis nächste Woche außer Gefecht setzen, ihre Knochen schmerzten und fühlten sich an wie Glas, manchmal tat es schon weh, wenn sie nur atmete. Das Aufstehen am Morgen fiel ihr immer schwerer, nachts schlief sie immer schlechter ein. Nach Maßgabe der Evolution hatte sie lange genug gelebt. Sie hatte die Phase ihrer Nützlichkeit für ihre Spezies längst überschritten. Sie befand sich in der Nachspielzeit.
Es war ihr wichtig, nicht in der Vergangenheit zu leben. Aber das hieß nicht, dass sie es nicht konnte.
»… Zukunft …«
Eine Stimme? Sie schlug die Augen auf und sah zu dem alten Radio. War da was im Rauschen? Vielleicht nur eine Frequenzschwankung – so alte Empfänger waren manchmal sehr launisch.
Shirley richtete sich auf – achtete nicht auf das Stechen im Rücken – und sah nach, auf welcher Frequenz sie war. 66,2AM. Keine Radiosender weit und breit. Vielleicht hatte sie sich das nur eingebildet.
»… dann …«
Dieselbe Stimme.
Shirley setzte die Brille auf, die sie um den Hals hängen hatte. Ganz langsam drehte sie den Knopf. 66,1. Nichts. 66,0. Nichts. Dann in die andere Richtung. 66,3. »… macht sich davon …« Die Stimme wurde lauter. Klarer. 66,4. »… Newcastle. Die Meute hetzt los, und wir auch.«
66,4. Da war was. Ein Sender, der nirgendwo verzeichnet war. Ein Piratensender. Einer, der bislang nicht da gewesen war.
Sie lächelte. Piratensender, ein interessantes Konzept. Ein Radioprogramm, das von einer Einzelperson oder einer kleinen Gruppe mit privater Ausrüstung gesendet wurde. Die Idee war älter als sie, und das wollte was heißen. Das Signal musste ganz aus der Nähe kommen – wie es bei Piratensendern oft der Fall war. Der Empfang war schwach, trotz der Anlage des Krankenhausfunks, die den alten Rundfunkempfänger verstärkte. Die Stimme schwankte, wurde verzerrt, änderte die Lautstärke. Und sie klang seltsam, als würde sie absichtlich verfremdet und durch einen Computer gejagt. Shirleys Interesse war geweckt.
Sie drückte sich den Kopfhörer noch fester auf die Ohren. »Na, sieht so aus, als wär’s mal wieder an der Zeit für die Nachrichten. Wer Neues über Chester-le-Street und Umgebung hören möchte, ist nirgends besser aufgehoben als auf 66,4 Mallet AM.«
Mallet AM. Und er hatte auch noch einen Nachrichtenteil. Er hörte sich an wie ein richtiger Radiosender. Ein ambitioniertes Unternehmen. Wer immer dahintersteckte, er machte einen guten Job. War es ein Mann oder eine Frau, einsam und gelangweilt, der oder die sich den Spaß gönnte? Oder irgendwelche Kids, die herumexperimentierten? Egal, Shirley war froh, zuhören zu dürfen.
»Heute ist der zehnte Februar«, fuhr die Stimme fort, »dann mal los. Viel gibt’s allerdings nicht zu vermelden, weil eben nicht viel passiert ist. Da in den letzten Wochen die Hundehäufchen im Chester Park zugenommen haben, hat Parkverwalter Art Fowler Schilder aufgestellt, um die Vierbeiner von diversen Grünflächen fernzuhalten. Prompt wurde eines der Schilder von Fiona Smith’ Dackel Rodney bepinkelt. Unklar ist allerdings, ob Art Fowler diesen unerhörten Regelverstoß bemerkt hat – aber seid versichert, wir werden an diesem Thema dranbleiben, falls es mehr dazu gibt.«
Shirley lachte und klatschte in die Hände. Es hörte sich wie eine richtige Nachrichtensendung an. Was für ein Spaß. Genau das, was sie brauchte – der Sender war einfach köstlich.
»Immobilienpreise in Chester-le-Street sind in letzter Zeit gestiegen. Viele Geschäfte hatten im vergangenen dunklen Jahr schwere Zeiten zu überstehen – der Immobilienmarkt ist keine Ausnahme. Nach mehreren hitzigen Debatten in der örtlichen Kommunalverwaltung hat der Parlamentsabgeordnete Ralph Harver mit dem Immobilienkonzern Havanna Housings eine Vereinbarung geschlossen, die darauf abzielt, die Gegend für neue Anwohner attraktiv zu machen. Das scheint zu funktionieren, der Immobilienmarkt hat tatsächlich wieder angezogen. Allerdings so sehr, dass es jetzt den Anschein hat, als wäre das Freizeitzentrum in Chester-le-Street ernsthaft in Gefahr, geschlossen und abgerissen zu werden.
Mallet AM hat bei Harver angefragt, um zu erfahren, ob dem Freizeitzentrum das gleiche Schicksal blüht wie so vielen anderen Freizeiteinrichtungen in der Stadt. Jedenfalls wäre es ein schwerer Schlag für die Gemeinde, vor allem für die jungen Familien, für die Mitarbeiter des Freizeitzentrums und für alle, die dort eifrig zum Schwimmen gehen. Sollte sich Neues ergeben, werden wir natürlich davon berichten.«
Shirley runzelte die Stirn. Sie hatte bislang nicht gehört, dass die Chester Baths (wie die Einheimischen das alte Gebäude zwischen dem unteren Ende der Front Street und dem Park nannten) von der Schließung bedroht waren. Sie war mit den Kindern häufig dort gewesen und sah sie noch, umhüllt von dickem Chlorgeruch, im Kinderbecken planschen, unter den von der Decke hängenden Deko-Schmetterlingen und den an die Wände gemalten Cartoon-Tieren mit ihrem übertriebenen Lächeln. Es wäre sehr schade, wenn das Gebäude wirklich abgerissen würde.
Der Moderator fuhr fort: »Und zum Schluss: Seb Starith, Inhaber der gleichnamigen Bäckerei in der Front Street, ist heute um 12.17 Uhr aus fast einem Meter fünfzig Höhe von der Leiter gestürzt, als er vor seinem Laden ein neues Schild anbringen wollte. Er hat sich dabei eine Verletzung am Steißbein zugezogen und wurde zur Untersuchung ins Chester-le-Street Hospital gebracht, wo er mindestens eine Nacht verbringen wird. Noch ist unklar, ob er sich etwas gebrochen hat, unbestätigten Aussagen zufolge dürfte das allerdings der Fall sein. Auch hier werden wir euch auf dem Laufenden halten.«
Seltsam. Shirley hatte gar nichts davon gehört, obwohl sie am Nachmittag in der Front Street gewesen war. Auch niemand aus ihrer Stickgruppe hatte etwas erwähnt, und diese Frauen waren sonst immer für Klatsch und Tratsch zu haben, ganz besonders Marsha. Und überhaupt, Shirley war direkt an der Bäckerei vorbeigegangen und hatte dort nichts Ungewöhnliches bemerkt.
»Die Bäckerei wird in der Zwischenzeit von Starith’ Enkeltochter weitergeführt, die die üblichen Öffnungszeiten beibehalten will.«
Vielleicht war das der Grund. Shirley war gegen 3 Uhr dort gewesen. Vielleicht war der arme Seb da schon ins Krankenhaus gebracht worden und seine Enkelin hatte bereits im Laden gestanden. In den Shirley keinen Blick geworfen hatte. So musste es wohl gewesen sein.
»Wir melden uns morgen wieder zur gleichen Zeit mit neuen Nachrichten, jetzt aber eine weitere Stunde mit gefühlvoller und vor allem lizenzfreier Musik. Und los.« Nach einigen Sekunden Stille erklang in ihren Kopfhörern schmalzig-seichte Musik, wie man sie in Hotelaufzügen oder Kaufhäusern zu hören bekam.
Shirley lauschte ein, zwei Minuten, hoffte, noch mehr zu hören, wusste aber, dass sich der Moderator verabschiedet hatte. Sie nahm den Kopfhörer ab.
66,40 Mallet AM. Was für ein Glücksfall. Und ein relativ professionelles Auftreten. Wer immer dahinterstehen mochte, der am Mikro verstand jedenfalls sein Handwerk. Er oder sie würde für jedes Radioteam eine Bereicherung sein – er kannte sich mit der Technik besser aus als die meisten ehrenamtlichen Mitarbeiter. Ein Piratensender in dieser Zeit – wie einzigartig. Sie musste unbedingt Deena davon erzählen, wenn sie zu Besuch kam.
Sie notierte sich die Frequenz auf einem Zettel. Erst dann sah sie auf die Uhr.
Verdammt! Keine fünf Minuten mehr. Sie hatte ihre eigene Sendung ganz vergessen. Sie stand schnell auf, griff sich die Wunschliste, die Charlie-LP und ihren kalt gewordenen Tee. Sie trat ins Studio eins und machte es sich auf dem Stuhl bequem. Ken Vox war bereits in seiner Abmoderation. Sie bereitete sich darauf vor, ihn aus- und sich selbst einzublenden.
Im Kopf ging sie ihre übliche Einleitung durch. Datum, Wochentag, ein Kommentar zu einer witzigen Sache, über die sie zufällig in der letzten Woche gestolpert war, dann sofort zu den wunderbaren Wünschen der Abteilung 14. Der Gedanke, dass sie irgendwo Fans hatte, gefiel ihr, auch wenn eine feste Zuhörerschaft im Krankenhaus, wo sich das Publikum stündlich ändern konnte – von einer Woche auf die nächste ganz zu schweigen –, doch ziemlich unwahrscheinlich war. Trotzdem stellte sie es sich gern vor – und ihre Eröffnungsnummer war genau das, was ihre Fans von ihr erwarten würden.
Sie hatte sich ihre witzige Tatsache schon zurechtgelegt: Wussten Sie, dass die wissenschaftliche Bezeichnung für Kältekopfschmerz sphenopalatine Ganglioneuralgialautet? Sie hatte den Satz vor dem Spiegel vier- oder fünfmal aufsagen müssen, bis er saß.
Sie war also bereit. Außer …
Sie fuhr den Computer hoch und überprüfte das Datum.
Und dann wunderte sie sich. Mit dem Nachrichtenteil von Mallet AM hatte etwas nicht gestimmt. Der Moderator des Piratensenders hatte gesagt, er bringe die Nachrichten für den zehnten Februar.
Aber, und das war jetzt sehr sonderbar, es war doch erst der neunte.
01.02
Chester-le-Street
Dienstag, 9. Februar 2021
22.22 Uhr
Shirleys kleiner Bungalow lag keinen Kilometer vom Krankenhaus entfernt zwischen der Front Street und einer dicht bebauten Gegend, die nur als »die Avenues« bekannt war. Shirley wohnte am Rand davon, für Deenas Geschmack aber immer noch viel zu nah. Deena hatte ihr von dem Bungalow abgeraten. Die Avenues hatten keinen guten Ruf, aber das war Shirley egal. Sie wollte unbedingt raus aus dem großen Haus, das Bob in Houghton-le-Spring gekauft hatte und in dem sie zum Schluss nur noch allein herumgegeistert war. Sie hatte sich etwas Geeigneteres, Kleineres suchen müssen.
Moggins begrüßte sie mit einem Greinen und Schnurren. Moggins war eine sieben Jahre alte, weiß getigerte Norwegische Waldkatze. Der Kater war ein Einzugsgeschenk von Deena und damit Sinnbild des steten Wunsches ihrer Tochter, sich um sie kümmern zu wollen. Was Shirley natürlich nicht Moggins vorwerfen konnte.
»Na, mein Lieber«, sagte sie zur Katze, die sich an ihren Knöcheln rieb. »Du willst dein Abendessen, was?«
Lächelnd zog sie die Schuhe aus, schlüpfte in ihre Schlappen und ging durch den Flur in die Küche. Alles in dem Haus war klein, die Wege waren kurz, nicht unähnlich dem Kabuff im Krankenhaus, das als Studio firmierte. Die Küche war kompakt, das Wohnzimmer heimelig, das einzige Schlafzimmer eng und das Badezimmer ausreichend. Lediglich in den beiden Fluren konnte sie größere Strecken zurücklegen, und selbst die waren gering verglichen mit den Entfernungen, die sie im alten Haus zu bewältigen gehabt hatte.
Und keine Treppen, was ein fortwährender Segen war, nachdem sie sich einmal die Hüfte geprellt hatte, als sie ins Stolpern geraten und gegen die Küchenanrichte geknallt war. Hätte sie noch im alten Haus gewohnt, hätte sich Deena wahrscheinlich so große Sorgen gemacht, dass sie gleich mit der ganzen Familie eingezogen wäre. Hier aber, unter den beengten Verhältnissen, hatte sie sich allein erholen dürfen, nur in der Obhut von Moggins, ihrer einzigen Pflegekraft.
Sie schaltete das Licht in der Küche an. Zwei Seiten des Raums wurden von Schränken und Haushaltsgeräten eingenommen. Herd, Waschmaschine, Geschirrspüler, Spüle. Nichts Aufsehenerregendes. Das Übrige war Essbereich, hier hatte sie auch ihr Bügelbrett, ansonsten am Fenster einen kleinen Esstisch mit zwei Stühlen. Nicht viel, aber es war ihr Zuhause. Es mochte an ihren alten Gewohnheiten liegen, aber in der Küche fühlte sie sich am wohlsten.
Sie beschäftigte sich gern. Auch wenn sie sich in letzter Zeit vermehrt den Verlockungen des ganztägigen Fernsehprogramms und der urbritischen Tätigkeit des »Füßehochlegens« ergeben hatte, fühlte sie sich weitaus lebendiger, wenn es »was zu tun gab«. Deshalb war ihre Woche auch ziemlich voll – Krankenhausfunk, Stickgruppe, daneben ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Tierschutzorganisation RSPCA, dazu kamen Essenstafeln, und manchmal war sie Babysitterin für ihre Enkel. Fast so, also wollte sie dem Typen da oben klarmachen, dass sie noch nicht gedachte abzutreten. Sie war zwar Rentnerin, und sie leistete vielleicht auch nichts, was einmal in die Geschichtsbücher eingehen würde, aber sie konnte trotzdem noch Gutes tun.
Mit einem Nicken holte Shirley eines von Moggins’ Lieblingsfressen aus dem Schrank: Lachs mit Rindfleisch. Theoretisch eine grauenhafte Zusammenstellung, aber eigentlich roch es gar nicht so übel.
Moggins sprang auf die Anrichte, als sie das Päckchen in seine Schale drückte.
»Hier, mein Herr. Friss nicht alles auf einmal.«
Auch wenn es so aussah, als hätte sich Moggins genau das vorgenommen.
Sie schaltete den Wasserkocher an und drehte die Heizung auf. Alt sein hieß, dass einem ständig kalt wurde. Sie hörte, wie im stillen Haus die Flamme der Therme ansprang.
Frieden.
»Hallo, Shirley.«
Hinter ihr. Im Zimmer. Sie zuckte nicht zusammen. Nicht mehr. Tatsächlich tat sie das Gegenteil – sie erstarrte. Nur ihr Herz machte einen Sprung. Die vertraute Stimme. Die Stimme, die sie am besten kannte. Die Stimme, die sie in ihren Träumen hörte.
Sie drehte sich um. Dort saß er, am Küchentisch – so, wie er jetzt wohl aussehen würde. Rasierter Schädel. Stoppeln. Fältchen, die davon zeugten, wie viel er gelächelt hatte, als er noch am Leben gewesen war. »Hallo, Gabe.« Unwillkürlich musste sie lächeln, obwohl sich ihre Augen mit Tränen füllten.
Sie fing sich schnell, drehte sich zum Wasserkocher um, holte eine weitere Tasse aus dem Schrank – Gabes Doctor Who-Tasse in TARDIS-Gestalt – und machte frischen Tee. Sie trug beide Tassen zum Küchentisch und stellte ihm seine hin.
Moggins lief aus dem Zimmer, zweifelsohne verstand er nicht, was hier vor sich ging, verstand nicht, mit wem Shirley redete. Shirley verstand es selbst nicht. Sie wusste nur, vor etwa einem Jahr war Gabe mit einem Mal aufgetaucht und hatte sie … »besucht«, wie sie es nannte. Und sie wusste … wusste, dass das alles nicht … real war … aber das bedeutete nicht, dass es das nicht war … Es war kompliziert.
Sie setzte sich. »Du bist da.«
Gabe sah sie an – er lächelte nicht, runzelte nicht die Stirn. Er sah in sie hinein. »Warum machst du das?« Er klang genau … ja, er klang genau wie er.
»Was?«, sagte sie.
»Warum machst du mir einen Tee? Jedes Mal.« Das Einzige war: Manchmal kam ein kurzes Zögern, wenn er etwas sagte, so, als würde Shirleys Unbewusstes erst dahinterkommen müssen, wie ihr Sohn es sagen würde, was er sagte.
»Ich bin jetzt alt«, erwiderte Shirley. »Das machen die alten Leute so. Sie bieten ihren Gästen eine Tasse Tee an.« Es stimmte. Ihr Leben bemaß sich nach der Anzahl heißer Getränke.
»Vermutlich«, sagte Gabe, fast wie in einem Traum. »Aber du weißt doch, dass ich nichts trinke. Ich kann nichts trinken.«
Shirley schluchzte auf. Sie griff in ihrer Tasche nach einem Taschentuch, fand aber keins. Es gab welche in der Schublade neben der Spüle, aber sie wollte sich nicht abwenden, solange er da war. Manchmal verschwand er dann einfach – manchmal verließ sie kurz das Zimmer, und wenn sie zurückkam, war er nicht mehr da. Sie wusste nicht, nach welchen Regeln das geschah, aber sie wollte ihn zur Sicherheit nicht aus den Augen lassen. »Nur so eine Angewohnheit.«
»Wie geht es dir, Shirley?«, fragte Gabe.
»Kannst du mich Mum nennen?«
»Willst du, dass ich dich Mum nenne?«
»Nicht, wenn du es nicht willst.«
»Shirley«, sagte Gabe und hielt kurz inne, als hätte er es ihr schon tausendmal erklärt. Was er tatsächlich auch hatte. »Ich kann nur das tun, was du mich in deinen Gedanken tun lässt. Du weißt doch, wie es funktioniert. Ich nenne dich Mum, wenn du meinst, dass ich es tun soll.«
Shirley dachte darüber nach. So wie immer. Nichts davon war ihr neu. Nur glaubte sie, dass ihre Antwort diesmal anders ausfallen könnte, aber dem war nicht so. »Nein. Lass es.«
»Warum?« Er klang ruhig, heiter. Vielleicht sogar so, als wäre er mit sich im Reinen.
Shirley lächelte durch ihre Tränen hindurch. »Ich habe es nicht verdient.«
Gabe reagierte nicht, sondern betrachtete nur seine dampfende Tasse Tee. »Gut. Also, wie geht es dir, Shirley?«
»Heute ist was passiert, im Studio. Ich hab dir erzählt, dass ich für den Krankenhausfunk arbeite, oder?«
Gabe nickte.
»Na ja, ich war mit den Vorbereitungen zum Wunschkonzert fertig und hab an einem alten Rundfunkempfänger rumgespielt. Und dabei bin ich auf einen merkwürdigen, aber sehr beeindruckenden Piratensender gestoßen. Nennt sich Mallet AM. Durchs Programm führt eine Art Computerstimme. Im Grunde läuft nur Musik. Aber als ich eingeschaltet habe, kamen zufällig Nachrichten. Die im Nachhinein aber ziemlich seltsam waren. Denn der Moderator hat sich im Datum geirrt, es war fast schon komisch. Es war so, als hätte er die Nachrichten von morgen vorgelesen. Wahrscheinlich war das bloß ein Irrtum. Bloß ein Irrtum – es war nur seltsam, weil der Rest sehr professionell rüberkam. Fast, als würde man einem richtigen Radiosender zuhören.«
»Wie interessant«, kam Gabes monotone Stimme.
»Das denkst du jetzt nicht.«
»Ich denke das, was du denkst. Wenn es dir wichtig ist, ist es auch mir wichtig.«
»Ist doch merkwürdig, oder?«, sagte Shirley. Nicht zum ersten Mal wünschte sie sich, sie würde mit dem richtigen Gabe sprechen. Nicht mit dieser … Hülle. »Ich bin sehr beeindruckt. Hoffentlich ist er wieder auf Sendung, wenn ich das nächste Mal im Studio bin. Ich würde gern wissen, wer den Sender betreibt – er muss ganz in der Nähe sein, Piratensender haben keine große Reichweite. Ich würde ihn gern kontaktieren und ihm sagen, dass ich die Sendung sehr genossen habe.«
»Aber du hast die Stimme nicht erkannt?«
»Ich sagte doch, es war eine Computerstimme, irgendwie verzerrt.«
»Aber du hast nicht irgendwelche Eigenheiten wahrnehmen können? Einen Dialekt vielleicht?«
Seltsam, dass er so was fragte. »Was willst du mir damit sagen?«, fragte Shirley.
Gabe blinzelte. »Was willst du dir selbst damit sagen?«
»Ach, das weiß ich nicht.« Shirley warf die Hände in die Luft und gluckste. »Keine Ahnung.«
Auch Gabe gluckste. »Dann hab ich auch keine Ahnung.«
Sie lachten beide. Shirley nippte an ihrem Tee, Gabe sah auf seinen. Bis sie sich beruhigt hatte und den rosa Elefanten im Zimmer ansprach. »Was passiert hier?«
Gabe schwieg.
»Du bist nicht hier. Du kannst nicht hier sein.«
Keine Reaktion.
Shirley musste schlucken, plötzlich fühlte sie sich sehr müde. Es war ein langer Tag gewesen, und sie kam zu dem Schluss, dass man nichts beschönigen sollte, wenn man über einen Tisch mit zwei Tassen Tee hinweg mit sich selbst redete. »Werde ich verrückt? Hat sich mein Verstand verabschiedet?«
Gabe starrte sie an. »Meinst du, du wirst verrückt?«
»Nein.«
»Dann bist du es vielleicht nicht.«
»Vielleicht?«
»Vielleicht hast du mich nur heraufbeschworen, weil du jemanden zum Reden brauchst.«
»Ach, ich bin ganz zufrieden mit meinem gesellschaftlichen Leben, danke. Ich habe Deena, die mich jeden zweiten Tag anruft und mir einreden möchte, dass ihr das ein Bedürfnis ist. Ich habe die Mädels der Stickgruppe, die mich regelmäßig nerven. Und ich habe Moggins.«
»Wo ist er jetzt?«, fragte Gabe – er hatte Katzen nie gemocht oder, anders gesagt, Katzen hatten ihn nie gemocht. Deshalb hatten sie auch keine gehabt, als er und Deena noch klein gewesen waren. Katzen hatten allergisch auf ihn reagiert, selbst als er noch ein Säugling war. Wenn sie mit ihm im Kinderwagen unterwegs war und eine Katze lief ihnen über den Weg, dann fauchte sie und machte einen Buckel. Als er älter war, wollte er sie streicheln, aber das wollten die Katzen nicht und nahmen sofort Reißaus. Er war zu tollpatschig und zu einschüchternd. Als Teenager schließlich teilte er die Abneigung, die die Katzen für ihn empfanden.
»Er mag es nicht, wenn ich mit jemandem rede, der nicht da ist«, sagte Shirley.
Gabe nickte. »Verständlich.«
Shirley nahm einen Schluck Tee. »Kann ich dir was anbieten? Ich könnte dir ein Schinken-Bananen-Sandwich machen. Ich kaufe immer Schinken und Bananen, obwohl ich sie selbst nicht esse. Nur für den Fall, dass ich mal eins brauche. Wahrscheinlich sollte ich bei meinem Cholesterin gar kein Toastbrot essen. Deena würde einen Anfall bekommen. Trotzdem kaufe ich es. Weil ich das immer schon so gemacht habe. Und so wird es sein, bis ich ins Grab falle. Du wirst schon sehen.« Sie verstummte, bis sie es aus irgendeinem Grund wiederholte. »Du wirst schon sehen.«
Gabe sagte nichts, fast so wie früher, als er noch wirklich hier gewesen war. Hätte er ihr doch bloß mehr erzählt, hätte er sie doch bloß wissen lassen, was wirklich los war, dann wäre er vielleicht noch am Leben. Sie hätte ihm helfen können.
Wie merkwürdig. Es war, als wäre er wirklich im Zimmer, als würde er ihr wirklich gegenübersitzen. Einige Male hatte sie versucht, ihn zu berühren, ihre Hand auf seine zu legen, aber er hatte sich ihr immer entzogen. Ihr Verstand, der sie vor sich selbst schützte. Sie konnte es nicht glauben, dass ihr Verstand so überzeugend das perfekte, lebendige Abbild ihres Sohnes heraufbeschwören konnte. Jedes noch so kleine Detail war vorhanden. Wenn sie genau genug hinsah, konnte sie die kleine, erhöhte Narbe an seiner Stirn erkennen, die er sich zugezogen hatte, als er sich in der Schule gegen eine nicht festgeschraubte Tischplatte gelehnt hatte. Sie konnte die Bartschuppen erkennen, die er nie richtig losgeworden war, egal, womit er sie behandelt hatte. Sie sah den ungewöhnlich wulstigen oberen Rand seiner Ohrmuschel, was ihm etwas entfernt Elfenartiges verlieh – und ihn in der Schule schnell zum Gespött der anderen gemacht hatte.
Mehr noch – auch sein Geruch war hier. Sein muffiges Aftershave, in dem er immer gebadet zu haben schien und das nie seinen leichten Körpergeruch verdecken konnte. Gabe wurde es schnell zu heiß, immer war er leicht verschwitzt. Schweißglänzend. Und dieser Geruch war da – jetzt.
Und seine Kleidung – er trug sein altes Metallica-T-Shirt und die aufgerissene Jeans, die er jeden Tag getragen hatte, nur um seinen Vater, den Ordnungsfanatiker, zu ärgern.
Vor ihr saß eine so perfekte Vision von Gabe Steadman, dass sie sich ziemlich unheimlich anfühlte. Wie nannte man diesen Effekt gleich noch mal? Ach ja, »unheimliches Tal«, »Gruselgraben«. Diese Version ihres Sohnes war wirklich gruselig.
»Was?«, sagte er. Seine Stimme – genau wie sie sie in Erinnerung hatte, vielleicht ein wenig tiefer, älter.
Sie starrte ihn an. Sie sah, hörte, roch ihren Sohn so, als wäre er jetzt hier, heute, im Jahr 2021. Ein Jahr, das er nie erlebt hatte.
Als Gabe zum ersten Mal am Küchentisch gesessen hatte, als sie nach Hause kam, war Shirley erst maßlos erschrocken, hatte sich aber schnell wieder gefangen. Gabe hatte nur dagesessen – und sie mit leerem Blick angesehen. Ihr Verstand hatte ihn noch nicht richtig erfasst. Sie hatte es aufs Alter geschoben. Etwas in ihrem Körper passierte, was nicht ganz optimal war.
Aber dann kam er wieder – und wieder und wieder und wieder. Irgendwann gewöhnte sie sich an ihn und begann sich mit ihm zu unterhalten.
Das war auch schon wieder ein Jahr her. Und jetzt saßen sie hier.
»Was?«, wiederholte Gabe.
»Nichts«, antwortete Shirley. Aber sie wusste nicht, ob das stimmte.
»Du hast gesagt, du wunderst dich, warum ich hier bin«, sagte Gabe. »Vielleicht hast du mir was zu erzählen.«
Shirley dachte kurz nach. Was sollte sie schon sagen? Aber je länger sie darüber nachdachte, desto mehr wurde ihr bewusst, dass das die falsche Frage war. Sie hatte so vieles zu sagen, dass sie das alles noch nicht einmal in zusammenhängende Sätze packen konnte. Aber sie musste es versuchen.
Shirley spürte, wie ihr wieder Tränen in die Augen traten. »Vielleicht weil ich dir sagen möchte, dass es mir leidtut. Es tut mir leid, Gabe. Wenn ich gewusst hätte … Wenn ich nur eine Sekunde darüber nachgedacht hätte … Ich hätte es nie zulassen dürfen, dass er dich wegschickt. Ich habe gewusst, dass es dir nicht gefällt, dass du es hasst, aber nicht, wie schlimm es wirklich für dich war. Und jetzt tut es mir so unendlich leid. Damit muss ich jetzt leben, Tag für Tag. Das ist meine Strafe. Ein leeres Kästchen zu begraben, dort, wo der Leichnam meines Sohnes sein sollte. Ich büße dafür. Ich büße für mein Schweigen. Aber das wird nie etwas daran ändern, dass du jetzt hier sein, dass du mir jetzt gegenübersitzen solltest. Du solltest diese Tasse in die Hand nehmen und deinen Tee trinken, und ich sollte dir ein Schinken-Bananen-Sandwich machen können, das du isst. Aber das kannst du nicht. Und ich kann es nicht. Damit muss ich leben.«
Gabe reagierte nicht, während sie ihm ihr Herz ausschüttete – er neigte sogar ein wenig den Kopf wie ein Hund, der von irgendeinem Lärm abgelenkt wurde. Er sah einfach nur zu, wie sie zunehmend erschöpft in ihre fast leere Teetasse heulte. Der Tee war kalt – sie hatte es nicht anders verdient.
Als sie sich schließlich gefangen hatte, räusperte sich Gabe. »Du weißt, dass du das jedes Mal sagst, wenn ich erscheine? Fast bis aufs Wort.«
Sie fuhr hoch. »Ich … ja?« Sie konnte sich nicht erinnern, es schon einmal ausgesprochen zu haben – tatsächlich konnte sie sich kaum an irgendetwas erinnern, was geschah, wenn ihr Gabe erschien. Sie war ganz auf ihn konzentriert.
»Es geht nicht um mich, als ich sagte, dass du mir vielleicht was zu erzählen hast.«
»Ich verstehe dich nicht«, sagte Shirley.
Gabe schien nachzudenken – als müsste er sich überlegen, ob er ein bestimmtes Thema anschneiden sollte. Was wollte er ihr sagen? Was wollte sie ihm sagen? »Ich rede von Callie.«
Darum ging es also. Callie.
»Ich weiß … ich kann nicht …«, stammelte Shirley. »Du weißt nicht …«
»Doch«, sagte Gabe.
Shirley stand auf. Sie musste ein Taschentuch holen. Sie war völlig aufgelöst. Und eigentlich wollte sie auch nicht mehr hier sitzen. Sie wollte sich nicht mit einem Geist unterhalten, auch wenn dieser Geist ihr Sohn war. Sie konnte es jetzt nicht gebrauchen, dass ihr Verstand sie kurieren wollte. Sie ging zu den Küchenschubladen, wandte Gabe den Rücken zu. Sie zog ein Taschentuch heraus – ein rosafarbenes, gepunktetes Stoffrechteck – und putzte sich die Nase. »So ist es besser«, sagte sie und drehte sich zum Tisch um.
Gabe war verschwunden.
Einen Augenblick lang stand sie so da. Und dann, nachdem sie sich erneut die Nase geschnäuzt hatte, sammelte sie die Tassen ein, schüttete Gabes Tee in den Ausguss und schaltete den Geschirrspüler ein.
Ein Miauen von der Tür. Sie wandte den Kopf. Moggins stand dort und sah zu ihr auf.
»Sag jetzt nichts«, sagte Shirley. »Ich weiß ja.«
Wie dumm, dachte sie.
»Komm schon, gehen wir ins Bett.« Als sie das Zimmer verließ, knipste sie das Licht aus, weil Moggins das nicht machen würde.
01.03
Chester-le-Street
Mittwoch, 10. Februar 2021
16.40 Uhr
Am nächsten Tag herrschte in Shirleys Bungalow, anders als am Abend zuvor, einiger Trubel. Deena und ihre Familie waren gekommen (unangekündigt wie immer), und die Kids stürmten durch die Zimmer, als würden sie an einem endlosen Wettrennen teilnehmen. Shirley und Deena saßen am Küchentisch – ihre Tochter exakt dort, wo der Geist ihres Sohnes gesessen hatte. Sie schienen damit an der Ziellinie zu sitzen, denn jedes Mal, wenn Maisie und Kenneth vorbeikamen, stießen sie einen Jubelschrei aus.
Maisie, mit ihren zehn Jahren die Ältere, war kurz davor, zu einem wunderbaren jungen Mädchen heranzuwachsen. Sie war selbstbewusst, starrköpfig und erinnerte Shirley sehr an Deena. Es war klar, statt herumzurennen würde sie sehr viel lieber in der Ecke sitzen und auf ihrem Handy rumspielen, worüber Shirley ganz klar ihr Missfallen geäußert hatte. Stattdessen unterhielt sie ihren sechsjährigen und noch sehr kindlichen Bruder Kenneth. Er grinste, wenn er seine Schwester überholte, und steckte seine gesamte Energie in das Wettrennen, als würde sein Leben davon abhängen.
Deena hatte es schnell aufgeben, sie zu zügeln, und Shirley hatte ihnen dann einfach alles erlaubt, was sie wollten. Früher, zu ihrer Zeit, hätte sie sie angeschrien, so wie sie Deena angeschrien hatte. Kinder brauchten ein gesundes Maß an Disziplin, so wie sie gewisse Freiräume brauchten. In diesem Fall wäre Disziplin vonnöten gewesen, aber das war nicht ihre Aufgabe.
Deena und Shirley tranken Tee. Auch hier richtete sich das Leben nach den Tassen Tee, die getrunken wurden. Aber vielleicht spielte das auch gar keine Rolle – Tee war einfach eine feine Sache, und er gab einem was zu tun.
»Also, ich hab ihnen gesagt, wenn ich nicht ebenfalls eine entsprechende Gehaltserhöhung bekomme, können sie sich jemand anderen suchen«, sagte Deena. Wie ihre Mutter hatte sie den Geordie-Akzent nicht übernommen. Sie war neun Jahre alt gewesen, als sie in den Nordosten zogen, ihr Akzent war da bereits fest in ihr verankert. Komisch war nur, dass Gabe, der beim Umzug dreizehn war, durchaus die eine oder andere Wendung aufgeschnappt hatte. Deena war als Kind aber immer eher die Introvertiertere gewesen. Sie redete wie Shirley – hörte sich also eher wie eine BBC-Nachrichtensprecherin an als wie die Leute hier in der Gegend. »Ich habe eine Familie mit kleinen Kindern, ich muss Mäuler füttern, ich hab kein Verständnis für diese Art von sexistischen Vorurteilen. Es kann doch nicht sein, dass wir uns immer noch mit dieser Form von Frauenfeindlichkeit herumschlagen müssen. Ist dir das klar?«
Shirley war in Gedanken immer noch bei dem, was ihr Gabe am Vorabend gesagt hatte. Konnte es sein, dass sie sich einzureden versuchte, sie müsse auf Callie zugehen? Wie sollte sie das überhaupt anfangen? Sie hatten nicht mehr miteinander gesprochen, seitdem Gabe fortgeschickt wurde. Das war 2008 gewesen. Vor wie vielen Jahren? Dreizehn. Das war eine gewaltige Mauer, die es zu überwinden galt. Eine Mauer, die sie selbst errichtet hatte.
»Mum.«
Shirley bemerkte, dass Deena sie anstarrte. »Tut mir leid, worum geht es? Ah ja, dass deine Bezahlung und die Männer besser sein sollen. Ich meine, nicht besser, sondern … Weißt du, du kannst nicht dauernd die Welt verändern, Dee. Manchmal musst du einfach mit dem klarkommen, was du hast.«
»Wow«, sagte Deena. »Meine Mutter, Ladies und Gentlemen, eine wirklich starke Frau.«
»So hab ich das nicht gemeint … Tut mir leid, ich bin abgelenkt«, stotterte Shirley.
»Ernsthaft: Was ist los?«
Shirley sah auf ihre Hände. Sie pochten immer noch leicht vor Schmerzen und hatten sie die halbe Nacht wachgehalten. Am Morgen hatte sie sie in eine Schüssel mit warmem Wasser eingeweicht, um sie so weit zu lockern, damit sie die nötigsten Dinge erledigen konnte. Aber davon konnte sie Deena nichts erzählen. Ihre Tochter würde sie nur zum Arzt schicken, der ihr dann noch mehr Tabletten verschreiben würde zu der sowieso schon vorhandenen bunten Menagerie aus Pillen in unterschiedlichsten Größen und Farben, die sie sich einwarf. »Ich hab letzte Nacht nicht gut geschlafen«, sagte sie.
Das schien Deena zu genügen. Sie nahm ihre leeren Teetassen und ging damit zur Spüle.
Shirley mühte sich vom Stuhl hoch und stieß beinahe mit Maisie zusammen, die um die Ecke gerast kam.
Shirley rechnete bereits mit einem Zusammenprall, der allerdings ausblieb. Ihre Enkeltochter stoppte gerade noch rechtzeitig. »Sorry, Gramma«, kicherte Maisie.
»Schon gut«, sagte Shirley und tätschelte ihr den Kopf. »Aber macht mal halblang, ihr dreht so viele Runden, dass ihr noch eine Spur in meinen Teppich brennt.«
Maisie lachte, ging um sie herum und raste ebenso schnell wie zuvor wieder davon.
Shirley seufzte und trat zu Deena, die den Geschirrspüler öffnete, der noch nicht ausgeräumt war. »Ich mach das schon«, protestierte sie.
»Schon gut, Mum«, sagte Deena und fing bereits mit dem Ausräumen an. »Wirklich. Mir gefällt es sowieso nicht, wenn du dich dauernd bücken musst.«
»Na, wenn du mich das Geschirr in der Spüle abwaschen lassen würdest, wie es alle machen, wäre das kein Thema«, spöttelte sie. »Ich wollte keinen Geschirrspüler, du erinnerst dich?«
Deena richtete sich auf und betrachtete sie skeptisch. Sie stellte die herausgenommenen Teller auf die Anrichte. Wann hatte sich das Machtgleichgewicht so sehr verschoben? Es hatte mal eine Zeit gegeben, da hatte Shirley Deena so angesehen, und Deena war sich wie ein ungezogenes Gör vorgekommen. »Sich über die Spüle beugen ist auch nicht gut. Du weißt, was Doktor Illyah gesagt hat?«
»Ich hätte nie zulassen dürfen, dass du mitkommst.«
»Man muss sich nicht schämen, wenn man …« Deena verstummte mitten im Satz. Sie griff ins obere Geschirrspülfach und holte eine Tasse heraus. Gabes TARDIS-Tasse. »Mum.«
Unwillkürlich sah Shirley weg. »Was?«
»Du benutzt diese Tasse nie«, sagte Deena. »Es sei denn …«
Shirley sagte nichts. Musste das sein? Sie brauchte diese häufigen Besuche nicht – diese Aufdringlichkeit. Sie kam wunderbar allein zurecht. Sie und Moggins gegen den Rest der Welt.
»Mum.«
»Was?«, entgegnete sie trotzig.
Jetzt wurde Deenas Ton weicher. Nein, nicht nur weicher. Echte Besorgnis lag darin. »Hast du ihn wieder gesehen?«
Shirley blickte ihr in die Augen. »Warum ist das so …«
»Hast du ihn wieder gesehen?«
Shirley zuckte mit den Schultern, ging zum Tisch zurück und ließ sich auf den Stuhl plumpsen, soweit ihre Knochen das aushielten. »Ich hab ihn vielleicht gesehen, als ich vom Krankenhausradio heimgekommen bin.«
Deena nahm ebenfalls wieder Platz. Eine fließende, schwungvolle Bewegung der gut geölten Jugend. »Hast du mit ihm geredet?«
»Natürlich.«
»Mutter!« Wie viele andere nannte Deena sie nur dann Mutter, wenn sie wirklich wütend war. Seit Neuestem kam ihr das Wort mit alarmierender Regelmäßigkeit über die Lippen. »Wir haben darüber gesprochen. Du hast gesagt, du lässt dich nicht mehr darauf ein. Du hast gesagt, du würdest …«
»... die Augen schließen, bis zehn zählen und es so lange wiederholen, bis er fort ist, ich weiß«, sagte Shirley. »Aber ich kann es nicht, Deena. Es geht mir besser, wenn er da ist. Ich fühle mich vollständiger. Ich habe jemanden, mit dem ich reden kann … und der keine flauschige Katze ist. Ich kann vor ihm nicht die Augen verschließen. Er ist mein Sohn.«
»Nein«, erwiderte Deena entschieden. Es kam ihr so leicht über die Lippen, dass Shirley ganz schlecht wurde. »Nein, ist er nicht. Das ist nur dein Verstand, der dir was vorgaukelt, weil du allein lebst. Weil du … gut …«
Shirley lachte. »Du kannst es ruhig sagen. Weil ich alt bin. Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich bin siebzig Jahre alt, und du meinst, ich hätte sie nicht mehr alle.«
Deena versuchte es anders. »Ich meine, was sind denn die Alternativen, Mum? Dass dieses Was-weiß-ich ein Geist ist?«
»Dieses Was-weiß-ich ist dein Bruder. Und nein, ich weiß, was er ist, und ja, es geht nur mich was an, aber ich kapiere nicht, warum es schlecht sein muss.«
»Es ist schlecht, weil es nicht wirklich ist. Soll ich Doktor Illyah anrufen?«
»Wage es ja nicht«, sagte Shirley. »Du kannst nicht jedes Mal mit dem verfluchten Arzt drohen, wenn ich etwas sage, was deine beschissene Weltsicht ins Wanken bringt.«
Deena war entsetzt. »Solche Ausdrücke vor meinen Kindern? Zwei innerhalb von fünf Sekunden? Hat dir das mein Geisterbruder beigebracht?« Deena hatte es noch nie gemocht, wenn sie fluchte.
»Er bringt mir nichts bei. Wir reden nur. Ich rede.«
»Über was?«
Shirley wurde bewusst, dass sie das gar nicht so genau wusste. »Über dieses und jenes«, antwortete sie. »Was ich tagsüber gemacht habe. Wie gestern im Studio.« Sie hatte einfach mit jemandem über Mallet AM reden müssen. Moggins wäre nicht sehr aufmerksam gewesen. Also hatte sie es Gabe erzählt. Ganz einfach.
»Warum redest du nicht mit mir«, sagte Deena traurig. »Ich bin jetzt seit einer Stunde hier, und du hast mir nichts über deinen Tag oder über das Studio oder irgendwas erzählt. Warum unterhältst du dich nicht mit dem Kind, das noch am Leben ist?«
Shirley wollte schon zu einer Antwort ansetzen. Sie könnte Deena von gestern erzählen, vom Wunschkonzert, von ihrer Sendung, vor allem von Mallet AM. Sie könnte ausführlich darüber reden, was sie vom Piratensender hielt, wie gern sie dem Mann oder der Frau gratuliert hätte, ihm oder ihr hätte sagen wollen, dass einer Karriere in einem richtigen Sender nichts im Wege stünde. Sie könnte ihr von der seltsamen Verwechslung des Datums erzählen – und ob sie schon wisse, dass die Chester Baths vielleicht dichtmachen würden. Aber nichts davon tat sie. Denn Deena würde genau so reagieren, wie sie immer reagierte – sie würde alles zu Tode analysieren, würde alles zu Tode quasseln, würde ihr den ganzen Spaß madig machen. So sagte Shirley nur: »Ich hab dich nicht gebeten zu kommen.«
Deena sah sie nur an, dann seufzte sie. »Verdammt nett von dir, Mum.«
Als sie darauf etwas erwidern wollte, kam Deenas Mann Tom ins Zimmer gepoltert, in seinem Overall, am Arm einen wahnwitzig großen Werkzeugkasten. Er stellte ihn einen Tick zu wuchtig auf die Küchenanrichte, sodass sich Shirley bereits um den Marmor sorgte.
Deenas Mann war ein Riese, über zwei Meter groß, mit dem entsprechenden Gewicht. Zur Hälfte Muskeln, zur Hälfte Fett, ein Bauarbeiter, der den einen Teil seiner Zeit herumsaß und den anderen Teil riesige Mengen undefinierbarer »Sachen« schleppte. Wie jeder hatte er natürlich auch während des dunklen Jahres ein wenig zugelegt.
»Weiß nicht, was da mit der Luke für den Dachboden ist, Shirl. Die hat sich irgendwie verklemmt. Die lässt sich ums Verrecken nicht lösen.« Die Luke zum Dachboden war schon seit Jahren festgeklemmt – vielleicht schon länger. Sie hatte den Dachboden nie genutzt, es gab für sie keinen Grund, hinaufzugehen. Vor Kurzem aber hatte sie geglaubt, oben Vögel gehört zu haben, deshalb wollte sie dafür sorgen, dass sie rein- und rauskamen, falls sie Nachwuchs hatten. »Ich könnte ein paar meiner Jungs drauf ansetzen, damit sie die Luke aufbrechen.«
»Nein«, sagte Shirley, die weder viel Aufhebens noch Toms grobschlächtige Bauarbeiterkumpel in ihrem Haus haben wollte. »Die Vögel haben reingefunden – also finden sie auch wieder raus. Und alles andere, was da oben ist, kann ruhig auch weiterhin oben bleiben. Nur Bobs Sachen und ein paar von Gabe. Seine Kleidung und Schallplatten und so. Nichts, was ich brauche.«
»Okay.« Tom nickte, entdeckte eine frische Tasse Tee und ging ohne nachzufragen davon aus, dass sie für ihn bestimmt wäre. Diese Zielstrebigkeit, vermutete Shirley, war das, was Deena ursprünglich so attraktiv an ihm gefunden hatte. Sie selbst hielt ihn für eine unglaubliche Nervensäge. Er schlürfte seinen – oder eigentlich ihren – Tee. »Aber wenn du’s dir anders überlegst, kann ich jederzeit meine Jungs schicken.«
»Danke, Tom«, erwiderte Shirley und wusste schon jetzt, dass sie sein Angebot niemals annehmen würde. »Ich werde es im Hinterkopf behalten.« Auch wenn das nicht mehr unbedingt ihre Stärke war. Ständig vergaß sie Sachen, egal, ob sie sich vorgenommen hatte, sie sich zu merken, oder nicht. Ihr Leben versuchte sich daran zu erinnern, welche Schauspielerin früher darin mitgewirkt hatte.
Deena strich die Falten ihrer Bluse glatt. Offensichtlich war sie auf den Weg ins Büro. »Tom, sammel die Kinder ein. Wir brechen auf.«
»Aber ich hab Hunger«, sagte Tom.
»Dann halten wir irgendwo an«, sagte Deena und schnappte sich Maisie, als sie in die Küche gestürmt kam.
Das Mädchen protestierte, rief, sie wolle noch bei Gramma bleiben, gab dann aber nach. Wie meist setzte Deena ihren Willen durch. Shirley hatte sie in dieser Hinsicht ein bisschen zu gut erzogen – natürlich hatte Bob daran keinen Anteil gehabt –, und das hatte sie jetzt davon.
Tom verkniff sich jeden weiteren Kommentar und packte sich Kenneth, als der kleine Junge in die Küche kam.
»Ohhhh«, rief Kenneth, als Tom ihn einfach hochhob – die kleinen stämmigen Beine strampelten noch in der Luft.
Tom griff sich wieder seinen Werkzeugkasten und tauschte mit Shirley einen kurzen Blick aus, mit dem er ihr zu verstehen gab, dass er sich so ziemlich das Gleiche wie sie dachte.
Deena bemerkte es, sagte aber nichts, warf einen letzten, traurigen Blick zu Shirley, bevor sie Maisie hinaus in den Flur führte. Tom folgte. Shirley blieb in der Küchentür stehen, bemerkte Moggins, der sie vom Tisch aus beäugte, wo sie ihre Schlüssel und ihre Tasche abgestellt hatte. Die Familie ging durch den Flur und war schon kurz vor der Eingangstür, als …
»Ach, fast hätte ich’s vergessen«, rief Tom und blieb mit Kenneth auf dem Arm im Flur stehen. »Shirley, du wirst deine helle Freude dran haben. In der Mittagspause war ich in der Front Street, und ich komm an der Bäckerei vorbei, der von Starith. Seb ist oben auf so ’ner alten Leiter und will ein riesiges Schild aufhängen. Jedenfalls, zwei Sekunden später kommt eine Windbö, und er macht einen Abgang. Kracht ungebremst auf den Boden.«
»Was?«, entfuhr es Shirley. Ihr wurde ganz seltsam in der Brust. Starith war von einer Leiter gefallen?
Der Piratensender.
»Ich hab ihn dann zum Krankenhaus watscheln sehen, als hätte er sich den Hintern gebrochen«, sagte Tom mit einem Glucksen.
»Tom!«, zischte Deena. »Warum sollte Mum daran ihre helle Freude haben?«
Tom sah sie betreten an, ganz im Gegensatz zu Kenneth, auf dessen pummeligen Gesicht sich ein breites Grinsen abzeichnete. »Ich dachte eben, weil Shirley im Krankenhaus arbeitet.«
Mallet AM.
»Und deswegen soll das witzig sein?«
Wie konnte der Sender so etwas vorhergesehen haben?
»Ich weiß nicht, warum nicht? Hatte eben mit dem Krankenhaus zu tun.«
Deena schüttelte den Kopf.
»Tom«, sagte Shirley, ohne auf Deena zu achten. »Wie spät war es da?« Was hatte der Radiosender gesagt? Die Stimme? Seb Starith sei von einer Leiter gestürzt, als er ein Schild aufhängen wollte. Aber zu welcher Uhrzeit? 12 Uhr noch was …
»Ähm … na ja, es war in der Mittagspause, so gegen 12.15 Uhr. Oder so.«
Exakt der Zeitpunkt, der genannt worden war.
»Alles in Ordnung, Mum?«, fragte Deena. »Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen.«
Shirley nahm Deenas Besorgnis wahr und schob alle Gedanken an Starith und den Piratensender beiseite. »Nein, keinen Geist. Diesmal nicht.« Shirley lächelte, was sich auf ihrem Gesicht mittlerweile sehr fremd ausnahm.