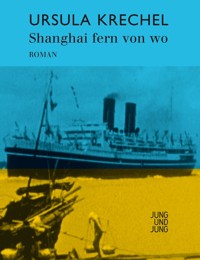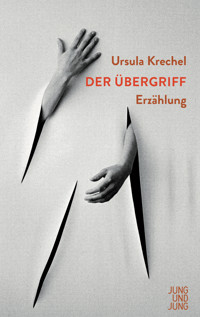
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau beginnt zu reden. Dabei sind ihre Lippen schon ganz spröde, so oft ist ihr über den Mund gefahren worden. Aber wie entkommt sie dieser Einschüchterung? Indem sie den Mund nur noch öffnet, um zu essen, zu küssen und zu staunen? Andererseits: Gibt nicht gerade das Schweigen der Stimme Raum, die ihr den Mund verbietet? Zu oft ist geschwiegen worden, auch damals, als das ganze Haus hörte, wie die Nachbarmädchen geschlagen wurden. Hat man die eigene Sprache verlernt, weil alle verlernt haben hinzuhören? Wie der Reporter, der nicht mehr hinhört, wenn er vom Krieg berichtet, so fest hat er jede Verzweiflung im Griff.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 Jung und Jung, Salzburg
Bearbeitete Neuauflage, 1. Auflage 2001
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
ISBN 978-3-99027-191-9
URSULA KRECHEL
Der Übergriff
Erzählung
mit einem Nachwort von Antje Rávik Strubel
INHALT
Die Belästigung
Die Übertretung
Die unendliche Disziplin
Die Verflüchtigung
Die Schlüsselgewalt
Das vorhandene Vergehen
Die Verflüssigung
Nachwort Antje Rávik Strubel
1
DIE BELÄSTIGUNG
Immer, wenn ich den Mund aufmache, erhebt sich neben mir eine Stimme. Sie sagt laut und vernehmlich: Halt’s Maul. Obwohl ich schon seit den unzähligen Malen, bei denen ich meinen Mund geöffnet habe, weiß, dass es diese Stimme gibt, überrascht sie mich jedes Mal von neuem. Sie krächzt nicht, sie poltert nicht, sie spricht mit überlegener Klarheit. Die Luft zwischen meinem Ohr und der Stimme ist frisch, fast eine Fröstelluft, eine ernüchternde Luft. Wenn ich den Mund öffne, um zu essen oder um zu küssen, oder ihn einfach staunend offenstehen lasse, weil ich glaube, dass ich wieder die Stimme gehört habe, bleibt die Stimme still. Es ist also einerseits vernünftiger, den Mund nur zu öffnen, um zu essen, zu küssen, zu staunen, dann entginge ich der Belästigung durch die Stimme, doch andererseits, manchmal, einfach so, möchte ich etwas sagen. Wäre die Stimme keine Stimme, sondern eine Hand, ich müsste zugeben, dass sie sich wie eine Ohrfeige anfühlt. Eine Ohrfeige, die aber auf meinen Mund zielt. Manchmal ducke ich mich unter ihr weg, mit einer geschickten Drehung des Kopfes, dann prallt die Stimme mit voller Wucht auf die Luft, beult sie aus, dort, wo noch vor einem Bruchteil einer Sekunde mein Mund, den ich nicht Maul nennen möchte, gewesen ist. Zwischen der Stimme und mir viel unbereinigte Luft, die jetzt durchschnitten wird. Die Stimme ist herrisch und ziemlich laut, doch nicht ungewöhnlich laut, eher gewöhnlich laut, ich könnte mit ihr argumentieren, ich könnte ihr Vorwürfe machen, dass sie das ganze Luftgefüge zwischen meinem Ohr und meinem Mund verschiebt, umschichtet, durcheinanderwirbelt, dass sie in meinen offenen Mund hineinstrahlt. Ich könnte, wenn ich mich sehr, sehr anstrengen würde, diese Stimme überhören. Ich weiß, was sie sagt, ich weiß, dass andere Stimmen, denen ich gerne zuhöre, andere Sätze sagen, Sätze über das ausbleibende Gewitter, über die Kränklichkeit des Hundes. Die Stimmen, die ich kenne, rennen mehrmals rund um den Block, hecheln ein bisschen mit ihren gesunden Lungen und Zungen, grüßen im Lauf – und schon sind sie vorbeigerauscht. Gesund sind diese Stimmen allemal, bis tief in die mit Freundschaftsbanden umwickelten Stimmbänder. Jede Freundschaftsgabe ist eingewickelt, eingeschnürt. Komm doch, sagen die verbindlichen Stimmen, wir laden dich herzlich ein. Nur die Stimme in meinem Ohr, die Halt’s Maul sagt, ist nüchtern und knochentrocken. Ich habe der Einladung nicht Folge geleistet, mein Stuhl blieb leer, ich wollte verreisen, ich bin schon verreist, dafür entschuldige ich mich.
Die Stimme neben meinem Ohr schallt in meinen Kopf hinein, als wäre das Ohr nur ein Trichter für Gemeinheit. Ich weiß nicht genau, ob man diese hineinträufelt oder ob sie herausquillt. Ich bin in diesem Augenblick so beschämt über den unklaren Körpervorgang, dass ich überhaupt nichts höre, weder die Stimme, die Halt’s Maul sagt, noch die vielfältigen alltäglichen Freundlichkeiten, denen nicht zu trauen ist. Andere Stimmen sagen vielleicht: Wart ein bisschen, und lass mich etwas sagen, ehe du zu sprechen anfängst. Alles in höchst zivilen Formen. Oder sie entschuldigen sich für die Unterbrechung, doch führen sie gute Gründe an für die augenblickliche Spontaneität, mit der sie einsetzen. Gründe, denen ich nichts entgegenzusetzen hätte.
Halt’s Maul. Ich höre die Stimme auch schon, wenn ich nur den Mund öffne, um zu sagen: Nein, ich sehe dies vollkommen ein, ich habe dem nichts entgegenzusetzen. Also sage ich nichts, schließe meinen offenstehenden Mund, und die klar akzentuierte, höfliche Stimme, die ja in Wirklichkeit keineswegs durch eine Höflichkeit von mir unterbrochen werden wollte, spricht weiter. Höflich ist es eigentlich nicht, ins Ohr eines Menschen zu rufen: Halt’s Maul. Es tut aber seine Wirkung. So vergesse ich die Unterbrechung, ich höre zu, was jemand zu mir sagt, nicke, schaue, starre geradeaus, und alles hat seine gute Ordnung. Ich höre gerne zu, was jemand mir sagen will über das ausbleibende Gewitter, über die Kränklichkeit des Hundes. Seit er vergiftetes Gras gefressen hat, fallen ihm an einem Unterschenkel die Haare aus, jetzt liegt der Knochen blank, und die Höhe der Tierarztrechnungen steigt wie das Fieber. Der Hund, der das vergiftete Gras gefressen hat, setzt sich jetzt mitten auf die Fahrbahn, klagend streckt er sein haarloses Bein von sich. Ein Auto bremst vor ihm, nur widerwillig lässt sich der Hund von der Fahrbahn vertreiben. Ich bin nicht die Person, die einen Hund von der Mitte der Straße jagt. Es muss sich um eine lange Strecke der Wahrnehmung handeln, die mir fehlt, ein gutes Stück Zeit, das vergangen ist hinter meinem Rücken. Ich weiß nicht genau, was da geschieht. Ich bemühe mich, wenn ich schon übermäßig schweigsam bin, wenigstens eine gute Beobachterin zu werden, aber zu viel geschieht hinter meinem Rücken. Ich drehe mich dann um, bin verlegen, mich so plötzlich umschauen zu müssen, vielleicht verstehe ich die Tonlosigkeit, die Geräuschlosigkeit des Bremsvorgangs nicht. Mir ist der Ton abgestellt bis auf einen einzigen. Dem bin ich ausgeliefert.
Immer, wenn ich den Mund aufmache, erhebt sich neben mir eine Stimme. Halt’s Maul. Ich halte mich an der Reling fest. Das Achterdeck ist leergefegt, in meinen Ohren ist ein Scheppern und Rauschen, ein heulender Wind. Der Erste Offizier geht über das Deck und grüßt übertrieben höflich, als wäre ich nicht eine alte Bekannte (Kundin?), dann verschwindet er wieder im Bauch des Schiffes. Ich bin schon lange auf diesem Schiff gereist bei blauem Wetter und im stürmischsten Unwetter. Ich bin eine erfahrene Schiffsreisende, man muss schon ziemlich lange Schiffsreisen unternommen haben, um sich vollmundig mit diesem Titel zu schmücken, der dann, wenn man ihn gebraucht, so schlaff wie ein Segel bei Windstille an der Person herunterhängt. (Und warum reist man so lange auf Schiffen herum? Vermutlich doch, um eine schnelle Ankunft grundsätzlich zu vermeiden.) Auf Deck verbinden den Mund mit der Luft rundherum unzählige Luftfäden, schnüren ihn zu, schneiden in die Lippenhaut, dass sie rau wird, doch dies alles hat nur die Bedeutung, den Mund vor dem endgültig sturen Geöffnetsein in Schutz zu nehmen, ein Mund, der sich bedenkenlos bis in den Rachenraum bei der kleinsten Neigung auf einer Schiffsreise öffnet, könnte einem Magenunwohlsein, einer konvulsivischen Zuckung, die den ganzen Verdauungstrakt durchrüttelt, Vorschub leisten. Die Speiseröhre brennt, es fühlt sich an, als hätte die Magensäure sie ganz verätzt. Ein beschämender, säuerlicher Geschmack auf den Lippen. Der Mund, der sich nicht über der Reling öffnet, sondern irgendwo, wo sich ihm eine leere Stelle in der Luft bietet, der Mund muss zur Ordnung gerufen werden.
So liegen die Passagiere bäuchlings in ihren Kabinen, von den Wellen gewiegt, von starken Schlafmitteln betäubt, die Hüftknochen und die Ellenbogen bohren in die Matratze und hinterlassen kleine Täler auf der Liegefläche, die Bettlaken filtern die Hitze nicht, und oben sind die Münder, die sich willentlich nicht öffnen. Die Reling ist weit weg, der Schiffsrachen verbarrikadiert. Ein Mund, der strikt verschlossen gehalten werden soll, öffnet sich in peinvoller Not. Eine Hand zerrt an der Kabinentür, Füße stolpern hinaus. Der ganze Mensch dazwischen ist eine gekrümmte Peinlichkeit. Milchige Brühe bildet auf den Wellen fremde Schaumkronen, an denen die Möwen nippen. Alles muss am frühesten Morgen geschehen, bevor das Deck gewaschen wird, sofort muss es wieder benutzbar sein. Eine Stimme ist nicht zu hören, kein einziger Möwenschrei, nur das gleichmäßige Brummen der Maschinen, keine einzige Stimme, nur die Wellen, die an die Bugwand klatschen, das feine Aufperlen von Tropfen, das Schwappen einer Pfütze auf dem Deck. Also allerhand, was sich Gehör verschafft zwischen Nacht und Morgen.
Das Meer ist eine unerwartete Ohrfeige, aber sie verrutscht ins Haar, aufs Glücklichste gepolstert. Während ich diesen Satz schreibe, ein wenig unsicher, ob er nicht zu aufwendig ist an dieser Stelle, während ich also diesen unschuldigen Satz schreibe, der, mit so vielen Überlegungen behangen, schon seine Unschuld eingebüßt hat, beginne ich, den Satz vor mich hinzusprechen. Ich mache den Mund auf: Das Meer. Da ist sie wieder, die kräftig akzentuierte Stimme, die mir befiehlt: Halt’s Maul. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, jedenfalls jetzt nicht, da ich nur lese und nichts sage, was sich anhören könnte, als wäre es mir gerade in den Sinn gekommen. Ich sage noch einmal vor mich hin, was ich gerade geschrieben habe: Das Meer ist eine unerwartete Ohrfeige, aber sie verrutscht ins Haar, aufs Glücklichste gepolstert. Der Satz hört sich nun an, als hätte ein anderer ihn geschrieben, wie so viele Sätze, die einfach in Zeilen stehen, als wären sie nie gesprochen worden, aus keinem einzigen Mund. Und sie müssen auch nicht gesprochen werden. Man kann sie erfinden. Es könnte sein, dass so viele Sätze geschrieben worden sind, in Zeilen und zwischen Zeilen oder mit abrupt abstürzenden Zeilen, weil sie ohne Unterbrechung nicht gesprochen werden konnten, jedenfalls nicht aus diesem oder jenem Mund. Während ich meinen Mund geschlossen halte, ist es still um mich, die Stockrosen in der Vase sind stumm. Als ich im Laden war, begrüßte die Blumenbinderin eine andere Kundin, die einen sehr kleinen Hund an der Leine führte, mit überschwänglicher Herzlichkeit. Ich vermisste keinen Hund an meiner Seite, ich war auch freundlich begrüßt worden, doch nicht so ausufernd wie die Frau mit dem Hund. Eine solche Begrüßung hätte mich misstrauisch gemacht, für so viel überschüssige Freundlichkeit habe ich keinen Bedarf und keinen Etat. Vermutlich erwartet die Händlerin dann, dass ich ein Riesenbukett bestelle. Ich hatte auf den Gruß hin genickt, freundlich genickt, das glaube ich sagen zu können, das glaube ich schreiben zu müssen, ich wollte den Mund nicht aufmachen, noch nicht, um die erwartete Stimme in meinem Ohr zu täuschen. So wortkarg wie möglich zeigte ich auf die Blumen, die ich kaufen wollte. Die Blumenbinderin störte das nicht, sie war in ihren Gedanken und Neigungen schon bei der anderen Kundin mit dem Hund. Zu dem Zwergdackel sagte sie: Mäuschen. Und die Kundin nahm dieses Kosewort für ihr Tier freudig an, schnappte förmlich danach. Aus dem hinteren Raum des Blumenladens stürzte jetzt ein gefleckter Jagdhund auf den winzigen Hund zu, er schnupperte am Geschlecht, sein Glied schon halb herausgestülpt. Sofort wurde er zurückgepfiffen von der Blumenbinderin: Lass das, das Mäuschen ist gerade Mutter geworden, es kann dich jetzt nicht brauchen. Wir drei Frauen, die Blumenbinderin, die Kundin und ich, lachten, das Dackelchen stand da, etwas kläglich in seiner Kurzbeinigkeit und mit seinen geröteten Zitzen, es konnte wirklich keinen erregten Rüden brauchen. Zu gerne würde die Blumenbinderin die Welpen sehen. Ich würde die Viecherln wahnsinnig gerne mal sehen, sagte sie. Zu gerne würde die Kundin sie ihr zeigen. Kommen Sie doch vorbei, sagte die Kundin. Doch die Blumenhändlerin hat leider im Augenblick viel zu tun. Die Kundin zeigte eine Spanne zwischen Daumen und Zeigefinger: So groß sind die Welpen schon, und jeden Tag wachsen sie ein bisschen.
Jetzt hat die Blumenbinderin die blassen Stockrosen in der Farbe eines alten Charmeuse-Unterrocks für mich zusammengesteckt. Ist es recht so? Ich zahle stumm und habe viel erlebt. Die Gräser, die die Blumenbinderin um die Stängel herum drapiert hat, sind stumm, das Teelicht auf dem Tisch ist stumm, und auf dem braunen Spiegel, den der Tee in der Tasse bildet, keine einzige Welle, die an den Rand schwappt. Ich habe keine Gelegenheit, Tee zu trinken, ich möchte den Mund geschlossen halten, ich muss, ohne meinen Mund zu öffnen, meine schreibende Hand bewegen, ich öffne meinen Mund nicht, um einen einzigen Satz zu sagen. Ich nutze die unerhörte Stille, um vor dem erneuten Lautwerden der Stimme ein wenig zu sprechen, aber nur in Gedanken, mein Mund ist verschlossen, mein Wesen ist verschlossen, wenn diese beiden Schließungen etwas miteinander gemein haben. Ich presse die Kiefer aufeinander, bis sie schmerzen, kein Wort, kein Laut kommt aus meinem Mund. Ich halte das Maul. Und gebe keinen Anlass, dass die Stille vor meinen Ohren zerstört wird. Vor meinen Augen ein zur Hälfte beschriebenes Blatt. Ich bewege meine Hand auf dem Papier mit der größtmöglichen Geräuschvermeidung.
So ist es schön still. Ich schreibe diesen Satz, und während ich ihn schreibe, möchte ich ihn leise vor mich hin sagen. Ich erwarte die Stimme, die laut und vernehmlich zu mir spricht. Ja, jetzt, genau in die Lücke, die mein Atem läßt, springt sie und zerstört die Stille, die ich genossen habe, solange ich ein paar Zeilen schrieb. Ich bin gezwungen aufzustehen, umherzugehen auf dem knarrenden Fußboden, in meinen dünnen asiatischen Slippern leise aufzutreten, damit die Stimme dort an der Stelle bleibt, wo eben noch mein Ohr war. Ich ducke mich unter der Schallwelle, gebückt gehe ich ins andere Zimmer, beiläufig nehme ich eine Schere in die Hand, doch fällt mir nicht ein, was ich damit schneiden könnte.
Eine Pause ist entstanden, eine Horchpause, in der die Stimme noch aus dem einen Raum nachhallt und den anderen Raum füllt. Ein Nagelhäutchen, ein müdes Blatt der Stockrose, etwas müsste doch zu schneiden sein, nur eine winzige Geste, die Anspielung auf eine Tätigkeit, die Vortäuschung einer vernünftig begründeten Tätigkeit, die einen Ortswechsel erfordert. Ich bin nur so lange im anderen Zimmer, bis die Stimme nicht mehr zu hören ist. Ich komme als ein Flüchtling ins erste Zimmer zurück. Ich habe die Erinnerung an die Stimme mitgebracht. Meine Erinnerung füllt nun auch dieses Zimmer, das eben noch frei von der Stimme war. Ich habe die Stimme wie eine Schmutzspur mitgebracht, jetzt fühle ich mich weder in dem einen noch in dem anderen Zimmer wohl. Ich hätte das erste Zimmer nicht so kopflos verlassen dürfen, so wäre wenigstens dieser Raum nicht von der Stimme eingenommen. Ich gehe zurück mit der Erinnerung an die Stimme, die mich eingeschüchtert hat, zupfe an den Blumen in der Vase. Hat die Blumenbinderin mir eine nicht mehr frische Stockrose in den Strauß geschummelt? Ich könnte mich beklagen, nach der wieder gewohnheitsmäßig herzlichen Begrüßung – die nicht von der Rücksicht auf den einen Hund und der Strenge dem anderen Hund gegenüber gestört, nein, nur getrübt wäre –, könnte, während mein Blick über die neue, frisch eingekaufte Blumenfülle schweifte, sagen: Hören Sie, da haben Sie mir aber beim letzten Mal ein Mickerchen von einer Stockrose in meinen Strauß gesteckt, das am nächsten Tag gleich schlapp gemacht hat. Die Blumenbinderin sähe mich erstaunt an, vielleicht hätte ich mich schon im Ton vergriffen, denn meine kleine Beschwerde passte nicht zu der betonten Herzlichkeit. Ich wäre ein bisschen verlegen, denn sich zu beklagen muss man lernen, und vor allen Dingen ist zu lernen, wie man, nachdem man sich beklagt hat, einen ordentlichen Abgang macht, einen Abgang, der den Ausnahmezustand des Beklagens in den künftigen und früheren Allgemeinzustand des Hinnehmens von Misslichkeiten überführt. Man muss eine Menge kleiner, harmloser Floskeln parat haben, die in einem solchen Fall den Ausnahmezustand mit dem Normalfall des alltäglichen Umgangs puffern. Diese Floskeln sind allgemein bekannt. Über Hunde zu sprechen ist besser als über Bäume, der Blick senkt sich automatisch dabei, während er beim Gespräch über Bäume leicht in ein elegisches, zielloses Schweifen gerät, das dümmlich wirkt. Gelänge es mir nicht, an dieser Stelle die passenden Floskeln einzufügen (ich meine nicht, an dieser Stelle, an der ich jetzt schreibe, sondern an der Stelle, an der ich stände, vor der immer mit Wassertropfen benetzten, von Absplitterungen der Blumenstängel übersäten Theke), ich müsste mir vornehmen, das Blumengeschäft zu wechseln. Oder es bliebe mir gar nichts übrig, als mir eine andere Blumenbinderin zu suchen. Ich habe dies so breitwandig aufgeblättert als eine Vorstellung von einer ungestörten Beschwerde, weil ich weiß oder besser gesagt: nach allem Vorangegangenen annehmen muss, dass kaum, nachdem ich den Laden betreten habe und zu sprechen beginne, sich neben mir eine Stimme erhebt, die mir das weitere Sprechen abnimmt, den ganzen schönen, ausgearbeiteten Plan zunichtemacht. Aber die Blumenbinderin hat vermutlich mein Stockrosenkaufgesicht ohnehin schon wieder vergessen. Und während ich schreibe, ist der Ton sowohl in dem einen Zimmer als auch in dem anderen Zimmer verklungen. Mein Abwarten und Räsonieren, mein Beharren auf einer sinnlosen kleinen Tätigkeit hat ihn fast vergessen lassen, also kein Wort mehr über die Stimme, die in mein Ohr hinein schmettert.
Das Meer ist jetzt glatt und seidig, eine schmiegsame Oberfläche, die nicht wie Wasser aussieht, eher wie ein ausgebreitetes Tuch, das sich nur an der Schiffswand kräuselt. Ich ruhe mit dem kleinen Mutterhund und den winzigen Welpen in einer Kabine des Schiffs. Das Licht, das durch die geschlossenen Jalousien fällt, malt schmale Streifen auf die bebenden Leiber. Zwei der Welpen saugen an den Zitzen. Die Hündin hat eine Vorderpfote über sie gelegt und döst, während die beiden anderen Welpen ineinander gekugelt schlafen. Ich habe mich nie nach dem Besitz eines Hundes gedrängt, nicht einmal als Aufpasserin fühlte ich mich geeignet, doch jetzt in der Hitze des Mittags bin ich zufrieden mit diesen Hunden, über deren Schlaf ich wache. Ich sage kein Wort in das Saugen und Schnaufen hinein. Wenn ich mir vorstelle, die Stimme herrschte jetzt in mein Ohr – sie weckte die schlafenden Hunde auf, die ichweißnichtwie in meine Obhut gekommen sind, ich wäre empört. Halt’s Maul. Halt’s Maul. Ich wollte losschreien, doch mich im selben Augenblick kontrollieren. Pst, pst, nehmen Sie doch Rücksicht auf die Tiere. Es fällt mir gleich auf, dass ich die Stimme sieze, während sie mich einfach geduzt hat. Ich habe keinen Grund, die Stimme zu duzen, die den Luftraum zwischen Mund und Ohr so häufig in Beschlag nimmt, dass kein Platz bleibt für Ungehörtes. Ich hätte beim ersten Ton in meinen Ohren, früher, als ich zum ersten Mal ihr harsches Halt’s Maul hörte, antworten sollen: Ich möchte nicht geduzt werden. Doch ich war so verdutzt in meiner geläufigen Stille, die zerbrochen war, dass ich nicht auf den Gedanken kam, gleich energisch zu antworten. Vielleicht war das ein Fehler. Vielleicht wäre sie verstummt, vielleicht hätte sie sich zu größeren, weitreichenderen Beleidigungen verstiegen, Drohungen, die mir Schrecken einjagen. Jetzt ist es zu spät. Ich habe mir angewöhnt, den Mund nicht mehr so häufig wie früher und nicht mehr so unüberlegt zu öffnen. In Gesprächen, die andere mit mir führen wollen, wirkt dies ein wenig sonderbar, doch ich muss mich nicht erklären. Pst, pst, nehmen Sie doch Rücksicht auf die Tiere. Die Stimme zöge sich zurück in einen inneren Raum des Schiffes, der mir nicht zugänglich ist, nur der leis funktionierenden Mannschaft. Kein Eintritt für Unbefugte, die Stimme dränge durch, träte selbstverständlich ein. Dort in der Offiziersmesse soll sie sich das Maul stopfen lassen mit Bröseln und Bissen, bis sie den Rachen voll hat. Und die Mannschaft, breitbeinig und gebräunt in ihren makellosen Spenzern und weißen Hosen, nähme gönnerhaft Notiz von dem fremden Gast. Und ich bin hier in meiner verschlossenen Kabine, die erfüllt ist vom rekelnden Wohlbefinden. Es ist mir recht, auf die Tiere aufzupassen, es wäre mir auch recht, ein anderer hätte diese Aufgabe übernommen. Ich wäre zufrieden, ohne die Tiere zu sein. Alles in allem bin ich gleichmütig geworden in der Hitze, vielleicht auch nur maulfaul. Das kindlich eifrige Schmatzen und Saugen der Welpen am Fußende des Bettes hört sich angenehmer an als viele andere Geräusche, die ich gehört habe. Die Hündin hebt ihren dunklen Blick, als hätte ich etwas zu ihr gesagt, aber ich döse auch.
Hat es jemals die Möglichkeit gegeben, der Belästigung Herr zu werden? Ich habe diese Möglichkeit offenkundig verpasst. Und was hätte die Möglichkeit sein können? Der Stimme, die Halt’s Maul sagt, wie einem hergelaufenen Hund Kusch! Kusch! entgegenzuschleudern und sie zu vertreiben? Diese Möglichkeit schien mir tollkühn, aber auch wie viele tollkühne Abenteuer kindisch, ja närrisch. Also versuchte ich, indem ich die Gelegenheit vorüberstreichen ließ, eine Torheit zu vermeiden. Wenn es einen solchen Zeitpunkt für eine energische Geste gab – ich kann ihn in meiner Erinnerung weder zurückverfolgen noch finden. Mein Widerstand, der nach allen Voraussetzungen kaum leicht entflammbar war, ist in ein Taktieren, einen gnädig diplomatischen Umgang mit der Stimme übergegangen, ehe er noch begonnen hat. Ich stelle mir jetzt, während ich in der Hitze döse, diesen Zeitpunkt genau vor dem Verpassen der Gelegenheit als einen triumphalen Augenblick vor. Keine Macht der Stimme. Der aufflammende Widerstand gegen das widerwärtige Geräusch, der energische Wille zum Nicht-regiert-Werden. Der entschlossene Protest. Ja, ich habe ihn nicht aufgebracht, habe den Mund zum Essen, Küssen aufgemacht, doch nie zu einer Widerrede, das werfe ich mir vor. Den Mund zum Küssen, zum Essen zu öffnen, schien mir angenehmer, als ihn für eine präparierte Widerrede aufzureißen. Hätte die Stimme ein Gedächtnis, was ich annehme – denn jeder Gegner hat ein Gedächtnis für die Schwächen, die ihm seine Überlegenheit ermöglicht haben –, meine Feigheit (Ohrfeige, Mundfeige sind vage Hinweise auf den Wortgebrauch) meine Feigheit wäre also sicher in dieses Gedächtnis eingegraben. Meine Feigheit, die ich auch beschönigend Ohnmacht nennen könnte.
Jemand hat mir seine Visitenkarte unter die Tür geschoben und mit einer großzügig gerundeten Handschrift seine Kabinennummer darauf geschrieben. Auf der Rückseite der Karte schlägt er mir ein Treffen vor. Ja, er möchte mich unbedingt treffen, die Handschrift erbebt bei der Bitte um ein Treffen. Es ist schon eher ein Verlangen als eine Bitte. Ob das von dem Visitenkartenbesitzer erwünschte Treffen hier auf dem Schiff oder anderswo stattfindet, läßt er offen, das überlässt er mir, meinen Wünschen, Fantasien, wobei er voraussetzt, dass meine Wünsche und Fantasien den seinen weit entgegenkommen. Der Visitenkartenbesitzer hat mich an Deck beobachtet, und ich habe nicht achtgegeben, wer mich beobachtet hat. Es macht mir nichts aus, beobachtet zu werden, ich studiere gerne Visitenkarten und stelle mir die Wünsche und Fantasien fremder Personen vor. Meistens sind sie nicht so fremd, wie die Verfechter dieser Wünsche und Fantasien heimlich denken, sondern allgemein verbreitet. Es wird mir schnell langweilig, wenn ich mir die allgemein verbreiteten Wünsche und Fantasien vorgestellt habe. Heuchlerisch behaupte ich, sie zu teilen, während ich mein Lager noch immer mit der Dackelhündin und ihren Welpen teile. Den Körper des Visitenkartenbesitzers stelle ich mir so papieren, so viereckig wie seine Karte vor, einen solchen Mann habe ich nicht an Deck gesehen, vielleicht habe ich ihn auf eine Weise übersehen, die ihn aufgereizt hat. Am Abend klopft es an meine Kabinentür, die Hündin beginnt zu bellen, die Welpen fiepen. Sie versuchen, es ihrer Mutter gleichzutun. Die nur mit einem Haarflaum bedeckten Schwänze sind steil aufgerichtet, die Ohren noch schlapp, lappenartig wie bei Schafen, ihre wachsame Energie sitzt in der Kehle. Ich muss lachen über die Aufregung der Tiere, über die Verteidigung eines Reviers, das nicht ihres ist und nicht meines, wie es nicht meine Hunde sind, wie es nie meine Hunde sein werden. Ich lache sehr leise, damit die Stimme nicht einsetzt. Das Klopfen verstummt.
Als das Schiff im Hafen anlegt, ist an der Uferpromenade ein Jahrmarkt aufgebaut, Bärenführer und Kettenkarussells wetteifern um die Aufmerksamkeit, Reisfladenbäcker, Eisverkäufer und Bratereien von Hackfleischbällchen drängen sich auf. Mit blitzenden Zangen werden die Fleischbällchen gewendet. Ich bleibe dort stehen, wo es nach frischer Pfefferminze riecht. Ein paar Schritte weiter der beißende Geruch von verbranntem Bratfett. Ein würdiger Greis hat einen Zollstock geschultert, an der einen oder anderen Bude bleibt er stehen, er senkt den Zollstock auf die Höhe des Bratrostes. Er misst den Durchmesser der Fleischbällchen, hier sind sie zu klein, dort auch, dann gerade richtig. Nach jedem Messvorgang wischt er den Zollstock mit einem großen Sacktuch ab. Bedächtig geht er weiter. Zwischen den sich vorwärtsschiebenden Besuchern des Jahrmarkts schafft er sich eine respektvolle Distanz.
Ich hörte hinter mir eine jammernde Stimme. Ein Mann, dem die rechte Hand fehlte, hielt in der linken einen kleinen Karton, in dem einzelne Münzen rappelten. Er stieß die Schaulustigen an, hielt ihnen den Armstumpf entgegen. Mir tat er leid mit seinem traurigen Gefuchtel, ich kramte nach einer Münze. Eine alte Frau blickte mich streng an und macht eine abwehrende Geste wie: Geben Sie ihm bloß nichts. Sie schubste den Bettler, zischte ihm etwas zu, das nach äußerster Verachtung klang. Dann schrie ein ihm gleichaltriger Mann auf ihn ein, der Mann duckte sich, kläglich hielt er die linke Hand über den Kopf, umso mehr fehlte die rechte bei dieser Bewegung des Schützens. Es sah aus, als sei er es gewohnt, geschlagen zu werden. Der würdige Greis kam auf den Mann zu, tippte mit dem Zollstock an den Armstumpf, jetzt wimmerte der Mann hell auf wie ein Kleinkind. Der Greis scheuchte ihn weg, die Zuschauer machten finstere Mienen.
Lautsprecher sind über den Köpfen an den schütteren Bäumen montiert. Die Singstimme einer Frau hüllt den Raum zwischen den Buden ein, sie singt langgezogene Vokale, die nicht aufhören wollen und bis in die nächste Gasse reichen, in die übernächste Gasse. Dort steht ein Händler mit Zuckerwatte; ich kaufe eine Portion, ich könnte auch ein Joghurtgetränk, ein Glas Pfefferminztee oder etwas anderes kaufen. Ich wünsche mir die Luft zurück, die ich mitgebracht habe vom Schiff, die Luft, die nachts durch die Spalten der Jalousien in die Kabine strich. Ich stelle mir vor, anstatt der Stimme, die