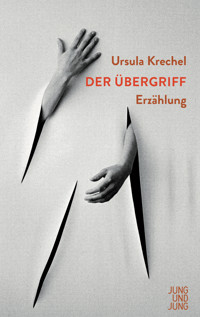Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Shanghai am Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Für Tausende Juden ist es das letzte Schlupfloch, und sie kommen, ohne Visum, aber voller Hoffnung. Ursula Krechels bewegender Roman erzählt von Menschen, die versuchen, das Überleben zu lernen.Da steht sie mitten in einer Restaurantküche in Shanghai und walkt den Teig, als ginge es um ihr Leben, und das tut es auch. Ein Strudel soll es werden, ein süßer natürlich, aber dann füllt sie, was noch übrig ist, mit zartem Gemüse, und auf einmal hat sie der chinesischen Küche etwas hinzuerfunden, was niemand mehr missen möchte: die Frühlingsrolle.Franziska Tausig ist eine von vielen, der Berliner Buchhändler Ludwig Lazarus ist ein anderer, und am Ende waren es achtzehntausend Juden, die seit 1938 eines der letzten Schlupflöcher noch nutzen konnten und so im fernen fremden Shanghai überlebten. Sie kamen ohne Visum und Illusionen mit einem Koffer und zehn Reichsmark in der Tasche, Anwälte, Handwerker, Kunsthistoriker, und wenn sie in dieser überfüllten Stadt und dem feucht drückenden Klima zurechtkommen wollten, dann waren Erfindungsgabe und Tatkraft gefordert. Nicht jeder war, nach dem, was hinter ihm lag und vor ihm, dazu imstande.Atemberaubend vielstimmig und vielschichtig erzählt Ursula Krechel davon. Aus langjährigen Recherchen entstand so der Stoff zu einem weitgespannten erzählerischen Bogen, der den Leser in eine Welt bringt, die einem näher ist als erwartet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Shanghai fern von wo
© 2008 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck: Friedrich Pustet, RegensburgISBN 978-3-902497-44-4
URSULA KRECHEL
Shanghai fern von wo
ROMAN
„Nach Shanghai.“
„Was? So weit?“
„Weit von wo?“
Salcia Landmann zitiert ein Gesprächzwischen zwei Emigranten
„Wir trauten uns nicht, von unserem Überlebenin Shanghai zu erzählen. Andere hatten so vielSchlimmeres erlebt und nicht überlebt.“
Anonymer Emigrant
Das Können
Was ist Tausig für ein Mensch? Man muß ihn von weither holen, und wenn man das getan hat, muß man die Frage stellen: Kann man ihn verpflanzen? Kann man sich ihn verpflanzt vorstellen? Man muß die Lockerheit vortäuschen, mit der eine große schwere Hand einen Menschen aus seinem Haus, aus seiner Stadt hervorholt, faßt und an einen anderen Ort, auf einen anderen Kontinent setzt, die Beweglichkeit, die Biegsamkeit, das Training einer allumfassenden Regsamkeit ist dem Menschen nicht eingeschrieben. Man kann sich diese große schwere Hand (Pranke?) nicht als eine Gotteshand vorstellen, eher als die eines grobianischen Riesen, eine Hand aus einem finsteren Märchen, wenn man nicht mehr an Gott, aber vielleicht noch an die Wunder in den Märchen glaubt. Mit anderen Worten: man kann sich die Verpflanzung von Tausig nicht wirklich vorstellen. Tausig war ein aufstrebender junger Rechtsanwalt.
Der Buchhändler Ludwig Lazarus, der nie mit seiner Meinung hinter dem Berg hielt, sagte: Der Mensch versenkt sich, versucht zu begreifen, greift einen Grashalm oder ein Spinnenbein, einen Lichtfunken in der Stadt und weiß nichts, nichts. Keine Antwort. Das Warum ist ein Wassertropfen, verdunstet, schlägt sich an einem anderen Ort nieder. Es knickt das grüne Holz ganz leis. Oder wie Ludwig Lazarus fragte: Warum die menschliche Niedertracht, warum die Abreißer, die Niederreißer auf alle Zeit? Und hatte keine Antwort auf seine eigene Frage und Tausig auch nicht. Aber Tausig glaubte an nichts, deshalb stellte er auch nicht solche Fragen wie Lazarus, er war Agnostiker von Natur aus und blieb es, und er war Rechtsanwalt von Beruf. Er glaubte, daß man Recht sprechen und rechtlich empfinden könne, er glaubte auch, daß man ein Recht durchsetzen könne oder daß jemand einen Rechtsanwalt brauche, der ihm hilft, sein Recht durchzusetzen. Er glaubte auch, man hätte Ludwig Lazarus damals in Berlin zu seinem Recht verhelfen können. Seine Eltern hatten in weiser Voraussicht kurz vor der Machtergreifung Hitlers ihre Buchhandlung verkauft, das Kapital sollte Lazarus eine Art Leibrente sichern, doch die Käufer hatten die Gunst der Stunde gewittert und den Vertrag angefochten. Prompt stufte ihn ein Berliner Gericht als „sittenwidrig“ ein. Das wäre ja noch schöner, einem mißliebigen Juden lebenslänglich eine Summe auszuzahlen, wenn jüdisches Eigentum ebenso für einen Spottpreis „arisiert“ werden konnte, gleichgültig, wie lange das „lebenslängliche“ Leben für einen derart Enteigneten noch sein würde. Aber Lazarus winkte ab. Lassen Sie mal, Herr Tausig, Sie kennen das österreichische Recht, aber nicht das grassierende Unrecht. Darauf wußte Herr Tausig nichts zu sagen.
Daß Tausig glaubte, man könne Recht sprechen und rechtlich empfinden, ein Recht durchsetzen mit Hilfe eines Rechtsanwalts, war nicht falsch. Kein Glaube war falsch, wenn man ihn besaß. Daß er selbst einmal rechtlos werden würde, hätte er nie gedacht, vielleicht mangelte es auch an Phantasie dazu. Warum sich etwas mit Macht vorstellen, das unvorstellbar ist? Tausig war ein ungarischer Rechtsanwalt aus Temeswar, Temeswar war ein Teil von Österreich-Ungarn, daran war kein Zweifel, in der Stadt wurde deutsch und ungarisch gesprochen, es wurde österreichisch geurteilt, das verwirrte niemand, es war eine kluge Zeit, in der man Agnostiker sein konnte oder Jude oder Protestant in Karlsbad und Katholik oder Nichtkatholik in Linz und Moslem oder Nichtmoslem oder Agnostiker in Mostar, das war Österreich-Ungarn, man mußte nicht urteilen, man konnte sich auf ein Recht berufen, das weitreichend war. Die Köpfe in Temeswar waren rumänisch und deutsch und ungarisch, das machte nichts, man ging ins Caféhaus, rauchte, trank, winkte dem Kellner, ließ sich ans Telephon holen. Ausgerufen zu werden, war eine große Neuheit: Herr Rechtsanwalt Tausig, bitte! Der Rechtsanwalt Tausig richtete sich auf, erhob sich, er war groß gewachsen, durchschritt das Café machtvoll, vielleicht ein bißchen tolpatschig, er nahm den Hörer in die Hand, hörte, hörte zu und wiegte bedächtig den Kopf, Schweigepflicht dem Mandanten gegenüber, der erst ein künftiger Mandant zu sein schien, ernsthaftes Abwägen, Kopfnicken ins Telephon hinein, was unsinnig war, er merkte es selbst, und Diskretion. Ich komme sofort, sagte er. Aber es hatte gar kein Mandant angerufen, seine junge Frau Franziska hatte ihn sprechen wollen, nur einfach seine Stimme hören! Die tiefe, weiche, überaus höfliche ungarische Stimme. Und er lachte ins Café hinein, flüsterte in die Sprechmuschel, lachte vergnügt über die Sehnsucht seiner Frau, eine Hörsucht, eine Liebessucht, eine Glückssucht, deren Urheber und Empfänger er gleichzeitig war. Er zahlte und verließ das Café. So hatte er es Lazarus erzählt, und so hat Lazarus es wiedergegeben, voll Staunen über eine Liebe, wie er sie nicht kennenlernen durfte.
Sie hatten 1912 geheiratet, ein schöner Mann, ein kluger Mann mit großer Zukunft, sagte Franziska Tausig später, und alle, die ihn kannten, stimmten zu. Und sie, Klavier, Fremdsprachen, gebildet in feiner Haushaltsführung, für eine bessere Wienerin genügte das, so sah es 1912 aus. Ihr Vater: ein reicher Holzkaufmann, klaftertief in Eiche, spätabends fuhr sein Bleistift Zahlenkolonnen entlang, klopfte aufs Holz des Schreibtisches. Bauholz war eine sichere Sache, Bauholz wurde überall gebraucht, wo Zukunft war, wo für eine Zukunft Gebäude mit riesigen Dachstühlen errichteten wurden, also überall in Österreich-Ungarn, wo die Eisenbahn hinreichte, fast überall. Franziska Tausig sagte: Ich hatte eine einzige Aufgabe im Leben, und die war nicht übermäßig schwierig zu erfüllen. Ich mußte eine passende Ehe eingehen, um nicht mehr nur Tochter aus gutem Haus zu sein. Sie tat das, indem sie den Rechtsanwalt Tausig wählte. Die Ehe wurde in Weiß geschlossen mit Bravour. Danach schien das Leben ein breiter Strom zu sein, donauartig in einem breiten Bett, ein Strom, der trug sie, ganz von selbst ergab sich „Leben“. Aus Leben wurde Lebensgewißheit, Tage, Wochen, Jahre an einer Perlenkette aufgereiht, Freude und Harmonie, ein Tasten, Sanftmut des Verbundenseins. Spitzendeckchen auf den Wiesen, das silberne Fischbesteck stand stramm am Kai, und wir Glücksmenschen, sagte sie später zu Lazarus, immer mittendrin. Dann war das Glücksmenschentum vorbei, aber damals, schwimmtüchtig lebenskräftig, immer mittendrin. Als 1918 Temeswar rumänisch wurde, war das ein Pech für den ungarischen Rechtsanwalt, ein Pech für die verwöhnte Gattin, Österreich-Ungarn war ein tiefes Loch geworden, in das mancher fiel. Weg mit dem ungarischen Rechtsanwalt, ein neues Recht mußte her, Tausig glaubte an das Recht und hatte wieder recht. Ein ungarischer Rechtsanwalt hat in Rumänien keinen guten Stand. Also weg mit dem Ungarn, der nur zufällig ein Jude war. Tausig war Agnostiker und Sozialdemokrat, eine aparte Kombination, auch in Temeswar. Seine Frau ging an hohen Feiertagen in den Tempel, das genügte. Der schwiegerväterliche Holzhandel hatte Platz für Herrn Tausig und Frau Tausig, das Fischbesteck, das Porzellanservice mit Goldrand, das Klavier. Deshalb zogen sie nach Wien. Herr Tausig war nicht mehr Rechtsanwalt, das war sehr schade, aber nicht justitiabel, die Vaterfirma knickte das grüne Holz ganz leis, doch es trieb weiter in dünnen Ästchen.
Er hörte nicht mehr gut, im Krieg hatte er genug gehört, zu viel gehört, Geschützdonner hatte sein Innenohr verletzt. Ein Rechtsanwalt ist ein Streitvermeider, er hat die Paragraphen im Hinterkopf, aber geradheraus muß er hören, was gesprochen wird. Der Streit entbrennt, vielleicht kann man ihn noch eindämmen (löschen?), jemand hat sich verrannt, der Rechtsanwalt rennt ihm nach und nötigt ihm das Recht auf, das er beinahe verlassen hätte. Beinahe wäre der Mandant im rechtsfreien Raum hoffnungslos herumgestolpert, das mußte vermieden werden. Der Rechtsanwalt ist ihm Stock und Stab. Tausig hörte nicht mehr gut genug, als Rechtsanwalt hätte er das Gras wachsen hören müssen, das feine ungarische Gras, von einem sanften Wind gewiegt, einem Steppenwind, über den die Hufe kleiner Pferde polterten. Lenau schrieb Gedichte, in denen klang die Luft wie Hufgetrappel, und Zügel schossen im Flachen; Frau Tausig kannte solche Gedichte auswendig. Das Gras war niedergetreten worden in der Sommerhitze, verbrannt im Krieg. Da war Temeswar noch nicht rumänisch, und er war noch ein junger Mann mit einer schönen kraftvollen Frau. Kirschaugen, Weichselkirschaugen und maronenbraunes Haar, feine biegsame Finger, die auf dem Klavier die Tasten anschlugen, über eine Bilderleiste wischten, prüften, ob Staub darauf sei, auf dem Brett den Teig kneteten, bis er Blasen warf. Es war schön, ihr zuzusehen, wie ihr Gesicht sich rötete beim Backen, und dann aßen sie den Strudel noch ganz warm, gleich nachdem sie ihn aus dem Ofen gehoben hatte, und lachten sich an, zuerst leckten sie sich die Lippen, dann die Achseln, die Zehenzwischenräume, die Ohrmuscheln, die Schwimmhäute, auf denen die Samenfäden paddelten. Er: ein geborener guter Mensch, so sagte seine Frau von ihm. Er hörte nicht gut genug, der Rechtsanwalt Tausig, aber er hatte wache Augen, und er war verliebt mit Augen, Nase, Mund und Ohren, es machte nichts, daß er schlecht hörte. Er sah seine schöne Frau an, ihre Lebhaftigkeit, Kirschenmund, Ohrmuschelvornehmheit, Agnostiker und Sozialdemokrat, eine feine, ganz ungewöhnliche Mischung, dazu die Frau, eine wunderbare Frau, das fand auch Lazarus.
Tausig war ein tatkräftiger Mann, er fügte sich in die Veränderung, klagte nicht, schmiegte sich ihr an, eine Hebebühne, ein Kran, ein Krieg, eine große, grobe anonyme Hand hatte ihn ergriffen, ihn von Temeswar nach Wien versetzt. Franziska Tausig hatte das Bettzeug, die Wiege, die in der Familie weitervererbt wurde, das noch unbenutzte Kinderspielzeug (das anzusehen ihr Freude machte), das Fischbesteck, die Kristallgläser, die Spitzendecken eingepackt und in Wien wieder ausgepackt. Herr und Frau Tausig erinnerten sich nur ungenau, mit welcher Schnelligkeit die Gewißheit, einen Boden unter den Füßen verloren zu haben, um sich griff. Es war ein neuer schwankender Boden (abschüssig), auf dem man gehen lernen, tanzen lernen mußte. Tausig wechselte den Beruf, notgedrungen, er wurde Fürsorgerat der Sozialdemokratischen Partei. (Hatten andere Parteien auch Fürsorgeräte? Aber Wien war sozialdemokratisch bis auf die Knochen, die noch nicht sichtbar waren, als er kam.) Tausig besuchte arme Leute, gelähmte alte Frauen, die jahrelang ihre Wohnung nicht mehr verlassen hatten, Wohnungen, in denen es nach Alter und Armut roch, kinderreiche Arbeitslose in winzigen Wohnungen, in rachitischen Häusern, zahnlos die Treppengeländer und die Fußmatten vor den Wohnungstüren ein Gelump. Besser keine Fußmatten als solche, sagte er sich. Rotznasige Gören saßen auf den Stufen, keine Schürzenzipfelkinder, sie staunten ihn an mit offenem Mund und Nasenlöchern, in denen ein Finger steckte. Die Tausigs wünschten sich auch ein Kind, lange wünschten sie sich ein Kind, und dann bekamen sie ein Kind, es war wie im Märchen, ein Glück, ein Sterntalerglück, das ihnen in den Schoß fiel, aus dem Schoß gezeugt, aus dem Schoß geboren. Ihr Sohn kam in Wien zu Welt, ein Sohn mit dunklen Augen und einem schwarzen Flaum auf dem Schädel und Fäustchen, Fäustchen, die er ballte. Stundenlang konnte Tausig den Sohn Otto ansehen, wenn er von den armen Leuten kam. Ein Sohn, der blinzelte, spuckte, schniefte, er schlief wieder ein mit einem schief verzogenen Mündchen, und Tausig war stolz auf ihn, und er hatte wieder recht. Als das Kind ein bißchen älter war, schon Treppen steigen konnte mit Eifer, nahm er es mit zu diesen Besuchen, und das Kind staunte die Armut an, und die Armut war keine Lehre, eher ein Schock, eine Abschreckung, etwas zum Angsthaben. Herr Tausig sah die Armen, die Arbeitslosen, die Frauen in den verblichenen Kittelschürzen mit knotigen Arthrosehänden, er hatte ein mitleidiges Herz, zu weich für einen Fürsorgerat. Kam er an einem Würstelstand vorbei, kaufte er Würstel, soviel er tragen konnte, und schenkte sie den Arbeitslosen. So ein Mann war Tausig, ein bewundernswürdiger und gleichzeitig bemitleidenswerter Mann, ein Mann ohne Ökonomie, aber mit einer Vorstellung vom Elend und wie es zu ändern war. Er führte den Sohn an das Elend heran und zeigte ihm, daß es möglich ist, Elend zu lindern. Und auch: daß es mehr Elend gibt, als ein einzelner zu lindern imstande ist. Er war ein Mann, der recht hatte, und schon das war bemitleidenswert und schockierend zugleich: aus dem offenkundigen Recht wurde nichts, gar nichts.
Die Vaterfirma plötzlich arisiert, das Ersparte frißt der Staat, im Kontor schließt sich der Schwiegervater ein. Da ist nichts mehr, er läßt den Bleistift fallen, nichts gehört ihm mehr. Der Holzhandel über dem Kopf angezündet und zerstoben. In seiner Firma regiert jetzt Herr Schmitt, ein früherer Angestellter im Holzhandel, bei uns geflogen, sagte Frau Tausig mit Verachtung, als sie Lazarus und auch Brieger von sich erzählte. Nicht auf Anhieb war festzustellen, an wen sie sich wandte. Der schöne Weichselkirschmund erzählte, und zwei Männer hörten zu, hellhörig Lazarus, und Brieger wie ein stummer Zeuge, hörte zu und merkte sich alles, was er hörte. Und was er sah um so mehr: Weichselkirschmund. Franziska Tausig sprach erbittert und brauchte auch Zuhörer, wenn sie vom väterlichen Holzhandel sprach. Von der Sozialdemokratie in Wien wußte sie nicht so viel. Aber über den Holzhandel erregte sie sich: Herr Schmitt, bei uns geflogen und in der Partei beharrlich aufgestiegen, ein Abwickler im großen Stil, und wir sind kleine Fische auf dem Trockenen, geknickt das Holz. Ein Vertrauensmann, dem wir gründlich mißtrauen. Herr Schmitt teilt Tausigs nun das Geld zu. Das Geld ist knapp, wird künstlich verknappt, verflüchtigt sich im Nu, in Wochen, ängstlichen Monaten. Eines Nachts wird Herr Tausig abgeholt. Die Tausigs hatten die Tür verrammelt und hätten nie geöffnet, wenn in der Nacht geklopft, geklingelt worden wäre, da war es gut, daß Tausig so schlecht hörte. Aber Tausig war in der Nacht in den Korridor gegangen, um sich am Zapfbecken ein Glas Wasser einzuschenken, er öffnete die Tür schlaftrunken und lief den SA-Männern förmlich in die Arme, sie nahmen ihn mit, so wie er war, im Morgenrock. (An dieser Stelle bleibt die Zeit stehen für ihn. Nur seine Frau muß die Uhr weiterstellen, in einem wilden Takt tickt sie nun, und Frau Tausig hört sie, sie gellt in ihren Ohren.) Als er zurückkommt, spricht er nicht. So sprich doch, sprich doch endlich, bitte, fleht seine Frau ihn an, ruft sie, schreit sie in ihrer Not. Er war ein ungarischer Rechtsanwalt aus einer vormals gewesenen Zeit, auch ein Sozialdemokrat gehörte in eine frisch und blutig zerstörte Zeit, sie kannte beide, den Rechtsanwalt, den Fürsorgerat, und es war dumm, sie zu verwechseln, sie liebte sie beide. Er war ein anderer Mann geworden in den Wochen, jetzt war er nur noch Gram: zerstoben zwanzig Jahre Holzhandel in Wien wie nichts. Der Schock saß tief, ein dürrer, trockener Span, man brauchte keinen sozialdemokratischen Fürsorgerat, man machte reinen Tisch, einen Tisch, auf dem kein Krümel übrigbleibt.
Wie war Tausig aus dem Konzentrationslager entlassen worden? Frau Tausig erzählte das später Lazarus: Es hatten in Wien einige Büros aufgemacht, deren Adressen von den Angehörigen der Gefangenen im Flüsterton weitergegeben worden sind, nachdem sie sie aufgesucht hatten in großer Heimlichkeit. Wer das Glück hatte, im Ausland Verwandte oder Freunde zu besitzen, die ein Affidavit für Amerika oder ein Permit für England beschafften, der konnte dort eine echte Passage buchen. Es gab aber auch die Möglichkeit, für eine überhöhte Summe eine falsche Passage zu kaufen, mit der man seine Angehörigen vorläufig aus dem Konzentrationslager befreien konnte. Frau Tausig kaufte eine solche falsche Passage. Ihr Vater half mit Geld, das nicht im Holzhandel steckte, und so kam ihr Mann nach Hause. Sehr niedergeschlagen war er, als er erfuhr, daß es keine richtige Passage war. Er war nicht nur niedergeschlagen, er machte seiner Frau auch Vorwürfe, daß sie so viel ausgegeben hatte, das vielleicht für anderes hätte verwendet werden können. Frau Tausig war ein wenig erstaunt über seine Ungehaltenheit, sie begriff sie nicht, für was hätte sie denn das Geld verwenden sollen, wenn keine richtige Passage zu bekommen war? Du bist frei, sagte sie immer wieder ihrem Mann, freigekauft. Aber der Begriff schien nicht zu ihm zu dringen. Bin ich ein Sklave, freigekauft? Die Frage ließ Franziska Tausig nicht gelten.
Zwei Wochen später kommt der Blockwart, klingelt kräftig an der Tür und macht ein taktvolles Gesicht. Franziska Tausig bemüht sich, ihre Gesichtszüge zu kontrollieren, keine Angst, kein Befremden, ja, auch Höflichkeit hilft. Und ihr Mann bleibt im Zimmer, sie schließt die Tür hinter sich, er soll nicht hören, wie sie mit dem Blockwart spricht, als hätte sie keinen Mann, keinen Sohn. Ihr Sohn hat noch vor einem Jahr für die Kinder des Blockwarts wie für andere Kinder Kasperletheater gespielt mit Teufel, Schandarm und Krokodil, die ganze lustige Elendsmasche, die alle vergnügte, man wußte, wo das Böse war, und prügelte darauf ein in guter Wiener Tradition. Da war der Blockwart noch nicht Blockwart, sondern führte ein Milchgeschäft mit großen verbeulten Kannen und kleinen Packerln Topfen und war ein Nazi, als man in Österreich eigentlich noch keiner sein konnte, jedenfalls amtlich nicht. Aber das hatte sie vergessen, wollte sie vergessen. Liebe Frau Tausig, so beginnt er gutnachbarlich, es ist ein Glück, daß Ihr Mann entlassen worden ist, ein Glück, an dem ich nicht ganz unschuldig bin. Ja?, denkt Franziska Tausig, ja? Und denkt: Red nur weiter. Sie denkt an das Geld für die falsche Passage, das sie hinausgeschmissen hat, und muß sich ein ausgesprochenes „Ja, und?“ verbeißen. Ja, bohrt der Mann weiter (sein „Ja, und?“ verschluckt er), und wissen Sie nicht, daß ich Sie gerettet habe? Aber das können Sie ja nicht wissen, fällt er sich selbst ins Wort. Die wollten Sie schnappen, und ich hab denen gesagt, daß Sie Ausländer sind. Aus Ungarn sind Sie, nicht wahr? Oder aus Rumänien? Die Zeit an der Tür dehnte sich. Was sollte Frau Tausig sagen, was sollte sie sagen?
Aber da schwatzte der Mann schon weiter: Wissen Sie, wenn man könnte, wie man wollte, wie leicht wäre es, Menschen zu helfen. Man würde es ja so gerne tun. Schauen Sie, Sie haben da eine Schreibmaschine. Wenn man solche Briefe schreiben könnte, damit wäre sehr vielen Menschen zu helfen. Kurzer Prozeß, Frau Tausig schenkte ihm die Schreibmaschine, damit sie ihn los wurde. Er ging und kam am anderen Tag wieder. Frau Tausig, sagte er, das Silber da in der Vitrine, was glauben S’, wenn man das jetzt verkaufen würde, davon könnte man gut und gern leben. Daß der Fürsorgerat nicht mehr arbeiten durfte, wußte er. Frau Tausig, sagte der Blockwart, forderte er eher schon, geben Sie mir das Silber, ich kenne einen Händler, der macht einen sehr guten Preis. Soll ich das für Sie unternehmen? Der Mann hätte ihr in Nullkommanichts die Wohnung ausgeräumt aus reiner Mildtätigkeit.
Neun Wochen auf einem überfüllten Schiff, gepfercht wie eine Ladung Heringfässer oder Öl. Es war ein deutsches Schiff, das in Fernost verschrottet werden sollte. Das blaue Wasser des Ozeans färbte sich schmutzig gelbbraun, neun Wochen, überlang und gedehnt, schnurrten zusammen zu einem einzigen Abschied und zu einer Ankunft. Neun Wochen voller Angst: das Schiff drehte ab, oder es durfte nicht landen und würde seine schwere Passagierlast zu einem Amalgam aus Kummer und Hoffnungslosigkeit verdauen, zermalmen. Das Schiff umrundete das Kap der Guten Hoffnung, weil das Deutsche Reich sich weigerte, Devisen für die Kanalgebühren der Suez-Passage zu entrichten. Aber das Schiff fraß sich Meile für Meile durch den Stillen Ozean. Am Ende der Reise, aber noch nicht am Ende, das kannte Lazarus auch. Die Dunkelheit, die Schwüle hüllte die Scham ein. In der Nacht auf dem schwankenden Schiff waren die Erniedrigungen in Wien ganz nah, doch sie näherten sich Shanghai, der Küstenstreifen war eine dunkle Wand, auf die die Vergangenheit prallte. Es war, als würde der Schiffsbug eine schlammige, schwere Masse zerteilen, einen feuchten, heißgerührten Brei. Herr Tausig trug auf dieser Reise fast immer eine Sonnenbrille. Er nahm sie ungern ab, unter ihr tropfte oft Flüssigkeit in den Hemdkragen. Unendlich schwer war ihm der Abschied von seinem Sohn gefallen, schwerer als seiner Frau. Frau Tausig sagte sich: Der Sohn ist in Sicherheit, er ist in England, das ist ein Geschenk, auch wenn wir es jetzt nicht annehmen können, das Geschenk. Ihr Mann sah es anders: Er (der Sohn) ist von uns getrennt und wir von ihm, das ist ein Unglück, das nicht aus der Welt zu schaffen ist, dagegen konnte seine Frau nichts sagen. Sie weinte nicht, um ihn, den Mann, den Vater von Otto, nicht weinen zu machen. Aber sie stellte sich den Sohn auch weinend vor, weinend um die gottverlassenen Eltern auf der Reise nach Shanghai.
Es rumorte in den Laderäumen Tag und Nacht, das Ziel der Reise mußte nahe sein. Dinge wurden weggeworfen, die die Reisenden für unnötig hielten. Manches fiel ins Wasser, wurde leichthändig den Fluten übergeben. Doch das winzigste Zettelchen Papier wurde glattgestrichen, vielleicht brauchte man es noch, um eine Nachricht darauf zu schreiben. So schwer war es, sich daran zu gewöhnen, bitterarm zu sein. Es hielt die Passagiere nicht mehr in den Kabinen und im überfüllten Zwischendeck, sie drängten auf das Oberdeck, die besten Plätze an der Reling hatten Jugendliche ergattert. Der Schiffsbug sägte durch die trägen Wassermassen, das Land kam näher, schon war die Uferpromenade zu erkennen, Leute schrien, jubelten, fielen sich in die Arme. Endlich, endlich nahte das Ende der Reise, man sah die Stadt, man sah Shanghai! Die ersehnte, die befürchtete, die gefürchtete Stadt, eine fremde Respektsperson. Da wurden die Schiffsmotoren ausgeschaltet, der riesige Dampfer stand in der gelben Brühe, tutete in die Luft, die Passagiere mucksmäuschenstill, wie versteinert im Schwülen. Mußte das Schiff abdrehen, so kurz vor der Landung? War alles vergebens gewesen: sich losreißen, eine Schiffspassage ergattern, zuerst eine falsche für viel Geld, dann eine gültige für noch mehr Geld, die lange Reise, endete sie im Nirgendwo? Herr Tausig rückte die Sonnenbrille zurecht, schob sie auf die Nasenwurzel, er wollte nicht gesehen werden. Aber seine Frau sah ihn, sah seine hängenden Schultern, sein spitz gewordenes Kinn, die Bartschatten, und sie sah hinter ihm den Rechtsanwalt aus Temeswar, der er gewesen war, in den sie sich verliebt hatte. Er (der frühere) nickte ihr zu, er (der frühere) tippte ihr auf die Schulter, machte Mut, ja, das war der Mann, den sie geheiratet hatte, und eine Fröhlichkeit der Ankunft kam über sie, bei allem Zweifel, wo und wie sie ankommen würden, der alte blaue Himmel war schmutziggrau, aber es war derselbe Himmel wie in Temeswar und in Wien. Im Hafen lagen Kriegsschiffe, gewaltige Pötte, es wimmelte von kleinen Booten, später lernten die Tausigs, daß sie „Sampans“ hießen. Große Dschunken mit kunstvoll geflickten brauen Segeln erinnerten die Reisenden daran, daß sie sich im chinesischen Gewässer befanden. Handelsschiffe aus aller Herren Länder luden und löschten.
Plötzlich löste sich ein Schrei vom Unterdeck: Der Lotse kommt an Bord. Der Lotse. Die Menge an der Reling, dicht gedrängt, jubelte, die Anspannung fiel ab. Eine Barkasse näherte sich dem Schiff, knatternd und wellenschlagend, eine Strickleiter wurde hinuntergelassen, der Lotse kletterte hinauf, mit ihm ein Arzt, ein Beamter des Magistrats, ein Dolmetscher und Schreibkräfte, alles sehr gemächlich. Daß die Passagiere ausgehungert waren, daß endlich etwas geschehen sollte mit ihnen nach der langen Reise, die Hinzugestiegenen schienen es nicht zu wissen oder zu ignorieren. Die Kommission zog sich mit dem Kapitän in den Rauchsalon zurück, Stewards brachten Getränke, Zeit verging, fiel in ein Loch, und es blieb eine entnervend lange Zeit. Am liebsten hätten die Passagiere an der Tür gelauscht. Doch dann geschah etwas, das Hoffnung machte. Matrosen stellten Tische auf, sie brachten Schreibmaschinen und Tuschfläschchen und legten haarfeine Pinsel, Stempel und Stempelkissen bereit, alles wurde für die Arbeit der Einwanderungsbehörde vorbereitet. Der Magistratsbeamte setzte sich an einen der Tische, die Schreibkräfte an einen zweiten, der Dolmetscher beugte sich über das rechte Ohr des Magistratsbeamten, er hatte ein dünnes, papierenes Lächeln im Gesicht, als er seine Manschetten zurechtrückte, ein Wink des Magistratsbeamten, ein feiner Satz des Dolmetschers, der die Liste der Passagiere plötzlich vom Kapitän gereicht bekommen hatte und in der Hand hielt: Bitte nach Aufruf vortreten! Und so traten die Passagiere vor, zeigten ihre Ausweise und ihre Belege für die Schiffspassage, manche hatten eine Mappe mit Zeugnissen, aber der Dolmetscher winkte ab, wie von vornherein ermüdet, wenn jemand sie eilfertig öffnete. Alles wurde verglichen und abgehakt, dann stellte der Magistratsbeamte eine Frage, und der Dolmetscher stolperte ein wenig mit der Zunge, als er sie übersetzte. In den Pässen stand jeweils eine Berufsbezeichnung, aber der Dolmetscher fragte nicht nach dem Beruf (Rechtsanwalt?), sondern fragte jeden einzelnen Passagier: Was können Sie? Das brachte die Passagiere in Verlegenheit. Ein Junge, gerade dem Schulalter entwachsen, sagte: Ich kann auf Bäume klettern und jodeln. Das mußte in aller Sorgfalt übersetzt werden, wobei diesmal ein messerscharfes Lächeln im Gesicht des Magistratsbeamten stehenblieb und in der Hitze gefror. (Überhaupt wurde viel gelächelt, mehr als die Tausigs in den letzten Monaten lächeln gesehen hatten. Ob das gut war oder nur ein Trick, das würde sich herausstellen.) Bis zum T wie im Namen Tausig dauerte es sehr lang. Die heiße Luft stand still, dramatisch still und trieb den Schweiß aus den Poren. Sofort war das Hemd ein nasser Lappen, die Strümpfe klebten an den Fersen und den Waden. Was kann ein Rechtsanwalt? Hier stand das Recht blitzend und geschliffen, hier brach es, wurde es gebrochen, fiel in Scherben, die niemand auflas, denn sie verletzten den, der sich danach bückte. So war es schon in Temeswar gewesen, als die Rumänen ihr eigenes Recht behaupteten, das früher ein nahezu allgemeingültiges Recht war von Vorarlberg bis weit nach Ungarn und auf den Balkan, jetzt auf dem Schiffsdeck versank das österreichische Rechtssystem, das hochgelobte, einmal allumspannende, in einer trägen Brühe, es gab’s nicht mehr in Shanghai. Gut war es, die Sonnenbrille vor den Augen zu behalten. Was kann ein österreichischer Rechtsanwalt in Shanghai? Der Dolmetscher lächelte, schwieg ebenso betreten wie Herr Tausig, ein festgezurrtes Lächeln im Gesicht, das durch nichts zu erschüttern war, was kann ein österreichischer Rechtsanwalt in Shanghai?, Schulterzucken, eigentlich kann er nichts. Weiter in der Liste. Was kann eine Hausfrau aus Wien? Sie sieht sehr nett aus, nicht zu groß, nicht zu dick, wenn auch verdrückt, verschwitzt nach der langen Reise, ein freundliches, verständiges Gesicht oben, eines, das nichts versteht, aber Verständnis zeigt für die Situation des Ausgefragtwerdens, die auch den Fragenden nicht angenehm ist. Was können Sie?, wird sie gefragt. Sie kann so allerhand, ein Kind aufziehen, sie kann stricken, häkeln, Klavierspielen, sie kann kochen, backen, das ist schon eine ziemlich lange Liste. Daß sie etwas kann, was gebraucht werden könnte, daran hat sie nicht gedacht. Man verbeugt sich vor ihr, und sie hat den Instinkt, sich auch zu verbeugen, sie verbeugt sich, verständig, so sieht man es nicht, wie verschwitzt sie ist, so sieht man ihren geradegezogenen europäischen Scheitel, das dunkle Haar, maronenbraun, ihr Lächeln, wenn sie sich wieder hochrappelt nach dem Verbeugen, man weiß nicht, wozu es gut ist. Aber es sieht gut aus. Papierfeines Lächeln, eine verschwitzte Hand, die jetzt doch gedrückt wird. Es ist die Dolmetscherhand, die die fremden Sitten kennt, die selbst eine heiße Hand ist. Warum kann jemand Deutsch in Shanghai, warum arbeitet er für Chinesen? Alles rätselhaft. Franziska Tausig bekommt einen Schein in die Hand mit schwarzen Tuschefliegenbeinchen und ein Papier, auf das die Schreibmaschine C O O K gehackt hat, der Anschlag war so hart, daß das Papier gelocht wurde. Wo ein O gewesen war, konnte man den Himmel sehen. Franziska Tausig kann nur ein vages Englisch, doch sie hat die Hoffnung, als eine brauchbare Köchin eingestuft worden zu sein, ihr verschwitztes, verdrücktes Herz macht einen Freudensprung, den sie ihrem bekümmerten Mann nicht zeigen will.
Als Herr und Frau Tausig in Shanghai ankamen, niedergedrückt, hatten sie Glück im Unglück. Nach dem Lotsen und den Beamten von der Einwanderungsbehörde kamen Europäer und Chinesen in einem großen Pulk an Bord, gut gekleidete Leute, manche hatten auch einen eigenen Dolmetscher mitgebracht, sie zeigten auf einen Namen und eine Berufsbezeichnung in den Einwandererlisten, ließen die Person aufrufen und fragten wieder nach den Fertigkeiten, sie hatten Arbeitsplätze zu vergeben. Mit der Gewißheit, etwas sehr Gesuchtes bieten zu können, als Retter und Gönner traten sie auf, ernst und gewichtig, und die Passagiere, die in eine Wartehalle geführt worden waren, gerieten sofort in Habtachtstellung. Barfrauen waren sehr gesucht, aber Frau Tausig war keine Barfrau und wollte auch keine werden. Auch Handwerker wurden gebraucht, besonders Schuster oder besser noch Maßschuhmacher, das war ein feiner Beruf, und er wäre in Wien auch ein feiner Beruf geblieben, wenn der, der ihn ausgeübt hatte, nicht Jude gewesen wäre. Ein Rechtsanwalt hatte schlechte Karten, besonders schlechte Karten, wenn er nicht mehr jung und schwerhörig war. Auch Lazarus wurde nicht müde zu sagen: „Die Anwälte waren im Grunde so gut wie verloren, denn was sollten sie mit dem deutschen oder dem österreichischen Recht in China?“ Er wußte von einigen, die bei chinesischen Gerichten zugelassen waren, und ein Jurist, der in Breslau Richter gewesen war, wurde von der Jüdischen Gemeinde in Shanghai beim Schiedsgericht angestellt, das war auch nicht jedermanns Sache. Herr Tausig hatte sich auf die Emigration vorbereitet, indem er einen Kurs im Maschinenstricken gemacht hatte. Eine Strickmaschine mit vielen klappernden Zähnchen, nicht nur zwei Nadeln, sondern einem ganzen Gebiß: das war der letzte Schrei. Und er hatte auch ein Produkt seiner neu erworbenen Tätigkeit mitgebracht, einen Schal, den er seiner Frau gestrickt hatte. Den drehte und knäuelte er in der Hand, aber niemand interessierte sich für sein Produkt. Ja, hätte er eine Strickmaschine mitgebracht aus Europa! Exporteur von Strickmaschinen nach Fernost, das wäre es vielleicht gewesen, allerdings hätte er einen Handelspartner in Österreich haben müssen, aber wer hätte in Gemeinschaft mit einem Juden handeln wollen? Wer hätte sich getraut? So war er am Ende in Wien nicht einmal mehr in der Lage gewesen, eine Strickmaschine anzuschaffen. Die Schiffspassage hatte das letzte Geld verschlungen. Kochen und Backen waren ein weites Feld, Franziska Tausig sah nicht aus wie eine Köchin oder Bäckersfrau, aber die österreichische Küche hatte einen guten Ruf. Ein Herr rief ihren Namen auf, sie kam vor, wollte ihm die Hand zur Begrüßung geben, eine Gewohnheit, die sie schnell verlernen mußte in Shanghai, aber er wollte sie zunächst nur betrachten, betrachtete sie von oben bis unten, die vom Meer zerzauste Frisur, ihr gut geschnittenes, aber verdrücktes marineblaues Kostüm mit einigen Perlmuttknöpfen zwischen Brust und Taille, er betrachtete ihre Hände, Klavierhände, und den Ehering daran, der Blick schweifte zum Rock und den Strümpfen, die viel zu warm waren in der Gluthitze Shanghais, aber eine Dame in Wien trug Strümpfe, sein Blick rutschte hinunter zu ihren Riemchenschuhen. Frau Tausig fühlte sich taxiert wie ein Pferd, so war sie noch nicht angesehen worden, aber es half nichts, sie hielt es aus. Plötzlich hatte der Mann genug gesehen von ihr und fragte sie geradeaus ins Gesicht: Können Sie Apfelstrudel backen? Ich hörte, Sie sind Wienerin. Frau Tausig bejahte erst die eine und dann die andere Frage, und sie bejahte energisch. Kommen Sie morgen in mein Restaurant, sagte der Mann. Wenn Sie Apfelstrudel backen können, einen anständigen Wiener Apfelstrudel, dann stelle ich Sie als Köchin ein. Apfelstrudel hatte sie schon gebacken, manche gelingen, manche nicht, so sind Apfelstrudel nun einmal, launische Burschen sind sie mit einem eigenen Kopf, in dem sie Rosinen haben. Tief vergraben im warmen Backofenbauch lassen sie es sich wohlsein, während der Bäcker, die Bäckerin vor ihnen schwitzt und in die Knie geht. Jeder, der Apfelstrudel backt, weiß das. Können Sie Apfelstrudel backen? Es half nichts, Frau Tausig wollte und mußte die Frage ein weiteres Mal bejahen. Und später, nachdenkend, schreibend, glaubte sie, die Frage freudig bejaht zu haben, die Zweifel schluckte sie hinunter. Daß auch Lazarus Zweifel hatte, Zweifel, jemals festen Boden unter die Füße zu bekommen, deutete er an.
Lastwagen warteten im Hafen auf die Ankömmlinge. Ein Sprecher des Hilfskomitees begrüßte die Flüchtlinge wortreich, Frau Tausig vergaß in ihrer Aufregung sofort, was er gesagt hatte, sie behielt nur einen Satz im Gedächtnis: Jetzt sind Sie nicht mehr Deutsche und Österreicher, jetzt sind Sie nur noch Juden. Herr und Frau Tausig waren noch nie auf einem offenen Lastwagen gefahren, wo hielt man sich fest, wo setzte man sich hin? Diese Fragen erübrigten sich von selbst, es wurden so viele Passagiere auf der offenen Fläche zusammengepreßt, daß alle stehen mußten oder bei einem Ruck, einer plötzlichen Bremsung miteinander umfielen wie Kegel. Die Lastwagen hielten vor einem Gebäudekomplex, der notdürftig hergerichtet war. Es war Krieg gewesen in Shanghai, die Stadt brannte, begrub ihre Toten, von denen die Lebendigen in Deutschland und Österreich nie gehört hatten. Sie waren mit ihrem Überleben beschäftigt. Die Stadt quoll über von Flüchtlingen aus den besetzten Gebieten Chinas. Die Japaner hatten auch Teile der Stadt in Beschlag genommen und gaben ihnen eine japanische Verwaltung. Häuser waren zerstört, und sie mußten mühselig aufgebaut werden, das erfuhren die Neuankömmlinge beim Anstehen nach Essen und Wäsche von denen, die schon länger Emigranten in Shanghai waren, die, das sah man mit einem Blick, nicht mehr auf die Beine gekommen waren. Die Blocks, in denen die jüdischen Emigranten jetzt wohnten, waren zerstörte Häuser. Die ersten Emigranten hatten geholfen, sie notdürftig wieder herzurichten. Es war ein lukratives Geschäft mit der Ware Mensch. Man verfrachtete sie in einen abgerissenen Stadtteil, und sie bauten ihn wieder auf, sie hatten eine Beschäftigung, und der Grundbesitz wurde wertvoller. Nichts wußten die Neuankömmlinge über die Stadt oder beschämend wenig. Man mußte die Stadt studieren. Herr Tausig hinter seiner Sonnenbrille wollte die Stadt nicht in sich aufnehmen, ihren Lärm, ihre Gerüche. Großmächtige Stadt mit ihren vielfach zerklüfteten Verwaltungen, mit zehntausenden von Ausländern aus allen Nationen, der French Concession, dem Internationalen Settlement, dem Western District. Es war erst im Jahr 1937 gewesen, daß japanische Flugzeuge die Stadt bombardiert und schwer beschädigt hatten, danach hatte die Welt die große Stadt wieder vergessen. Japanische Truppen hatten nach heftigem Widerstand der Chinesen den im Nordosten gelegenen Arbeiterbezirk Chapei und den Stadtteil Hongkew, der die größten Verwüstungen erlitten hatte, besetzt. Sie kontrollierten jetzt auch das chinesisch gebliebene Shanghai und den Stadtteil Hongkew. Die Stadt war von ihrem Hinterland abgeschnitten, weitsichtige Unternehmen begannen schon, ihre Firmensitze nach Hongkong oder nach Singapore zu verlegen. Großmächtige Stadt mit ihren Rasenflächen und Tenniscourts, den Hunderennen, den Handelsriesen, die ihre Geschäfte überallhin abwickelten, den eleganten Art-Déco-Gebäuden für die internationale Gesellschaft, nichts wußten die Flüchtlinge, nichts vom unermeßlichen Reichtum der alten Familien und nichts vom Jammer der chinesischen Flüchtlinge, die aus den besetzten Gebieten in die Stadt geflutet waren, zerlumpt, verdreckt, elend und hilfsbedürftig. Nichts wußten sie von der offenen Stadt, offen für jedes Gewerbe, offen für jede Schande, offen für den, der Geld scheffeln wollte, und offen für den, der verhungern mußte. All das war so, weil das kaiserliche China 1843 nach seiner Niederlage im ersten Opiumkrieg von Großbritannien einen Vertrag auferlegt bekommen hatte, der Shanghai zur offenen Stadt machte. Offene Stadt, offene Erfahrung, ein offenes Tor, durch das man geht. Aber daß man nicht wieder hinauskommt, erwies sich erst später. Ein offenes Tor, das sich unweigerlich schließt. Wer einmal in die Stadt hineingekommen ist, findet eine ganz andere Schwierigkeit vor, als er erwartet hat. Er kann jede Arbeit annehmen, die sich ihm bietet. Aber bietet sich ihm eine Arbeit? Eher nicht. Er muß sich die Arbeit, die er tun will, selbst erfinden, ein Gewerbe, eine Beschäftigung, eine Dienstbarkeit, vielleicht nur eine Luftnummer. Die Chance, eine Arbeit zu finden, das merkte Lazarus sofort, war eben gleich groß wie diejenige, in einer Lotterie das große Los zu ziehen. Der Immigrant mußte warten lernen können, Monat um Monat, ein Jahr, bis sich ihm eine Gelegenheit bot. Alle, die nach Shanghai emigriert sind, ob sie nun eine Stellung bekommen haben oder nicht, sagte Lazarus, sind bestrebt gewesen weiterzuwandern. Dazu hätte man ein Visum gebraucht, Geldvorräte zeigen, Bürgen haben müssen, wer konnte das, niemand konnte es. Anderswo wollte man sie nicht mehr. Keiner wollte bleiben, man lebte auf Abruf.
Die japanischen Militärs bestanden darauf, daß sie als Vertreter des Tennōs mit größter Ehrerbietung gegrüßt werden mußten, chinesische Passanten wurden von ihnen auf offener Straße gedemütigt, und da waren die neuen Flüchtlinge aus Deutschland, aus Österreich, die die Demütigungen sahen, die sie fatal daran erinnerten, wie sie in Deutschland, in Österreich gedemütigt worden waren. Lazarus hatte einen Sinn für Proportionen: was man alles lernen mußte. Nichts wußten sie von den anderen Flüchtlingen, nichts von China, feine Unterschiede mußten sie sich einbleuen, foreigner, russian, refugee. Die foreigners waren Engländer, Amerikaner, Holländer, die deutsche Gemeinde mit ihren Konsulatsangehörigen und den Firmenvertretern, ordentlich mit Nationalsozialisten durchsetzt, die lernten sie noch kennen. Von den Russen wußten sie nichts, jetzt konkurrierten sie mit ihnen um Arbeit, und am unteren Ende die Flüchtlinge, die Neuankömmlinge, verloren im riesigen Gewimmel, nichts wußten sie, die refugees.
Der eine Saal für Männer, ein Saal für Frauen, ein paar Hocker und Kleiderhaken, Haufen von Gepäck, Haufen von schmutziger Wäsche, Schuhen, schlammigen Schuhen, verschwitzten, stinkenden Laken und Decken, das war’s. Friß oder stirb. Die Heime waren in den ärmsten Teilen Shanghais eingerichtet worden. Sie waren weit vom Hafen entfernt, weit von den großen europäisch wirkenden Avenuen, den prachtvollen viktorianischen Bank- und Geschäftshäusern, weit von diplomatischen Vertretungen und Konsulaten, jenseits der Gardenbridge, in einem Stadtteil von deprimierender Häßlichkeit. Das Heim, in dem die Tausigs unterkamen, war eine Baracke, in der früher Weißrussen gelebt hatten, so sagte man ihnen. Sie war mühsam zusammengeflickt worden mit Hilfe der ersten Emigranten, die wiederum die Häuser für die zweite Welle der Emigranten zusammenflickten, die reparierten für die nächsten, die ein Obdach brauchten, und so weiter.
An langen kahlen Fluren lagen die Schlafsäle für Männer und Frauen mit Kindern in drangvoller Enge. In diesem Heim waren mehr als hundertzwanzig Betten in einem Schlafsaal. Daran, daß Ehepaare zusammensein wollten, war nicht gedacht. (Wer machte solche Pläne und warum?) Bett neben Bett, kein Spind, kein Hocker, kein Haken an der Wand, jeder allein mit seinem Bündel Unglück, unter dem Bett der Koffer mit den Erinnerungsstücken. Die Ankunft im Heim nagte am Selbstgefühl, und es war abzusehen, daß das Leben im Schlafsaal das Selbstgefühl auffraß. So gab es gleich bei der Ankunft Tränen. Herr Tausig setzte auch an diesem ersten Abend die Sonnenbrille nicht ab, überwältigt vom eigenen Nichtsehenwollen. Dreimal am Tag stellten die Flüchtlinge sich an, um in Blechnäpfen Essen zu fassen. Da sahen die Shanghailander – so nannten sich die alteingesessenen weißen Bewohner Shanghais – die noch sehr gut, eben europäisch gekleideten Menschen in der Schlange stehen, um einen Teller Bohnen oder Maisbrei zu bekommen. Scham in ihren Gesichtern, Scham, ihnen zuzusehen. Die Shanghailander sahen lieber weg.
Herzflattern, ein Zittern in den Händen, Frau Tausig sah die Unterbringung im Heim in der Ward Road wie durch einen Nebel, sie packte nichts aus, sie half ihrem Mann, die Koffer zu verstauen, wie sollte sie schlafen in der Massenunterkunft, im riesigen Schlafsaal mit sechzig Frauen, während ihr Mann im doppelt so großen Schlafsaal für Männer untergebracht war in einem oberen Doppelstockbett wie in einer Jugendherberge. Aber er lernte gleich am ersten Abend einen erstaunlichen Mann kennen, einen Berliner, der munter wie ein Eichhörnchen in die ihm benachbarte Koje kletterte. Brieger aus Charlottenburg, sagte er, Kunsthistoriker. Und wer sind Sie? Herr Tausig wäre bei dieser offiziellen und gleichzeitig ironischen Vorstellung beinahe wieder aus der Bett-Truhe gefallen, in die er gerade gestiegen war, die Vorstellung war wie eine Art von innerer Verbeugung, aber die beiden älteren Männer, die lange mit der Waschschüssel an einem einfachen Wasserhahn angestanden hatten, um sich für die Nacht fertigzumachen, übersahen ihre Nachthemden, die Lächerlichkeit ihrer Begegnung, zu der sie nun einmal gezwungen waren, und sahen durch den jeweils anderen hindurch. Gute Nacht, gute Nacht, Zimmergenosse.
Am Morgen dann ein böses Erwachen wie aus einem schlechten Traum im Saal der hustenden, schlurfenden, schwitzenden Männer, der Kunsthistoriker aus Berlin winkte vom Nachbarbett, man traf sich wieder bei der Frühstücksausgabe in der langen Schlange, Hirsebrei mit getrockneten Datteln, was für ein Frühstück, man traf auch Breslauer und Frankfurter, aber kaum jemanden, der keine größere Stadt im Rücken hatte. Es hatten sich wohl nur Großstädter getraut, nach Shanghai zu reisen, um der provinziellen Erschütterung und Erbitterung der Nazis zu entgehen, das war auch eine Erfahrung, eine niederschmetternde Erfahrung. Um sie zu machen, mußte eine weite und teure Schiffspassage gebucht werden. Dann fand Herr Tausig seine Frau wieder, das machte ihn froh, er trank ein Täßchen Tee, das ein Blechbecher Tee war, aß ein Stück Gebäck, das schmalzig schmeckte, in das seine Frau aber optimistisch und tatkräftig hineinbiß, sie lächelte ihn an, nicht gerade, als hätte sie die Nacht in einem Grandhotel verbracht, doch in einem einigermaßen bürgerlichen Etablissement. (Und er wußte, daß sie mit ihrer ganzen Körperhaltung, mit ihrer ganzen aufgesetzten Erwartung log. Und hätte er es ihr gesagt, sie hätte ihm antworten müssen: Bleib doch, wo du bist, heul doch. Wir müssen weiter.) Das sagte sie natürlich nicht, er fürchtete, daß sie es sagen wollte. Deshalb sagte er auch nichts und schmiegte sich schweigend an sie, seine Frau mit ihrem unnatürlich optimistischen Gesicht. Hier bleibe ich nicht, hatte ihr Mann gesagt, als sie ihn beim Anstellen vor der Essensausgabe wiedersah, ich werde verrückt. Sie hatte auf ihn eingeredet wie auf einen trotzigen Jungen, wo willst du denn hin?, du mußt hier bleiben. Seit sie verheiratet waren, hatten sie sich kaum getrennt. Die letzte Trennung: als man ihren Mann mitnahm mitten in der Nacht in Wien, als sie nicht wußte, ob er jemals wiederkam. Jetzt wollten sie sich nicht mehr trennen. Mit anderen Worten: er trottete ihr nach. Der Restaurantbesitzer hielt Wort und holte Frau Tausig am frühen Nachmittag ab, der Nebel hatte sich kaum gelichtet, und nun kam es darauf an, ihre dunkle Erinnerung an das Apfelstrudelbacken hervorzukramen. Das Restaurant, zu dem er sie führte, war ein zweistöckiges solides Gebäude, er zeigte ihr die Gasträume und schlüpfte mit ihr in die prallheiße Küche.
Wenn die Zukunft nicht eintraf, dehnte die Gegenwart sich aus. Die Gegenwart hieß: eine große Schürze umzubinden, ein stumpfes Messer in die Hand zu nehmen, ein scharfes war offenbar nicht vorhanden oder wurde für andere Zwecke benutzt, sich über einen Korb mit Äpfeln zu beugen, sie zu schälen in einer rasanten Spirale, Schnitz für Schnitz fuhr die Klinge in die Apfelviertel und säbelte sie in feine Scheiben, schnitt so schnell, daß die Äpfel keine Zeit hatten, braun zu werden. Frau Tausig hatte Kuchen für Familienfeste gebacken, das Rezeptbuch hatte sie nicht nach Shanghai mitgenommen, was brauchte sie ein Kochbuch, wenn die ganze bürgerliche Existenz Schiffbruch erlitten hatte und kein überliefertes Rezept half. Wie viele Eier auf welche Menge Mehl und wie viel lauwarmes Wasser mit Salz und Fett zusammenzukneten waren, das war in die hinterste Ecke ihres Gedächtnisses gerutscht. Gibt es denn Zimt und Rosinen und ungebleichtes Mehl?, fragte Frau Tausig den Restaurantbesitzer. Es gibt alles, was Sie brauchen, antwortete der. Das war klug gesprochen, aber doch unbefriedigend. Und ihre Frage eine Verzögerung, eine Hoffnung, den Test noch hinauszuschieben in eine Zukunft, in der es nicht auf ihre Fähigkeit ankam, eine Zukunft, in der Beschaffungsmängel ihre mangelhafte Qualifikation verdeckten. Sie siebte das Mehl in eine große Schüssel, drückte eine Mulde in den Mehlberg, schlug ein Ei darin auf, streute Salz darüber und füllte Wasser in die Mulde. Sie tat es langsam, sorgsam, sie spürte, daß man ihr auf die Hände sah. Es genierte sie, und gleichzeitig war sie ein bißchen stolz, Zuschauer zu haben. Sie mußte sich einen Ruck geben, mit den Händen in den weißgrauen Matsch zu fassen, mit den Fingern das Mehl zu einem bröseligen Brei zu verreiben, zwischen den Fingern klebte der Brei wie Schwimmflossen, die Hände mußten mit Mehl bestäubt werden, sie knetete und knetete, sie knetete um ihr Leben. Frau Tausig formte den Brei zu einem Teigkloß und erinnerte sich plötzlich, daß dieser ruhen mußte, und so machte sie für alle Umstehenden eine Geste, die besänftigte. Und gleichzeitig zeigte sie auf den Teigkloß. Sie hatte das Empfinden, daß sie verstanden wurde, so ruhte der Teig, während sie schwitzte. Noch mehr schwitzte sie, als sie den Backofen vorheizte. Sie verlas die Rosinen, zupfte die Stiele ab, fand Steinchen zwischen den Früchten, erinnerte sich daran, wie sie als Kind ihrer Mutter beim Backen zugesehen und Rosinen erbettelt hatte (ihr Sohn hatte das nie getan), plötzlich sah sie die begierige Kinderhand, die ihre eigene Hand gewesen war, dachte flehentlich an ihre Mutter wie an eine Schutzpatronin, zurückgelassen als alte hilflose Frau in Wien, und wußte, sie mußte den Teig schlagen, schlagen, bis er Blasen warf, immer wieder nahm sie ihn auf und knallte ihn auf den Schüsselrand. Mehl klebte an den Händen und im Haar. Es war eine schwere Arbeit, den Teigkloß durchzuwalken, immer wieder mit dem Handballen auf ihn zu poltern und zu klopfen, bis er schmiegsam war, ein Handschmeichler, eine Masse, die ihr zu Willen war. Sie nahm den Teig aus der Schüssel und legte ihn auf das Backbrett. Jetzt kam es darauf an, den Teig aus dem kindskopfgroßen Kloß zu einer papierfeinen Schicht auszuwälgern, ohne daß er brach. Zuerst rollte sie das Nudelholz hin und her, bis eine flache Scheibe, so groß wie ein Eßteller, daraus wurde, dann hob sie diese Teigscheibe an, faßte darunter, bis ihre Fingerspitzen in der Mitte angekommen waren. Sie dehnte den Teig, zipfelte und zog an ihm, verführte ihn zu wachsen und gleichzeitig dünner zu werden, und das mußte schnell geschehen, damit die Hitze den Teig nicht kleben ließ. Wie eine Zauberkünstlerin stand sie in der Restaurantküche, mit Händen, die, unter der Teigschicht verborgen, zerrten und zogen, tüpfelten, der Abdruck ihrer Fingerspitzen war auf der Teigoberfläche zu sehen, der Teig wurde dünner und dünner und die Fläche größer und größer. Papierdünn mußte er werden, eine Zeitung mußte man durch den Teig lesen können, so hatte sie es gelernt von ihrer Mutter. Man sah nicht richtig, was sie da tat in der Höhle unter dem Teig, sie zwickte ihn, sie zauselte, zerrte ihn von der Mitte zu den Rändern, damit er sich dehnte, sie verführte ihn zum Wachstum. An jeder Stelle, an der sie ihn anfaßte, hätte er reißen können, aber er riß nicht – zu ihrer eigenen Verwunderung. Wuchs und wuchs: nicht unter ihren Händen, sondern im Zelt, das der Teig bildete über ihren raschen Händen. Ja, es war ein Kunststück, das ihr da gelang. Der Restaurantbesitzer sah zu, einige der chinesischen Köche, die eben noch mit dem Fleisch und den Ingwerknollen beschäftigt gewesen waren, sahen zu, der Reiskoch Rudi, ein Emigrant aus Breslau, der früher Fabrikant gewesen war (das erfuhr sie später), zwinkerte ihr zu. Aus einem großen Suppentopf dampfte und brodelte es mächtig, während Franziska Tausig arbeitete. Die Spülfrauen hatten zu spülen aufgehört, die fremde Bäckerin zog den Teig vorsichtig auseinander, dehnte ihn, sorgsam prüfte sie, ob er Löcher bekam, aber wundersamerweise blieb er heil. Das war ein Glück (oder vielleicht nur ein Zufall?), noch einmal ein kritischer Blick, ein Zollstock wäre ihr jetzt lieb gewesen, doch sie fürchtete, er hätte eine Maßeinheit, mit der sie nichts anzufangen wußte: Fuß oder Hand oder Inches oder ein chinesisches Maß, das sie in Verlegenheit gebracht hätte, also streckte sie ihren nackten verschwitzten Arm aus, sie hatte eine Vorstellung von der Länge der Hand und des Armes bis zum Ellenbogen und diese Fläche im Rund, ja, das könnte eine ordentliche Strudelfläche sein, sie war zufrieden. Sie bat um Butter, ein kleiner Topf wurde ihr gebracht, der eher wie ein Schmalztopf aussah, also vermutete sie, daß Butter in Shanghai kostbar und selten war, und so war es auch. Die Butter erhitzte sie, um sie hauchfein auf dem Teig zu verteilen, dazu hatte sie sich einen Pinsel erbeten. Sie wußte nicht, was Pinsel auf englisch hieß, aber sie versuchte es mit einer wischenden Bewegung der rechten Hand in der Handfläche der linken Hand, einer kalligraphischen Bewegung auf dem Trockenen. Der Suppenkoch, ein Mann mit einem hängenden dünnen Bärtchen, das er zwirbelte, hatte ihren Wunsch sofort verstanden und brachte einen kleinen Pinsel, an dem roch sie vorsichtshalber, er roch ein bißchen scharf, aber nicht unangenehm (sie wußte damals noch nicht, wie Sojasauce roch und schmeckte und was sie in einer harmlosen Speise verderben konnte), so bestrich sie die Teigfläche, die ihr nun wie ein bleicher Vollmond vorkam, mit der flüssigen Butter. Sie bat um ein Tuch, man gab ihr etwas, das wie eine Windel aussah, sie roch auch daran, kein besonderer Geruch fiel ihr auf, damit war sie zufrieden.
Auf das Tuch legte sie den Teig, verteilte die gezuckerten Apfelschnitze und die Rosinen und eine Prise Zimt darauf – das war der einfachste und befriedigendste Arbeitsgang – und dann faltete sie ihn mit Hilfe des Tuches übereinander, ja, es war nicht viel anders als ein Kind zu windeln, schlug die Enden des Teigpakets um, damit nichts zipfelte und gleichzeitig der Apfelsaft nicht heraussuppen konnte, jetzt war die Erinnerung an einen Kinderkörper ganz nah, an das Wickeln und Windeln ihres Sohnes, den sie so vermißte, was sie nicht zeigen konnte, ohne an ihren Mann zu denken und ohne sich ihren Mann noch trauriger vorzustellen, im Heim in der Ward Road zurückgeblieben, in einem der Männerschlafsäle, vollgestopft mit Gegenständen, Teppichen, Leuchtern, Photoalben und Besteckschatullen, die jetzt vollkommen nutzlos waren. Und das energische Wickeln und Falten des Apfelpaketes hatte auch einen unverhohlenen und gleichzeitig nur dem Reiskoch Rudi vielleicht begreiflichen Zweck: Ich hole meinen Mann heraus. Ich backe, damit er nicht im Männerschlafsaal versauert unter den Gestrandeten, an ihr eigenes Gestrandetsein dachte sie in diesem Augenblick nicht. (Aber Brieger, den Tausig am Morgen kennengelernt hatte, war nicht gestrandet, er machte nur eine Pause zwischen der einen Aktivität und der anderen. Er erholte sich förmlich im Schlafsaal. Das war, bevor er ein Zimmer, das durch einen Vorhang abgetrennt war, mit Ludwig Lazarus teilte.) Mehlbestäubte Hände sind eine gute Vorsichtsmaßnahme gegen das Gefühl des Gestrandetseins, merkte sie zu ihrer Erleichterung, doch diese Erleichterung erleichterte ihren Mann wiederum nicht, beschwerte, bekümmerte ihn eher.
Sie legte ihr Werk auf das eingefettete Backblech, schob es in den Ofen. Jetzt hieß es warten und beten, daß die Hitze im Backofen der Temperatur, die auf dem Schalter angegeben war, entsprach, knapp zweihundert Grad brauchte der Strudel und dreißig bis vierzig Minuten, sie sah auf die Uhr und wartete mit zittrigen Knien. Man bot ihr eine Tasse Tee an, sie nippte an dem Tee, der bitter schmeckte, sie sah den Köchen zu, die Gemüse putzten und Reis in einem großen Topf kochten, das Messer, mit dem sie die Äpfel geschält hatte, lag noch auf dem Tisch, sie bot sich an, beim Gemüseputzen zu helfen, klack, klack, klack fuhr das Messer in die Kohlstrünke und hackte sie klein. Der Restaurantbesitzer sah es mit Wohlgefallen, die Frau konnte arbeiten und sah, wo gearbeitet werden mußte, ein Pluspunkt für sie. Frau Tausigs Nerven beruhigten sich dabei ein wenig, und der chinesische Koch lachte sie an und entblößte seine schiefen Zähne, zwischen denen die Zunge rosig herausdrängte. Der Reiskoch Rudi sagte: Wird schon werden. Und Frau Tausig antwortete skeptisch: Wird eben doch nicht alles so, wie man will. Aber Rudi setzte noch eins drauf: Man hat schon Pferde kotzen sehn.
Dann begann es in der Küche zu duften, es war ein gutes Zeichen. Frau Tausig hob den Strudel aus dem Ofen, die Köche umringten sie und den Strudel, der Besitzer, der in der Zwischenzeit im Restaurant mit Gästen getrunken hatte, wurde in die Küche gerufen. Frau Tausig schnitt den Strudel an, verteilte ihn auf Teller, und alle in der Küche aßen davon, sahen die Bäckerin respektvoll an, es war ein magischer Akt. Sie wußte nicht, wie ihr geschah, ihr erster chinesischer Apfelstrudel war gelungen und wurde sehr gelobt. Daß es der beste Apfelstrudel war, den sie in ihrem Leben gebacken hatte, darauf bestand Frau Tausig später. Der Apfelstrudel war eine Lebensrettung, ein Wunder, so kam es ihr vor. Sofort war sie als Köchin angestellt, als neue „Missi“, wie es auf Pidgin-Englisch hieß. Franziska Tausig hatte das große Los gezogen, auf Anieb hatte sie einen Arbeitsplatz bekommen. Den nächsten Strudel, den sie buk, kaufte eine japanische Offiziersgesellschaft, eine große Runde andächtiger Kuchenesser, die immer wieder kamen, sie brachten Freunde mit, aßen und aßen und sahen glücklich aus, während sie aßen.
In der Nähe des Restaurants fanden Herr und Frau Tausig eine Kammer mit wackligen Möbeln, aber immerhin einen Raum für sie allein, eine Tür, die geschlossen werden konnte, wenn sie auch schief in den Angeln hing. Frau Tausig hängte ein Tischtuch ans Fenster, sie pinnte ein Photo ihres Sohnes an die Wand, aufgenommen, kurz bevor sie ihn zu einem Kindertransport nach England gebracht hatte. Das war die ganze Privatheit, die sie notdürftig errichtet hatten. Herr Tausig hatte recht gehabt, als er sagte, er bleibe nicht im Emigrantenheim. Frühmorgens ging Franziska Tausig aus dem Haus, rührte Teige, knetete, schmeckte ab, neben dem Apfelstrudel standen Mohnstrudel, Vanillekipferln und Nußmakronen auf dem Programm, sie versuchte sich an englischen Teekuchen. Sachertorten waren ganz unmöglich, die Schokolade wäre sofort in der schwülen Shanghaier Luft geschmolzen, damit gab sich Franziska Tausig gar nicht erst ab. Die Kunden wollten Strudel und Kipferln, und so buk sie die Wiener Palette rauf und runter und eben keinen Teekuchen. Sie stand in der Hitze zusammen mit den Köchen, doch es war gut zu arbeiten, und es war gut, etwas zu tun, das sie besser konnte, als sie es sich vorgestellt hatte. Ihr Mann holte sie abends am Seiteneingang der Küche ab, mit bemehlten Händen kam sie ihm entgegen: Es dauert noch einen Augenblick, ich muß den Biskuit mit einem Faden in Schichten schneiden. Geh doch ins Lokal. Die Frau des Besitzers schenkte ihm eine große Tasse Kaffee ein, der ihm bedenklich dünn erschien. Und da saß er auf einem gelenkig knirschenden Bambusstühlchen mit einem Bezug aus Blumenmuster, wartete und sah sein Leben wie in einem Trichter zusammengedrängt, von Temeswar über Wien nach Shanghai, und alles, was er sich einmal vorgestellt hatte zu erreichen, für Recht zu sorgen, das bestehende Recht anzuwenden, es notfalls auszudehnen und auch den Armen in den Wiener Gemeindewohnungen alle erdenkliche Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, war geschrumpft auf einen winzigen Punkt: seine Frau buk, und er aß das Gebackene, damit er bei Kräften blieb, um eines Tages wieder seinen Sohn zu sehen. So einfach war das. Herr Tausig nestelte seine schwarze Brille hervor, die Frau des Besitzers ahnte, was er unter der Brille verbergen wollte, er tat ihr leid, und als Frau Tausig sich endlich aus der Küche losreißen konnte, gab sie dem Ehepaar den Rest des heute gebackenen Kuchens mit. Das Restaurant hatte keine Kühlung, es hatte in der Küche nur ein Fenster mit Fliegendraht, die Speisen verdarben über Nacht, klebten und klitschten und matschten zusammen, alles mußte am Morgen frisch hergerichtet werden, die Cremes, die Glasuren aus glänzendem Glutamat, die Hefeteige, die Karlsbader Hörnchen. Im Nu schimmelten die Kuchen, wenn es zu regnen begann. Und es regnete oft, es war nicht nur ein einfaches Plätschern, Rieseln. Plötzlich vom Himmel stürzende Wassermassen überfluteten die Straßen, überforderten die Gullies völlig, peitschten die Bäume, rüttelten an den Türen, Wasser tropfte, rann aus den Ärmeln, kein Schirm konnte es abhalten, Taifunwetter, das tagelang den Himmel zum Platzen brachte, umstülpte und verdüsterte. Es war kein Himmel mehr zu sehen. Es war keine Hoffnung und auch keine Hoffnungslosigkeit zu sehen, nur eine Gewißheit, daß es plötzlich nichts mehr zu sehen gab. Hoffnungslosigkeit und ein verzweifeltes Ausschöpfen der Ressourcen: im Notfall Schüsseln gegen die steigende Flut, es half nur Flucht vor den Fluten unter Mitnahme von wichtigen Gegenständen und Dokumenten. Das Haus verschlammte, verslumte; und es half nichts, sich darauf zu berufen, daß hier einmal ein wirkliches „Heim“ gestanden hatte, etwas Erworbenes, das keinen Namen hatte, aber doch eine wirkliche Hoffnung verkörperte: die Hoffnung, bleiben zu können zu ausgehandelten, ausgehaltenen Bedingungen.
Zuerst verschenkte Frau Tausig die Kuchenstücke, die die Besitzerin des Restaurants ihr mitgegeben hatte, sie stand da wie eine gütige Göttin (grundgütig) mit einem Blech oder einem Teller, bis ihr jemand sagte: Sind Sie denn wahnsinnig? Was haben Sie zu verschenken? Nichts haben Sie zu verschenken. Die Kuchenstücke lassen sich gut und gern verkaufen. Frau Tausig war erstaunt, beinahe aufgeschreckt. Das mußte sie sich sagen lassen, und sie ließ es sich nicht zweimal sagen. (Gesagt, getan, hieß es im Märchen.) Und es war auch märchenhaft: etwas, das morgen verdorben gewesen wäre, heute noch rasch zu einem guten Preis zu verkaufen. Das Geschenk zu verkaufen, schien ihr eine Art des legitimierten Betruges zu sein, sie hatte Skrupel, eine Backwarenhändlerin zu werden. Ein professionelles Zögern, das noch keinen Namen hatte, vielleicht gerade ein in die Gänge gekommener namenloser Handel, für den man sich gerne entschuldigen wollte, aber bei wem? Verkaufen, ja, aber zu welchem Preis? Der Preis stand in den Sternen, der Himmel feucht und verhangen in Shanghai, so daß sie keine Sterne sah. Sie hatte noch nie etwas verkauft, ihr Vater hatte Holz verkauft en gros und en détail. Wie er seine Preise kalkulierte, hatte sie nie interessiert. Er bot Holz an, und es wurde gekauft. Jetzt kam ihr das eigene Nicht-Interesse am Holzhandel borniert vor. Übriggebliebenes wurde auch nicht am Ende der Heizsaison verschenkt. Allerdings verdarben Bauholz und Abfälle, die zum Heizen zu gebrauchen waren, auch nicht. Das Verkaufen von verderblichen Kuchenstücken in der Nachbarschaft war eine andere Sache. Die Kuchenstücke, die sie anbot, waren sanft und süß und klebrig, schmeichelten dem Gaumen, die Süße machte glücklich und zufrieden, so mußte man es sagen, aber Schenken und Verkaufen trennten Welten, die nicht zu vermischen waren. Unüberlegte Wohltätigkeit wurde in Shanghai für sehr schädlich gehalten. Denen, die bettelten, etwas zu geben und nicht denen, die Hilfe dringend nötig hatten, war ein mitgebrachter Automatismus, den sie durch Überlegung verwerfen mußte. (Mit anderen Worten: Frau Tausig mußte die eigene Gutherzigkeit unterdrücken, das Hemd war näher als der Rock, das eigene Überleben besser als das von anderen, es war ein schwieriges Lernprogramm.) In Shanghai wurde nichts verschenkt außer Bazillen und Flöhen und Zecken. Also warum Kuchenstücke verschenken? Das mußte auch Frau Tausig begreifen. Die Reste der Kuchen und die Tüten mit Plätzchen und Kipferln, die sie aus dem Restaurant spätabends mitbrachte, fanden Kunden, ein Zubrot zu ihrem Bäckerinnenlohn. Nur ihr Mann hielt sich nicht an die Regeln, er schenkte weiter den Chinesenkindern das Brot, wenn es übrig war nach Feierabend. Zu was war es gut? „Master Bread“ nannten sie ihn und schütteten sich aus vor Lachen. Benennung als Aneignung, wer benennt, hat ein Recht, erwirbt sich ein Recht, so sah das auch der Rechtsanwalt aus Temeswar, ohne sich um chinesisches Recht zu kümmern, aber er sah das Unrecht, daß die chinesischen Kinder darbten, und schenkte weiterhin das Brot weg, hinter dem Rücken seiner Frau. Schon am Nachmittag lungerten die Kinder herum, hungrig warteten sie auf eine Fütterung. Wie im Zoo, Herr Tausig konnte nicht umhin, so zu denken. Er schwieg darüber, wie er dachte, und dann dachte er gar nicht mehr und handelte nur noch, wie es ihm richtig erschien.
Frau Tausig ging früh am Morgen mit den Suppenköchen und einem Jungen auf den Markt, sie betastete die Äpfel und die Pfirsiche und große, schwere, stachlige Früchte, die sie vorher noch nie gesehen hatte, sie wurden Ananas genannt. Und die Suppenköche drehten die Hühner nach allen Seiten, sie drehten sie an der beweglichsten Stelle, am Hals, begutachteten die Krallen und die Kämme, bevor sie sie kauften. Sie kauften auch Kürbisse und Kohlköpfe für die Hühnerbrühe und kleinere Mengen von Suppengemüse, Frau Tausig rappelte mit den Nüssen und prüfte, ob sie frisch waren, im Herbst gäbe es Berge von wäßrigen Pflaumen, die sie einkochen wollte, das war eine energische Vorfreude, der dann die Hauptfreude und die Nachfreude folgten; das Schlecken des dunkel eingekochten Zwetschgenrösters zur phantasievollen Verwertung. Und die Chinesen, denen sie davon zu kosten geben würde auf einem spitzen Löffel, rollten die Augen vor Entzücken. Später, später würde sie die Masse auf einen Teig streichen. Sie kauften gemeinsam Eier von Hühnern, Enten und Gänsen und ganze Tauben dazu, es war eine nachgelagerte Freude, die sie einholte. Es war eine Freude, auf den Markt zu gehen, es gab alles, wenn man es bezahlen konnte. Aber wenn man bezahlen konnte, konnte man betrogen werden – die Suppenköche hatten immer ein Rechenbrett bei sich, die Suppenköche verwalteten das Geld –, Frau Tausig wählte aus, was sie zum Backen brauchte, und die Suppenköche zahlten, eine paradiesische Situation. Alles war käuflich in Shanghai, diese Regel lernte Frau Tausig rasch.