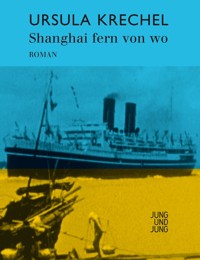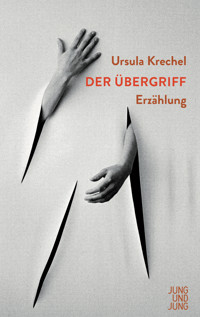Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ursula Krechel schreibt hier über zwanzig wegbereitende Frauen aus Kunst und Wissenschaft, deren Namen wir zwar kennen, die starken Lebensgeschichten dahinter aber zu wenig. Wer könnte uns diese besser erzählen als sie? In höchstem Maße eindrucksvoll ist es zu sehen, wie hier eine Dichterin über Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und eine Wissenschaftlerin schreibt: Ursula Krechel, das hat sie bewiesen, weiß zu erzählen, und sie erzählt mit unverhohlener Leidenschaft, was diesen Frauen widerfahren ist – und kluge Frauen haben, wenn sie sich nicht verstecken wollen, selten ein leichtes Leben.Diesen Gang gelebten Lebens bringt uns die erfahrene Lyrikerin Ursula Krechel in überraschenden und konzentrierten Formulierungen nahe, und so entstehen essayistische Arbeiten, in denen uns auch die uns scheinbar vertrauten Schriftstellerinnen so gegenüber treten, dass wir uns dem Dringlichen ihrer Existenz und ihres Werkes nicht entziehen können, aber auch nicht wollen.Alle diese Frauen standen in ihrem Willen, sich zu behaupten und zu erkunden, was sie in sich und der Welt entdeckten, an einem Anfang, der jene, die nach ihnen kamen, im Weitergehen bestärkte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stark und leise
© 2015 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlagentwurf unter Verwendung einer Fotografievon D’Ora aus »Die Dame«Druck: Theiss GmbH, St. Stefan im LavanttalISBN 978-3-99027-071-4
URSULA KRECHEL
Stark und leise
Pionierinnen
»Weshalb der Essay, der in England und Frankreich so glänzend vertreten ist, in Deutschland ganz fehlt? Ich glaube, das liegt daran, daß die Deutschen zu viel pedantische Gründlichkeit und zu wenig geistige Grazie besitzen und wenn sie was wissen, schon gleich eine schwere Dissertation mit einem Sack Zitate lieber als eine leichte Skizze machen.«
Rosa Luxemburg
I
Mit den Bausteinen ihres Verstandes: Christine de Pizan
Herrscherlob und Kniezittern: Anna Louisa Karsch
Schwester der Erde und des Lufthauchs: Karoline von Günderrode
Geometrie eines Paarlaufs: Bettina und Achim von Arnim
Eine Unzeitgemäße: Annette von Droste-Hülshoff
II
Linkseitig, kunstseidig: Dame, Girl und Frau
Die Dirigentin des großen Bahnhofs: Vicki Baum
Fieber und Feuer: Emmy Ball-Hennings
»Als ob ich schon tot wäre«: Hannah Höch
Die Pionierin der Sexualwissenschaft bittet um die Hand: Charlotte Wolff
Topographie auf Sand und Asche: Elisabeth Langgässer
»In hartes Grau verwandelt ist das Grün«: Ruth Landshoff-Yorck
Das Weltläufige als Widerstandsform: Irene Brin
Die Zerstörung der kalten Ordnung: Irmgard Keun
III
Ortlosigkeit, Stucktröstung: Ingeborg Bachmann
Als der Kalte Krieg sich beinahe erhitzte: Elisabeth Borchers
So viel Ironie war nie: Christa Reinig
Vom Gießen und Fließen: Friederike Mayröcker
Gespannter Bogen, gespannte Aufmerksamkeit: Elke Erb
Nahtstelle: aufgetrennt
Nachweise
I
Mit den Bausteinen ihres Verstandes:CHRISTINE DE PIZAN
Christine de Pizan zu entdecken, ist ein fröhliches, lehrreiches und gleichzeitig rührendes Unterfangen. Es könnte sein, daß die Beschäftigung mit ihren Schriften zu einer Umwertung des Frühhumanismus führt, wie die Entdeckung oder erneute Lektüre der Marie de France die frühere Gewichtung der Werke von Chrétien de Troyes, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg, Walther von der Vogelweide ins Wanken brachte. Es könnte sein, daß in Zukunft gesagt werden muß: Der Humanismus begann mit einer Autorin, die sich entschieden gegen üble Nachrede über ihr Geschlecht wehrte, erzählerische und essayistische Nachweise gegen die Vorwürfe führte. Es könnte sein, daß zugegeben werden muß: Der Frühhumanismus setzte nicht ein wiedergefundenes antikes Menschenbild gegen das christliche, sondern ganz am Anfang fand jemand den Mut, die beschämenden Lücken in vielfältigen Menschenbildern aufzuzeigen, die Lücken, die auch die Arbeit, die Lebenskraft, die Menschlichkeit von Frauen betreffen. Es könnte zugegeben werden müssen, daß die Loslösung von den festgefügten höfischen und klösterlichen Riten und Denkbewegungen, die der Frühhumanismus bewirkte, die Betonung von Wissen gegenüber dem Glauben, eine ernstzunehmende Verkünderin jenseits seiner Wiege in Italien hatte. Kindlers Literatur Lexikon verzeichnet Christine de Pizan mit drei Werken, wobei ihre Epistre au Dieu d’Amours, eine parodierende Auseinandersetzung mit dem Frauenbild im Rosenroman von Jean de Meun, den größten Raum einnimmt. Sie entfachte mit ihrem Widerspruch den ersten Literaturstreit der französischen Geschichte.
Christine de Pizan wurde 1365 in Venedig geboren. Sie stammte aus einer Familie von Gelehrten und wuchs mit Brüdern auf. Ihr Vater Tommaso di Benvenuto da Pizzano, der in Bologna, einem der wichtigsten intellektuellen Zentren des damaligen Europa, tätig war, folgte einem Ruf Karls V., »des Weisen«, an den Hof in Frankreich. Er kam als Astrologe und Arzt. »Die Frau und das Kind des Meisters Tommaso, meines Vaters, wurden gleich nach ihrer Ankunft in Paris in allen Ehren empfangen. Der mildtätige, gütige und weise König begehrte, sie, die noch ihre reichverzierten, kostbaren lombardischen Gewänder trugen, die Frauen und Kindern von Stand angemessen sind, schon bald nach ihrer Ankunft zu sehen. Der König hielt sich im Dezember im Schloß Louvre in Paris auf, und er empfing Tommasos Frau und Familie und machte ihnen schöne Geschenke.« Ihr Leben lang wird Christine den König ehren und der Friedenszeit unter seiner Regentschaft (1364–1380) gedenken. Im Buch von der Stadt der Frauen (Le Livre de la Cité des Dames) legt sie an einer Stelle der Frau Rechtschaffenheit eine vermutlich sie selbst betreffende Äußerung in den Mund: »Dein eigener Vater, ein bedeutender Naturwissenschaftler und Philosoph, glaubte keineswegs, das Erlernen einer Wissenschaft gereiche einer Frau zum Schaden; wie du weißt, machte es ihm große Freude, als er deine Neigung zum Studium der Literatur erkannte. Aber die weibliche Meinung deiner Mutter, die dich, wie es für Frauen gemeinhin üblich ist, mit Handarbeiten beschäftigen wollte, stand dem entgegen, und so wurdest du daran gehindert, in deiner Kindheit weitere Fortschritte in den Wissenschaften zu machen.«
Mit fünfzehn Jahren heiratet sie den zehn Jahre älteren Notar und königlichen Sekretär Étienne du Castel. Nach ihrem eigenen Bekunden muß dies eine glückliche Ehe gewesen sein, aus der eine Tochter und zwei Söhne hervorgegangen sind. Doch innerhalb der nächsten zehn Jahre verfinstert sich Christine de Pizans Glück; sie spricht ganz im Stil der Zeit davon, daß sich Fortunas Rad zu ihren Ungunsten gedreht habe. Zunächst stirbt der königliche Gönner ihrer Familie, so daß der Einfluß des Vaters bei Hofe abnimmt, dann stirbt der Vater, und im Jahre 1390 wird ihr Mann von einer Epidemie hinweggerafft. Mit 25 Jahren obliegt ihr die Sorge für ihre Kinder, für zwei noch unmündige jüngere Brüder und ihre Mutter; ihre Brüder kehren später nach Italien zurück, dafür kommt eine Nichte in ihre Obhut.
Christine de Pizan verzweifelt nicht, sondern besinnt sich auf ihre Fähigkeiten. Sie scheint mit dem Abschreiben von Manuskripten zunächst ihren Lebensunterhalt verdient zu haben, bevor sie dann ihre eigene Stimme erhebt, in Liedern, Balladen, in der Lehrdichtung und in ihren Streitschriften. In einer vielzitierten Ballade gibt sie Auskunft über den schwierigen Schritt ihres dichterischen Beginnens:
Seulete suy et seulete vueil estre,Seulete m’a mon doulz ami laissiee,Seulete suy, sans compaignon ne maistre,Seulete suy, dolente et courrouciee.
(Ganz allein bin ich, und ganz allein will ich auch sein, / Ganz allein ließ mich mein süßer Freund zurück, / Ganz allein bin ich, ohne Gefährten, ohne Gebieter, / Ganz allein bin ich, von Schmerz und Kummer erfüllt.)
Von Anfang an ist diese Autorin, wie übrigens auch die Dichterin Marie de France, darauf bedacht, ihren Namen mit ihren Werken zu verbreiten. »Je, Christine« – »Ich, Christine«, so beginnen viele Abschnitte. Sie schützt sich vor der Annexion ihrer Werke durch Dritte, insistiert auf ihrer Autorschaft. Und sie hat wohl bei ihrer vorliterarischen Arbeit des Abschreibens die Entdeckung gemacht, daß nicht das Schreiben allein, sondern auch seine Verbreitung für die Hierarchisierung der Literatur von Bedeutung ist. Die große Zahl der Handschriften ihres Werkes läßt vermuten, daß sie ihre Schriften selbst zur Vervielfältigung brachte und daß sie einmal eine vielgelesene Autorin war. Ebenso ließ sie sich häufig als Schreibende darstellen: eine schmale Frau im blauen Kleid mit einem bauschigen Witwenschleier.
Inmitten des höfischen Getümmels wagt sie von ihrer Einsamkeit, ihrer Verlassenheit zu sprechen. In L’Avision de Christine (Christines Vision) gibt sie eine Selbsteinschätzung: »Ich habe damit begonnen, anmutige Gebilde zu ersinnen, und diese waren in meinen Anfängen ohne allzu viel Tiefgang. Dann aber erging es mir wie dem Handwerker, der mit der Zeit immer kompliziertere Dinge herstellt: In ähnlicher Weise bemächtigte sich mein Verstand immer außergewöhnlicherer Gegenstände; mein Stil wurde eleganter, meine Themen gewichtiger.«
Der Hinweis auf den Handwerker ist interessant: Christine schreibt nicht, weil ihr Gott die Feder führt, ihr Konzept ist vollkommen anders als das der Mystikerinnen. Sie schreibt eine Art von poetischer Universalgeschichte, liest Quellen und interpretiert sie auf ihre Weise. Ihre Geschlechtszugehörigkeit verbietet es, sich um ein Lehen zu bemühen. Sie dichtet nicht zum Fürstenlob, wenn sie auch mit der Zeit hochgestellte Gönner findet. Nein, Christine de Pizan ist an handwerklicher Qualität interessiert, an der Ausbildung ihres Talents, an ihrer eigenen Stimme.
Wie kommt es, daß sie vom Wert der Weiblichkeit so unbedingt überzeugt ist und ihre Überzeugung beredt und tapfer vertritt? Wie kommt es, daß sie Respekt und Anerkennung der Leistungen für die weibliche Hälfte der Menschheit einklagt? Während in der höfischen Literatur der Frau gehuldigt wird, ihren Schönheitsattributen, wird sie in der Realität von vielen Bereichen des Lebens ausgeschlossen. Christine ist eine harsche Kritikerin der »folle amour« – »der törichten Liebe«. Sie ist eher an Werken als an Gefühlen interessiert. Die Verherrlichung der nicht eingelösten Liebe in der Minne, das Spiel der Sehnsucht, ist ihre Sache nicht. Das Kapitel über die großen Liebenden im Versroman Buch von der Stadt der Frauen schließt sie lapidar ab: »Es kann gar keinen Zweifel daran geben, daß eine charakterstarke Frau zu einer sehr tiefen Liebe fähig ist, wenn sie einmal wirklich liebt – daneben gibt es natürlich auch einige flatterhafte Frauen.«
Die höfische Literatur belustigt sich mit erotischen Scherzfragen wie: Zieht ihr warme Kleidung im Winter oder eine höfische Geliebte im Sommer vor? Was haltet ihr für vorteilhafter? Drei Glas eines Aphrodisiakums oder drei Damen alle Tage? Wenn eure Dame ihre Hingabe von einer Liebesnacht mit einer zahnlosen Alten abhängig macht, wollt ihr diese Bedingung lieber vorher oder nachher erfüllen? Dagegen benutzt Christine ihren logischen Verstand und sammelt Argumente gegen »derartig viele teuflische Scheußlichkeiten«, die Männer in ihren Schriften über Frauen verbreiten. Sie tut dies aber nicht in einem moralischen Traktat, sondern in der Erzählung vom Bau einer Stadt. Es ist ein allegorischer Zufluchtsort, eine »Festung gegen die Schar der boshaften Belagerer«, ein Aufbewahrungsort theologischer, juristischer und ethischer Argumente für die Rechte von Frauen, ein stolzes Gebilde, aufgetürmt aus den Leistungen von Frauen in verschiedensten Disziplinen, kurz gesagt: ein utopischer Ort ohne Vertäuung in einer Realität. Die Allegorien der Gerechtigkeit, Vernunft und Rechtschaffenheit weisen die Baumeisterin Christine an, die rühmenswerten Taten und Werke von Frauen sind das Baumaterial. Wunderschön sind die Dialoge zwischen den allegorischen Stadtpatroninnen und der Baumeisterin; es sind Dialoge voller Witz und scheinbarer Naivität. Manches Argument erinnert an die wunderbar witzige Hedwig Dohm, sicher die geistreichste Vorkämpferin der Frauenemanzipation um 1900, die schrieb, wenn der liebe Gott der Meinung gewesen wäre, Frauen seien für Haus und Küche bestimmt, dann hätte er sie gleich mit einem Kochherd im Schlepptau erschaffen.
Im Buch von der Stadt der Frauen richten die drei Gründer-Allegorien die Baumeisterin auf, wenn sie mutlos ist. »Es hat außerdem den Anschein, daß für dich jede Äußerung eines Philosophen den Status eines Glaubensgrundsatzes hat und du es für ausgeschlossen hältst, daß sie auch irren könnten. Was die Dichter angeht, von denen du sprichst: Weißt du denn nicht, daß sie schon oft nichts anderes als Ammenmärchen verbreitet haben? […] Bediene dich wieder deines Verstandes und kümmere dich nicht weiter um solche Torheiten! Denn eines mußt du wissen: Alle Bosheiten, die allerorts über die Frauen verbreitet werden, fallen letzten Endes auf die Verleumder und nicht die Frauen zurück.« Das sitzt wie eine schallende Ohrfeige, ausgeteilt im Jahr 1405. Geradezu fulminant ist das Argument gegen die körperliche Schwäche. Die Vernunft überzeugt Christine und spätere Leser, daß Frauen gerade da, »wo sie sich ins Zeug legen« müssen, wo sie unterlegen sind, um so mehr Klugheit und Scharfsinn entfalten. »Kompensationsleistung« hieße der gegenwärtige Begriff. Es gibt ein Kapitel, in dem das Argument entkräftet wird, Frauen wollten vergewaltigt werden, und ein anderes über das systematische Vergessen der Leistungen von Frauen.
Kein Zweifel, Christine gräbt mit der »Spitzhacke« ihres Verstandes, wühlt in der Erde, baut ein selbstbewußtes Fundament, setzt Baustein für Baustein aufeinander, plant, mauert, mörtelt und umfriedet die Stadt lieber, als daß sie sich den Schneid abkaufen läßt. Unzählige Beispiele aus Geschichte, Legende und aus literarischen Vorlagen bezeugen für sie, »daß eine kluge Frau zu allen Dingen befähigt ist«. Umsichtige Herrscherinnen bevölkern schließlich die Stadt der Frauen, in Kemenaten, Wehrtürmen und in den Palästen wohnen sie, historische Gestalten der Antike und Mythologie, Amazonen, Sagenfiguren und Heilige: Die Märtyrerin Martina, aus deren Wunden Milch statt Blut floß, die Jungfrau Christine, der es gelang, mit einem Stück der ihr aus dem Mund gerissenen Zunge so zielsicher zu werfen, daß der Richter, den sie traf, sofort auf einem Auge erblindete, und eine andere Heilige, die sich zur Abschreckung ihrer Peiniger blutiges Kükenfleisch auf die Brust schmierte. Auch die einem antiken Mythos entlehnte Manilipe, die Herkules vom Pferd warf, hat das Stadtrecht bei Christine; manche Autoren, bekundet sie, seien der Meinung, es müsse am Pferd gelegen haben. Eine andere Bewohnerin der Stadt ist Königin Veronika aus Kappadokien, die ihren Schwager, der sie um ihr Erbe bringen wollte, eigenhändig tötete und mit dem Wagen über ihn hinwegfuhr.
Schöne junge Frauen bevölkern die Stadt, die ihre Ehemänner liebten, obwohl sie alt und häßlich waren. Auch von Männern, die zu ihrem eigenen Vorteil dem Rat ihrer Frauen folgten, wird erzählt, wie von den Erfinderinnen aller möglichen Künste. Es sind lehrreiche, komische und anrührende Geschichten, eine Kompilation von Biographien und Mythen, und alle dienen dem Zweck, misogyne Vorurteile zu entkräften. Sie »halten rationalen Argumenten nicht stand«, befindet Frau Rechtschaffenheit.
Erschreckend ist, daß viele Argumente die gleichen geblieben sind, traurig, daß Generationen von Frauen sie sich von neuem schmieden mußten. Dennoch läßt sich Christine de Pizans Buch nicht einfach in Parameter der Neuzeit übertragen. Ihr großer Schrecken vor der Sittenlosigkeit und Lüsternheit der Frauen spricht dagegen und auch ihr zeitgebundener Stolz, daß eine Frau die Pforte zum Paradies geöffnet habe. Dagegen ist ihr Argument, Adel begründe sich nicht auf Geblüt, sondern auf Tugend, staunenswert.
Nach dem Buch von der Stadt der Frauen wird Christine de Pizan in ihren Schriften politischer. Sie beklagt die Schrecken des Bürgerkriegs, schreibt Flugschriften und äußert sich zu tagespolitischen Fragen. Sie richtet Appelle an die Mächtigen: an den Herzog von Berry und Isabella von Bayern, die Gemahlin von Karl VI., die im Volksmund »la gaupe« – »die Schlampe« hieß und das geschundene Frankreich an England auslieferte. »Bestürzt und schmerzerfüllt sage ich: ›Wie kann das menschliche Herz es zulassen – so übel ihm Frau Fortuna im Augenblick auch mitspielen mag –, daß der Mensch zu einer grausamen, mordgierigen Bestie wird? Wo bleibt seine Vernunft, jene Eigenschaft, der er es verdankt, ein vernunftbegabtes Wesen genannt zu werden? Wie kann es angehen, daß Fortuna den Menschen so sehr zu verändern vermag und er sich in eine Schlange, in einen Gegner des eigenen Geschlechts verwandelt? Welch ein Jammer! Schließt eure Augen nicht, ihr Edlen Frankreichs! Was haben eure Untertanen euch angetan, die euch wie Götter verehren und allerorts euren Ruhm mehren, sie, die ihr indes jetzt nicht wie Kinder, sondern wie Todfeinde behandelt, denn eure Zwietracht gereicht ihnen zum Verderben und verursacht ihnen Kummer und Not, Kriege und Schlachten.‹« Mutige, starke Worte einer Architektin der Vernunft, der es im Jahr 1410 gelang, sich Gehör zu verschaffen. Der Machtkampf tobte zwischen den Herrscherhäusern von Burgund und Orléans. Ihre Brüder waren längst nach Italien zurückgekehrt. Sie harrte aus im Ausweglosen. Europa war in den Hundertjährigen Krieg getaucht. Der rätselhaften Fortuna hatte sie längst ein eigenes Gedicht von 23.636 Versen gewidmet: Livre de la Mutacion de Fortune (Buch von der Wechselhaftigkeit des Glückes).
Christine de Pizan: Das Buch von der Stadt der Frauen. Aus dem Mittelfranzösischen übersetzt, eingel. und komment. von Margarete Zimmermann. Berlin 1986.
Wege in die Stadt der Frauen. Texte und Bilder der Christine de Pizan. Hrsg., übersetzt und komment. von Margarete Zimmermann. Zürich 1996.
Author, Reader, Book. Medieval Authorship in Theory and Practice. Hrsg. von Stephen Partridge und Erik Kwakkel. Toronto 2012.
Joachim Bumke: Höfische Kultur – Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München 1986. Hedwig Dohm: Emanzipation. Zürich 1977.
Margarete Kottenhoff: »Du lebst in einer schlimmen Zeit«. Christine de Pizans Frauenstadt zwischen Sozialkritik und Utopie. Köln 1994.
Ursula Liebertz-Grün: Marie de France, Christine de Pisan und die deutschsprachige Autorin im Mittelalter. Euphorion. Bd. 78. 1984. S. 219–236.
Lire les textes médiévaux aujourd’hui: historicité, actualisation et hypertextualité. Hrsg. von Patricia Victorin. Paris 2011.
Régine Pernoud: Christine de Pizan. München 1990.
Klaus Reichert: Fortuna oder die Beständigkeit des Wechsels. Frankfurt am Main 1985.
Bettina Roß: Politische Utopien von Frauen – von Christine de Pizan bis Karin Boye. Dortmund 1998.
Irene Tischler: Historie und Wissenschaftskritik in der Philosophie der Renaissance: Theorien der Geschlechterdifferenz bei de Pizan, Cereta und da Pozzo. Innsbruck 2011.
Herrscherlob und Kniezittern:ANNA LOUISA KARSCH
An den Prinzen von Preussen,als von dem Nutzen der Geschichte gesprochen wurde.
Prinz! die Geschichte mahlt den Menschen und den Held,Den König und die Unterthanen;Sie lehret dich von Rom, wie unter seine FahnenEs niederwarf die ganze Welt;Sie zeigt dir Griechenland die Siegerhand erhebenUnd nachbarlichem Volk als Herr Gesetze geben;Bald aber wiederum durch niedern Geiz empörtVon eignem Volk bekrieget und zerstört;Und endlich siehest du Rom von dem Throne werfenGanz Griechenland zerrissen seyn;Du siehst der Dinge Wechsel ein,Um den Verstand in dir zu schärfen.
Stolz, Herrschsucht, Ehrgeiz, Tyranney,War Ursach von der Thronen Falle.Daß Pyrrhus groß gewesen sey,Beweisen seine Thaten alle:Jedoch, um grösser noch zu seyn,Zog er vor eine Stadt, sprang über ihre Mauer,Aus Ruhmsucht ward ihm nicht des Würgens Arbeit sauer;Von einem Dache flog ein Stein,Dem Menschen=Würger ins Genicke,Aus runzlichter, verdorrter Weiberhand;Er fiel, und starb, verspottet von dem Glücke!
Du aber Hoffnung für das Land,Sey deines Volkes Lust, die Zierde deines Sitzes!Und wenn dein Nachbar dirs vergönnt;So führ ein friedlich Regiment,Das majestätisch ist, ohn die Gewalt des Blitzes,Der um den König her vom Felde schrecklich fährt,Wenn er mit hunderten sich gegen tausend wehrt!
Eine Dichterin schreibt an einen Herrn; es ist der spätere Friedrich Wilhelm II., der Neffe Friedrichs II. Sie redet ihn unverstellt an als Du. Sie tut dies im hohen Ton der Zeit, aber sie läßt sich nicht von Regeln leiten, ihre Zeilen schwingen unregelmäßig. Die Oden, die ihre Zeitgenossen, silbenzählend, mythologisch herausgeputzt, verfassen, hat sie nicht studiert. Jeder wollte in dieser Zeit besungen, dichterisch erhöht werden; es war erst ein halbes Jahrhundert her, daß ein Dichter ein Tauflied für eine preußische Prinzessin geschrieben hatte, in dem er diese mit dem Jesuskind verglich. Das Mythologisieren, das Heroisieren wurde mit klingender Münze bezahlt, es war vorauseilende Auftragsdichtung, ein Hofamt winkte. Die Karschin aber schreibt »nach der Natur«, schreibt von der bitteren Not ihrer Jugend, zum Beispiel in einem höchst anrührenden Gedicht an den Domherrn von Rochow oder in einem Brief an Johann Georg Sulzer vom 1. September 1762:
»Mein Oheim fragte eines Tages nach den Maßregeln meiner Erziehung, ›oh‹, sagte meine Mutter, ›das unartige Kind soll lernen, und es ist nichts in sie zu bringen‹. Mein Oheim bewies ihr die Unmöglichkeit in dem Geräusch des Wirtshauses. Er nahm mich mit. Seine Wohnung war in Polen. Er genoß in einem kleinen Haus die Ruhe des Alters und lebte von dem, was er in jugendlichen Jahren als Amtmann erspart hatte. Die liebreichste Seele sprach in jedem Wort seines Unterrichts, und in weniger als einem Monat las ich ihm mit aller möglichen Fertigkeit die Sprüche Salomonis vor. Ich fing an zu denken, was ich las, und von unbeschreiblicher Begierde entflammt, lag ich unaufhörlich über dem Buche, aus welchem wir die Grundsätze unserer Religion erlernen. Mein ehrlicher Oheim freute sich heimlich, aber riß mich oft vom Buche und wandelte mit mir durch ein kleines Gehölz oder durch eine blumige Wiese. Beides war sein Eigentum, und beides gab ihm Gelegenheit, mit mir von den Schönheiten der Natur zu reden. Ich wiederholte ihm alles Gelesene und verlangte die Erklärung derjenigen Stellen, die über meine Begriffe waren.« Die Mutter reißt das Mädchen aus dem gerade begonnenen Lernprozeß, als sie mit einem zweiten Mann – nach dem Tod des ersten – einen Sohn zur Welt bringt, »und ich bekam das Amt einer Kinderwärterin. […] Mein Stiefvater donnerte wegen meiner Lesesucht auf mich los! Ich versteckte meine Bücher unter verschwiegene Schatten eines Holunderstrauchs und suchte von Zeit zu Zeit mich in den Garten zu schleichen, um meiner Seele Nahrung zu geben.« Die Authentizität und die Frische des Textes sprechen für sich. Man denkt unmittelbar an Karl Philipp Moritz’ Anton Reiser, den Entwicklungsroman eines zurückgesetzten Kindes, doch dessen erster Teil ist erst 1785/86 erschienen, der zweite 1790.
Die Kunst der Anna Louisa Karsch heißt Einfühlung, auch Einfühlung in die eigene Preisgegebenheit. Was sie schreibt, schreibt sie aus einer Empfindung heraus, aus innerer Bewegung. Herder wird später an diesen poetischen Zugang zur Welt anknüpfen. Die gebildeten Zeitgenossen der Anna Louisa Karsch sind eher verblüfft, daß diese Frau all das ignoriert, was sie, die alten Meister studierend, sich in Rivalitäten und Abhängigkeiten begebend, mühsam gelernt haben. Sie gilt als ein Wunder, ein Star im aufstrebenden Preußen. Es ist das Preußen des Siebenjährigen Krieges, in dem sie schreibt. Ein blutiges, verlustreiches Hin und Her zwischen Österreich, Rußland, Frankreich auf der einen Seite und Preußen auf der anderen, Einquartierungen, Abgaben für die Bevölkerung, besonders Schlesien, ihre Heimat, blutet. Die Dichterin mischt sich ein, enthält sich der patriotischen Vivat-Rufe, sie denkt über den Nutzen der Geschichte nach, während der Krieg unglaubliche Opfer auf allen Seiten fordert. Daß sie ausgerechnet Pyrrhus, den König der Molosser, der gegen die Römer kämpfte und diese unter außerordentlichen Verlusten schlug, als einzige mythologische Gestalt benutzt, ist erstaunlich, schier revolutionär in einem Widmungsgedicht. Sieh, Prinz, daß du nicht stolperst, daß du dich nicht zu Tode siegst! Das Blatt kann sich in jedem Augenblick wenden, dann bist du wahrscheinlich am Ende. Der Siebenjährige Krieg, den Preußen so verlustreich gegen die europäische Koalition führte, endete bekanntlich ohne Landgewinn für Preußen im Hubertusburger Frieden vom 15. Februar 1763. Im selben Jahr führt die Karsch ein Gespräch über Dichtkunst mit dem König, doch sein Interesse an der deutschen Sprache und ihren ästhetischen Erzeugnissen ist gering. Und die Kassen sind leer.
Die Dichterin, die mit einer solchen Verve dem Thronfolger schreibt, hat die Dichtung nicht in die Wiege gelegt bekommen. Sie ist als Tochter eines Bauernschankwirts 1722 in Niederschlesien geboren worden. Als der Vater stirbt, gibt die Mutter das Mädchen zu einem Großonkel, der es schreiben und lesen lehrt. Fortan liest sie Psalmen, träumt sich in eine heroische Welt; zu Hochzeiten und zu Beerdigungen schreibt sie Auftragsgedichte, auf Zuruf macht sie verblüffende Verse. Ihre tief empfundenen religiösen Gedichte erregen Aufmerksamkeit. Woher hat sie die Schöpferkraft, woher nimmt sie die Formen? Niemand weiß es, das macht sie interessant. Das »Natürliche« hat Konjunktur, es ist wie das Tasten nach einem unbekannten Neuen, bislang Übersehenen. Die Gelehrsamkeit hat sich erschöpft.
Der Ehemann der Karsch läßt sich von ihr scheiden, es ist dies die erste bürgerliche Scheidung in Preußen, ein Skandal. Ohne Chance, als Geschiedene leben zu können, heiratet sie von neuem und gerät vom Regen in die Traufe. Sie möchte den Mann loswerden und denunziert ihn, so wird er unter die Soldaten gesteckt. Hin- und herreisende Offiziere tragen ihren Ruhm weiter bis nach Berlin, Besatzungsmächte kommen ins Schlesische, die Neuigkeiten bringen. Ein Gönner, Baron von Kottwitz, sieht, daß die Karschin ihr Talent verschleudert, und nimmt sie in seiner Kutsche mit nach Berlin. Hier hat sie Raum und Zeit zum Schreiben, sie wird hofiert, protegiert und zankt sich mit ihrer ehrgeizigen Tochter, die unter dem Namen Caroline Louise von Klencke ebenfalls dichtet wie auch die Enkelin Helmina von Chézy. Ein kometenhafter Aufstieg – doch dann ist sie auf sich selbst gestellt, muß ihre Familie ernähren. Das vage Versprechen Friedrichs des Großen, ihr eine Rente auszusetzen oder zumindest ein kleines Haus in Berlin zu schenken, bleibt unerfüllt. Friedrich der Große mit seiner Neigung zur französischen Kultur ist nicht wirklich interessiert. Die Geschichte wartet auf ihn. Nur ein einziger Gedichtband von Anna Louisa Karsch erscheint zu ihren Lebzeiten. Erst Friedrich Wilhelm II., der als 42jähriger 1786 den Thron besteigt, macht das Versprechen wahr: Die Dichterin bekommt ein Haus an der Neuen Promenade, da hat sie noch zwei Jahre zu leben.
Anna Louisa Karsch: Auserlesene Gedichte. Faksimiledruck nach einer Ausgabe von 1764. Mit einem Nachwort von Alfred Anger. Stuttgart 1966.
Anna Louisa Karsch (1722–1791): Von schlesischer Kunst und Berliner »Natur«. Ergebnisse des Symposions zum 200. Todestag der Dichterin. Hrsg. von Anke Bennholdt-Thomsen und Anita Runge. Göttingen 1992.
Die Karschin – Friedrich des Großen Volksdichterin. Ein Leben in Briefen. Hrsg. von Elisabeth Hausmann. Frankfurt am Main 1933.
Schwester der Erde und des Lufthauchs:KAROLINE VON GÜNDERRODE
Das lieben die Frauen: Das leidvolle Scheitern sind sie gewohnt, »so mußte es kommen«. Amerikanische College-Studentinnen bezeugten in psychologischen Tests: Die kluge Kandidatin, die das beste Examen macht, wird nicht unbedingt eine erfolgreiche Frau, die ihren Platz im Leben findet. Sie wird vielmehr – in der Phantasie von möglichen Überfliegerinnen beim Studium – eine außenseiterische Existenz, der der Freund abhanden kommt, die Anstoß erregt an allen Ecken und schließlich scheitert, weil für sie kein Raum ist in der akademischen und in der handhabbaren praktischen Welt.
Braucht die leidenschaftlich forschende, selbstgewisse Frau so viel Raum? Ja und abermals ja. Karoline von Günderrode ist über Generationen von Germanisten und Germanistinnen für das »tragische Schicksal« mißbraucht worden. Es hieß vielfach aufgefächert: Das Nichtlebbare des Weiblichen, die Hohepriesterin des Unlebbaren. Sie paßt nicht so recht zur Sinnenhaftigkeit der Romantik, zu der Profilierung der weiblichen Subjektivität, wie Caroline Schlegel-Schelling, Rahel Varnhagen und Bettina von Arnim sie verkörpern. Die Tragik, der eigenen Zeit voraus zu sein und an ihr zu leiden, hat besonders Christa Wolf in ihrer Sicht der Günderrode herausgearbeitet. Ein Beispiel für den Mut und die Tragik, die ängstlichen Männerbedenklichkeiten hinter sich gelassen zu haben. (Ohne diesen Mut erhebt sich kein weiblicher Kopf über das Nadelkissen und das Backblech.) Der Schauder, daß diese harsche Konsequenz mit einem spitzen Gegenstand, einem Dolch, am Ufer des Mittelrheins, dort wo er besonders flach, aber romantisch ist, geendet hat – unter Hinterlassung von Büchern, Konvoluten von Texten, Briefschaften. Und da die Romantik, zumindest in Deutschland, in den furchtbarsten Verrenkungen der Ideologien endete, in der staats- und religionsfrommen Lethargie, muß Karoline von Günderrode heute an der schattigen Friedhofsmauer in Oestrich-Winkel am Rhein gehuldigt werden. (Oder besser mit dem Kopf in der historischkritischen Ausgabe ihrer Werke, die Walter Morgenthaler vorbildlich ediert hat.)
Wo sie in Frankfurt am Main lebte und arbeitete, im v. Cronstettenund Hynsberg’schen Adelig-Evangelischen Damenstift am Roßmarkt 17, an der Ecke zum Salzhaus, klafft heute eine Lücke, der Durchbruch zur Kaiserstraße. Daneben stand lange ein Möbelkaufhaus mit dem ernüchternd einsilbigen Namen »Mann«. Die Stadt hat nach der Dichterin eine Straße benannt – zwischen dem Paketamt und der Promenade, auf der sich die Autohändler die Kunden abzujagen versuchen, – eine gänzlich unpoetische Straße. Ihre erhaltenen Handschriften liegen im Deutschen Hochstift und in der Universitätsbibliothek Frankfurt. Kaum ein Philologe hatte sich die Mühe gemacht, Handschriften und Editionen zu vergleichen, so haben sich Fehler fortgezeugt, Zweifelhaftes wurde unter ihrem Namen publiziert. Mit kaum einem Werk der Frühromantik ist so nachlässig, gleichgültig umgegangen worden wie mit diesem. Und noch etwas: Akademische Karrieren werden durch die Beschäftigung mit großen, erhabenen Gegenständen eher befördert als mit außenseiterischen, unvollendet gebliebenen Dichtern und Dichterinnen, die den Außenseitern zur Behandlung überlassen bleiben, die eben darum am Rand des Wissenschaftsbetriebs ein Schattendasein fristen. Die Wahl des bedeutenden Gegenstandes adelt den, der sich mit ihm auseinandersetzt. Oder der bedeutende Gegenstand wirft seinen Schatten. Walter Morgenthaler, der die Voraussetzungen geschaffen hat, diese Dichterin neu zu lesen, verdiente sein Brot als Computerfachmann. Die Edition wurde so zu einem Projekt der Leidenschaft – fast wie das Dichten. Keine deutsche Institution fand sich bereit, sie zu unterstützen; der Schweizer Nationalfonds mußte einspringen.
Es gibt keine Kategorien, in die diese Dichterin zu passen scheint. Und doch war Karoline von Günderrode nicht allein in dem aufrührerischen Klima, das sie mittrug und dem sie sich hingab. Sie saß mit Freunden und Freundinnen in wechselnden Zirkeln zusammen: Frankfurt, Marburg, Heidelberg, die universitären Zentren strahlten. Auf den Landgütern Trages bei Gelnhausen in Hessen und Winkel am Rhein erlebten leidenschaftliche Freundschaften ihre Blüte, taumelten die jungen, begabten Menschen aufeinander zu. Gleichwohl widersetzte sich die spröde Natur der Günderrode dem allgemeinen Geselligkeitskult. Sie ermüdete leicht unter Menschen, mit denen sie wenig Gemeinsames zu teilen glaubte.
Dienstboten stutzen das Licht, Postkutschen bringen immer neue Gäste, Abschiede und Begegnungen, einmal taucht ein Heidelberger Professor auf, der dem Juristen Savigny, der die Schwester von Bettina Brentano heiraten wird, freundschaftlich verbunden ist, während Clemens Brentano vergeblich Karoline umwirbt. Die Günderrode taugt gewiß nicht zu einer bürgerlichen Ehe, strebt sie nicht einmal an – im Gegensatz zu ihren Frankfurter Freundinnen. Der Professor Friedrich Creuzer beschäftigt sich mit der Antike, auch orientalische Mythen sind ihm nicht fremd; er ist ein Vorläufer von Johann Jakob Bachofen. Er ist bezaubert von der jungen, klugen Frau. Sie ist ihm freundlich gesonnen. Sie schickt ihm ihre jeweils neuesten Arbeiten, nimmt willig seine Korrekturen auf, die Zeichensetzung, moniert er, sei nicht ihre Stärke, und er lobt sie, lobt ihre großen Gedanken und manchmal, gesteht er, weint er über einem ihrer Gedichte. So beginnt eine Liebe, die sich fern von der wirklichen Welt im luftigen Raum der Gedanken und Möglichkeiten entwickelt. Creuzer beeindruckt alle durch seine Gelehrtheit, kehrt aber dann zurück in seine Staatssklaverei, wie er die Universität nennt, der er noch enger verbunden ist, weil er die 13 Jahre ältere Witwe seines Lehrstuhlvorgängers geheiratet hat. Sie hat schon eine Tochter im heiratsfähigen Alter, die ebenfalls im Haushalt lebt und gründlich in seiner Korrespondenz spioniert. Durch die Leidenschaft für das Stiftsfräulein setzt er seinen Lehrstuhl aufs Spiel.
Karoline von Günderrode sieht das alles mit offenen Sinnen. Sie praktiziert eine Idee von Liebe, die, wo nicht die geliebte Person, dann doch den Entwurf, den die geliebte Person von sich selbst aufscheinen läßt, erhöht. Man schreibt das Jahr 1804. Friedrich Schillers Wilhelm Tell wird im März am Weimarer Hoftheater uraufgeführt. Jean Pauls Vorschule der Ästhetik erscheint. Es ist Sommer. Ein reiches Jahr. Hölderlins Gedichte aus der Bad Homburger Zeit entstehen. Kleist schreibt seinen Zerbrochnen Krug, reist und möchte Tischler werden; diesen Plan gibt er wie so viele auf. Zwei Jahre später ist die Günderrode tot, sechs Herbste später ist auch Kleist tot. Es gibt Zeiten, in denen die Todessehnsucht das sicherste Zeichen von Lebendigkeit ist.
Die Günderrode hat 1804 ihre erste Sammlung Gedichte und Phantasien unter dem Pseudonym Tian veröffentlicht. Sie erregt Staunen und Bewunderung. Brentano lobt die Lyrikerin, doch mit ihren dramatischen Entwürfen kann er nichts anfangen. Das Dramenschreiben möge sie lassen. (Er selbst kann es ja nicht. Wie soll es ihr da gelingen?) Ihre Freundin Lisette Nees, die Hüterin des beruhigenden Ortes Winkel am Rhein, schreibt der Dichterin: »Wage es, liebste Lina, und biete den Frankfurter literarischen Zirkeln Trotz und erkläre Dich frei gegen alles was nicht frei ist, und der Leibeigenschaft zugesellt werden muß. Von allen deutschen Dichtern dürftest Du in diesem Geiste keinen lesen als Tieck, die beiden Schlegel, Goethe und Novalis.«
Als ich mit zagen Knien und trübem Herzen und zwei Freunden das Grab der Günderrode am Rhein zum ersten Mal besuchte, las ich den beiden Freunden ihr Gedicht Der Nil. vor. Es ist ein ungeheuer kraftvolles Gedicht über den lebensspendenden Fluß, zweifellos inspiriert von Hölderlins Fluß-Gedichten. Einer der beiden Freunde lebt heute nicht mehr. Er hat wohl auf gänzlich unromantische Weise das Lebensende der badisch-hessischen Dichterin nachvollzogen und ging in einen bayrischen See; nie wurde eine Spur von ihm gefunden. Tode, Tötungen sind Aktionen, die ein Innehalten fordern, doch auch eine Interpretation möglich machen. Nicht alle Selbsttötungen sind Aggressionen gegen sich selbst, die ursprünglich gegen andere zielten. Manche sind Hilfeschreie, die niemand gehört hat, andere gelungene Aktschlüsse in einem Lebensdrama. Sie sind im extremen Maße Pathosformeln und verletzen die Ordnung der Lebenserhaltung. In jedem Fall lassen sie Traumatisierte, Angehörige und Helfer zurück, die sich Vorwürfe machen, das Unglück nicht haben kommen sehen, Zeichen nicht erkannt zu haben. Die Günderrode ist als eine Schriftstellerin vorwiegend von ihrem selbstgesetzten rabiaten Ende her interpretiert worden.
Der Briefroman ihrer Freundin Bettina von Arnim Die Günderode hat dieser Rezeption Vorschub geleistet. Doch Bettina schreibt und argumentiert aus der Sicht der Jüngeren, des verlassenen Mädchens, das die Lehrmeisterin verloren hat und das deren Konflikte zwischen den unklassischen Philologien, den hochgesteckten Zielen einer weiblich-heldischen Dichtung und den Niederungen eines philisterhaften Gezerres zwischen Leidenschaft und Ehevernunft nicht überschauen konnte – wozu die Ältere, die bei ihrem Tode doch erst 26jährige Freundin, hochgemut und tief depressiv, in der Lage sein mußte. Vielleicht ist Bettinas geflochtener Kranz, der erst 34 Jahre nach dem Tod der Freundin im kalten Wind des reaktionären Preußens entstand und die rheinhessische Frühromantik wie eine rückwärts gewandte Utopie erscheinen ließ, ein Erahnen der Verschiedenheit, auch ein Erahnen, mit welchen explosiven inneren Materialien die so anders geartete Freundin, das Stiftsfräulein, umging. Die Briefe der Günderrode an ihre junge Freundin sind häufig mahnend, ein wenig lehrmeisterlich, ein Propädeutikum des Vor- und Nachdenkens. »Du stehst aber wie ein lässiger Knabe vor Deinem Tagewerk, Du entmutigst Dich selbst, indem Du Dir den steinigten Boden, über den Dorn und Distel ihren Flügelsamen hin und her jagen, nicht urbar zu machen getraust. Unterdes hat der Wind manch edlen Keim in diese verwilderte Steppe gebettet, der aufgeht, um tausendfältig zu prangen. […] Glaubst Du denn, dass ich ruhig bin, wenn Du so mit mir sprichst, von einem zum anderen springst, dass ich Dich aus den Augen verliere. Du hebst mich aus den Angeln mit Deinen Wunderlichkeiten!«
Karoline von Günderrode ist 1780 in Karlsruhe geboren. Ihr Vater war Kammerherr und starb, als das Kind sechs Jahre alt war. Ihre Mutter, eine literarisch außerordentlich gebildete Frau, ging mit sechs Kindern an den nassau-dillenburgischen Hof nach Hanau, danach wurde sie Hofdame der Erbprinzessin Augusta von Kassel. Der Vater hatte sich mit Texten zu geschichtlichen und staatsrechtlichen Themen einen Namen gemacht, die Mutter schrieb Gedichte und Aufsätze; es herrschte die dünne Luft deutscher Gelehrsamkeit. Die Mutter studierte Fichte, den »deutschesten« der Philosophen, der Spuren legte für einen Nationalismus, dessen Saat aufging und reiche, furchtbare Früchte trug. Alle Beigaben des »Völkischen« sind seinem Nationalbegriff beigemischt bis zur erhabenen Lächerlichkeit einer »deutschen Taufe«. Die Tochter liebte Schelling, den Luftgeist.
Drei von Karoline von Günderrodes Schwestern starben in ihrer Jugend. So war der Tod ein vertrauter Gast, einer, dem zu trauen war. Es fällt auf, daß in den Lebensgeschichten vieler, die den Freitod suchen, der Tod von frühauf eine lebendige Erfahrung und Erinnerung ist. Heinrich von Kleist war im Alter von sechs Jahren Waise, Cesare Pavese verlor ebenfalls im Alter von sechs Jahren den Vater, René Crevel wurde als Halbwüchsiger von seiner Mutter gezwungen, seinen Vater, der sich erhängt hatte, zur Abschreckung zu betrachten. Es ist eine Gewohnheit zum Tode, nahezu ein Automatismus, der dieses Ende als das beste aller schlechten Enden vor- und voraussieht.
Die Pension der Mutter ist äußerst bescheiden. An einen ihrem Stand gemäßen Eintritt der Tochter in die weibliche Welt mit Hilfe einer Mitgift ist nicht zu denken. So tritt die 17jährige Karoline als Kanonistin in das Stift ein. Die Damen tragen die schwarze Tracht mit dem Kreuz auf der Brust, sie haben Zeit, ihren Neigungen nachzugehen. An manchen Tagen werden der Günderrode ihre Neigungen zur Plage: Sie leidet an den Augen und muß im Dunkeln bleiben. Die Damen sind eine würdige Gemeinschaft in dem großen, kühlen Bau am Roßmarkt. Die Mauern öffnen sich, Besucher kommen und gehen, bringen Bücher, Nachrichten aus der literarischen Welt. Die Frau Rat Goethe wohnt nur einen Steinwurf entfernt, das lebhafte und gesellige Brenta-nosche Haus strahlt in die Klausur hinein und übt seine Anziehungskraft aus. Dem Clemens Brentano erklärt die Günderrode, was sie sich erhofft. Leben und Schreiben mögen eins sein: »[…] leicht und unwissend, was ich tat, habe ich so die Schranke zerbrochen, die mein innerstes Gemüt von der Welt schied; und noch hab ich es nicht bereut, denn immer neu und lebendig ist die Sehnsucht in mir, mein Leben in einer bleibenden Form auszusprechen, in einer Gestalt, die würdig sei zu den Vortrefflichsten hinzutreten, sie zu grüßen und Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Ja, nach dieser Gemeinschaft hat mir stets gelüstet, dies ist die Kirche, nach der mein Geist stets wallfahrtet auf Erden.« Die Poesie als eine unio mystica, ein dem Leben nicht standhaltender utopischer Anspruch.
Das Stiftsfräulein verliebt sich mit der ihr eigenen Unbedingtheit in den Heidelberger Professor der Altertumswissenschaft Friedrich Creuzer, dessen Häßlichkeit von vielen Zeitgenossen bezeugt wird. Vorher hatte sie schon dem Juristen Karl von Savigny Avancen gemacht und ihm tollkühn ihr Gedicht Der Kuß im Traume, aus einem ungedruckten Romane. zugeeignet und vermutlich in einem Brief zugestellt. Sie braucht einen intellektuellen Gesprächspartner. Fast täglich werden Briefe zwischen Heidelberg und Frankfurt gewechselt. Manchmal schreibt Creuzer, sich in den Universitätsversammlungen langweilend, an sie, während die Günderrode, klar und durchsichtig wie Wasser, alles sie Störende abstreift. Creuzer argumentiert: »Siehe, darum klage ich so oft über mein Amt, weil es mich hindert, einzig zu leben, um Dich zu erfreuen. Wäre ich reich, so würde ich bloß darauf denken, bloß für dich zu arbeiten. Dürfte ich doch die Wange küssen, die so rot war vom Morgentraum.« Er schlägt ihr das für ihn Bequemste vor, eine ménage à trois. Wilde, verzweifelte Pläne werden gemacht. Es eröffnet sich für ihn die Aussicht auf eine Professur in Rußland. Die Günderrode faßt den wahrhaft romantischen Entschluß, als Page, Schüler, Student, jedenfalls als männliche Begleitperson, mit dem unbeholfenen, erdenschweren Creuzer zu reisen. Doch auch diese Hoffnung zerschlägt sich. Creuzer taugt nicht zu hochfliegenden Plänen. »Wenn er zu fliegen versuchte«, schreibt ein Biograph der Günderrode, Richard Wilhelm, »zog er die ganze Last seines unklaren Hausstandes hinter sich her.« Mit einer mythischen Gewalt tritt dagegen die Gewißheit zu lieben in Karoline von Günderrodes Leben, steigert und radikalisiert es, ein Fest, bei dem der liebste Gast fast immer fehlt, ein Leben, das aus dem Mangel Reichtum macht.
Eins in Zwei zu sein,Eins im Andern sich zu finden,Daß der Zweiheit Gränzen schwindenund des Daseins Pein
heißt es in ihrem Gedicht Die eine Klage. Die Liebe entgrenzt die festgefügte Person, verbindet sie rückwärts und vorwärts, mit allem Gewordenen und allem Denkbaren, und der Mann bleibt in seinen Grenzen gefangen.
In diesem für sie unaufhebbaren Konflikt trösten sie ihre philosophischen Studien über Schelling. »Damals kannte ich Schelling noch nicht. Wenn der nicht gewesen wäre, so wäre ich nichts«, schreibt sie einmal an Creuzer, der sich ein solches Geständnis ärgerlich verbittet. Vermutlich nicht, weil er die Demut der Freundin schlecht ertragen kann, sondern weil er ungern einen anderen Herrn neben sich, über Karoline von Günderrode dulden will. Die Günderrode dankt Schelling, daß er die Keime, die sie in sich trug, in ein System bringt, in dem sie weiterwachsen können. Nicht seiner Dialektik der Begriffe fühlt sie sich verpflichtet, sie dankt ihm, daß er ihr, der in den Grenzen der bürgerlichen Konfession verarmten Gläubigen, eine Vorstellung von »Religion« – um Novalis’ Begriff zu gebrauchen – gab. Einer Religion in sich und außer sich, einer Religion, die keinen Gott braucht. Schellings Philosophie bestätigt ihre Blickrichtung auf das All, bestätigt ihren Zusammenhang mit Vergangenheit und Zukunft. In ihrem Nachlaß findet sich ein erstaunlicher philosophischer Text, Jdee der Erde, in dem es heißt: »So giebt jeder Sterbende der Erde ein erhöteres, entwikelteres Elementarleben zurük, welches sie in aufsteigenden Formen fort bildet und der Organismuß indem er immer entwikeltere Elemente in sich aufnimt muß dadurch immer vollkommener und allgemeiner werden. So wird die Allheit lebendig durch den Untergang der Einzelheit, und die Einzelheit lebt unsterblich dort in der Allheit deren leben sie lebend entwikelte, und nach dem Todte selbst erhöht und mehrt; und so durch leben und sterben die Jdee der Erde realisiren hilft.«
Im Lichte der neueren Märtyrerforschung, »stellt die Entscheidung zum Märtyrer den Versuch dar, unter Bedingungen der Unterwerfung oder Abhängigkeit ›souverän‹ zu agieren«. Schwäche werde dabei in Stärke, Ohnmacht in Macht konvertiert. Dies trifft auch auf Karoline von Günderrode zu.
In der Enge des Stifts, in den Konflikten der peinlichst geheim gehaltenen Liebe wächst sie über sich selbst hinaus, wird Schwester der Erde und des Lufthauchs, eine Priesterin der Liebe, die in sich selbst verschlossen sein muß. Eine Tat, die den Gordischen Knoten durchtrennt, fürchtet Creuzer. Er zögert und zögert. Er klagt. Und besingt die männliche Festigkeit, mit der die Günderrode an ihrer Liebe festhält, während er vorsichtige Vorschläge macht: Wenn sie sich anderswie an einen Mann binden, sprich: wohlanständig verheiraten wolle, so werde er ihr nicht im Wege stehen, sondern alles zu ihrem Besten tun. Eine Zumutung für eine Liebende: so viel falsche Fürsorglichkeit. Immer wieder verzögern sich die vereinbarten Treffen, allerlei Nichtigkeiten halten ihn in Heidelberg fest, manchmal scheint es, als fürchte er die unbedingt Liebende. Er spürt in seinen Forschungen den nächtlichen Seiten des Griechentums nach, ahnt sie, aber lebt sie nicht. Manchmal fürchtet er für ihren guten Ruf, wenn er im Stift auftaucht. Das sind geordnete Rückzugsgefechte. Einmal will seine Frau ihn freigeben und in eine Scheidung einwilligen. Endlich könnte das Paar ohne Skandal vereint sein, aber Creuzer zögert wieder, die Scheidung durchzusetzen. Er müßte dafür den Kurfürsten behelligen, aber der hat jetzt andere Sorgen. Es könnte Krieg geben, da darf man ihm nicht mit privaten Lappalien kommen. Creuzer zögert so lange, bis seine Frau die Bereitschaft zur Scheidung widerruft. Im Laufe des Jahres 1806 wird der Ton der Briefe zusehends gereizter, Creuzer fühlt sich in die Enge getrieben, erkrankt und entsagt seiner Liebe zu dem Stiftsfräulein. Die Botschaft dringt an den Rhein, die Dichterin nimmt sie ruhig auf. Sie spaziert ans Flußufer und sticht sich den Dolch ins Herz, den sie schon lange besitzt.
Ihre dritte Textsammlung Melete. Fragment eines unediert gebliebenen Werks von Tian war noch durch Creuzers Vermittlung auf den Weg gebracht worden und sollte 1806 bei Zimmer und Mohr in Heidelberg erscheinen. Nach dem Tod der Dichterin wurde der begonnene Druck wieder eingestellt. Es ist der Verlag, bei dem von 1805–1808 die Liedsammlung Des Knaben Wunderhorn erschien. So eng, so nah waren die Verbindungen. Doch Creuzer ließ den Druck abbrechen; ursprünglich wünschte er, auch einen eigenen Text in den Band aufzunehmen. An seinen Cousin, den Prediger und Professor der praktischen Philosophie in Marburg, Leonhard Creuzer, schrieb er von seiner Überzeugung, »[…] daß Unterdrükung dieser Schrift durchaus nötig sey. Auch wünscht der Bruder der Seeligen dies ausdrücklich, dem man doch hier wohl eine entscheidende Stimme lassen muß. […] Schwarz ist auch gegen den Druck.« Am 31. Oktober schrieb Creuzer wieder an seinen Cousin, um den Nachlaß der Günderrode und die verschiedenen Briefwechsel zu ordnen und an ihre Empfänger zurückzugeben. Er war milde gestimmt, sanftmütig, gefaßt. »Wenn ich nur meine Sophie noch recht lange behalte.«
Creuzer wird sehr alt und lebt in Heidelberg bis zu seinem Tod mit seiner Frau Sophie. In seinem autobiographischen Bericht erwähnt er die Günderrode nicht; er spricht von dieser Zeit als einer »Periode schwerer Seelen= und Körperleiden«. Am 20. Oktober 1806 schreibt er an Leonhard Creuzer in ähnlichen Wendungen, wie Novalis sie im März 1797 nach dem Tod seiner Kindergeliebten Sophie gefunden hat: »Warum ist mir nicht die Harmlosigkeit solchen Daseins geworden? Oder soll ich erst durch Sturm und Wetter dahin gelangen? Dann möchte ich früher wohl zur ewigen Ruhe eingehen. Doch wie Gott will. Glaub mir, ich bin in einer ernsten Schule gewesen und dreimal töricht sollst du mich nennen, wenn es nicht Früchte trägt.« Der Tod, dieser sonderbar vertraute Bursche, bei dessen Anwesenheit jeder noch Lebendige, doch Todesfürchtige den Hut zieht, wirft einen großen Schatten – einen zu großen, der die jung Gestorbene vermutlich unter sich begräbt und den ehemaligen Freund erniedrigt und schweigsam macht, zu einer seltsamen Figur – aus der Zeit, aus dem Rahmen gefallen: Niemand beschuldigt ihn ja; aber vielleicht ist das um so schwieriger.
Man muß Karoline von Günderrode exhumieren anhand ihrer wahren Hinterlassenschaften – und das sind ihre leuchtenden Texte und nicht die Erinnerung an die tragische Person an der feuchten Kirchhofsmauer. Was geht in einer jungen Frau vor, die eine Erzählung von einer unbedingten Heldin, die den Vater rächt und den Geliebten tötet, so beginnt: »Ermar hatte das Geschlecht von Parimor vom Thron gestoßen. Parimor selber, sein Weib und seine Freunde waren gefallen unter dem Schwerte des Ueberwinders, nur Timur sein einziger Sohn, fiel lebend in Ermars Hände. Ungern unterwarf sich das Land dem Sieger, der die Burg des unglücklichen Parimor an der Nordküste der Insel bezog; und die höchste Gewalt mit seinem Bruder, dem wilden Konnar theilte.« Das Heroische, das sich aus dem Idealischen ihrer Texte herausschält, bleibt fremd für die ästhetischen Bemühungen, die in der Literatur von Frauen gerade das Fragmentierte, lose Gefügte, Spontane, Authentische, »Nicht-Klassische« suchen. Liest man das Werk der Günderrode, so ist eine Autorin zu entdecken, die Heinrich von Kleist, auch in seiner Gewaltsamkeit, ungleich näher steht als Clemens Brentano. Christa Wolf hat diese Nähe als eine unausweichliche Konstellation in der Geschichtlichkeit imaginiert, die Günderrode allerdings in ihr eigenes Konzept von Literatur integriert. Wo das Schreiben als Prozeß Fragment geblieben ist – der zweite Band des Kunstautors Tian hieß bereits Poetische Fragmente, gedruckt bei Friedrich Wilmanns in Frankfurt am Main im Jahr 1805 –, ist eine offene Form angestrebt; es ist nicht »unfertig«, sondern fließend, es wehrt sich gegen Festschreibungen.
Der Kritiker der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung Christian Nees, der Ehemann ihrer Freundin Lisette Nees, spricht davon, was diese Fragmente »sind, mit dem, was sie, gemäß ihrer ursprünglichen Anlage, und in dem, zu Tage brechenden Sinn der Dichterin, werden und seyn sollten«. Irritierend für ihn ist, daß die Günderrode »dichten [wollte] als Weib im männlichen Geist«. So erscheint ihm das Scheitern vorgezeichnet. Doch hätte sie zu dichten versucht als Weib im weiblichen Geist, ihre Arbeit wäre als eine höhere schriftliche Stickerei angesehen worden. Sie selbst empfindet sich wohl »den Sehern« in der Literatur am nächsten: Novalis, Friedrich Hölderlin. Sie will das Ganze, Glühende, Reine, nie das Lauwarme, Ungefähre, und wenn dies in der Realität nicht möglich ist, dann doch in der Vorstellung, die allemal reicher, kunstvoller, ernsthafter ist. Sie will den Augenblick der Wahrheit. Sie verlangt nichts weiter als Offenbarung, und wenn sie durch den furchtbarsten Schmerz zu ihr kommt. »Sie tritt als romantische Philosophin vor die Bühne, sie erblickt nicht Dasein, sie verlangt Offenbarung«, schreibt der Biograph Richard Wilhelm.
An Melete.
Schütze, o sinnende Muse, mir gnädig die ärmlichen Blätter!Fülle des Lorbeers bringt reichlich der lauere SüdAber den Norden umziehn die Stürme und eisichte Regen;Sparsamer sprießen empor Blüthen aus dürftiger Aue.
Die Zueignung des Bandes an Melete. – vermutlich Anfang des Jahres 1806 entstanden – spricht in stoischer Nüchternheit, in streng gemeißelter Schönheit vom Aushalten, von einem Durchhalten, das das Leiden purifiziert und zu einem Objekt des ästhetischen Kalküls macht. Der Titel entspricht einem der von Friedrich Creuzer gemachten Vorschläge aus der produktiven Zusammenarbeit des Paares. Hier spricht keine unglücklich Liebende, der der Schmerz Worte verleiht, hier spricht eine poetische Instanz und wendet sich an »die Muse des sinnigen Daseins – die Muse, die auf hohe Lieder sinnet.«
Zum Aushalten des Schmerzes gehört auch ihr unsentimentaler und weit über ihre Zeit hinausweisender Zugang zu Träumen. Sie literarisiert sie nicht, hält sie von prophetischer Bedeutsamkeit frei. Ungewöhnlich für ihre Zeit notiert sie sie nahezu »roh«. Auffallend sind die Todesschwärze und die Ergebenheit in das Unvermeidliche des Sterbens in diesen Traumnotaten. Zwei Traumberichte kreisen um den Tod der Schwestern.
»Jch ging an Lottens Seite durch eine schöne Gegend; vor uns war ein kleines zerfallendes Landhaus zwischen Kornfelder u Wiesen, aber alle Kornähren lagen wie vor ihrer eignen Schwere zu Boden gedrükt. Lotte war weis gekleidet, bleich u schwankend; u meine Seele war traurig. Die Zeiten wechslen, u eilen, sagte ich: die Geschlechter vergehen u du bist so krank, u wirst auch bald vergehen. Ach! sagte sie: sei nicht traurig daß die Geschlechter vergehen, u daß ich auch bald vergehe. –––«
»Jch hatte zwei Schwestern, die Älteste liebte ich vorzüglich weil sie mit mir eine große Ähnlichkeit der Gesinnung hatte; ich war seit mehrern Wochen von ihr entfernt und dachte oft in Sehnsucht und Liebe an sie, da träumte mir einst diese beiden Schwestern seyn gestorben, ich war sehr traurig darüber. Da erschienen mir ihre Geister in dem Hofe eines alten Hauses indem wir einen großen Theil unserer Jugend verlebt hatten. Sie traten beide aus einer dunkeln Kammer vor der ich immer einen gewissen Schauer gehabt hatte. Es war Nacht, eine feuchte Herbst-Luft wehte und reichlicher Regen fiel herab. Meine ältere Schwester nahte sich mir, und sprach: Eine ewige kalte Nothwendigkeit regiret die Welt, kein freundlich liebend Wesen. Jch erwachte; Es träumte mir noch mehrmals sie sei gestorben obgleich sie sehr gesund war. Nach zwei Jahren erfülte sich der Traum, beyde starben kurz nacheinander.«
Was sich neben den Gedichten zu entdecken lohnt, sind Karoline von Günderrodes Dramen und Dramenentwürfe, die auch Christa Wolf in ihrer Auseinandersetzung mit dem Werk der Günderrode außer Acht läßt. Es sind Abbreviaturen, Skizzen, die breitwandige Gemälde anlegen; der gedankliche Elan ist nicht aufgebraucht vom Verlauf, sie sind nicht untergegangen in Wirklichkeit. Nicht Mimesis interessiert sie, sondern Konstruktionen, ein Aufeinanderprallen. »… und ich hab mir einen Plan gemacht zu einer Tragödie, die hohen spartanischen Frauen studiere ich jetzt. Wenn ich nicht heldenmüthig sein kann und immer krank bin an Zagen und Zaudern, so will ich zum wenigsten meine Seele ganz mit jenem Heroismus erfüllen und meinen Geist mit jener Lebenskraft nähren, die jetzt mir so schmerzhaft oft mangelt und woher sich alles Melancholische doch wohl in mir erzeugt.«
Im postdramatischen Theater ist das Bewußtsein vom Fragmentarischen in der romantischen Dichtung, das Interesse am Elliptischen, am Nicht-Ausgeschriebenen, an der Lücke an Stelle des vom Dramatiker Vorgegebenen, das den Darstellern keinen Raum mehr läßt, wieder erwacht. Die weiblichen Dramenfiguren der Günderrode, etwa Hildgund, die burgundische Prinzessin, geraten in Bewegung; es sind Amazonen, Grenzgängerinnen mit universellem Handlungsanspruch. Sie stehen für das Experimentelle, Gattungsübergreifende weiblicher Dramenproduktion. Es ist eine Eroberung des Raumes, der Gesten. »Dieser Bereich ist verklammert mit Größenphantasien, die von Triumph, Glanz und Größe sprechen. Insofern kann das Drama als ein Feld der ›Verheißung‹ gelten«, schreibt Dagmar von Hoff. In den Dramen wird eine Bedeutung des Tragischen definiert, die den weiblichen Figuren weitere Räume als die privaten öffnet. Die weiblichen Figuren der Günderrode sprechen in der Öffentlichkeit, und sie sprechen für eine Öffentlichkeit. Sie behaupten eine staatstragende, machtvolle Rolle. Dieser Anspruch ist konstitutiv für die Gattung, steht im Gegensatz zu den »intimeren«, subjektiv getönten Produktionsformen der Romantik: dem Gedicht, dem Brief, dem Salongespräch. Hildgund, eine Jungfrau in Waffen, fühlt die Macht, einen Dolch führen zu können. Die Verarbeitung der Attila-Sage, zu ihrer Zeit unschwer als Anspielung auf Napoleon zu erkennen, ist positiv gewendet. Zweifellos reagiert die Günderrode auf Friedrich Schillers Drama Die Jungfrau von Orleans. Eine romantische Tragödie, die in Leipzig 1801 uraufgeführt worden ist. Bezeichnenderweise wird der Untertitel des Dramas kaum beachtet bzw. zitiert. Hildgund, selbsternannte Erlöserin, Befreierin, ist per se eine Überschreitung aller Grenzen. Zwei Zeilen nur aus ihrem Monolog:
Der Völker Schicksal ruht in meinem Busen