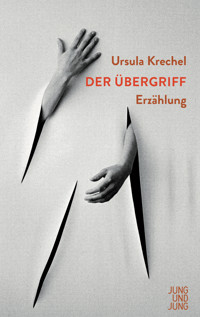Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Buch für alle, die Lust haben, Literatur zu schreiben. Und für die, die es sich nie zutrauen würden. Sie möchten einen Roman schreiben und damit viel Geld verdienen?Dann sind Sie für dieses Buch nicht der Richtige. Wenn Sie aber nicht ans Geld, sondern an die Wörter und Sätze denken, die sich in Ihnen melden und die ein Text werden wollen, dann haben Sie gerade das Buch in der Hand, das Ihnen dabei helfen kann. Es enthält nämlich weder Schnittmuster noch Baupläne und schon gar keine Gebrauchsanweisungen; es nimmt vielmehr Sie selbst ernst als jemanden, der sich auf das riskante Unternehmen einläßt, aus Erfahrung und Sprache Kunst entstehen zu lassen. Da ist dann vom Glück des Beginnens ebenso die Rede wie vom Einfall, vom Figuren finden, von Klang und Wohlklang, aber auch von der Blockade und dem Warten. Kluges Nachdenken über die Rolle des Schriftstellers hilft beim Überprüfen der eigenen Erwartungen. Das Buch ist durchzogen von der Lust, die das Schreiben verursacht, und der Freude, die seine Ergebnisse bewirken können.Ursula Krechel hat in den vergangenen Jahren ihre eigene Schreiberfahrung in den unterschiedlichsten Institutionen, vor allem aber an der Universität Leipzig und am Literarischen Colloquium Berlin zahlreichen Studenten weitergegeben. Inspirierter und inspirierender ist über den möglichen Aufbruch in die Welt der Literatur noch nicht geschrieben worden
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
In Zukunft schreiben
3. Auflage
© 2003 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck: CPI Moravia Books, Pohořelice, © 2010ISBN 3-902144-66-1
URSULA KRECHEL
In Zukunft schreiben
Handbuch für alle,die schreiben wollen
The old cry used to be: you can’t make a writer. Oh, yes, you can. You can take him young, insecure, and worried.
You can make him old, insecure, and worried.
Paul Engle
Man fragte Rockefeller, wie er zu seinem Reichtum gelangt sei. „Indem ich untersuchte, wie man jeden Gegenstand, der mir in die Hände fiel, zu Geld machen könnte.“ Idem für die Poesie, die Literatur.
Max Jacob
Am Anfang stehen
Ein Fensterkreuz, an dem eine Jacke baumelt, das Taubengurren, das Tschilpen der Spatzen am frühen Morgen auf der Regenrinne, das Brummen des Druckers unter dem Tisch, alles könnte in einen Text eingehen, ist Text, wenn sich jemand zum Schreiben, zum Beschreiben entschließt. Er tut dies zum ersten Mal, er tut dies, als hätte noch nie jemand vor ihm über Tauben und Spatzen und eine lüftende Jacke geschrieben, jedenfalls glaubt er das. Es ist ein unendliches Glück, noch ist alles möglich, noch ist alles Entwurf, Skizze. Noch leuchtet alles im blendenden Licht. Wer zu schreiben beginnt, hat einen Vorrat von Welt, von Gegenständen zur Verfügung. So soll es bleiben.
So bleibt es und ändert sich doch: Die Empfindung für das Schreiben ändert sich mit der wachsenden Schreiberfahrung. Schreiben ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, das Denken zu schärfen, etwas in Erfahrung zu bringen für sich und andere und es aufzubewahren. Der Schreibende kann sich wie ein Kundschafter vorkommen. Er ist niemand, der schon alles weiß, es niederschreibt und sein Wissen mitteilt. Vielmehr ist er einer, der wissen will. Ihn treibt die Neugier auf all das, was ihm unterwegs begegnet. In diesem Zustand ist Gegenwart, brennende, leuchtende Gegenwart, die Antennen sind aufgerichtet, ausgerichtet auf das eigene Erleben und auf das exemplarisch Erlebbare. Dieser glückhafte Zustand hat eine dunkle Kehrseite, er schnürt die Beziehung zur Vergangenheit ab und verhindert eine wichtige Dimension von Erfahrung: die der Geschichtlichkeit des eigenen Tuns und Bestrebens.
Wer beginnt und den Wunsch hat, das spontane Schreiben zu einer Arbeit, möglicherweise zu seinem Beruf zu machen, tut dies in einem bestimmten historischen und sozialen Raum. Er ist angefüllt mit Texten. In ihm herrschen ästhetische Übereinkünfte verschiedenster Art, Wertungen und Tabus. Doch wer zu schreiben beginnt, wird nicht der Fülle gewahr. Für eine Zeitlang ist der Blick nach innen gewandt, es füllen sich nur Blätter mit Zeichen, mit Symbolen, so entsteht (vielleicht) etwas von dem anderen, welches Literatur, Kunst ausmacht. Wer zu schreiben beginnt – und dies kann ein Beginn in jedem Lebensalter sein –, hat etwas mitzuteilen. Er hat sich mitzuteilen. Jedenfalls glaubt er das. Ob er etwas zu sagen hat, muß sich in jedem einzelnen Fall beweisen. Etwas zu sagen haben, soll hier zunächst keinesfalls metaphorisch verstanden werden. Es müßte dann heißen: Jemand hat etwas zu sagen. Mitzuteilen ist die dramatische Situierung eines einzelnen Menschen in der Welt, seine Herkunft, seine Vorlieben, Abneigungen, sein Lieben. Es könnte auch sein, daß jemand am Anfang gar nicht über sich selbst Mitteilungen machen möchte, sondern seiner Wahrnehmung vertraut. Es könnte sein, daß er schreibend Wirklichkeit erforschen, ja, überhaupt erst Wirklichkeit genauer erfassen will, daß er mitteilt, was er sieht und hört, was er liest und wie er darauf reagiert. Es könnte sein, daß jemand mitteilen möchte, wie und über was um ihn herum gesprochen wird, mit äußerster Hellhörigkeit, daß er beobachten möchte, was geschieht, was ihm oder anderen geschieht, geschehen könnte. Und vor allen Dingen ist die Veränderung der Wahrnehmungsfähigkeit im Gegensatz zu anderen Menschen, die früher geschrieben haben, ein wichtiger Teil der Arbeit. Das Ich beginnt, Fragen zu stellen, beginnt, Beobachtungen zu machen und sie selbst zu verantworten, sich Eigenheiten zu stellen, sie aufzusuchen. Es beginnt, seine Beobachtungen mit den im Umlauf befindlichen Behauptungen zu vergleichen. Es nimmt Differenzen wahr.
Mit anderen Worten: Es geht um eine starke Individualisierung in der Sicht von Welt, im Umgang mit Sprache, in der Verarbeitung von Wahrgenommenem. Wer zu schreiben beginnt, öffnet einen Raum, der gefüllt werden will, nicht vollgeschrieben. Wer schreibt, glaubt, schreiben zu können, weiß aber noch nicht, daß er das Schreiben lernen muß, lebenslänglich und täglich noch einmal. Der Schriftsteller ist ein Pionier des lebenslangen Lernens. Auch das Weiterschreiben von Tag zu Tag, von Buch zu Buch ist ein Lernen über Beschränkungen, über Zwänge und Regeln. Manche Zwänge und Regeln muß der Schriftsteller, die Schriftstellerin sich selbst auferlegen.
Als sich in mir der Berufswunsch Schriftstellerin formte, verfing, festigte oder als ich begriff, daß keine andere Tätigkeit als Schreiben mich auf Dauer befrieden (ich sage nicht: befriedigen) würde, war dieser Wunsch, der Entschluß, dem Wünschen zu trauen, ein geheimer. Das Schreiben im Rücken der Schulaufgaben, zwischen rasch hingefetzten Pflichtübungen, war eine Erregung, zu der das Geheimnis unmittelbar gehörte. Es zog mich mit vierzehn, fünfzehn Jahren, nachdem alles Erreichbare ausgelesen, ausgetrunken war, zum gerade eröffneten Neubau der Stadtbibliothek, einem weißen Wabenbau am Rande des Trierer Palastgartens, der Bau war kühl und hell, ein paar Treppenstufen führten hinauf, eine kleine kulturelle Erhabenheit, die ich auf Zehenspitzen nahm. Innen im weiten Lesesaal saßen ältere Herren über Halbjahresbänden der Lokalzeitung auf der Suche nach einer vergilbten Notiz, Studenten kamen in den Semesterferien, die Aufsicht flüsterte, die Herren räusperten sich. Ich bekam einen Leseausweis, was mich überraschte und stolz machte, ich lernte das Wort Inkunabel. Manchmal führte der Direktor der Stadtbibliothek Gäste durch das neue Haus, in dem endlich die alten, kostbaren Bücher sicher aufbewahrt waren, ich hörte, daß sie im Krieg ausgelagert gewesen waren und glücklicherweise gerettet wurden. Ich schloß mich einer Besuchergruppe an, bestaunte die Miniaturen, die in den Zwickeln der goldenen Buchstaben saßen, öffnete die Karteikästen aus hellem Holz, blätterte, doch ich wußte nicht, was ich suchte. Die Schublädchen mit den alphabetischen Namensverzeichnissen nützten mir nichts, es war schön, in die Griffmulden zu fassen, es war schön, sich an einen der hellen, großen Holztische zu setzen und hinauszuschauen in den Park, drinnen und draußen, geschützt in einem kulturellen Kokon, die Glocken läuteten, draußen gingen Frauen spazieren, manche hatten einen Hund, meine Mutter ging nie allein spazieren. Ich saß auf einem gepolsterten Stuhl mit sanft gebogener Lehne, azurblau, so sahen auch Cocktailsesselchen aus. Es war schön, mit der Hand, die nicht schrieb, über das eigene Knie und weiter über das Polster des Sesselchens zu streichen. Ich stand auf vom blauen Sitz, in dem es sich so zeitgenössisch modern saß, ich fand den systematischen Katalog, schnüffelte beim Buchstaben P, bei Poesie, fand den Begriff Poetik, den ich nicht kannte. So begann es. Andere begannen als Heizer auf einer Seereise oder als Kesselreiniger in den Kavernen des Sozialismus.
1Das Glück des Beginnens: die Gattungen
Mitteilungen unter verschärften Bedingungen
Wer schreibt, macht die oft schmerzhafte Erfahrung, daß die Mitteilung, auch die schriftliche, und das freie Schreiben, das er begonnen hat, gänzlich verschiedene Bedingungen haben und anderen Regeln gehorchen. Er schreibt vielleicht am Anfang „nur einfach so“. Und es ist ja ein Menschenrecht, sich mitzuteilen. Darauf beruft sich auch – insgeheim – der Schreibende. Ein Menschenrecht, in seiner Mitteilung verstanden zu werden, gibt es nicht.
Der einfache Aussagesatz „Ich bin krank.“ hat je nach der sozialen Situation der Mitteilung eine vollkommen unterschiedliche Bedeutung. In der Sprechstunde eines Arztes heißt dieser Satz in der weiteren Folge: „Untersuchen Sie mich!“ Oder: „Lindern Sie meine Schmerzen!“ Der Aussagesatz verbirgt eine unausgesprochene Bitte oder gar eine Handlungsaufforderung. Der gleiche Satz, in einer intimen Situation zu einem nahen Menschen gesprochen, kann eine Entschuldigung oder eine Erklärung für ein ungewöhnliches, ja bestürzendes Verhalten sein. Seine Übersetzung hieße dann: „Ich kann nicht tun, was du von mir erwartest.“ Möglicherweise begründet der gleiche Satz eine noch vertraulichere Aussage: „Ich habe eine schwere, lebensbedrohende Krankheit, die mich von vielem ausschließt.“ So gesprochen, läßt er dem Adressaten einen Freiraum, in dem Mitleid, Furcht oder Abwehr entstehen können. Der Satz mag die Aufschlüsselung eines Geheimnisses oder einer tiefen Beschämung sein. Zu einem Arbeitgeber gesprochen, hat er wieder eine andere Bedeutung: „Fragen Sie nicht weiter, ich werde heute nicht am Arbeitsplatz erscheinen.“ Die Mitteilung ist stark formalisiert und schneidet eine weitere Kommunikation ab. Die Fragen, die darauf folgen könnten, „Ist es schlimm?“, „Tut es weh?“, sind dann unangemessen. Entweder erscheint ein tatkräftiger und wieder gesunder Mensch am nächsten Tag am Arbeitsplatz, oder er legt ein Attest vor, das seinen Satz mit ärztlicher Autorität unterfüttert, eine Ursache des Fernbleibens liefert, doch nicht unbedingt die Krankheit nennen muß.
Wollte man einen Roman oder eine Erzählung lesen, die mit dem Satz „Ich bin krank.“ beginnt? Hat man einen solchen Anfangssatz je gelesen? Vermutlich nicht. Es fehlt diesem Satz eine Dimension der Tiefe. Man könnte diese auch als eine zeitliche Dimension bezeichnen, die dem Erzählen innewohnt. Wie war das, als ich gestern noch gesund war? „Ich bin krank.“ Man wiegt diesen Satz, man wiegt das Buch in der Hand, es wiegt nicht so schwer, schwerer wiegt die Erwartung einer langwierigen tragischen Verwicklung mit falschen Diagnosen, gescheiterten Operationen, Unverträglichkeiten, eine existenzielle Krise, nein, das zieht nicht an. Es sei denn, außerliterarische Gesichtspunkte wie Voyeurismus oder Schadenfreude stehen im Vordergrund. Man erwartet insgeheim etwas, von dem schlichtere Leute gerne sagen: Darüber könnte ich Romane schreiben. Und glücklicherweise tun diese Leute es doch nicht. (Vielleicht, weil sie ahnen, niemand wollte ihren Roman kennenlernen.) Der Satz, der in der Alltagskommunikation so weitreichende Bedeutungsfelder öffnet, lädt nicht zum Lesen ein, eher fürchtet man intime Geständnisse oder Zumutungen, eine Grenzüberschreitung der Negativität.
Könnte ein Gedicht mit diesem Satz beginnen? Sogleich liegen die drei Wörter anders in der Hand, und vor allen Dingen liegen sie anders im Mund. Ja, man muß sie in den Mund nehmen und probehalber vor sich hinsprechen: drei gleichrangige Silben, drei kurze Wörter, bam bam bam. Ich bin krank. Das sind Glockenschläge, so wird die Zeit angezeigt. Für ein Gedicht sind sie viel zu schwerfällig, zu unbeweglich. Sofort müßte eine kleinere Glocke zu bimmeln beginnen, damit eine Wortmusik entstünde. Versuchsweise stellen wir die Wörter des Aussagesatzes um, wie es das Deutsche im Gegensatz zu anderen Sprachen erlaubt: „Krank bin ich.“ Damit hat sich bereits etwas Entscheidendes geändert. Wir hören die erste Silbe wie einen Auftakt. „Krank bin ich.“, und plötzlich stellt sich eine Erwartung ein. Man möchte insgeheim gleich Auslassungszeichen hinzufügen: „Krank bin ich …“ Die Silben sind nicht mehr gleichrangig, krank und ich haben einen stärkeren Akzent als die mittlere Silbe. Man möchte fortfahren, so etwa: „Krank bin ich und klage nicht.“ Was macht diese Zeile in aller Bescheidenheit des Ausdrucks einigermaßen befriedigend, während eine Fortführung wie: „Krank bin ich und hole mir ein Attest.“ sofort die lyrische Schmerzgrenze erreicht und verworfen wird? Als Gedichtzeile geschrieben, klingt diese zweite, versuchsweise notierte Einheit nicht. Es sind zu viele widerstrebende Elemente darin, zu viel Durcheinander, die sechs letzten Silben stolpern, und gleichzeitig fehlt ihnen etwas Spezifisches, sie sind einfach langweilig.
Krank bin ich und klage nicht.
Wenn wir diese Zeileneinheit auf ihren Lautstand untersuchen, besticht sie durch ihre Reduktion, nur zwei Vokale tragen die Zeile, A und I, das unbetonte E in „klage“ ist zu vernachlässigen. Die Reduktion ist eine Ordnungsmacht, auch im Gedicht, weniger ist mehr, die Entscheidung für eine bestimmte Struktur schafft Befriedigung. Eine weitergehende Befriedigung ergibt sich aus der Wiederholung des Konsonanten K bei den betonten Silben krank und kla- und der Inversion der Lautfolge von i und n. Da das Verb eine natürliche, größere Betonung hat als die Verneinung am Schluß, lesen wir unwillkürlich:
Krank bin ich und klage nícht …
Auf der verneinenden Silbe ruht ein Akzent, der jedoch nicht so stark ist wie der Akzent der sinntragenden Wörter, ein Nebenakzent. Die kleine Operation hat sogleich in das Reich des Akustischen geführt, während in der Prosafassung sich alle Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der einzelnen Wörter gerichtet hat. Das Gedicht als eine mit einem Blick überschaubare Einheit läßt uns nicht fürchten, hier werde eine Krankengeschichte ausgebreitet, dafür hat es keinen Raum, und vielleicht ist auch deshalb die kleine Zusatzerfindung „klage nicht“ befriedigend. Die Zeile sagt energisch und explizit, was ein Gedicht leisten kann und was es vermeidet, für Schwellungen, Abszesse und falsche Diagnosen ist hier kein Platz.
Stellen wir uns eine Figur auf dem Theater vor, die den Satz „Ich bin krank.“ ausspricht. Sofort können wir uns auf eingespielte Reflexe verlassen, ja, wir wissen es, die Figur wird doch nicht die ganze Geschichte erzählen. Der Theaterinstinkt wird uns vermuten lassen, sie wird überhaupt nichts erzählen, jedenfalls nicht das, was uns, als wir von Prosa ausgegangen sind, gleich in Besorgnis gestürzt hat. Der Theaterinstinkt sagt: Hier muß etwas geschehen, es kann nicht so schlimm sein, wenn eine Figur mit diesem Satz auftritt. Wir sehen es. Jemand ist nicht krank, sondern behauptet, krank zu sein. Vielleicht sagt der Gestus der Figur bereits: Ich spiele einen Kranken. Sie können dies glauben oder nicht. (Natürlich ist der Schauspieler X, der den Kranken darstellt, kerngesund.)
„Ich bin krank.“ Wir sehen einen Körper im Raum, der uns Hinweise gibt, inwieweit wir dem Aussagesatz trauen können und wollen. Vielleicht tritt eine zweite Figur auf, die sagt: „Ich nicht.“ Sofort befinden wir uns in einer clownesken Situation.
X: Ich bin krank.
Y: Ich nicht.
X: Das tut mir aber leid.
Würde nicht X, sondern Y „Das tut mir aber leid.“ sagen, wir befänden uns in einem Elends-Dialog, in dem mit Gewißheit auf eine Einführung die erwartete Fortführung kommt. „Mein Wellensittich ist gestorben.“/ „Das tut mir aber leid.“ Oder: „Heute morgen hat es geregnet.“/ „Ich habe auch meinen Schirm vergessen.“/ Oder: „Ich habe keinen Stoff mehr.“/ „Ich erreiche den Dealer auch nicht.“ So funktioniert der handliche Small Talk der Mißlichkeiten, der bekümmernswerten Stoffeligkeiten, aber daraus ergibt sich keine theatralische Situation, nur die Flucht ins längst Bekannte, Vertraute, das Gähnend-Langweilige, der Sumpf, in dem alles höflich erstickt, die Milderung möglicher Empfindungen, die Sprachschlieren, Sprachmünzen, mit denen Kontakte geknüpft und aufrecht erhalten werden. Gute Dialoge sind elliptisch, sie bilden keine Alltagsrede ab, sondern reduzieren ihre Elemente, bis sie blank liegen.
Ein wenig Bosheit ist bei der Szene mit im Spiel, ein Überraschungseffekt. Vielleicht trägt die erste Figur ein Ringerhemd und ist bepackt mit gewaltigen Muskelpaketen, während die zweite Figur magenkranke Falten ins Gesicht geschminkt bekommen hat und mit einem Gipsbein auftritt. Auf einen Blick ist die Situation erfaßbar: hier geht es nicht um eine Krankheitsschilderung, sondern auch um den Beweis, was ein solcher einfacher Satz an Situationskomik hergibt. Billy Wilder würde möglicherweise noch empfehlen, die erste Figur durch ein Fenster einsteigen zu lassen. Jemand, der durch eine Tür kommt, tritt einfach auf. Jemand, der durch ein Fenster steigt, schafft eine Situation. Träte die zweite Person mit anderen Worten auf, würde sie zum Beispiel sagen: „Ich bin auch krank.“ –, wir wüßten, das Theater ist kein Siechenheim, gleich wird eine dritte Person auftreten, eine muntere Krankenschwester, ein etwas sadistischer Arzt, der die Schäden schnell zu beheben bereit ist. Wir ahnen, so könnte eine Slapstick-Komödie beginnen. Die theatralische Situation setzt eine dauernde Gegenwart voraus – im Gegensatz zur narrativen. Etwas geschieht jetzt, und was wir sehen, ist immer jetzt, auch wenn der Kranke plötzlich seine Krücken wegwirft, wir sind bei ihm. Seine Krankengeschichte, die wir auf der ersten Seite einer Prosa vermutet und wegen ihrer Umständlichkeit mißtrauisch beäugt haben, interessiert hier nicht, der Autor weiß es, der Schauspieler und wir, die Zuschauer, wissen es, ein nahezu archaisches Bündnis. Auch deshalb gehen wir gerne ins Theater – und nur mit einer gewissen Überwindung zu einem Krankenbesuch, in dem der Satz „Ich bin krank.“ eine Voraussetzung unserer Zuneigung und des Opfers an Zeit ist. Wir gehen ins Krankenhaus und haben aus dem Lehrbuch der guten Laune den Satz: „Du bist krank, naja, das wird schon wieder!“ schon an der Pförtnerloge instinktsicher im Kopf gespeichert, und der arme Kranke sieht uns an, erstaunt ob unseres gnadenlosen, taktlosen, ihn in seiner schmerzlichen Situation überrumpelnden Optimismus, für den wir uns im nachhinein ein wenig schämen. Und seltsam, die Theaterfigur, die auf die Mitteilung „Ich bin krank.“ mit der patzigen Antwort „Ich nicht.“ gekontert hat, ist dieser Beschämung auf glückliche Weise entgangen. Darüber lachen wir als Zuschauer, niemals lachen wir, wenn wir das Krankenhaus als Besucher verlassen; vielleicht sind wir erleichtert.
Eine theatralische Situation entfaltet sich
Treten wir einen weiten Schritt zurück: Molière beginnt seine Prosakomödie „Der eingebildete Kranke“ (1673 uraufgeführt) nicht mit einer Krankheitsbeteuerung. Die erste Szene des ersten Aktes zeigt Argan, den eingebildeten Kranken, Apothekenrechnungen prüfend, in seinem Zimmer. Sein Konsum an Arzneien ist enorm, und sein ganzes Bestreben besteht darin, die Kosten, die der Apotheker ihm in Rechnung stellt, zu drücken. Er ist geizig und raffiniert, ein Selbstdarsteller ohne spezifische körperliche Leiden, doch mit einem Vorstellungsvermögen von möglichen Krankheiten und zukünftigen Todesursachen, mit denen er seine Umgebung tyrannisiert. Er setzt auf die Verfügbarkeit aller zeitgenössischen Hilfsmittel, die der Gesundheitsförderung und der Bannung möglicher Belästigungen dienen. Die Obsessionen Argans beziehen sich vorwiegend auf die Ausscheidungsorgane, und ein wichtiges theatralisches Mittel, um auf sie in aller sinnlichen Präsenz zu verweisen, ist das Klistier.1 Dem Körper wird etwas Unspezifisches eingegeben, damit seine spezifischen Ausscheidungsfunktionen verbessert werden. Dies ist die niedere, derbe Seite der Komik in Molières Erfindung. Argan ist ein Objekt der Belustigung, nicht durch Behauptung der Krankheit, sondern durch die vielfältige Abwehr aller Reaktionen, die den gesunden Familienvater und Ehemann einer jungen Frau ausmachen. Im Selbstgespräch der ersten Szene fährt er den Apotheker an:
Gemach, gemach, Herr Fleurant! Wenn ich bitten darf. Wenn’s Sie weiter so treiben, verleidet es einem ja überhaupt das Kranksein. Geben Sie sich mit vier Franken zufrieden.2
Nach seinem langen Eingangsmonolog tritt die Magd Toinette auf, doch sie ist auch eine Spielerin, eine unter falschen Voraussetzungen agierende Komödienfigur. Sie bewegt sich im als ob, sie „tut, als hätte sie sich den Kopf gestoßen“3. Es folgt in vier Repliken auf Argans Vorhaltungen sechsmal der Schmerzenslaut „Oh“. Die Hauptfrage des Zuschauers ist nicht die der klugen Magd Toinette, die später selbst in einer burlesken Travestie den Arzt mimt und Argan mit drastischen Ankündigungen das Krankseinwollen austreibt. „Aber, Herr Argan, Hand aufs Herz, sind Sie wirklich krank?“4 Eine Antwort auf diese existienzielle Forderung nach Ehrlichkeit, die die Magd, Standesgrenzen sprengend, einklagt, ist nicht zu erwarten. Eher könnte man das Komödienschema erweitern und etwa so aus einigen Szenen destillieren:
Argan: Ich bin krank, so krank.
Toinette: Ich nicht, aber ich habe Schmerzen, und Sie haben keine.
Argan: Unverschämtheit. Rufen Sie meine Tochter, ich will sie mit einem Arzt verheiraten.
Toinette: Das werden Sie nicht.
Argan steht da als einer, der wundersamerweise nach den vielen Tränken und Arzneien, die ihm verabreicht wurden, immer noch nicht das Zeitliche gesegnet hat.5 Und mühsam handelt ihm sein aufgeklärter Bruder Béralde, im Zusammenspiel mit der Magd Toinette, einen vernünftigeren Umgang mit der Medizin ab. Die Einbildung, bestehend aus Sein und Schein in ihrem totalen Widerspruch, entfaltet ihre Komik. Argan erkennt nicht, daß seine zweite Frau heuchlerisch nur auf seinen baldigen Tod wartet, um ihn zu beerben, noch begreift er, daß Hypochondrie und Zweckdenken seine Wahrnehmung vergiften. Nicht Krankheit macht ihn so elend, sondern die Leugnung von Wirklichkeit, sein herrischer und gleichzeitig hilfloser Umgang mit seinem Hausstand.
Ein sonderbarer Instinkt läßt uns im Theater Vergnügen erwarten, ein bißchen jedenfalls. Auch das intellektuelle Vergnügen, an der Entwicklung von Figuren teilzuhaben. Es ließe sich von einer Erwartungshaltung sprechen, die auf Verschiebung, Instabilität angelegt ist, auf die Ersetzung der jetzigen Gegenwart durch eine zukünftige. So beginnt keine Gattungstheorie, doch die Überlegungen zum Beginn des Schreibens beziehen sich auf die Erwartungen vor dem Schreiben, vor dem Mitteilen, vor dem Gelesenwerden. Die Literaturwissenschaft spricht von einem Erwartungshorizont, den ein Bezug auf die Gattung auslöst, verändert, umgestaltet.
„Ich bin krank.“ Diese äußerst schlichte Mitteilung schien auf Anhieb in einer theatralischen Situation reizvoll, einen zukünftigen Konflikt erzeugend, wie immer er ausgehen mag. Wir interessieren uns nicht grundsätzlich für einen Menschen, der diese Aussage macht. Wir interessieren uns für die Situation, in der diese Aussage gemacht werden könnte, wir sehen sie auf Anhieb. (Deutet die Bühne ein Krankenhaus an oder einen Abstellraum oder einen Börsensaal? Was für einen Unterschied macht das für die Aussage? Die eine Situation läßt auf ein realistisches Alltagsdrama schließen, die anderen auf eine Komödie, in der die Unangemessenheit der Zuordnungen und Erwartungen eine Rolle spielt.) Wir müssen die Situation rasch begreifen und uns für die Folgen der Aussage interessieren. Das sind schon ziemlich große Aufgaben, die den ersten Satz fast zu einer theatralischen Nagelprobe machen. Sie ist auf vielfältige Weise lösbar.
Tempus und Distanz
In der Prosa weckt der gleiche Satz „Ich bin krank.“ keine entschiedenen Erwartungen, es fehlt ihm etwas, das man Mehrfachbelichtung des Schreibfilms nennen könnte. Rasch ist unser Interesse, kaum geweckt, schon erlahmt. Wer schreibt, muß es wach halten, über eine lange Lesedauer hinweg. Ein Buch beginnt:
Es war, das zeigte sich dem noch nicht Achtzehnjährigen schon bald nach den von mir mit dem Willen zu Wahrheit und Klarheit zu notierenden Ereignissen und Geschehnissen, nichts als nur folgerichtig, daß ich selbst erkrankte, nachdem mein Großvater plötzlich erkrankt war und in das nur wenige hundert Schritte von uns gelegene Krankenhaus hatte gehen müssen, wie ich mich erinnere und wie ich noch heute genau vor mir sehe, in seinem grauschwarzen Wintermantel, den ihm ein kanadischer Berufsoffizier geschenkt hatte, so unternehmend ausschreitend und seine Körperbewegung mit seinem Stock taktierend, als wollte er einen Spaziergang machen, wie gewohnt, an seinem Fenster vorbei, hinter welchem ich ihn beobachtete, nicht wissend, wohin ihn, den einzigen wirklich geliebten Menschen, dieser Spaziergang führte, ganz sicher in traurig-melancholischer Gefühls- und Geistesverfassung, nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte.6
So beginnt Thomas Bernhards Buch „Der Atem. Eine Entscheidung“. Man könnte diesen Anfang als eine Paraphrase des Satzes „Ich bin krank.“ lesen und müßte sich gleich korrigieren, der Satz dehnt sich in eine höchst komplexe erzählerische Situation, wie ich krank geworden bin, unter welchen Umständen und mit welchen Folgen. Die erste Veränderung betrifft das Tempus: die Krankheit wird in einer deutlich zurückliegenden Vergangenheit situiert und gleichzeitig durch das Präfix er- in einen prozeßhaften Verlauf gebracht. Und sogleich wird der „noch nicht Achtzehnjährige“, dem die Krankheit widerfahren ist, in eine Relation zum erzählenden Ich gesetzt. So erscheinen von Anfang an zwei Erzählinstanzen, das vormalige erleidende Ich und das kommentierende Ich, das Übersicht gewonnen hat und mit der Krankheit zu leben gelernt, ja, das die erste lebensbedrohende Krise überwunden hat. „Es war“, so könnte ein Märchen beginnen, jedenfalls eine rabiat gemütliche Erzählung, wenn an Stelle des erwarteten „einmal“ nicht der radikal in die trockene Berichtsebene führende Einschub käme.
Das Imperfekt schafft im Gegensatz zum Präsens eine Distanz. Auch in der Alltagssprache nehmen wir eine Mitteilung wie „Stell dir vor, ich bin krank gewesen.“ mit weniger Anspannung zur Kenntnis als die im Präsens gemachte Mitteilung. Hier bei Bernhard wird zusätzlich „mit dem Willen zu Wahrheit und Klarheit“ quasi eine Ebene des Zeugnis-Gebens aufgerufen, und die Krankheit erscheint „folgerichtig“. Dieser so nüchterne Ton, der einem Arztbericht angemessen sein könnte, ist jedoch eine erzählerische Volte. Keineswegs muß es dem Leser des ersten Satzes „folgerichtig“ erscheinen, wie behauptet wird, daß auf die Erkrankung des Großvaters die des Enkels erfolgt, und ebenso wenig folgerichtig erscheint die offenkundige Veränderung des Erzählgegenstandes, die Ersetzung des Krankheitsthemas durch das Motiv des Spazierens. Mitten im Satz ist plötzlich unendlich viel Zeit, Zeit, um aus dem Fenster zu schauen, den Platz, den der Großvater dort eingenommen hat, als einen erzählerischen Beobachterposten selbst in Besitz zu nehmen und den gewonnenen Raum zu verteidigen. Und leise deutet diese Position am Fenster des Großvaterzimmers auch schon an: hier wird auf vielfältige Weise ein Platz eingenommen, der bis zu dem Gang ins Krankenhaus vom Großvater ausgefüllt wurde. Alle Sinnlichkeit, alle Beschreibungssorgfalt wird auf den ins Krankenhaus spazierenden Großvater gelenkt, auf die Bewegung und das Verschwinden, weg von der eigenen Befindlichkeit, in aller Differenziertheit des Abschieds. Doch diese Gelassenheit ist schon unterhöhlt durch den Gebrauch des Irrealis „als wollte er“. Nein, ein „Spaziergang“ ist dies sicher nicht, obwohl Thomas Bernhard das unauffällige Kunststück gelingt, dieses Wort zweimal in einem einzigen Satz unterzubringen. Das erzählende gedoppelte Ich läßt die Gestalt des Großvaters nicht los, leiht uns, den Lesern, seine Augen am Fenster. Und gleichzeitig liefert in der Komplexheit des Satzes die Apposition eine Begründung für die innige Anteilnahme des Enkels am Befinden des Großvaters, sie gilt dem „einzigen wirklich geliebten Menschen“, eine Konstellation, die aufhorchen läßt und gleichzeitig einen Mangel verdeckt. Die Apposition erlaubt ein Atemholen in dem langen Satz, der Leser ist schon ziemlich weit vorgedrungen und weiß noch nicht, wie weit er mit seinem eigenen Lese-Atem haushalten muß. Es ist ja dann glücklicherweise nicht mehr weit bis zum Ende, das schlicht ist wie eine Heimholung. In der Ruhe bleibt das Bild stehen (verdoppelt sich im nächsten Satz noch einmal): „nachdem ich ihn verabschiedet hatte.“ Sosehr der Großvater, das geheime Zentrum des jugendlichen Lebens, in diesem ersten Satz Raum und Gestalt gewonnen hat, sosehr die höchst komplexe Satzstruktur sich vom Subjekt des Erzählens wegbewegt hat, am Ende gelingt es, ruhig und sachlich die erzählerische Operation zu Ende zu bringen, es schließt sich der Bogen, „nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte“.
Wie sehr das Bedürfnis nach einem gelungenen Abschied auch ein Erzählbedürfnis ist, wird im Laufe des Buches deutlich, in dem der am Anfang offenbar nur zu einem harmlosen Eingriff ins Krankenhaus gehende Großvater plötzlich stirbt, während der Enkel überlebt, ohne die Chance gehabt zu haben, sich wirklich und angemessen vom Großvater zu verabschieden. Die Familie hält Tod und Begräbnis vor dem bedrohten Jugendlichen geheim. Der noch nicht Achtzehnjährige: eine Figur im Dazwischen, im Raum, den die vergangene Abhängigkeit von der Familie und das zukünftige Erwachsensein zuläßt, eine Figur, die im Nu unser Mitleid erregt, weil der Einbruch der Krankheit einen für sie offenen Entscheidungsraum auf drastische Weise verschließt – und daneben der mit dem „Willen zu Wahrheit und Klarheit“ schreibende erwachsene Autor. Die Krankheit vernichtet den Berufswunsch, Sänger zu werden. Der Atem und die Lebensenergie reichen nicht mehr so weit, werden buchstäblich in dem kranken Organ zusammengepreßt. Nicht nur in der Unterscheidung zwischen Ich-Erzähler und der vom Tode bedrohten Erzählfigur des „noch nicht Achtzehnjährigen“ ist eine zeitliche Dimension sichtbar, auch ein anderer Einschub macht die historische Distanz und Nähe zu dem dramatischen Geschehen deutlich: „wie ich mich erinnere und wie ich noch heute genau vor mir sehe“. Es ist dies eine Bekräftigung, eine rhetorische Geste, erprobt in unzähligen Erzählkonstellationen, mündlichen und schriftlichen. Der Erzähler macht uns nichts vor, bürgt mit seiner Erinnerung, ihrer Aufrichtigkeit, ihrer Autorität, für das innere, unauslöschbare Bild.
Noch ein Signal gibt dem Satz eine Tiefenschärfe: es ist der Hinweis auf den kanadischen Offiziersmantel. Ein Besatzungsoffizier schenkt einem älteren Bürger seinen Mantel. Ist er dazu überhaupt befugt? Macht er eine außergewöhnlich mildtätige oder gar den Großvater vor anderen Bürgern des besetzten Landes auszeichnende Geste? Zumindest wird der Großvater einer Gabe teilhaftig, die rar und kostbar ist. Ob er sie aus Armut oder als ein Zeichen der Würde trägt, die ihn von anderen absetzt, ist ungewiß.
Zwei Jahre bevor Thomas Bernhards Buch „Der Atem“ erschien, schloß in aller Stille ein Schweizer Autor ein Buchprojekt ab, von dem er nicht einmal hoffen konnte, daß er es einmal als ein Buchobjekt in Händen halten dürfte. Das Datum, an dem er seinen Text beendete, ist bekannt, er setzte es als letzte Zeile unter sein Manuskript. Es war der 17. Juli 1976. Das Konvolut gelangte über einen Buchhändler in die Hände von Adolf Muschg, der es mit Schrecken und der gebotenen Faszination las. Er wiederum schickte es dem Verleger Helmut Kindler mit einem starken Appell: „Meine Bitte, deren Dringlichkeit in der Sache liegt: Sie sollten dieses Buch herausbringen und sehr bald; nicht obwohl von diesem Autor nach menschlichem Ermessen kein zweites zu erwarten ist, sondern weil. Wenn Sie ein Vorwort für nötig halten, ich wäre dazu bereit, aus Überzeugung und Betroffenheit.“7 Am Abend des 1. November 1976 erfuhr der junge Autor von seinem Psychotherapeuten, der ihn in der Klinik besuchte, daß der Verlag sein Buch herausbringen will. Danach verwirrten sich seine Gedanken. Der Todkranke, der sich das überdeutliche Pseudonym Fritz Zorn gegeben hatte, starb am nächsten Morgen gegen fünf Uhr früh. Sein Buch beginnt in einer spröden, berichthaften Trockenheit.