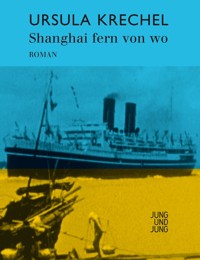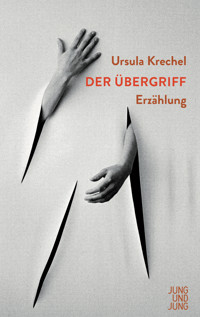Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2012Nach Shanghai fern von wo geht Ursula Krechel noch einmal den Spuren deutscher Geschichte nach. Ihr neuer Roman handelt vom Exil und von den fünfziger Jahren, von einer Rückkehr ohne Ankunft. Was muss einer fürchten, was darf einer hoffen, der 1947 aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrt? Nach ihrem gefeierten, 2008 erschienenen Buch Shanghai fern von wo geht Ursula Krechel mit ihrem neuen großen Roman Landgericht noch einmal auf Spurensuche. Die deutsche Nachkriegszeit, die zwischen Depression und Aufbruch schwankt, ist der Hintergrund der fast parabelhaft tragischen Geschichte von einem, der nicht mehr ankommt. Richard Kornitzer ist Richter von Beruf und ein Charakter von Kohlhaas'schen Dimensionen. Die Nazizeit mit ihren absurden und tödlichen Regeln zieht sich als Riss durch sein Leben. Danach ist nichts mehr wie vorher, die kleine Familie zwischen dem Bodensee, Mainz und England versprengt, und die Heimat beinahe fremder als das in magisches Licht getauchte Exil in Havanna. Ursula Krechels Roman lässt Dokumentarisches und Fiktives ineinander übergehen, beim Finden und Erfinden gewinnt eine Zeit atmosphärische Konturen, in der die Vergangenheit schwer auf den Zukunftshoffnungen lastet. Mit sprachlicher Behutsamkeit und einer insistierenden Zuneigung lässt Landgericht den Figuren späte Gerechtigkeit widerfahren. Landgericht, der Roman mit dem doppeldeutigen Titel, handelt von einer deutschen Familie, und er erzählt zugleich mit großer Wucht von den Gründungsjahren einer Republik.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
URSULA KRECHEL
Landgericht
Roman
© 2012 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenISBN E-Book 978-3-99027-100-1ISBN print: 978-3-99027-024-0
Inhalt
Über dem See
Auf dünnem Eis
Bunker
Mombach
Sehnsucht
Aus dem Inneren
Das Universum
Der Aufprall
Die kubanische Haut
Krater und Schneisen
Die Tat
Rechnungen, Brechungen
Rätsel
Mitten durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, zuckte die innerliche Zufriedenheit empor, seine eigne Brust nunmehr in Ordnung zu sehen.
Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas
Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Joh. 1, 11
Über dem See
Er war angekommen. Angekommen, aber wo. Der Bahnhof war ein Kopfbahnhof, die Perrons unspektakulär, ein Dutzend Gleise, aber dann betrat er die Bahnhofshalle. Es war ein großartiges Artefakt, eine Bahnhofskathedrale, von einem kassettierten Tonnengewölbe überspannt, durch die Fenster flutete ein blaues, fließend helles Licht, ein Licht wie neugeboren nach der langen Reise. Die hohen Wände waren mit dunklem Marmor verkleidet, „reichskanzleidunkel“, so hätte er ironisch vor seiner Emigration diesen Farbton für sich genannt, jetzt fand er ihn nur herrschaftlich und vornehm, ja auch einschüchternd. Aber der Marmor war nicht einfach nur als Verkleidung auf die Wand gebracht worden, sondern ebenfalls abgesetzt, abgetreppt, so daß die Wände rhythmisch gegliedert waren. Der Fußboden blank, hinter den Schaltern ordentlich uniformierte Männer, die durch ein rundes Fensterchen blickten, davor Schlangen von Menschen, die gar nicht so schlecht gekleidet waren. (Wenn er bedachte, es handelte sich um Kriegsverlierer, um Geschlagene, trugen sie den Kopf erstaunlich hoch.) Er sah auch französisches Wachpersonal in den Nischen der Halle, das einen höflichen Blick hatte auf das Bahnhofstreiben. Die Männer trugen olivfarbene Uniformen und Waffen. Wie er mit einem Blick die vornehme Halle erfaßte, konnte er sich keinen Anlaß eines Eingreifens vorstellen, und dabei blieb es auch. Eine stille, mahnende, Gewißheit herbeizwingende Gegenwart.
Er spürte die beruhigende Zivilisiertheit, die Zeitlosigkeit dieser Bahnhofshalle, er sah die hohen Schwingtüren, sicher drei Meter hoch und ganz mit Messingblech verkleidet. Mit feiner Schreibschrift war das Wort „Drücken“ in die Messingoberfläche graviert worden, etwa in Brusthöhe. Kathedralentüren, Türen, die dem Reisenden alle Allüren nahmen, das Bahnhofswesen war wichtig und bedeutend, und der einzelne Reisende würde schon sicher und pünktlich an sein Ziel kommen. Kornitzers Ziel war so lange im Ungefähren geblieben, nicht einmal ein verschwommenes Sehnsuchtsziel dachte er sich aus, so daß er diesen Widerspruch überaus schmerzlich empfand. Seine transitorische Existenz war ihm Gewißheit geworden. Alles war erhaben und auf gediegene Weise erhebend in dieser Halle, er sah sich um, er sah seine Frau, der er seine Ankunftszeit mitgeteilt hatte, nicht. (Oder übersah er sie nach zehn Jahren?) Nein, Claire war nicht da. Zu seiner Überraschung sah er aber zahlreiche Tagestouristen, die mit geschulterten Skiern aus dem nahen Wintersportgebiet kamen, freudig aufgekratzt, mit gebräunten Gesichtern.
Er stieß eine der hohen Türen auf und war geblendet. Hier lag der See, der große blaue Spiegel, nur ein paar Schritte waren es zum Kai, sanftes Wasser schwappte heran, kein Kräuseln der Oberfläche. Natürlich hatte sich seine Ankunft verzögert, um gut zwei Stunden, aber dieses Verzögern kam ihm wie eine Überdehnung vor, die Freude, anzukommen und seine Frau wiederzusehen, war in eine unbestimmte Zeit verwiesen. Hier war der Leuchtturm, der aus dem Wasser aufragte, hier war der bayerische Löwe, der mit gelassener Herrschaftsgeste den Hafen bewachte, und dort waren die Berge, die fernen und gleichzeitig nahen Berge, eine Kulisse aus Weiß und Grau und Alpenrosa, ihr Geschiebe, ihre archaische Kraft, unverrückbar, unerhört schön. Da hörte er seinen Namen rufen.
Das Wiedersehen eines Mannes und einer Frau, die sich so lange nicht gesehen hatten, sich verloren glauben mußten. Das atemlose Erstarren, Sprachlosigkeit, die Augen, die den Blick des anderen suchen, sich festklammern am Blick, Augen, die groß werden, trinken, sich versenken und sich dann abwenden wie erleichtert, ermüdet von der Arbeit des Wiedererkennens, ja, du bist es, du bist es immer noch. Das ganze Gesicht, das sich in den Mantelkragen bohrt, sich dann aber wieder rasch hochreckt, die zitternde Erregung, die den anderen Augen, den zehn Jahre vermißten Augen, nicht standhält. Die hellen, wäßrigen Augen des Mannes hinter der Nickelbrille und die grünen Augen der Frau, die Pupillen haben einen dunklen Ring. Es sind die Augen, die das Wiedersehen inszenieren, aber die, die es aushalten müssen, die ihm standhalten müssen, sind veränderte, in die Jahre gekommene Menschen, etwa gleich groß, auf gleicher Augenhöhe. Sie lächeln, sie lächeln sich an, die Haut um die Augen faltet sich, kein Wimpernzucken, nichts, nichts, nur der Blick, der lang ausgehaltene Blick, die Pupillen sind starr. Dann löst sich eine Hand, ist es die Hand des Mannes oder die der Frau?, in jedem Fall ist es eine mutige Hand oder eher nur die Kuppe des rechten Mittelfingers, die Mut beweist und auch Instinkt und über den hohen Backenknochen des verloren geglaubten Ehepartners fährt. Ein vertrauter Finger, eine Nervenerregung, die von einer Gefühlsregung noch sorgsam geschieden ist. Es ist eher die empfindlich gespannte Haut über dem Backenknochen, die reagiert, die dem ganzen Körper „Alarm“ meldet. Eine Vereinigung der Nervenzellen, nicht des Ehepaares, diese dauert sehr, sehr viel länger, es ist eine Empfindung, die das ganze Nervengeflecht durchrüttelt, ein „du bist’s, ja, wirklich, du bist’s“. Das instinktive Wiederfinden der geliebten, der vertrauten Haut war ein Wunder, über das die Kornitzers später noch oft sprachen, später, später, miteinander, ihren Kindern konnten sie es nicht mitteilen. Nicht der „berührte“ Körperteil (Mann oder Frau) sendete den Alarm in den ganzen Körper, es war der aktive „berührende“, und nach einer halben Sekunde war nicht mehr festzustellen, wer berührt hatte und wer berührt worden war. Die noch einsame, knapp zehn Jahre lang den Ehepartner entbehrende Hand bewegte sich, zuckte, streichelte, ja umschlang und wollte nicht mehr loslassen.
Das war das Ankommen. Dieses Signal der Nervenzellen bereitete dem ganzen Menschen einen Weg. Einen Weg vom Bahnhof in der Bodensee-Stadt zum Gasthaus am Hafen, das Kornitzer kaum sah, in dem er seiner Frau gegenübersaß und eine Suppe löffelte, das Gepäck rund um ihn verstreut, gestapelt. Er sah seine Frau jetzt eher wie einen Umriß, sie war knochig geworden, die Schultern vom Frieren hochgereckt, er sah ihren großen Mund, den sie nun öffnete, um den einen oder anderen Löffel Suppe hineinzuschieben, er sah ihre Zähne, das goldene Tüpfelchen, das einen ihrer Eckzähne, auf den sie einmal gefallen war, ausflickte, er sah ihre Hände, die rauher und gröber geworden waren seit dem Abschied in Berlin. Seine eigenen Hände versteckte er im Schoß. Die Suppe hatte er rasch und sachlich hinuntergelöffelt. Er sah seine Frau an, Schicht für Schicht versuchte er das jetzige Bild, das Bild der Frau, die ihm gegenübersaß, mit dem Bild, das er sich gemacht hatte alle Jahre zwischendurch, in Übereinstimmung zu bringen. Es gelang nicht. Auch das Photo in seiner Brieftasche, das er so häufig angestarrt hatte, bis er glaubte, es auswendig zu können – wenn dies bei einem Bild überhaupt möglich war –, half ihm nicht. Claire war jetzt jemand, der Suppe löffelte und sich offenkundig nicht fürchtete, einem nahezu Fremden gegenüberzusitzen. Einen Augenblick dachte er: Was hat sie zu fürchten gelernt, daß sie sich jetzt nicht fürchtet? Er unterließ es zu fragen: Claire, wie ist es dir ergangen? Die Frage setzte eine größere Vertrautheit voraus, eine Frage, die Zeit zu einer langen, romanhaften Antwort brauchte, und vor allen Dingen Zuhörzeit, ein ruhiges, entspanntes: Erzähl doch mal. Und auch sie fragte nicht: Richard, wie ist es dir ergangen? Er hätte mit den Schultern zucken müssen, ein Rafftempo, ein schneller Vorlauf und ein langsamer Rücklauf und wo anfangen?, dann hatte seine Frau endlich ihren Suppenteller ausgekratzt und den Löffel klirrend (vielleicht zitterte sie?) auf das Porzellan gelegt und fragte: Wie viele Tage bist du gereist? Darauf war eine knappe Antwort möglich: Vierzehn auf dem Schiff und drei Tage von Hamburg an den Bodensee. Das schien ihr nicht übermäßig lang, sie machte nicht den Eindruck, als wolle sie ihn deshalb bedauern. Sie nahm ihn mit in ihr Dorf, das war eigentlich nicht vorgesehen. Die Hilfsorganisation, die ihm seine Reise bezahlt hatte, die ihn an den Bodensee transportiert hatte, hatte ihm ein Merkblatt mitgegeben, in dem es hieß, daß er sich sofort nach seiner Ankunft bei der entsprechenden Stelle an dem zukünftigen Wohnort zu melden hätte. Kornitzer sagte es Claire, aber davon wollte sie nichts wissen. Die Hilfsorganisation läuft nicht weg, da kannst du auch noch morgen hin. Kornitzers Gepäck sollte nachgeschickt werden mit einem Fuhrwerk, Claire hatte mit einem bäuerlich wirkenden Mann am Bahnhof verhandelt, in einer Stunde vielleicht solle er sie abholen, und so kam der Mann ins Gasthaus. Kornitzer und seine Frau halfen ihm, die Gepäckstücke aufzuladen. Sich gemeinsam zu bücken und zu recken, zu heben und zu schieben, das war die erste gemeinsame Handlung, die den Grund hatte, eine Privatheit herzustellen. Einen Vorhang, der sich vor das Paar schob, als es sich in Claires geblümtem Zimmerchen im Haus 6 eines Weilers mit dem Namen Bettnang zurückzog, in dem ihre einzigen geretteten Kostbarkeiten ein Plattenspieler und eine Schreibmaschine waren. Die Schreibmaschine glaubte er noch aus Berlin zu kennen, sie hieß „Erika“, und ihre Hebelmechanik hatte unverdrossen den ganzen Krieg und die Evakuierung überstanden. Hut ab vor „Erika“, und eine der ersten triumphierenden Bemerkungen, die Claire ihrem zurückgekehrten Mann gegenüber machte, war: Ich habe eine ganze Menge Farbbänder gehortet, Farbbänder waren angeblich nicht kriegswichtig, oder man hatte vergessen, sie als kriegswichtig zu erklären. Und sie nehmen sehr wenig Platz in einem Fluchtgepäck ein. Wir können also Anträge und Briefe schreiben, die eine gute Form haben. Darauf wußte er nichts zu sagen, er nickte nur, er sah, wie vorausschauend sie gehandelt hatte. Er hatte auch überlegt, was er mitbringen sollte von der langen Reise. Kaffee? Tabak? Süßigkeiten? Südfrüchte? Dokumente seiner Tätigkeit? Aber die Bestimmungen änderten sich fast jeden Tag, was heute erlaubt war, war aus politischen oder hygienischen Gründen (oder aus praktischen Gründen, die sich hinter ideologischen oder ganz unerfindlichen Gründen verbargen, aus Gründen der Zoll-Erfassung vielleicht) plötzlich verboten. Niemand wußte es. Was sprach gegen ein Säckchen Zucker? Was sprach gegen die noch vor einem Monat erlaubte Menge von Parfum und Tabak? Man stand wie ein Idiot da, und vielleicht war genau das der Sinn der sich dauernd widersprechenden Maßnahmen.
Hier ist der Waschtisch, sagte Claire, ich habe kein fließendes Wasser. Den Schrank sah er selbst, auch das Bett, schmal, fast jungfräulich sah es aus, die wackligen Stühle. Er sah in Claires Gesicht eine Scham, eine Kränkung. Und er sah auch ihre Handbewegung, die ein bißchen nonchalant war, daran erkannte er ihr früheres Selbstbewußtsein: Bitte, so ist es nun mal, so ist es gekommen, er sah das Licht der kleinen Nachttischlampe und das lächerlich dünne Bändelchen, mit der man sie an- und ausknipsen konnte. Und das Paar, das erst wieder lernen mußte, ein Paar zu sein, knipste sie aus. Dann war es dunkel, und die Dunkelheit war ein Tasten, eine Blindenschule des Empfindens, eine Klippschule, ja wirklich nur ein Tasten und Atmen. So waren sie an diesem ersten Tag nicht weiter gekommen als bis zur ersten Empfindung „Bist du’s, bist du’s wirklich?“ und zur Bestätigung: „Ja, du bist’s.“ Vielleicht war darin schon eine leise Überforderung. Es war nicht abzusehen, wie und wann die Familie je wieder zusammenkommen könnte. Noch handelte es sich um zwei versprengte Menschen, die von ihren Menschenkindern kaum etwas wußten.
Am nächsten Tag machte er sich auf den Weg in die Stadt, die gewundene Straße entlang, vorbei an Wiesen und allein gelegenen Höfen, immer die Bergketten im Blick, die Fältelungen der Gebirgsmassen, Wolkenbänder, die darüber festgezurrt waren. Als er gut eine halbe Stunde gegangen war, kam Quellbewölkung auf, schneeweiße Wolkenhalden schoben sich ineinander, ein plastisches, haptisches Wolkengerangel mit ganz ungewissem Ausgang. Fuhrwerke überholten ihn und der Postbus, er wollte aber gehen, wollte so lange gehen, bis vor ihm an einer Straßenbiegung der See auftauchte. Das Grau der Luft, das sich wie ein zarter Schleier über die Wasserfläche breitete. Er ging sechs Kilometer immer bergab, es war ein Sacken in den Kniekehlen, etwas gänzlich ungewohnt Körperliches, das ihm gefiel, etwas Wanderburschenartiges. Und er war doch ein Mann Mitte vierzig, der schon sehr viel, zu viel erlebt hatte.
Die innere Stadt, das hatte er bei seiner Ankunft gar nicht recht beachtet, war eine Insel, die durch die lange Brücke mit dem festen Land, dem Bauernland, verbunden war. Am Ufer Villen, Gartenanlagen, eine feine Gegend. Er sah auch gleich, daß viele der Villen von französischen Offizieren und ihren Dienststellen requiriert worden waren, Wachposten standen davor. Dann jenseits der Brücke die Holzschindelhäuser, die überkragenden oberen Geschosse, überkragende Dächer mit Schwalbenschwanzgauben. Die Stadt Lindau tat so, als wäre sie ein Ding außerhalb von Raum und Zeit. Dieser Gedanke gefiel ihm, aber er konnte ihn nicht weiterdenken und keine Schlüsse daraus ziehen. Etwas lullte ihn ein, und es (ja, was war es?) regte ihn gleichzeitig auf. Er betrachtete Erker, die steinernen Laubengänge, die geruhsame Giebeligkeit und die steilen Treppen, die zu Weinstuben führten, in denen vermutlich sechzig Jahre nichts verändert worden war, altdeutsche behäbige Gemütlichkeit, nur die Kellnerinnen, die vor den Weinstuben auf der Straße mit verschränkten Armen schwatzten, waren jünger geworden, und Kornitzer sah sie mit Wohlgefallen an. Und noch etwas sah er und konnte sich keinen Reim darauf machen. Er hatte von den Zerstörungen der Städte in Deutschland gelesen, von Trümmerwüsten, von Feuerstürmen. In dieser Stadt sah er kein einziges zerstörtes Haus, nicht einmal ein Dachziegel schien von einem Dach gefallen zu sein. Er mußte Claire danach fragen, wenn er wieder in Bettnang war.
Er fand den Weg zur UNRRA, der Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, die für ihn zuständig war, leicht. Das Büro war im ersten Stock eines breit gelagerten Hauses mit einem Erker an der Seite der Insel, die dem festen Land zugewandt war, in der Zwanzigerstraße. Auf Stühlen in einem Korridor saßen einige junge Männer, lümmelten sich eher, dachte Kornitzer, sie sprachen untereinander eine weiche melodische Sprache, sahen kurz auf, als er sich zu ihnen setzte, als wollten sie sagen: Was will der denn hier? Es schienen Polen zu sein oder Ukrainer, Zwangsarbeiter oder aus den Konzentrations- und Arbeitslagern Befreite, die hier in der schönen Stadt gestrandet waren und irgendwohin gebracht werden mußten oder wollten, zu übriggebliebenen Menschen, die sie erwarteten, wie Claire ihn erwartet hatte, oder zu einem ganz unwägbar neuen Leben, für das sie votiert hatten in Ermangelung eines anderen, das vernichtet worden war, wie er hierher gebracht werden wollte, in Ermangelung des früheren Berliner Lebens, von dem nur Trümmer übriggeblieben waren. (So hatte Claire es ihm angedeutet.) Die Tür öffnete sich, und eine junge Frau mit einem starken Akzent, den er nicht orten konnte, flüsterte, eher defensiv: Der Nächste bitte. Zwei der Männer erhoben sich. Nur einer, sagte die Frau und reckte zum besseren Verständnis den rechten Daumen in die Höhe. Freund kann Deutsch schlecht, erklärte einer der Versprengten und schob sich mit in das Zimmer. Die Frau ließ die Tür offen, es sah so aus, als wolle sie nicht mit zwei fremden Hilfsbedürftigen in einem geschlossenen Raum sein. Es dauerte eine ganze Weile, bis die beiden das Zimmer mit einem Formular verließen, auch bei den nächsten Bittstellern blieb die Tür offen. Dann gab es eine lange Pause, in der die Tür für eine ganze Weile geschlossen blieb. Zuletzt saß Kornitzer mit einem jungen Mann zusammen, dem ein oberer Schneidezahn fehlte und der eine flinke, nervöse Zunge in die Lücke bohrte. Er sagte – zischelte eher durch die Zahnlücke –, er sei einfach weg-, von den Eltern weggeholt worden, sein Dorf sei umstellt worden, die Kirchenbesucher seien festgenommen worden, alles, was jung war, er machte eine heftige Handbewegung über die Schulter hinweg, es war eine verächtliche Handbewegung, alles weg nach Deutschland. Das sei ganz schwer gewesen für die Eltern. Ohne Sohn, ohne Hilfe auf dem Hof. Und dann versank er in ein finsteres Schweigen, in das Kornitzer nicht durch eine unangemessene Frage eindringen wollte.
Als Kornitzer dann endlich an der Reihe war, schloß die Frau die Tür hinter ihm, es war wie ein Vertrauensbeweis. Kornitzer sagte, was er sagen mußte, eine Litanei, begleitet vom Rascheln der mitgebrachten Dokumente, er berichtete, daß er gestern als Displaced Person hier angekommen sei, daß er Hilfe erwarte bei seiner Rückkehr. Seine Befürchtung, sie mache ihm Vorwürfe, daß er nicht unverzüglich die Hilfsstelle aufgesucht habe, erwies sich als unbegründet. Er hatte auch die Befürchtung gehabt, er würde als Displaced Person gleich in eine Massenunterkunft eingewiesen. Die Wiederaufnahme durch eine „arische“ Ehefrau war in den Formularen nicht vorgesehen. Vermutlich war der Fall äußerst selten. Die Frau füllte ein Formular aus, das drei Durchschläge hatte, schickte ihn in ein Nachbarzimmer, wo er gegen Vorlage eines der Durchschläge Lebensmittelkarten bekam. Es wurde ihm aufgetragen, die restlichen Blätter wieder in das erste Büro zu bringen, im Flur Platz zu nehmen und das Abschlußgespräch abzuwarten. So saß er wieder im Flur, diesmal mit zwei jungen Frauen, die fast noch Mädchen waren und ihm auf seltsam komische Art zuzwinkerten, als wäre ihre einzige mögliche Kontaktaufnahme ein unschuldiges oder vermeintlich unschuldiges, in Wirklichkeit durchtriebenes Augenspiel. Es war ein Augenzwinkern wie ein Entblößen, und er mußte den Blick senken, was die jungen Frauen zu kränken schien. Zurück im ersten Zimmer, wollte die Angestellte der UNRAA ihn höflich und gleichzeitig zeitsparend verabschieden, aber er blieb angewurzelt dastehen. Ich bin Jurist, ich bin Richter, ich möchte in meinem Beruf so bald wie möglich arbeiten. Sie sind DP, sagte die Frau, Sie haben die deutsche Staatsbürgerschaft verloren. Ich bin für Sie als DP verantwortlich, aber nicht für Sie als Arbeitssuchenden. Gehen Sie zum Landratsamt, dem ist ein Arbeitsamt angeschlossen. Dort sitzt ein sehr guter Mann. Den hat man 33 entlassen und 45 wieder eingestellt, als sei nichts gewesen. An den wenden Sie sich. Glaser werden gesucht, Maurer und Hilfskräfte in der Landwirtschaft, von Richtern weiß ich nichts. Und dann verabschiedete sie ihn mit einem kurzen, freundlich gemeinten, aber doch geschäftigen Kopfnicken.
Dieses Ergebnis wollte Kornitzer doch zuerst mit seiner Frau besprechen, wie er früher vieles mit ihr besprochen hatte, Geschäftsergebnisse, Zukunftspläne, Phantasien, die gar nicht so fern vom Weg lagen. Also machte er sich nach Bettnang auf den Weg, die gewundene Straße hinauf, der Rückweg dauerte länger als der Hinweg, ja, die Straße war sehr steil, eine Welt aus Schneewehen und eben erblühenden Apfelbäumen dehnte sich zwischen dem Seeufer und dem steil aufsteigenden Allgäu-Hang, alles verlangsamte und verkühlte sich. Und im Aufstieg sah er immer wieder zurück, zum See, zu den hohen Bergen, zu der begnadeten Landschaft der Gipfel und zu den Rüschen von Schnee im Straßengraben. Die Zeit war jetzt eine Erfahrungszeit. Das Gehen pufferte seine Erfahrung als Antragsteller und trennte sie von seiner Erfahrung als verunsicherter Ehemann, und die Zeit, die er in Claires Zimmer auf ihre Rückkehr aus der Molkerei, in der sie Arbeit gefunden hatte, wartete, war eine zeitlose Zeit. Dann kam Claire mit dem Postbus, sie hatte gerötete Backen, aber sie war auch ermüdet nach einem Arbeitstag im Sekretariat, einer Arbeit, die sie kaum kannte, denn sie hatte in Berlin (damals, bevor sie sich trennen mußten) natürlich eine eigene Sekretärin. Und was er ihr mitzuteilen hatte über seine erste Begegnung mit der Hilfsorganisation auf deutschem Boden, war rasch erzählt, schmolz wie Schnee in der Frühjahrssonne. Ruh dich aus nach der langen Reise, sagte Claire, geh erst in ein paar Tagen zum Arbeitsamt.
Vieles war abgeschnitten, abgefallen, aber glücklicherweise nicht seine Wahrnehmungsfähigkeit, nicht seine Fähigkeit, Freude zu empfinden, eine übergroße Freude. Und daß er sie empfand, ja, daß auch sein zaghaftes Ankommen eine Freude war, verdankte er einzig und allein seiner Frau. Er zögerte, nach zehn Jahren der Entfernung sie noch „seine Frau“ zu nennen. Aber sie hatte ihn überwältigt mit ihrer Sicherheit: sie wollte ihn wiederhaben als „ihren Mann“, das hatte sie amtlich niedergelegt, und so hatte er es gelesen. Und um ihn wiederzuhaben, dazu hatte sie die vernünftigsten Schritte unternommen.
Er sah aus dem Fenster, sah den Zwiebelkirchturm, dahinter ging eine mächtige Sonne unter, eine pralle Frucht, Südfrucht, die Berge glühten, und etwas glühte in ihm. Ja, hier zu sein, bei Claire zu sein, war gut. Er glühte, es befeuerte ihn, eine Arbeit zu finden, für die er geschaffen war. Eine Tätigkeit, die ihn ausfüllte und ernährte und Claire und die Kinder dazu. Der Weiler Bettnang mit seinen sechs, sieben Höfen hatte kein Gasthaus, die Bewohner saßen abends auf der Bank vor dem Haus, manchmal kam ein Nachbar dazu. Sie tranken Most und sahen in die blaue Luft, die für Kornitzer eine fremde blaue Luft war. Da wollte sich Kornitzer doch nicht dazusetzen. Der Weiler hatte eine Zwergschule, einen Schuhmacher, eine Sennerei und einen kleinen Laden („Geschäftle“, sagten die Leute), in dem die nötigsten Alltagsdinge zu kaufen waren, Zwieback für alle Fälle, Sauerkraut im Faß, Streichhölzer und Gummibänder und Näh- und Sicherheitsnadeln und Zwirn. Die meisten Lebensmittel, Milchprodukte und Obst, kamen von den Höfen und aus den Gärten, im Laden war für sie kein Bedarf.
Kornitzer schlüpfte gern in die kleine Kirche, goldgefaßte Altäre links und rechts und eine wie ein Schwalbennest hoch an die Wand geklebte Kanzel. Die goldenen Heiligen auf beiden Seiten des Hauptaltars träumerisch unter ihren Bischofsmützen, am rechten Seitenaltar ein Sebastian, dem die Pfeile regelmäßig wie ein Muster in seinem schön geschnitzten und bemalten Fleisch steckten und der mild und süßlich auf die Beter herablächelte. Alles war auf eine behagliche Weise gelungen, erprobt seit Jahrhunderten und nie aufgegeben. Selbstsicherheit einer bäuerlichen Kultur, die keine Fragen stellt und nicht in Frage gestellt werden will. Claire nahm die knappen Kirchenbesuche ihres Mannes eher ironisch auf, sie war Protestantin durch und durch, das Ausufernde, in Gold Getauchte, die Stuckgirlanden waren ihr fremd, die verzückten Heiligengesichter stießen sie ab. Aber wenn Kornitzer so für eine kurze Rast in dem Kirchlein bei den goldgefaßten Heiligen saß, hätte es ihm auch oder vielleicht besser bei Katholiken gefallen. (Claire besuchte die protestantische Stadtkirche ab und zu und machte nicht viel Aufhebens davon.)
Die kleine Dorfkirche mit ihrem Bedeutungshof beherrschte den Weiler, von der Stufe zur Kirchentür aus hatte man den schönsten Blick. Ein Kranz von Grabstätten scharte sich um die Kirche, lehnte sich an die Friedhofsmauer. Die Grabsteine blickten mit großen, dem Tod entgegengesetzten Augen in die Gebirgslandschaft, wärmten den Rücken an der Kirchhofsmauer für eine Generation oder länger, bis die nächsten Toten Platz brauchten. Kornitzer sah die unerhört weiten Fältelungen der Berge, das Eisige, das Kalte, Granitene, es wunderte ihn nicht, daß frühere Reisende die Alpen für feindlich, ja für häßlich gehalten hatten und den Vorhang der Kutsche zuzogen, wenn die Gebirgsmassen ins Blickfeld kamen. Und dann spazierten die Augen ins Dorf zurück. Die Kirche, der Friedhof, das Pfarrhaus mit den verblichenen roten Fensterläden, das Feuerhaus und eine Handvoll Höfe, breit hingelagert, vorne die Scheunen, dahinter im rechten Winkel angebaut die Kuhställe. Manchmal reichte der Platz zur Straße hin noch für einen Blumenzwickel. Zwischen den Schenkeln von Wohnhaus und Stall thronte der warme Misthaufen. Er war ein Zentrum des Hofes, die Hühner kratzten darauf herum, pickten nach Würmern und Maden, verdrehten rechthaberisch die Hälse, und der Hahn bewachte sie. Kornitzer war nie längere Zeit auf dem Land gewesen, vielleicht bei Wanderungen oder Durchquerungen einer Landschaft zu einem bestimmten Ziel. Bettnang mit seiner betörend schönen Lage über dem See beeindruckte ihn, der Schuster klopfte auf dem Eisen herum, die Kühe muhten, die Hühner gackerten, zweimal am Tag kam der Postbus, und sonst war es so ruhig, daß er seine eigene Unruhe zum erstem Mal, seit er am Bodensee war, schmerzhaft spürte.
Claire bedeutete ihm, daß das Dorf jetzt leer sei und in sich selbst ruhe. Um die gleiche Zeit, als sie ins Dorf gekommen war, also im Januar 1944, seien im Klassenverband Schulkinder aus dem Ruhrgebiet gekommen. In einer panischen Aufregung sei das Dorf vor der Masse der Unterzubringenden erstarrt. Und der Lehrer, ein Hemd im Winde, ein Mann an der Pensionsgrenze, habe die Kinder, die in Listen gesammelt und numeriert worden waren und ihre Nummer auf einem Schild um den Hals trugen, vom Bahnhof auf die Höhe des Dorfes gebracht. Ob auch die Stadt am See so viele Kinder aufnehmen mußte, wußte Claire nicht, eher nicht, eher gehörten die Kinder in die Dörfer, keiner kannte das Schicksal der Städte, so war die Meinung, und sie war ja nicht falsch gewesen. An der Postbushaltestelle habe der Lehrer die Kinder aus dem Ruhrgebiet aufgestellt, aus welcher Stadt sie kamen, hatte sie vergessen, eins neben dem anderen in Reih und Glied, Kinder mit Rucksäcken und Köfferchen und aufgeregten Gesichtern. Die Bäuerinnen seien aus den Häusern gekommen und hätten sich für ein, zwei Kinder entschieden. Ihre Bäuerin, Frau Pfempfle, habe Mädchen aufgenommen, neben ihren großen Jungen wollte sie Mädchen auf dem Hof haben, kleine städtische Mädchen, die die Kühe anstaunten wie Wundertiere und die warme Milch gleich im Stall tranken und sich danach schüttelten. Der Hof habe auch einen polnischen Knecht gehabt, sagte sie. Also einen Zwangsarbeiter, fiel er ihr ins Wort und dachte an den jungen Mann mit dem fehlenden Schneidezahn, den er im Büro getroffen hatte. Claire ignorierte seinen Einwand: Kein Mensch habe Zwangsarbeiter gesagt, die Bauernhöfe hätten ohne Knechte gar nicht existieren können. Ihr Knecht habe mit der Familie an einem Tisch gegessen, bis der Ortsbauernführer zur Kontrolle kam und die Bäuerin anwies, so ginge das aber nicht. Der Pole müsse im Stall essen. Am nächsten Tag habe die Bäuerin ihm wieder seinen Platz am Tisch angewiesen. Dann, nach Kriegsende, seien auch Franzosen im Dorf gewesen, sicher fünfzig Mann, eine Einquartierung, die die Häuser voll wie Hutschachteln erscheinen ließen. Claire erzählte gerne, und er hörte ihr gerne zu. So war es auch früher gewesen. Und dann stellte er doch die Frage, die ihn, seit er allein in die Stadt gewandert war, umtrieb: Warum war die Stadt nicht zerstört? Die Stadt sei mit stiller Hilfe der Schweizer Diplomatie zur Internationalen Rotkreuz-Stadt erklärt worden, sagte Claire. Deshalb seien auch keine Brücken gesprengt worden. Am 22. April 1945 sei die Stadt Lindau in Alarmbereitschaft versetzt worden. Von Tag zu Tag waren mehr Flüchtlinge in die Stadt gekommen. Die wenigen Züge, die noch fuhren, seien überfüllt gewesen. Im alten Rathaus habe sich ein SS-Stab eingenistet, das schien ein sicherer Ort zu sein, und in die Kreisleitung der NSDAP sei ein Militärstab eingezogen. Gerüchte schwirrten durch die Stadt, die sich grundsätzlich widersprachen. Aber Claire Kornitzer erinnerte sich auch genau an den 30. April 1945. Es war ein heller, leuchtender Frühlingstag, der Tag, an dem sich Hitler tötete. Morgens um 8 Uhr wurde Feindalarm in der Stadt gegeben. Es wurde erzählt, daß der Besitzer eines Gasthauses mit dem Namen „Idyll“ den einrückenden Franzosen entgegengefahren sei und den Offizier des ersten Panzers um Schutz für seine Heimatstadt gebeten habe. Es hieß auch, er habe die Führung des Panzers und zweier Wagen motorisierter Truppen, die von Wasserburg kamen, übernommen. Kurz nach 9 Uhr rollte dann der erste französische Panzer über die Seebrücke. Auf dem Turm der katholischen Kirche wehte eine weiße Fahne. Das Kampftruppenkommando und die Polizei wurden von den Franzosen rasch entwaffnet. Dann seien immer mehr Truppen, die vor einem Tag noch feindliche Truppen genannt worden wären, in die Stadt geflutet, während die Panzer in Aeschach verblieben oder in Richtung Bregenz davonfuhren. Überall seien die Menschen zusammengeströmt, niemand habe gewußt, wie es nun weitergehe. Und es gab auch nicht so viel Vertrauen zwischen den Gaffenden auf der Brücke, daß es sich lohnte, ernsthaft darüber zu streiten. Man mußte sehen und abwarten, wie es weiterging.
Rasch wurden die Übergabebedingungen bekanntgegeben: Ausgehverbot von abends 20 Uhr bis morgens um 6.30 Uhr. Ein Lautsprecherwagen fuhr durch die Stadt und die umliegenden Dörfer und befahl die Ablieferung aller Waffen, der Munition, Sendegeräte, Ferngläser. Die wenigen in der Stadt verbliebenen Militärs hatten sich als Gefangene zu melden. Ohne den geringsten Zwischenfall sei die Stadt dann besetzt worden. Auf den Giebelwiesen, auf dem Bahndamm und an anderen Plätzen im Stadtgebiet hätten die Franzosen Geschütze aufgestellt, die auch bald feuerten. In Bregenz hätten sich SS-Truppen zurückgezogen und Widerstand geleistet. Am darauffolgenden Tag wurde dann Bregenz beschossen, es gab einen Höllenlärm, wie man ihn in der Nachbarstadt nicht kannte. Der Boden bebte, der Himmel war rauchgeschwärzt, eine amboßförmige Wolke bildete sich, die Stadt brannte an vielen Stellen. Es war die endgültige Niederlage der Tatsachen. Mehr war dazu nicht zu sagen, mehr wollte man sich in der Stadt und auf den Hügeln dahinter nicht vorstellen. Viele Menschen seien auf der Seebrücke gestanden und hätten schweigend das Schauspiel der brennenden Nachbarstadt angesehen – mit einem Grauen und der geheimen Befriedigung, daß es das eigene Dach, die Giebel, die Fensterscheiben nicht getroffen hatte und nicht den eigenen Kopf, der sich nicht genug verwundern konnte. Drei Stunden griffen alliierte Fliegerverbände an, während die Geschosse der schweren Artillerie ununterbrochen hinüberflogen. Am Dienstag, den 1. Mai war dann Bregenz gefallen, der große Strom der Kampftruppen zog weiter, die Versorgung mit Elektrizität setzte aus, es gab auch keine Zeitung mehr. Eine gespenstische Ruhe herrschte, strahlendes Frühlingslicht darüber gespannt. Gott schlief, Gott ruhte aus, nachdem er so viel Chaos zugelassen hatte. Das Chaos, dabei runzelte Claire die Stirn, sei doch eher eine Angelegenheit des Beginnens, vor der Erschaffung der Welt gewesen, und nun war seit Beginn der Menschheitsgeschichte an eine Art von Ordnung, von Systematik, nicht mehr zu denken. Gerade sie, eine geborene Berlinerin, eine Preußin, eine Protestantin, verlange nach einer nüchternen Ordnung, und sie zu entbehren, sei eine besondere Strafe gewesen, die sie glaube, nicht verdient zu haben. Kornitzer mußte lächeln bei diesem leisen Ausbruch seiner Frau. Ungefähr 150 Nationalsozialisten seien verhaftet worden, fuhr sie fort, auch die Ortsgruppenleiter von drei Städten. Der NSDAP-Kreisleiter hatte es vorgezogen, mit einigen Mitgliedern seines Stabes die Stadt zu verlassen. Er sei aber einige Tage später von einem Polen erschossen wurden, so habe man es berichtet, so erzählte es Claire ihrem Mann.
Der Gastwirt der „Idylle“, der sich damit groß getan hatte, daß er die Franzosen empfangen hatte, wurde später der Lüge bezichtigt und verließ die Stadt. An seinen Namen erinnerte sich Claire Kornitzer nicht mehr, und das machte auch nichts. Nun hieß es: Er war dem ersten französischen Panzer begegnet, und der Offizier hatte ihn gebeten, ihm den Weg in die Stadt zu zeigen, nichts anderes. Und die Aufdeckung seiner beschämend unspektakulären Heldentat war so ernüchternd, daß man den Mann gründlich vergessen hätte, wäre er nicht noch im Amtsblatt des Kreises erwähnt worden. Aber Claire hatte diese Ausgabe des Kreisblattes weggeworfen, andere behielt sie, sie wußte selbst nicht, warum. Schwamm über den Mann, Schwamm über die „Idylle“, sie wußte nicht, ob das Gasthaus mit dem falsch klingenden Namen noch existierte. Und es interessierte sie auch nicht, ja, nicht im geringsten, sagte sie ihrem Mann, der eine geduldige Aufmerksamkeit für alles Heimatkundliche entwickelte.
Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiter, klingelte es abends beim Einschlafen in seinem Kopf. Ich habe meine Frau zur Anerkennung des Begriffs Zwangsarbeiter gezwungen, wo sie von dem polnischen Knecht, wie vermutlich alle Deutschen, sprechen wollte. Aber er, Kornitzer, war auch deutsch! Er war ausgebürgert worden, also mußte er sich schlaftrunken mit sich selbst auf einen so banalen Begriff wie „alle Deutschen im Lande“ beschränken. Oder sollte er sich dazu versteigen, in seinem Kopf von „allen Deutschen, die vom herrschenden Nationalsozialismus infiziert waren“, zu denken? Das schlösse auch seine Frau ein, die er ausnehmen wollte, die er ausnehmen mußte. Die Frage irritierte ihn, er sah sich als Bezwinger mit guten Gründen, aber das machte nicht froh, so nahm er schlaftrunken den Arm seiner Frau, der ihm am nächsten lag und knetete ihn, obwohl er ihn eigentlich nur streicheln wollte, aber die innere Anspannung, Claire Unrecht getan zu haben, ließ ihn wohl kräftiger zupacken, und Claire stieß einen Laut aus, den sie im Wachzustand wohl nicht über die Lippen gebracht hätte, einen tiefen, schnaubenden Seufzer wie ein Pferd, und dann merkte er auch an dem Arm, den er weiter in seiner Hand behielt: Claire schlief schon längst. Und Kornitzer, noch lange schlaflos, sagte sich: Ich habe an ihr unlauter gehandelt. Das klang gut, auch befreiend, aber es war wiederum kein juristischer Begriff. Er dachte noch ein bißchen nach, ob er einen solchen, der wirklich paßte, nachschieben könnte, es war wie eine innere Verfassungsbeschwerde gegen sich selbst. Er fand keinen passenden Begriff, nun ja: „Nötigung zur Verständigung“ wäre noch am passendsten gewesen. Aber die Nötigung konnte auch billigend als eine Einladung zu einer Rechtsgemeinschaft aufgefaßt werden, die er ohnehin schon mit seiner Frau bildete. Daß er sich seiner Frau gegenüber nicht strafbar gemacht hatte, wußte er selbst, auch so schlaftrunken wie er war. Aber es gab einen Schatten, der nicht moralisch oder ethisch zu bewerten war, sondern auf einer Ebene, die er doch gerne auf dem Feld seiner Fachwissenschaft verorten wollte.
Als er sich sicher eine Stunde im Bett gewälzt hatte, nahm er ein zweites Mal vertrauensvoll den ihm am nächsten liegenden Arm seiner Frau und behielt ihn umfaßt, als wäre er eine Schlummerrolle, etwas, an dem er sich ohne Bedingungen anklammern konnte, das tat er, und seine Frau machte am Morgen den Eindruck, als hätte sie von all diesem Denk- und Gefühlsaufwand nicht das Geringste mitbekommen, was erleichternd war, aber auch ein bißchen unheimlich.
Wie hatte Claire Kornitzer ihren Mann wiedergefunden? Das war eine lange Geschichte. Im Amtsblatt hatte sie einen Aufruf gefunden, der sie elektrisierte.
Deutsche jüdischer Konfession
Zur Vorbereitung der Wiedergutmachung des den deutschen Bürgern jüdischer Konfession oder Abstammung zugefügten moralischen und materiellen Unrechts wird die Erfassung des fraglichen Personenkreises durchgeführt. Sämtliche im Kreis Lindau (B) wohnhaften deutschen Bürger jüdischer Konfession oder Abstammung werden hiermit aufgefordert, bis spätestens 20. Januar 1946 ihrem zuständigen Bürgermeister schriftlich Meldung zu machen nach folgendem Muster:
Zu- und VornameOb Volljude (im Sinne der Nürnberger Gesetze oder Mischling I. oder II. Grades)Geburtsort und -tagLetzter WohnsitzFamilienstandFrüherer BerufJetziger BerufGesundheitliche SchädenVermögensverluste
Die Bürgermeister legen die Meldungen gesammelt bis längstens 1.Februar 1946 dem Landrat vor.Der Landrat: gez. Dr. Eberth
Die Ausschreibung traf nicht auf Claire Kornitzer zu, aber sie war wie ein Haltegriff, ein Rettungsring, eine Gewißheit, daß sie gehört werden würde und daß sie ihrem Mann, auf den die Ausschreibung zutraf, Gehör verschaffen würde. Nur: Sie hatte keine Vorstellung über die Mittel, mit denen ihr Mann sie finden konnte und sie ihn. Sie hatte auch keine Vorstellung, wie viele Menschen sich im Landkreis auf diesen Aufruf melden würden. Die Meldefrist war äußerst knapp bemessen, man mußte sich auf den Hosenboden setzen, um die Unterlagen zusammenzutragen und sorgsam aufzulisten. War die Frist so knapp, weil es plötzlich – gut ein halbes Jahr nach Kriegsende – peinvoll war, daß bis jetzt niemand nach Juden gefragt hatte (als hätte sich das „Judenproblem“ in Auschwitz, in Majdanek erledigt), oder war die Frist deshalb so knapp bemessen, damit sich nur wenige Zurückgekehrte oder aus den Verstecken Gekrochene melden konnten? Claire rätselte darüber, kam aber zu keinem Schluß.
Daß nur 681 Juden in der Französischen Zone überlebt hatten, konnte sie nicht wissen, und hätte sie es gewußt, wäre sie nicht verwundert, nur todtraurig gewesen.
Gleich neben dem Aufruf hatte sie eine Anzeige gefunden: Großer Rucksack mit Lederriemen gegen einen Meter trockenes Tannenoder Buchenholz zu tauschen gesucht. Ja, Brennholz war gesucht, aber Transportmittel waren auch begehrt. Im Rucksack war nicht genügend Holz zu transportieren. Vielleicht hatten manche Städter Rucksäcke, mit denen sie am Wochenende Wanderungen in die Berge gemacht hatten, und Gartenbesitzer fällten ohne Bedenken ihre Bäume, Tannen, Buchen. Die Pfempfles, die Bauern, bei denen sie wohnte, dachten nicht daran, ihre Obstbäume zu fällen, die Bäume waren die Grundlage des Hofes, sie waren etwas, das immer zur Familie gehörte, wie das Milchvieh. Auf der gegenüberliegenden Seite fand sie die Anzeige: Meinen Schülern zur Kenntnis, daß der Zither-Unterricht wieder am Dienstag, den 22. Januar 1946 beginnt. Das Unterrichtszimmer befindet sich in der Hauptstraße 27/III bei Herrn Zollsekretär Merkl. Neuanmeldungen ebenso dort erbeten. Und sie las auch von der dringenden Suche nach einem Bassisten (Schlagbaß) sowie einem Cellisten und einem Posaunisten, außerdem wurde eine routinierte Schlager-(Refrain)-Sängerin gesucht. Zu richten waren die Eilangebote an das Konzert- und Tanzorchester Otti Weber-Helmschmied.
Das las sie alles sehr sorgfältig, und sie versuchte sich einzufühlen in die Leute, die solche Anzeigen aufgaben. Und sie versuchte auch, sich vorzustellen, andere Menschen in ihrer nun einmal nicht freiwillig gewählten Umgebung fühlten sich in ihre, Claire Kornitzers, Situation ein: die Kinder weit weg, damit sie überlebten, der Mann noch sehr viel weiter weg, damit er überlebt. Und der Kriegsbeginn, die unsinnige Anzettelung des Krieges, der ein Weltenbrand wurde, verhinderte ihre Auswanderung, verhinderte die Vereinigung des Vaters mit den Kindern, verhinderte ihre Vereinigung mit ihrem Mann auf einem anderen Kontinent. All das hinterließ Narben, Erschütterungen, Verluste, die einem Fremden kaum begreiflich zu machen waren. Rucksäcke, Feuerholz und eine Zither tauchten aus dem Nebel auf; Posaunisten und Bassisten stießen dazu und versanken wieder im Nebel. Und so mußte sie sorgsam und ohne allzu viel Gefühlsballast in den entsprechenden Lücken der Formulare schreiben, nicht zu viel, keinesfalls zu viel, aber doch kraftvoll und nicht zaghaft. Und so schrieb sie.
„Betr. Erfassung deutscher Bürger jüdischer Konfession oder Abstammung.
Auf Grund des Aufrufes im Amtsblatt (Nr. 4 vom 15. 1. 1946) habe ich folgende Angaben zu machen:
Zuname: Kornitzer
Vorname: Claire Marie geb. Pahl
Ich selbst bin voll-arisch, jedoch (im Sinne der Nürnberger Gesetze) mit einem Volljuden seit 1930 verheiratet. Meine Ehe ist nicht geschieden.“
Das Wort „nicht“ hat sie zweimal unterstrichen: nicht, und noch einmal nichtgeschieden. So ragt es prominent aus dem Schriftstück hinaus. Und so füllt sie sorgsam den Fragebogen weiter aus:
„Ehemann: Dr. Richard Karl Kornitzer (ehemaliges richterliches Mitglied der Patent- und Urheberrechtskammer des Landgerichts I in Berlin)
am 1. 4. 1933 ohne Gehalt und Pension wegen seiner Rassezugehörigkeit fristlos entlassen.
Im Februar 1939 nach Kuba ausgewandert und seit dem Februar 1942 fehlt mir jede Nachricht von meinem Mann.
Kinder: Georg geb. 22. 1. 1932
Selma geb. 30. 3. 1935
Beide Kinder sind von mir Anfang Januar 1939 nach England zur Erziehung gebracht worden. Auch über den Verbleib meiner Kinder habe ich nur widersprüchliche Nachrichten.“
Der ganze Komplex der Vermögensentschädigung, ihre Gesundheit, all das interessiert sie jetzt nicht so sehr, sie geht darauf nur kursorisch ein, vielleicht hofft sie auf die Hilfe ihres Juristen-Mannes. Sie hat jetzt andere Interessen, existenzielle Interessen, und die teilt sie dem Landratsamt mit.
„Zur Frage der Wiedergutmachung: ich spreche die ergebene Bitte aus, mir zunächst in folgenden beiden Punkten so weit als möglich behilflich zu sein:
1. den jetzigen Aufenthaltsort meines Mannes zu ermitteln und seine evtl. Rückkehr zu unterstützen.
2. meine eigenen Bemühungen, eine Einreiseerlaubnis für einen kurzen Besuch meiner Kinder in England zu erhalten, freundlichst zu unterstützen. Die kurze Reise nach England soll neben dem Besuch der Kinder, die ich sieben Jahre entbehren mußte, auch den Zweck haben, die Wiedervereinigung der Familie zu fördern.“
Sie schreibt ohne Grußformel, sehr selbstbewußt, sie hat genug gelitten und entbehrt. Sie schreibt in großen, schwingenden Buchstaben ihren Namen: Claire Kornitzer, das E am Ende des Vornamens zittert, verknäult sich ein wenig. Egal, was Graphologen dazu sagen mögen (gibt es noch welche?), vielleicht eine Erregung, ein gutes Ende vorauszusehen, vielleicht auch eine optische Entsprechung des Nierengrießes, der sie seit einiger Zeit quält, als schiede sie auch etwas Spitzes, ganz unpassend Zugespitztes aus, eine Hoffnung, eine Selbstsicherheit, die Energie, hier aus dem Winkel des Bodensees die Zügel in die Hand zu nehmen, um die Familienkutsche, die havariert ist aus bekannten Gründen, wieder in die richtige Spur zu bringen. Claire Kornitzer legt sich mächtig ins Zeug. Und seit ihrer Meldung wurden auch die Hilfsorganisationen tätig, Listen wurden verglichen, das Räderwerk einer Sozialmaschinerie auf Hochtouren, es lief heiß, unzählige Namen von Verschollenen in allen Blättern und Aufrufen, Namenslisten wurden über die Kontinente gekabelt, die Listen der Suchenden und die der Gesuchten übereinanderkopiert, bis sie an einer Stelle deckungsgleich wurden.
Kornitzer hatte seine Frau wiedergefunden, und er hatte dazu ein Panorama geschenkt bekommen, wie er es noch nie gesehen hatte. Die grünen Matten mit den malmenden Milchkühen im Vordergrund, dann ein Wäldchen, die breit angelegten Obstgehölze, Obstplantagen mußte man schon sagen, wenn man in den Tropen gewesen war, Äpfel und Birnen in einer solchen Fülle, wie er sie noch nie gesehen hatte. Und dann darüber der Prospekt der Berge, Gipfel für Gipfel in breiter Front. Kalt und weiß, kalkig waren die ersten, bläulicher die dahinter und die hintersten spielten ins Violett, ritzten den blauen Himmel blutig. Wie ein Schüler lernte er ihre Namen. Er war in eine Landschaft gebettet, wie er sie sich nicht hatte träumen lassen können, viel frische Luft, so daß sie ihn fast betäubte. Der Sonnenaufgangshimmel, wenn er aus dem Fenster sah, hatte einen feinen Haarflaum. Der Sonnenuntergangshimmel mit einer langen Kette wächserner Wolken wirkte wie modelliert, frisiert, Wolkenmodelle in einer großen volkstümlichen Ausstellung, einer Glaspalastwirksamkeit. Prachtvolle Tage, denen Regenvorhänge folgten, die Bergkette verschwand im Mausgrauen. Am nächsten Tag ein Federbett am Himmel, die Luft schneidend und österlich, immer noch etwas Schnee in den Mulden, Sprühen, Verwischen, Schmelzen. Ja, hier mußte man Bauer sein, konnte man nichts anderes als Bauer sein mit einer rotwangigen Frau, die im Stall ein Kopftuch trug, und einer Schar Kinder, rosig und gesund, mit einer Haut wie Milch und Blut, und Honig floß, tropfte über die dick geschmierten Butterbrote, in der Küche hing ein Kreuz im Winkel über dem Eßtisch, an dem sich alle versammelten, und die Kinder tauchten die Bommeln, mit denen ihre Strickjacken am Hals verschlossen waren, in den Honig, und die Bäuerin übersah es gnädig, sie hatte genug zu tun im Stall, im Haus, die Kinder gediehen, aßen die Äpfel, die Äpfel rotbackig und blank und die Kinder auch. (Vielleicht täuschte er sich. Vielleicht idealisierte er das, was er nicht kannte. Die Enge, die Strenge, das Verbot, aus der Gemeinschaft auszuscheren, wo immer sie sich denkend, handelnd, Gefühlen unterworfen befand, das Verbot, über die Stränge zu schlagen, eigene Wege zu gehen, kannte er nicht.) Eine Kuh kalbte im Stall, die dramatischen Verwerfungen auf der Bauchdecke des Tieres mußten beobachtet werden, und die Kinder saßen noch beim Frühstück.
Ja, der Weiler Bettnang gefiel Richard Kornitzer. Oder gefiel er ihm so gut, weil er Claire hier wiedergefunden hatte, weil in diesem Bauernhaus, das mit einer Schulter zur Landstraße wies, eine Art von Gewißheit herrschte, die er so lang vermißt hatte? Unten die Pfempfles, die Hofbesitzer, Mann und Frau in seinem und Claires Alter, mit einer Gelassenheit den Zeitläufen gegenüber – wo und wie der Obstbauer den Krieg erlebt hatte, wagte Kornitzer nicht wirklich zu fragen, immerhin war er Gast. Im ersten Stock wohnten Vertriebene aus dem Egerland, Schwestern oder Schwägerinnen mit drei Kindern und einem Mann, der mit Eifer einen Schuhwichshandel aufgezogen hatte. Schuhwichse war nicht lebenswichtig, eher schon ein Luxusprodukt, aber ein erschwingliches. So türmten sich im Treppenhaus Kartons mit Schuhwichsdosen, woher der Mann den Bestand hatte, blieb sein Geheimnis. Der Mann der zweiten Vertriebenen war verschollen, nichts wußte sie von ihm und seinem möglichen Tod.
Pfempfles melkten und fütterten die Kühe, sie spritzten die Obstwiesen siebenmal im Jahr, wie es der Kreisobstbauminspektor empfahl, so hatte Kornitzer es verstanden: Die Winterspritzung bis Mitte März, die erste Vorblütenspritzung kurz nach dem Austrieb, die zweite Vorblütenspritzung kurz vor dem Aufbrechen der Blüten, die erste Nachblütenspritzung sofort nach dem Abfall der Blütenblätter, die zweite Nachblütenspritzung etwa zwei Wochen nach der ersten Nachblütenspritzung, die dritte Nachblütenspritzung etwa zwei bis drei Wochen nach der zweiten Nachblütenspritzung, bei Regenwetter früher, bei trockenem Wetter später und die Spätschorfspritzung Anfang August bis Anfang September. Der größte Feind der Früchte war der Apfelblütenstecher, aber auch Blattläuse, Schorf, Frostnachtspinner und Obstmaden konnten für die Ernte gefährlich werden. Die Winterspritzung bekämpfte die Eier der verschiedenen Schädlinge. Pfempfles führten sorgfältig Buch über die vorbeugenden Spritzungen, nichts durfte dem Zufall überlassen bleiben. Wenn sich erst Krankheiten auf den Blättern oder Früchten zeigten, waren sie meist nicht mehr zu bekämpfen. An den kranken Stellen verursachten die Spritzmittel aus Kupferkalk und Schwefelkalk sogar häufig Verbrennungen. Es war auch wichtig, frühmorgens oder spätabends zu spritzen und niemals in die offenen Blüten, denn die Bienen, die die Blüten bestäubten, mußten geschützt werden. Und möglichst bei windstillem Wetter.
So penibel die Pfempfles mit den Apfelbäumen verfuhren, so viele Freiheiten ließen sie ihren Söhnen, wenn nur die Arbeit auf dem Hof gemacht wurde. Sie hatten zwei Söhne, der Älteste war im Alter von Georg, dem Kornitzersohn, es war ein groß gewachsener Junge mit flachsblondem Haar, der eine so ruhige Selbstgewißheit ausstrahlte, als könnte er im Nu den Hof übernehmen: die Kühe, die Apfelbäume, die dann alt gewordenen Eltern – er hatte ja auch mit der Mutter und dem polnischen Zwangsarbeiter alleine wirtschaften müssen –, und ein kleinerer Junge, der gerne Faxen machte, dem Claire schon von weitem zuwinkte, wenn sie mit dem Postbus abends nach Bettnang kam. Ein Junge, der sich gern bei ihr in ihrem Zimmer herumtrieb und bettelte, sie möge doch den Plattenspieler anstellen. Sie tat es ihm zu Gefallen, aber sie hatte auch Gefallen an dem Vergnügen des Jungen, daß er etwas wollte, was nicht selbstverständlich war bei den Bauern, Musik hören. Wollen wir tanzen?, fragte sie ihn manchmal, aber er winkte ab. Tanzen könne er nicht. Das lernst du, wenn du nur willst, ermunterte sie ihn. Und legte ihm die Hände auf die Schultern, hör zu, mahnte sie ihn und lächelte ihr gewinnendstes Lächeln, leg deine Arme um mich. Dann schaukelte und stampfte sie mit ihm los, trällerte die Melodie vom Plattenspieler mit, ließ sich sein Stolpern und Einknicken klaglos gefallen. Siehst du, sagte sie, geht doch. Und wenn die Platte abgespielt war, prustete sie vor Lachen, und ihr jugendlicher Tanzpartner reckte sich ein bißchen, als hätte die gemeinsame Unternehmung mit der großstädtischen Mieterin ihn weltläufiger und erwachsener gemacht, ein bißchen jedenfalls. Machen wir wieder, sagte Claire und schob den Jungen dann, ehe er sich auf ihrer Bettkante festsetzte, um noch eine Platte zu hören, aus dem Zimmer hinaus. Zu ihrem Mann sagte sie: Es macht dem Kleinen so viel Spaß. Ihr eigener Spaß war ihr an der Nasenspitze anzusehen. Und Pfempfles im unteren Geschoß wisperten manchmal: Daß Frau Kornitzer bei allem, was sie durchgemacht hat, ihren guten Humor nicht verliert.
Auf dünnem Eis
Richard Kornitzer war gekommen mit einem Ausweis der Vereinten Nationen, aus welchem sich seine Eigenschaft als bona-fide Displaced Person und seine Zulassung zum Aufenthalt in der französischen Zone durch telegraphische Anweisung des Kontrollrates für Deutschland (Combined Travel Board) vom 7. August 1947 ergeben hatte. Er hatte außerdem eine Identitätskarte im ruppigen amerikanischen Spanisch der Hilfsorganisation: Refugiados Hebreos Habana. So war er angekommen im Nachkriegsdeutschland, er wußte, warum, er wollte ankommen, es zog ihn hin, das war eine eigenwillige und gleichzeitig passive Entscheidung, von welcher Seite man es betrachtete. (An der seine Frau den allergrößten Anteil hatte.) Ohne ihre energische Vorarbeit wäre er niemals angekommen oder erst Jahre später. Sie hatte ihn angefordert, sie wollte ihn wiederhaben, „ihren Mann“. Und in ihrer Vorentscheidung, in der seine Entscheidung neblig und vage (vielleicht auch beschämend) aufgehoben war, war ein Glück.
Aber Kornitzer kam als Mister Nobody (un don nadie) aus Nowhere (en ningún lugar). Die Sprache der Hilfsorganisation war Englisch, die UNRAA und später die IRO waren seine Paten, Patentanten, und sie ackerten ja auch, ihn und unzählige andere Displaced Persons an den Ort zu bringen, an dem sie erwünscht waren, an dem sie vielleicht Reste, Überreste ihrer verlassenen Familie finden würden oder eine tabula rasa, die weit entfernt war von den Kratern der Unmenschlichkeit. Die Sprache, die er viele Jahre zu benutzen gelernt hatte mit einigem Geschick, das Hochspanische mit einem Tasten nach dem weichen kubanischen Spanisch, hatte in Versunkenheit zu fallen. Er hatte sich lange Zeit gerne des Spanischen bedient, und er glaubte es einigermaßen ordentlich zu können, was ihm ehrerbietig bezeugt worden war. Die Sprache der Besatzungsmacht in diesem westlichsten Teil Deutschlands war Französisch, die Sprache des Landratsamtes, das für ihn zuständig war, war kernig, solide, Deutsch. Das Mündliche war Alemannisch, was Kornitzer auf Anhieb nicht gut verstand, und er wunderte sich auch, daß kaum einer seiner ersten Gesprächspartner Hochdeutsch sprach. Er ahnte, daß es ein trotzig fortgeführtes Sprechen war, eine Tonart, in die er sich einhören mußte. Also schrieb er lieber als daß er mündlich verhandelte. Und man antwortete auf die Briefe seiner Frau und auch auf seine, es waren Briefe verschiedener Kategorien. Auch das war nicht übel, sah auf dem weißen Papier aus wie die Spur eines Eisläufers auf der planen Fläche, eine feine Ritzung, man mußte genau schauen, wer sie hinterlassen hatte, mit welchem Kraftakt, die Geschicklichkeit, die Geschwindigkeit, all diese Energien waren meßbar, wägbar, anschaubar, wenn man es wollte. Es kam ihm der Gedanke, seine Erfahrung auf die gefrorenen Buchten des Bodensees zu übertragen, einen Ritt über den Bodensee, weil ihm alles, was er erlebt hatte, nun mit der Rückkehr so flüchtig erschien. Seine Emigration, die die Deutschen als Auswanderung bezeichneten: Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr. Manchmal lagen Leitern im Gelände, auf Bäume gestützt. Er war gewohnt, er hatte sich daran gewöhnen müssen, daß sein Leben gefährlich war. Zehn Jahre im Nirgendwo, in der Unsicherheit (niemand wollte den Namen wissen), wie lang, warum, woher, wohin, Schwamm drüber. Schwamm über das Mörderische, Schwamm über die Gewalttaten, das fiel ihm auf, aber er drückte ein Auge zu. Denn das Ankommen war auch eine Erleichterung.
Er war im März 1948 nach Deutschland zurückgekommen, er verträumte das Frühjahr, staunte den Sommer an. Er schrieb auf Claires guter Schreibmaschine am 12. August 1948 eine Eingabe an die Betreuungsstelle für politisch Verfolgte beim Landratsamt:
„Unter höflicher Bezugnahme auf die Rücksprache mit Herrn Oberinspektor Kemper und meine Eingabe vom 5. Juli d. J. an den Herrn Kreispräsidenten überreiche ich anliegend:
1. begl. Abschrift meiner Geburtsurkunde, aus welcher sich meine jüdische Abstammung ergibt
2. ein behelfsmäßiger Ausweis aus meiner Emigration in Havanna
Hierzu bemerke ich, daß ich außer der Qualifikation als Opfer des Naziregimes infolge rassischer Verfolgung von den vorgenannten Dienststellen der Vereinigten Nationen in Amerika zum Zwecke der Mitarbeit am demokratischen Wiederaufbau in Deutschland an leitender Stelle in die bevorzugte Rückführungsliste aufgenommen und hergesandt worden bin. Es ist mir ausdrücklich versichert worden, daß mir aus Gründen der Rasse, Religion, der früheren Ausbürgerung und dergl. keinerlei wie immer geartete Einwendungen oder Anstände entgegengehalten würden.“
Das hat Kornitzer gut formuliert, und nach der Erschütterung der Ankunft hat er auch wieder Selbstbewußtsein, Straffheit bekommen, auch daran war Claire nicht unschuldig. Und weiter schrieb er an die Betreuungsstelle:
„Sobald ich mich jedoch – nach einigen Wochen der Eingewöhnung in Europa nach der Reise – hier bei den in Frage stehenden Behörden gemeldet habe, bin ich auf ständigen Widerstand gegen meine sofortige Rehabilitierung in leitender Stellung gestoßen. Insbesondere ist mir die nationalsozialistische Maßnahme der Ausbürgerung entgegengehalten worden, dazu auch das Fehlen freier Positionen, obwohl sich in zahlreichen, auch leitenden Positionen frühere Nationalsozialisten befinden. Das hat zur Folge gehabt, daß ich nunmehr durch Monate hindurch wegen der früheren nationalsozialistischen Maßnahmen heute noch ohne jedes Arbeitseinkommen bin, ganz abgesehen von der Ausschaltung vom demokratischen Wiederaufbau. Obwohl mir von leitenden Stellen zugestanden wurde, daß ich inzwischen ohne den Nazismus die Stellung eines Landgerichtsdirektors erreicht hätte und daß dringender Bedarf an demokratischen Richtern in allen deutschen Ländern besteht, muß ich feiern.“
„Feiern“, das hieß: keinen Ort zu haben, die eigene werktägliche Arbeitskraft irgendwo einzubringen an vielen, vielen Tagen, an denen er lieber arbeiten wollte. Und diese Unbill der ungewollten, unfaßbaren Untätigkeit, der Arbeitslosigkeit, mußte er der Betreuungsstelle für politisch Verfolgte beim Landratsamt melden. Und er fügte seinem Brief eine Formel hinzu, auf die er einigermaßen stolz war und die einfach so stehenbleiben konnte:
„Wegen der politischen Bedeutung dieser Vorgänge werde ich noch die endgültigen Entscheidungen der Behörden abwarten, an die ich dieserhalb Eingaben gemacht habe.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Ergebenst
Dr. Richard Kornitzer“
Alles schwankte, es gab keinen festen Boden unter den Füßen. Das Ankommen war eine Erschütterung wie das Weggehen. Ein Ausfüllen von Formularen, ein Anhalten des Atmens, eher eine Klugheit, ein Abwägen zwischen verschiedenen Möglichkeiten, von denen das Andocken in der Stadt am Bodensee die beste zu sein schien. Dies war eine vollkommen neutrale Betrachtungsweise, seine persönliche Sicht und seine privaten Umstände wollte er außer Acht lassen. Er mußte sich selbst heimisch machen, dazu halfen nicht die Heimischen, dazu halfen die Besatzungsmacht und die von ihr rasch und energisch eingesetzten Behörden, in denen unbescholtene Leute saßen. Sie stempelten Papiere und setzten kraftvolle Unterschriften darunter. Mit anderen Worten: Sie waren bemüht.
Das Herkommen war verschüttet, eine Zukunft unwägbar, und gerade diese Unwägbarkeit hatte er gewählt. Er hatte seit zehn Jahren nichts mehr erwählt, er war eingeordnet, aufgelistet worden, dabei hatte er Glück gehabt, ein ganz ungeheuerliches Glück. Und nur ganz im Inneren hatte er gewichtet, gerichtet, gezählt, wo er stünde, wo er stehengeblieben wäre, hätte man ihn nicht hinausgeschmissen aus seinem Land, hätte man ihn nicht gezwungen, gezwungen freiwillig zu gehen, seine Frau hoffte er nachkommen lassen zu können. Das war nicht gelungen. Hätte man nicht den ihm zudiktierten Namen Richard Israel Kornitzer (der Dr. jur. kam nicht mehr vor) in Listen eingetragen mitsamt einer Adresse, einer Steuernummer, hätte man nicht seine wirtschaftliche Existenz vernichtet. Reichsfluchtsteuer war zu zahlen, während man ihn hinausschmiß. Er hatte eine Abreiseadresse und eine Zieladresse, die nur ein Schiff war. Es hatte einen schönen klangvollen Namen: Reina del Pacífico. Das Ablegedatum und der Name des Dampfers, mit dem er reiste, klangen wie ein Geburtsdatum und ein Geburtsort einer vogelleichten Existenz, die vorsichtig, damit sie nicht gleich umkippte, aufs Wasser gesetzt wurde. Eine Adresse, ein Eintrag in einem Geburtsregister, eine Paßnummer, eine standesamtliche Eintragung zu einer Eheschließung, eine Bemerkung über den Beitritt zu einer kirchlichen Gemeinschaft (Taufe? Ja.), all dies ließ keine Spuren oder doch nur so periphere, daß diese Spuren, als er endlich angekommen war, nicht zählbar, nicht auflistbar waren. Die Zusammenhänge, aus denen er stammte, waren abgeschnitten, und er selbst war eine Rumpfexistenz. Er war ein Paket geworden, das expediert werden mußte. Aber er war auch ein Mensch. Diese Wahrnehmung löste die Probleme nicht, im Gegenteil, sie schuf neue, die gar keine Namen hatten, vielleicht hießen sie nur Anpassungsschwierigkeiten, Gefühlsstörungen, aber das würde sich geben, so mußte man denken, wenn der Mann nach knapp zehn Jahren wiederkam, wiederkommen durfte, auf ausdrücklichen Wunsch, ja auf das beherzte Eingreifen der Frau.
Alles schwankte, die Berge grüßten, die satten grünen Matten waren ein Grund, auf dem man stehen könnte (wenn man Grund und Boden hätte), ein Fuß in der Stadt, ein Fuß auf dem Berg, mit Riesenschritten ginge es so zurück in eine Normalität. Claire Kornitzer hatte als Sekretärin bei einem Patentanwalt am Bodensee gearbeitet, solange noch Krieg war, produzierte die Waffenindustrie in der Nachbarstadt: Die Zeppelinwerft, die Motorenfabrik, die Zahnradfabrik und die Aluminiumfabrik, alle liefen auf Hochtouren. Alle arbeiteten fieberhaft an neuen (kriegswichtigen, kriegsentscheidenden, so hieß es) Produkten. Ingenieure tüftelten an Erfindungen, die Firmen meldeten Patente an, noch und noch, man wußte ja nie, man würde nach Kriegsende (so oder so) die Patente ins Ausland verkaufen. Da hatte der Patentanwalt viel zu tun, und er war froh, eine verständige Mitarbeiterin zu bekommen, die durch ihren Mann, der verschollen war, schon in den frühen dreißiger Jahren Erfahrungen mit dem Patentrecht hatte. Er war zufrieden mit Claire, und Claire glaubte, es auch gut getroffen zu haben. Dann wurde die Stadt der Flugzeugwerft, der Maschinenfabriken, der Aluminiumerzeugung bombardiert, eine Dornier trudelte, brannte, lag wie ein großer Torpedokäfer auf dem Rücken, ein Flügel gekippt, aufgerissen. Dem Luftangriff vom 28. April 1944 fiel die Schloßkirche in Friedrichshafen zum Opfer, der Dachstuhl brannte, der Helm kippte, die Orgel und große Teile der Kirchenbänke wurden vernichtet. Weil kein Notdach errichtet werden durfte, blieben die unbeschädigten Deckengewölbe der Witterung ausgesetzt, so daß sich die Deckenfresken mit der Zeit auflösten und der wertvolle Stuck seit dem Herbst 1945 von der Decke herunterstürzte.
Die Büros der Ingenieure waren vor den Angriffen notdürftig aufs Land evakuiert worden und arbeiteten unverdrossen weiter, so hieß es. Aber nach dem Krieg wollte niemand mehr etwas wissen von den Motoren, der Luftfahrtindustrie, der kriegswichtigen Maschinenproduktion und ihren Erfindungen, von dem Hafenwesen, dem Zahnradwesen, dem Eisenbahnausbesserungswesen noch am ehesten. Die Produktionsstätten für Aluminium waren zerstört, das Waffenwissen lag brach, die Firmen zwangsaufgelöst, die Patente wie Blei im Keller, kein Bedarf, nicht einmal mit der Kneifzange anzufassen. Einige Ingenieure, die sich etwas auf ihr Wissen zugute hielten, verschwanden, waren auf klammen Wegen ins Ausland gegangen, hatten sich einfach abgesetzt mit ihren eingerollten Plänen, ihrem strikten Willen zum Siege, und wenn es nicht der Endsieg geworden ist, dann der einer einschmiegsamen Rede, die von Europa säuselte, wenn sie Deutschland meinte, von dem europäischen technischen Fortschritt, der europäischen technischen Überlegenheit, wenn sie Deutschland meinte. Es war zum Lachen. Nahmen sie Patente mit, an denen sie einen Anteil hatten oder von denen sie behaupteten, einen Anteil zu haben? Das war nicht voraussehbar, sagte der Patentanwalt seiner tüchtigen Mitarbeiterin. Also war auch die Niederlage nicht voraussehbar für den Patentanwalt. (Oder undenkbar? Nicht vorstellbar?) Die Technik siegte, die Niederlage war nicht voraussehbar, auch nicht vorstellbar, nicht die vollständige Kapitulation des Luftfahrtwesens, des Maschinenwesens, des Motorwesens, des ganzen menschlichen deutschen Wesens mitsamt seiner Erfindungskraft, seinen Tüftlern und Bastlern. Die deutsche Waffenindustrie mitsamt ihren Erfindungen hatte sich als zerbrechlich erwiesen, sie lag am Boden, und dort sollte sie nach dem Willen der Alliierten bleiben, zertrümmert, abgeräumt. Die Schloßkirche bekam erst 1947/48 mit Schweizer Hilfe ein Notdach, die Schweizer schickten Handwerker, die Handwerker brachten Schokolade für die Kinder mit, das Hämmern und Klopfen war am Seeufer zu hören.
Der Nachkrieg und die Währungsreform hatten auch die Anwaltskanzlei in Turbulenzen gebracht, man dankte Claire Kornitzer, man verwies sie darauf, daß sie als „Evakuierte“ bald die strukturlos gewordene Gegend verlassen würde und mit ihrer Qualifikation (für die hier leider keine Verwendung bestünde) sicher in einer größeren Stadt mehr Glück hätte. Man gab ihr ein brillantes Zeugnis, für das sie eines ihrer guten Farbbänder der Schreibmaschine zur Verfügung stellte, und das war’s. Es drängten junge Frauen, die noch keine Ausbildung hatten, die auch auf den übriggebliebenen Schreibmaschinen gymnastische Übungen machen wollten, es drängte eine Normalität. Für eine Berliner Geschäftsführerin einer GmbH, die abgehalftert worden war aus Gründen, die zehn Jahre später nicht mehr begriffen wurden, war zum zweiten Mal kein Platz. Claire Kornitzer ging stempeln, dann schlüpfte sie in der Verwaltung einer Molkerei unter, zählte die Milchkannen und schrieb Rechnungen und Berichte. Claire Kornitzer, ungebunden, hungrig, ohne Familie (aber mit Sorgen um ihre zerstreute Familie) war eine Belastung, eine Last, die abgeworfen wurde, aus betriebsinternen Gründen, aus nachkriegsbedingten Gründen, wie sie vorher aus Gründen, die die nationalsozialistische Gesetzgebung vorgab, aus ihrem Beruf gedrängt worden war. Ein Ehepartner, der ein Klotz am Bein war. Eine Ehefrau, die sich weigerte, die Scheidung gegen den jüdischen Partner einzureichen, war verloren. Sie war mehrmals zur Gestapo vorgeladen worden und hatte unterschreiben müssen, nichts über diese Vorladungen, die Erschütterungen ihres bürgerlichen Lebens waren, weiterzugeben. Also war sie nicht zur Gestapo vorgeladen worden, also war sie nicht mißhandelt worden, zum Schweigen verdonnert. Also hatte sie das alles nur geträumt, und jede Aussage, jedes Flüstern, jede Äußerung gegenüber einem vertrauten Menschen, der sich dann doch nicht als so vertraut herausstellte, hätte weitere Einschüchterungen zur Folge gehabt, das hatte sie begriffen, das hatten sie einige Männer in einem Büro gelehrt, in dem sie lange warten mußte, bis es Nacht geworden war, bis das Haus nicht mehr vor Schreien und Brüllen und Türenschlagen vibrierte. (Und sie verstand diese Lehre nur so ungefähr, eher mit den Nerven, mit den empfindlichen Fingerspitzen als mit dem Verstand.) Was folgte, auch ohne ihr Verstehen, und besonders ohne ihre Einwilligung: Sie hatte nicht nur nichts zu sagen, sie hatte einzupacken und ihren Mann besser gleich als später aus der Schußlinie zu ziehen, so einfach war das.
Was aber feststand, waren ein paar Daten, Fakten: Das 1. Juristische Staatsexamen von Richard Kornitzer war vollbefriedigend. 1926 promovierte er zum Dr. jur., da ist er gerade mal 23 Jahre alt. Das 2. Juristische Staatsexamen legt er mit „gut“ ab. Das waren hervorragende Noten, ein schneller Student, ein Überflieger, entschlossen, seinen Weg zu gehen. Warum es Einser-Philosophen gibt und Einser-Volkswirte, aber die Noten der Juristen tiefer liegen, weiß kein Mensch zu sagen. Vielleicht um die jungen Juristen nicht zu verwöhnen, während der junge Philosoph weiß, daß auf ihn nicht die geringste Verwöhnung wartet, sondern die rauhe Gewißheit, daß niemand ihn braucht. Hervorragende Juristen werden gebraucht. Ich halte Herrn Dr. Kornitzer zur bevorzugten Beförderung und Anstellung für besonders geeignet, hatte ihm der Landgerichtsdirektor am 15. Januar 1932 in seiner Begutachtung bescheinigt und weiter geschrieben: