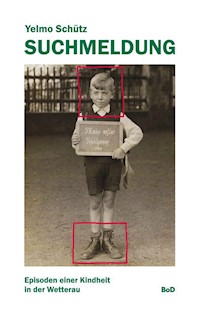Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Legende vom jungen Künstler Gregor Schulze wird erzählt, dessen frühe Erfolge auf eine unaufhaltsame Karriere hinauszulaufen scheinen. Doch mit einem Mal häufen sich sowohl im privaten Umfeld als auch in der öffentlichen Wahrnehmung Katastrophen. Bei der Suche nach einem Ausweg aus der Krise entkommt er dem Hamsterrad des Kunstmarkts und erlebt eine neue Freiheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Legende vom jungen Künstler Gregor Schulze wird erzählt, dessen frühe Erfolge auf eine unaufhaltsame Karriere hinauszulaufen scheinen. Doch mit einem Mal häufen sich sowohl im privaten Umfeld als auch in der öffentlichen Wahrnehmung Katastrophen. Bei der Suche nach einem Ausweg aus der Krise entkommt er dem Hamsterrad des Kunstmarkts und erlebt eine neue Freiheit.
Yelmo Schütz wurde 1938 geboren. Nach seiner Emeritierung als Kunstwissenschaftler wandte er sich der Belletristik zu. Er lebt in Karlsruhe.
Vita brevis, ars longa.
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
Das Sekretariat
Der Metzgerladen
Der Malsaal
Die Bude
Die Kneipe
Die Galerie
TEIL ZWEI
Die Schreinerei
Der Maschinenraum
Der Klassenwechsel
Die Lehre
Die Prüfung
Der Meisterschüler
TEIL DREI
Der Assistent
Der Künstler
Die Hanseaten
Die Reise
Der Makler
Das Palais
TEIL VIER
Die Zwänge
Die Niederkunft
Der Babyblues
Die Kündigungen
Die Irren
TEIL FÜNF
Die Rezension
Die Scheune
Der Restaurator
TEIL EINS
Das Sekretariat
Er hatte sich das alles sehr einfach vorgestellt. Wer sollte ihm den Zugang zur Akademie verwehren? Schließlich hatte er sich über sechs Semester fast ausschließlich mit Kunst beschäftigt. Natürlich müsste er keinen Vorbereitungskurs besuchen; das war etwas für mittelmäßig Begabte. Die Mehrzahl der Bewerber, die schon an der Penne geglänzt hatten, würden ihre Schülerarbeiten aus den letzten beiden Schuljahren in ihre Mappe packen und bangen, ob sie zu der gefürchteten Aufnahmeprüfung zugelassen würden.
Er hatte sich erkundigt und erfahren, dass es zwei Klausurtermine gab. Beim ersten wurde nach einem Modell ein Stillleben gezeichnet, bei dem zweiten war ein Farbproblem in einer thematisch offenen Komposition zu lösen.
Seine Schritte hallten in dem weiß getünchten Säulengang. Eingestaubte Gipsabgüsse von antiken Skulpturen, die an der gegenüberliegenden Wand aufgereiht standen, zeugten von Lehrmethoden einer früheren, längst vergessenen Epoche. Im Hof hatte er lediglich den Hausmeister beim Zusammenfegen von Laub beobachtet. Ansonsten schien die Akademie in einem tiefen Schlaf zu liegen. Von fern her drang das metallische Hacken einer Schreibmaschine an seine Ohren; diesem Geräusch musste er folgen. Immerhin, die Verwaltung machte keine Semesterferien.
In schweren Antiqua-Lettern auf weißem Grund stand: Vorzimmer des Rektors. Um die Schreibmaschine zu übertönen, klopfte er kräftig an die Tür. Er hörte eine Stimme, öffnete die Tür und trat ein.
„Guten Tag, ich möchte meine Mappe abgeben. Für das Wintersemester will ich mich bewerben“, sagte er.
Eine Endvierzigerin mit grau melierten, gelockten Haaren saß seitlich vor ihrer hohen Schreibmaschine aus der Vorkriegszeit und wandte sich ihm mit kühlem Blick zu. Sie schien eine selbstbewusste Person zu sein, die sich ihres Wertes in der überschaubaren Hierarchie der kleinen Akademie durchaus bewusst war. Zwischen sie und den jungen Besucher schob sich ein wuchtiger schwarzer Schreibtisch, der wohl einmal seinen Weg aus dem Rektorat hierher gefunden hatte. Eine offene Tür zur Linken gab den Blick frei in einen großen, mit modernen hellen Möbeln ausgestatteten Raum, vermutlich das Rektorat. Die Wände des Sekretariats waren mit Aktenschränken und Regalen vollgestellt, und nur über dem Schreibmaschinentisch hing ein düsteres Gemälde im Stil von Böcklin. Gleich neben der Eingangstür stand für Besucher ein einfacher großer Tisch mit drei Stühlen.
„Sie sind eine Woche zu früh dran, junger Mann“, sagte die Sekretärin mit tonloser Stimme. „Haben Sie die Unterlagen nicht angefordert?“
Das klang gleichgültig, nicht wie ein Vorwurf, und als hätte es mit ihr gar nichts zu tun. In ihm hingegen stieg ein leichter Ärger auf, den er nur mit Mühe unterdrücken konnte. – Sollte er die sperrige Mappe etwa wieder mitnehmen und in einer Woche noch einmal anreisen?
„Hier“, sagte die Sekretärin und reichte ihm ein doppelseitiges Formular über den Schreibtisch. „Das füllen Sie mal aus, und dann sehen wir weiter.“
Mit einer knappen Kopfbewegung wies sie auf den langen Tisch, setzte sich wieder zu ihrer Maschine und tippte. Ohne anzuklopfen, trat ein Mann im offenen Malerkittel und mit wehender weißer Lockenmähne herein.
„Hallo Müllerin“, rief er. „Machst du mir einen Kaffee?“
„Guten Tag, Prof. Flumen. Darf ich das grad zu Ende tippen? Dann kriegen Sie Ihren Kaffee.“
„Na klar, Müllerchen, lass dir Zeit. Ich schau mir derweil mal an, womit der Aspirant uns beglücken will.“
Ohne den über das Formular gebeugten Bewerber zu beachten, schnürte der Professor die Mappe auf und fing an zu blättern. Nach den ersten zehn Bildern hielt er inne und sprach ihn nun doch an: „His Master‘s Voice, wie mir scheint. Ein gelehriger Schüler in einem straff geführten Kurs. Bei wem warst du? Die Handschrift kenne ich nicht.“
„Hab in Darmstadt ein Lehramtsstudium gemacht mit Wahlfach Kunst, sechs Semester. Das war aber kein Kurs. Ich habe einfach die allererste Aufgabe weiterentwickelt und bin drangeblieben. Natürlich hat der Dozent mich beraten, hat mir aber wenig dreingeredet.“
„Hmm, hmm“, murmelte der Professor. „Nur die erste Aufgabe hast du gemacht und die dann weiterentwickelt. Soso. Und das über sechs Semester. Ja? Ist mir alles zu glatt, zu perfekt.“ Er blätterte weiter. Dann brummte er: „Und was soll das hier – diese Collagen?“
„Ach ja, die hab ich nach der Prüfung zu Hause gemacht. Eigentlich nur ein Experiment. Hab versucht, von diesem konstruktiven Vokabular wegzukommen. Die Formen sollten dichter und lebensvoller werden, in den Raum gehen.“
„Du hast Landkarten mit farbigem Kugelschreiber überzeichnet und mit Gouache übermalt. Wem hast du das abgeguckt? Wer macht so was?“, fragte der Professor.
„Keine Ahnung, ob sonst noch jemand das auch macht. Hab’s halt probiert. Ich mag Landkarten.“
„Ihr Kaffee ist fertig, Herr Professor!“, rief die Sekretärin. Flumen rückte seinen Stuhl zu dem Schreibtisch und nahm den ersten Schluck. Auch für sich selber hatte die Sekretärin einen Kaffee aufgebrüht und sich an den Schreibtisch gesetzt. Beide legten ihre Unterarme auf die Schreibtischplatte. Er brummte kaum hörbar einiges vor sich hin. Nachdem er seinen Kaffee getrunken hatte, stand er auf und rief gut gelaunt: „Danke bestens, Müllerchen. Ach, wenn wir dich nicht hätten – wo bliebe dann die Kunst!“ Er beugte sich noch einmal über den Schreibtisch und raunte ihr etwas zu. Schon in der geöffneten Tür stehend, rief er zu dem jungen Bewerber herein: „Mach weiter mit den Karten. Man sieht sich!“ Lautstark schlug er die Tür zu.
„So, Sie sind fertig mit dem Formular. Lassen Sie mal sehn“, sagte Frau Müller. Sie überflog das Blatt. „Herr Gregor Schulze, Sie haben Lehramtsstudium angekreuzt. Das ändern wir. Sie studieren Malerei bei Prof. Flumen. Er hat Sie angenommen.“
Gregor stutzte, dann widersprach er heftig: „Nein, ich will doch für das höhere Lehramt studieren mit Deutsch als Beifach!“
„Hören sie Herr Schulze. Das tun Sie nicht“, entschied die Sekretärin. „Wissen Sie, wie viel Bewerber die Eignungsprüfung bestehen? Keine fünf Prozent! Das hat wenig mit Begabung zu tun, sondern damit, dass jeder Professor nur ganz wenige Neue annimmt, damit seine Klasse nicht zu groß wird.“
Gregor hatte noch nicht durchschaut, wie die Kunstakademien hier im Land funktionierten. Deshalb unternahm er einen weiteren Versuch: „Ich wollte erfahren, welche Professoren es hier gibt, und ich wollte mir einen aussuchen.“
Frau Müller lachte amüsiert auf: „Sie wollten sich einen Professor aussuchen! Das gibt es nicht. Jeder Professor sucht sich seine Schüler aus. So wird ein Schuh draus, verstehen Sie? Und wenn Sie später immer noch auf Lehramt machen wollen und die Leute hier kennen, dann können Sie immer noch wechseln, so nach vier bis sechs Semestern. Aber nun seien Sie erst mal froh und dankbar, dass Sie einen Studienplatz bekommen haben. Die Zusage erhalten Sie von mir schriftlich mit der Post. Ihre Mappe können Sie wieder mitnehmen.“ Endlich hatte Gregor die Sekretärin verstanden.
Draußen stand er vor dem Schwarzen Brett und überflog die Anschläge. Für das Sekretariat wurde eine Schreibkraft in Teilzeit gesucht. Daneben hing ein Terminhinweis zur Beantragung von Stipendien nach dem Honnefer Modell. Richtig, danach sollte er sich erkundigen, denn von seinen Eltern käme höchstens noch ein kleiner Zuschuss. Er kehrte noch einmal ins Sekretariat zurück.
Die Auskunft von Frau Müller fiel für Gregor unerwartet aus: „Wichtige Frage, Herr Schulze, Sie schreiben, Sie haben schon auf Lehramt studiert. Haben Sie dieses Studium mit einem Examen abgeschlossen?“
„Ja, natürlich!“, bestätigte er.
„Dann haben Sie keinen Anspruch mehr auf ein staatliches Stipendium. Mit Honnef wird grundsätzlich nur das Erststudium gefördert“, war die ernüchternde Auskunft.
„Oh, damit habe ich nicht gerechnet, denn von meinen Eltern kann ich nichts mehr erwarten. Mein Vater geht demnächst in Rente.“
„Ja, tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Aber viele jobben nebenbei, kellnern abends.“
Da fiel Gregor die Annonce ein, die er gerade gelesen hatte. Er sagte: „Sie suchen eine Aushilfe hier für das Sekretariat. Das wäre doch etwas für mich. Oder?“
Frau Müller schüttelte verzweifelt den Kopf: „Ich habe dem Rektor davon abgeraten, die Anzeige überhaupt ans Schwarze Brett zu hängen. Immer wieder werde ich gefragt. Aber entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das ganz offen sage: Das ist kein Job für Künstler. Genialität ist hier im Büro nicht gefragt. Hier muss sauber, korrekt und zuverlässig gearbeitet werden, und auch was Sie in Ihrem Lehrerstudium gelernt haben, könnten Sie hier nicht gebrauchen. Maschinenschreiben muss man können, das ist das Wichtigste.“
„Das kann ich“, war Gregors prompte Antwort.
„Ja-ja, Suchsystem Adler mit einem Finger – das kenne ich.“ Sie lachte kurz auf. „Nein, hier im Büro schreibt man mit zehn Fingern blind, und man kennt vor allem die Anforderungen für Geschäftsbriefe. Das muss jede Schreibkraft mitbringen. Steno muss nicht unbedingt sein.“
„Ich habe während meiner Schulzeit an einer privaten Handelsschule Maschinenschreiben gelernt. Ich tippe nicht besonders schnell. 120 Anschläge waren es damals bei der Prüfung. Und Geschäftsbriefe kann ich auch schreiben.“
„Ja, wenn das so ist, könnten wir Sie vielleicht doch gebrauchen. Bringen Sie mal das Zeugnis dieser Privatschule mit, dann werde ich mit dem Rektor reden. Einen Haken hat die Sache. Sie möchten wahrscheinlich vor allem in den Semesterferien arbeiten, aber da ist gar nicht viel los bei uns. Am meisten Arbeit fällt zu Beginn und am Ende des Semesters an.“
Da Gregor meinte, noch ein Angebot machen zu müssen, um einen kleinen Schritt weiterzukommen, sagte er: „Ich könnte ja zur Probe mal einen Formbrief tippen. Dann sehen Sie, ob Sie mich gebrauchen können.“
Frau Müllers Züge verfinsterten sich, und sie beendete energisch das Gespräch: „Jetzt machen wir gar nichts! Sie sehen doch, dass ich mitten in einer Schreibarbeit bin. Merken Sie nicht, dass Sie mich aufhalten. Schließlich will ich mich nicht den ganzen Nachmittag mit Ihnen beschäftigen.“
Mit einer Entschuldigung und einem kurzen Gruß entfernte er sich fast geräuschlos.
Nur zwei Wochen waren vergangen, als Gregor wieder das Sekretariat der Akademie betrat. Er hatte die Zusage für seine Aufnahme in die Klasse für Malerei bei Prof. Flumen erhalten, sodass nichts mehr auf dem Spiel stand. Jedoch war ihm die offensichtliche Verärgerung von Frau Müller am Ende seines ersten Besuchs, die sich eigentlich kaum von einem Hinauswurf unterschied, noch in lebhafter Erinnerung. Deshalb hatte er vor der Tür kurz gezögert und einmal tief durchgeatmet. Nun stand er vor dem schwarzen Schreibtisch, auf dem die Sekretärin Formulare sortierte, die sie auf mehrere Stapel verteilte. Sie blickte nur kurz zu ihm auf, und er konnte nicht feststellen, ob sie ihn wiedererkannte. Da er sich nicht sicher war, ob das für ihn günstig wäre, vermied er es, auch nur ein Wort zu viel zu sagen. Sie murmelte undeutlich: „Nach der Mittagspause, so in zwei Stunden.“
Er verabschiedete sich unauffällig mit halblautem Gruß.
Gregor schritt den Säulengang weiter entlang und sah, dass es noch einen direkten Zugang zum Rektorat gab. Es folgten das Prorektorat, eine Druckwerkstatt, zwei Ateliers für Grundklassen sowie einige nummerierte Türen.
Die breite Treppe führte zum ersten Stock in eine Art Foyer mit Stellwänden. Gregor las auf einem Plakat, dass die Professoren hier ihre eigenen Werke präsentierten. Flumen entpuppte sich als ein Spätkubist, ein gewisser Eckstein repräsentierte die konstruktive Richtung, und Wolko war der Informelle. Die Dozenten der Grundklassen waren mit Zeichnungen und Aquarellen vertreten. Etwas verloren standen zwischen der Malerei und der Grafik einige Sandsteinskulpturen und Stelen aus sauber gefügten Brettern. Mit einer gewissen Befriedigung stellte er fest, dass er im Einflussbereich von Flumen nicht ganz falsch lag. Gerne hätte er auch gesehen, welche Schwerpunkte die Assistenten vertraten, doch hatte man diese nicht beteiligt.
Gregor verließ das Gebäude und fragte den Hausmeister auf dem Hof, ob die Akademie eine Mensa habe.
„Ach, wo denke Sie hin! Für die paar Leutchen tät sich das doch net lohne.“ Er deutete zum Tor hinaus. „Die Mensa von der Uni is net weit von hier. Da kriege Sie immer was zu esse, auch in de Semesterferie.“
„Noch eine Frage: Wo sind eigentlich die Bildhauerateliers?“, fragte Gregor. „Ich habe sie nicht gesehen.“
„Habe Sie sich fürs Wintersemester beworbe – ja? Sind Sie schon für die Prüfung zugelasse?“
„Prof. Flumen hat mich angenommen“, antwortete Gregor stolz.
„Glicksfall! Das kommt selten vor. Ja, Sie sehe doch hier den lange Holzbau, hier vorne die Holzwerkstatt und dann bis in de Garte enei die Steinbildhauer. Awer im Moment is keiner da, nur der Schreinermeister. Also, dann Mahlzeit!“
Gregor war gemächlich zur Mensa gebummelt, hatte nach dem Essen noch ein Bier getrunken und war betont langsam zurückgeschlendert. Nun saß er auf der Bank vor der Akademie, ließ den Verkehr an sich vorüberrauschen und döste vor sich hin. Auf keinen Fall wollte er vor Ablauf der ihm gesetzten Frist im Sekretariat erscheinen, um die Sekretärin womöglich noch einmal zu provozieren.
Umso überraschter war er, als sie ihn freundlich begrüßte: „Ach, extra wegen dem Zeugnis sind Sie hierhergefahren. Lassen Sie mal sehen. 102 Anschläge steht da und nicht 120. Also, in Zukunft gehen wir bitte nicht ganz so großzügig mit der Wahrheit um“, fügte sie in strengem Ton hinzu.
Gregor bekam einen roten Kopf und schämte sich wegen seines Schummelversuchs. Er hatte nicht damit gerechnet, dass er das Zeugnis wirklich vorlegen müsste und erst recht nicht, dass Frau Müller sich die Zahl 120 gemerkt hätte. Er nuschelte eine kurze Entschuldigung.
Mit einer wegwerfenden Handbewegung wischte Frau Müller das beiseite und sagte: „Ich habe übrigens mit dem Rektor gesprochen. Sie bekommen ein Fixum von 250 Mark im Monat, müssen allerdings jederzeit einspringen, wenn Sie gebraucht werden. Drei Wochen Urlaub können Sie in den Sommerferien machen und eine Woche über Weihnachten. Sind Sie damit einverstanden?“
Gregor konnte seine Freude kaum zurückhalten. Das war mehr, als er von einem staatlichen Stipendium hätte erhoffen können. Er rief: „Natürlich bin ich einverstanden – na klar! Und wie erfahre ich, dass Sie mich brauchen?“
„Sie sind ja regelmäßig im Malsaal von Prof. Flumen. Ihn werden Sie da übrigens wenig sehen, denn er arbeitet in seinem Privatatelier im zweiten Stock, zu dem kaum jemand Zutritt hat. Sie müssen sich vor allem an Frieder Genda halten, seinen Assistenten. Allerdings, hm – es geht mich ja nix an. Haben Sie schon ein Zimmer in der Nähe? Fragen Sie doch mal in der Neudorfer Straße. Jetzt ist die Zeit günstig. Sie sind solo? Oder bringen Sie eine Freundin mit?“
Gregor wunderte sich, dass sie mit einem Mal mit privaten Fragen kam. Etwas mutiger schlug er, ihr direkt in die Augen blickend, einen lässigen Ton an: „Im Moment bin ich unbeweibt, aber auch andere Eltern haben schöne Töchter.“
„Dann bin ich ja beruhigt, und Sie werden die Avancen des lieben Frieder Genda unbeschadet überstehen.“
Eben hatten die mäandrierenden Bemerkungen der Sekretärin bei ihm gezündet. Lachend rief er: „Ich hab da keine Vorurteile. Hauptsache, er kennt sich in seinem Fach aus.“
Frau Müller beugte sich so weit über ihren Schreibtisch, dass Gregor tiefer in ihr Dekolleté blicken musste, als es schicklich war. Sie winkte ihn zu sich heran und flüsterte: „Die Studenten nennen ihn Frieda, Sie verstehn.“
„Danke für diesen Hinweis“, sagte er. „Kann ja nicht schaden, wenn man rechtzeitig in einige Interna eingeweiht wurde.“
„Ja, Sie sollten immer mal kurz hier hereinschauen, am besten täglich. So, und hier ist der Vertrag, wenn Sie den bitte unterschreiben.“
Gregor wunderte sich und versuchte eine eigene Interpretation: „Während des Semesters, wenn ich Sie recht verstehe. In den Semesterferien sicher nicht so oft – oder?“
„Ja, wenn Sie hier sind. Zwei bis dreimal pro Woche.“
Gregor hatte den Eindruck, dass er schon in dem Betrieb angekommen war. Deshalb verabschiedete er sich diesmal in angemessenem Ton, nämlich selbstbewusst und gut gelaunt.
Der Metzgerladen
„Das ganze Geld hat der Papa ins neue Schlachthaus gesteckt, und er hat auch noch en Kredit aufgenomme. Alles mit schöne weiße Fliese bis unner die Deck. Hygienisch muss alles sei, sagt er, wie in em OP. Und wir stehn hier in dem alte Lade. Ich komm mir vor wie in em Museum! Guck dir nur mal die neue Läde in der Innestadt an, da gehn die Schaufenster jetzt alle runner bis uff de Gesteig. Alles schön hell und eiladend. Und bei uns muss man vier Stufe hochsteige. Die Kundschaft geht lieber in en moderne Lade. Die kaufe lieber in der Stadt ei als hier drauße bei uns.“
„Mir gefällt das net, wie se jetzt üwerall in der Stadt die Läde umbaue: Unne Glas und owe Fachwerk. Das basst eifach net zusamme. Und guck dir bloß mal die Auslage an in dene moderne Metzgerläde, all die viele Wurschtsorte aus der Fabrik! Er kauft sei Schlachtvieh noch direkt von de Bauern, weil er weiß, was da verfiddert wird. Schon damals, wie er sei Geselleprüfung gemacht hat, war ich beeidruckt, wie wichtig ihm die Qualität vom Fleisch und von der Wurscht is. Und nach der Meisterprüfung hat er gesagt: Jetzt mach ich mich selbstständig und schlacht selber, denn nur so kann ich dafür garantiern, dass das Vieh net gequält wird. – En Metzger ohne en Ehrbegriff, en Handwerker ohne Charakder hätt ich nie heirate wolle.“
„Aber die Kohle muss auch stimme“, erwiderte die Tochter. „Von seiner Ehr wird en Handwerker net satt. Das hat unser Bernd verstanne. Er hat sei Abi gemacht, und jetzt ist er Lehrer, und der Papa will unbedingt, dass ich en Metzger heirate, der den Betrieb weiterführt. Kei zehn Kunde warn heut Vormittag hier. Ich will net mei Lewe lang Wurscht verkaufe. Ich weiß net – wenn ich mich hier umguck …“
„Er will auch den Lade umbaue, ganz modern. Awer erst müsse die Schulde abbezahlt sei. Ich glaub, da kommt noch einer. Ich geh in die Küch und mach unser Esse“, sagte die Mutter und verließ den Laden durch die Hintertür.
Auf Anhieb war sie sich sicher, dass er ein Student von der Akademie war, mit bloßen Füßen in Sandalen und zerknitterter Hose, die schon lange keinem Bügeleisen begegnet war. Eigentlich mussten sie einem leidtun, diese Hungerkünstler. Waren es doch meistens nette Burschen, die, anstatt an der Uni etwas Gescheites zu studieren, um dann für den Rest ihres Lebens ausgesorgt zu haben, hier mit Farbe herumklecksten. Und nur die wenigsten, so hieß es immer wieder, könnten später von ihrer Kunst leben. Dann heirateten sie eine tüchtige Frau, die sie ernährte, oder sie fielen dem Staat zur Last.
„Bitteschön, was darf’s sei?“, fragte sie den Kunden.
„Haben Sie etwas Warmes, das ich direkt aus der Hand essen kann? Ich habe eigentlich keine Lust, zur Mensa zu laufen. Ich möchte nur eine Kleinigkeit, und danach will ich hier in der Umgebung herumfragen nach einem Zimmer.“
„Ich könnt Ihne a Scheib Leberkäs heiß mache und in a Brötche lege. Wär das was für en arme Bettelstudent?“
„Na, ganz so schlimm stehts mit mir noch nicht“, trumpfte er auf. „Immerhin bin ich vor der Eignungsprüfung an der Akademie angenommen worden und habe auch in der Verwaltung einen kleinen Job gefunden, der mich ernähren wird. Ja, das wäre mir recht, wenn Sie mir ein Brötchen mit Leberkäse machen könnten.“
Wie der mich anguckt!, sinnierte sie. – Nett sieht er ja aus, aber er will bestimmt auf gut Wetter mache, damit er demnächst noch a Extrawurscht kriegt. Oh, ihr Studente seid schlau. Aber ich durchschau euch alle. – Während sie an der Wärmetheke hantierte, versuchte er das Gespräch am Laufen zu halten.
„Wenn Sie hier eine Bude suchen würden“, sagte er. „Wo würden Sie dann fragen?“
„Das kann ich mir gar net vorstelle. Ich wohn hier bei meine Eltern, und hier bleib ich auch. Vorerst jedenfalls.“
„Bis Sie heiraten“, ergänzte er.
„Ich hab noch kei Pläne“, lachte sie ein wenig verlegen.
„Manchmal kommt das Glück schneller, als man es für möglich hält“, bemerkte er altklug. „Aber hätten Sie vielleicht einen Tipp für meine Zimmersuche?“
„Bei der Akademie is die Stadt eigentlich zu End. Sie sehn, das hier is der letzte Lade, und danach wirds dörflich, erst zweistöckige, dann einstöckige Wohnhäuser. Manche verdiene sich gern noch a paar Mark mit em möblierte Zimmer. Gucke Sie mal nach ältere Leut, nach Rentner.
Er hatte sich vor dem schmalen Schaufenster auf die Bank gesetzt und ließ sich sein gehaltvolles Brötchen schmecken. Sie konnte nur seinen schmalen Kopf mit den etwas zerzausten Haaren sehen. – Er sieht doch ganz anders aus als unsere Metzgergesellen, dachte sie. – Und man kann sich gut mit ihm unterhalten.
„Elsa, das Esse is fertig! Mach de Lade zu und sag de Männer im Schlachthaus Bescheid. Awer Tempo, sonst wirds Esse kalt!“
„Immer Tempo, immer Tempo“, murrte sie, drehte den Schlüssel in der Ladentür um und rannte über den Hof zum Schlachthaus, wo sie ihre Botschaft weitergab.
Am Esstisch redeten nur Vater und Mutter. Elsa hatte den Blick auf das Wellfleisch mit Sauerkraut und Kartoffelpüree gerichtet, denn dieses Schlachttagsessen mochte sie besonders gerne, und sie vermied es aufzublicken, weil Harald, der gerade seine Gesellenprüfung bestanden hatte, sie ständig fixierte und dabei bisweilen zu kauen vergaß.
Die zwei Gesellen und der Stift hatten kaum zu Ende gegessen, als sie auch schon von ihrem Meister aufgescheucht wurden mit den Worten: „Auf gehts ihr Männer, die Arbeit ruft! Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich komm gleich nach.“
In Zeitlupe erhoben sich die Drei. Mit müden und etwas missmutigen Gesichtern verließen sie die geräumige Wohnküche, während der Chef sich eine Zigarette anzündete. Als sich ihre schweren Schritte draußen entfernten, sprach der Meister zu seiner Frau: „Der Harald hat a gut Prüfung gemacht. Er is tüchtig, er hat Ehrgeiz, und ich überleg, ob ich ihm vorschlage soll, dass er abends auf die Meisterschul geht. Ich müsst ihn natürlich jeden Tag für ei Stund freistelle. Aber durch sein Eifer holt er das raus, denk ich.“ Dann wandte er sich zu Elsa: „Er is überhaupt en sympathischer Bursch, findst du net auch?“
Da sie schwieg, fügte er zögernd hinzu: „Ich glaub, ich könnt ihn mir sogar als mein künftige Schwiegersohn vorstelle.“ Während die Mutter den Tisch abdeckte, ergänzte sie: „Er ist en anständiger junger Kerl. So schnell find man kein in der Generation.“
„Mir liegt er überhaupt net“, meldete sich nun endlich auch Elsa zu Wort. „Wie der mich immer anstiert! Ich find den Karl nett, awer der is ja schon älter und verheirat. Nein, lasst mich in Ruh mit eure Metzger. Ich bin noch jung und denk überhaupt noch net ans Heirate.“
„Man muss immer über den Tag hinausdenke“, belehrte sie der Vater und verließ die Küche.
„Spül du mal das Geschirr“, sagte die Mutter. „Ich geh in de Lade und häng derweil die frisch Wurscht auf.“
Elsa wusste, dass ihre Eltern nicht verkuppelt worden waren. Sie hatten schon öfter erzählt, dass sie sich beim Maitanz begegnet waren und sich Hals über Kopf verliebt hatten. Von einer solchen romantischen Liebe träumte auch sie. Gewiss, Vater und Mutter kamen aus einfachen Verhältnissen, aber deshalb musste sie nicht für die Firma ihre Jugend, ihr ganzes Leben opfern. Schließlich hatte der Bruder es ihr vorgemacht, hatte die Eltern vor den Kopf gestoßen und war seinen eigenen Weg gegangen. Nein, sie würde keinen Mann heiraten, wenn sie nicht ganz toll in ihn verliebt wäre, das stand für sie jetzt fest. Gewiss, sie verstand sich gut mit ihren Eltern und mochte sie auch, aber wen sie einmal heiraten würde, das wäre ganz allein ihre Sache.
Sie war mit der Küchenarbeit fertig und hatte die Zeitung vom Fensterbrett genommen, die ihr Vater erst abends lesen würde. Sie interessierte sich nicht für Politik, sollte sich aber doch informieren, denn in drei Jahren dürfte sie wählen, und dann wollte sie nicht blind den Meinungen ihres Vaters folgen, der abends aus der Zeitung vorlas, was ihn besonders ärgerte und das er dann genüsslich kommentierte.
Für Elsa gab es in der Politik mehr Fragen als Antworten, Rätsel über Rätsel. Seit Wochen hieß es, es bestünde die Gefahr eines Atomkriegs. Wer konnte denn so was wollen? Denn dann wären wir alle futsch. Seit dem Tod von Marilyn Monroe gab es immer noch Meldungen über sie. Vermutlich wurde sie doch von vielen Menschen vermisst. Elsa hatte sie auch gemocht, für sie war die Blondine eine Art Idol.
Draußen ging die Glocke der Ladentür. Anscheinend hatte die Mutter aufgeschlossen, weil sie eine Kundin vor dem Fenster gesehen hatte.
„Elsa für dich“, rief die Mutter. „Komm mal raus!“
Sie trat durch die Seitentür und blinzelte ungläubig. Da stand dieser Student schon wieder. Was wollte er denn nun? Und von ihr?
„Guten Tag“, sagte er lächelnd. „Sie waren so nett, mir ein paar nützliche Tipps für die Zimmersuche zu geben. Keine zwei Stunden war ich unterwegs und hatte tatsächlich Erfolg, und dafür wollte ich Ihnen ganz herzlich danken. Eigentlich sind wir in den Geschäften gar nicht so sehr willkommen, weil man an uns Studenten nicht viel verdient.“
„Ach, sage Sie das net“, schaltete sich die Metzgersfrau ein. „Mir is ein Kunde so lieb wie der anner. Es kommt auch die Zeit, dass Sie ausstudiert habe, und dann werde Sie vielleicht sogar en besonders guter Kunde, wer weiß.“
„Da bin ich sehr zuversichtlich“, bestätigte Gregor, um sich dann wieder Elsa zuzuwenden. Er berichtete: „Tatsächlich bin ich bei einem älteren Ehepaar fündig geworden, das die beiden früheren Kinderzimmer im Dachgeschoss an Studenten vermietet. Eng geht es da zu und nur fließend Wasser im dunklen Flur, das Klo im Erdgeschoss. Aber sonst hat die Bude nur Vorteile. Sie ist billig und liegt dicht bei der Akademie, wo ich ohnedies den größten Teil des Tages verbringen werde.“
Auf dem Rückweg war ihm der Einfall gekommen, er könnte sich noch kurz bei der Metzgerstochter für ihren Tipp bedanken. Obwohl sie ziemlich reserviert gewesen war, gefiel sie ihm. Sie hatte zarte rote Backen und eine strohblonde Ponyfrisur. Er versuchte sich auszumalen, was sich unter der weiß-rot-karierten Kittelschürze verbarg. Einen Versuchsballon konnte er ja mal steigen lassen.
Da Elsas Mutter den Laden verlassen hatte, wurde er mutiger. Er wagte nur ein gespielt schüchternes Lächeln, weil er vermutete, dass ein allzu forsches Auftreten das Mädchen verschrecken würde. Er fragte: „Hätten Sie Lust, mit mir heute Abend ins Kino zu gehen? Im Roxy läuft Das Apartment. Das ist eine Liebeskomödie mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine. Die beiden sind umwerfend komisch. Was halten Sie von meinem Vorschlag?“
Da Elsa es ihm nicht zu leicht machen wollte, wandte sie ein: „Mein Lieblingsstar ist die Marilyn Monroe. Ich bin immer noch traurig, dass sie diesjahr gestorbe is.“
„Wenn mal ein Film mit der Marilyn kommt, können wir uns den auch ansehen“, schlug er als Kompromiss vor.
Das schien Elsa zu überzeugen, denn mit einem Mal begann sie aufzutauen, denn sie rief aus: „Du magst sie auch? Das find ich toll!“ Sie erschrak, dass sie ihn spontan geduzt hatte und hoffte, dass ihm das entgangen wäre. Doch er ging sofort auf den vertrauten Ton ein. Als er ihr seine Hand über die Theke reichte, konnte sie nicht anders als einzuschlagen. Er stellte sich vor: „Ich heiße Gregor. Und du?“
„Elsa“, sagte sie etwas kleinlaut, denn es war ihr nicht entgangen, dass er sie überrumpelt hatte. Ihre Blicke hatten sich nur kurz gekreuzt.
„Also, der Film beginnt um acht. Wenn wir mit der Trambahn fahren, reicht es, wenn ich dich um halb abhole. Ist das okay?“
Sie nickte unsicher und fragte: “Bist du denn schon in dei Zimmer eigezoge?“
„Ich hab den Schlüssel bekommen. Alles perfekt.“ Er griff in seine Hosentasche, zog das blinkende Metall heraus und hielt es triumphierend in die Höhe.
Kaum hatte er den Laden verlassen, als Elsa zum Telefonapparat sprang, der im Flur hing und die Nummer ihrer Freundin wählte. „Hallo Gilla“, rief sie aufgeregt. „Ich muss mit dir rede. Hast du en Moment Zeit?“
„Ich sitze an meinen Hausaufgaben – Berufsschule. Du weißt, da lass ich mich gern mal stören.“
„Ich bin heilfroh, dass ich das hinner mir hab.“ Sie erzählte: „Weißt du, en Student von der Akademie war hier, eigentlich en netter Kerl, aber alles ging zu schnell, hat mich irgendwie über de Tisch gezoge. Er will mit mir ins Kino geh, und ich hab zugesagt, will aber net. Ich kenn doch die Type, die wolle doch alle nur dasselbe. Jetzt musst du mir helfe, damit ich da wieder rauskomm.“
„Wieso willst du absagen?“, fragte Gisela. „Weil er was von dir will? Du kannst doch auch was wollen. Der Erste muss nicht der Letzte sein. Ich meine, du musst doch nicht gleich ans Heiraten denken.“
„Ja, wenn ich verliebt wär“, wandte Elsa ein. „Aber er is mir nur sympathisch. Ich wills ihm net zu leicht mache, verstehst du?“
„Ach so ist das.“ Gisela lachte amüsiert. „Er soll sich erst mal anstrengen, dich umwerben und so. Capito! Und wie stellst du dir das vor?“
„Du kommst um siebe oder kurz danach zu mir, und wenn er drauße warte tut, gehn wir zusamme raus, und ich sag ihm, dass ich vergesse hat, dass wir verabredet warn. Dann lass ich ihn erst mal schmore.“
„Ich würde das anders machen. Ich denke mir, du müsstest selbstbewusster auftreten. Aber gut, ich komme.“
Elsa und Gisela hatten ihren Beobachtungsposten hinter dem Vorhang des Wohnzimmerfensters bezogen, als der Student auftauchte. Es war erst fünf vor halb acht.
„Er sieht wirklich nicht übel aus. Ich würde mit ihm ins Kino gehen“, flüsterte die Freundin. „Gehn wir raus?“
Elsa blickte auf ihre Armbanduhr. „Es is noch kurz vor halb. En Moment warte wir noch.“
Durch das große Hoftor traten sie auf den Gehsteig. Wie nicht anders zu erwarten, war Gregor ziemlich überrascht, als zwei Mädchen auf ihn zukamen. Da Elsa mit ihrer Ausrede zögerte, preschte er mit einem unerwarteten Vorschlag vor: „Wir gehen zu dritt ins Kino. Das ist eine famose Idee. Sie mögen auch Shirley MacLaine und Jack Lemmon?“ Mit seiner Frage hatte er sich direkt an Gisela gewandt.
„Entschuldigung, es geht heut net“, begann Elsa. „Ich hat ganz vergesse, dass ich mit meiner Freundin verabred bin.“ Schnell schlug Elsa die Augen nieder und scharrte nervös mit ihrem rechten Schuh über den Boden, als wollte sie etwas zeichnen.
Gregor hatte sich schnell wieder gefangen, denn er sprach, während er abwechselnd den Blickkontakt mal zu Elsa, mal zu ihrer Freundin suchte. – Oh Mist, dachte er. – Ich fürchte, dass ich mit meinem Vorschlag zu stürmisch gekommen bin. – Er schlug vor: „Aber der Film läuft noch die ganze Woche. Wie wäre es am Samstag oder Sonntag?“
Da Elsa noch immer zu Boden blickte, sah er die Freundin an, die ihrerseits Elsa mit dem Ellbogen aufmunternd anstieß. Gregor hatte verstanden, dass er die Freundin als Verbündete brauchte. Deshalb wiederholte er seinen Vorschlag: „Wir könnten doch zu dritt gehen, wenn ihr wollt?“
Als Elsa nickte, stellte er sich der Freundin vor: „Ich heiße Gregor. Duzen wir uns auch?“ Gisela war einverstanden und nannte ihren Namen. Dann einigten sie sich schnell auf die Vorstellung am Sonntagabend um acht Uhr.
Im Kino hatte Elsa zwischen ihrer Freundin und dem Studenten gesessen. Alle drei hatten viel gelacht über das komische Paar im Film, und zwischen Gregor und seiner Nachbarin war es lediglich zu einem Ellbogenkontakt gekommen. Als sie draußen auf der Straße standen, schlug er vor, dass man noch in eine Kneipe einkehren könnte. Aber beide Mädchen lehnten das ab, weil sie am nächsten Morgen früh aufstehen müssten. Gisela, die ganz in der Nähe wohnte, verabschiedete sich schnell und witzelte über Elsas Schüchternheit: „Bei der Hinfahrt hab ich euch gelotst. Die Rückfahrt müsst ihr jetzt allein schaffen.“
„Ja, hab vielen Dank für deine Hilfe“, ging Gregor auf den ironischen Ton ein. „Die Route hab ich mir gemerkt, und ich bin zuversichtlich, dass wir nicht verlorengehen.“
Beim Abschied lachten die beiden Freundinnen. Gregor deutete vor Elsa eine leichte Verbeugung an und sagte: „Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, Arm und Geleit Ihr anzutragen?“
Elsa nahm das Angebot an und hängte sich bei ihm ein, antwortete aber: „Du musst net so geschwolle schwätze.“
„Das war doch ein Zitat“, klärte Gregor sie auf. „Faust sagt das zu Gretchen, als er ihr zum ersten Mal auf der Straße begegnet.“
„Da könnt ja jeder komme“, empörte sich Elsa. „Und, was hat sie dazu gesagt?“
„Sie hat geantwortet: Bin weder Fräulein weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen.“
In der Bahn griff Elsa das Thema noch einmal auf: „Ich mag das gar net. Wenn einer so stürmisch kommt, hat er’s gleich bei mir versch… verspielt.“
„Aber bei den beiden läuft es anders“, fuhr er fort. „Denn Faust gibt nicht gleich auf, und dann kriegen sie sich doch sehr schnell.“
„Und erzähl, wie hat er’s gemacht?“
„Zunächst schenkt er ihr teuren Schmuck, den er, der Teufel weiß, woher genommen hat. Doch sind es nicht seine Liebesbeteuerungen, sondern das kindische Orakel mit dem Blütenzupfen, das sie von seiner Liebe überzeugt.“
Elsa lachte ein wenig unsicher, als sie ausstiegen. „Ach ja, man is ja net abergläubisch, aber es is a Spiel, und dann möcht man am liebste doch dran glaube.“
Gregor blieb kurz stehen; er bückte sich, denn er hatte zwischen dem Pflaster und einer Hauswand die Blüte eines Gänseblümchens entdeckt, das er pflückte. Er stellte sich vor Elsa und hielt ihr die winzige Blume entgegen.
Elsa errötete ein wenig, lächelte und nahm sie ihm aus der Hand. Vor der Metzgerei drückte er ihr noch schnell einen flüchtigen Kuss auf die Wange, bevor sie hinter dem hohen dunkelroten Hoftor verschwand. Sie hatten sich nicht verabredet, aber er wusste ja, wo er sie finden konnte. Das dachten sie wohl beide in diesem Augenblick.
Bevor sie in ihrem Zimmer das Licht einschaltete, warf sie noch einen Blick durch das Fenster und sah die schmale Gestalt, die sich im Schein der nächsten Straßenlaterne entfernte und dann in der Dunkelheit verschwand. Sie knipste ihre Nachttischlampe an, setzte sich auf die Bettkante, zupfte und zählte: „Er liebt mich … – Hm“, murmelte sie. „Ist doch alles nur Aberglaube.“
„Mit so em brotlose Künschdler solldest du nix afange, Elsa. Du weißt ja, wie der Papa und ich drüber denke. Dann musst du wirklich dei Lebe lang Fleisch und Wurscht verkaufe, ihn mit deiner Arbeit aushalte, und er liegt auf der faule Haut.“
„Ihr habt euch auch net verkuppele lasse von eure Eltern“, wandte Elsa ein.
„Wir hatte beide nix. Wir warn arm. Aber hier is en Betrieb, a Vermöge. Das Haus mit dem Lade und das neue Schlachthaus. Was soll da draus wern?“
„Ganz eifach“, antwortete Elsa. „Wenn der Papa in Rente geht, verkauft ihr das Haus und die Metzgerei, und ihr genießt das Lebe. Ihr geht spaziern und verreist. Dann habt ihr endlich mal Freizeit.“
„Gar nix schaffe und nur da rumsitze und Kaffee trinke, Das kann ich net“, bekannte die Mutter. „Elsa, ich meins wirklich gut mit dir. Pass uff, dass du en klare Kopp behältst!“
Während die Mutter in die Wohnung zurückging, um die Betten zu machen, blieb Elsa hinter der Theke stehen und wartete auf die ersten Kunden. Sie hatte sich überhaupt nicht in diesen Studenten verliebt. Und dieser kleine Kuss hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Dennoch wunderte sie sich, dass er nicht wieder in den Laden kam, und sie hatte ihn auch nicht vor dem Schaufenster vorbeigehen sehen. Es war doch nicht möglich, dass es schon vorbei sein sollte, bevor es richtig angefangen hatte. Ein Tag verging nach dem anderen, und sie wurde unruhiger. War sie ihm gleichgültig geworden? Hatte sie etwas falsch gemacht? Hatte sie sich vielleicht doch zu spröde verhalten?
Nach zwei Wochen stand er mit einem Mal im Laden. Das Semester musste angefangen haben, denn sie sah gegen Mittag öfter junge Leute auf der Straße. Er entschuldigte sich. Längst hätte er sich mal sehen lassen sollen, aber er hatte arbeiten müssen und war auch für ein paar Tage zu Hause gewesen. Ob sie morgen in der Mittagspause gemeinsam einen kleinen Spaziergang machen könnten? Er wies mit dem Arm schräg zum Schaufenster.
„Hier, wo die Häuser zu Ende gehen, gibt es ein Flüsschen“, sagte er. „Wir könnten da ein Stück entlangspazieren und wieder zurück. Noch ist das Wetter schön, das sollten wir nutzen. Jetzt muss ich aber zur Akademie.“
Da sie all die Tage an ihn gedacht hatte und obwohl sie sich auch ständig selber zurechtgewiesen hatte, nahm sie sich täglich vor, ihn zu vergessen. Doch nun konnte sie nicht anders, als sofort zusagen.
„Ja, morge um halb zwei. Dann hab ich gegesse. Du kannst da drauße auf der Bank auf mich warte“, antwortete sie.
Durch die angelehnte Tür, die zum Laden führte, warf sie einen kurzen Blick und sah seinen Hinterkopf vor dem Schaufenster. Sie zog ihre blaue Wolljacke an und eilte in den Hof, wo sie am Tor einen Moment verharrte. – Ich hab’s gar net eilig, sagte sie sich. – Er soll nur net denke, dass ich scharf drauf bin, ihn zu sehe.
Sie drückte die Klinke herunter, öffnete das Tor langsam und trat ins Freie. Er schien sehr erfreut, denn er sprang auf, trat auf sie zu und sagte: „Schön, dass du pünktlich bist. Ich nehme an, dass du nicht viel Zeit hast. Wann öffnet euer Laden wieder?“
„Um drei, aber ich muss früher zurück sei.“ – Höchstens a halb Stund, dachte sie. – Das muss erst mal reiche. – Dann begann sie das Gespräch, denn während der letzten Tage waren ihr viele Fragen gekommen. Wenn sie sich in Zukunft öfter träfen, durfte sie sich nicht darauf verlassen, dass er von sich aus alles erzählen würde, was sie wissen wollte.
„Du bist bei deine Eltern gewese. Was sage die denn dazu, dass ihr Sohn en brotloser Künstler werde will?“
„Die wissen genau, dass er nie brotlos wird“, behauptete Gregor. „Ich habe das Erste Examen für Volksschulen und könnte jederzeit den Dienst antreten, wenn ich wollte.“
Elsa konnte ihr Erstaunen kaum unterdrücken. „Ach, du bist schon Lehrer! Aber warum machst du das net? Du bekämst doch a schönes Gehalt. Das lässt du dir entgehe!“
„Wenn ich das Studium hier abschließe, werde ich Kunstlehrer an einem Gymnasium. Die Arbeit als Studienrat ist bedeutend angenehmer, und ich verdiene dann deutlich mehr als ein Volksschullehrer.“
„Ja, wenn das so is“, meinte Elsa. „Das is ja dann ganz anders, als wenn einer bloß Künstler werde will. Ja, das find ich sehr vernünftig, wie du das machst.“
„Jetzt bin ich erst mal in die Malereiklasse von Prof. Flumen aufgenommen worden – und zwar ohne Prüfung. Aber ich kann in zwei bis drei Jahren ohne weitere Formalitäten zu den Kunsterziehern überwechseln und muss dann nur noch ein Beifach an der Uni belegen.“
„An der Uni willst du auch noch studieren? Mensch Gregor, du wirst noch so schlau wie du willst!“ Elsa gelang es nur mit Mühe, ihren veränderten Eindruck, den sie sich von dem vermeintlichen Hungerleider gemacht hatte, zu verbergen. Während sie an dem von Kopfweiden bestandenen Flüsschen entlanggingen, beteiligte sie sich lebhaft an dem Gespräch und blickte auch immer wieder einmal kurz von der Seite bewundernd zu Gregor auf.
„Du hast gesagt, dass du in der Verwaltung von der Akademie arbeite tust. Hast du dafür genug Zeit? Und lohnt sich das? Ich mein finanziell.“
„Fünf Tage hab ich zusammen mit der Sekretärin Mappen registriert, Listen geschrieben und geholfen, die Eignungsprüfungen vorzubereiten. Mein erstes Gehalt hab ich auch schon bekommen. Während des Semesters springe ich nur noch stundenweise ein.“ Mit dem Gehalt hatte er natürlich übertrieben, denn die künstlerischen Hilfskräfte wurden besser bezahlt und waren zudem näher an der Kunst. Aber mit solchen Details wollte er Elsa nicht behelligen, und sie war auch vollauf zufrieden mit dem, was sie an diesem Mittag erfahren hatte. Gerne willigte sie ein, als Gregor für den übernächsten Tag einen weiteren Spaziergang vorschlug.
Der Malsaal
Der Hausmeister schloss, wie es seine Pflicht war, um halb acht den Haupteingang auf, durch den Frau Müller als erste um Punkt acht Uhr das Gebäude betrat. Die Studenten trudelten zwischen zehn und elf ein, woran sich auch nach wenigen Tagen die Studienanfänger gewöhnt hatten, nachdem sie sich durch ihr frühes Erscheinen lange genug recht verloren vorgekommen waren.
Ein Dutzend Studienstaffeleien waren über den weiten Raum verteilt, und an jedes der fünf hohen Fenster war ein Arbeitstisch geschoben. In einem Regal standen große Pappkartons, die teils originell bemalt, teils auch nur mit einem Namenskürzel versehen waren. Außerdem gab es einen rostigen Stapeltrockner sowie das hölzerne Monstrum von einem Mappenständer.
Zunächst wurde geraucht und geklönt, bis einer seine Kippe auf den Boden schmiss, sie mit dem Schuh austrat und scheinbar ärgerlich ausrief: „Wofür bin ich eigentlich hier? Vielleicht, um mit euch Arschlöchern zu quatschen!“ Daraufhin setzte eine geschäftige Unruhe ein. Leinwände auf Keilrahmen, mit Packpapier bespannte Holzplatten oder sonstige angefangene Bilder wurden auf die Staffeleien gestellt, und es kehrte Ruhe ein.
Die meisten trugen, der Tradition folgend, weiße Kittel, die Spuren der Malerei zur Schau trugen. Einige hatten sich ein Schlosserhemd ohne Kragen übergezogen, das seit kurzem beliebt wurde. Eines der Mädchen hatte sich über Pulli und Jeans eine Küchenschürze gebunden.
Flumens Assistent Frieder Genda machte einen ersten Rundgang, mit leiser Stimme begrüßte er unter den fortgeschrittenen Studenten einen nach dem anderen und wandte sich dann den Neulingen zu. Drei von ihnen hatten ihre Staffeleien Rücken an Rücken zusammengestellt, um den Älteren nicht zu nahe zu kommen. Genda zeigte ihnen, wie man Packpapier faltenlos auf eine Holzplatte zieht und besprach mit ihnen die erste Aufgabe. Er forderte sie auf, ihre Staffeleien ins Licht zu rücken und ließ sie alleine.
Genda war groß und schlank, seine Bewegungen etwas linkisch, und er ging leicht gebückt, als wollte er sich ein wenig kleiner machen. Auffällig waren seine wasserhellen Augen und die geschürzte Oberlippe. Er ging zu dem einzigen neuen Studenten, der sich an einem Tisch niedergelassen und unmittelbar nach seiner Ankunft begonnen hatte, Blätter aus einem Schulatlas zu reißen und sie in Stücke zu schneiden. Eine fertige Collage lag oberhalb der Arbeitsfläche.
„Wir haben vier Neue in diesem Semester“, sagte Genda mit einem freundlichen, ein wenig schüchternen Lächeln. „Dich soll ich in Ruhe lassen, hat Flumen mir gesagt. Aber mich interessiert das, was du da machst. Mit dem Kugelschreiber gehst du kraftvoll in die Landkarten. Aber die Gouache aus dem Farbkasten deckt nicht, und das Deckweiß bietet nur einen schwachen Notbehelf. Wir verwenden hier vorwiegend die modernen Acrylfarben als Alternative zu Ölfarben. Willst du die mal probieren?“
Frieder Genda hatte seine linke Hand auf Gregors Schulter gelegt und deutete mit der anderen auf ein Detail. Als er mit seiner Hüfte Gregors Arm berührte, erhob dieser sich und ging einen Schritt zur Seite, sodass Gendas Hand herunterglitt. Frieder hatte verstanden, und er flüsterte: „Tschuldige! Und wie gehst du jetzt weiter vor?“
„Ich wähle die Karten nach Farben aus: grün, braun und blau bei den topografischen, weitere bunte Farben aus sonstigen Karten. Ich schaue, wo Linien zueinander passen – Flüsse oder Straßen. Dann schneide ich aus und klebe die Stücke zusammen. Zunächst hatte ich nur Stadtpläne in Quallen verwandelt. Gerade baue ich an einem Mons Voluptatis. Dazu will ich ein paar Versionen machen.“
„Ja-jaaa, ich sehe schon“, antwortete Genda, indem er auf ein rosafarbenes Detail wies. „Du stehst auf Frauen. Macht ja nichts. Muss es auch geben, andernfalls sterben wir aus.“
„Dann sind wir uns einig“, antwortete Gregor. „Wenn wir arbeitsteilig vorgehen, werden wir erfolgreich sein.“
Genda kam mit einer Pappschachtel voll Farbtuben, die er Gregor auf den Tisch stellte. Dazu sagte er: „Das sind Reste von Flumen. Wenn dir einige Töne fehlen, musst du sie dazukaufen. Eigentlich stellen wir den Studenten kein Material. Nur in Ausnahmefällen mal.“
„Wie kommt es, dass bei ihm nicht nur leere, sondern auch halb volle Tuben übrig bleiben?“ Gregor blickte ihn fragend an.
„Ganz einfach. Er stellt sie mir hin, damit ich sehe, was ich einkaufen muss. Meistens vergesse ich, ihm die angebrochenen Tuben zurückzubringen. Einzelne Farbtöne kann ich auch gebrauchen. Oder wir können sie hier verwerten. Ja, so machen wir das, damit möglichst viele was davon haben.“ Genda zwinkerte Gregor zu. „So nährt manch ein bedürftiger Student hier seine künstlerischen Bemühungen von den Farbresten, die von seines Herren Tische fallen. Aber die meisten kaufen ihre Farben selber.“ Genda deutete auf eine Tube. „Allein dieser Hersteller bietet ca. 120 Töne an. Flumen verwendet etwa vierzig.“
„Ich finde es gut, dass es hier beide gibt, nämlich diejenigen, die sich eigene Farben leisten können und die anderen, die von deinem originellen Sozialfonds profitieren.“
Eine Handvoll Studenten hatte das Gespräch der beiden mitangehört. Sie hatten ihre Staffeleien verlassen, waren zu Gregors Tisch getreten und blickten auf die Landkartenfetzen.
Einer fragte herablassend: „Ist das Malerei, oder soll es so was Ähnliches werden?“
Gregor antwortete ernsthaft: „Am Anfang steht das ungeordnete Material. Das Zusammenfügen ist eine plastische Arbeit, die ich dann, du sagtest es ganz richtig, mit Farbe in eine Art von Malerei überführe.“
„Brauchst du noch weitere Auskünfte, Bertram?“ Der Assistent Genda mochte im Atelier weder kritische noch herabsetzenden Kommentare, denn er wollte vermeiden, dass jemandem in einem zu frühen Stadium Zweifel bei seinen Versuchen kämen. – Sie hatten den Wink verstanden und wandten sich wieder ihren eigenen Arbeiten zu.
Erst gegen Ende der zweiten Woche, als Gregors Mappe schon drei übermalte Collagen oder Mischtechniken, wie manche sie nannten, enthielt, unternahm auch er einen ersten Rundgang durch den Malsaal. Die drei Anfänger arbeiteten weiterhin an Farbübungen, die Genda ihnen aufgetragen hatte. Sie bildeten eine eng zusammengedrängte Gruppe. Dann gab es die Fortgeschrittenen, die sehr selbstbewusst auftraten, indem sie beispielsweise das Anfängertrio ignorierten. Zum Erscheinungsbild der Älteren gehörte es auch, sich an größere Formate heranzuwagen. Sie malten teils auf Packpapier, teils auf Leinwand.
Bei Bertram, wo es nach Terpentin roch, blieb Gregor stehen. „Du malst mit Ölfarben – als einziger?“ Er wartete, aber der Maler schwieg. „Wo liegen die Vorteile? Gibt es auch Nachteile?“
Bertram kniff die Augen zusammen, und indem er die Lippen nur einen schmalen Spalt öffnete, antwortete er: „Gewöhn dir ab, Fragen zu stellen, die du dir selber beantworten könntest, wie die Journalisten.“ Damit wandte er sich wieder seiner Arbeit zu. In einer altmeisterlichen Technik malte er überlängt verzerrte Figuren.
Gregor blieb bei einem stehen, der in langsamen Armschwüngen einen Fächer von karminroten Bögen auf seine weiß grundierte Leinwand zog. Er hielt inne und blickte Gregor an. Mit einer knappen Kopfbewegung wies er in die Richtung von Bertram und flüsterte: „Mach dir nix draus, wenn unser Neo-Greco sich aufplustert. Warts ab! Die Zeit wird die Spreu vom Weizen trennen. In zwanzig Jahren sind wir schlauer. Ich heiße übrigens Anselmo.“
Gregor nannte seinen Namen und fragte: „Wollten deine Eltern dir etwa Feuerbach als Idol nahelegen?“
„Nein-nein! Den Namen hab ich von meinem italienischen Onkel, der mit Kunst überhaupt nichts am Hut hat“, erwiderte Anselmo, der, seiner rustikalen Aussprache nach zu urteilen, aus dem Westerwald kam. „Gehst du eigentlich nie in die Kneipe?“, fragte er.
„Gibt es einen Stammtisch der Flumen-Klasse? Wann trefft ihr euch?“, fragte Gregor zurück.
„Der Feuerstein in der Webergasse ist die Künstlerkneipe. Da trifft man jeden Tag sowohl Aka-Studenten als auch Künstler.“
„Ich hab kurz vor Semesterbeginn ein Mädel kennengelernt“, bemerkte Gregor. „Hatte deshalb keine Zeit.“
„Gut, du bist also kein Fall für Frieda. Zu Anfang war er ja ziemlich interessiert an dir. Fast jeden Neuen testet er. Sein Bildhauerfreund sollte ihm eigentlich ausreichen. Unsereins kann auch nicht mehr als eine Freundin gebrauchen. Kostet viel zu viel Zeit.“
„Eben, ich musste bei ihr zunächst heftig baggern. Aber nun läuft die Sache, und sie besucht mich schon auf meiner Bude. Sie hat auch davon gesprochen, dass ich sie mal besuchen soll, damit ihre Eltern mich kennenlernen. Aber ich möchte nicht, dass es zu eng wird.“
„Wir Künstler sind doch als potenzielle Schwiegersöhne nicht gefragt. Oder willst du auf Lehramt umsatteln?“
„Hm, vielleicht. Weiß noch nicht so recht“, kam es etwas einsilbig von Gregor.
„Ich hab mich auch noch nicht entschieden. Bin im dritten Semester. Ich nehme an, dass es sich nach sechs bis acht Semestern eher abschätzen lässt, ob man freischaffend bestehen kann“, erklärte Anselmo.
„Ist es denn nicht schwierig, so spät noch umzusteigen? Schließlich gibt es hier doch die Grundklassen für die Lehramtsleute“, warf Gregor ein.
„Die sind hier großzügig. Nur beim wissenschaftlichen Beifach an der Uni muss man dann Gas geben. Ich würde Geschichte nehmen und nebenbei noch ein bisschen Kunstgeschichte. Als Kunstlehrer braucht man das dringend.“
„Anselmo, ich glaube, ich komme heut Abend mal in die Kneipe“, kündigte Gregor an. „Vielleicht sieht man sich.“
„Ja, ich werde da sein“, versprach Anselmo.
Der untersetzte Anselmo hatte ein ausgefranstes Oberlippenbärtchen, das zwischen den runden Backen etwas verloren wirkte. Aber Gregor war er auf Anhieb sympathisch.
Ein erleuchtetes Transparent trug den Kneipennamen Zum Feuerstein. Eine großflächige Schrift zwischen den Fensterreihen des Erdgeschosses und des ersten Stocks verwies auf einen historischen Vorgänger. Da stand in verblassten Lettern Kleines Brauhaus. Allerdings wurde auch heute im Feuerstein noch selbst gebrautes Bier ausgeschenkt. Florian Schwenke hatte den vom Großvater gegründeten Betrieb nach Kriegsende vom Vater übernommen und war stolz auf seine kleine Hausbrauerei. Im engen Hinterhaus standen zwei Sudpfannen, wo er das ganze Jahr über sein Helles braute. Dem entsprechend floss auch nur helles Bier aus einem der beiden Zapfhähne auf der Theke. Nur an Weihnachten und zu besonderen Anlässen bot er seinen Gästen auch ein dunkles Festbier an. So war es üblich, dass dem Gast, der sich an einem der fünf langen Tische niedergelassen hatte, ungefragt ein halbes Helles hingestellt wurde. Denn es gab hier weder Wein noch Limonade oder Kaffee. Ohne je den Namen zu tragen, hatte das Lokal sich zur Künstlerkneipe gemausert, denn es lag nahe bei der früheren Kunstschule, aus der die heutige Kunstakademie hervorgegangen war.
In dem weiten Raum, der nahezu das gesamte Erdgeschoss einnahm, war es besonders laut, die Luft rauchgeschwängert, und es roch nach Bier. Der Tisch nahe der Theke war von älteren Gästen besetzt, ausschließlich Männern, die hier studiert hatten und dann in der Stadt hängen geblieben waren, weil der große Erfolg nicht kommen wollte, der sie in eine Großstadt gelockt hätte. An den übrigen Tischen saß der künstlerische Nachwuchs, Studenten der Akademie, unter denen nur ausnahmsweise Mädchen waren. Ihnen gesellten sich auch ab und an ein paar neugierige Touristen zu, die glaubten, hier etwas vom Flair der Boheme schnuppern zu können. Doch waren sie nur willkommen, wenn sie nicht vergessen hatten, ihre Spendierhosen anzuziehen.
Im Eingang erschien ein neues Gesicht, ein Student, der bisher hier noch nicht gesichtet worden war. Er schien zu überlegen, zu welcher Gruppe er sich setzen sollte. Jetzt nahm er seine Brille ab und wischte über die Gläser.
„Ist das nicht der Neue, den der Flumen ohne Prüfung aufgenommen hat?“ Sie steckten ihre Köpfe zusammen. Bertram zischte durch die Zähne: „Möchte wissen, was Flumen an den blöden Collagen findet. Kann mir nichts anderes vorstellen, als dass da eine heftige Dosis Vitamin B mitgeholfen hat. Aber ich bin mir sicher, dass wir das heute Abend noch rauskriegen.“
„Auch Frieda kümmert sich besonders um ihn, obwohl der Neue sich überhaupt nicht interessiert gezeigt hat“, ergänzte ein anderer seine Beobachtungen. „Er soll sich an die Tochter vom Metzger Schwarting rangemacht haben. Aber Frieda scheint das nicht zu stören, denn er scharwenzelt ständig um ihn herum.“
„Er genießt ja auch insofern eine Sonderbehandlung, als er die einführenden Farbübungen nicht mitmachen muss. Anselm, du hast dich doch heute länger mit ihm unterhalten. Hast du was rausbekommen?“
„Ich finde, dass er eigentlich ein ganz dufter Typ ist. Aber das hat nicht viel zu sagen. Wenn ihr einen bestimmten Verdacht habt, könnt ihr ja versuchen, ihn ein bisschen auszuquetschen. Hier beim Bier geht das besser als im Atelier.“
„Gut Anselm“, sagte Bertram. „Wenn du ihn hier zu uns holst, ist das ganz unverfänglich. Mach mal!“
Anselmo erhob sich und winkte Gregor zu, der zögernd auf den Tisch zusteuerte. „Jetzt macht mal Platz neben mir“, forderte er.
„Hallo, grüß euch. Ihr seid alle an der Aka?“, fragte der Neue. „Aber aus verschiedenen Klassen, nehme ich an.“
„Heute sind wir an diesem Tisch ausnahmsweise nur Maler“, klärte Anselmo ihn auf.
„Und da nebenan“, erkundigte sich Gregor. „Sind das ausschließlich Bildhauer?“
„Ach nein, man sondert sich hier nicht ab“, sagte Anselmo. „Wir kennen uns ja alle. Nebenan sitzen Maler und Bildhauer, weißt du, wie es sich gerade ergibt. Du wirst sie alle noch kennenlernen. Nur da vorne an der Theke, die nennen wir die Altmeister. Eigentlich sind es die Sitzengebliebenen der früheren Kunstschule. Mit denen findet man keinen Kontakt, denn sie wissen alles besser und sind davon überzeugt, dass wir nicht malen können.“
„Damit haben sie doch recht“, brummte Bertram. „Wer kann denn hier malen? Wer?“
„Außer dir vermutlich niemand“, sagte Anselmo, wobei er einen ironischen Unterton vermied.
Bertram stellte eine These in den Raum: „Anscheinend hat Flumen einen neuen Begriff von Malerei ausgerufen: Collage als eine Form von Malerei.“ Er blickte Gregor fragend an.
„Wenn ich ihn recht verstehe, denkt er an einen erweiterten Begriff von Malerei, nicht an einen revidierten oder gar neuen“, mutmaßte Gregor.
„Du kennst ihn näher, kanntest ihn schon, bevor du dich beworben hast?“ Vom anderen Ende des Tisches hatte sich jemand mit dieser Frage gemeldet.
„Ich kannte den Namen nicht, als ich meine Mappe im Sekretariat abgeben wollte“, sagte Gregor. „Ich kannte überhaupt keine Namen. Wollte mich erkundigen, mir Werke der einzelnen Professoren ansehen und mir dann einen aussuchen, der mir am meisten zusagte. Bei dem wollte ich mich bewerben.“
Dröhnendes Gelächter brandete auf. „Die Unschuld vom Lande!, rief einer. „Glaubt doch tatsächlich, er könnte sich seinen Professor aussuchen! Hat es das je gegeben?“
Er musste mit seinen Vorstellungen ziemlich weitab von der Realität gelegen haben. Immerhin hatte er sogar Bertram zum Lachen gebracht. Noch ein wenig kichernd fragte dieser: „Und wie gings dann weiter? Wie kam es, dass Flumen dich ohne Prüfung genommen hat?“
„Ich war mit meiner Mappe eine Woche zu früh gekommen. Die Akademie war wie ausgestorben. Als ich im Sekretariat meine Personalien in den Bewerbungsbogen eintrug, kam Flumen herein, um sich von Frau Müller einen Kaffee machen zu lassen. Da er ein paar Minuten warten musste, öffnete er meine Mappe und blätterte sie durch. Während er dann an Frau Müllers Schreibtisch seinen Kaffee trank, tuschelte er mit ihr. Als er dann weg war, erfuhr ich von der Sekretärin, dass ich in seine Klasse aufgenommen war. Ja, das war alles. Ziemlich banal, und bei mir entsteht allmählich der Eindruck, dass das einige von euch ziemlich irritiert hat.“
„Ist ja auch ein starkes Stück“, murrte Bertram. „Entweder es machen alle Bewerber eine Prüfung, oder die Herren suchen sich gleich ihre Lieblinge nach den Mappen aus.“
„Ja, anscheinend gibt es wohl beide Wege. Ich war darüber nicht informiert. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass ich bei der Aufnahmeprüfung durchfalle“, sagte Gregor.
„Aber dann hast du dich doch sicher gefreut, als es bei dir so glatt gelaufen war“, sagte Anselmo.
„Zunächst ja, aber dann kamen mir Zweifel und ich befürchtete, dass ich, ohne von meiner Seite etwas dazu getan zu haben, unversehens in die Rolle eines vermeintlichen Vorzugsschülers geraten bin“, bekannte Gregor.
„Aber diese Rolle hast du jetzt. Daran kannst du nichts mehr ändern.“ Bertram hatte sein Kinn vorgeschoben und blickte Gregor mit verbissener Miene an.
„Wenn ich mich selber um einen Vorteil bemüht hätte, müsste ich ein schlechtes Gewissen haben. Aber so werde ich zusehen, diese Vermutungen, die einige von euch geäußert haben, einfach zu ignorieren.“ Erst jetzt sah Gregor, dass ein Bier vor ihm stand. Er hob das Glas an, prostete nach allen Seiten und trank genussvoll.
„Dann hat Flumen für dich entschieden, dass du freie Malerei studierst. Niemand hat dich gefragt, ob du dich für Bildhauerei oder Kunsterziehung entscheiden willst. War dir das denn so recht, oder hättest du, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, anders entschieden?“ Die Frage kam von einem bulligen Pfeifenraucher. Anselmo flüsterte Gregor zu: „Das ist Leo, der macht auf Lehramt.“
Gregor antwortete kurz: „Etwa bei Halbzeit werde ich entscheiden, wie es weitergeht.“
Leo blickte ihn mit seinen gutmütigen Augen an, hob für einen Moment seinen dicken Zeigefinger und verkündete seine Einsicht: „Es ist doch bekannt, dass grade mal ein Promille aller Künstler von seiner Arbeit leben kann. Und nicht auf jeden wartet eine begüterte Frau. Als Kunstlehrer beschäftigst du dich tagtäglich mit deiner Materie, ja, du arbeitest mit dem jungen Volk ernsthaft künstlerisch, kannst mit ihnen gestalten und experimentieren, und du erfreust dich an ihren kleinen Fortschritten. Du musst keine Klassenarbeiten korrigieren, und es steht dir ein komfortabler Materialfundus zur Verfügung. Zum Malen hast du nachmittags und in den langen Ferien Zeit. Ich sehe hier die ideale Kombination der künstlerischen Arbeit mit einem anspruchsvollen und dennoch recht angenehmen und ordentlich bezahlten Broterwerb.“
Ein spindeldürrer und schon fast kahlköpfiger Endzwanziger fühlte sich zum Widerspruch herausgefordert und verkündete mit gereizter Stimme: „Wer sich nichts zutraut in der Kunst, wer nicht das ganze Gewicht seiner Person auf die Kunstwaage wirft, der soll doch Beamter werden, den ungezogenen Pennälern die Ohren lang ziehen, mit fünfundsechzig in Pension gehen und dann mit seinem Spazierstöckchen durch die Straßen flanieren.“
Anselmo flüsterte Gregor zu: „Das ist Victór aus Ecksteins Klasse, ein Idealist und Eiferer für die reine Lehre. Der wird bestimmt mal Professor.“
Die widersprüchlichen Perspektiven hatten den meisten die Lust an der Diskussion vertrieben. Sie sprachen dem ungefilterten Gerstensaft zu und unterhielten sich nur noch mit gedämpften Stimmen. Gregor hatte den Eindruck, fürs erste der Schusslinie seiner Kritiker entkommen zu sein.
Mitte Dezember war die Hälfte des Semesters vergangen, als Flumen zum ersten Mal im Malsaal gesichtet wurde. Gregor hatte die Hoffnung schon aufgegeben, ihn überhaupt noch einmal zu sehen, geschweige denn mit ihm zu sprechen. Frieder hatte zuvor alle aufgefordert, sämtliche in diesem Semester entstandenen Arbeiten auf dem Boden auszubreiten oder an die Wände zu stellen. Der Chef mit seinem Assistenten im Schlepptau wandelte zwischen den Staffeleien umher. Nur für Genda hörbar, brummte Flumen seine Kommentare. Das war nicht die übliche Korrektur, bei der man Kritik oder Anregungen für die Weiterarbeit bekam. Bei den drei Anfängern drang ein Satz durch, nämlich: „Von jedem nur eins. Das entscheidest du.“ Vor den von Gregor auf seinem Tisch ausgebreiteten sechs Blättern sagte er: „Drei bis vier, je nach dem, was der Raum hergibt.“
Dann wandte er sich überraschenderweise direkt an Gregor: „Was treibst du eigentlich so oft im Sekretariat? Ich meine: Wo hast du das gelernt?“
„Nebenbei während meiner Schulzeit“, antwortete Gregor. „Das hat mir hier den kleinen Job als Hilfskraft eingebracht.“
Mit gedämpfter Stimme kam Flumens Aufforderung: „Komm mal in mein Atelier. Ich muss mit dir was bereden.“