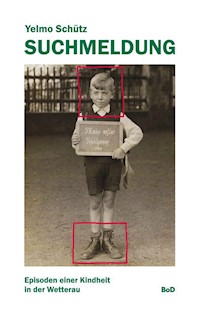
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein turbulentes Jahrzehnt der deutschen Geschichte, begrenzt auf den engen Horizont eines kleinen Dorfes in der Wetterau und aus der Perspektive eines Kindes. Es sind die letzten drei Kriegsjahre, die Wirren der Nachkriegszeit mit Mangelwirtschaft, Not und Schwarzmarkt und die Jahre des Aufschwungs nach der Währungsreform. Aus Gregors Blickwinkel entwickelt sich ein Bild, das in völligem Gegensatz zu dem steht, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Gregor findet nichts Schlimmes am Krieg, und er genießt die schier unermesslichen Freiräume, die sich für Kinder auf dem Land eröffnen. Mit mäßigem Erfolg versucht er, der väterlichen Strenge zu entkommen, und die Schule erlebt er nur als ein notwendiges Übel auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Als ihn jedoch ein Jahr vor Abschluss der Volksschulzeit sein Klassenlehrer dazu überredet, noch zum Gymnasium überzuwechseln, beginnt der Boden unter ihm zu wanken. Über all die Jahre hatte er immer wieder einmal mit dem Gedanken gespielt, aus der dörflichen Enge auszubrechen. Doch als er die geöffnete Tür vor sich sieht, möchte er am liebsten in der vertrauten Umgebung bleiben. Doch der Sog des Unbekannten ist stärker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ein turbulentes Jahrzehnt der deutschen Geschichte, begrenzt auf den engen Horizont eines kleinen Dorfes in der Wetterau und aus der Perspektive eines Kindes – es sind die letzten drei Kriegsjahre, die Wirren der Nachkriegszeit mit Mangelwirtschaft, Not und Schwarzmarkt und die Jahre des Aufschwungs nach der Währungsreform. Aus Gregors Blickwinkel entwickelt sich ein Bild, das in völligem Gegensatz zu dem steht, was wir aus den Geschichtsbüchern kennen. Gregor findet nichts Schlimmes am Krieg, und er genießt die schier unermesslichen Freiräume, die sich für Kinder auf dem Land eröffnen. Mit mäßigem Erfolg versucht er, der väterlichen Strenge zu entkommen, und die Schule erlebt er nur als ein notwendiges Übel auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Als ihn jedoch ein Jahr vor Abschluss der Volksschulzeit sein Klassenlehrer dazu überredet, noch zum Gymnasium überzuwechseln, beginnt der Boden unter ihm zu wanken. Über all die Jahre hatte er immer wieder einmal mit dem Gedanken gespielt, aus der dörflichen Enge auszubrechen. Doch als er die geöffnete Tür vor sich sieht, möchte er am liebsten in der vertrauten Umgebung bleiben. Doch der Sog des Unbekannten ist stärker.
Yelmo Schütz verbrachte seine Kindheit und Jugend in der Wetterau. Nach seiner Emeritierung als Kunstwissenschaftler wandte er sich der Belletristik zu. Er lebt in Karlsruhe.
Dem pädagogischen Wirken des Lehrers Fritz Sandmann gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Kapitel Erstens
Kapitel Zweitens
Kapitel Drittens
Kapitel Viertens
Kapitel Fünftens
Kapitel Sechstens
Kapitel Siebtens
ERSTENS
Erstes Gespräch des Autors mit Gregor
Erinnerungen sind wie Inseln, die im breiten Strom der Zeit wie verloren zu schwimmen scheinen. Es gibt keine Verbindungen zwischen ihnen, und selbst die Abstände lassen sich kaum ermessen. Vor allem der Anfang ist nicht als ein gesicherter Punkt auszumachen, weshalb das Bild vom Fluss natürlich hinkt. Denn jeder Bach hat eine Quelle, die allerdings nicht der Anfang des Wassers ist. Insofern könnte man den Vergleich doch gelten lassen – Unklarheiten auf beiden Seiten.
Fragte man Gregor Schulze nach seiner Kindheit, antwortete er ausweichend.
Wozu darüber reden, meinte er. Ja, es war eigentlich eine gute Zeit, zu Anfang, die Kriegszeit. Für mich jedenfalls. Vielleicht nicht für Stadtkinder. Die Schule – mit wenigen Ausnahmen eine durchgängig unangenehme, bedrückende Situation mit all den ehemaligen Nazilehrern. Das wirkliche Leben gab es nur beim freien, beim wilden Spielen – außerhalb der Schule und auch außerhalb der Familie. Wir haben nicht für das Leben, sondern für die Schule, für die Lehrer gelernt. Äußerst selten gab es Momente, in denen ein Lehrer mal eine Idee, eine Initiative aufgegriffen hätte. Nein, Vorschläge von Schülern – das gab es damals überhaupt nicht. Das war nicht erwünscht. Hier sah ich keine Chance, meine persönliche Weiterentwicklung voranzutreiben. Wirklich fruchtbare Momente gab es kaum in der Schule, und sie waren auch in der Familie recht selten. Sie ergaben sich, wenn ich mit anderen Kindern, mit Freunden zusammen war. – Ich glaube, du täuschst dich, wenn du in meiner Biografie etwas Interessantes, etwas Spannendes oder gar Spektakuläres suchst. Ich kenne mich aus in meiner Geschichte und kann dir versichern, dass alles ziemlich banal ist. Kaum der Rede wert.
Wie weit er sich zurückerinnere, mit welchem Alter seine Erinnerungen beginnen?
Mit vier fing es an, vielleicht auch ein paar Monate früher, erwiderte er. Aber das sind nur ein paar Episoden, sehr unscharf wie im Nebel. Die ersten Erinnerungen und die ersten Träume vermischen sich miteinander. Heute kann ich nicht mehr unterscheiden, was da anfangs wirklich und was geträumt war.
Irgendwann begann er dann doch, über die eine oder andere Begebenheit zu sprechen, wobei nie ganz klar war, ob er von authentischen Erinnerungen sprach, oder ob er sich vielleicht auf Erzählungen anderer, der Eltern oder der Brüder bezog.
Er sinnierte: Es ist doch äußerst verdächtig, dass viele frühe Erinnerungen bei mir schwarz-weiß sind. Vermutlich verdankt sich vieles den kleinen Bildchen in den Fotoalben und weniger tatsächlich erinnerten Erlebnissen.
Da ihm die Fragwürdigkeit von Erinnerungen im Allgemeinen und seiner persönlichen Erinnerungen im Besonderen bewusst war, sperrte er sich dagegen, selber etwas aufzuschreiben. Er war von nichts mehr überzeugt als von der Korrumpierbarkeit seines Gedächtnisses, und er wunderte sich zunehmend darüber, dass seine Urteile über sein eigenes Handeln in der Vergangenheit einem dauernden Wandel unterworfen waren. Nicht anders erginge es ihm bei der Einschätzung anderer Personen, vor allem der ihm nahestehenden, seiner Eltern und seiner beiden Brüder.
Ungefähr zwei Jahrzehnte bin ich nun im Ruhestand, sagte er. Seitdem habe ich kaum etwas anderes getan, als immer wieder diese alten Filme vor meinem geistigen Auge ablaufen zu lassen. Auch diese wandelten sich ständig. Bedauerlicherweise kann ich sie nicht aufzeichnen, sonst würde ich sie archivieren und zusammenschneiden, damit eine attraktive Geschichte daraus würde. So aber muss ich es bei diesem inneren Kino belassen, das einzig und allein für mich zugänglich ist.
Kurios sei bei diesem seinem Selbstunterhaltungsprogramm, dass die einzelnen Ereignisse oder Filme, wie er sie lieber nenne, im Laufe der Zeit immer länger würden und zugleich auch immer mehr in die Breite gingen und sich unübersichtlich verzweigten. Er gewinne den Eindruck, dass die Filmerzählung sich verselbstständige und sich in einer unverantwortlichen Art und Weise von den Tatsachen entferne, als ginge es gar nicht mehr um die Wahrheit, sondern nur um die Erzählung; als erzähle nicht er seine Geschichten, sondern diese erzählten sich selber. Er halte das für eine äußerst bedenkliche Entwicklung, sehe aber, dass sie sich nicht aufhalten lasse, sodass die Zeit nicht ferne sei, zu der auch für ihn die Tatsachen nicht mehr im Vordergrund stünden, sondern nur noch die Erzählung. Vielleicht sei das eine normale Tendenz im Alter, die möglicherweise irgendwann sogar unmerklich in die Demenz hinübergleite. Jedenfalls habe er sich in seiner beruflichen Arbeit derlei Leichtfertigkeiten nicht gestattet.
Verdrängte Anfänge
Der kleine Gregor war gerade einmal zwei Jahre alt, als sein Vater Heinrich Schulze zur Wehrmacht einberufen wurde. Natürlich konnte er sich später weder an jenes einschneidende Ereignis, geschweige denn an die Zeit zuvor erinnern, als der Vater noch arbeiten ging, regelmäßig abends nach Hause kam und sonntags für die Familie da war. Dass es diese Zeit jedoch gab, dass der kleine Gregor hier schon vorkam – als kleiner weinender Nackedei auf dem Küchentisch, auf wackeligen Beinchen in einer Blumenwiese, beim Sonntagsspaziergang mal auf Mamas, mal auf Papas Arm – das beweisen die Fotos, die Tante Karin aus Frankfurt und der um zwölf Jahre ältere Bruder Friedrich aufgenommen hatten. Aber die letzten drei Kriegsjahre sind ihm bis ins Alter noch in lebhafter und insgesamt auch durchaus nicht unangenehmer Erinnerung geblieben.
Einmal sagte er sogar: Die Kriegsjahre waren meine beste Zeit.
Dann meinte er jenen Satz doch einschränken zu müssen: Natürlich gibt es an einem Krieg nichts Gutes. Aber für mich als Kind waren das gute Jahre.
Gregor wurde oft als ein stilles, ein bedächtiges Kind wahrgenommen, das überraschenderweise bisweilen ein starkes Temperament entwickeln konnte. Er ließ sich nicht allzu schnell begeistern, vielmehr entsprach es eher seiner Sicht auf die Welt, den Blick mit einer grundsätzlichen Skepsis auf die Dinge, die Menschen und die Ereignisse zu richten. Auch angesichts eines besonders schönen Geschenks oder eines feierlichen Moments wurde er nachdenklich, weil er immer einen winzigen Mangel entdeckte und nie das absolut Schöne, das Vollkommene oder das Überwältigende fand. Seine Einbildungskraft war so stark, dass er die schönsten Dinge, das größte Glück durch seine Fantasie meinte erschaffen zu müssen.
Gregor muss noch recht klein gewesen sein, als er einmal an einer Bastelarbeit des acht Jahre älteren Bruders Wotan mitwirken wollte. Wotan, der ein begabter Bastler war, hatte aus Sperrholz ein kleines Schienenfahrzeug gebaut. Gregor sah die Lore, daneben Nägel und einen Hammer. Er klopfte sämtliche Nägel in das kleine Wägelchen, und das Resultat wird ihm wohl gefallen haben. Als Wotan hinzukam, war er gar nicht begeistert. Wütend ergriff er einen Stock und schlug seinen Zorn aus sich heraus und in Gregors Rücken hinein. Die herbeigeeilte Mutter versuchte, dem Wüterich Einhalt zu gebieten. Doch da sie nicht handgreiflich einschritt, sondern nur um Gnade bettelte und zeterte, lebte Wotan seinen Zorn aus. Gregor konnte sich später nicht daran erinnern, und die Mutter erzählte ihm, es sei ein heißer Sommertag gewesen, er habe nur eine dünne Spielhose angehabt und sein ganzer Rücken sei mit roten und blauen Striemen bedeckt gewesen. Er habe ihr sehr leidgetan.
Aber sonderbar – ziemlich sonderbar! Obwohl die Mutter ihm die Geschichte mehrfach und äußerst lebendig wiedergegeben hatte, mochte Gregor seinem Bruder das brutale Verhalten nicht übelnehmen oder nachtragen. Da er sich nicht erinnern konnte, nahm er Mutters Erzählung vielleicht nicht anders auf als die Märchen der Brüder Grimm, die ja fast alle jenes Erlebnis an Grausamkeit übertrafen. Jedoch schien nach jenem Vorfall Gregors Erinnerung einzusetzen. Er beobachtete ein ums andere Mal Wotans Basteleien und bewunderte ihn vorbehaltlos.
Und dann gab es da noch den Bruder Friedrich. Gregors erste Erinnerung an ihn muss eine sehr frühe gewesen sein, denn sie hatte sich in Form einer Momentaufnahme oder eines nur wenige Sekunden langen Films in sein Gedächtnis eingegraben. Gregor sitzt auf Friedrichs Schultern, sehr, sehr hoch aber dennoch fest und sicher. Der Bruder trägt einen hellen Anzug, vielleicht beige-braun-grau gesprenkelt. Es ist Sonntag. Friedrich geht auf dem wenig befahrenen und beinahe zugewachsenen Feldweg hinter dem Garten der Familie Schulze. Die Wiesen, die mit Apfel-, Birn- und Zwetschgenbäumen bestanden sind, breiten sich ringsum in einem saftigen Grün aus, und es gibt viele weiße und gelbe Blumen. Friedrich spricht mit Gregor, er singt ein Lied, er pfeift eine Melodie. Der kleine Bruder erlebt einen Glücksmoment, ein Hochgefühl, wie er es auf den Schultern des Vaters nie in diesem absoluten und uneingeschränkten Umfang wiedergefunden hat. Der stille Friedrich hat über all die Jahre Gregor nie geschimpft geschweige denn bestraft. Unter all den Erwachsenen, mit denen Gregor auch später zu tun hatte, die Nachbarn, die Kindergärtnerinnen, die Lehrer und der Pfarrer, war und blieb der große Bruder der einzige Mensch, von dem er sich angenommen fühlte und den er dafür liebte.
Frühe Träume
Unzählige Male hatte Gregor während des Krieges und danach den Traum vom eigenen Fahrrad geträumt. Zunächst war es ein Tagtraum, der ihn über Monate verfolgte, bis dann in einer Nacht dieser dringende Wunsch Wirklichkeit zu werden schien. Mit seinem Freund Heinz, der im Haus der Freytags gegenüber wohnte, war er durch Wiesen und Felder gelaufen. Die beiden hatten sich darüber unterhalten, dass sie vielleicht hundert Mark fänden, als sie plötzlich auf dem Feldweg zwei bunte Kinderräder liegen sahen. So ein Fund! Gregor nahm das rote und Heinz das blaue. Sie schwangen sich auf die Sättel und sausten los – eigentlich flogen sie über die Feldwege bis ins Dorf, danach durch die Gassen bis nach Hause. Das Ganze vollzog sich völlig lautlos und ohne jegliche Anstrengung, sodass Gregor das Fahren eher als ein Fliegen erlebte.
Ja, es hatte damals in Unter-Warstein schon das eine oder andere Kinderrad gegeben. In seinem eigenen Alter kannte Gregor den hellblonden Freddi aus der Siedlung mit seinem klobigen schwarzen Rad mit aus Buchenholz gedrechselten Griffen an einem hohen Gesundheitslenker. Doch an dem mühelosen Gleiten oder Fliegen des roten oder blauen kleinen Rades hatte sich danach ein jedes Rad zu messen, aber keines konnte dem Vergleich standhalten, kein einziges.
Gregor hatte noch andere Träume geträumt, die sich in der Kindheit mehrfach wiederholten. Er rannte über eine Wiese, stieß sich vom Boden ab und glitt in ein oder zwei Metern Höhe durch die Luft. Dabei hielt er den Körper lang gestreckt und die Arme, mit denen er seinen Flug steuerte, ausgebreitet. Kam er dem Boden zu nahe, stieß er sich mit einem Fuß kräftig ab, um danach wieder Höhe zu gewinnen. Im Gegensatz zu diesen Träumen der Leichtigkeit gab es auch Träume der Schwere, die immer mit einer Verfolgung verbunden waren. Jemand, ein Bösewicht oder ein Feind, verfolgte Gregor. Zunächst rannte er schnell über eine Wiese, dann wurden seine Füße schwer wie Blei, und er konnte sie kaum vom Boden lösen. Je näher der Verfolger kam, umso mehr wuchs die Schwere in den Füßen und zugleich die Angst. Dann, in allerletzter Sekunde vor der Katastrophe erwachte er mit einem Schreckensschrei – er war gerettet.
Schließlich gab es noch die Träume von Höhe und Tiefe, die sich bisweilen nicht voneinander unterscheiden ließen. Oft begann es damit, dass er in die Höhe schoss, schneller und immer schneller wie eine Rakete. Dann nahm er sich selber nicht mehr wahr, denn er selbst war die rasende Geschwindigkeit und die riesige Höhe in Gestalt eines spitzen Kegels, der wuchs und wuchs. Dieser Kegel war immateriell mit einer Oberfläche, die in Farbtönen zwischen Karminrot, Violett und Ultramarinblau ringförmig changierte. Irgendwann verlangsamte sich die Geschwindigkeit, und noch bevor sie zum Stillstand kam, stülpte sich der Kegel um in einen riesigen Trichter. Gregors Körper war winzig klein und stürzte mit rasender Geschwindigkeit in die Tiefe. Der Trichter war so unermesslich groß und Gregor so winzig, dass er zeitweise gar nicht unterscheiden konnte, ob er wirklich hinunterfiel oder doch nur schwebte, während der Trichter sich ständig rotierend ausdehnte. Auch diese Träume endeten immer mit dem erschreckten Aufwachen vor der drohenden Katastrophe.
Vom Einkaufen und der Posnerin
Eigentlich wünschte sich Gregor, dass die Mutter ab und zu mit ihm spiele. Aber sie musste immer etwas arbeiten: Kochen, spülen, waschen, bügeln, das Vieh füttern, im Garten umgraben, jäten oder ernten, einkaufen und viele unnötige Tätigkeiten verrichten, wie er meinte. Gewiss, sie hatte viel zu tun, aber ein wenig Zeit hätte sie schon mal erübrigen können. Gregor dachte: Sie will gar nicht mit mir spielen, oder sie kann gar nicht spielen. Fragte er sie, was sie als Kind gespielt hätte, blickte sie ihn traurig an und konnte kaum etwas erzählen. Da sie von sieben Kindern die Älteste war, hatte sie schon früh helfen müssen.
Anfangs hatte die Mutter Gregor zum Einkaufen mitgenommen – zum Bäcker Wegener, zum Metzger Fuchs und in den Kolonialwarenladen von Frau Posner. Beim Wegener ging es schnell, denn sie kauften selten mehr als einen runden Dreipfünder. Mussten sie etwas warten, schaute Gregor vom Laden aus durch die offene Tür in die große Backstube, wo er Herrn Wegener mit seinen beiden Gesellen bei der Arbeit beobachten konnte. Den Duft von frisch gebackenem Brot fand Gregor betörend. Gern begleitete er seine Mutter zum Metzger Fuchs, weil er dort meistens eine schmale Scheibe Wurst geschenkt bekam. Auch beobachtete er gespannt, wie Frau Fuchs mit unterschiedlichen Messern die Wurst schnitt und wie Herr Fuchs mit seinen großen Händen einen Fleischklumpen packte, ohne dass ihn das Blut gestört hätte, wie er es schnitt und mit dem doppelschneidigen Beil die Knochen zerhackte. All das verfolgte Gregor mit Interesse. Doch hätte er sich nie vorstellen können, selber einmal Metzger zu werden.
Bei der Posnerin, wie sie von allen genannt wurde, ging es immer lebhaft zu. Die Mutter hatte Gregor erzählt, dass Frau Posner Schauspielerin gewesen war, bevor sie den Schöngeist Willi Posner geheiratet hatte. Seitdem war der Lebensmittelladen ihre Bühne. Mit ihrer Stimme beherrschte sie das kleine Ladenlokal, begrüßte jeden neu eintretenden Kunden lautstark und unterhielt sich mal mit dieser, mal mit jener Kundin, wobei sie davon ausging, dass jedes abgehandelte Thema für jeden von demselben Interesse wäre. Selbst das Addieren der Teilbeträge, das Bekanntmachen der Endsumme sowie alle Schritte der Bargeldabrechnung erklangen laut und deutlich durch den ganzen Laden. In dem Kolonialwarenladen blickte Gregor ständig auf den Mund von Frau Posner, denn ihre beiden mittleren oberen Schneidezähne waren besonders lang, ständig in Bewegung und ruhten sich nur ab und zu für ein paar Sekunden vor der Unterlippe aus. Dann dachte Gregor: Was sind das für Zähne! Habe ich etwas Ähnliches nicht schon einmal im Zoo gesehen? Aber Frau Posner sprach über alles, nur nicht über ihre riesigen Zähne.
Bald schickte die Mutter Gregor zu kleinen Besorgungen. Das begann mit dem Brotkauf. Auf dem Rückweg wurde der Brotlaib nach einer weichen Kruste abgesucht, wo das Brot beim Backen mit einem anderen Laib zusammengewachsen war. Hier konnte Gregor völlig unauffällig kleine Fetzen abreißen, ohne dass der Mutter das aufgefallen wäre. Sowohl für den Metzger Fuchs als auch für den Kolonialwarenladen bekam er eine kleine Einkaufsliste mit. Zur Posnerin ging er überhaupt nicht gerne, denn Kinder wurden, wenn der Laden voll war, leicht übersehen. Oft kam es vor, dass eine Hausfrau hereinkam und, noch in der offenen Tür stehend, über alle Köpfe hinwegrief, dass sie nur schnell ein halbes Pfund Zucker brauche. Darüber konnte Gregor sich maßlos ärgern.
Böse Wörter
Zu Hause wurde anders gesprochen als draußen. Das musste Gregor schon früh lernen, und in diesem Punkt war die Mutter sehr streng.
Die Kinder hatten gegen Mittag vor dem Haus gespielt, als es zu regnen anfing. Bruna rief: Scheißwetter! Ich geh haam. Es gibt sowieso gleich Esse.
Also lief auch Gregor ins Haus, obwohl die Mutter ihn noch nicht gerufen hatte. Und im Flur rief er: Scheißwetter!
Komm mol her!, kam es aus der Küche. Was hab ich denn äwe geheert?
Die Bruna hat das aach gesagt. Es hat nämlich oogefange zu …
Weiter kam er nicht, denn da traf ihn eine schallende Ohrfeige. Die Mutter machte ein strenges Gesicht, hob den Zeigefinger drohend in die Höhe und sagte: Das is e bees Wort. Das will ich nie wieder heern von dir. Hast du mich verstanne?
Gregor nickte und versuchte vergebens, seine Tränen zu unterdrücken. Aber seine linke Backe brannte furchtbar.
Natürlich hatte er schon mehr als einmal gehört, dass Wotan, wenn ihm bei einer Bastelei etwas misslungen war, Scheiße rief. Allerdings nie in Anwesenheit der Mutter. Das hatte Gregor gefallen, und er hatte schon auf eine Gelegenheit gewartet, um es auch einmal zu versuchen. Scheißwetter, so dachte er, ist nicht ganz so schlimm wie Scheiße. Nun war ihm klar, dass zwischen den beiden Ausdrücken offenbar kein wesentlicher Unterschied bestand. Beide sind für die Mutter böse Wörter. Er hätte es nicht gewagt, mit ihr darüber zu diskutieren. Und sie hatte ihn sofort sozusagen exemplarisch bestraft und erst nachträglich eine Erklärung abgegeben. Nun musste er sehr vorsichtig sein mit Wörtern, die nicht ganz stubenrein waren.
Jeden Tag hörte er draußen neue Kraftausdrücke, und es reizte ihn ungemein, der Mutter mitzuteilen, dass auch er sie kannte. Dabei musste er allerdings eine List anwenden, um straffrei auszugehen. Er durfte nur über böse Wörter berichten, sie sozusagen zitieren ohne sie selbst zu gebrauchen. Er kam also nach Hause und sagte: Mama, der Rudi hat gesagt: Der Helme is e saudumm Arschloch. Gell, Mama, das is e bees Wort? Das dirf man net sage.
Die Mutter runzelte die Stirn und warf einen giftigen Blick auf diesen kleinen Tunichtgut. War er wirklich so naiv, oder hatte er sie ausgetrickst?
Natürlich! Zwaa beese Wörter sin das. Man muss net alles noochschwätze. Mit dem Rudi musst du dich aach gar net abgäwe.
Dieses Spiel übte Gregor eine ganze Weile, bis er die Mutter mit seinem erweiterten Vokabular bekannt gemacht hatte. Sie reagierte jedes Mal verärgert, allerdings schimpfte sie nur über die ungezogenen Kinder. Gregor dachte zunächst, die bösen Wörter bezögen sich ausschließlich auf die Genitalien und die Ausscheidungen. Deshalb erkundigte er sich vorsichtshalber: Is eigentlich Drecksau aach e bees Wort?
Jetzt reicht’s awer endgiltig! Heer endlich uff, mir jeden Tag neue beese Werter zu bringe. Sonst muss ich dir mol die Hos strammziehe.
Gregor wusste jetzt Bescheid, sodass er sich bemühte, in zwei Sprachen zu kommunizieren: zu Hause brav und angepasst, wie es von ihm erwartet wurde und draußen möglichst derb und odrinär, wie es unter den Gassenkindern der Brauch war.
Jetzt kann mir nichts mehr passieren, dachte er. Doch dann tappte er doch noch einmal in eine Falle, zumal eine solche, die er sich selber gestellt hatte.
Mutters schönes Sonntagskleid war einfarbig ultramarinblau, enganliegend, sodass es ihre damals schlanke Figur – sie war Anfang vierzig – gut zur Geltung brachte. Gregor sah sie gern in dieser Robe, allerdings störte ihn ein kleines Detail. Das war der weiße Kragen. Der war glatt und besaß als außergewöhnlichen Akzent an jedem Ende eine doppelte Ecke. Jedes Mal, wenn Gregor seine Mutter ansah, wurde sein Blick von diesem Doppelspitzenpaar angezogen, denn es erinnerte ihn an die Euter von Ziegen. Für die Schneiderin müsste es doch eine Kleinigkeit sein, dachte er, diesen Kragen zu ändern. Irgendwie: einfache Ecken oder runde Abschlüsse, aber nicht diese Memmen. Irgendwann musste er ihr das sagen, und dann könnte sie bei nächster Gelegenheit der Schneiderin den Auftrag erteilen.
Sie wollten zu einem Sonntagsspaziergang aufbrechen, hatten im Wohnzimmer ihre schönen Sachen angezogen. Da – wieder dieser Kragen. Jetzt muss es raus! Gregor stellte sich vor seine Mutter, blickte zu ihr auf und sagte: Der Memmekrage gefällt mir gar net.
Was? – Die Mutter trat einen Schritt zurück und blickte Gregor empört an.
Sie holte aus, und ihre flache Hand landete mit einer lauten Klatsche auf Gregors Wange. – Das hatte Gregor nicht geahnt, dass auch Memme ein böses Wort ist.
Allein zu Hause
Es kam eine Zeit, da mochte Gregor seine Mutter nicht mehr begleiten, wenn sie wegen größerer Einkäufe ins Dorf ging. Dann blieb er allein zu Hause, spielte entweder ruhig für sich weiter, oder er suchte nach geheimnisvollen Dingen, die eigentlich nicht für ihn bestimmt waren.
Er stand am Küchenfenster und wartete, bis die Mutter das Hoftor hinter sich zugeschlagen hatte, den Platz vor dem Haus überquerte, um die Gassenecke bog und aus seinem Gesichtsfeld verschwunden war. Nun gehörte die Küche ihm, und er konnte sich den Küchenschrank einmal genauer ansehen. Das hatte er auch schon einmal in Gegenwart der Mutter versucht, die ihn jedoch sofort zurückgepfiffen hatte mit: Da sin kaa Spielsache. Lass de Kücheschrank zu!
Von da an reizte ihn dieser Schrank, und immer, wenn die Mutter eine der oberen Türen öffnete, schaute er genau hin und überlegte, ob diese Dinge wohl für ihn interessant sein könnten. Den Brotkasten und die Schubladen in mittlerer Höhe kannte er bereits zur Genüge, weil er von dort schon einige Male etwas hatte holen dürfen. Auch wusste er, dass hinter den unteren Türen die Kochtöpfe, Pfannen und großen Schüsseln standen. Aber die oberen Fächer waren zu hoch für ihn, und er hatte sie immer nur aus großer Entfernung von unten gesehen. Alle Schranktüren bestanden aus Holz, nur die oberen waren verglast. Aber hinter den Glasscheiben waren weiße Vorhänge gespannt, sodass man nicht hineinsehen konnte. Das fand Gregor ziemlich hinterhältig.
Er nahm einen Stuhl und schob ihn zu dem weit ausladenden Möbelstück. Es bestand aus lebhaft gemasertem Fichtenholz, das farblos lackiert und honiggelb nachgedunkelt war. Gregor stieg auf den Stuhl und genoss zunächst die Aussicht, denn von hier oben konnte er sogar sehen, wenn jemand vor dem Fenster vorbeiging. Er öffnete die rechte Schranktür. Direkt vor ihm stand der große gläserne Zuckerkelch, der zur Hälfte mit Würfelzucker gefüllt war. Die Mutter hatte die Zuckerwürfel sicher nicht gezählt. Also ließ er einen Würfel in seinen Mund wandern und genoss es, wie dieser sich auf seiner Zunge auflöste.
Er stieg hinunter, rückte den Stuhl vor die Schrankmitte und kletterte erneut hinauf. Nun hatte er das gesamte Porzellan vor sich – auf dem unteren Boden die Tellerstapel und die Tassen für alle Tage, auch eine ohne Henkel. Mehrfach schon hatte Gregor nach einer großen Kaffeekanne und einem Milchgießer mit einem Muster aus Vergissmeinnichtgirlanden gefragt, deren eckigen Griffe wie knorrige Äste aussahen. Sie waren aus dem Hausstand von Heinrichs Mutter übriggeblieben. Man hatte keine Verwendung mehr dafür, aber man hob sie auf, weil sie zum Wegwerfen zu schade waren. Diese beiden Reststücke gefielen Gregor aufgrund ihrer bizarren Form besser als Mutters vollständiges Kaffeeservice. Sowohl die Form als auch das Streumuster mit rötlichen Kleeblüten fand er langweilig.
Hinter der linken Tür standen Weingläser mit dünnen Stielen, einige Bechergläser, und es lagen da Mutters Kopfschmerztabletten. Hinter den Gläsern gab es eine Teebüchse, die er sich nun einmal genauer anschauen wollte. Sie ist leer, hatte die Mutter mehr als einmal betont. Vorsichtig schob er zwei Gläser zur Seite und holte die Dose nach vorne. Tatsächlich war sie nicht ganz leer, sondern enthielt einen kleinen Rest Schwarztee, der anscheinend noch aus der Vorkriegszeit stammte. Er wurde nicht mehr angerührt, da man in der Familie Pfefferminztee bevorzugte. Die Dose roch schon von außen ebenso fremd wie verführerisch und war schwarz auf silberfarbenem Grund mit exotischen Motiven bedruckt: Ein Elefant mit einem Baumstamm zwischen dem Rüssel und den Stoßzähnen, beiderseits mit Paketen beladene Kamele, schwarze Elefantenführer und Kameltreiber sowie ein weißer Mann und seine schöne Frau, neben denen je ein schwarzer Diener einen Sonnenschirm aus Palmblättern hertrug. Gerahmt war jedes einzelne Bild mit Ornamenten aus Zweigen mit großen Blättern, Blüten und exotischen Früchten. Es musste wunderschöne Länder geben; von Afrika, von Amerika und von Indien hatte er schon gehört. Aber da konnte niemand hinreisen, so weit waren die entfernt. Außerdem war ja Krieg. Gregor stellte die Dose wieder an ihren Platz, rückte die Gläser zurecht, schloss die Schranktür und stieg herunter.
Nachdem der Stuhl wieder am Tisch stand, überlegte er, was er sich noch ansehen könnte. Hinter der rechten Tür in mittlerer Höhe befand sich die Hausapotheke. Er öffnete sie nur kurz, denn es schlug ihm ein unangenehmer Geruch entgegen. So musste er sich auf der Gegenseite entschädigen, wo sich hinter der Tür zwei Reihen von weiß glasierten Keramikschubladen mit blauer Schrift verbargen. In fünf großen Schubladen befanden sich Mehl, Zucker, Salz, Reis und Gries, in den kleineren die Gewürze, deren Geruch ihn immer wieder aufs Neue faszinierte. Schon oft hatte er die kleinen Schubladen aufgezogen und sich von dem Duft von Nelken, Zimt, Muskatnuss, Koriander, Kümmel und Anis betören lassen. Sie kämen aus Ägypten und Indien, hatte die Mutter ihm gesagt. Jetzt im Krieg seien sie schwer zu bekommen. Ja, dachte Gregor, das musste wohl die Welt sein, in der Kalif Storch gelebt und es den berühmten fliegenden Teppich gegeben hatte.
Gregor hörte, wie das Hoftor ins Schloss fiel. Er ging durch den Flur und hielt die Haustür auf, wo er die Mutter empfing. Wenn sie die Einkaufstasche und das Einkaufsnetz auf den Tisch stellte, freute er sich darauf, alles auspacken und einräumen zu dürfen. Es beruhigte ihn, dass die Mutter ihn niemals fragte, was er in ihrer Abwesenheit gespielt hatte.
Genau in der Mitte des Küchenschranks, in der Aussparung, hinter dem Wecker stand ein unscheinbares Bildchen, ein gestrecktes Querformat von etwa fünfzehn mal vierzig Zentimetern. In einem braunen Leistenrahmen mit zwei Handgriffen an den Schmalseiten lag unter Glas die Silhouette eines tanzenden Kinderpaars.
Auf Gregors Frage antwortete die Mutter: Das sin Hänsel und Gretel, die freue sich, dass sie die bös Hex los sin. Sie tanze und singe, Brüderchen komm tanz mit mir, beide Hände reich ich dir.
Das gefiel Gregor, und sofort wollte er diese Szene mit der Mutter spielen. Ein-, zwei-, dreimal machten sie das. Danach mochte die Mutter nicht mehr, und jedes Mal hatte sie eine andere Ausrede. Sie wird wohl selber gemerkt haben, dass ihr die Leichtigkeit zum Tanzen fehlte; sie wird unter ihrer eigenen Unbeholfenheit gelitten haben. In ihrer Arbeit hingegen fühlte sie sich zu Hause. Dass dieses Mitbringsel von ihrer Frankfurter Schwester Lola, die bei feinen Leuten in Stellung war, eigentlich kein Bild, sondern ein Likörtablett war, wusste niemand in der Familie. Dennoch behaupteten Hänsel und Gretel ihren Platz hinter dem Wecker auf dem Küchenschrank über vier Jahrzehnte.
Ein andermal hatte Gregor sich während der Abwesenheit der Mutter im Wohnzimmer umgesehen. Natürlich kannte er diesen Raum, hatte mit der Familie schon manchen Sonntag hier verbracht. Allerdings musste er dann auf dem Kanapee oder auf einem Stuhl sitzen. Aber da war das Vertiko, auf dem die schönsten Dinge in unerreichbarer Höhe standen. Gregor stellte einen Stuhl davor und stieg hinauf. Dies war allerdings nicht so bequem wie in der Küche, denn die Küchenstühle hatten feste Sperrholzsitze, während die Wohnzimmerstühle Sitze aus Rohrgeflecht besaßen, auf denen Gregor keinen Halt fand, sodass er auf den Randleisten stehen musste.
In dem Spiegel des Vertikos erblickte Gregor sich selber. Zwischen sich und seinem Spiegelbild standen die einzigen Nippes, die es im Hause gab. Da prangte in der Mitte ein prächtiges Schreibzeug aus dunklem Marmor mit zwei gläsernen Behältern, auf denen vergoldete Messingklappen glänzten und in denen noch ein wenig vertrocknete blaue Tinte aus fernen Jahren zurückgeblieben war. In der Mitte stand eine Marmorsäule mit einem kleinen eingelassenen Thermometer. Auf dem Kapitell erhob sich ein wehrhafter Bronzeadler mit ausgebreiteten Flügeln. Aus seinem geöffneten Schnabel ragte eine ungewöhnlich lange Zunge aus Draht, die sich zunächst senkte und sich dann hakenförmig nach oben bog.
Als sie wieder einmal an einem Sonntag im Wohnzimmer saßen, fragte Gregor nach der Bedeutung der sonderbar geformten Zunge. Frieher, sagte die Mutter, awer das is schon lang her, hat do droo e Hakekreuz gehängt.
Ja, und wo is das Hakekreuz jetzt?, wollte Gregor wissen.
Die Mutter zuckte die Schultern. Irgendwie sei es weggekommen. Das bedauerte Gregor, denn so fand er den Adler unvollständig, und die Zunge war viel zu lang.
Zu beiden Seiten wurde die Schreibgarnitur flankiert von zwei glänzenden zylinderförmigen Messingvasen, die ein Kamerad von Vater Heinrich aus den Hülsen von Granaten gefertigt hatte. Da sie wegen ihres angeschraubten Dreifußes nicht wasserdicht waren, stellte die Mutter nur manchmal Strohblumen oder Zittergras hinein. Ansonsten blieben sie leer.
Den eintürigen Kleiderschrank kannte Gregor, da seine eigenen Sonntagskleider zusammen mit denen der Eltern dort aufbewahrt wurden. Aber da gab es ein rätselhaftes Gerät, das noch nie benutzt worden war. Das wollte er sich ansehen. Er öffnete die Schranktür, und es schlug ihm der Geruch vom Mottenpulver entgegen. Sonderbar, dachte er. In allen Kleiderschränken liegen Mottenkugeln, aber ich habe noch nie eine Motte gesehen.
Da lag es in der linken hinteren Ecke unter Tüchern und Schals, dieses sonderbare Gerät, das von seiner Form her eher in die Küche oder in die Speisekammer gepasst hätte, ein graues Emailgefäß, an dessen Boden ein roter Gummischlauch aufgesteckt war mit einem Glasröhrchen am Ende.
Gleich bei ihrer Rückkehr vom Einkauf durfte er die Mutter nicht danach fragen, denn dann hätte sie sofort gewusst, dass er heimlich im Schrank gestöbert hatte. Sie hätte geschimpft, ihm vielleicht sogar eine runtergehauen, ihm aber keine Auskunft gegeben. Er musste also eine passende Gelegenheit abwarten.
Als sie am nächsten Sonntag vom Kirchgang nach Hause kamen, betraten sie das Wohnzimmer, wo die Mutter ihren Hut und ihren Mantel sowie Gregors Jacke in den Schrank hängte. Gregor deutete in die linke untere Ecke des Schrankbodens und fragte: Was ist das fier en roter Schlauch?
Zu seinem Erstaunen erhielt er sofort eine Auskunft: Die Oma Schulze war lang krank vor ihrm Tod, erzählte die Mutter. Das war drei Jahr, bevor du uff die Welt komme bist. Fast e ganz Jahr hat sie sie im Bett geläje, und in der Zeit konnt sie net uffs Clo geh. So musst ich ihr aamol in der Woch mit Saafewasser en Inlaaf in de Popo mache – hier mit dem Irrigator.
Die Mutter ging in die Küche, um das Mittagessen zu kochen und ließ Gregor im Wohnzimmer zurück. Er konnte sich das alles nicht genau vorstellen. Aber es musste eine ziemlich eklige Arbeit gewesen sein, dachte er.
Spielen im Haus
Wenn es das Wetter einigermaßen erlaubte, war Gregor draußen auf der Gasse, wo immer viele Kinder spielten. Vor dem Haus machte die Gasse einen Knick. Zwischen der Gasse und dem Haus gab es einen kleinen quadratischen Platz, der nicht gepflastert war und den die Kinder deshalb zum Spielen bevorzugten. Denn hier konnten sie mit dem Schuh oder einem Stück Ziegelstein ganz leicht Linien für Hüpfspiele ziehen. Viel Verkehr gab es nicht, aber wenn wirklich einmal ein Fuhrwerk oder noch seltener ein Auto vorbeikam, fuhr dieses auf dem holprigen Kopfsteinpflaster der Gasse, aber nicht über den Platz.
War Gregor in der Küche, so verging kaum eine Stunde, und ein Kind stand unter dem Fenster und rief nach ihm. Dann hielt es ihn nicht mehr lange im Haus, und er war sofort draußen.
Bei Regen durfte Gregor nicht hinaus, und es war ihm nicht erlaubt, Kinder mit ins Haus zu bringen. Eigentlich sollte er auch nicht zu anderen nach Hause zu gehen. Aber das tat er doch immer wieder heimlich, ohne der Mutter davon zu erzählen. Allein zu Hause wurde es ihm bald langweilig. Die wenigen Spielsachen, die in einem Pappkarton neben dem Küchenschrank Platz gefunden hatten, reizten ihn nur noch wenig. Die Bauklötze, die schon durch eine Kindergeneration einer anderen Familie gegangen waren, bevor die Brüder sie geschenkt bekommen hatten, waren so stark dezimiert, dass er nur eine kleine Brücke oder den Sockel eines Hauses oder ein niedriges Türmchen bauen konnte.
Im Alter von vier Jahren trug Gregor knielange Hosen, je nach Jahreszeit Kniestrümpfe oder lange Strümpfe, die an einem Leibchen festgeknöpft waren sowie eine von der Mutter selbst genähte Bluse mit langen Ärmeln. Darüber hatte er immer, wie alle kleinen Buben seines Alters, eine Schürze und zwar eine Bubenschürze an. Diese unterschied sich von einer Mädchenschürze deutlich. Sie war in einer gedeckten Farbigkeit gehalten und hatte in der Mitte eine große Tasche, während die Schürzen der Mädchen leuchtend bunt waren und zwei kleine Taschen besaßen. Wenn Gregor vor dem großen Küchenfester saß und versonnen in das Grau des Regens blickte, steckte er den Mittelfinder und den Ringfinger in den Mund, während er den kleinen Finger und den Zeigefinger auf der Wange auf und ab bewegte. Lief seine Nase, so griff er nicht nach seinem Taschentuch, sondern wischte den Rotz an seinen Blusenärmel. Das konnte er nur tun, wenn die Mutter ihn nicht beobachtete. Wenn sie allerdings nach einigen Tagen entdeckte, dass seine Blusenärmel am unteren Ende glänzten, schimpfte sie und ermahnte ihn, doch gefälligst das Taschentuch zu benutzen, das in der Schürzentasche steckte.
Gregor hatte einen kleinen Lastwagen, an dem fast keine Farbe mehr war und mit dem er alle möglichen Sachen durch die Küche transportierte. Auch versuchte er, sich selbst Spielsachen zu basteln. Bruder Wotan hatte ihm gezeigt, wie man aus einer leeren Garnrolle, einem Bleistift und einem Gummiring einen Panzer baut. Dieses Gefährt sah wohl einem Panzer nicht ähnlich, fuhr aber genau so schnell wie ein Spielzeugauto mit Aufziehmotor. Oder er sammelte leere Streichholzschachteln, die er zu einem kleinen Kaufladen zusammenklebte. In die Schubladen kamen ein paar Knöpfe und getrocknete Erbsen und Bohnen. Nun sollte die Mutter kommen und bei ihm einkaufen. Aber das Problem kannte er ja schon: Sie hatte keine Zeit. – Das war für Gregor das Signal, dass er nicht mehr in der Küche bleiben musste.
Er ging hinüber in die Speisekammer. Ein halbhoher Schrank war nur mit einem braun-rot geblümten Vorhang verschlossen. Gregor hob das etwas speckige Tuch zur Seite. Ein herrlicher Geruch von Holzrauch schlug ihm entgegen, der von den an einer Vielzahl von Querstangen hängenden Schinken, Speckseiten, Dörrfleisch und Räucherwürsten kam. Nur mit einer Fingerspitze musste er eine Schmalseite berühren, und schon roch sein Finger nach Räucherschinken.
Ein kleiner Tisch stand da, an dessen Kanten noch die ausgefransten Reste einer früheren Wachstuchbespannung hingen. An dem Tischchen wurde nicht mehr gearbeitet, denn die Platte war immer mit den beiden emaillierten Milchkannen, dem Krauthobel, dem Fleischwolf, weiteren Küchenmühlen und einem riesigen schwarzen Waffeleisen vollgestellt. Waffeln, ja, die aß Gregor besonders gerne. Er sollte die Mutter bitten, wieder einmal Waffeln zu backen. Bei dieser Vorstellung lief ihm das Wasser im Munde zusammen. Am besten, gleich morgen, dachte er.
Unter dem Tisch lagen alle Schuhe der Familie. Daneben stand noch eine Wasserbank. Das war eine kleine Bank ohne Lehne, auf der zwei Personen hätten sitzen können. Sie besaß einen unteren Boden, auf dem hinter einem Stoffvorhang ehemals zwei Eimer mit Wasser Platz gefunden hatten. Seitdem es in Warstein eine Wasserleitung gab, hatte das Möbelstück in der Küche seine Funktion eingebüßt. Nun verbargen sich hinter dem Vorhang der große gusseiserne Bräter und der Einkochtopf.
Hinter der Tür war ein breiter, von Vater Heinrich selbst gezimmerter Kleiderrechen an die Wand genagelt. In ein Brett hatte er acht Zimmermannsnägel geschlagen und das Ganze hellgrau angestrichen. Hier hingen die Werktags- und Arbeitskleider. Diese bildeten für Gregor den Fundus, aus dem er sich bisweilen bediente, um sich zu verkleiden.
Er schlüpfte in eine der viel zu langen Hosen des Vaters, eine viel zu große Jacke von einem der Brüder, setzte einen alten Hut auf und betrat die Küche. Die Mutter lächelte mehr nachsichtig als amüsiert und rief: Ach, mein klaaner Gernegroß!
Mama, wann bäckst du mol wieder Waffele? Moije?
Ach, das is immer viel Arweit und so unbequem mit dem aale Waffeleise.
Awer Waffele sin das Beste! Und wenn du dazu eigemachte Birne machst. Das isst du doch aach gern.
Na, vielleicht nächst Woch.
Auf dem Speicher
Aus der Kammer führte eine steile Treppe ins Dachgeschoss. Wenn die Mutter sehr beschäftigt war, er nicht hinausdurfte und er auch nicht durch Ungehorsam in Misskredit geraten war, schlich er sich durch die Speisekammer die Treppe hinauf. Der vordere Teil war ein Speicher mit gestampftem Lehmboden zwischen den Deckenbalken. Nur ein schmaler Streifen war mit Dielen bedeckt, über die man zur hinteren Hälfte gelangen konnte. Hier gab es ein Zimmer mit einem Giebelfenster, von dem aus man den Hof, den Platz vor dem Haus und die Gasse mit den gegenüber stehenden Häusern, die alle zweistöckig waren, überblicken konnte. Dieses Zimmer hatte die Mutter während des Krieges ausbauen lassen, sodass Friedrich und Wotan nicht mehr im Wohnzimmer schlafen mussten. Hier standen zwei Einzelbetten und zwei eintürige Kleiderschränke.
Der Dachboden vor dem Jungmännerzimmer diente als Abstellraum. Da standen Dinge, für die im Erdgeschoss kein Platz war. Es gab zwei Moppkisten, die auf Gregor eine besondere Anziehung ausübten. Eigentlich waren es abschließbare Holzkoffer, grau lackiert mit Eisenbeschlägen, die Heinrich während seiner Stationierung in der Bretagne von einem Kameraden hatte bauen lassen, die er im Urlaub mitgebracht und nicht wieder mitgenommen hatte. Nun dienten sie der Mutter als Lappenkisten, in denen Gregor gerne heimlich kramte. Da fand er nicht nur Stoffreste, sondern auch Kleider von den reichen und äußerst eleganten Herrschaften der vornehmen Tanten Karin und Lola. Diese Kleider waren aus edlen Textilien genäht, aus violettem Samt, aus schwarzem Plissee und glänzender Seide, weiß, schwarz oder auch schreiend bunt. Die Mutter konnte mit diesen Sachen nichts anfangen. Nicht einmal zum Umarbeiten seien sie geeignet, sagte sie, aber zum Wegwerfen auch wiederum zu schade. Gregor zog ein einzelnes Stück heraus und stellte sich in dem Kleid eine große schlanke, mit Perlen und glitzernden Edelsteinen geschmückte Frau vor, die sich in tänzelnden Schritten bewegte, ein menschlicher Paradiesvogel, nur dazu da, um von ihm angeschaut und bewundert, aber nicht berührt oder wie auch immer begehrt zu werden. Die Auftritte der schönen Frauen erlebte Gregor ausschließlich auf dem Speicher.
In den Lappenkisten lagen auch einige Männersachen. Sie stammten von einem sehr beleibten Mann, der mindestens doppelt so dick sein musste wie Gregors Vater. Aber diese Kleider regten Gregors Fantasie kaum an. Da war ein grün gesprenkelter, von Motten zerfressener Jagdanzug mit knielangen Beinen. Ein Paar Wickelgamaschen nahm er mit nach unten, ließ sich zeigen, wie man sie anlegt und befestigt und brachte sie bald wieder nach oben. Dann fand er einen blau, grün und weiß gestreiften Pyjama des dicken Mannes.
Gregor zog den riesigen Schlafanzug an, hielt die weite Hose fest und ging hinunter zu seiner Mutter, die ihm sagte, was er schon wusste, nämlich, dass das Stück ihm viel zu groß sei.
Awer ich möchte’n hawe, nörgelte er. Du kannst’n wäsche und von der Frau Schenker klenner mache lasse.
Tatsächlich ging die Mutter darauf ein. Als die Hausschneiderin das nächste Mal kam, schnitt sie große Stücke aus Hose und Jacke heraus und nähte alles wieder zusammen. Übrig blieb ein großer Haufen Stoff, und Gregor triumphierte.
Jetzt zieh’ ich nie wieder e Nachthemd oo.
Die Mutter wollte schon abwehren, aber die Schneiderin meinte: Dann muss ich eben noch einen zweiten Schlafanzug nähen.
Auch dafür hatten sich schnell noch ausreichend Stoffreste gefunden.
Auf dem Speicher standen auch zwei große Plüschtiere, die fast so groß waren wie Gregor, ein sitzender Hund und ein stehendes Schaf. Umgekehrt wäre es ihm lieber gewesen, denn, da ihm der Hund sympathischer war, wäre er gern auf ihn gestiegen, um auf ihm zu reiten. Das hölzerne Schaukelpferd hingegen übte nur eine mäßige Anziehung auf ihn aus, da es so plump gebaut war, dass man auf den ersten Blick erkannte, wo die Beine und der Hals an den walzenförmigen Leib angesetzt waren. Hinzu kam, dass Gregor nur moderat schaukeln durfte, damit der weiche Lehmboden nicht aufgerissen wurde. So bewegte er sich genau so weit nach vorne, wie er auch gleich wieder zurückfiel. Nur wenn er sehr heftig schaukelte, konnte er erreichen, dass die Kufen immer ein kleines Stück nach vorne rutschten. Aber das wagte er nur, wenn niemand in der Nähe war. – Es stand dort eine mit dunkelgrünem Leinen bezogene Hutschachtel mit Messingschloss. Innen war sie mit glänzender dunkelroter Seide gefüttert, worin ein Zylinder steckte. Auf seine Frage erfuhr Gregor von der Mutter, dass dieser Zylinder dem Vater gehörte und noch von ihrer Hochzeit stammte.
Setz’n doch e mol uff, bettelte Gregor, als Vater Heinrich einmal auf Urlaub zu Hause war. Er ist noch so schee, viel schenner wie dein normaler Hut.
Da musste er erfahren, dass sein Vater dieses prächtige Stück niemals getragen hatte. Der Zylinder war ihm von einem Onkel geschenkt worden, und, da er ihm nicht passte, hatte er ihn während der gesamten Hochzeitszeremonie in der Kirche und auch vor dem Fotografen nur in der Hand gehalten.
Weggeräumte Bücher
Auf dem Speicher stand ein niederes Regal mit Büchern. Unten in der Wohnung hatten sie nur die Bibel und die Gesangbücher mit den Kirchenliedern, die im Kleiderschrank lagen. Alle anderen Bücher musste man, wenn man eines ansehen oder lesen wollte, von oben herunterholen, denn sie gehörten nicht zum alltäglichen Gebrauch.
In einigen Büchern waren Bilder, die Gregor immer wieder anschaute, vor allem, bevor er eingeschult wurde. Die Illustrationen des Julius Schnorr von Carolsfeld in der zerfledderten Biblischen Geschichte gefielen ihm besonders gut. Die Frauengestalten mit ihren festen Brüsten, ihren kräftigen Armen und den runden Schenkeln fand er geradezu zum Verlieben und in ihrer Gesamtheit viel reizvoller als alle wirklichen Frauen zusammen in Unter-Warstein. Und das, obwohl es sich nicht einmal um Gemälde, sondern um schlichte Holzschnitte handelte. Die Männer des Alten Testamentes mit ihrer Ausstrahlung von Stärke, Mut und Tatkraft waren geeignet, zu Idolen zu werden. In seiner Kindheit war für Gregor das Alte Testament eine Räuberpistole wie viele andere, in der allerdings der Gott der Israeliten eine äußerst befremdliche Rolle spielte. Gregor sah in ihm eine furchterregende Gestalt ähnlich der von Vater Heinrich. Dieser Gott hatte den eisernen Willen, seine Interessen durchzusetzen. Er belohnte die Gehorsamen mit großen Viehherden, mit Reichtum, vielen Frauen und Kindern. Wer sich ihm wiedersetzte, wurde nicht nur selbst, es wurden sogar seine Nachkommen noch nach Generationen verfolgt. Das Neue Testament hingegen mit dem milden Jesus, jenem Allesdulder, konnte Gregor nur als ein Märchen nehmen aus einer Welt, die noch weiter entfernt war als der bunte Orient, das schwarze Afrika, das rätselhafte China und das ferne Amerika. Denn die Repräsentanten dieser Religion, der Pfarrer, die Lehrer und nicht zuletzt der Vater Heinrich, droschen auf die Kinder ein, als wären es ihre Todfeinde. Nein, dieser Jesus war nur etwas für die Kirche und für besondere Mußestunden. Der herben Lebenswirklichkeit entsprach eher das Alte Testament.
Es gab auch ein Realienbuch im Regal, bei dem es Gregor vor allem um die Stiche aus der Geschichte, der Geografie, der Biologie und der Physik ging.
Gefälliger als diese Grafiken waren die gemalten Illustrationen von Paul Hey in einem Märchenbuch der Brüder Grimm. Auch Wotans Bücher standen in demselben Regal. Durch die Abbildungen in den Vogelbüchern lernte Gregor die Vogelarten nicht nur kennen, sondern sie auch in der Natur zu bestimmen.
Da lag noch ein dickes Buch, in dem fast auf jeder Seite eine große Maschine abgebildet war. Es waren Dampfmaschinen und elektrische Maschinen. Manchmal stand neben der Maschine oder auf einer angebauten Rampe, zu der eine Treppe hinaufführte, ein Mann mit steifem Hut und einem großen schwarzen Schnauzbart. So konnte Gregor sich die unglaubliche Größe dieser Maschinen vorstellen, die bisweilen ein Schwungrad besaßen, das zur Hälfte in den Boden hineinragte und dessen Radius mehr als doppelt so groß war wie der Mann daneben. Gregor hatte sich die grafischen Illustrationen schon mehrfach angesehen, die ihm eine ferne Welt, die Welt der Technik, eröffneten, die ihn nicht weniger faszinierte als die Märchen. Er hatte sich vorgenommen, dieses Buch zu lesen, wenn er in die Schule ginge und lesen gelernt hätte.
Das Maschinenbuch gehörte Friedrich, der als Malerlehrling lernte, Fenster und Türen zu streichen und Wände zu tapezieren. Dennoch interessierte er sich auch für Elektrizität. Das dicke Buch hatte ein Arbeitskollege ihm geschenkt, der selber damit nichts anzufangen wusste. Aber auch Friedrich legte es bald beiseite und bastelte lieber. Er hatte schon einmal eine Steckdose repariert und auch einen Schalter. Vor kurzem hatte er sich mit wenigen Teilen ein kleines Radio gebaut, auf dem es nur einen Sender gab, Radio Frankfurt. Nun saß Friedrich oft abends mit den Kopfhörern am Küchentisch.
Gregor fragte den großen Bruder nach dem Buch. Ob es solche Maschinen wirklich gab, oder ob der Zeichner sie sich ausgedacht hätte, wollte er wissen.
Doch, doch, betonte Friedrich. Die stehn in Fabrike, in riesige Halle, und sie mache en Höllelärm. Sie stampfe und brumme, sie rausche und zische. Und aus einige kommt sogar Dampf eraus.
Warum? Sind das Spielsache für Erwachsene? Ich glaab’s net.
Das kannst du mir glaawe. Du kennst doch die Lokomotiv bei der Eisebahn und die Lokomobile bei der Dreschmaschin. Das sind natürlich kaa Spielsache. Die Maschine müsse schaffe, die müsse Arweit leiste. Dampfmaschine treiwe andere Maschine oo, aus dene zum Beispiel Strom kommt.
So e Fabrik mit große Maschine mecht ich mol sehe. Sind die all in Frankfurt?
Fabrike gibt’s nur in der Stadt. Hier uff’m Land net. Awer da kommst du net nei. Nur die Leut, die da schaffe.
Das is awer bleed. Wenn ich in der Fabrik schaff, und es gefällt mir net. Was mach ich dann?
Dann lernst du en annere Beruf.
Gregor stampfte wütend mit dem Fuß auf. Das is ungerecht! Ich will die Maschine vorher sehe. Und erst dann iwerleg ich mir mein Beruf.
Das Puppentheater
Auf dem Dachboden stand ein Puppentheater, nach dem Gregor oft fragte. Da die Kiste sperrig und schwer war, konnte die Mutter sie nicht herunterholen. Stand das Theater einmal in der Wohnküche, musste man Umwege gehen, um sich zwischen Herd, Küchenschrank, Wasserstein und Tisch bewegen zu können. So blieb dieses begehrte Spiel auch nicht lange stehen. Manchmal baute es einer der beiden Brüder an einem Wochenende im Winter auf. Dann verschwand es spätestens am Sonntagabend wieder. Als Gregor sechs Jahre alt war, konnte er das Theater selber aufbauen. Nun drang er öfter darauf, dass ihm jemand die Kiste vom Speicher herunterholte.
Bei den Nachbarskindern hatte es sich längst herumgesprochen, dass es da eine wundervolle Puppenbühne gab. So kam es, dass Gregor auch gefragt, angebettelt oder sogar bedrängt wurde und er die Begehrlichkeiten dann an die Mutter und die Brüder weitergab. Hatte er sich nach tagelangem Bitten und Nörgeln endlich durchgesetzt, durfte er nur wenige Kinder einladen – höchsten vier oder fünf.
Wenn die Kinder kamen, hatte Gregor das Theater bereits aufgebaut. Sämtliches Zubehör befand sich in der sperrigen Holzkiste, die etwa einen Meter breit, achtzig Zentimeter tief und zwanzig Zentimeter hoch war und zugleich als Bühnenboden diente. Öffnete man am hinteren Ende den Klappdeckel, dann ließ sich der gesamte Inhalt herausnehmen. Das waren der Bühnenrahmen, ein roter Samtvorhang mit einer Messingstange, die Kulissen und die Puppen. Zuerst errichtete Gregor den prächtigen Rahmen, der aus drei Teilen bestand, zwei seitlichen Pfeilern und einem Oberteil, die zusammen ein mächtiges Tor, eine Art Triumphbogen bildeten. Sie bestanden aus einer schweren Graupappe, die vorne mit bunt bedrucktem Papier beklebt und hinten durch Latten verstärkt und derart mit eisernen Laschen versehen war, dass man sie passgenau zusammenstecken konnte. Nun wurde noch der rote Vorhang eingehängt. Dann setzte sich Gregor zunächst einmal vor den Torrahmen der Bühne, um ihn eingehend zu betrachten und zu bewundern. Denn etwas Derartiges hatte er in der Wirklichkeit noch nie gesehen. Der Grundton war in einem hellen Ocker gehalten, sodass man sich vorstellen konnte, dass das Tor aus gelbem Sandstein errichtet worden war. Die beiden Pfeiler wurden durch korinthische Pilaster gerahmt, zwischen denen sich groteske Gestalten mit Fruchtgirlanden ausbreiteten, die an Widderschädeln aufgehängt waren. Den Sturz bildete ein prachtvoll ornamentierter Giebel, auf dem hebräische Schriftzeichen durch weitere Grotesken gerahmt waren. Da auch die Erwachsenen den Text nicht entziffern konnten, wahrte die Bühne auf diese Weise ihr Geheimnis. Allerdings wurde jedem, der danach fragte, erzählt, dass die Tante Karin aus Frankfurt das Theater mitgebracht hatte. Nachdem die Kinder ihrer jüdischen Dienstherrschaft erwachsen geworden waren, hatte Karin die Kiste für ihre Neffen Friedrich und Wotan nach Unter-Warstein mitnehmen dürfen. Wie es der Tante gelungen war, die riesige Kiste nach Warstein zu bringen, wusste Gregor nicht, und er hatte auch nie danach gefragt. Vielleicht hatte ja Vater Heinrich, der schon vor dem Krieg in Frankfurt gearbeitet hatte, beim Transport geholfen.
Als Nächstes ging es an den Bühnenraum. Vier bogenförmige Kulissen, die einen dichten Eichenwald darstellten, steckte Gregor mit ihren Rundhölzern in Aussparungen des Bodens, und schließlich wurde der Raum durch einen Prospekt abgeschlossen, auf dem ein Waldweg in eine geheimnisvolle Tiefe führte. Dieser Ausblick war schöner als jedes gemalte Bild. Nun besah Gregor sich die etwa zehn Zentimeter großen Puppen, aus deren Köpfen jeweils eine Drahtschlaufe ragte, an der ein Zwirnsfaden befestigt war. Es gab ein Mädchen und einen Jungen, eine hübsche junge Dame ohne Beine und einen vornehmen Herrn, eine alte Frau und einen alten Mann, einen finsteren Burschen mit pechschwarzem Vollbart und ohne Unterleib, einen Soldaten, einen Jäger ohne Arme, ein braunes Pferd und einen schwarzen Hund.
Was würden sie spielen? Vielleicht Rotkäppchen und der Wolf. Dieses Märchen hatte die Mutter Gregor so oft erzählt, dass er es fast wörtlich auswendig wusste. Aber das würde er mit den Kindern gemeinsam überlegen, denn es müsste ja noch jemand mit ihm spielen, da er nicht mehr als eine Figur mit jeder Hand führen konnte.
Als die Kinder kamen, betrachteten sie das Theater voller Bewunderung von allen Seiten, bevor sie sich auf dem Fußboden vor der Bühne niedersetzten. Wenn Gregor dann den roten Vorhang aufzog, gab es noch einmal Rufe des Erstaunens, als sie die Illusion eines romantischen Waldes vor sich sahen. Gregor breitete alle Spielfiguren vor ihnen aus, und alle waren sofort einverstanden, als er vorschlug, zunächst das Märchen von Rotkäppchen und dem Wolf zu spielen. Bruna war glücklich, dass sie mit Gregor hinter die Bühne gehen durfte. Er übernahm den schwarzen Hund, der den Wolf darstellte und den Jäger, sie das Rotkäppchen und die Großmutter.
Gregor zog den Vorhang langsam auf, worauf ein erwartungsvolles Raunen zu vernehmen war. Bruna zog das Rotkäppchen zwischen den Kulissen in die Mitte der Bühne, wo es sich hin- und herdrehte. Zum Blumenpflücken konnte es sich nicht richtig bücken. Wenn Bruna den Faden lockerließ, legte das kleine Mädchen sich auf den Bauch. Ja, diese Figuren hatten ihren Tücken, denn sie ließen sich entweder mit den Füßen über den Boden schleifen, oder man konnte sie hüpfen lassen. Hob man sie jedoch auch nur einen Millimeter über den Boden, begannen sie, sich in unberechenbarer Weise um die eigene Achse zu drehen, wandten sich hierhin und dorthin. Als der Wolf auftrat, sprach Rotkäppchen mit diesem, wandte sich aber meistens von ihm ab. Eigenartigerweise störte das jedoch keines der Kinder außer Gregor, der diesen Mangel als ausgesprochen ärgerlich empfand.
Nachdem der Wolf getötet und die Rettung der Großmutter gefeiert worden war, wollten auch die anderen Kinder spielen. Helmer und Gudrun hatten sich darauf geeinigt, Dornröschen zu spielen. Der Vorhang ging auf, und mitten im Eichenwald standen Dornröschen und der Prinz, tanzten aufeinander zu, drehten sich auch wieder weg, prallten aufeinander und küssten sich angeblich. Dann hörte man, wie Gudrun Helmer fragte, wie es denn nun weitergehe.
Die bees Fee muss jetzt komme!, rief Helmer. So ging es turbulent weiter. Das vereinbarte Spielthema war binnen kurzem vergessen, und sie improvisierten munter drauflos.
Verlor das Spiel an Spannung, riefen die Zuschauer: Ich will aach mol spiele!
Dann wurde wieder gewechselt. Spätestens nach einer Stunde waren die Vorstellungen vorüber. Während die Nachbarkinder nach Hause gingen, demontierte Gregor die Bühne und verstaute alles in der Kiste, die er dann aufrecht stellte, damit sie nicht zu viel Platz in der Küche beanspruchte. Die Kinder aber erzählten noch tagelang von Gregors Theater, das mittlerweile schon längst wieder auf den Dachboden gebracht worden war.
Ungemütlicher Waschtag
Ganz unangenehm war der wöchentliche Waschtag für Gregor, den er mehr hasste als irgendetwas anderes. In der Waschküche, wo der große Kupferkessel dampfte, roch es nach Seifenlauge. Auf einem dreibeinigen Bock stand eine breite Zinkwanne, an der die Mutter auf einem Brett die Arbeitshosen und das Bettzeug schrubbte und bürstete. Immer wieder musste sie Gregor erklären, was sie da alles machte, denn die Arbeit wollte gar kein Ende nehmen. Und mehr als einmal fragte er sich, ob all die Umstände denn wirklich nötig wären: einweichen, kochen, bürsten, spülen, auswringen, aufhängen. Die weiße Wäsche wurde sogar hinterm Garten auf der Wiese zum Bleichen ausgelegt. In der Waschküche war es schwül und dampfig, in der Küche hingegen wurde es kalt, weil die Tür meist offenstand und das Feuer im Herd ausging. Dann kam die Mutter irgendwann gegen Mittag nach oben geeilt und machte schnell eine Suppe.
Da das Waschen, vor allem das Schrubben mit der Bürste, sehr anstrengend war, mochte die Mutter dabei nicht viel reden. Deshalb antwortete sie eher widerwillig, wenn Gregor seine lästigen Fragen stellte. Da hingen in regelmäßigen Abständen ganz hinten in der Waschküche rätselhafte Kleidungsstücke, von denen Gregor nicht wusste, wer sie anzog. Schon einmal hatte er gefragt und eine ausweichende Antwort erhalten.
Gerade hatte die Mutter wieder so ein graues Stück auf das Brett gelegt, um es kräftig zu bürsten. Es sah so ähnlich wie ein Strumpf aus, besaß allerdings anstelle von Öffnungen auf beiden Seiten jeweils eine Lasche mit einem Knopfloch. Gregor trat etwas näher heran, während die Mutter das rätselhafte Stück umdrehte und auf der anderen Seite weiterbürstete.
Was stehst du do rum? Du kenntst owe in de Kich spiele, herrschte die Mutter ihn an.
Wie zieht man das oo?, fragte er.
Die Mutter warf ihm einen bösen Blick zu: Iwerhaapt net!
Awer es gibt so viele. Wem geheern die? Warum wäschst du die jedes Mol?
Jetzt unterbrach die Mutter das Bürsten und blickte Gregor wütend an. Ach, rief sie, sonst nichts. Ihre Stimme hatte auf einmal ganz tief und rau geklungen.
Etwas Ungutes lag in der Luft, aber Gregor verstand nicht, was es sein mochte. Deshalb wollte er doch noch eine letzte Frage stellen.
Sin das Strimp? Oder was is das sonst?
Das sin Gamaschestrimp! So, jetzt reicht’s awer. Geh enuff in die Kich. Ich hab noch viel Arweit und kaa Zeit für so e Geschwätz.
Wenn im Winter Stein und Bein zusammengefroren waren, erledigte die Mutter das Bürsten der Wäsche oben. Der Bock mit der Wanne und dem Waschbrett stand dann mitten in der Küche. Mehrfach musste sie aus dem Kessel Wäsche holen und sie danach wieder nach unten bringen. Zwischendurch blieb bisweilen eine Tür offenstehen, sodass es bei dampfgeschwängerter Luft in der Küche mal zu warm und dann wieder zu kalt war. Dann beklagte Gregor sich zum wiederholten Mal, dass der Waschtag so ungemütlich sei. Wenn ihm gar nichts Besseres einfiel, kniete er auf einem Stuhl vor dem breiten Fenster. Auf den drei unteren Scheiben hatten sich bizarre Landschaften aus Eisblumen gebildet, in denen er zwischen dem dichten weißen Gehölz fantastische Gestalten entdeckte, die alles übertrafen, was er in Märchen gehört und sich vorgestellt hatte.
Im Winter konnte die Mutter die Wäsche nicht im Freien aufhängen. Deshalb teilte sie diese auf. Die kleineren Stücke kamen dann auf die wenigen Leinen, die unter die Decke der Waschküche gespannt waren. Für die großen Stücke hatte der Vater auf dem Dachboden zwischen den Spanten Leinen von einer Dachseite zur anderen gezogen. Da das Dach nicht isoliert war – man sah also zwischen den Balken die Latten und die Ziegel – wurde es hier oben auch sehr kalt, sodass die Wäsche oft viele Tage hängen musste, bis sie trocken war. Einmal kam Gregor im Winter auf den Dachboden und sah dort Bettlaken, Bezüge und zwei rote Wolldecken hängen. Von den unteren Rändern aller Stücke hingen kleine Eiszapfen herunter. Gregor wollte wissen, ob nur die Ränder oder die ganzen Wäschestücke gefroren waren. Er fasste die Ecke einer der beiden Wolldecken an und bog sie im rechten Winkel um. Der Widerstand war ungewohnt stark, auf einmal knirschte es leise, und ein kleines rotes Dreieck fiel zu Boden. Gregor erschrak. Er hob das eisige Wollstück auf und warf es in einen staubigen Winkel hinter einen Stapel Dachziegel. Schnell stieg er die Treppe hinunter. Der Mutter erzählte er nicht, was ihm gerade passiert war. Aber bei einer der roten Decken war später eine Ecke abgeschrägt. Noch Wochen danach, als die Wäsche längst schon wieder trocken im Schrank lag, erwartete Gregor, dass die Mutter ihn zur Rede stellen und bestrafen würde. Doch sie tat es nicht.
Als Gregor ein paar Jahre älter war, konnte er der Mutter am Waschtag helfen. Auf der Streuobstwiese hinterm Haus spannte er mit ihr Leinen zwischen Apfel- und Zwetschgenbäumen, wobei er jeweils in die Mitte, wo sie bei Belastung durchhingen, als Stütze eine Bohnenstange stellte, an deren Ende ein Nagel schräg eingeschlagen war. Er half auch bisweilen beim Auslegen der weißen Wäsche auf der gemähten Wiese, wo sie gebleicht werden sollte.
Die Bleiche war ein eigenes Stück Arbeit, für das Gregor sich nun auch verantwortlich fühlte, wenn er beim Ausbreiten geholfen hatte. Deshalb warf er, während er im Garten umherstreifte, hin und wieder einen Blick hinaus auf die Wiese.
Da entdeckte er, dass eine Herde Gänse, die sich das saftige Gras hatte schmecken lassen, ganz gemächlich über das Bettzeug und die Laken watschelte. Er rannte über die Wiese und bekam gerade noch die letzte Gans am Hals zu fassen, während die anderen die Flucht ergriffen.
Dir werd ich zeige, zischte er, wo du spaziern geh dirfst!
Er schleuderte die Gans zweimal im Kreis durch die Luft, ließ sie los, und im hohen Bogen landete sie unsanft auf dem Feldweg. Insgeheim fürchtete Gregor, dem Vieh die Halswirbel ausgerenkt zu haben, aber es hatte den Sturz anscheinend ganz unbeschadet überstanden und rannte mit lautem Protestgeschrei hinter der Herde her.
Gregor hatte aber nicht bedacht, welchen Druck die Fliehkraft im Darm der Gans erzeugen würde. Dieser hatte den Inhalt nicht halten können, und nun sah Gregor das Zeugnis seines Einsatzes: Über zwei weiße Laken zog sich ein dicker grüner Strich aus Gänsekacke. Einerseits war er noch immer stolz auf seine Leistung, andererseits erkannte er, dass die Mutter die beiden Laken natürlich noch ein zweites Mal waschen musste. Mit zwiespältigen Gefühlen erstattete er ihr Bericht. Erstaunlicherweise schimpfte die Mutter nicht, sondern murrte nur kurz, bevor sie mit den beiden Tüchern noch einmal in die Waschküche ging.
Wenn Gregor krank war
Ähnliche Bilder wie die Eisblumen hatte Gregor schon im Schlafzimmer an den Kopfteilen der Elternbetten entdeckt. Die Bretter hatten keine natürliche Maserung, sondern waren, wie man sagte, in Holzfarbe gestrichen. Das war eine mehr oder weniger geschickte Nachahmung von Holzmaserung mit einer Bierlasur. Wenn Gregor krank war, durfte er im Elternbett liegen, und dann hatte er es am liebsten, wenn die Mutter sich zu ihm auf die Bettkante setzte und ihm Märchen erzählte. Sie hatte ein kleines Repertoire von höchstens acht Geschichten, aus denen Gregor auswählen durfte. Dann passte er auf, dass sie die immer gleichen Geschichten auch mit den immer gleichen Worten erzählte und ja Detail ausließ. Es gab auch ein Buch mit Grimms Märchen, in dem natürlich viel mehr Geschichten gewesen wären. Aber das laute Vorlesen machte der Mutter große Mühe. Sie las stockend, musste nach wenigen Wörtern tief Luft holen, bevor sie fortfahren konnte. Nach jedem zweiten Satz seufzte sie. Das Erzählen hingegen ging ganz flüssig und fast mühelos vonstatten. Deshalb hörte Gregor die Mutter auch lieber erzählen als lesen.





























