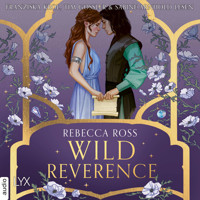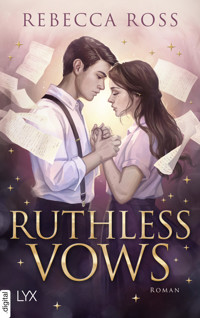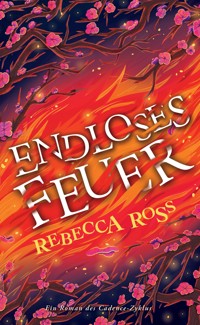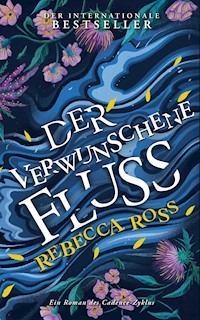
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panini
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der verwunschene Fluss
- Sprache: Deutsch
DIE MAGIE DER MUSIK. Cadence ist eine verzauberte Insel: Der Wind flüstert geheimnisvoll, Tartans können so stark wie Rüstungen sein, und der kleinste Schnitt eines Messers löst bisweilen unergründliche Angst aus. Die launischen Geister, die die Insel mit Feuer, Wasser, Erde und Wind regieren, treiben ihren Schabernack mit den Menschen, die die Insel ihr Zuhause nennen. Der Barde Jack Tamerlaine hat seit zehn langen Jahren keinen Fuß mehr auf Cadence gesetzt, doch als mehrere junge Mädchen von der Insel verschwinden, wird er gerufen, um bei der Suche nach den Vermissten zu helfen. Der Hilferuf kommt unerwartet, stammt er doch von Adaira – Jacks erklärter Feindin aus Kindertagen. Sie ist bereit, ihren alten Zwist zu vergessen, denn sie weiß, dass die Geister ausschließlich auf die Musik eines Barden reagieren, und so hofft sie, dass Jack sie mit seinem Gesang anlocken kann, damit sie die verschwundenen Mädchen zurückbringen. Doch mit jedem weiteren Lied wird deutlich, dass der Zwist mit den Geistern unheimlicher ist, als sie zunächst erwartet hatten, und ein älteres, dunkles Geheimnis über Cadence lauert, das sie alle zu vernichten sucht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ins Deutsche übertragen von Kerstin Fricke
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Copyright © 2023 Rebecca Ross. All rights reserved.
Titel der Amerikanischen Originalausgabe: »A River Enchanted« by Rebecca Ross, published in the US by Harper Voyager an imprint of HarperCollins Publishers LLC.
Designed by Paula Russle Szafranski
Map Design by Nick Springer / Springer Cartographics LLC
Wave illustrations © perori / Shutterstock
Deutsche Ausgabe 2023 Panini Verlags GmbH, Schloßstr. 76, 70176 Stuttgart.
Alle Rechte vorbehalten.
Geschäftsführer: Hermann Paul
Head of Editorial: Jo Löffler
Head of Marketing: Holger Wiest (E-Mail: [email protected])
Presse & PR: Steffen Volkmer
Übersetzung: Kerstin Fricke
Lektorat: Mona Gabriel
Umschlaggestaltung: tab indivisuell, Stuttgart
Satz und E-Book: Greiner & Reichel, Köln
YDROSS001E
ISBN 978-3-7367-9810-6
Gedruckte Ausgabe:
1. Auflage, März 2023,
ISBN 978-3-8332-4336-3
Findet uns im Netz:
www.paninicomics.de
PaniniComicsDE
Für meine Brüder Caleb, Gabriel und Luke, die immer die besten Geschichten kennen.
1
Ein Lied für das Wasser
1
Es war am sichersten, den Ozean bei Nacht zu überqueren, wenn sich der Mond und die Sterne auf dem Wasser spiegelten. Zumindest hatte man das Jack immer erzählt. Er war sich allerdings nicht sicher, ob diese alten Grundsätze heutzutage noch galten.
Jack war gerade in Woe eingetroffen, einem Fischerdorf an der Nordküste des Festlands, und hielt sich die Nase zu, weil das Dorf einen durchaus passenden Namen trug und elendig nach Hering stank. Eiserne Gartentore waren von Rost verfärbt, die Häuser standen schief und krumm auf Pfählen, und die Fensterläden waren verriegelt, um nicht im gnadenlos jaulenden Wind zu klappern. Selbst die Taverne war geschlossen, das Feuer erloschen, die Bierfässer hatte man längst verkorkt. Das Einzige, was sich überhaupt bewegte, waren die streunenden Katzen, die die Milch aufleckten, die in Schälchen für sie auf den Türschwellen bereitstand, und die Schiffe und Ruderboote, die am Kai auf dem Wasser tanzten.
Alles war ruhig und in Träume versunken.
Vor zehn Jahren hatte er zum ersten und einzigen Mal das Meer überquert. Er war von der Insel zum Festland gereist, was etwa zwei Stunden dauerte, wenn der Wind günstig stand. Damals war er in genau diesem Dorf eingetroffen, nachdem ihn ein alter Seemann über das im Sternenlicht funkelnde Wasser gebracht hatte. Der Mann war von den vielen Jahren in Wind und Sonne wettergegerbt und drahtig gewesen und hatte nicht davor zurückgeschreckt, sich der Insel in seinem Ruderboot zu nähern.
Jack erinnerte sich noch gut daran, wie er das erste Mal das Festland betreten hatte. Damals war er elf Jahre alt gewesen und hatte als Erstes festgestellt, dass es hier anders roch, selbst mitten in der Nacht. Der Geruch nach nassem Tau, Fisch und Rauch hatte ihn irgendwie an ein verrottendes Märchenbuch erinnert. Selbst das Land unter seinen Stiefeln hatte sich anders angefühlt, als würde es härter und trockener, je weiter er in den Süden gelangte.
»Wo sind die Stimmen im Wind?«, hatte er den Seemann gefragt.
»Das alte Volk spricht hier nicht, Junge«, hatte der Mann geantwortet und den Kopf geschüttelt, als er glaubte, Jack würde nicht hinsehen.
Es dauerte noch einige Wochen, bis Jack gelernt hatte, dass Kinder, die auf der Insel Cadence zur Welt kamen, als halbwild und seltsam angesehen wurden. Nicht viele kamen so wie Jack zum Festland, und weitaus weniger blieben so lange, wie er es getan hatte.
Selbst nach zehn Jahren fiel es Jack schwer, seine erste Mahlzeit auf dem Festland zu vergessen und wie trocken und schrecklich sie geschmeckt hatte. Oder das erste Betreten der Universität, die ihn mit ihrer Größe in Erstaunen versetzt hatte und mit der Musik, die durch ihre langen gewundenen Korridore hallte. Und er erinnerte sich noch genau an den Augenblick, in dem ihm klar wurde, dass er wohl nie mehr auf die Insel zurückkehren würde.
Jack seufzte, und seine Erinnerungen zerfielen zu Staub. Es war spät. Er war seit einer Woche unterwegs, und jetzt war er hier, jeglicher Logik zum Trotz, und bereitete sich darauf vor, erneut den Ozean zu überqueren. Nun musste er nur noch den alten Seemann finden.
Er lief eine der Straßen entlang und versuchte, sich daran zu erinnern, wo der unerschrockene Mann lebte, der ihn zuvor über das Wasser gebracht hatte. Katzen huschten aus dem Weg, und eine leere Flasche rollte über die unebenen Pflastersteine und schien ihm zu folgen. Endlich entdeckte er eine Tür, die ihm bekannt vorkam, direkt am Rand der Siedlung. Eine Laterne hing vor dem Haus und tauchte die Tür mit der abblätternden roten Farbe in ein schwaches Licht. Ja, damals war es auch eine rote Tür gewesen, fiel Jack wieder ein. Und ein Türklopfer aus Messing, geformt wie ein Tintenfisch. Dies war das Haus des furchtlosen Seemanns.
Einst hatte Jack an derselben Stelle gestanden, und er konnte sich sehr gut vorstellen, wie er damals ausgesehen hatte: ein spindeldürrer, vom Wind gepeitschter Junge, der das Gesicht verzog, um die Tränen in seinen Augen zu verbergen.
»Komm mit, Kleiner«, hatte der Seemann nach dem Andocken gesagt und Jack die Stufen hinauf zur roten Tür geführt. Damals war es mitten in der Nacht und bitterkalt gewesen. Was für ein Willkommen auf dem Festland. »Du kannst hier schlafen und morgen früh die Kutsche in den Süden zur Universität nehmen.«
Jack hatte genickt, in jener Nacht jedoch kein Auge zugetan. Er hatte sich im Haus des Seemanns auf den Boden gelegt, in seine Decke gewickelt und zu schlafen versucht. Doch er hatte nur an die Insel denken können. An die Monddisteln, die bald blühen würden, und er hatte seine Mutter dafür gehasst, dass sie ihn fortschickte.
Irgendwie war er nach diesem quälenden Moment erwachsen geworden und hatte an einem fremden Ort Wurzeln geschlagen. Allerdings musste er offen zugeben, dass er sich immer noch spindeldürr fühlte und wütend war auf seine Mutter.
Jack ging die wackeligen Stufen hinauf, wobei ihm das Haar in die Augen geweht wurde. Er hatte Hunger und wenig Geduld, obwohl er um Mitternacht an diese Tür klopfte. Wieder und wieder ließ er den Messingtintenfisch gegen das Holz prallen. Er hörte nicht auf, selbst dann nicht, als er drinnen jemanden fluchen hörte und das Schloss geöffnet wurde. Ein Mann zog die Tür einen Spalt weit auf und starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen an.
»Was wollt Ihr?«
Jack wusste sofort, dass dies nicht der Seemann war, den er suchte. Dieser Mann war zu jung, auch wenn die Elemente bereits ihre Spuren in seinem Gesicht hinterlassen hatten. Ein Fischer vermutlich, da aus seinem Haus der Geruch nach Austern, Rauch und billigem Bier herauswehte.
»Ich suche einen Seemann, der mich nach Cadence bringen kann«, erwiderte Jack. »Hier wohnte vor Jahren einer, mit dem ich von der Insel aufs Festland gelangt bin.«
»Das muss mein Vater gewesen sein«, erwiderte der Fischer barsch. »Und er ist tot und kann Euch nicht mehr hinbringen.« Der Mann wollte die Tür schon wieder schließen, doch Jack schob einen Fuß in den Spalt und hinderte ihn daran.
»Mein Beileid. Könnt Ihr mich hinbringen?«
Bei dieser Frage riss der Fischer die blutunterlaufenen Augen auf und schnaubte. »Nach Cadence? Nein. Nein, das kann ich nicht.«
»Habt Ihr Angst?«
»Angst?« Die Laune des Mannes wurde schlagartig noch schlechter. »Ich weiß nicht, wo Ihr die letzten ein oder zwei Jahrzehnte verbracht habt, aber die Clans der Insel sind sehr eigen und mögen keine Besucher. Falls Ihr töricht genug seid, dorthin zu reisen, müsst Ihr vorher mit einem Raben eine Anfrage stellen. Und danach müsst Ihr warten, bis der Laird, den Ihr aufsuchen wollt, die Überquerung genehmigt. Da die Lairds der Insel sich jedoch gern Zeit lassen, müsst Ihr vermutlich eine Weile warten. Besser wäre es allerdings, gleich auf die herbstliche Tagundnachtgleiche zu warten, zu der der nächste Handel stattfindet. Und ich rate Euch, genau das zu tun.«
Wortlos zog Jack ein zusammengefaltetes Pergamentstück aus der Manteltasche. Er reichte dem Fischer den Brief, der ihn stirnrunzelnd im Licht der Laterne las.
Jack kannte den Inhalt auswendig. Er hatte ihn unzählige Male gelesen, seitdem der Brief vergangene Woche eingetroffen war und sein Leben völlig unverhofft aus dem Tritt gebracht hatte.
Deine sofortige Anwesenheit ist aus dringenden Gründen erforderlich. Bitte kehre direkt nach Erhalt dieses Briefes mit deiner Harfe nach Cadence zurück.
Unter der schön geschwungenen Schrift prangten die Signatur seines Lairds und darunter der Abdruck von Alastair Tamerlaines Siegelring in weinroter Tinte, was aus dieser Bitte einen Befehl machte.
Nach einem Jahrzehnt, in dem er so gut wie keinen Kontakt zu seinem Clan gehabt hatte, wurde Jack nun nach Hause gerufen.
»Ihr seid ein Tamerlaine?« Der Fischer gab ihm den Brief zurück. Erst jetzt ging Jack auf, dass der Mann vermutlich gar nicht lesen konnte und nur das Wappen erkannt haben musste.
Jack nickte, und der Fischer musterte ihn intensiv.
Er ließ die eingehende Prüfung wortlos über sich ergehen, da er ganz genau wusste, dass an ihm und seinem Erscheinungsbild nichts Außergewöhnliches war. Jack war groß und dünn, als hätte er über Jahre zu wenig zu essen bekommen, und schien nur aus scharfen Kanten und unbeugsamem Stolz zu bestehen. Seine Augen waren dunkel, seine Haare braun. Aufgrund der vielen Stunden, die er mit dem Lehren und Komponieren im Haus verbrachte, war seine Haut blass, und er trug wie üblich sein Hemd und seine Hose, beides in Grau, wobei die Kleidungsstücke nach den fettigen Tavernenmahlzeiten fleckig geworden waren.
»Ihr seht aus wie einer von uns«, stellte der Fischer fest.
Jack wusste nicht, ob er erfreut oder beleidigt sein sollte.
»Was habt Ihr da auf dem Rücken?«, erkundigte sich der Fischer und starrte Jacks Tasche an.
»Meine Harfe«, entgegnete Jack knapp.
»Das erklärt einiges. Ihr seid hergekommen, um Euch ausbilden zu lassen?«
»So ist es. Ich bin Barde und war auf der Universität in Faldare. Würdet Ihr mich jetzt bitte zur Insel bringen?«
»Das kostet was.«
»Wie viel?«
»Ich will Euer Geld nicht. Ich will einen auf Cadence geschmiedeten Dolch«, erklärte der Fischer. »Ich hätte gern einen Dolch, mit dem ich alles durchtrennen kann: Seile, Netze, Schuppen … das Glück meiner Rivalen.«
Die Bitte um eine verzauberte Klinge wunderte Jack nicht. Derartige Objekte ließen sich nur auf Cadence schmieden und waren sehr kostspielig.
»Ja, das lässt sich einrichten«, sagte Jack nach kurzem Überlegen. Er dachte dabei an den Dolch seiner Mutter, den mit dem Silbergriff, den sie stets in der Scheide an ihrer Seite trug, wenngleich Jack noch nie gesehen hatte, dass sie ihn benutzte. Aber er wusste, dass der Dolch verzaubert war; das Schimmern konnte man deutlich erkennen, wenn man die Waffe nicht direkt ansah. Sie war von einem leichten Schleier umgeben, als wäre Feuerschein mit in den Stahl eingearbeitet worden.
Er hatte nicht die geringste Ahnung, was seine Mutter Una Carlow dafür bezahlt hatte oder wie viel Una im Gegenzug für die Herausgabe der Klinge hatte leiden müssen.
Er streckte die Hand aus, und der Fischer schlug ein.
»Einverstanden«, sagte der Mann. »Wir brechen bei Tagesanbruch auf.« Er wollte die Tür schließen, aber Jack weigerte sich, den Fuß wegzunehmen.
»Wir müssen jetzt aufbrechen«, beharrte er. »Solange es dunkel ist. Dann ist die Überfahrt am sichersten.«
Dem Fischer fielen beinahe die Augen aus dem Kopf. »Seid Ihr noch ganz bei Trost? Ich würde diese Überfahrt bei Nacht nicht mal für einhundert verzauberte Dolche machen!«
»In dieser Hinsicht müsst Ihr mir vertrauen«, ließ Jack nicht locker. »Raben mögen den Lairds tagsüber Nachrichten bringen, und die Handelskogge segelt zu Beginn jeder Jahreszeit, aber man muss im Dunkeln rüberrudern, wenn sich der Mond und die Sterne auf dem Wasser spiegeln.«
Wenn sich die Geister des Wassers leicht besänftigen lassen, fügte er innerlich hinzu.
Der Fischer starrte ihn verblüfft an. Jack wartete; er war bereit, hier die ganze Nacht und auch den nächsten Tag auszuharren, wenn es sein musste, was der Fischer offenbar spürte, denn er gab nach.
»In Ordnung. Für zwei Cadence-Dolche bringe ich Euch heute Nacht übers Wasser. Wir treffen uns in ein paar Minuten an meinem Boot. Es ist das ganz rechts am Ankerplatz.«
Jack warf über die Schulter einen Blick zum dunklen Kai hinüber. Das schwache Mondlicht glitzerte auf den Rümpfen und Masten, und er entdeckte das Boot des Fischers, ein recht bescheidenes, das einst seinem Vater gehört und Jack beim ersten Mal über das Wasser getragen hatte.
Kaum hatte er einen Schritt gemacht, wurde die Tür hinter ihm auch schon wieder verriegelt. Kurz fragte er sich, ob der Fischer ihn nur hatte loswerden wollen, indem er zustimmte, damit Jack vor seiner Tür verschwand, dennoch ging er schnellen Schrittes und guter Hoffnung zum Kai, wobei ihn der Wind auf der nassen Straße beinahe von den Beinen holte.
Er hob den Blick und starrte in die Dunkelheit hinaus. Auf dem Meer waberte eine Spur aus Sternenlicht, ein silbriger Weg, dem der Fischer folgen musste, um Cadence zu erreichen. Die Mondsichel hing wie ein Lächeln am Himmel, umgeben von den sommersprossenartigen Sternen. Vollmond wäre ideal gewesen, doch Jack hatte keine Zeit, um darauf zu warten.
Zwar wusste er nicht, weshalb sein Laird ihn nach Hause rief, doch er hatte so eine Ahnung, dass es kein freudiges Wiedersehen werden würde.
Es kam ihm vor, als hätte er eine Stunde gewartet, als er endlich das an ein Glühwürmchen erinnernde Licht einer Laterne sah. Der Fischer stemmte sich mit eingezogenen Schultern und finsterer Miene gegen den Wind und hatte sich eine schützende Öljacke übergezogen.
»Ich hoffe, Ihr haltet Euer Wort, Barde«, brummelte er. »Ich will zwei Cadence-Dolche für all diese Mühe.«
»Andernfalls wisst Ihr ja, wo wo Ihr mich findet«, erwiderte Jack barsch.
Der Fischer starrte ihn finster an, wobei ein Auge größer wirkte als das andere. Dann deutete er mit dem Kinn auf sein Boot. »Einsteigen.«
Und so verließ Jack zum ersten Mal das Festland.
* * *
Das Meer war zuerst sehr aufgewühlt.
Jack klammerte sich am Dollbord des Bootes fest, und sein Magen rebellierte, weil das Boot einen wilden Tanz hinlegte und heftig schwankte. Die Wellen wogten, doch der kräftige Fischer durchschnitt sie wacker und ruderte sie weiter auf die See hinaus. Er folgte der Spur aus Mondlicht, wie Jack vorgeschlagen hatte, und schon bald beruhigte sich das Meer. Der Wind jaulte weiter, doch es war noch immer der Wind des Festlands, der nichts als kalten Sand in seinem Atem mit sich führte.
Als Jack über die Schulter schaute, sah er die Laternen von Woe zu winzigen Flecken schrumpfen, und seine Augen brannten, was ihm verriet, dass sie bald in die Gewässer der Inseln wechseln würden. Er konnte es spüren, als hätte Cadence einen Blick, der ihn in der Finsternis fand und fixierte.
»Vor einem Monat wurde eine Leiche an den Strand gespült«, riss der Fischer Jack unverhofft aus seinen Gedanken. »Hat uns in Woe ganz schön erschreckt.«
»Wie bitte?«
»Ein Breccan, jedenfalls den Waid-Tätowierungen auf seiner aufgeblähten Haut nach. Sein blaues Plaid kam kurz nach ihm an Land.« Der Mann machte eine Pause, ruderte jedoch weiter und tauchte die Riemen in einem hypnotisierenden Rhythmus ins Wasser. »Mit aufgeschlitzter Kehle. Vermutlich war das jemand aus Eurem Clan, der die unglückliche Seele dann ins Meer geworfen hat. Damit wir den Schlamassel beseitigen, wenn die Gezeiten uns die Leiche vor die Haustür legen.«
Jack sah den Fischer schweigend an, während er bis auf die Knochen erschauderte. Selbst nach all diesen Jahren fern der Heimat durchfuhr ihn beim Klang des Namens seines Feindes die Angst.
»Es könnte auch einer aus seinem eigenen Clan gewesen sein«, erwiderte Jack. »Die Breccan sind für ihre Blutrünstigkeit bekannt.«
Der Fischer gluckste. »Soll ich allen Ernstes einen Tamerlaine für unvoreingenommenen halten?«
Jack hätte ihm diverse Geschichten über Überfälle erzählen können. Dass die Breccan in den Wintermonaten häufig die Clangrenzen überschritten und die Tamerlaines bestahlen. Sie plünderten und verwundeten, sie raubten gnadenlos, und Jack spürte, wie sein Hass wie Rauch in ihm aufstieg, als er sich daran erinnerte, wie er sich als kleiner Junge vor ihnen gefürchtet hatte.
»Wie kam es eigentlich zu dieser Fehde, Barde?«, hakte der Fischer nach. »Erinnert sich überhaupt noch jemand daran, warum ihr einander hasst, oder folgt ihr einfach dem Weg, den eure Ahnen euch vorgezeichnet haben?«
Jack seufzte. Er hatte sich bloß eine schnelle, ruhige Überfahrt gewünscht. Doch er kannte die Geschichte. Es war eine alte, mit Blut getränkte Sage, die sich wie die Sternenkonstellationen veränderte, je nachdem, wer sie erzählte – der Osten oder der Westen, die Tamerlaines oder die Breccan.
Er dachte darüber nach. Die Strömung ließ nach, und das Zischen des Windes ging in ein schmeichelndes Flüstern über. Selbst der Mond stand tiefer am Himmel, als könne er es kaum erwarten, die Legende zu hören. Der Fischer spürte es ebenfalls. Er schwieg und ruderte langsamer, als würde er darauf warten, dass Jack der Geschichte Leben einhauchte.
»Vor den Clans gab es das alte Volk«, setzte Jack an. »Die Erde, die Luft, das Wasser und das Feuer. Sie schenkten Cadence Leben und Gleichgewicht. Aber schon bald fühlten sich die Geister einsam und waren es leid, nur ihre eigenen Stimmen zu hören und ihre eigenen Gesichter zu sehen. Der Nordwind ließ ein Schiff vom Kurs abkommen, das an den Felsen der Insel zerschellte. Unter dem Treibgut befand sich auch ein wilder und arroganter Clan, die Breccan, die auf der Suche nach neuem Land waren.
Nicht viel später brachte auch der Südwind ein Schiff auf Irrwegen zur Insel. Darauf befand sich der Tamerlaine-Clan, der sich Cadence ebenfalls zur Heimat machte. Die Insel war zwischen den beiden Clans aufgeteilt, wobei die Breccan im Westen und die Tamerlaines im Osten lebten. Und die Geister segneten das, was sie erschufen.
Zuerst herrschte Frieden. Doch es dauerte nicht lange, bis es immer mehr zu Auseinandersetzungen und Handgemengen zwischen den Clans kam, bis erste Gerüchte über einen Krieg im Wind mitschwangen. Joan Tamerlaine, die Laird des Ostens, hoffte, den Konflikt abzuwenden, indem sie die Insel einte. Sie war bereit, einer Hochzeit mit dem Laird der Breccan zuzustimmen, solange trotz der Differenzen zwischen den Clans weiterhin Frieden herrschte und man einander mit Mitgefühl begegnete. Als Fingal Breccan ihre Schönheit sah, beschloss er, dass er ebenfalls Harmonie wünschte. ›Komm und werde mein Weib‹, sagte er, ›auf dass unser beider Clans vereint werden.‹
Joan heiratete ihn und lebte bei Fingal im Westen, doch die Zeit verstrich und Fingal zögerte die offizielle Unterzeichnung eines Friedensabkommens immer wieder hinaus. Joan musste indes feststellen, dass die Breccan streng und grausam waren, und konnte sich nicht an diese Lebensart anpassen. Entsetzt über das viele Blutvergießen, strebte sie danach, ihnen die Gebräuche des Ostens nahezubringen in der Hoffnung, diese im Westen ebenfalls zu verankern und dem Clan zu mehr Güte zu verhelfen. Aber Fingal ärgerte sich über ihre Wünsche und war der Ansicht, sie würde den Westen nur schwächen, daher weigerte er sich, die Art der Tamerlaines anzunehmen.
Nicht viel später hing der Frieden nur noch am seidenen Faden und Joan begriff, dass Fingal überhaupt nicht die Absicht hatte, die Insel zu einen. Er sagte etwas, handelte hinter ihrem Rücken jedoch völlig anders, und die Breccan überfielen immer häufiger den Osten und beraubten die Tamerlaines. Joan, die starkes Heimweh plagte und die Fingal leid war, reiste bald darauf ab, doch sie schaffte es gerade mal bis in die Mitte der Insel, wo Fingal sie einholte.
Sie stritten sich, sie kämpften. Joan zückte ihren Dolch und schnitt sich von ihm los – Namen, Eid, Geist und Körper, doch nicht ihr Herz, das ihm nie gehört hatte. Sie brachte ihm einen winzigen Schnitt an der Kehle bei, an derselben Stelle, an der sie ihn einst in der Nacht geküsst hatte, als sie vom Osten träumte. Die kleine Verletzung blutete stark, und Fingal spürte, wie das Leben aus seinem Leib wich. Als er fiel, riss er sie mit sich und stieß ihr seinen Dolch in die Brust, um das Herz zu durchbohren, das ihm nie gehört hatte.
Sie verfluchten einander und den Clan des jeweils anderen und starben eng umschlungen, benetzt mit beider Blut, genau an der Stelle, an der der Osten auf den Westen trifft. Die Geister fühlten den Riss, als die Clanlinie gezogen wurde, und die Erde trank das Blut der Sterblichen, nahm den Streit und das gewaltsame Ende in sich auf. Der Frieden wurde zu einem fernen Traum, und das ist auch der Grund dafür, warum die Breccan noch immer stehlen und plündern, warum sie sich nach etwas verzehren, das ihnen nicht gehört, und warum sich die Tamerlaines weiterhin verteidigen, Kehlen aufschlitzen und Herzen mit ihren Klingen durchbohren.«
Der Fischer hatte gebannt gelauscht und das Rudern eingestellt. Als Jack verstummte, schüttelte sich der Mann, runzelte die Stirn und griff abermals nach den Riemen. Der Halbmond setzte seine bogenförmige Bahn über den Himmel fort, die Sterne dimmten ihr Licht, und der Wind heulte erneut, da die Geschichte nun zu Ende war.
Das Meer ließ die Wellen wieder tanzen, und Jack richtete den Blick auf die ferne Insel, die er nach zehn langen Jahren zum ersten Mal wiedersah.
Cadence war bei Nacht dunkler, ein Schatten vor dem Meer und dem Sternenhimmel. Lang und zerklüftet erstreckte sich die Insel vor ihnen wie ein ausgestreckter Drache, der in den Wellen schlief. Bei diesem Anblick war Jacks Herz gerührt, dieser elende Verräter. Schon bald würde er abermals auf dem Boden wandeln, auf dem er aufgewachsen war, und er wusste nicht, ob man ihn dort willkommen heißen würde oder nicht.
Er hatte seiner Mutter seit drei Jahren nicht geschrieben.
»Ihr seid ein kranker Haufen, wenn Ihr mich fragt«, murmelte der Fischer. »All dieser Unsinn und dieses Gerede über Geister.«
»Dann verehrt Ihr das alte Volk nicht?«, fragte Jack, wenngleich er die Antwort längst kannte. Auf dem Festland gab es keine Feengeister, sondern nur die Patina von Göttern und Heiligen, mit denen die Altarräume der Kirchen verziert waren.
Der Fischer schnaubte. »Habt Ihr etwa schon mal einen Geist gesehen?«
»Ich habe Hinweise auf sie gesehen«, antwortete Jack bedächtig. »Sie zeigen sich Sterblichen nur äußerst selten.« Unwillkürlich musste er an die zahllosen Stunden denken, die er als Junge durch die Hügel gestreift war, immer auf der Suche nach einem Geist inmitten der Heide. Selbstverständlich hatte er nie einen gefunden.
»Hört sich für mich eher wie purer Unsinn an.«
Jack sagte nichts mehr, und das Boot glitt näher an die Insel heran.
Er konnte die goldenen Flechten auf den östlichen Felsen sehen, die Licht ausstrahlten und die Küste der Tamerlaines markierten. Sofort brachen Erinnerungen über ihn herein. Er dachte daran, dass alles, was auf der Insel wuchs, irgendwie seltsam und oftmals verzaubert war. Er hatte die Küste unzählige Male erkundet, zu Mirins großer Frustration und Sorge. Doch jedes Mädchen und jeder Junge auf der Insel wurde von den Strudeln, Wirbeln und geheimen Höhlen am Ufer angezogen. Ebenso bei Tage wie auch in der Nacht, wenn die Flechten so golden glühten, als wäre noch etwas Sonnenlicht auf den Felsen zurückgeblieben.
Auf einmal bemerkte er, dass sie im Wasser trieben. Der Fischer ruderte, doch sie wandten sich von den Flechten ab, als würde das Boot von dem dunklen Streifen an der Westküste angezogen.
»Wir gelangen in Breccan-Gewässer.« Jack hatte vor Schreck einen Kloß in der Kehle. »Ihr müsst uns schnell wieder gen Osten rudern.«
Der Fischer keuchte und tat, was Jack verlangt hatte, doch sie kamen quälend langsam voran. Irgendetwas stimmte nicht, ging Jack auf, und sowie er spürte, dass Ärger drohte, legte sich der Wind und das Meer wurde so glatt und glasig wie ein Spiegel. Alles wurde ruhig; eine ohrenbetäubende Stille senkte sich auf sie herab, bei der ihm die Nackenhaare zu Berge standen.
Tapp.
Der Fischer erstarrte und riss die Augen so weit auf, dass sie Vollmonden glichen. »Habt Ihr das gehört?«
Jack hob eine Hand. Seid still, wollte er den Mann ermahnen, aber er hielt den Mund und wartete darauf, dass sich die Warnung wiederholte.
Tapp. Tapp. Tapp.
Er spürte es in den Schuhsohlen. Etwas war im Wasser und fuhr mit langen Nägeln über die Unterseite des Bootsrumpfs. Suchte nach einer Schwachstelle.
»Bei der Göttermutter«, flüsterte der Fischer mit schweißnassem Gesicht. »Woher kommt dieses Geräusch?«
Jack schluckte schwer. Ihm stand ebenfalls der Schweiß auf der Stirn, und sein Körper war so angespannt wie die Saiten seiner Harfe, als die Klauen unter ihnen weiter gegen das Holz tippten.
Die Geringschätzung des Festländers hatte das heraufbeschworen. Der Fischer hatte das alte Volk des Wassers beleidigt, das sich wahrscheinlich in der Gischt auf den Wellen versammelt hatte, um Jacks Geschichte zu lauschen. Und nun würden beide Männer dafür mit einem sinkenden Boot und einem wässrigen Grab bezahlen müssen.
»Verehrt Ihr die Geister?«, fragte Jack leise und starrte den Mann an.
Der Fischer riss den Mund auf, und Furcht spiegelte sich auf seiner Miene wider. Auf einmal drehte er das Boot und ruderte mit ganzer Kraft in Richtung Woe zurück.
»Was soll das werden?«, rief Jack.
»Weiter fahre ich nicht«, sagte der Fischer. »Ich will nichts mit Eurer Insel und dem, was in diesem Wasser lebt, zu tun haben.«
Jack kniff die Augen zusammen. »Wir hatten eine Abmachung.«
»Ihr könnt über Bord springen und ans Ufer schwimmen oder mit mir zurückkehren.«
»Dann lasse ich Eure Dolche auch nur zu zwei Dritteln schmieden. Wie würde Euch das gefallen?«
»Behaltet Eure verdammten Dolche.«
Jack war sprachlos. Der Fischer hatte sie schon fast aus den Gewässern der Insel weggebracht, doch Jack durfte nicht ans Festland zurückkehren. Nicht jetzt, wo er der Heimat schon so nahe war, dass er die Flechten sehen und die kühle Süße der Berge schmecken konnte.
Er stand auf und drehte sich im Boot um, das daraufhin zu schaukeln anfing. Wenn er seinen Mantel und die Ledertasche mit seiner Kleidung zurückließ, würde er die Entfernung auch schwimmend überbrücken können. Er konnte ans Ufer schwimmen, würde sich jedoch in feindlichen Gewässern befinden.
Außerdem brauchte er seine Harfe. Laird Alastair hatte explizit danach verlangt.
Rasch öffnete er seine Tasche und holte seine Harfe heraus, die er in ein Öltuch eingeschlagen hatte. Das Meerwasser würde das Instrument ruinieren, doch dann kam ihm eine Idee. Er kramte erneut in seiner Tasche herum und fand das Stück Tamerlaine-Plaid, das er seit Verlassen der Insel nicht mehr getragen hatte.
Als seine Mutter es für ihn gewebt hatte, war er acht Jahre alt gewesen und auf der Inselschule in immer mehr Prügeleien geraten. Sie hatte es verzaubert, indem sie ein Geheimnis ins Muster webte, und er war hocherfreut gewesen, da sich sein Erzfeind die Hand brach, als er Jack das nächste Mal in den Bauch boxen wollte.
Jack starrte das Stoffstück an, das nun so unscheinbar wirkte. Es war weich, wenn man es auf den Boden legte, aber hart wie Stahl, sobald es etwas wie ein Herz oder eine Lunge schützte. Oder in diesem Fall großer Verzweiflung eine Harfe, die ins Wasser getaucht werden würde.
Er wickelte sein Instrument in die karierte Wolle ein und schob es zurück in die Hülle. Ihm blieb nichts anderes übrig, als ans Ufer zu schwimmen, bevor der Fischer ihn noch weiter davon wegbrachte.
Nachdem er seinen Mantel abgelegt hatte, drückte er seine Harfe an sich und sprang über Bord.
Das Wasser war bitterkalt. Der Schock raubte ihm zuerst den Atem, und das Meer drohte, ihn ganz zu verschlingen. Er durchbrach keuchend die Oberfläche, das Haar klebte ihm im Gesicht, und seine aufgesprungenen Lippen brannten ob des Salzes. Der Fischer ruderte immer weiter weg und hinterließ nur ein Kräuseln der Furcht auf der Oberfläche.
Jack spuckte dem Festländer noch einmal hinterher, bevor er sich der Insel zuwandte. Er konnte nur beten, dass ihm die Geister des Wassers gewogen sein würden, als er sich schwimmend auf den Weg nach Cadence machte. Dabei hielt er den Blick auf die leuchtenden Flechten gerichtet, um ja an der sichereren Tamerlaine-Küste an Land zu gehen. Doch sobald er sich in Bewegung setzte, rollten die Wellen über ihn hinweg und die Strömung kehrte lachend zurück. Er wurde nach unten gezerrt und vom Wasser mitgezogen.
Angst durchtoste ihn und hämmerte in seinen Adern, bis ihm aufging, dass er jedes Mal die Oberfläche erreichte, wenn er dies wollte. Sobald er das dritte Mal Luft geholt hatte, begriff Jack, dass die Geister mit ihm spielten. Hätten sie ihn ertränken wollen, wäre das längst geschehen.
Aber natürlich, dachte er und versuchte, näher ans Ufer zu schwimmen, während die Strömung ihn erneut nach unten zog. Selbstverständlich würde seine Heimkehr nicht derart mühelos vonstattengehen. Er hätte mit einem derartigen Empfang rechnen müssen.
Er schabte sich am Riff eine Handfläche auf. Der linke Schuh wurde ihm vom Fuß gerissen. Mit einem Arm umklammerte er seine Harfe, die andere Hand streckte er in der Hoffnung aus, die Oberfläche zu erreichen. Diesmal stieß er nur auf Wasser, das ihm zwischen den Fingern hindurchrann. Im Dunkeln schlug er die Augen auf und sah erschrocken eine Frau, die mit glänzenden Schuppen vor ihm durchs Wasser huschte und deren langes Haar ihn im Gesicht kitzelte.
Erschauernd hätte er beinahe das Schwimmen vergessen.
Irgendwann hatten die Wellen genug von ihm und spuckten ihn auf einem sandigen Strandstreifen aus. Mehr Erbarmen hatten sie nicht mit ihm. Hustend kroch er über den Sand. Er wusste sofort, dass er sich auf Breccan-Boden befand, und bei dem Gedanken drohten seine Knochen wie Wachs zu schmelzen. Jack brauchte einen Moment, bis er sich aufrappeln und wieder besinnen konnte.
Die Clangrenze war bereits zu sehen. Sie war durch Steine gekennzeichnet, die wie Zähne in einer Reihe aus dem Strand ragten und bis hinein ins Meer verliefen, wo ihre Spitzen irgendwann in den Fluten verschwanden. Sie war noch etwa einen Kilometer entfernt, und das ferne Leuchten der Flechten schien ihm zuzurufen: Beeil dich! Beeil dich!
Jack rannte, ein Fuß nackt und frierend, der andere im nassen Schuh schmatzend. Er bahnte sich einen Weg zwischen verworrenem Treibholz und einem kleinen Strudel hindurch, der glitzerte wie ein Traum, aus dem man gleich erwachen würde. Es ging unter einem steinernen Bogen hindurch, und er glitt über einen weiteren Felsen, der mit Moos bedeckt war, bis er endlich die Clanlinie erreichte.
Dort hievte er sich über die vom Meeresnebel feuchten Felsen. Keuchend taumelte er auf Tamerlaine-Territorium. Hier konnte er endlich durchatmen, er blieb auf dem Sand stehen und holte tief und langsam Luft. Einen Augenblick lang war alles ruhig und friedlich, nur das Rauschen des Meeres hing in der Luft. Doch dann wurde er auch schon von den Beinen geholt. Er fiel hin und ließ vor Schreck seine Harfe los. Im Sturz biss er sich auf die Unterlippe, und da spürte er das Gewicht einer Person, die auf ihn einprügelte.
Sein verzweifelter Drang, das Gebiet der Tamerlaines zu erreichen, hatte ihn die Ostwacht vergessen lassen.
»Ich habe ihn!«, rief sein Angreifer, der eher wie ein übereifriger Junge klang.
Jack keuchte, aber es hatte ihm die Sprache verschlagen. Das Gewicht auf seiner Brust verschwand, und er spürte zwei Hände, die sich fest wie eiserne Handschellen um seine Fußgelenke legten und ihn über den Strand schleiften. Panisch streckte er die Hände nach seiner Harfe aus. Er würde zweifellos Mirins Plaid vorzeigen müssen, um zu beweisen, wer er war, da sich der Brief des Lairds in seinem Mantel befand, den er hatte zurücklassen müssen. Doch seine Arme waren zu schwer, daher leistete er keinerlei Gegenwehr, obwohl er innerlich schäumte.
»Darf ich ihn töten, Hauptmann?«, fragte der Junge viel zu begierig.
»Vielleicht. Bring ihn erst mal her.«
Diese Stimme. Tief wie eine Schlucht und von leiser Heiterkeit durchdrungen. Erschreckend vertraut, selbst nach all diesen Jahren fern der Heimat.
Das musste ja so kommen, dachte Jack und schloss die Augen, weil ihm der Sand ins Gesicht stach.
Endlich ließ man ihn los, und er blieb erschöpft auf dem Rücken liegen.
»Ist er allein?«
»Ja, Hauptmann.«
»Bewaffnet?«
»Nein, Sir.«
Schweigen. Dann hörte Jack das Knirschen von Stiefeln auf dem Sand und verspannte sich, da sich jemand über ihn beugte. Zaghaft schlug er die Augen auf. Selbst im Dunkeln und mit nichts als Sternenlicht, das das Gesicht des Wachmanns erhellte, erkannte Jack ihn wieder.
Die Sternbilder krönten Torin Tamerlaine, der auf Jack herabblickte.
»Gib mir deinen Dolch, Roban«, verlangte Torin, woraufhin Jacks Schreck in Entsetzen umschlug.
Torin erkannte ihn nicht. Aber wieso hätte er das auch tun sollen? Als Torin Jack das letzte Mal gesehen und mit ihm gesprochen hatte, war Jack zehn Jahre alt gewesen und hatte mit dreizehn Distelnadeln im Gesicht lauthals geweint.
»Torin«, keuchte Jack.
Torin stutzte, hielt den Dolch allerdings fest in der Hand. »Was hast du gesagt?«
Jack hob eine Hand und stieß stotternd hervor: »Ich bin’s … Jack Tam… erlaine.«
Es hatte beinahe den Anschein, als würde Torin erstarren. Er rührte keinen Muskel und hielt die Klinge über Jack wie ein Omen dessen, was ihm bevorstand. Dann brüllte er: »Bring mir eine Laterne, Roban.«
Der Junge – Roban – lief los und kehrte mit einer Laterne in seiner Hand zurück. Torin nahm sie ihm ab und hielt sie so, dass Jack das Licht ins Gesicht fiel.
Jack musste die Augen zusammenkneifen, als es auf einmal hell wurde. Er schmeckte Blut, und seine Lippe schwoll ebenso an, wie seine Demütigung zunahm, während er wartete.
»Bei den Geistern«, murmelte Torin. Endlich verschwand das Licht und ließ nur vor Jacks Augen tanzende Flecken zurück. »Das ist ja nicht zu fassen.«
Er musste eine Spur des Jungen gefunden haben, der Jack vor zehn Jahren gewesen war. Eines stets unzufriedenen Jungen mit dunklen Augen. Denn Torin Tamerlaine legte den Kopf in den Nacken und lachte.
* * *
»Lieg nicht einfach so da. Steh auf, damit ich dich ansehen kann, Junge.«
Widerstrebend kam Jack Torins Aufforderung nach. Er rappelte sich auf und strich sich den Sand von der nassen Kleidung. Seine Handfläche brannte.
Er zögerte das Unausweichliche hinaus und fürchtete sich davor, den Wachmann anzusehen, dem er einst so sehr nachgeeifert hatte. Daher betrachtete Jack seine ungleichen Füße und den Schnitt auf seiner Hand. Die ganze Zeit über spürte er Torins Blick auf sich, und letzten Endes musste er ihn ebenfalls ansehen.
Überrascht stellte er fest, dass sie nun ungefähr gleich groß waren. Aber da hörten die Gemeinsamkeiten auch schon auf.
Torin war für die Insel gebaut: breitschultrig und stämmig, mit robusten, krummen Beinen und sehr muskulösen Armen. Seine Hände waren riesig, wobei er in der Rechten noch immer lässig den Dolch festhielt, und sein kantiges Gesicht zierte ein gestutzter Bart. Seine blauen Augen lagen weit auseinander, und nach zu vielen Prügeleien war seine Nase schief. Er hatte sein langes Haar in zwei Zöpfen zurückgebunden, die selbst um Mitternacht blond wie ein Weizenfeld aussahen. Außerdem trug er noch dieselbe Kleidung, an die sich Jack erinnerte: eine dunkle Wolltunika, die ihm bis zu den Knien reichte, dazu eine mit Silber besetzte Lederweste, ein braunrotes Jagdplaid über der Brust, das er mit einer Brosche zusammenhielt, auf der das Tamerlaine-Wappen prangte. Eine Hose trug er nicht, was er mit vielen Männern auf der Insel gemein hatte. Außerdem hatte Torin die üblichen kniehohen Stiefel aus ungegerbtem Leder an, die sich an seine Beine schmiegten und von Lederbändern zusammengehalten wurden.
Jack fragte sich, was Torin wohl von ihm halten mochte. Möglicherweise dachte er, dass Jack zu dünn war oder zu schwach und dürr aussah. Dass er zu blass war, weil er zu viel Zeit im Haus verbrachte. Dass seine Kleidung schäbig und schrecklich und seine Augen matt wirkten.
Doch Torin nickte nur zustimmend. »Du bist groß geworden, Junge. Wie alt bist du jetzt?«
»Ich werde diesen Herbst einundzwanzig«, antwortete Jack.
»Schön, schön.« Torin warf Roban einen Blick zu, der in der Nähe stand und Jack beäugte. »Schon in Ordnung, Roban. Er ist einer von uns. Das ist Mirins Junge.«
Diese Worte schienen Roban zu verblüffen. Er konnte kaum älter als fünfzehn sein, und seine Stimme brach, als er ausrief: »Du bist Mirins Sohn? Sie spricht oft von dir. Du bist Barde!«
Jack nickte erschöpft.
»Es ist lange her, dass ich einen Barden gesehen habe«, fügte Roban hinzu.
»Tja«, meinte Jack leicht genervt. »Dann kann ich nur hoffen, dass du meine Harfe an der Clanlinie nicht zerbrochen hast.«
Robans schiefes Grinsen verblasste. Er stand wie versteinert da, bis Torin ihn anwies, das Instrument zu holen. Während Roban fort war und sich auf die Suche machte, folgte Jack Torin zu einem kleinen Lagerfeuer im Schutz einer Meereshöhle.
»Setz dich, Jack«, sagte Torin. Er löste sein Plaid und warf es Jack über das Feuer zu. »Und trockne dich erst mal ab.«
Jack fing es ungeschickt auf. Kaum hatte er das Plaid berührt, wusste er auch schon, dass es sich um eine von Mirin verzauberte Weberei handelte. Welches von Torins Geheimnissen hatte sie wohl hineingewebt, fragte sich Jack gereizt, fror jedoch zu stark, um sich zu widersetzen. Daher legte er sich die karierte Wolle um die Schultern und hielt die Hände übers Feuer.
»Hast du Hunger?«, erkundigte sich Torin.
»Nein.« Jacks Magen war nach der Reise über das Wasser, dem Schreck, an der Breccan-Küste gelandet zu sein, und nachdem ihm Roban beinahe alle Zähne ausgeschlagen hatte, noch arg aufgewühlt. Erst jetzt merkte er, dass seine Hände zitterten. Torin registrierte das ebenfalls, und er reichte Jack seine Flasche, bevor er sich ihm gegenüber ans Feuer setzte.
»Mir ist aufgefallen, dass du aus dem Westen gekommen bist«, meinte Torin mit deutlichem Misstrauen in der Stimme.
»Bedauerlicherweise ist dem so«, bestätigte Jack. »Der Festländer, der mich zur Insel gerudert hat, bekam es auf einmal mit der Angst zu tun. Mir blieb nichts anderes übrig, als das letzte Stück zu schwimmen, und die Strömung trug mich in den Westen.«
Er trank zur Stärkung einen Schluck aus der Flasche. Das Heidebier war erfrischend und brachte neues Leben in seine Adern. Rasch nahm er noch einen zweiten Schluck und fühlte sich gefestigter und stärker – was, wie er wusste, nur daran lag, dass er etwas zu sich nahm, das auf der Insel gebraut worden war. Das Essen und die Getränke hier waren zehnmal so geschmackvoll wie alles, was man auf dem Festland bekam.
Als er Torin musterte, konnte er nun im Feuerschein die Hauptmannsbrosche an seiner Brust erkennen. Ein springender Hirsch mit einem Rubin als Auge. Ebenso fiel ihm die Narbe auf Torins linker Handfläche auf.
»Du wurdest zum Hauptmann befördert«, stellte Jack fest. Das kam nicht überraschend. Torin war schon in sehr jungen Jahren der beliebteste aller Wachmänner gewesen.
»Vor drei Jahren«, erwiderte Torin. Seine Miene wurde sanfter, als ginge ihm diese Erinnerung sehr nah. »Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du ungefähr so groß, Jack, und du hattest …«
»Dreizehn Distelnadeln im Gesicht«, beendete Jack den Satz amüsiert. »Gibt es diese Herausforderung noch immer bei der Ostwacht?«
»Jede dritte Frühlingstagundnachtgleiche. Aber Verletzungen wie deine habe ich seitdem nicht mehr gesehen.«
Jack starrte ins Feuer. »Ich wollte eigentlich immer zur Wache gehen. In jener Nacht wollte ich mich des Ostens als würdig erweisen.«
»Indem du in einen Distelhaufen gefallen bist?«
»Ich bin nicht reingefallen. Man hat sie mir ins Gesicht gedrückt.«
Torin schnaubte. »Wer soll das gewesen sein?«
Deine nette Cousine, hätte Jack geantwortet, doch ihm fiel gerade noch rechtzeitig ein, dass Torin Adaira innig liebte und ihm höchstwahrscheinlich gar nicht glauben würde, dass sie zu einer derart schändlichen Tat fähig sein könnte.
»Niemand von Bedeutung«, erwiderte Jack stattdessen, obwohl Adaira die Erbin des Ostens war.
Beinahe hätte er sich bei Torin nach ihr erkundigt, überlegte es sich dann jedoch anders. Jack hatte seit Jahren nicht mehr an seine Rivalin aus Kindertagen gedacht, und er ging davon aus, dass Adaira längst verheiratet war und vielleicht sogar schon mehrere Kinder hatte. Bestimmt war sie heute noch beliebter als in ihrer Jugend.
Als er über sie nachdachte, wurde ihm wieder einmal deutlich bewusst, wie viel er nicht wusste. Er hatte keine Ahnung, was während seiner Abwesenheit, in der er sich in die Musik vertieft hatte, auf der Insel passiert war. Er wusste nicht, warum Laird Alastair ihn hatte rufen lassen. Ebenso konnte er nicht sagen, zu wie vielen Überfällen es gekommen war und ob die Breccan noch immer eine so große Gefahr darstellten, sobald das Eis kam.
Ermutigt erwiderte er Torins Blick. »Drohst du jedem Streuner, der die Clanlinie überquert, mit dem sofortigen Tod?«
»Ich hätte dich nicht getötet, Junge.«
»Das habe ich nicht gefragt.«
Torin verstummte, wandte den Blick allerdings nicht ab. Der Feuerschein zuckte über seine schroffen Züge, in denen weder Reue noch Scham zu erkennen waren. »Das hängt davon ab. Einige streunende Breccan wurden tatsächlich vom Schalk der Geister reingelegt. Sie hatten sich verlaufen und führten nichts Böses im Schilde. Andere sind Kundschafter.«
»Gab es in letzter Zeit Überfälle?« Jack wollte herausfinden, ob Mirin ihn in ihren letzten Briefen angelogen hatte. Seine Mutter wohnte ganz in der Nähe des westlichen Territoriums.
»Seit letztem Winter gab es keinen Überfall mehr. Aber ich rechne damit, dass sie bald wiederkommen werden. Sobald es kälter geworden ist.«
»Wo hat der letzte Überfall stattgefunden?«
»Auf dem Acker der Elliotts.« Torin musterte ihn eindringlich, als würde er so langsam begreifen, wie wenig Jack wusste. »Machst du dir Sorgen um deine Mum? Mirins Farm wurde zuletzt angegriffen, als du noch ein kleiner Junge warst.«
Jack erinnerte sich daran, wenngleich er so jung gewesen war, dass er sich manchmal fragte, ob er das bloß geträumt hatte. Eine Gruppe von Breccan war in einer Winternacht aufgetaucht, und ihre Pferde hatten den Schnee im Hof in Matsch verwandelt. Mirin hatte Jack in einer Ecke ihres Hauses in den Armen gehalten und mit einer Hand seinen Kopf gegen ihre Brust gedrückt, damit er nichts sehen konnte, während sie in der anderen ein Schwert festhielt. Jack hatte gehört, wie sich die Breccan alles nahmen, was sie wollten – ihre Wintervorräte und das Vieh aus dem Stall sowie einige Silbermark. Sie zerbrachen Krüge und warfen Mirins gestapelte Webereien um. Dabei gingen sie rasch vor und hielten den Atem an, als wären sie unter Wasser, da sie ganz genau wussten, dass ihnen nur ein Moment blieb, bis die Ostwacht eintraf.
Sie hatten Mirin und Jack nicht angerührt und auch kein Wort zu ihnen gesagt. Die beiden schienen für sie ohne jede Bedeutung zu sein. Ebenso wenig hatte Mirin sie herausgefordert. Sie war ganz ruhig geblieben und hatte tiefe Atemzüge gemacht, aber Jack erinnerte sich noch genau an ihr Herz, das flügelschnell geschlagen hatte.
»Warum bist du nach Hause gekommen, Jack?«, fragte Torin leise. »Keiner von uns dachte, dass du je zurückkehren würdest. Wir glaubten, du hättest dir als Barde auf dem Festland ein neues Leben aufgebaut.«
»Das ist nur ein kurzer Besuch«, erklärte Jack. »Laird Alastair hat mich hergebeten.«
Torin zog die Augenbrauen hoch. »Hat er das?«
»Ja. Weißt du vielleicht, warum?«
»Ich glaube, ich weiß, warum er dich hat rufen lassen«, sagte Torin. »Wir stecken in großen Schwierigkeiten, und der gesamte Clan ist in arger Bedrängnis.«
Jacks Herzschlag beschleunigte sich. »Ich wüsste nicht, was ich gegen die Überfälle der Breccan ausrichten könnte.«
»Es geht nicht um die Überfälle.« Torins Augen waren ganz glasig, als hätte er einen Geist gesehen. »Nein, es geht um etwas viel Schlimmeres.«
Nach und nach drang Jack die Kälte unter die Haut und bis auf die Knochen. Er wurde an den Geschmack von Furcht auf der Insel erinnert und wie verloren man sich fühlte, wenn sich das Land veränderte. Dass im Handumdrehen ein Sturm ausbrechen konnte. Wie das alte Volk an einem Tag gütig und am nächsten boshaft sein konnte. Dass seine kapriziöse Art so flatterhaft wie ein Schmetterling war.
Dieser Ort war schon immer gefährlich und unvorhersehbar gewesen. Wunder erblühten neben großen Gefahren. Aber nichts hätte ihn auf das vorbereiten können, was Torin als Nächstes sagte.
»Es geht um unsere Mädchen, Jack. Unsere Töchter verschwinden.«
2
Manchmal sah Sidra den Geist von Torins erster Frau am Tisch sitzen. Sie besuchte sie immer, wenn eine Jahreszeit endete und eine andere anfing, wenn die Veränderung in der Luft zu spüren war. Donella Tamerlaines Geist saß gern im Licht der Morgensonne, trug Lederrüstung und Plaid und beobachtete, wie Sidra in der Küche am Feuer stand und für Maisie das Frühstück zubereitete.
Manchmal fühlte sich Sidra unwürdig und so, als würde Donella sie beurteilen. Wie gut sorgte Sidra für die Tochter und den Mann, die Donella zurückgelassen hatte? Aber meist hatte Sidra eher den Eindruck, dass Donella ihr Gesellschaft leistete, weil ihre Seele derart mit diesem Ort und diesem Boden verhaftet war. Die Frauen – eine tot und eine lebendig – waren durch Liebe, Blut und Erde miteinander verbunden. Drei so eng umschlungene Bande, dass sich Sidra nicht einmal wunderte, wieso Donella nur ihr allein erschien.
»Ich muss Maisie diesen Herbst zur Schule schicken«, sagte Sidra und rührte Haferbrei um. Es war still im Cottage, das vom trüben ersten Morgenlicht durchdrungen war, und der Wind setzte eben erst zu seinem morgendlichen Klatschgejaule an. Als Donella schwieg, warf Sidra ihr einen Blick zu. Die Geisterfrau saß auf ihrem Lieblingsstuhl am Tisch, und ihr hellbraunes Haar fiel ihr über die Schultern. Ihre Rüstung schimmerte im Licht und war nur einen Atemzug davon entfernt, ganz durchsichtig zu sein.
Donella war so wunderschön, dass es Sidra zuweilen den Brustkorb zusammenzog.
Der Geist schüttelte widerwillig den Kopf.
»Ich weiß.« Sidra seufzte. »Ich habe ihr die Buchstaben und das Lesen beigebracht.« Doch alle Inselkinder mussten nun einmal in Sloane zur Schule gehen, sobald sie sechs wurden. Was Donella ganz genau wusste, auch wenn sie schon fünf Jahre tot war.
»Es gibt einen Weg, das hinauszuzögern, Sidra.« Donellas Stimme war schwach, nur ein Hauch dessen, wie sie zu Lebzeiten geklungen hatte, allerdings hatte Sidra sie damals noch nicht gekannt. Die beiden Frauen hatten sehr unterschiedliche Lebenswege eingeschlagen, die sie doch wundersamerweise an denselben Ort geführt hatten.
»Meinst du, ich sollte ihr mein Handwerk beibringen?«, fragte Sidra, die ganz genau wusste, dass Donella exakt das dachte. Was sie überraschte. »Ich dachte immer, du würdest dir wünschen, dass Maisie dir nacheifert, Donella.«
Die Geisterfrau lächelte, doch ihr Verhalten wirkte melancholisch, selbst im Licht der aufgehenden Sonne. »Ich sehe in Maisies Zukunft kein Schwert, sondern etwas anderes.«
Sidra rührte langsamer weiter. Unwillkürlich musste sie an Torin denken, der so dickköpfig war wie ein Ochse. In ihrer Hochzeitsnacht hatten sie einander gegenüber in ihrem Bett gesessen – vollständig bekleidet – und stundenlang über Maisie und ihre Zukunft gesprochen. Wie sie sie zusammen großziehen wollten. Er wünschte sich, dass seine Tochter auf der Insel zur Schule ging. Dort würde man ihr alles beibringen: wie man mit Pfeil und Bogen umging, wie man las und schrieb, wie man ein Schwert schärfte, wie man rechnete, wie man einen Mann zu Boden warf, wie man Hafer und Gerste mahlte, wie man sang, tanzte und jagte. Nicht ein Mal hatte Torin davon gesprochen, dass Maisie von Sidra die Kräuter- und Heilkunde erlernen sollte.
Als würde sie ihre Zweifel spüren, fügte Donella hinzu: »Maisie hat schon viel gelernt, indem sie dir einfach nur zusieht, Sidra. Sie genießt es, sich an deiner Seite um den Garten zu kümmern. Sie hilft dir gern beim Zubereiten der Salben und Tonika. Unter deiner Anleitung könnte sie zu einer großartigen Heilerin heranwachsen.«
»Ich genieße ihre Gesellschaft«, gab Sidra zu, »aber ich muss zuerst mit Torin darüber reden.« Und sie wusste nicht, wann sie ihn das nächste Mal sehen würde.
Was sie allerdings wusste, war, dass Torin der Ostwacht zutiefst verpflichtet war. Er bevorzugte die Nachtschicht und schlief tagsüber in den dunklen, ruhigen Eingeweiden der Festung, weil er bei den anderen Wachen in der Kaserne sein wollte. Sie konnte seine Hingabe nachvollziehen und was ihn dazu bewegte. Warum sollte er, selbst wenn er der Hauptmann war, zu Hause schlafen, wo seine Soldaten in der Kaserne bleiben mussten?
Hin und wieder nahm er sein Abendessen mit ihr und Maisie ein, wenn sie frühstückten. Aber selbst dann galten seine Liebe und Aufmerksamkeit seiner Tochter, und Sidra tat alles, weswegen er sie geheiratet hatte – sie kümmerte sich um Haus und Hof und half ihm, sein Kind großzuziehen. Hin und wieder kam er bei Voll- oder Neumond, wenn Maisie ihren Großvater auf dem Hof nebenan besuchte, zu ihr. Diese Vereinigungen verliefen stets spontan und kurz, als hätte Torin nur wenige Augenblicke Zeit. Doch er war immer sanft und aufmerksam, und zuweilen blieb er auch noch bei ihr im Bett liegen und fuhr ihr durch das zerzauste Haar.
»Ich denke, du siehst ihn früher wieder, als du glaubst«, sagte Donella. »Und er wird dir nichts abschlagen, Sidra.«
Diese Worte erstaunten Sidra, die vermutete, dass der Geist übertrieb. Aber dann fragte sie sich: Wann habe ich Torin denn je um etwas gebeten? Und ihr ging auf, dass sie so etwas nur äußerst selten tat.
»Na gut«, meinte sie. »Ich werde ihn fragen. Bald.«
Die Haustür wurde aufgerissen. Donella verschwand, Sidra schrak zusammen und wirbelte gerade noch rechtzeitig herum, dass sie sehen konnte, wie Torin vom Winde verweht und mit rotem Gesicht hereinkam. Seine Tunika war taufeucht, an seinen Stiefeln klebte Sand, und sein Blick fand sie sofort, als hätte er genau gewusst, wo sie sein würde: am Feuer, wo sie das Frühstück für seine Tochter zubereitete.
»Mit wem hast du gesprochen, Sid?«, fragte er und schaute sich stirnrunzelnd um.
»Mit niemandem«, antwortete sie nervös. Torin hatte keine Ahnung davon, dass sie Donella sehen und mit ihr sprechen konnte, und Sidra vermutete, dass sie auch nie den Mut aufbringen würde, es ihm zu sagen. »Du bist zu Hause. Warum?«
Torin zögerte. Sie hatte noch nie nach dem Grund für seine Heimkehr gefragt. Aber wenn er hier war, hatte er auch Hunger, weil er die ganze Nacht über gearbeitet hatte. Er wollte sein Abendessen und seine Tochter umarmen.
»Ich dachte, ich esse zusammen mit dir und Maisie.« Er senkte die Stimme. »Und ich habe einen Besucher mitgebracht.«
»Einen Besucher?« Sidra ließ gespannt den Löffel sinken. Hätte sie an diesem Morgen dem Wind gelauscht, dann wären ihr die Gerüchte zu Ohren gekommen, die er über die Hügel trug. Aber sie war mit dem Geist von Torins erster Liebe beschäftigt gewesen.
Sie ging um den Tisch herum, wobei ihr die Zugluft das offene Haar aufwirbelte, und blieb erst stehen, als ein junger Mann das Cottage betrat, der vor sichtlichem Unbehagen die Schultern einzog. Er hielt etwas in den Armen, das wie ein in eine Öltuchhülle eingeschlagenes Instrument aussah, und Sidras Herz machte vor Freude einen Satz, bis sie sein unordentliches Erscheinungsbild bemerkte. Um seine Schultern lag Torins Plaid, doch die Kleidung darunter war schlicht und hing traurig an ihm herab. Er warf einen langen Schatten aus Sorge und Verbitterung.
Aber das waren die Augenblicke, für die Sidra lebte. Um zu helfen, zu heilen und Geheimnisse zu lüften.
»Ich kenne dich«, hauchte sie lächelnd. »Du bist Mirins Sohn.«
Der Fremde blinzelte und straffte sich, überaus erstaunt darüber, dass sie ihn wiedererkannte.
»Jack Tamerlaine«, fuhr Sidra fort, da ihr sein Name wieder einfiel. »Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, aber vor Jahren hast du den Hof meiner Familie im Tal von Stonehaven zusammen mit deiner Mutter besucht, um Wolle zu kaufen. Meine Katze saß in der alten Ulme in unserem Küchengarten fest, und du warst so freundlich, hinaufzuklettern und sie sicher wieder herunterzuholen.«
Jack wirkte noch immer verdutzt, doch dann wurden die Falten auf seinem Gesicht etwas schwächer, und der Hauch eines Lächelns umspielte seine Lippen. »Daran erinnere ich mich. Deine Katze hätte mir beinahe die Augen ausgekratzt.«
Sidra musste lachen, und es wurde augenblicklich heller im Raum. »Ja, sie war ein zickiges altes Vieh. Aber ich habe deine Kratzer hinterher versorgt, und es scheinen keine Narben zurückgeblieben zu sein.«
Es wurde still in der Kammer. Sidra lächelte noch immer und spürte Torins Blick auf sich. Als sie sich erneut ihm zuwandte, stellte sie fest, dass er sie voller Stolz betrachtete, was sie überraschte. Torin schien ihre Heilkünste bislang nie besonders beachtet zu haben. Das war ihre Arbeit, so wie die Ostwacht die seine war, und sie behielten diese Teile ihres Lebens für sich. Abgesehen von den seltenen Gelegenheiten, wenn Torin eine Wunde hatte, die genäht werden musste, oder wenn sie ihm wieder einmal die Nase richten sollte. Dann überließ er sich, wenngleich widerwillig, ihrer Obhut und Fürsorge.
»Komm nur herein, Jack«, bat Sidra den Jungen in dem Versuch, ihn in ihrem Haus willkommen zu heißen, und Torin schloss die Haustür hinter ihnen. »Das Frühstück ist gleich fertig, aber in der Zwischenzeit … Torin, willst du Jack nicht etwas zum Anziehen heraussuchen?«
Torin bedeutete Jack, ihm in den Nebenraum zu folgen. Der Großteil von Torins Kleidungsstücken befand sich in der Kaserne, aber die besten Stücke bewahrte er in einer mit Wacholderästen ausgelegten Truhe im Cottage auf – Tuniken und Wämser und auch wenige Hosen sowie diverse Plaids.
Sidra deckte rasch den Tisch und holte ihre Reserven heraus, die sie stets für den Fall zur Hand hatte, dass Torin unerwartet nach Hause kam. Sie stellte gekochte Eier, Buttertöpfe und gesüßte Sahne bereit, dazu ein Rad Ziegenkäse und eine Schale mit Wildblumenhonig, einen Teller mit kaltem Aufschnitt und Salzhering, einen Laib Brot und einen Krug mit Johannisbeergelee und zu guter Letzt den Topf mit Haferbrei. Als sie eben Tee in Becher einschenkte, kehrte Torin in die Hauptkammer zurück und hielt Jacks Instrument in den Händen, als könnte es ihn jeden Augenblick beißen. Sidra klappte schon den Mund auf, um ihn zu fragen, wie er auf Jack gestoßen war, als die Schlafzimmertür lautstark aufgerissen wurde und Maisie mit vom Schlaf zerwühlten braunen Locken herausgestürmt kam, um barfuß zu ihrem Vater zu rennen.
»Daddie!«, kreischte sie, sprang in Torins Arme und schmiegte sich an ihn, ohne das Instrument auch nur zur Kenntnis zu nehmen.
»Da ist ja meine süße Kleine!« Torin umfing sie mit dem anderen Arm und strahlte sie an. Maisie machte es sich auf seiner Hüfte bequem und schlang die Arme und Beine um ihn, als wolle sie ihn nie wieder loslassen.
Sidra ging auf die beiden zu und nahm Torin vorsichtig Jacks Instrument ab, während sie lauschte, wie sich Vater und Tochter in ihrem Singsangton unterhielten. Torin erkundigte sich nach den Blumen, die Maisie im Küchengarten gepflanzt hatte, und wie ihre Schreibübungen verliefen, und dann kam der Augenblick, auf den Sidra gewartet hatte.
»Rate mal, was passiert ist, Daddie.«
»Was ist denn passiert, Schätzchen?«
Maisie sah über seine Schulter hinweg zu Sidra hinüber und grinste verschmitzt. Bei allen Geistern, dieses Lächeln!, dachte Sidra, der das Herz aufging. Ihre Liebe zu dem Mädchen war kurz derart übermächtig, dass sie ihr den Atem raubte. Auch wenn die Kleine nicht von ihrem Fleisch und Blut war, bildete sich Sidra gern ein, sie wäre aus ihrem Geist gesponnen worden.
»Du hast deinen Schneidezahn verloren!«, stellte Torin erfreut fest, der die leere Stelle bemerkte.
»Aye, Daddie, aber das wollte ich dir nicht erzählen.« Maisie strahlte ihn an, und Sidra wappnete sich. »Flossie hat ihre Kätzchen bekommen.«
Torin zog die Augenbrauen hoch und warf Sidra einen Blick zu. Ein Vater spürte, wenn ihm Unheil drohte.
»Hat sie das?«, fragte er, starrte jedoch weiterhin Sidra an, weil er genau wusste, dass sie ihm diese Falle gestellt hatte. »Das ist ja wundervoll, Maisie.«
»Ja, Daddie. Und Sidra hat gesagt, ich muss dich fragen, ob ich alle behalten darf.«
»Das hat Sidra gesagt?« Endlich sah Torin seine Tochter wieder an. Sidra spürte, wie sie heiße Wangen bekam, aber sie stellte Jacks Instrument auf seinen Stuhl und setzte das Teeeinschenken fort. »Sie liebt ihre Katzen, nicht wahr?«
»Ich liebe sie auch«, erklärte Maisie energisch. »Sie sind so niedlich, Daddie! Und ich möchte alle Kätzchen behalten. Darf ich, darf ich, bitte?«
Torin schwieg kurz. Abermals spürte Sidra seinen Blick auf sich, während sie eine Teetasse nach der anderen füllte.
»Wie viele Kätzchen sind es denn, Maisie?«
»Fünf, Daddie.«
»Fünf? Ich … ich glaube nicht, dass wir sie alle behalten können, Schatz«, sagte Torin, woraufhin Maisie zu wimmern anfing. »Hör mal gut zu Maisie. Was ist mit den anderen Höfen, die gute Katzen zum Schutz ihrer Küchengärten brauchen? Was ist mit den anderen Mädchen, die keine Kätzchen haben, die sie streicheln und liebhaben können? Warum teilst du nicht mit ihnen? Gib anderen Mädchen vier der Kätzchen und behalt eins für dich.«
Maisie sackte schmollend in sich zusammen.
Sidra beschloss, ebenfalls etwas dazu zu sagen. »Das ist doch ein sehr guter Plan, Maisie. Außerdem kannst du die anderen Kätzchen dann immer noch besuchen gehen.«
»Versprichst du es, Sidra?«, bat Maisie.
»Ich verspreche es.«
Da fand Maisie ihr Lächeln wieder und wand sich aus Torins Armen. Sie nahm auf ihrem Stuhl Platz, um zu frühstücken, und Sidra drehte sich erneut zum Herd um und hängte den Kessel an den Haken. Sie spürte, dass sich Torin ihr näherte, und hörte, wie er ihr ins Ohr flüsterte: »Wie willst du hier je einen Wachhund halten, wenn überall Katzen herumlaufen?«
Sidra straffte sich und spürte, wie die Luft zwischen ihnen vibrierte. »Ich sagte dir doch schon, dass ich keinen Wachhund brauche, Torin.«
»Zum hundertsten Mal, Sid … Ich möchte aber, dass du einen Wachhund bekommst. Damit er dich und Maisie nachts beschützen kann, wenn ich nicht da bin.«
Sie stritten nun schon mehrere Monate deswegen. Sidra wusste, warum Torin derart beharrlich war. Jede verstreichende warme Nacht machte einen bevorstehenden Überfall wahrscheinlicher. Und wenn es nicht die Breccan waren, die ihm Sorgen bereiteten, dann das heimtückische alte Volk. In letzter Zeit gab es zunehmend Ärger auf der Insel, im Wind und im Wasser und in der Erde und im Feuer. Zwei junge Mädchen waren verschwunden, und sie konnte nachvollziehen, weshalb er in dieser Sache nicht lockerließ. Weder sie noch Torin wollten riskieren, dass Maisie von einem Feengeist fortgelockt wurde. Aber Sidra glaubte nicht daran, dass ein Wachhund die richtige Lösung wäre.
Ein Hund konnte Geister von einem Hof verjagen, sogar die guten. Und ihr Glaube an das alte Volk der Erde war tief verwurzelt. Allein dank dieser Hingabe vermochte es Sidra, die schlimmsten Verletzungen und Krankheiten des Ostens zu heilen. Darum gediehen ihre Kräuter, ihre Blumen und ihr Gemüse und ermöglichten es ihr, die Gemeinde und ihre Familie zu ernähren und zu heilen. Würde Sidra es wagen, einen Hund ins Haus zu holen, könnten die Geister zu der Auffassung gelangen, ihr Glaube an sie sei schwach, und sie wusste nicht, welche Auswirkungen das auf ihr Leben haben würde.
Sie war im Glauben an das Gute in den Geistern aufgezogen worden. Torins Glaube war im Laufe der Jahre stetig gebröckelt, und in letzter Zeit verlor er kein gutes Wort mehr über sie, sondern schien gewillt zu sein, sie alle aufgrund weniger, böswilliger Exemplare über einen Kamm zu scheren. Jedes Mal, wenn Sidra ihm gegenüber das Thema Geister ansprach, wurde Torin eiskalt und schien ihr gar nicht mehr richtig zuzuhören.
Manchmal fragte sie sich, ob er den Geistern die Schuld an Donellas viel zu frühem Tod gab.
Sidra drehte sich um und sah ihm in die Augen. »Ich habe ausreichend Schutz.«
»Was soll ich dazu sagen?«, stieß er leise und wütend hervor. Da er selten hier war, wusste er ganz genau, dass sie sich diesbezüglich nicht auf ihn bezog.
»Du bist völlig grundlos beleidigt«, sagte sie sanft. »Dein Vater wohnt gleich nebenan. Wenn es Ärger gibt, gehe ich zu ihm.«
Torin holte tief Luft, ließ dieses Thema jedoch auf sich beruhen. Stattdessen musterte er sie, und Sidra hatte das ungute Gefühl, er könnte sie durchschauen und ihre Gefühle ergründen. Ein Augenblick verstrich, dann trat er zurück und gab diesen Kampf vorerst auf. Er setzte sich am Kopfende des Tisches auf seinen Stuhl mit Strohlehne und hörte Maisie zu, die über ihre Kätzchen plauderte, wandte den Blick allerdings nicht von Sidra ab, als suche er noch immer nach einem Weg, sie von der Anschaffung eines Hundes zu überzeugen.
Sie hatte Jack fast vergessen, bis die Tür zum Nebenraum quietschend geöffnet wurde und Maisie den Besucher mit großen Augen anstarrte und mitten im Satz innehielt.
»Wer bist du?«, sprudelte es aus ihr heraus.
Die Direktheit des Mädchens machte Jack offensichtlich nichts aus. Er kam zum Tisch, stellte fest, dass sein Stuhl mit dem Instrument bereits auf ihn wartete, und nahm darauf Platz. In Torins Kleidung wirkte er ziemlich steif. Das Plaid war schwer und sperrig und wurde an der Schulter zusammengehalten. In die großzügige Tunika hätte er gleich zweimal hineingepasst. »Ich bin Jack. Und wer bist du?«
»Maisie. Das ist mein Daddie, und das ist Sidra.«
Sidra spürte, dass Jack sie ansah. Sidra, nicht Mum oder Mommy