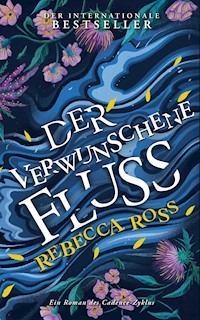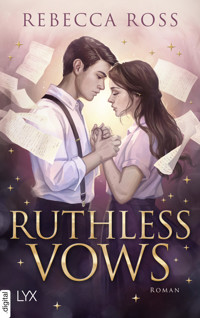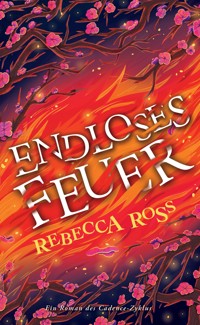9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Soll Brienna ihrem Herzen folgen oder ihre Aufgabe im Machtgeflecht der Höfe erfüllen? Brienna wünscht sich nichts sehnlicher, als nach abgeschlossener Ausbildung im Haus Magnalia ihre besondere Gabe zu erproben und eine Aufgabe an einem der Höfe zu bekommen. Und doch zerreißt es ihr das Herz, ihren geheimnisvollen Lehrer Master Cartier zurückzulassen. Sie wird an den Hof des Reichs Maevana berufen und gerät in ein Netz aus Intrigen: Mit Hilfe ihrer Gabe soll sie den König stürzen! Als sie endlich Cartier wiedersieht, muss sie sich entscheiden, ob sie ihrem Herzen die Treue hält … Slow-Burn-Romantasy inmitten eines Machtkampfes um den Thron, in dem Allianzen Leben retten können. »Ein echter Page-Turner.« School Library Journal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rebecca Ross
The Queen´s Rising
Aus dem Englischen von Anne Brauner und Susann Friedrich
Brienna wünscht sich nichts sehnlicher, als nach abgeschlossener Ausbildung im Haus Magnalia ihre besondere Gabe zu erproben und eine Aufgabe an einem der Höfe zu bekommen. Und doch zerreißt es ihr das Herz, ihren geheimnisvollen Lehrer Master Cartier zurückzulassen. Sie wird an den Hof des Reichs Maevana berufen und gerät in ein Netz aus Intrigen: Mit Hilfe ihrer Gabe soll sie den König stürzen! Als sie endlich Cartier wiedersieht, muss sie sich entscheiden, ob sie ihrem Herzen die Treue hält …
Slow-Burn-Romantasy inmitten eines Machtkampfes um den Thron, in dem Allianzen Leben retten können.
Wohin soll es gehen?
Personenverzeichnis
Buch lesen
Viten
Für Ruth und Mary, Mistress der Kunst und Mistress des Wissens
HAUS MAGNALIA
Die Vorsteherin von Magnalia
Die Aériale von Magnalia:
Solene Severin, Mistress der Kunst
Evelina Baudin, Mistress der Musik
Xavier Allard, Master des Schauspiels
Therese Berger, Mistress des Esprits
Cartier Évariste, Master des Wissens
Die Arden von Magnalia:
Oriana DuBois, Arden der Kunst
Merei Labelle, Arden der Musik
Abree Cavey, Arden des Schauspiels
Sibylle Fontaine, Arden des Esprits
Ciri Montagne, Arden des Wissens
Brienna Colbert, Arden des Wissens
Weitere Besucher in Magnalia:
Francis, Bote
Rolf Paquet, Briennas Großvater
Monique Lavoie, Gönnerin
Nicolas Babineaux, Gönner
Brice Mathieu, Gönner
HAUS JOURDAIN
Aldéric Jourdain
Luc Jourdain
Amadine Jourdain
Jean David, Lakai und Kutscher
Agnes Cote, Hauswirtschafterin
Pierre Faure, Koch
Liam O’Brian, Lehnsmann
Weitere Personen im Zusammenhang mit Jourdain:
Hector Laurent (Braden Kavanagh)
Yseult Laurent (Isolde Kavanagh)
Theo d’Aramitz (Aodhan Morgane)
HAUS ALLENACH
Brendan Allenach, Lord
Rian Allenach, der erstgeborene Sohn
Sean Allenach, der zweitgeborene Sohn
Weitere wichtige Personen:
Gilroy Lannon, König von Maevana
Liadan Kavanagh, die erste Königin von Maevana
Tristan Allenach
Norah Kavanagh, die drittgeborene Prinzessin von Maevana
Evan Berne, Drucker
DIE VIERZEHN HÄUSER VON MAEVANA
Die Gewitzten des Hauses Allenach
Die Aufgeweckten des Hauses Kavanagh*
Die Älteren des Hauses Burke
Die Grimmigen des Hauses Lannon
Die Kühnen des Hauses Carran
Die Barmherzigen des Hauses MacBran
Die Beliebten des Hauses Dermott
Die Gerechten des Hauses MacCarey
Die Weisen des Hauses Dunn
Die Besonnene des Hauses MacFinley
Die Freundlichen des Hauses Fitzsimmons
Die Standhaften des Hauses MacQuinn*
Die Aufrechten des Hauses Halloran
Die Flinken des Hauses Morgane*
* kennzeichnet ein in Ungnade gefallenes Haus
Das Haus Magnalia galt als Bildungsanstalt, in der wohlhabende begabte Mädchen ihre Passion meisterten. Es war nicht für Mädchen gedacht, die den hohen Ansprüchen nicht genügten, oder für uneheliche Töchter und schon gar nicht für Mädchen, die ihrem König die Stirn boten. Rein zufällig trifft all das auf mich zu.
Ich war zehn Jahre alt, als mein Großvater zum ersten Mal mit mir nach Magnalia fuhr. Es war nicht nur ein sehr heißer Sommertag – ein Nachmittag für Wolkenungetüme und gereizte Gemüter –, sondern noch dazu der Tag, an dem ich die Frage stellte, die mich verfolgte, seit ich ins Waisenhaus gekommen war.
»Großpapa, wer ist mein Vater?«
Großvater saß mir gegenüber. Seine Lider waren schwer von der Hitze, bis meine Erkundigung ihn aufrüttelte. Er war ein anständiger Mann, herzensgut und doch sehr zurückgezogen, und aus diesem Grund vermutete ich, dass er sich für mich schämte – für das uneheliche Kind seiner geliebten verstorbenen Tochter.
Doch an diesem drückend heißen Tag war er dazu verdammt, mit mir in der Kutsche zu sitzen, und ich hatte eine Frage geäußert, die er beantworten musste. Stirnrunzelnd betrachtete er meine erwartungsvolle Miene, als hätte ich ihn gebeten, mir den Mond vom Himmel zu holen. »Dein Vater ist kein achtbarer Mann, Brienna.«
»Hat er einen Namen?«, bohrte ich weiter. Hitze machte mich wagemutig, während sie ältere Herrschaften wie Großpapa zum Schmelzen brachte. Ich war zuversichtlich, dass er mir endlich erzählen würde, von wem ich abstammte.
»Das hat wohl jeder, nicht wahr?« Nun wurde er griesgrämig, nachdem wir bereits seit zwei Tagen in dieser Gluthitze reisten.
Ich sah zu, wie er sein Taschentuch herauskramte und sich den Schweiß von der faltigen Stirn wischte, die wie ein Ei gesprenkelt war. Er hatte ein rötliches Gesicht mit einer besonders großen Nase und einen weißen Haarkranz. Dem Hörensagen nach war meine Mutter recht ansehnlich gewesen – und ich ihr wie aus dem Gesicht geschnitten –, doch ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie jemand, der so hässlich war wie Großpapa, etwas Schönes hervorbringen sollte.
»Ah, Brienna, mein Kind, wieso musst du nach ihm fragen?«, seufzte Großpapa ein wenig freundlicher. »Reden wir doch lieber über das, was auf dich zukommt. Über Magnalia.«
Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter, die mir wie eine Murmel in der Kehle stecken blieb. Über Magnalia wollte ich nicht sprechen.
Bevor ich noch trotziger werden konnte, bog die Kutsche ab und die Räder rollten aus den Furchen auf eine glatte, gepflasterte Zufahrtsstraße. Als ich aus dem staubverschmierten Fenster sah, schlug mein Herz schneller. Ich beugte mich vor und legte die Hände an die Scheibe.
Als Erstes fielen mir die Bäume auf. Ihre Äste hingen bewundernswert über der Einfahrt, wie Arme, die uns willkommen hießen. Pferde grasten träge auf den Weiden, ihr Fell glänzte feucht von der sommerlichen Hitze. Jenseits der Weiden lagen die fernen blauen Berge von Valenia, das Rückgrat unseres Königreichs. Ihr Anblick besänftigte meine Enttäuschung – dieses Land befeuerte meine Neugier und meinen Mut.
Klappernd fuhren wir unter den Zweigen der Eichen einen Hügel hinauf und kamen schließlich in einem Vorhof zum Stehen. Durch den aufgewirbelten Staub betrachtete ich die grauen Steinmauern, die gleißenden Fensterscheiben und den Kletterefeu des Hauses Magnalia.
»Aufgemerkt, Brienna«, sagte Großpapa, der hastig sein Taschentuch einsteckte. »Hier ist tadelloses Benehmen geboten – als würdest du vor König Phillipe stehen. Lächele, mach einen Knicks und sag nichts Unpassendes. Kannst du deinem Großpapa diesen Gefallen tun?«
Ich nickte. Mir war, als hätte ich auf einmal die Sprache verloren.
»Sehr gut. Dann lass uns beten, dass die Vorsteherin dich aufnimmt.«
Als der Kutscher die Tür öffnete, wies Großpapa mich an, zuerst auszusteigen. Meine Beine zitterten, so klein kam ich mir vor, während ich den Hals verdrehte, um das herrschaftliche Anwesen zu bestaunen.
»Ich spreche erst unter vier Augen mit der Vorsteherin und dann wirst du sie ebenfalls kennenlernen«, sagte Großvater und zog mich die Treppe zum Eingang hoch. »Denk stets daran, Höflichkeit zu bewahren. In diesem Haus leben sittsame Mädchen.«
Er musterte mich, als er klingelte. Mein blaues Kleid war von der Kutschfahrt zerknittert, meine Zöpfe hatten sich gelöst und die Haare hingen kraus um mein Gesicht. Doch die Tür wurde bereits schwungvoll aufgezogen, bevor Großvater einen Kommentar zu meinem wenig ansehnlichen Äußeren abgeben konnte. Seite an Seite traten wir in den bläulichen Schatten der Eingangshalle von Magnalia.
Während Großvater in das Arbeitszimmer der Vorsteherin gebeten wurde, blieb ich im Gang stehen. Der Diener bot mir einen Platz auf einer gepolsterten Bank an und ich setzte mich allein dorthin, um zu warten. Vor Aufregung ließ ich die Beine baumeln und starrte auf den schwarz-weißen Boden im Schachbrettmuster. Im Haus herrschte eine tiefe Ruhe, als würde ihm das Herz fehlen. Und da es so still war, hörte ich die Unterredung meines Großvaters mit der Vorsteherin. Ihre Worte flossen durch die Zimmertür.
»Für welche Gabe verspürt sie eine besondere Neigung?«, fragte die Vorsteherin. Ihre Stimme war tief und fein wie Rauch, der an einem Herbstabend in die Höhe stieg.
»Sie zeichnet gern … Zeichnen kann sie wirklich gut. Außerdem hat sie eine lebhafte Fantasie – im Schauspiel würde sie sicher brillieren. Und was die Musik angeht: Meine Tochter hat es auf der Laute weit gebracht und ich bin sicher, dass Brienna etwas von ihrem Talent geerbt hat. Was noch … Ach ja, im Waisenhaus liest sie wohl gern. Sie hat sämtliche Bücher zweimal gelesen.« Großpapa schweifte ab. War ihm überhaupt bewusst, was er da sagte? Er hatte mich noch nie zeichnen sehen oder auch nur einmal eine selbst erdachte Geschichte aus meinem Munde gehört.
Ich rutschte von der Bank, schlich langsam zur Tür und presste mein Ohr daran. Begierig lauschte ich ihren Worten.
»Das ist alles gut und schön, Monsieur Paquet. Aber wie Ihr sicherlich wisst, versteht man unter dem Meistern einer Passion, dass Eure Enkelin sich in einer der fünf Gaben auszeichnen muss, und nicht etwa in allen.«
Ich machte mir Gedanken über diese fünf. Kunst. Musik. Schauspiel, Esprit. Wissen. In einer Einrichtung wie Magnalia wurden Mädchen als Arden angenommen – als Schülerinnen eines Fachs. Man konnte eine der fünf Passionen wählen und sie anhand der sorgfältigen Anweisung eines Masters oder einer Mistress fleißig studieren. Wer sein Talent vollkommen ausgeschöpft hatte, erhielt selbst den Titel Mistress und zudem den Umhang – eine persönliche Auszeichnung, die den Erfolg und den Stand betonte. Auf diese Weise wurde man zu einer Berufenen der Kunst, der Musik oder einer der anderen drei Gaben geweiht.
Mein Herz pochte laut in meiner Brust und meine Hände waren schweißnass, während ich mir ausmalte, eine Berufene zu sein.
Welches Fach würde ich wählen, falls die Vorsteherin mich annahm?
Doch ich hatte keine Zeit, darüber zu grübeln, denn Großvater sprach weiter: »Brienna hat einen hellen Verstand, das verspreche ich Euch. Sie kann jede der fünf Passionen meistern.«
»Es freut mich, dass Ihr Eure Enkelin so hoch einschätzt, aber ich muss Euch sagen … mein Haus ist sehr anspruchsvoll und schwierig. Für diese Saison habe ich meine fünf Arden bereits beisammen. Falls ich Eure Enkelin aufnähme, müsste ein Aérial zwei Arden unterrichten. Das ist noch nie vorgekommen.«
Ich versuchte mir vorzustellen, was ein Aérial sein mochte – möglicherweise eine Art Lehrer? –, als ich ein scharrendes Geräusch hörte und von der Flügeltür zurücksprang, weil ich fürchtete, sie würde auffliegen und mich als Lauscherin entlarven. Doch anscheinend hatte Großvater nur nervös seinen Stuhl verschoben.
»Ich versichere Euch, Madame, Brienna wird Euch keinerlei Schwierigkeiten bereiten. Sie ist ein sehr gehorsames Mädchen.«
»Aber sagtet Ihr nicht, sie sei im Waisenhaus aufgewachsen? Und sie trägt nicht Euren Namen. Wie kam es dazu?«, fragte die Vorsteherin.
Eine Pause entstand. Ich hatte mich auch schon immer gewundert, dass mein Nachname sich von dem meines Großvaters unterschied. Also drückte ich das Ohr noch ein wenig fester ans Holz …
»Es dient dazu, Brienna vor ihrem Vater zu schützen, Madame.«
»Sollte sie in Gefahr schweben, kann ich Brienna leider nicht aufnehmen, Monsieur –«
»Bitte hört mich an, Madame, nur einen Augenblick. Brienna ist zwei Staaten angehörig. Ihre Mutter – meine Tochter – war Valenianerin. Ihr Vater stammt aus Maevana. Er weiß von Brianna und ich war besorgt … besorgt, er könnte sie ausfindig machen, wenn sie so hieße wie ich.«
»Und wieso wäre das so entsetzlich?«
»Weil ihr Vater –«
Weiter hinten im Gang wurde eine Tür geöffnet und geschlossen, Stiefelschritte näherten sich. Ich lief rasch zu der Bank zurück und warf mich buchstäblich darauf, sodass meine kurzen Beine über den Boden kratzten wie Fingernägel über eine Tafel.
Ich wagte nicht aufzublicken und lief vor Scham rot an, während der Stiefelträger immer näher kam und schließlich vor mir stehen blieb.
Ich hielt ihn für den Diener, bis ich den Kopf hob und einen jungen Mann bemerkte, der mit seinen weizenblonden Haaren ungemein gut aussah. Er war groß und schlank, keine einzige Falte verunstaltete seine Kniehose oder seine Tunika, doch am meisten beeindruckte mich … sein blauer Umhang. Da die Farbe Blau die Gabe des Wissens symbolisierte, war er ein Berufener, ein Master. Und ausgerechnet er hatte mich beim Lauschen an der Tür der Vorsteherin erwischt.
Bedächtig ging er in die Hocke, um mir in die Augen zu sehen. Er hatte ein Buch in der Hand und seine Augen waren kornblumenblau wie sein Passionsumhang.
»Wen haben wir denn da?«, fragte er.
»Brienna.«
»Das ist ein schöner Name. Wirst du als Arden nach Magnalia kommen?«
»Das weiß ich nicht, Monsieur.«
»Möchtest du es denn gern?«
»Ja, sehr gern, Monsieur.«
»Du musst nicht Monsieur zu mir sagen«, schalt er mich freundlich.
»Wie soll ich Euch denn sonst nennen, Monsieur?«
Er gab keine Antwort, sondern sah mich nur an, den Kopf ein wenig geneigt, sodass sein blondes Haar über eine Schulter glitt, wie ein Ausschnitt des Sonnenlichts. Er sollte fortgehen und doch wünschte ich mir gleichzeitig, dass er sich weiter mit mir unterhielt.
In diesem Augenblick wurde die Tür des Arbeitszimmers geöffnet. Als er das hörte, stand der Master des Wissens auf und drehte sich um. Mein Blick fiel auf die silbernen Fäden des Umhangs, der über seinen Rücken fiel – sie fügten sich auf dem blauen Stoff zu einer Sternenkonstellation, die ich sehr bewunderte. Zu gern hätte ich ihn gefragt, was dieses Bild zu bedeuten hatte.
»Ah, Master Cartier«, sagte die Vorsteherin, die an der Tür stehen geblieben war. »Wärt Ihr so freundlich, Brienna zum Arbeitszimmer zu geleiten?«
Ich verstand seine ausgestreckte Hand als Einladung und legte vorsichtig meine Finger hinein. Meine Hand war warm, seine kühl, während wir durch den Gang auf die wartende Vorsteherin zugingen. Bevor er losließ, drückte Master Cartier kurz zu und setzte dann seinen Weg fort. Er ermunterte mich, tapfer zu sein, aufrecht und stolz, um meinen Platz in diesem Haus zu finden.
Nachdem ich das Arbeitszimmer betreten hatte, wurde die Tür mit einem leisen Geräusch wieder geschlossen. Großvater saß in einem Sessel. Daneben stand ein zweiter, der mir zugedacht war. Behutsam setzte ich mich, als die Vorsteherin um den Schreibtisch herumging und mit einem flüsternden Rauschen ihres Kleides dahinter Platz nahm.
Mit ihrer hohen Stirn, die verriet, dass sie ihr Haar viele Jahre straff zurückgekämmt unter einer eng anliegenden Prachtperücke getragen hatte, machte sie einen recht strengen Eindruck. Mittlerweile verbarg sie die weißen Locken, die ihrer Erfahrung Rechnung trugen, fast vollständig unter einer Haube aus schwarzem Samt. In kalter Eleganz thronte sie auf ihrem Scheitel. Ihr Kleid, das in einem dunklen Rot schimmerte, hatte eine tief sitzende Taille und einen rechteckigen, mit Perlen besetzten Ausschnitt. In diesem Moment, als ich mich im Anblick ihrer reifen Schönheit verlor, verstand ich, dass sie mich in ein Leben einführen konnte, das mir sonst nicht vergönnt sein würde. Ein Leben, in dem ich berufen werden konnte.
»Ich freue mich, dich kennenzulernen, Brienna«, begrüßte sie mich lächelnd.
»Madame«, entgegnete ich und wischte meine verschwitzten Hände an meinem Kleid ab.
»Dein Großvater hat mir dein Loblied gesungen.«
Ich nickte und warf ihm einen beklommenen Blick zu. Er betrachtete mich mit einem heiklen Funkeln in den Augen und hielt erneut sein Taschentuch in der Hand, als müsste er sich an etwas festklammern.
»Welche Gabe bevorzugst du, Brienna?«, fragte sie und zog meine Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Oder hast du sogar eine angeborene Neigung zu einer der Passionen?«
Bei den Heiligen im Himmel, ich wusste es nicht. Fieberhaft ging ich sie im Geiste noch einmal durch … Kunst … Musik … Schauspiel … Esprit … Wissen. Und dann platzte ich mit dem heraus, was mir als Erstes in den Sinn kam. »Kunst, Madame.«
Sehr zu meinem Missfallen zog sie eine Schublade auf und holte einen unbeschriebenen Pergamentbogen und einen Bleistift heraus, die sie unmittelbar vor mir auf eine Ecke ihres Schreibtisches legte.
»Zeichne etwas für mich«, wies mich die Vorsteherin an.
Widerstrebend blickte ich zu Großvater, weil ich fürchtete, dass unsere Täuschung auffliegen würde. Er wusste so gut wie ich, dass ich nicht künstlerisch begabt war, und dennoch griff ich nach dem Bleistift.
Dann holte ich tief Luft und dachte an etwas, das mir am Herzen lag. Vor meinem inneren Auge erschien der Baum im Hinterhof des Waisenhauses – eine alte knorrige Eiche, auf die wir Kinder gerne geklettert waren. Und einen Baum konnte ja wohl jeder malen.
Während ich zeichnete, unterhielt sich die Vorsteherin mit meinem Großvater, um mir genügend Raum zu lassen. Als ich fertig war, legte ich den Bleistift hin, betrachtete mein Werk und wartete.
Es war eine erbärmliche Abbildung, die keinerlei Ähnlichkeit mit dem erinnerten Baum aufwies.
Die Vorsteherin sah sich die Zeichnung genau an. Sie runzelte leicht die Stirn, doch ihrem Blick ließ sich keine Regung entnehmen.
»Bist du sicher, Brienna, dass du dich dem Studium der Kunst widmen willst?« Sie sprach ohne Wertung, doch ich nahm die unterschwellige Herausforderung wahr, die in ihren Worten lag.
Beinahe hätte ich Nein gesagt und dass ich nicht dorthin gehörte. Doch die Vorstellung, ins Waisenhaus zurückzukehren und Küchenmädchen oder Köchin zu werden wie all die anderen Waisenmädchen, machte mir bewusst, dass dies meine einzige Chance war, dem zu entkommen.
»Ja, Madame.«
»Dann will ich für dich eine Ausnahme machen. Ich habe bereits fünf Mädchen in deinem Alter in Magnalia angenommen. Du wirst die sechste Arden sein und bei Mistress Solene Kunstunterricht bekommen. Die nächsten sechs Jahre verbringst du hier mit deinen Ardenschwestern, indem du lernst und aufwächst und dich auf deine siebzehnte Sommersonnenwende vorbereitest. Dann nämlich wirst du zur Berufenen geweiht und von einem Gönner erwählt.« Als sie innehielt, war ich vollkommen überwältigt von ihren Worten. »Wärst du damit einverstanden?«
Blinzelnd stammelte ich: »Ja, ja sehr wohl, Madame!«
»Hervorragend. Monsieur Paquet, bitte bringt Brienna im Herbst zur Tagundnachtgleiche zurück. Und vergesst nicht das Schulgeld.«
Als mein Großvater eilig aufstand und sich verbeugte, verströmte er Erleichterung wie ein aufdringliches Parfüm. »Vielen Dank, Madame. Wir sind beglückt! Brienna wird Euch nicht enttäuschen.«
»Nein, das denke ich auch nicht«, erwiderte die Vorsteherin.
Ich stand auf, machte einen schiefen Knicks und folgte Großpapa zur Tür. Kurz bevor ich in den Gang hinaustrat, warf ich einen Blick zurück.
Die Vorsteherin sah mir traurig nach. Obwohl ich noch ein junges Mädchen war, kannte ich diesen Blick. Mein Großvater hatte irgendetwas gesagt, das sie dazu bewogen hatte, mich aufzunehmen. Ihr Zugeständnis war nicht mein Verdienst und beruhte auch nicht auf meiner möglichen Entwicklung. Hatte sie sich vom Namen meines Vaters umstimmen lassen? Von diesem Namen, den ich nicht kannte? Spielte er wirklich eine so große Rolle?
Die Vorsteherin glaubte, dass sie mich aus Barmherzigkeit aufgenommen hatte und dass ich niemals berufen werden würde.
In diesem Augenblick nahm ich mir fest vor, ihr das Gegenteil zu beweisen.
Zweimal in der Woche versteckte sich Francis in dem Wacholderbusch, der vor dem Fenster der Bibliothek blühte. Manchmal ließ ich ihn absichtlich warten; Francis hatte lange Beine und wenig Geduld und es war auf eine Weise belebend, mir vorzustellen, wie er im Gestrüpp kauerte. Doch in einer Woche begann der Sommer und das trieb mich zur Eile an. Es war höchste Zeit, es ihm zu sagen. Ich trat in die ruhigen nachmittäglichen Schatten der Bibliothek und mein Puls begann zu rasen.
Sag ihm, dass es das letzte Mal ist.
Als ich das Fenster sanft nach oben schob, roch ich den süßen Duft des Gartens. Francis erhob sich gerade aus einer Stellung, die an einen Wasserspeier erinnerte.
»Ihr könnt einen Jungen wirklich warten lassen«, murrte er, doch so begrüßte er mich stets. Er hatte einen Sonnenbrand und sein helles Haar löste sich aus seinem Zopf. Die braune Botenuniform war schweißnass und die Sonne funkelte auf der kleinen Ansammlung von Verdienstorden, die über seinem Herzen baumelten. Er prahlte gern damit, dass er trotz seiner angeblich einundzwanzig Jahre der schnellste Bote in ganz Valenia war.
»Heute ist das letzte Mal, Francis«, warnte ich ihn, ehe ich meine Meinung ändern konnte.
»Das letzte Mal?«, wiederholte er, doch er grinste breit. Dieses Lächeln kannte ich. Er setzte es immer auf, um zu bekommen, was er wollte. »Warum?«
»Warum!«, rief ich und verjagte eine neugierige Hummel. »Das fragst du noch?«
»Dabei brauche ich Euch jetzt am meisten, Mademoiselle«, entgegnete er und angelte zwei schmale Umschläge aus der Innentasche seines Hemdes. »In acht Tagen findet die schicksalhafte Feier zur Sommersonnenwende statt.«
»Ebendeshalb, Francis«, sagte ich, da ich wusste, dass er nur an meine Ardenschwester Sibylle dachte. »In acht Tagen. Und ich habe noch so viel zu lernen.« Mein Blick ruhte auf den beiden Umschlägen. Einer war an Sibylle adressiert, doch der andere war für mich. Ich erkannte Großpapas Handschrift; endlich hatte er zurückgeschrieben. Mein Herz pochte unruhig, als ich mir vorstellte, was auf dem gefalteten Briefpapier stehen könnte …
»Macht Ihr Euch Sorgen?«
Rasch sah ich wieder zu Francis. »Selbstverständlich mache ich mir Sorgen.«
»Das müsst Ihr nicht. Ihr werdet es ganz wunderbar machen.« Ausnahmsweise nahm er mich nicht auf den Arm. Als ich die Aufrichtigkeit in seiner hellen, freundlichen Stimme hörte, wollte ich wie er daran glauben, dass ich in acht Tagen – wenn ich meinen siebzehnten Sommer erlebte – berufen würde. Dass ich meine Gabe meistern würde.
»Ich glaube nicht, dass Master Cartier –«
»Wen interessiert, was Euer Master denkt?«, schnitt Francis mir mit einem lässigen Achselzucken das Wort ab. »Ihr solltet Euch nur damit befassen, was Ihr selbst denkt.«
Ich sah ihn stirnrunzelnd an, während ich darüber nachdachte und mir vorstellte, was Master Cartier dazu sagen würde.
Ich kannte Cartier seit sieben Jahren. Francis kannte ich seit sieben Monaten.
Im November hatte ich am offenen Fenster gesessen und darauf gewartet, dass Cartier zum Nachmittagsunterricht erschien, als Francis auf dem Kiesweg vorbeikam. Wie alle meine Ardenschwestern wusste ich, wer er war, da wir ihn oft sahen, wenn er Post für das Haus Magnalia brachte oder abholte. Doch damals war es die erste persönliche Begegnung und er bat mich, Sibylle ein heimliches Briefchen zu übergeben. Das hatte ich getan und war seitdem in ihren Austausch von Briefen verwickelt.
»Mir ist wichtig, was Master Cartier denkt, weil er derjenige ist, der mich zur Passion erklärt«, sagte ich.
»Bei allen Heiligen, Brienna«, erwiderte Francis, als ein Schmetterling mit seiner breiten Schulter kokettierte. »Findet Ihr nicht auch, dass Ihr Euch selbst zur Berufenen erklären solltet?«
Das brachte mich zum Nachdenken, was Francis zu seinem Vorteil nutzte.
»Im Übrigen weiß ich, welche Gönner die Vorsteherin eingeladen hat.«
»Was? Wieso?«
Doch es leuchtete mir ein, dass er es wusste. Er hatte die Briefe überbracht, die Namen und Adressen gelesen. Ich betrachtete mit schmalen Augen seine Grübchen, als er erneut dieses Lächeln aufsetzte. Ich verstand sehr wohl, warum Sibylle Gefallen an ihm fand, doch für meinen Geschmack war er viel zu oft zum Scherzen aufgelegt.
»Oh, dann gib mir den vermaledeiten Brief«, rief ich und wollte ihn ihm aus der Hand nehmen.
Das hatte er vorausgesehen und wich rasch zurück.
»Wollt Ihr denn nicht wissen, wer eingeladen ist?«, bohrte er weiter. »Schließlich ist einer von ihnen in acht Tagen dazu bestimmt, Euer Gönner zu werden …«
Ich schaute ihn an, doch mein Blick wanderte an seinem Gesicht und der schlaksigen Gestalt vorbei. Der Garten war vertrocknet und sehnte sich in der leichten Brise bebend nach Regen. »Gib schon her.«
»Aber wenn es mein letzter Brief an Sibylle sein soll, muss ich einiges umschreiben.«
»Beim heiligen LeGrand, Francis, ich habe keine Zeit für deine Spielchen.«
»Gestattet mir einen weiteren Brief«, bettelte er. »Ich weiß nicht, wo Sibylle in einer Woche sein wird.«
Er hätte mir leidtun sollen – oh, welch Herzschmerz, eine Berufene zu lieben, wenn man selbst nicht berufen ist! Andererseits wäre es angebracht gewesen, auf meiner Entscheidung zu beharren, schließlich konnte er ihr den Brief auch per Boten schicken, wie er es schon die ganze Zeit hätte tun sollen. Doch ich stimmte seufzend zu, vor allem deshalb, weil ich endlich den Brief meines Großvaters entgegennehmen wollte.
Als Francis mir die Umschläge reichte, steckte ich den Brief von Großpapa augenblicklich in die Tasche und behielt den von Francis in der Hand.
»Wieso hast du in Dairine geschrieben?«, fragte ich mit einem Blick auf den verschnörkelten Namen der Adressatin. In der Sprache von Maevana, dem Reich der Königin im Norden, stand da: An Sibylle, meine Sonne und meinen Mond, mein Leben und mein Licht. Ich hätte beinahe laut gelacht und konnte es mir gerade noch verkneifen.
»Ihr sollt das nicht lesen!«, rief Francis und seine ohnehin sonnenverbrannten Wangen färbten sich noch dunkler.
»Es steht auf dem Umschlag, du Narr. Selbstverständlich lese ich das.«
»Brienna …«
Er streckte die Hand aus und ich genoss es schon, ihn auch einmal necken zu können, als die Tür zur Bibliothek geöffnet wurde. Ich musste nicht hinsehen, um zu wissen, dass es Cartier war. Seit drei Jahren hatte ich fast jeden Tag mit ihm verbracht und meine Seele hatte sich daran gewöhnt, wie er allein durch seine Anwesenheit einen Raum beherrschte.
Nachdem ich Francis’ Brief zu dem von Großpapa in die Tasche gesteckt und ihm mit aufgerissenen Augen einen hastigen Blick zugeworfen hatte, schloss ich rasch das Fenster. Er verstand mich einen Wimpernschlag zu spät – seine Finger wurden auf dem Fensterbrett eingeklemmt. Ich hörte einen Schmerzensschrei, hoffte jedoch, dass er Cartier durch das schnelle Herunterziehen des Fensters verborgen blieb.
»Master Cartier«, sagte ich atemlos zur Begrüßung und drehte mich um.
Er sah mich nicht an. Ich beobachtete, wie er seine Tasche auf einem Stuhl ablegte und mehrere in Leder gebundene Lehrbücher herausholte, die er anschließend auf den Tisch legte.
»Heute bei geschlossenem Fenster?«, fragte er, immer noch mit gesenktem Blick. Das war wahrscheinlich zu meinem Besten, denn mein Gesicht brannte, und das nicht von der Sonne.
»Die Hummeln sind heute sehr lästig«, antwortete ich und warf einen flüchtigen Blick durchs Fenster. Francis eilte über den Kiesweg zu den Stallungen. Ich kannte die Regel, dass wir uns in der Zeit als Arden in Magnalia mit niemandem einlassen sollten. In Wahrheit ging es vor allem darum, dass man nicht dabei erwischt wurde. Es war dumm von mir, die Briefe von Sibylle und Francis weiterzureichen. Als ich wieder nach vorn sah, ruhte Cartiers Blick auf mir.
»Wie steht es um die valenianischen Häuser?« Er wies mich an, zum Tisch zu kommen.
»Sehr gut, Master«, sagte ich und setzte mich auf meinen üblichen Platz.
»Beginnen wir mit dem Stammbaum des Hauses Renaud, vom erstgeborenen Sohn an«, forderte Cartier und nahm gegenüber Platz.
»Das Haus Renaud?« Bei der Gnade der Heiligen, selbstverständlich fragte er die weitverzweigte königliche Abstammungslinie ab, die ich mir so schlecht merken konnte.
»Es geht um das Geschlecht unseres Königs«, ermahnte er mich mit dem unbarmherzigen Blick, der so charakteristisch für ihn war. Diesen Blick kannte ich so gut wie meine Ardenschwestern, die sich hinter verschlossener Tür über Cartier beklagten. Er war der attraktivste Aérial in Magnalia, derjenige, der die Gabe des Wissens lehrte, aber auch der strengste. Meine Ardenschwester Oriana behauptete, er hätte einen Stein in der Brust, und hatte eine entsprechende Karikatur gezeichnet, auf der er einem Fels entsprang.
»Brienna.« Er sagte meinen Namen, als würde er ungeduldig mit den Fingern schnippen.
»Es tut mir leid, Master.« Obwohl ich versuchte, mir den Anfang der königlichen Linie ins Gedächtnis zu rufen, konnte ich nur an den Brief meines Großvaters denken, der in meiner Tasche darauf wartete, gelesen zu werden. Wieso hatte er so lange gebraucht, ihn zu schreiben?
»Du hast begriffen, dass Wissen die anspruchsvollste Gabe ist?«, fragte Cartier, als ihm mein Schweigen zu lange dauerte.
Ich sah ihn an und überlegte, ob er mir auf diese Weise taktvoll nahelegen wollte, dass ich dem nicht gewachsen war. Es wäre nicht der erste Morgen, an dem ich das selbst glaubte.
Im ersten Lehrjahr in Magnalia hatte ich Kunst studiert, und da ich keinerlei angeborene künstlerische Begabung besaß, war ich im darauffolgenden Jahr zu Musik übergegangen. Doch meinen Gesang konnte man nicht als solchen bezeichnen und unter meinen Fingern klangen alle Instrumente wie Katzenmusik. Im dritten Jahr hatte ich mich im Schauspiel versucht, bis ich feststellen musste, dass ich nicht über mein Lampenfieber hinwegkommen würde. Deshalb hatte ich mich im vierten Jahr dem Esprit gewidmet; an dieses verdrießliche Jahr erinnerte ich mich höchst ungern. Mit vierzehn stand ich dann vor Cartier und bat ihn, mich als Arden anzunehmen und in meinen verbleibenden drei Jahren in Magnalia eine Mistress des Wissens aus mir zu machen.
Dennoch war mir bewusst – und ich hatte den Verdacht, dies war auch den anderen Aérialen bekannt, die mich unterrichteten –, dass ich nur an dieser Schule weilte, weil mein Großvater vor sieben Jahren etwas Bestimmtes gesagt hatte. Ich war nicht etwa aus eigenem Verdienst hier oder weil ich vor Talent und Aufnahmevermögen überschäumte wie die anderen fünf Arden, die ich wie wahre Schwestern liebte. Doch möglicherweise lag es mir deshalb umso mehr am Herzen zu beweisen, dass die Passion nicht nur angeboren war, wie manche Menschen glaubten. Jedermann, ob aus dem gemeinen Volk oder dem Adel, konnte sich eine Passion aneignen, selbst wenn keine innere Begabung dazu spürbar war.
»Vielleicht sollten wir uns die erste Lektion noch einmal vor Augen führen«, unterbrach Cartier meine Tagträume. »Was bedeutet Passion, Brienna?«
Die Lehre der Passion. Sie hallte in meinen Gedanken wider, als eine der ersten Schriften, die ich auswendig lernte und wie alle Arden nie wieder vergessen würde.
Obwohl es kein Zeichen von Herablassung war, wenn Cartier mir acht Tage vor der Sommersonnenwende diese Frage stellte, war es mir ein wenig peinlich, bis ich tapfer den Kopf hob und merkte, dass sie in einem größeren Zusammenhang stand.
Was willst du, Brienna? Das fragten mich seine Augen, die mich eindringlich musterten. Warum möchtest du berufen werden?
Deshalb gab ich ihm die Antwort, die man mich gelehrt hatte, weil ich mich damit am sichersten fühlte. »Die Passion besteht grundsätzlich aus fünf Teilen«, setzte ich an. »Kunst, Musik, Schauspiel, Esprit und Wissen. Sie verkörpert Ergebenheit von ganzem Herzen, sie ist Inbrunst und Qual, sie ist Zorn und Begeisterung. Sie kennt keine Grenzen und kennzeichnet einen Mann oder eine Frau unabhängig von ihrer gesellschaftlichen Schicht, ihrem Status und ihrer Herkunft. Die Passion verwandelt sich in den Mann oder die Frau, so wie der Mann oder die Frau sich in die Passion verwandeln. Es handelt sich um die Vollendung von Befähigung und Persönlichkeit, ausgezeichnet durch Ergebenheit, Hingabe und das Werk.«
Ich konnte Cartier nicht ansehen, ob er von meiner auswendig gelernten Antwort enttäuscht war. Er ließ sich niemals etwas anmerken – ich hatte ihn nicht einmal lächeln sehen und noch nie lachen hören. Hin und wieder dachte ich, dass er nur wenig älter sein konnte als ich, aber dann ermahnte ich mich immer, dass meine Seele jung war und Cartiers nicht. Er war viel erfahrener und gebildeter, was höchstwahrscheinlich auf eine zu früh beendete Kindheit zurückzuführen war. Unabhängig von seinem Alter verfügte er über umfangreiches Wissen.
»Ich war deine letzte Wahl, Brienna«, sagte er, ohne auf mein Zitat der Lehre einzugehen. »Vor drei Jahren bist du auf mich zugekommen und hast mich gebeten, dich auf die Sommersonnenwende deines siebzehnten Jahres vorzubereiten. Doch statt sieben Jahre zur Verfügung zu haben, um dich Wissen zu lehren, musste ich mich mit dreien begnügen.«
Ich konnte seine Vorhaltungen kaum ertragen und musste an Ciri denken, seine zweite Arden des Wissens. Ciri sog all das Gelehrte mit einer beneidenswerten Gründlichkeit auf, doch sie konnte auch auf sieben Jahre Unterricht zurückblicken. Selbstverständlich schnitt ich im Vergleich zu ihr schlecht ab.
»Vergebt mir, dass ich nicht wie Ciri bin«, sagte ich, bevor ich mir diese ironische Bemerkung verkneifen konnte.
»Ciri hat mit zehn Jahren angefangen sich vorzubereiten«, erwiderte Cartier und wandte sich einem Buch zu, das auf meiner Seite des Tisches lag. Er nahm es in die Hand, blätterte über mehrere Seiten mit Eselsohren – etwas, das er verabscheute – und strich sie sorgsam aus dem alten Papier.
»Bedauert Ihr, dass ich mich so entschieden habe, Master?« Eigentlich hätte meine Frage folgendermaßen lauten müssen: Wieso habt Ihr mich nicht abgewiesen, als ich Euch bat, mein Master zu werden? Wenn es mir nicht gelingen konnte, innerhalb von drei Jahren berufen zu werden, warum habt Ihr es mir damals nicht gesagt? Doch vielleicht verriet mich mein Blick, da mein Lehrer zunächst mich ansah und sich dann eher gelangweilt wieder den Büchern zuwandte.
»Ich bedaure nur wenige Dinge, Brienna«, antwortete er.
»Was geschieht, wenn ich bei der Sonnenwendfeier von keinem Gönner erwählt werde?«, fragte ich, obwohl ich wusste, was aus jungen Männern und Frauen wurde, denen es nicht gelang, ihre Gabe zu meistern. Häufig waren sie verzweifelt und zu nichts mehr in der Lage, weder hier noch dort. Sie waren nirgends zugehörig und von den Berufenen und dem gemeinen Volk gleichermaßen ausgeschlossen. Wenn man so viele Jahre, Zeit und Denken für eine Gabe aufgewandt hatte und nicht darin brillierte … galt man als Versager. Man war keine Arden mehr, aber auch nicht berufen, und unvermittelt gezwungen, sich erneut in die Gesellschaft einzugliedern und nützlich zu machen.
Während ich auf Cartiers Antwort wartete, dachte ich an das schlichte Gleichnis, das Mistress Solene mir in meinem ersten Lehrjahr in Kunst geschildert hatte (nachdem ihr aufgefallen war, dass ich nicht das geringste künstlerische Talent besaß). Die Passion eignete man sich phasenweise an. Man begann als Arden, vergleichbar mit einer Raupe. In dieser Zeit sollte man möglichst viel von seiner Passion verschlingen und zu beherrschen lernen. Wunderkinder konnten dieses Pensum in zwei Jahren bewältigen, während andere, die langsamer lernten, auch gut und gerne bis zu zehn Jahre benötigten. Darauf folgten die Weihe zur Berufenen – ausgewiesen durch den Umhang und einen Titel – sowie die Phase der Gönnerschaft, vergleichbar mit dem Kokon, in dem man innehielt und seine Passion zur Reife führte. Darauf konnte man sich dann stützen, während man sich auf die Endphase vorbereitete, dem Sinnbild des Schmetterlings gleich, in der die Berufene selbstständig in die Welt hinauszog.
Ich war in Gedanken bei Schmetterlingen, als Cartier erwiderte: »Ich glaube, du wirst die Erste unter deinesgleichen sein, kleine Arden.«
Da mir diese Antwort nicht gefiel, ließ ich mich noch tiefer in den Brokatsessel sinken, der nach alten Büchern und Einsamkeit roch.
»Wenn du glaubst, du würdest scheitern, wird es höchstwahrscheinlich so kommen«, fuhr er fort und versenkte seinen blau funkelnden Blick in meinen braunen Augen. Zwischen uns tanzten Staubkörner wie kleine trudelnde Wirbel. »Meinst du nicht auch?«
»Doch, natürlich, Master.«
»Deine Augen lügen nie, Brienna. Du solltest dich um mehr Beherrschung bemühen, wenn du unaufrichtig bist.«
»Ich werde mir Euren Rat zu Herzen nehmen.«
Er neigte den Kopf, wandte jedoch seinen Blick nicht von mir ab. »Magst du mir verraten, worüber du in Wirklichkeit nachdenkst?«
»Ich denke über die Sonnenwendfeier nach«, antwortete ich ein wenig zu schnell. Das war nur die halbe Wahrheit, doch ich konnte mir nicht vorstellen, Cartier vom Brief meines Großvaters zu erzählen. Womöglich verlangte er von mir, ihn laut vorzulesen.
»Nun, diese Lektion war verlorene Liebesmüh«, sagte er und stand auf.
Ich war enttäuscht, weil er hier abbrach – ich konnte jeglichen Unterricht, den er mir zuteilwerden ließ, gut gebrauchen –, gleichzeitig aber auch erleichtert, da ich mich nicht konzentrieren konnte, solange Großpapas Brief wie glühende Kohlen in meiner Tasche steckte.
»Wie wäre es, wenn du am Nachmittag allein mit deinen Studien fortfährst?«, schlug er vor und wies mit einer schwungvollen Geste auf die Bücher, die auf dem Tisch lagen. »Du kannst sie ruhig mitnehmen.«
»Danke, Master Cartier.« Ich stand ebenfalls auf und machte einen Knicks, bevor ich, ohne ihn anzusehen, mit den Büchern unterm Arm nervös die Bibliothek verließ.
Ich schlenderte in den Garten und lief bis zu den Hecken, wo Cartier mich von den Fenstern der Bibliothek nicht mehr sehen konnte. Da am Himmel graue Wolken einen Sturm ankündigten, setzte ich mich auf die nächstbeste Bank und legte vorsichtig die Bücher neben mir ab.
Dann holte ich den Brief meines Großvaters hervor und hielt ihn in beiden Händen. Durch seine schiefe Schrift sah mein Name auf dem Pergament wie eine Grimasse aus. Mit zitternden Händen brach ich das rote Wachssiegel und entfaltete den Brief.