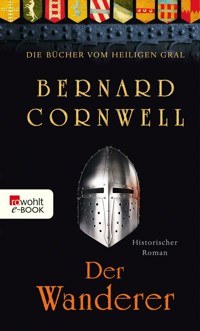
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Bücher vom Heiligen Gral
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Tödlicher Kampf um den Heiligen Gral Mitten im Hundertjährigen Krieg erhält Thomas von Hookton einen Auftrag vom englischen König: Er soll den Heiligen Gral suchen. Der letzte Besitzer war angeblich sein Vater – das Geheimnis um die Reliquie ist auch das seiner eigenen Familie. Die Suche führt Thomas durch Schlachten und Kriegsgetümmel, bis er erneut auf seinen Erzfeind trifft, den schwarzen Ritter. Der Kampf kann beginnen ... «Das Buch ist randvoll mit tollen Figuren und aufregenden Szenen und bestätigt ein weiteres Mal Cornwells Ruf als Meister des historischen Romans.» (Daily Mail) «Das ist spektakulär und verdammt gut: Krieg und Folter, Liebe, Lust und Verlust.» (The Times)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Ähnliche
Bernard Cornwell
Die Bücher vom Heiligen Gral. Der Wanderer
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Claudia Feldmann
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Tödlicher Kampf um den Heiligen Gral
Mitten im Hundertjährigen Krieg erhält Thomas von Hookton einen Auftrag vom englischen König: Er soll den Heiligen Gral suchen. Der letzte Besitzer war angeblich sein Vater – das Geheimnis um die Reliquie ist auch das seiner eigenen Familie. Die Suche führt Thomas durch Schlachten und Kriegsgetümmel, bis er erneut auf seinen Erzfeind trifft, den schwarzen Ritter.
Der Kampf kann beginnen ...
«Das Buch ist randvoll mit tollen Figuren und aufregenden Szenen und bestätigt ein weiteres Mal Cornwells Ruf als Meister des historischen Romans.» (Daily Mail)
«Das ist spektakulär und verdammt gut: Krieg und Folter, Liebe, Lust und Verlust.» (The Times)
Über Bernard Cornwell
Bernard Cornwell, geboren 1944, machte nach dem Studium Karriere bei der BBC, doch nach Übersiedlung in die USA entschloss er sich, einem langgehegten Wunsch nachzugehen, dem Schreiben. Im englischen Sprachraum gilt er als unangefochtener König des historischen Abenteuerromans. Seine Werke wurden in über 20 Sprachen übersetzt – Gesamtauflage: mehr als 20 Millionen. Als Rowohlt Taschenbuch sind folgende Romane lieferbar:
Die Uhtred-Serie:
Band 1: Das letzte Königreich
Band 2: Der weiße Reiter
Band 3: Die Herren des Nordens
Band 4: Schwertgesang
Band 5: Das brennende Land
Die Artus-Chroniken:
Band 1: Der Winterkönig
Band 2: Der Schattenfürst
Band 3: Arthurs letzter Schwur
Die Bücher vom Heilgen Gral:
Band 1: Der Bogenschütze
Sowie
Das Zeichen des Sieges
Stonehenge
Gemeinsam mit seiner Frau Judy hat Bernard Cornwell unter dem Pseudonym «Susannah Kells» zwei weitere historische Romane verfasst:
Das Hexen-Amulett
Die dunklen Engel
Weitere Informationen zum Autor
Erfahren Sie mehr über Bernard Cornwell und entdecken Sie spannende Hintergrundinformationen und spannende Aktionen auf www.bernard-cornwell.de
Inhaltsübersicht
Der Wanderer ist June und Eddie Bell gewidmet, in Freundschaft und Dankbarkeit
Teil 1Die Schlacht auf dem Hügel
England, Oktober 1346
Es war Oktober, die Zeit, in der das Jahr sich dem Ende zuneigt, das Vieh für den Winter geschlachtet wird und der Nordwind den ersten Frost ankündigt. Die Blätter der Kastanien leuchteten golden, die Buchen schienen in Flammen zu stehen, und die Eichen schimmerten wie Bronze. Es dunkelte bereits, als Thomas von Hookton, seine Gefährtin Eleanor und sein Freund, Vater Hobbe, den Bauernhof im Hochland erreichten. Der Bauer weigerte sich, die Tür zu öffnen, rief ihnen jedoch von drinnen zu, sie könnten im Stall schlafen. Regen prasselte auf das modrige Strohdach. Thomas führte ihr einziges Pferd in den Stall, in dem sich ein Stapel Brennholz, ein solider Holzkoben mit sechs Schweinen und ein Haufen Federn von einem gerupften Huhn befanden. Die Federn erinnerten Vater Hobbe daran, dass es der Tag des heiligen Gallus war, und er erzählte Eleanor die Geschichte, wie der Heilige eines Winterabends nach Hause gekommen war und dort einen Bären vorgefunden hatte, der gerade sein Abendessen stibitzen wollte. «Da hat er mächtig mit dem Bären geschimpft!», sagte Vater Hobbe. «Er hat ihm ordentlich den Marsch geblasen, und dann hat er ihn losgeschickt, Feuerholz zu holen.»
«Davon habe ich mal ein Bild gesehen», sagte Eleanor in ihrem gebrochenen Englisch. «Ist der Bär nicht sein Diener geworden?»
«Ja, aber nur, weil Gallus ein Heiliger war», erklärte Vater Hobbe. «Schließlich sammelt ein Bär ja nicht für jeden Dahergelaufenen Feuerholz. Nur für einen Heiligen.»
«Den Schutzheiligen der Hennen», ergänzte Thomas. Er wusste alles über die Heiligen, mehr sogar als Vater Hobbe. «Wozu braucht eine Henne wohl einen Schutzheiligen?», fragte er spöttisch.
«Gallus ist der Schutzheilige der Hennen?», fragte Eleanor verwirrt. «Nicht der der Bären?»
«Nein, der der Hennen», bestätigte Vater Hobbe. «Genau genommen ist er für das gesamte Geflügel zuständig.»
«Aber warum?»
«Weil er einmal ein junges Mädchen von einem bösen Geist befreit hat.» Vater Hobbe stammte aus einfachen Verhältnissen, war klein und drahtig und hatte einen unbezähmbaren Wust schwarzer Haare. Er liebte es, Geschichten von Heiligen zu erzählen. «Ein ganzer Haufen Bischöfe hatte versucht, den Dämon auszutreiben, aber keinem war es gelungen. Dann kam der heilige Gallus vorbei und verfluchte den Dämon. Jawohl, er verfluchte ihn! Da stieß der böse Geist einen schauerlichen Schrei aus und floh aus dem Körper des Mädchens, und er sah aus wie eine Henne, eine schwarze Henne.»
«Davon habe ich noch nie ein Bild gesehen. Aber ich würde gerne mal einen echten Bären sehen, der Feuerholz sammelt», sagte Eleanor lächelnd.
Thomas setzte sich neben sie und blickte hinaus in die Dämmerung. Es hatte aufgehört zu regnen, und ein leichter Nebel lag über dem Land. Er war nicht sicher, ob es wirklich der Tag des heiligen Gallus war; während ihrer Reise hatte er das Zeitgefühl verloren. Vielleicht war es schon der Tag der heiligen Audrey? Es war Oktober, so viel wusste er, und man schrieb das Jahr 1346 nach Christi Geburt, aber er konnte nicht genau sagen, welcher Tag heute war. Man verlor so leicht den Überblick. Sein Vater hatte ihm einmal alle Sonntage im Kirchenjahr aufgezählt, und Thomas hatte sie am nächsten Tag wiederholen müssen. Verstohlen bekreuzigte er sich. Er war der Bastard eines Priesters, und das brachte angeblich Unglück. Ein Schauer überlief ihn. Es lag eine Schwere in der Luft, die nichts mit dem hereinbrechenden Abend, den Regenwolken und dem Nebel zu tun hatte. Gott stehe uns bei, dachte er, diese Dämmerung verheißt nichts Gutes. Er bekreuzigte sich erneut und sprach ein stilles Gebet zum heiligen Gallus und seinem gehorsamen Bären. In London hatten sie einen Tanzbären gesehen; statt Zähnen hatte er nur noch verfaulte, gelbliche Stümpfe im Maul gehabt, und sein braunes Fell war vom Stachelstock des Besitzers ganz blutverklebt gewesen. Die Straßenköter hatten ihn angeknurrt, waren um ihn herumgestrichen und nur zurückgewichen, wenn er mit seinen Tatzen nach ihnen schlug.
«Wann sind wir denn in Durham?», fragte Eleanor.
«Morgen, schätze ich», sagte Thomas, den Blick noch immer nach draußen gerichtet, wo die lastende Dunkelheit sich über das Land ausbreitete. «Morgen kannst du dich ausruhen.» Sie erwartete ein Kind, das mit Gottes Hilfe im Frühjahr zur Welt kommen würde. Thomas wusste noch nicht so recht, was er davon halten sollte, dass er Vater wurde. Es schien ihm noch zu früh für eine solche Verantwortung, aber Eleanor war glücklich, und weil er ihr gerne eine Freude machte, sagte er ihr, er sei ebenfalls glücklich. Manchmal stimmte das sogar.
«Und morgen werden wir unsere Antworten bekommen», sagte Vater Hobbe.
«Morgen werden wir unsere Fragen stellen», berichtigte ihn Thomas.
«Gott führt uns nicht den weiten Weg hierher, um uns dann im Stich zu lassen», sagte Vater Hobbe bestimmt, und um jeden weiteren Widerspruch von Thomas zu unterbinden, machte er sich daran, ihr mageres Abendessen auszupacken. «Das ist alles, was vom Brot noch übrig ist. Und wir sollten etwas Käse und einen Apfel für das Frühstück aufheben.» Er schlug das Kreuz über dem Essen, um es zu segnen, und brach das harte Brot in drei Stücke. «Lasst uns essen, bevor wir nichts mehr sehen.»
Mit der Dunkelheit kam eine durchdringende Kälte. Ein kurzer Schauer zog vorbei, dann erstarb der Wind. Thomas schlief direkt neben der Stalltür, und kurz nachdem der Wind nachgelassen hatte, weckte ihn ein Lichtschein am nördlichen Himmel.
Er setzte sich auf, und schlagartig waren die Kälte, der Hunger und all die lästigen kleinen Unannehmlichkeiten des Lebens vergessen, denn er sah den Gral. Den Heiligen Gral, das Kostbarste, was der Heiland den Menschen hinterlassen hatte. Seit über tausend Jahren galt er als verloren, und nun sah Thomas ihn am Himmel leuchten, blutrot und umgeben von einem gleißenden Strahlenkranz, wie die Krone eines Heiligen.
Thomas wollte nicht länger zweifeln. Er wollte, dass der Gral existierte. Denn wenn der Gral zu den Menschen zurückkehrte, würde er alles Übel der Welt in seinen Tiefen verschwinden lassen. Er sehnte sich so sehr danach zu glauben, und in dieser Oktobernacht erblickt er den Gral als einen gewaltigen brennenden Kelch am Himmel. Seine Augen füllten sich mit Tränen, sodass das Bild verschwamm, doch er konnte es noch immer sehen, und ihm war, als stiege Dampf von dem heiligen Gefäß auf. Dahinter schienen Scharen von Engeln bis zum Firmament hinaufzuschweben, die Flügel von Flammen umkränzt. Der ganze Nordhimmel war in Rauch und Gold und Rot getaucht und leuchtete in der Nacht, wie ein Zeichen für den ungläubigen Thomas. «O Herr», entfuhr es ihm, und er schlug seine Decke zurück und kniete sich in den kalten Stalleingang. «O Herr.»
«Thomas?» Eleanor, die neben ihm geschlafen hatte, war aufgewacht. Sie setzte sich ebenfalls auf und blickte hinaus. «Feuer», sagte sie. «Da muss ein großer Brand sein.»
«Feuer?», fragte Thomas verwirrt. Dann tauchte er aus seinem ergriffenen Staunen auf und sah, dass in der Tat am Horizont ein gewaltiges Feuer brannte, dessen aufzüngelnde Flammen eine kelchförmige Lücke in den Wolken beleuchteten.
«Da muss eine Armee sein», flüsterte Eleanor. «Sieh nur!» Sie deutete auf ein weiteres Glühen in der Ferne. Sie kannten dieses Leuchten aus Frankreich, wo die englische Armee sich plündernd und brandschatzend durch die Normandie und die Pikardie gewälzt hatte.
Von Enttäuschung erfüllt, starrte Thomas den Himmel an. Ein Feuer? Nicht der Gral?
«Was ist los, Thomas?», fragte Eleanor besorgt.
«Es sind nur Kriegsgerüchte», murmelte er. Er war der Bastard eines Priesters und als solcher mit der Heiligen Schrift aufgewachsen, und im Matthäusevangelium hieß es, wenn das Ende der Zeit nahe, werde es Kriege und Kriegsgerüchte geben, und die Welt werde in einem Mahlstrom aus Gräuel und Verwüstung untergehen. Im letzten Dorf, wo die Leute ihnen voller Misstrauen begegnet waren, hatte ein mürrischer Priester sie als schottische Spione beschimpft. Vater Hobbe war wütend geworden und hatte seinem Bruder im Herrn gedroht, ihm eine Ohrfeige zu verpassen, doch Thomas hatte die beiden Kampfhähne beruhigt und dann mit einem Schafhirten gesprochen, der ihm berichtete, er habe über den Hügeln im Norden Rauch gesehen. Die Schotten marschierten nach Süden, hatte er gesagt. Die Frau des Priesters hatte darüber jedoch nur spöttisch gelacht. «Die schottischen Soldaten sind nichts weiter als Viehdiebe. Verriegelt nachts eure Tür, dann lassen sie euch in Ruhe.»
Das Licht am Horizont verblasste. Es war nicht der Gral.
«Was ist mit dir?», fragte Eleanor erneut.
«Nichts», sagte er. «Ich habe nur geträumt.»
Sie berührte ihn sanft am Arm. «Werden wir heiraten?»
«Ja, in Durham», versprach er ihr. Er war ein Bastard, und er wollte nicht, dass sein Kind denselben Makel trug. «Morgen erreichen wir die Stadt, und dort lassen wir uns in einer Kirche trauen, und danach stellen wir unsere Fragen.» Und hoffentlich lautet eine der Antworten, dass der Gral doch nicht existiert, ergänzte Thomas im Stillen. Hoffentlich ist er nur ein Traum, ein Spiel von Feuer und Wolken am Nachthimmel. Denn sonst, so fürchtete er, würde ihn womöglich noch der Wahnsinn packen. Er wollte seine Suche nicht mehr fortführen; er wollte den Gral aus seinem Leben streichen und nur noch das sein, was er bisher gewesen war: ein englischer Bogenschütze.
Bernard de Taillebourg, französischer Dominikanermönch und Inquisitor, verbrachte die Herbstnacht in einem Schweinestall, und als der Morgen mit dichtem weißem Nebel heranbrach, kniete er nieder und dankte Gott für das Privileg, in fauligem Stroh schlafen zu dürfen. Dann sprach er eingedenk seiner wichtigen Aufgabe ein Gebet an St. Dominikus und bat den Heiligen, sich bei Gott für ihn einzusetzen, auf dass seine Arbeit Früchte trage. «Wie die Flamme in deinem Munde uns zur Wahrheit führt», sagte er laut, «so möge sie uns auch den Weg zum Erfolg weisen.» Von Inbrunst ergriffen, wiegte er sich vor und zurück und schlug dabei mit der Stirn gegen einen rauen Steinpfeiler, der einen Teil des Stalldaches stützte. Schmerz durchzuckte seinen Schädel, und er verstärkte ihn, indem er seine Stirn erneut gegen den Stein presste und mit der Haut darüberschabte, bis er spürte, wie ihm das Blut über die Nase lief. «Heiliger Dominikus!», rief er ekstatisch, «Gott sei gedankt für deine Herrlichkeit! Weise uns den Weg!» Das Blut hatte jetzt seine Lippen erreicht. Er leckte es auf und dachte an all die Schmerzen, die die Heiligen und Märtyrer für die Kirche erduldet hatten. Seine Hände waren gefaltet, und auf seinem ausgemergelten Gesicht lag ein Lächeln.
Die Soldaten, die in der Nacht zuvor den größten Teil des Dorfes niedergebrannt, die Frauen, die nicht rechtzeitig geflohen waren, vergewaltigt und die Männer, die die Frauen zu beschützen versuchten, getötet hatten, sahen zu, wie der Priester immer wieder den Kopf gegen den blutbeschmierten Stein schlug. «Dominikus», hauchte Bernard de Taillebourg, «o Dominikus!» Einige Soldaten bekreuzigten sich, denn der Mönch musste wahrhaft ein heiliger Mann sein. Ein paar knieten sogar nieder, obwohl das in einem Kettenpanzer ziemlich unbequem war, doch die meisten betrachteten den Priester nur argwöhnisch oder sahen zu seinem Diener hinüber, der draußen vor dem Stall saß und ihre Blicke unverwandt erwiderte.
Der Diener war, ebenso wie Bernard de Taillebourg, Franzose, aber die äußere Erscheinung des jungen Mannes ließ auf eine exotischere Herkunft schließen. Er hatte oliv getönte Haut, und sein langes, glattes Haar war schwarz, was ihm, zusammen mit dem schmalen Gesicht, etwas Wildes gab. Er trug ein Kettenhemd und ein Schwert, und obwohl er nur der Diener eines Priesters war, strahlte er Selbstvertrauen und Würde aus. Seine Kleidung war elegant, was in dieser zerlumpten Armee ziemlich herausstach. Niemand kannte seinen Namen. Aber es mochte ihn auch niemand danach fragen, so wie niemand fragte, warum er nie mit den anderen aß oder plauderte, sondern sich stets von allen fernhielt. Jetzt saß der geheimnisvolle Diener da und beobachtete die Soldaten. In seiner linken Hand hielt er ein Messer mit einer sehr langen, schmalen Klinge, und als genug Männer zu ihm herüberschauten, balancierte er es mit der Spitze nach unten auf seiner Fingerkuppe. Die Haut war durch das abgeschnittene Stück eines Kettenhandschuhs geschützt, das er wie eine Schwertscheide darübergezogen hatte. Dann ließ er den Finger nach oben schnellen, und das Messer wirbelte mit blitzender Klinge durch die Luft, überschlug sich und landete erneut auf seinem Finger, wiederum mit der Spitze nach unten. Bei alldem hatte der Diener den Blick seiner dunklen Augen nicht eine Sekunde von den Soldaten abgewendet. Der Priester bemerkte von dieser Vorführung nichts, sondern betete weiter voller Inbrunst, die Wangen blutüberströmt. «Dominikus! Dominikus! Weise uns den Weg!» Das Messer schlug wieder einen Salto, und die Klinge funkelte im milchigen Licht des Nebelmorgens. «Dominikus! Führe uns! Führe uns!»
«Auf die Pferde! Los, bewegt euch!» Ein grauhaariger Mann mit einem riesigen Schild über der linken Schulter schob sich durch die Menge. «Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Was glotzt ihr denn so dämlich? Jesus, Maria und Josef, wir sind hier doch nicht auf dem Jahrmarkt! Los, verdammt noch mal, bewegt eure lahmen Ärsche!» Der Schild an seiner Schulter trug das Abzeichen eines roten Herzens, aber die Farbe war so verblichen und der Lederbezug so vernarbt, dass es kaum noch zu erkennen war. «Gütiger Jesus!» Der Mann hatte den Dominikaner und seinen Diener entdeckt. «Vater! Wir gehen jetzt. Jetzt sofort! Und ich warte nicht wegen irgendwelcher Gebete.» Er wandte sich wieder zu seinen Männern. «Aufsitzen! Und zwar ein bisschen plötzlich! Wir haben unser Teufelswerk zu tun!»
«Douglas!», herrschte ihn der Dominikaner an.
Der Grauhaarige fuhr herum. «Mein Name ist Sir William, Priester, und Ihr tätet gut daran, es nicht zu vergessen.»
Der Mönch blinzelte. Einen Moment wirkte er verwirrt, als sei er noch in der Ekstase seines von Schmerzen angefeuerten Gebets gefangen, dann verneigte er sich kurz, als Zeichen, dass er seinen Fehler einsah. «Ich sprach gerade mit dem heiligen Dominikus», erklärte er.
«Nun, dann hoffe ich, Ihr habt ihn gebeten, diesen verfluchten Nebel verschwinden zu lassen.»
«Er wird uns heute führen! Er wird uns führen!»
«Dann sollte er zusehen, dass er in Gang kommt», knurrte Sir William Douglas, Ritter von Liddesdale, «denn wir machen uns jetzt auf den Weg, ob Euer Heiliger bereit ist oder nicht.» Sir Williams Kettenhemd war von zahllosen Schlachten zerrissen und mit neueren Ringen geflickt, und am Saum und an den Ellbogen zeigte sich Rost. Sein Gesicht war ebenso vernarbt wie sein verblichener Schild. Er war jetzt sechsundvierzig und hatte wohl für jedes seiner Jahre, die sein Haar und seinen Bart grau gefärbt hatten, eine Schwert-, Pfeil- oder Speernarbe am Körper. Er betrat den stinkenden Schweinestall. «Schwingt die Haxen, Vater. Ich habe ein Pferd für Euch.»
«Ich werde zu Fuß gehen», erwiderte Bernard de Taillebourg und griff nach einem kräftigen Wanderstab, durch dessen Spitze eine lederne Peitsche geschlungen war. «Wie auch unser Herr zu Fuß gegangen ist.»
«Damit Ihr bei den Flussdurchquerungen keine nassen Füße kriegt, was?», spottete Sir William. «Ihr werdet über das Wasser gehen, nicht wahr, Vater? Ihr und Euer Diener.» Er schien als Einziger weder Ehrfurcht vor dem Priester noch Angst vor dem gutbewaffneten Diener zu haben, aber schließlich war Sir William Douglas berühmt dafür, dass er vor niemandem Angst hatte. Er war ein Clanführer von der Grenze, der Mord, Feuer, Schwert und Lanze einsetzte, um sein Land zu verteidigen, und so ein überkandidelter Priester aus Paris konnte ihn nicht beeindrucken. Überhaupt hatte Sir William nicht viel für Priester übrig, aber sein König hatte ihm befohlen, Bernard de Taillebourg bei dem heutigen Beutezug mitzunehmen, und Sir William hatte widerstrebend eingewilligt.
Überall um ihn herum schwangen sich Soldaten in die Sättel. Sie waren nur leicht bewaffnet, da sie nicht damit rechneten, auf Feinde zu treffen. Ein paar trugen Schilde, wie Sir William, aber den meisten genügte ein Schwert. Bernard de Taillebourg lief in seiner feuchten und schlammbespritzten Mönchskutte neben Sir William her. «Werdet Ihr in die Stadt reiten?»
«Natürlich nicht. Es herrscht Waffenruhe, schon vergessen?»
«Aber –»
«Und wenn Waffenruhe herrscht, dann halten wir uns daran.»
«Es wird also nicht zum Kampf kommen?»
«Nein, nicht zwischen uns und der Stadt. Und da es im Umkreis von hundert Meilen keine englische Armee gibt, gibt es auch keinen Grund zu kämpfen. Wir suchen nach Nahrung, Vater, Nahrung für uns und die Tiere, sonst nichts. Nur mit wohlgenährten Männern und Pferden kann man Kriege gewinnen.» Während er sprach, stieg Sir William auf sein Pferd, das von einem Knappen gehalten wurde. Er schob die Füße in die Steigbügel, zog den Lendenschutz des Kettenpanzers unter seinem Hintern hervor und nahm die Zügel auf. «Ich bringe Euch in die Nähe der Stadt, aber danach seid Ihr auf Euch selbst gestellt.»
Damit wendete Sir William sein Pferd und trieb es auf einen matschigen Weg, der zwischen zwei niedrigen Steinmauern entlangführte. Zweihundert berittene Soldaten folgten ihm in den nebligen Morgen, und der Priester, der zwischen den mächtigen, schmutzigen Pferden hin und her geschubst wurde, hatte Mühe, mit ihnen Schritt zu halten. Der Diener folgte ihm mit unbekümmerter Miene. Offensichtlich war er es gewohnt, unter Soldaten zu sein, denn er zeigte keinerlei Furcht, im Gegenteil, sein Verhalten ließ erahnen, dass er mit seinen Waffen vermutlich geschickter umzugehen wusste als ein Großteil der Männer, die hinter Sir William ritten.
Der Dominikaner und sein Diener waren gemeinsam mit einem Dutzend weiterer Botschafter von Philippe VI., König von Frankreich, nach Schottland entsandt worden, um König David II. um Hilfe zu bitten. Die Engländer hatten im Norden Frankreichs eine Schneise der Zerstörung hinterlassen, die französische Armee in der Nähe eines Dorfes namens Crécy vernichtend geschlagen und ein Dutzend Festungen in der Bretagne mit Hilfe der Bogenschützen in ihre Gewalt gebracht, während Edward von England aus seinen alten Besitztümern in der Gascogne seine wilden Reiter losgeschickt hatte. Und als sei das alles noch nicht genug, als wolle er ganz Europa zeigen, dass man Frankreich ungestraft zerstückeln konnte, belagerte der englische König nun auch noch die große Hafenfestung von Calais. Philippe de Valois tat sein Bestes, um die Belagerung zu durchbrechen, doch der Winter nahte, seine Fürsten murrten, ihr König sei ein schlechter Krieger, und so hatte er Schottlands König David, den Sohn von Robert Bruce, ein Hilfsgesuch geschickt. Fallt in England ein, hatte der französische König gedrängt, und zwingt Edward damit, die Belagerung von Calais aufzugeben, um sein Land zu beschützen. Die Schotten hatten die Bitte erwogen und waren schließlich von der französischen Gesandtschaft überzeugt worden, dass England wehrlos dalag. Wie konnte es anders sein? Edwards gesamte Armee befand sich in Calais, in der Bretagne und in der Gascogne, es war niemand mehr da, der England verteidigen konnte, und das bedeutete, dass der alte Erzfeind ihnen hilflos ausgeliefert war und nur darauf wartete, überfallen und ausgeraubt zu werden.
Und so waren die Schotten nach Süden gekommen.
Es war die größte Armee, die Schottland je über die Grenze geschickt hatte. Alle hohen Lords waren dabei, die Söhne und Enkel der Krieger, die England in der blutigen Schlacht von Bannockburn gedemütigt hatten, und sie hatten ihre Soldaten mitgebracht, die von den unablässigen Kämpfen entlang der Grenze abgehärtet waren. Aber diesmal, angelockt von der versprochenen Beute, waren auch die Clanführer aus dem Hochland und von den Inseln dabei, gefolgt von ihren wilden Stammeskriegern, die eine eigene Sprache besaßen und kämpften wie besessene Teufel. Zu Tausenden waren sie gekommen, um sich zu bereichern, und die französischen Gesandten waren zufrieden heimwärts gesegelt, um König Philippe mitzuteilen, Edward von England werde sicher umgehend die Belagerung von Calais aufgeben, sobald er erführe, dass die Schotten den Norden seines Landes verwüsteten.
Nur Bernard de Taillebourg war geblieben; er hatte noch etwas in Nordengland zu erledigen. Doch die ersten Tage der Invasion hatten ihn schier zur Verzweiflung getrieben. Die schottische Armee war zwölftausend Mann stark, größer als die, mit der König Edward die Franzosen bei Crécy geschlagen hatte, doch kaum über die Grenze, hatte die riesige Armee nichts Besseres im Sinn gehabt, als eine einsame Festung zu überfallen, die von armseligen achtunddreißig Mann verteidigt wurde, und obwohl alle achtunddreißig umgekommen waren, hatte das Ganze sie volle vier Tage gekostet. Weitere Zeit hatten sie durch Verhandlungen mit den Bürgern von Carlisle verloren, die mit Gold dafür bezahlt hatten, dass ihre Stadt verschont blieb, und dann hatte der junge schottische König noch drei Tage damit vertan, die große Augustinerabtei in Hexham zu plündern. Jetzt, zehn Tage nach Überquerung der Grenze und nach einem langen Marsch durch die nordenglischen Moore, war die schottische Armee endlich in Durham angekommen. Die Stadt hatte tausend Pfund in Gold geboten, damit sie verschont blieb, und König David hatte den Bewohnern zwei Tage gegeben, um das Geld zusammenzutreiben. Was bedeutete, dass Bernard de Taillebourg zwei Tage blieben, um irgendwie in die Stadt hineinzukommen, und deshalb folgte er Sir William rutschend, schlammbespritzt und durch den Nebel halb blind in ein Tal, über einen Fluss und auf einen steilen Hügel. «In welcher Richtung liegt die Stadt?», fragte er Sir William.
«Das kann ich Euch sagen, sobald der Nebel sich lichtet.»
«Glaubt Ihr, sie werden die Waffenruhe einhalten?»
«Die Bewohner von Durham sind fromm, Vater», erwiderte Sir William spöttisch, «aber vor allem haben sie die Hosen voll.» Das Lösegeld war von den Mönchen der Stadt ausgehandelt worden, und Sir William hatte dem König geraten, das Angebot abzulehnen. Wenn die Mönche ihnen tausend Pfund boten, wäre es besser, sie zu töten und sich zweitausend Pfund zu nehmen, aber König David war seinem Rat nicht gefolgt. David Bruce hatte einen Großteil seiner Jugend in Frankreich verbracht und betrachtete sich daher als kultiviert, doch Sir William kannte keine solchen Skrupel. «Euch wird schon nichts passieren, Ihr könnt den Leuten doch irgendeine Geschichte erzählen», beruhigte er den Priester.
Die Reiter waren auf der Hügelkuppe angekommen, und Sir William folgte dem Kamm, wiederum entlang eines von Steinmauern begrenzten Pfades, bis sie nach etwa einer Meile zu einem verlassenen Weiler kamen, wo sich vier geduckte Bauernhäuser um eine Wegkreuzung drängten, so niedrig, dass ihre Strohdächer direkt aus dem unebenen Boden zu wachsen schienen. In der Mitte der Kreuzung, wo die schlammigen Fahrspuren sich um einen Flecken aus Brennnesseln und Gras schlängelten, stand ein schiefes Steinkreuz. Sir William zügelte sein Pferd und betrachtete den gemeißelten Drachen, der sich um den Fuß des Denkmals wand. Ein Arm des Kreuzes fehlte. Einige seiner Männer saßen ab und inspizierten die niedrigen Häuser, doch sie fanden nichts und niemanden. Nur in einem der Häuser glühten noch ein paar verkohlte Scheite im Kamin, die sie dazu benutzten, um die Dächer in Brand zu setzen. Das Stroh fing jedoch nur schwer Feuer, denn es war so feucht, dass Moos und sogar Pilze darauf wuchsen.
Sir William zog einen Fuß aus dem Steigbügel und versuchte, das zerbrochene Kreuz umzustoßen, doch es rührte sich nicht. Er grunzte vor Anstrengung. Dann sah er Bernard de Taillebourgs missbilligende Miene und zog ein finsteres Gesicht. «Das hier ist kein heiliger Boden, Vater, sondern nur das gottverdammte England.» Er starrte den Drachen an, der sich mit aufgerissenem Maul nach oben wand. «Hässliches Vieh, findet Ihr nicht?»
«Drachen sind Kreaturen der Sünde, Wesen des Teufels», sagte Bernard de Taillebourg. «Sie können nur hässlich sein.»
«Wesen des Teufels, so, so.» Sir William trat erneut gegen das Kreuz. «Meine Mutter hat mir immer erzählt», keuchte er, «dass die verfluchten Engländer ihr gestohlenes Gold unter Drachenkreuzen vergraben.»
Zwei Minuten später war das Kreuz beiseitegehievt, und die Männer spähten enttäuscht in das Loch, in dem es gesteckt hatte. Der Rauch von den brennenden Dächern vermischte sich mit dem Nebel, waberte über die Straße und verschwand in den grauen Morgen. «Kein Gold», grummelte Sir William. Dann befahl er seinen Männern, ihm zu folgen, und führte sie Richtung Süden, aus dem beißenden Rauch hinaus. Er hielt Ausschau nach Vieh, das sie zur schottischen Armee treiben konnten, doch die Felder waren verlassen. Hinter den Plünderern leuchteten die Flammen der brennenden Häuser in einem verschwommenen Rot und Gold durch den Nebel, ein Glühen, das immer schwächer wurde, bis schließlich nur noch der Brandgeruch wahrnehmbar war. Plötzlich, wie aus dem Nichts, erfüllte dröhnendes Glockengeläut den Himmel, als wolle es mit seinem Getöse die ganze Welt aufrütteln. Sir William folgte dem Klang ein Stück, ritt durch eine Lücke in der Mauer auf eine Weide, hielt dort an und stellte sich in die Steigbügel, um zu lauschen, doch in dem Nebel war es unmöglich festzustellen, woher das Geläut kam und wie weit die Glocken entfernt waren. Dann hörte es genauso abrupt auf, wie es angefangen hatte. Der Nebel lichtete sich ein wenig und gab den Blick auf die orangegelben Blätter eines Ulmengehölzes frei. Bernard de Taillebourg sank auf der mit weißen Champignons gesprenkelten Wiese auf die Knie und begann laut zu beten. «Still, Vater!», herrschte Sir William ihn an.
Der Priester bekreuzigte sich, als flehe er den Himmel um Vergebung für Sir Williams Respektlosigkeit an, ihn beim Gebet zu unterbrechen. «Ihr habt gesagt, hier wären keine Feinde», beschwerte er sich.
«Ich horche auch nicht auf irgendwelche dämlichen Feinde», gab Sir William zurück, «sondern auf Tiere. Auf die Glöckchen von Kühen oder Schafen.» Dennoch wirkte Sir William erstaunlich nervös für jemanden, der nur nach Vieh Ausschau hielt. Immer wieder drehte er sich im Sattel um, spähte in den Nebel und zog eine finstere Miene, wenn irgendwo ein Pferdegeschirr klirrte oder Hufe auf den feuchten Boden stampften. Wütend knurrte er die Männer um ihn herum an, still zu sein. Er war schon Soldat gewesen, bevor einige von ihnen überhaupt geboren waren, und er wäre nicht so lange am Leben geblieben, wenn er nicht auf seine Instinkte gehört hätte. Und jetzt, in diesem feuchten Nebel, roch er Gefahr. Sein Verstand sagte ihm, dass es nichts zu fürchten gab, dass die englische Armee weit weg war, jenseits des Kanals, aber trotzdem roch er den Tod, und ohne recht zu merken, was er tat, nahm er den Schild von seiner Schulter und schob seinen linken Arm durch die Haltegriffe. Es war ein großer Schild, noch aus der Zeit, bevor die Krieger ihre Kettenpanzer mit Metallplatten verstärkt hatten, groß und breit genug, um den gesamten Körper eines Mannes zu schützen.
Ein Soldat rief etwas vom Rand der Weide herüber, und Sir William packte seinen Schwertknauf, doch dann erkannte er, dass es nur ein Ruf der Überraschung gewesen war, denn vor ihnen ragten aus dem Nebel, der oben auf dem Hügel fast verschwunden war, sich unten jedoch wie ein weißer Fluss durch die Täler wand, unvermittelt Türme auf. Ihnen gegenüber, ein gutes Stück entfernt, erhob sich ein weiterer Hügel aus dem milchigen Weiß, und seine Kuppe war von einer mächtigen Kathedrale und einer Burg gekrönt. Riesig und düster schienen sie über dem Dunst zu schweben wie das verhexte Schloss eines Zauberers. Der Diener von Bernard de Taillebourg, der das Gefühl hatte, seit Wochen der Zivilisation entsagt zu haben, starrte wie in Trance auf die beiden Gebäude. Auf dem höheren der beiden Kathedralentürme drängten sich schwarz gewandete Mönche, und der Diener sah, wie sie auf die schottischen Reiter zeigten.
«Durham», knurrte Sir William. Die Glocken hatten wohl die Gläubigen zu ihrem morgendlichen Gebet gerufen.
«Da muss ich hin!» Der Dominikaner erhob sich, griff nach seinem Stab und machte sich auf den Weg zu der dunstverschleierten Stadt.
Sir William schnitt ihm mit seinem Pferd den Weg ab. «Warum so eilig, Vater?», fragte er. De Taillebourg versuchte, sich an dem Schotten vorbeizudrängen. Ein scharrendes Geräusch ertönte, und plötzlich schwebte eine Klinge vor dem Gesicht des Dominikaners, kalt, schwer und grau. «Ich habe Euch gefragt, warum Ihr es so eilig habt.» Sir Williams Stimme war so kalt wie sein Schwert. Dann, alarmiert durch den Warnruf eines seiner Männer, blickte er auf und sah, dass der Diener des Priesters sein Messer gezückt hatte. «Wenn Euer Bastard von einem Diener nicht augenblicklich seine Waffe verschwinden lässt», sagte Sir William leise, aber mit unüberhörbarer Drohung, «brate ich mir seine Eier zum Abendessen.»
De Taillebourg sagte etwas auf Französisch, woraufhin der Diener widerstrebend die Klinge zurück in die Scheide schob. Der Priester sah zu Sir William auf. «Habt Ihr keine Angst um Eure unsterbliche Seele?», fragte er.
Sir William lächelte und ließ den Blick noch einmal über die Hügelkuppe schweifen, doch er konnte in den Nebelresten nichts Ungewöhnliches entdecken und kam zu dem Schluss, dass seine Nervosität nur das Ergebnis seiner allzu lebhaften Phantasie gewesen war. Vielleicht hatte er am Abend zuvor einfach zu viel gegessen und getrunken. Die Schotten hatten in dem eingenommenen Wohnsitz von Durhams Prior, dessen Vorratskammer und Weinkeller bestens gefüllt waren, ein Festmahl abgehalten, und allzu üppige Mahlzeiten zogen bisweilen böse Vorahnungen nach sich. «Die Sorge um meine Seele überlasse ich meinem eigenen Priester», sagte Sir William. Dann hob er mit der Schwertspitze de Taillebourgs Kinn an. «Was hat ein Franzose bei unseren Feinden in Durham zu suchen?», fragte er drohend.
«Das geht nur die Kirche etwas an», erwiderte de Taillebourg bestimmt.
«Wen das etwas angeht, entscheide ich, und ich will wissen, was Ihr vorhabt.»
«Wenn Ihr versucht, mich aufzuhalten», sagte de Taillebourg und stieß die Klinge weg, «werde ich dafür sorgen, dass der König Euch bestraft und die Kirche Euch verbannt und der Heilige Vater Eure Seele in die ewige Verdammnis schickt. Ich werde –»
«Haltet Eure gottverdammte Klappe!», knurrte Sir William. «Glaubt Ihr im Ernst, ich lasse mir von einem Priester Angst einjagen? Unser König ist noch ein halbes Kind, und die Kirche tut das, was ihre Geldgeber ihr sagen.» Er richtete die Klinge wieder auf den Priester, diesmal auf seinen Hals. «Und jetzt sagt mir, was Ihr vorhabt. Sagt mir, warum ein Franzose bei uns bleibt, anstatt mit seinen Landsleuten nach Hause zurückzukehren. Sagt mir, was Ihr in Durham wollt.»
Bernard de Taillebourg packte das Kruzifix, das um seinen Hals hing, und hielt es Sir William entgegen. Bei einem anderen Mann hätte man diese Geste als Zeichen der Furcht verstehen können, doch bei dem Dominikaner sah es eher so aus, als wolle er Sir Williams Seele mit den Mächten des Himmels drohen. Sir William warf einen gierigen Blick auf das Kruzifix, um dessen Wert einzuschätzen, doch das Kreuz war aus einfachem Holz und die kleine Christusfigur, die sich in Todesqualen daran wand, aus verblichenem Knochen. Wäre sie aus Gold gewesen, hätte Sir William den Anhänger vielleicht an sich genommen, doch so spuckte er nur spöttisch aus. Ein paar seiner Männer, die Gott mehr fürchteten als ihren Herrn, bekreuzigten sich, doch die meisten scherten sich nicht darum. Den Diener behielten sie im Auge, denn der sah gefährlich aus, aber ein Geistlicher mittleren Alters aus Paris konnte ihnen keine Angst einjagen, trotz des flammenden Blicks und der ausgezehrten Wangen. «Was wollt Ihr tun?», fragte de Taillebourg verächtlich. «Mich töten?»
«Wenn es sein muss», erwiderte Sir William ungerührt. Es war ihm von Anfang an nicht klar gewesen, was der Priester bei der französischen Gesandtschaft zu suchen hatte, und dass er hiergeblieben war, als die anderen abgereist waren, machte das Ganze noch mysteriöser. Doch ein geschwätziger Soldat, einer von den Franzosen, die zweihundert Plattenrüstungen als Geschenk für die Schotten überbracht hatten, hatte Sir William erzählt, der Priester sei auf der Suche nach einem großen Schatz, und wenn dieser Schatz sich in Durham befand, wollte Sir William darüber Bescheid wissen – und einen Teil davon haben. «Ich habe schon Priester getötet», sagte er zu de Taillebourg, «und als Bezahlung dafür bekam ich von einem anderen Priester einen Ablass, also glaubt ja nicht, dass ich Euch oder Eure Kirche fürchte. Es gibt keine Sünde, von der man sich nicht freikaufen kann, und keine Vergebung, die sich nicht mit Geld erlangen lässt.»
Der Dominikaner zuckte die Achseln. Hinter ihm standen zwei von Sir Williams Männern mit gezogenem Schwert, und er begriff, dass die Schotten ihn und seinen Diener tatsächlich töten würden. Diese Männer, die dem roten Herz von Douglas folgten, waren Raufbolde von der Grenze, für die Schlacht gezüchtet wie Hunde für die Jagd, und es war zwecklos, ihnen mit Verdammnis zu drohen, denn die war ihnen vollkommen gleichgültig. «Ich will nach Durham», sagte de Taillebourg, «um einen Mann zu suchen.»
«Was für einen Mann?», fragte Sir William, das Schwert noch immer am Hals des Priesters.
«Einen Mönch», erklärte de Taillebourg geduldig. «Er muss inzwischen sehr alt sein, vielleicht lebt er auch gar nicht mehr. Er ist Franzose, ein Benediktiner, und ist vor vielen Jahren aus Paris geflohen.»
«Warum ist er geflohen?»
«Weil der König seinen Kopf wollte.»
«Den Kopf eines Mönchs?», fragte Sir William skeptisch.
«Er war nicht immer Benediktiner. Einst war er ein Templer.»
«Ah.» Sir William begann zu verstehen.
«Und er weiß», fuhr de Taillebourg fort, «wo ein großer Schatz verborgen ist.»
«Der Schatz der Tempelritter?»
«Angeblich befindet er sich in Paris, seit vielen Jahren an einem geheimen Ort versteckt. Aber erst letztes Jahr haben wir erfahren, dass der Franzose noch lebt und in England ist. Dieser Benediktiner war einst der Sakristan der Templer. Wisst Ihr, was das ist?»
«Behandelt mich nicht wie einen Schulknaben, Vater», sagte Sir William kalt.
De Taillebourg neigte um Vergebung bittend den Kopf. «Wenn überhaupt jemand weiß, wo sich der Schatz der Templer befindet, dann ist es der Mann, der ihn bewacht hat. Und dieser Mann lebt, wie man uns berichtet hat, jetzt in Durham.»
Sir William ließ das Schwert sinken. Was der Priester sagte, klang logisch. Die Tempelritter, ein Orden mönchischer Soldaten, die einen Eid geschworen hatten, die Pilgerwege zwischen der Christenheit und Jerusalem zu beschützen, waren sehr reich geworden, so reich, dass es selbst die Träume von Königen übertraf, und das war dumm, denn es weckte den Neid der Könige, und neidische Könige waren gefährliche Feinde. Der König von Frankreich war ein solcher Feind, und er hatte den Befehl erteilt, die Templer zu vernichten. Zu diesem Zweck waren sie der Ketzerei beschuldigt worden, Rechtsgelehrte hatten mühelos die Tatsachen verdreht, und so war der Orden zerschlagen worden. Man hatte die Anführer verbrannt und ihr Land beschlagnahmt, aber der Schatz, der sagenumwobene Schatz der Tempelritter, war nie gefunden worden. Und der Sakristan des Ordens, dessen Aufgabe es war, den Schatz sicher zu verwahren, würde bestimmt wissen, wo er sich befand. «Wann wurde der Templerorden aufgelöst?», fragte Sir William.
«Vor neunundzwanzig Jahren.»
Dann konnte es in der Tat sein, dass der Sakristan noch lebte, dachte Sir William. Er war ein alter Mann, aber möglicherweise noch am Leben. Sir William schob sein Schwert in die Scheide, nun vollends überzeugt von de Taillebourgs Geschichte. Doch sie war von Anfang bis Ende erfunden, abgesehen davon, dass es in Durham einen alten Mönch gab, aber der war kein Franzose und nie ein Templer gewesen, und somit wusste er vermutlich nichts über den Verbleib des Schatzes. Aber Bernard de Taillebourg hatte mit überzeugender Stimme gesprochen, und die Sage vom verschwundenen Schatz hallte in ganz Europa wider; wann immer Männer zusammentraten, um sich wundersame Geschichten zu erzählen, gehörte sie dazu. Sir William wollte daran glauben, dass es den Schatz gab, und de Taillebourgs Aussage überzeugte ihn mehr als alles andere, dass er existierte. «Wenn Ihr diesen Mann ausfindig macht», sagte er, «und er lebt noch, und Ihr findet den Schatz, dann werden wir diejenigen sein, die es Euch ermöglicht haben. Wir haben Euch hierhergebracht, und wir haben Euch auf Eurer Reise nach Durham beschützt.»
«Stimmt», sagte de Taillebourg.
Die bereitwillige Zustimmung des Priesters überraschte Sir William. Mit gerunzelter Stirn musterte er den Dominikaner, als versuche er, dessen Glaubwürdigkeit einzuschätzen. «Also wird der Schatz zwischen uns geteilt», verlangte er.
«Selbstverständlich.»
Sir William war kein Dummkopf. Wenn er den Priester nach Durham gehen ließ, würde er ihn nie wiedersehen. Sir William hob den Kopf und blickte zur Kathedrale hinüber. Es hieß, der Schatz der Tempelritter sei das Gold von Jerusalem, mehr Gold, als irgendein Mensch sich vorstellen konnte, und Sir William war ehrlich genug einzusehen, dass er nicht die Möglichkeiten besaß, einen Teil dieses Goldschatzes nach Liddesdale abzuzweigen. Dazu brauchte er den König. David II. war zwar ein Schwächling, kaum trocken hinter den Ohren und verweichlicht durch seinen Aufenthalt in Frankreich, aber Könige verfügten über Mittel, die Rittern versagt waren, und David von Schottland konnte quasi als Gleichgestellter mit Philippe von Frankreich sprechen, während eine Botschaft von William Douglas in Paris ignoriert werden würde. «Jamie!», rief er seinem Neffen zu, der gemeinsam mit einem anderen Mann de Taillebourg in Schach hielt. «Du und Dougal, ihr bringt den Priester zum König.»
«Ihr müsst mich gehen lassen!», protestierte Bernard de Taillebourg.
Sir William beugte sich im Sattel vor. «Wollt Ihr, dass ich Euch die priesterlichen Eier abschneide, um mir daraus eine Börse nähen zu lassen?», fragte er mit einem Lächeln, dann wandte er sich wieder zu seinem Neffen. «Sagt dem König, sein französischer Priester hat Neuigkeiten, die uns betreffen, und er soll ihn bewachen lassen, bis ich wieder zurück bin.» Sir William hatte beschlossen, wenn es in Durham einen alten französischen Mönch gab, dann sollte er von den Dienern des Königs von Schottland befragt werden, und falls der Mönch etwas Wichtiges zu sagen hatte, konnte man diese Informationen an den französischen König verkaufen. «Führ ihn ab, Jamie», befahl er, «und pass auf den verfluchten Diener auf! Nimm ihm das Schwert ab.»
Obwohl die Vorstellung, ein einfacher Priester und sein Diener könnten ihm Schwierigkeiten machen, Jamie nur ein Grinsen entlockte, gehorchte er seinem Onkel. Er forderte den Diener auf, ihm sein Schwert zu geben, und als der Mann sich dem Befehl widersetzte, zog er seinerseits die Klinge. Mit scharfer Stimme befahl de Taillebourg seinem Diener zu gehorchen, und das Schwert wurde mit grimmiger Miene ausgehändigt. Jamie Douglas befestigte es an seinem Gürtel. «Die habe ich im Griff, Onkel.»
«Dann mach dich auf den Weg», sagte Sir William und sah seinem Neffen und dessen Gefährten nach, wie sie, beide auf prächtigen Hengsten von den Ländereien des Earl of Northumberland, den Priester und seinen Diener zurück zum Lager des Königs eskortierten. Zweifellos würde der Priester sich beim König beschweren, und David, der so viel schwächer war als sein großartiger Vater, würde sich sorgen, dass er bei Gott und dem französischen König in Ungnade fiel, aber später würde er sich noch viel mehr sorgen, dass er bei Sir William in Ungnade fiel. Bei dem Gedanken schmunzelte Sir William. Dann bemerkte er, dass ein paar seiner Männer am anderen Ende des Feldes abgestiegen waren. «Wer zum Teufel hat euch gesagt, dass ihr absitzen sollt?», bellte er wütend. Doch es waren gar nicht seine Männer, sondern Fremde, die der verschwindende Nebel freigegeben hatte. Er erinnerte sich an sein ungutes Gefühl und verfluchte sich, weil er seine Zeit mit dem Priester verschwendet hatte.
Und noch während er sich verfluchte, kam der erste Pfeil angeflogen. Ein Zischen von Federn in der Luft, dann ein dumpfer Aufprall, wie eine Streitaxt, die sich in Fleisch gräbt, gefolgt von einem abgehackten Stöhnen des Opfers und einer Sekunde der Stille.
Und dann der Schrei.
Thomas von Hookton hatte die Glocken gehört, ein tiefes, sonores Läuten, nicht das helle Bimmeln einer kleinen Dorfkirche, sondern einen mächtigen Klang von der Gewalt des Donners. Durham, dachte er, und ihn überkam eine große Erschöpfung, denn die Reise war sehr lang gewesen.
Sie hatte in der Pikardie begonnen, auf einem Feld, das nach toten Männern und Pferden stank, einem Feld gefallener Banner, zerbrochener Waffen und verschossener Pfeile. Es war ein großer Sieg gewesen, und Thomas hatte sich gefragt, warum er sich danach so matt und unruhig gefühlt hatte. Die Engländer waren nach Norden weitermarschiert, um Calais zu belagern, doch Thomas, der dem Earl of Northampton unterstellt war, hatte von diesem die Erlaubnis bekommen, einen verwundeten Kameraden nach Caen zu bringen, wo es einen außergewöhnlich geschickten Arzt gab. Doch dann war Befehl erlassen worden, dass niemand ohne die Erlaubnis des Königs die Armee verlassen durfte. Der Earl hatte beim König vorgesprochen, und so hatte Edward Plantagenet von Thomas von Hookton erfahren, dessen Vater Priester gewesen war und aus einer Familie französischer Exilanten stammte, den Vexilles, die angeblich einst im Besitz des Heiligen Grals gewesen waren. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber immerhin ging es um den Gral, das Kostbarste, was je auf der Welt existiert hatte, und so hatte der König Thomas befragt. Thomas hatte das Ganze als Mär herabgespielt, doch dann war der Bischof von Durham vorgetreten und hatte berichtet, dass Thomas’ Vater einst in Durham eingekerkert gewesen war. «Er war verrückt», erklärte der Bischof dem König. «Vollkommen wahnsinnig! Also haben sie ihn zu seiner eigenen Sicherheit eingesperrt.»
«Hat er vom Gral gesprochen?», wollte der König wissen, und der Bischof antwortete, es gebe noch einen Mann in seiner Diözese, der dies vielleicht wisse, einen alten Mönch namens Hugh Collimore, der den verrückten Ralph Vexille, Thomas’ Vater, gepflegt hatte. Der König hätte die Geschichte wahrscheinlich als Kirchengeschwätz abgetan, hätte Thomas in der blutigen Schlacht auf dem Hügel bei Crécy nicht das Erbstück seines Vaters, die Lanze des heiligen Georg, zurückerobert. In dieser Schlacht war auch Thomas’ Freund und Hauptmann, Sir William Skeat, schwer verwundet worden, und den wollte er zu dem Arzt in der Normandie bringen, aber der König hatte darauf bestanden, dass Thomas stattdessen nach Durham gehen und mit Bruder Collimore sprechen sollte. So hatte Eleanors Vater Sir William Skeat nach Caen gebracht, und Thomas, Eleanor und Vater Hobbe waren mit einem königlichen Kaplan und einem Ritter aus König Edwards Gefolge nach England gereist. Doch in London waren der Kaplan und der Ritter an einem Fieber erkrankt, sodass Thomas und seine Gefährten allein nach Norden weitergezogen waren, und nun standen sie an einem nebligen Morgen auf einem Hügel und lauschten dem Glockengeläut der Kathedrale von Durham. Eleanor war aufgeregt, genau wie Vater Hobbe, denn sie glaubte daran, dass der Gral Frieden und Gerechtigkeit in eine Welt bringen würde, die nach verbrannten Häusern stank. Nie wieder würde es Leiden geben, nie wieder Krieg und vielleicht auch nie wieder Krankheit.
Thomas wünschte, er könnte ebenfalls daran glauben. Er wünschte sich, dass seine nächtliche Vision echt war, nicht nur Flammen und Rauch. Doch falls der Gral tatsächlich existierte, würde er sicherlich in einer großen Kathedrale stehen, von Engeln bewacht. Oder aber er war von der Erde verschwunden, und wenn es keinen Gral mehr gab, setzte Thomas seinen Glauben lieber in seinen Bogen und seine Pfeile aus Eschenholz. Am Bauch des Bogens war ein silbernes Abzeichen befestigt, das einen Greif zeigte, das Wappentier seiner Familie, der Vexilles. Der Greif hielt einen Kelch in den Klauen, und man hatte Thomas erzählt, es sei der Gral. Immer wieder dieser Gral. Er lockte ihn, verhöhnte ihn, dirigierte sein Leben und veränderte alles, und doch tauchte er niemals auf, außer in einem Traum aus Feuer. Er war ein Mysterium, genau wie Thomas’ Familie, aber vielleicht konnte Bruder Collimore das Geheimnis lüften, und deshalb war Thomas nach Norden gekommen. Auch wenn er nichts über den Gral herausbekam, würde er sicher mehr über seine Familie erfahren, und das allein lohnte die Reise.
«Wo entlang?», fragte Vater Hobbe.
«Weiß der Himmel», erwiderte Thomas. Alles war im Nebel versunken.
«Das Glockengeläut kam von dort.» Vater Hobbe wies nach Nordosten. Er war voller Energie und Enthusiasmus und vertraute blind auf Thomas’ Orientierungssinn, obwohl Thomas nicht die geringste Ahnung hatte, wo sie sich befanden. Vor einer Weile waren sie an einer Weggabelung vorbeigekommen, und Thomas hatte aufs Geratewohl die linke Abzweigung gewählt, die jetzt anstieg und sich fast völlig im Gras verlor. Die Wiese war mit Champignons gesprenkelt und so feucht, dass ihr Pferd ein paarmal ausrutschte. Die Stute trug das bisschen Gepäck, das sie besaßen, und in einem der Säcke, die am Sattelknauf hingen, befand sich ein Brief vom Bischof an John Fossor, den Prior von Durham. «Geliebter Bruder im Herrn», begann der Brief, in dem Fossor gebeten wurde, Thomas von Hookton und seinen Gefährten zu gestatten, Bruder Collimore einige Fragen bezüglich Vater Ralph Vexille zu stellen, «an den Ihr Euch nicht erinnern werdet, denn er wurde in Eurem Haus verwahrt, bevor Ihr nach Durham kamt, ja sogar bevor ich in das Bistum berufen wurde, doch es wird noch ein paar Menschen geben, die sich an ihn erinnern, und Bruder Collimore – sofern er mit Gottes Willen noch lebt – besitzt einiges Wissen über ihn und den großen Schatz, den er verbarg. Wir erbitten dies im Namen des Königs und im Dienst des allmächtigen Gottes, der unserem Wappen in diesem Bemühen seinen Segen angedeihen lässt.»
«Was ist das?», fragte Eleanor und deutete den Hügel hinauf, wo ein mattes, rötliches Glühen durch den Nebel schimmerte.
«Still», zischte Thomas und hob warnend die Hand. Er roch Brandgeruch und sah Flammen züngeln, aber es waren keine Stimmen zu hören. Er nahm seinen Bogen vom Sattel und schnürte ihn, indem er den riesigen Eibenstab bog und die Schlaufe am Ende der Hanfsehne über die Hornkerbe schob. Dann zog er einen Pfeil aus der Tasche, bedeutete Eleanor und Vater Hobbe zu bleiben, wo sie waren, und schlich vorsichtig bis zu einer dichten Hecke, durch deren sterbendes Laub Lerchen und Finken flatterten. Das Feuer loderte kräftig, war also vermutlich erst vor kurzem gelegt worden. Mit halbgezogenem Bogen rückte er noch ein paar Schritte vor, bis er eine Handvoll Bauernhäuser an einer Wegkreuzung ausmachen konnte, deren Strohdächer und Holzbalken lichterloh brannten. Doch sonst war niemand zu sehen, und so winkte er Eleanor und Vater Hobbe, ihm zu folgen. Dann ertönte ein Schrei, scheinbar weit weg, vielleicht aber auch nur durch den Nebel gedämpft. Thomas starrte durch den Rauch und die Flammen und den Dunst, und plötzlich kamen zwei Reiter in Sicht, Männer in Kettenpanzern auf dunklen Streitrössern. Sie trugen schwarze Hüte, schwarze Stiefel und Schwerter in schwarzen Scheiden, und sie begleiteten zwei weitere Männer, die zu Fuß gingen. Der eine von ihnen war ein Priester – offenbar ein Dominikaner, wie seine schwarz-weiße Kutte erkennen ließ – mit blutverschmiertem Gesicht; der andere trug ebenfalls einen Kettenpanzer, war groß gewachsen und hatte langes, schwarzes Haar und ein schmales, intelligentes Gesicht. Die beiden folgten den Reitern durch den rauchdurchzogenen Nebel, doch als sie an der Wegkreuzung ankamen, sank der Priester auf die Knie und bekreuzigte sich.
Der anführende Reiter schien verärgert über das Gebet des Priesters, denn er wendete sein Pferd, zog das Schwert aus der Scheide und stupste den Knienden mit der Klinge an. Der Priester sah auf und rammte zu Thomas’ Verblüffung plötzlich seinen Stab gegen den Hals des Hengstes. Das Tier sprang zur Seite, und der Priester schlug erneut zu, diesmal auf den Schwertarm des Reiters. Dieser versuchte, mit seiner langen Klinge auszuholen, war jedoch durch die abrupte Seitwärtsbewegung seines Hengstes aus dem Gleichgewicht geraten. Der zweite Reiter lag bereits auf dem Boden, obwohl Thomas ihn nicht hatte fallen sehen, und der Schwarzhaarige mit dem Kettenpanzer stand breitbeinig über ihm, ein langes Messer in der Hand. Thomas starrte nur verwirrt hinüber, denn er war überzeugt, dass weder einer der Reiter noch der Priester noch der Schwarzhaarige den Schrei ausgestoßen hatte, doch außer ihnen war niemand zu sehen. Einer der beiden Reiter war bereits tot, der andere rang lautlos mit dem Priester, und Thomas kam das Ganze vollkommen unwirklich vor, wie ein Traum, als betrachte er eine Pantomime auf dem Jahrmarkt: Der schwarz gekleidete Reiter war der Teufel, der Priester Gottes Wille, und Thomas’ Frage nach dem Gral würde dadurch entschieden, wer den Kampf gewann. Vater Hobbe riss ihm den Bogen aus der Hand. «Wir müssen helfen!»
Doch der Priester sah nicht aus, als ob er Hilfe brauchte. Er benutzte den Stab wie ein Schwert, parierte den Schlag seines Gegners und hieb ihm mit einem Ausfallschritt den Stab gegen die Rippen. Dann rammte der Schwarzhaarige dem Reiter von unten ein Schwert in den Rücken, und der Mann bog sich zuckend nach hinten und ließ seine Klinge fallen. Einen Moment starrte er hinunter auf den Priester, dann sank er rücklings aus dem Sattel. Dabei blieben seine Füße vorübergehend in den Steigbügeln hängen, und das Pferd galoppierte panisch den Hügel hinauf. Der Mörder wischte die Klinge seines Schwertes ab und nahm sich die Scheide des anderen Toten.
Der Priester war losgelaufen, um das andere Pferd festzuhalten, spürte jedoch plötzlich, dass er beobachtet wurde, drehte sich um und erblickte in dem Nebel zwei Männer und eine Frau. Einer der Männer war Priester und hielt Pfeil und Bogen in der Hand. «Sie wollten mich töten!», rief Bernard de Taillebourg auf Französisch. Der Schwarzhaarige fuhr herum, das Schwert drohend erhoben.
«Ist schon in Ordnung», sagte Thomas zu Vater Hobbe, nahm seinem Gefährten den Bogen ab und hängte ihn sich über die Schulter. Gott hatte gesprochen, der Priester hatte den Kampf gewonnen, und Thomas musste wieder an seine nächtliche Vision denken, als der Gral wie ein Feuerkelch zwischen den Wolken aufgeleuchtet war. Dann sah er, dass das Gesicht des fremden Priesters unter den Blutspuren hager und ausgezehrt war, das Gesicht eines Märtyrers mit dem Blick eines Mannes, der nach Gott gehungert und dabei zum Heiligen geworden war, und beinahe wäre Thomas auf die Knie gesunken. «Wer seid Ihr?», rief er dem Dominikaner zu.
«Ich bin ein Bote.» Bernard de Taillebourg griff nach der erstbesten Erklärung, um seine Verwirrung zu überspielen. Gerade hatte er sich seiner schottischen Eskorte entledigt, und nun überlegte er, wie er dem großen jungen Mann mit dem schwarzen Bogen entkommen sollte. Doch dann zischte plötzlich ein Schwarm Pfeile um ihre Köpfe, einer traf den Stamm einer Ulme direkt neben ihm, ein anderer glitt über das nasse Gras, ganz in der Nähe wieherte ein Pferd, und Männer brüllten durcheinander. Der Dominikaner rief seinem Diener zu, er solle das zweite Pferd einfangen, das seine Flucht mittlerweile verlangsamt hatte, und als dies geschehen war, sah de Taillebourg, dass der Fremde mit dem Bogen ihn gar nicht mehr beachtete, sondern nach Süden starrte, von wo die Pfeile gekommen waren.
Also wandte er sich der Stadt zu, befahl seinem Diener, ihm zu folgen, und sah zu, dass er davonkam.
Für Gott, für Frankreich, für St. Denis und für den Gral.
Sir William Douglas fluchte. Überall zischten Pfeile durch die Luft. Pferde wieherten, und Männer lagen tot oder verletzt im Gras. Im ersten Moment war er verwirrt, dann begriff er, dass sein Nahrungssuchtrupp auf eine englische Einheit gestoßen sein musste. Aber was für eine Einheit konnte das sein? Hier gab es doch weit und breit keine feindlichen Soldaten! Die gesamte englische Armee war schließlich in Frankreich! Das konnte nur bedeuten, dass die Bürger von Durham die Waffenruhe gebrochen hatten, und dieser Gedanke erfüllte Sir William mit maßlosem Zorn. Bei Gott, wenn er mit dieser Stadt fertig war, würde kein Stein mehr auf dem anderen stehen! Er hob seinen riesigen Schild, um sich zu schützen, und galoppierte auf die Bogenschützen zu, die sich hinter einer niedrigen Hecke aufgestellt hatten. Es waren nicht allzu viele, vielleicht fünfzig Mann, und er hatte noch fast zweihundert berittene Soldaten bei sich, also brüllte er den Befehl zum Angriff. Scharrend glitten die Schwerter aus den Scheiden. «Tötet die Schweinehunde!», rief Sir William. «Tötet sie!» Er hieb seinem Pferd die Sporen in die Weichen und stieß in seinem Drang, zu der Hecke zu gelangen, andere verwirrte Reiter beiseite. Er wusste, dass der Angriff nicht formiert war, dass einige seiner Männer sterben würden, doch sobald sie den Schwarzdorn überwunden hatten, würden sie die Bastarde allesamt niedermetzeln.
Verfluchte Bogenschützen! Er hasste sie. Und noch mehr hasste er englische Bogenschützen. Und am meisten hasste er hinterhältige, die Waffenruhe brechende Bogenschützen aus Durham. «Vorwärts!», brüllte er. «Douglas! Douglas!» Es gefiel ihm, seine Feinde wissen zu lassen, wer sie tötete und wer ihre Frauen vergewaltigen würde, sobald sie tot waren. Wenn die Stadt die Waffenruhe gebrochen hatte, dann gnade ihr Gott, denn er würde sie von vorn bis hinten plündern und in Brand setzen. Er würde die Häuser niederbrennen, die Asche durchpflügen und die Gebeine ihrer Bewohner dem Eis und den Stürmen des Winters überlassen, und noch viele Jahre lang würden Männer die kahlen Steine der zerstörten Kathedrale sehen, die Vögel, die in den verlassenen Türmen der Festung nisteten, und sie würden wissen, dass der Ritter von Liddesdale Rache genommen hatte.
«Douglas!», rief er, «Douglas!», und er spürte den dumpfen Aufprall von Pfeilen auf seinem Schild. Dann wieherte sein Pferd und begann zu stolpern, und er wusste, dass die Eisenspitzen sich tief in die Brust des Tieres gebohrt haben mussten. Er zog die Füße aus den Steigbügeln, als das Pferd seitwärts taumelte. Männer stürmten unter herausforderndem Gebrüll an ihm vorbei, und Sir William warf sich aus dem Sattel und auf seinen Schild, der wie ein Schlitten über das nasse Gras glitt. Er hörte sein Pferd vor Schmerz brüllen, doch er selbst war unverletzt. Er sprang auf, griff nach seinem Schwert, das er im Fallen losgelassen hatte, und lief mit seinen berittenen Männern vorwärts. Einem der Reiter ragte ein Pfeil aus dem Knie. Ein Pferd stürzte, die Augen aufgerissen und die Zähne gebleckt, und aus den Pfeilwunden sprudelte das Blut. Die ersten Reiter hatten die Hecke erreicht; einige hatten eine Lücke gefunden und waren hindurchgeprescht, und Sir William sah, dass die verfluchten englischen Bogenschützen davonliefen. Bastarde! Feige, elende, gottverdammte englische Hurensöhne! Dann hörte er zu seiner Linken das harte Surren weiterer Bogensehnen, und einer seiner Männer fiel mit einem Pfeil im Kopf vom Pferd. Der Nebel lockerte sich ein wenig, und er sah, dass die feindlichen Bogenschützen keineswegs weggelaufen waren, sondern sich nur hinter eine solide Mauer aus Fußsoldaten zurückgezogen hatten. Wieder surrten die Bogensehnen. Ein Pferd bäumte sich auf, und ein Pfeil bohrte sich in seinen Bauch. Ein Mann taumelte, wurde ein zweites Mal getroffen und stürzte mit klirrender Rüstung hintenüber.
Gütiger Jesus, das war eine ganze Armee! Eine ganze gottverdammte Armee! «Zurück! Zurück!», rief er. «Macht kehrt! Zurück!» Er brüllte, bis er heiser war. Ein weiterer Pfeil donnerte mit solcher Wucht gegen seinen Schild, dass die Spitze sich durch das lederbezogene Weidenholz grub, und vor lauter Wut schlug er danach, sodass der Eschenstab zerbrach.
«Onkel! Onkel!», rief jemand. Sir William wandte sich um. Es war Robbie Douglas, einer seiner acht Neffen, der mit der schottischen Armee ritt. Er wollte ihm ein neues Pferd bringen, doch zwei englische Pfeile trafen die Kruppe des Tieres, und von Schmerz gepeinigt, riss es sich los.
«Reite zurück!», rief Sir William seinem Neffen zu. «Mach schon, Robbie!»
Doch Robbie ritt weiter auf seinen Onkel zu, obwohl ein Pfeil sich in seinen Sattel bohrte und ein weiterer ihn am Helm streifte. Er beugte sich hinunter, packte Sir Williams Hand und zog ihn mit sich. Pfeile folgten ihnen, doch der Nebel verdichtete sich erneut und verbarg sie. Sir William schüttelte die Hand seines Neffen ab und taumelte allein weiter, behindert durch seinen pfeilgespickten Schild und den schweren Kettenpanzer. So ein gottverdammtes Elend!
«Achtung, links!», rief eine schottische Stimme, und Sir William sah, dass ein paar englische Reiter von der Hecke herüberkamen. Einer von ihnen erblickte Sir William und hielt ihn für eine leichte Beute. Die Engländer waren ebenso wenig auf ein Gefecht vorbereitet gewesen wie die Schotten. Ein paar von ihnen trugen Kettenhemden, aber keiner war vollständig gerüstet, und keiner hatte eine Lanze. Aber Sir William ahnte, dass sie schon lange, bevor sie ihre ersten Pfeile abgeschossen hatten, auf ihn aufmerksam geworden sein mussten, und vor lauter Zorn, weil er in ihren Hinterhalt gelaufen war, trat er dem ersten Reiter entgegen, der sein Schwert wie einen Speer vor sich ausgestreckt hielt. Sir William versuchte gar nicht erst, den Stoß zu parieren, sondern stieß dem Pferd seinen schweren Schild gegen das Maul. Dann hieb er mit dem Schwert auf seine Beine ein. Das Tier wieherte vor Schmerz und sprang zur Seite. Der Reiter kämpfte noch um sein Gleichgewicht und versuchte, das Pferd zu beruhigen, als Sir Williams Schwert sich unter seinem Kettenhemd hindurch in seine Eingeweide bohrte. «Bastard!», knurrte Sir William und drehte die Klinge in der Wunde, bis der Mann wimmerte. Dann näherte Robbie sich von der anderen Seite und hieb ihm das Schwert in den Nacken, sodass der Kopf des Engländers fast abfiel, als er aus dem Sattel stürzte. Die anderen Reiter hatten sich auf geheimnisvolle Weise aus dem Staub gemacht, doch dann prasselten erneut die Pfeile nieder, und Sir William merkte, dass der wankelmütige Nebel sich wieder lichtete. Er zog sein Schwert aus dem Gefallenen, schob es blutbeschmiert in die Scheide und schwang sich auf das Pferd des Toten. «Weg hier!», rief er Robbie zu, der aussah, als wolle er es ganz allein mit der gesamten englischen Einheit aufnehmen. «Los, Junge, nichts wie weg!»
Bei Gott, es schmerzte, vor dem Feind davonzulaufen, aber es war keine Schande, wenn zweihundert Mann vor sechs- oder siebenhundert die Flucht ergriffen. Und sobald der Nebel verschwunden war, würde es eine richtige Schlacht geben, Mann gegen Mann und Stahl gegen Stahl, und dann würde er, Sir William, diesen verfluchten Engländern schon zeigen, wie man kämpfte. Er trieb sein erbeutetes Pferd vorwärts, um dem Rest der schottischen Armee von den Engländern zu berichten, doch dann erblickte er einen einzelnen Bogenschützen, der sich in einer Hecke verbarg. Der Mann hatte eine Frau und einen Priester bei sich, und Sir William legte die Hand auf den Schwertgriff, im Begriff, sich für die Pfeile zu rächen, die seinen Trupp dezimiert hatten, doch hinter ihm ertönte der Kriegsruf der Engländer – «St. George! St. George!» –, und so verschonte er den Bogenschützen und ritt weiter. Er ließ gute Männer auf dem herbstlichen Gras zurück, tot und sterbend, verwundet und verängstigt. Aber er war ein Douglas. Er würde zurückkommen und Rache nehmen.
E





























