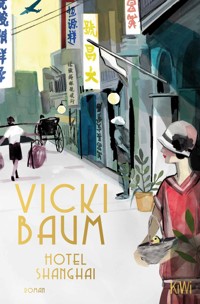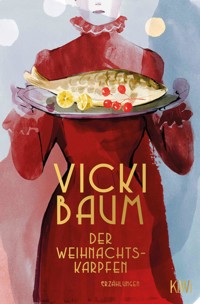
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vicki Baums Erzählungsband »Der Weihnachtskarpfen« erstmals als E-Book. Zeitlose Geschichten, in denen in klaren Worten von Menschen berichtet wird, denen Hunger, Krieg und Tod begegnen – und die dennoch um Menschlichkeit und Würde ringen. »Vermutlich das Anständigste, was ich geschrieben habe«, urteilte die Autorin selbst kokett über ihre Erzählungen. Gleich die erste des Bandes, »Der Weg«, brachte ihr den Hauptpreis eines Wettbewerbs ein und das besondere Lob eines Jury-Mitglieds: Thomas Mann. Baums berührende, fein beobachtete Geschichten wirken beeindruckend modern. Und bei aller Unterhaltsamkeit verhandeln sie wie nebenbei die ganz großen Themen der Existenz: Krieg, Liebe und Tod.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Vicky Baum
Der Weihnachtskarpfen
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vicky Baum
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vicky Baum
Vicki Baum, geboren 1888 als Tochter einer jüdisch-bürgerlichen Familie in Wien, gestorben 1960 in Hollywood. Sie war ausgebildete Musikerin und arbeitete ab 1926 als Redakteurin in Berlin. 1932 wanderte sie nach Hollywood aus. In Deutschland wurden ihre Bücher von den Nazis als »Asphaltliteratur« verfemt und verbrannt. Ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach dramatisiert und verfilmt worden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Vermutlich das Anständigste, was ich geschrieben habe«, urteilte Vicki Baum selbst über die vier in diesem Buch versammelten längeren Geschichten. Gleich die erste, »Der Weg« von 1925, brachte ihr den ersten Preis in einem Erzählwettbewerb ein – und das besondere Lob des Jury-Mitglieds Thomas Mann. Wie in den beiden anderen frühen Texten, »Hunger« und »Jape im Warenhaus«, erzählt Vicki Baum in ihr leichtfüßig und einfühlsam von existentiellen Nöten und ausweglosen Situationen, mit denen die Protagonisten in ihrem Alltag konfrontiert werden und zurechtkommen müssen. Die 1941 im Exil verfasste Titelgeschichte »Der Weihnachtskarpfen« schließlich ist eine berührende Parabel auf Kriegsverluste und die Sinnlosigkeit des Tötens. In klarer Sprache vorgetragen und geprägt von sanfter Ironie, legen all diese Geschichten nachdrücklich Zeugnis von der großen realistischen Erzählkunst Vicki Baums ab, die bis heute beeindruckt.
Inhaltsverzeichnis
Hunger
Der Weg
Jape im Warenhaus
Der Weihnachtskarpfen
Hunger
Frau Kreitlein öffnete die Türe mit einer Gebärde, als handle es sich um den Eintritt in ein Raritätenkabinett. »Das wäre die Stube«, sagte sie und schaute der Dame erwartungsvoll auf den Mund.
Die Dame sah genau wie ein kleiner Vogel aus; sie hatte ein etwas ausgerupftes Federkräuschen um den Hals, und auf ihrem Kopf balancierte ein Hütchen, das durchwegs mit gefärbten Schwalbenschwänzchen garniert war. Sie bewegte Kopf und Hütchen in kleinen Rucken, Spannung war in ihrem Vogelgesicht zu bemerken, und sie sagte: »Es hat ja grüne Tapeten –?«
»Ja, nun, grüne Tapeten hat es eben«, sagte Frau Kreitlein und warf den Wänden vorwurfsvolle Blicke zu.
»In grünen Tapeten könnte Gift sein –«, sagte die Dame sinnend und griff die Wände an, die ein etwas speckiges Gehaben an den Tag legten.
»Gift – i wo«, sagte Frau Kreitlein. Die Tapeten waren nicht neu, sie hatten hellere Stellen, wo die früheren Mieter die Fotografien ihrer Lieben hängen gehabt hatten, über dem Sofa hingegen dunkelte es etwas, da war der Lieblingsplatz von Provisor Schnetkes Pomadekopf gewesen. Frau Kreitlein rückte einen Trompeter von Säckingen in das beste Licht und sagte: »Es ist ein schönes Zimmer, nur, wie gesagt –«
Aber die Dame hielt noch beim Gift. »Arsen kann in grünen Tapeten sein«, äußerte sie und schien angeregt. »Haben Sie nicht von dem Bankier Oppenheimer in Petersburg gelesen, den seine Erben durch grüne Tapeten vergifteten? Nein? Sehr interessant. Auch in den Memoiren aus Louis-Quatorze-Zeiten kann man von solchen Dingen lesen. Man fühlt sich dann eine Zeit lang außerordentlich wohl in solchem Zimmer, man blüht auf, nachher fängt man an zu verfallen und stirbt unrettbar. Arsen könnte also in den Tapeten sein«, beschloss sie und rückte mit ihrem Vogelkopf weiter.
»Aber es ist ja vergittert!«, rief sie leise und faltete die Hände. »Was hat das Gitter am Fenster zu bedeuten?«
»Es ist wegen dem Gör«, sagte Frau Kreitlein; »das krabbelte früher immer aufs Fenster, und das war doch die Wohnstube, und da sagte mein Mann, lass uns doch ein Gitter machen, sonst fällt er noch raus, das Gör nämlich, denn damals war es noch klein, sechs Mark haben die Stangen allein gekostet, gearbeitet hat es mein Mann, er ist ja gelernter Schlosser, und glauben Sie, kaum war das Gitter da, nie wieder krabbelte das Gör aufs Fenster, aber so sind die Kinder.«
»Hinter vergitterten Fenstern –«, sagte die Dame versonnen, um gleich darauf den Kopf zu heben und in entschlossenem Ton zu beenden: »Das Zimmer gefällt mir; was kostet es?«
»Achtzehn Mark im Monat werden ja nicht zu viel sein, mit Kaffee, und wenn die Dame was zu waschen hat, das kann ich ja mitwaschen, nur eben, dass der Eingang durch die gute Stube ist, aber ich finde immer, das sieht doch ganz fein aus, wenn die Dame Besuch bekömmt, und der geht durch die gute Stube, ein Pinjano steht auch drin, das ist noch von Herrn Schnetke her, der war immer unpünktlich mit der Bezahlung, und schließlich rückte er ganz aus, und da gaben wir den Pinjano nicht her, spielen kann es ja keiner, aber wie macht es sich in der guten Stube, es gehört ja förmlich hinein, und mein Mann sagt, wenn das Gör größer ist, kann es ja Klavierspielen lernen, sagt er. Natürlich ist die Bezahlung pränumerando.«
»Natürlich«, sagte die Dame und errötete schwach. »Ich bezahle den ersten Monat gleich, in Zukunft kann das mein Bankier in Ordnung bringen.«
Frau Kreitlein sah wieder der Dame erwartungsvoll auf den Mund und fragte: »Was hat die Dame für einen Beruf, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin Klaviervirtuosin; jetzt spiele ich etwas weniger in Konzerten, aber ich gebe besonderen Talenten Unterricht. Ich war Professorin der Musik am kaiserlichen Konservatorium in Petersburg; aber die politischen Verhältnisse waren in letzter Zeit nicht mehr verlockend dort, Sie verstehen – nun, reden wir nicht davon; es regt mich auf.« Wirklich schien die Dame aufgeregt; ihre Mundwinkel zitterten ein wenig und die Hände auch. Sie trat an das Fenster, lehnte das Schwalbenhütchen an das Gitter um sechs Mark und starrte hinaus.
»Wie schwarz und tief es da hinuntergeht; wie eine Schlucht –«, sagte sie leise.
»Ja, sieht die Dame, da ist nun das verdammte Kohlenlager im Vorderhof. Sollst mal sehen, wer da in das Vorderhaus kommt, sagte mein Mann, wie der alte Wilke starb, der die Kunstglaserei hatte, wissen Sie, das kann nur ein Reicher bezahlen mit den Nebenräumen, und wer hat heutzutage das Geld, da kommt so ein Kohlenfritze daher, Köbeling heißt er, und macht das ganze Haus dreckig, das Gör hat immer eine schwarze Nase, Junge, sagt mein Mann, haste wieder Kohlen gefressen, sagt er, aber es nützt kein Reden, immer ist die Nase schwarz. Von den Stiefeln will ich schweigen.«
Und das tat Frau Kreitlein. Sie hatte nur Anfälle. Sie hatte Viertelstunden, wo sie über jedes Komma hinwegrasen musste, bis alles gesagt war. Aber sie hatte Stunden, wo sie schwieg wie ein begabter Diplomat. »Wenn ich um den Namen bitten dürfte«, sagte sie nur noch und verstummte dann gänzlich.
»Hier ist meine Karte«, sagte die Dame. »Und hier ist die Bezahlung für einen Monat. Allerdings habe ich noch eine Bedingung zu stellen –« Frau Kreitlein erschielte auf der Karte ein kleines von, sie öffnete staunend den Mund und rückte der Karte näher. Gabriele von Gabrilow, Klaviervirtuosin. Die achtzehn Mark lagen daneben, pränumerando und ohne lange Auseinandersetzungen. Frau Kreitlein war nicht besonders verwöhnt, Herr Schnetke lag nicht als einziger dunkler Punkt in ihrer Vermietungsvergangenheit. »Was die Dame wünscht«, sagte sie beflissen. Das Vogelköpfchen errötete leicht, die zitternden Finger bewegten sich schwach, und sie sagte: »Ich habe da ein Tierchen, ein ganz kleines Tier, ein süßes kleines Geschöpf; von dem kann ich mich nicht trennen. Es ist mein einziges Glück.«
Nanu, dachte Frau Kreitlein, aber da sie ihre schweigsame Stunde hatte, wartete sie stumm.
»Es ist in einem Käfig; es ist gar nicht zu bemerken«, sagte die Dame, und ihre gestopften Zwirnfinger zitterten stärker.
»Ein Vogel?«, fragte Frau Kreitlein.
»Nicht einmal; ein Vogel macht Lärm; es ist ein so stilles kleines Tier. Es ist mein ganzes Glück. Erinnerungen hängen daran –«
»Eine Katze?«
»Nicht einmal. Katzen sind falsch. Es ist ein Iltis.«
»Was?«, fragte Frau Kreitlein.
»Ein Iltis. So etwas wie ein Edelmarder, wissen Sie: ein Iltis.«
»Stinkt es?«
»Er ist ja zahm«, sagte die Dame flehend.
Frau Kreitlein schüttelte den Kopf. Was diese feinen Damen alles haben, dachte sie. »Wenn es nicht stinkt – denn man zu«, entschloss sie sich, gestärkt durch einen Blick auf Geld und Karte.
»Dann will ich also meine Koffer bringen lassen«, sagte die Dame, und nun erst schaute sie besitzergreifend den ganzen Raum an. »Ich werde einige Familienbilder herhängen und etwas von unserem Familiensilber aufstellen, dann wird es ganz hübsch hier. Leider ist mein Flügel noch in Petersburg – es sind – Zollschwierigkeiten –«
»Sie können ja immer mal auf dem Pinjano spielen«, sagte Frau Kreitlein, und ihr Ton wurde gleich etwas gönnerhaft, die Dame machte eine hochmütige Bewegung mit den Zwirnhandschuhen. »Danke bestens«, sagte sie knapp. Es roch heftig nach anbrennender Milch. Frau Kreitlein entstürzte dem Zimmer, draußen brüllte gleich darauf ein Kind. Die Dame schaute sich noch einmal um, besah die grünen Tapeten, das Gitter, die schwarze Schlucht und atmete zufrieden.
»Das Tierchen bringe ich selbst«, sagte sie. Sie war sehr froh.
Frau Kreitlein stand im Gemüseladen an der Ecke und hatte ihren Anfall.
»Ein feines Fräulein haben wir diesmal, ein wirklich feines, gleich pränumerando bezahlt und kein Wort über den Preis, achtzehn Mark, wo es doch nur in den dreckigen Kohlenhof hinausgeht, mein Mann sagt, hättest zwanzig verlangen sollen, sagt er, aber so ist man doch nicht, fein kann einer sein und braucht deshalb nicht viel Geld zu haben, aber wie der Kohlenfritze im Vorderhaus, der hat dickes Geld, wer weiß wie, und keine Bildung, wenn auch der Sohn auf Doktor lernt, das ist doch nicht fein, sage ich zu meinem Mann, sei froh, wenn sie pünktlich zahlt, mein Mann sagt, es wird schon einen Haken haben, sagt er, gewiss kommt dann jeden Abend der Bräutigam, oder es ist sonst eine Unsittlichkeit dabei, wer weiß, wo sie das Geld herhat, sagt er, da mach dir keine Sorgen, sage ich, an die rührt keiner an von wegen Bräutigam, schön ist sie ja nicht, das muss wahr sein, aber ein feines Fräulein. Zwei schwere Koffer hat sie, ihr Vater war doch Statthalter von Masuren, und durch die politischen Verhältnisse ist sie in schlechte Lage gekommen, jetzt ist sie Klaviervirchtuosin, spielen kann sie, sage ich Ihnen, sie spielt manchmal auf das Pinjano, dann kann sie ein Stück besonders, das heißt Schopäng, das trillert nur so, das Herz bleibt einem stehen, so schnell geht es. Was haben Sie nur für geschickte Finger, sage ich, und so kleine Hände dabei und kleine Füße, der Willi, das Gör, könnte bald Ihre Schuhe tragen, da lacht sie nur so fein, das ist die gute Rasse, sagt sie. Mit dem Willi, dem Gör, ist das überhaupt eine Liebe und Seligkeit, weil sie doch das Tierchen hat, es ist ihr ganzes Glück, sagt sie, rührend war das direkt, es ist ganz niedlich, der Willi sitzt den ganzen Tag vor dem Kasten und schaut es an, es riecht ein bisschen, aber schließlich ein Hund riecht auch, wenn er nass wird, und das Iltis riecht nur, wenn es erschrickt, den Willi kennt es nun schon, da erschrickt es nicht mehr, da riecht es auch nicht, bloß wenn ich im Zimmer sauber mache, da riecht es, aber man kann nichts sagen, sie hat es von ihrem Verlobten geschenkt bekommen, einem Grafen, er ist dann in den Kolonien gefallen, es ist das letzte Andenken an ihn, da hat man doch nicht das Herz und sagt, es riecht. Am meisten freut sie sich über die grüne Tapete, ich spüre es schon, Frau Kreitlein, sagt sie, es fängt schon an, was denn Fräulein, sage ich, es geht mir schon viel besser, ich blühe ordentlich auf. Na, dann ist’s ja recht, sage ich, von Aufblühen kann man nämlich wirklich nichts merken, sie ist ein bisschen wunderlich in manchen Sachen, mein Mann sagt, die hat nicht nur ein Iltis, die hat auch einen Vogel, sagt er, aber das ist unrecht, es ist wirklich ein feines Fräulein; jeden Abend schreibt sie in ein Heft Memoaren, das ist so Mode bei den Adeligen, sie hat uns schon daraus vorgelesen, der reinste Roman, man kann es in der Zeitung nicht schöner haben, dem Willi lernt sie am Pinjano ein Stück als Überraschung zum Geburtstag von meinem Mann, das Gör ist wie ausgewechselt, seit das Fräulein im Haus ist, dafür gebe ich das Iltis den Küchenabfall zum Futter, es riecht wie im Affenkäfig bei uns, sagt mein Mann, aber ich sage, lieber ein Iltis als die Geschichten mit den Mannsleuten wie bei der letzten Person, die wir hatten, wenn es auch riecht, sobald es Angst hat; nun also zwei Pfund Zwiebeln, aber von den neuen, Herrn Rapenstiel.«
Und Frau Kreitlein schließt den Mund und wird nun zwei Stunden lang kein Wort reden.
Gabrilowsky heißt die Dame, die bei Kreitleins wohnt; Gabriele Gabrilowsky, Tochter des verstorbenen Verwalters Gabrilowsky aus Zwienice im Kreis Groß-Strelitz, neununddreißig Jahre alt, alleinstehend, Private, im Bezug einer Gnadenpension von monatlich fünfunddreißig Mark. Kein Vater Statthalter, kein Bräutigam Graf, kein Flügel, kein Bankier, ach nein. Eine Hochstaplerin also? O nein, ihr Lieben, gewiss keine Hochstaplerin. Was sie erzählt, ist wahr, weil sie es glaubt; sie betrügt ja niemand, sie zahlt so pünktlich ihre achtzehn Mark, pränumerando – obwohl das nicht immer einfach ist –, sie macht keine Ansprüche, sie bezweckt nichts mit ihren Porträts, dem Familiensilber und den adeligen Memoiren. Nur, ihr Lieben, gibt es Menschen, die es nicht vermögen, das Wirkliche auszuhalten, ihm in die Augen zu schauen gleichsam, sie sind auf der Flucht, sie müssen ein bisschen Klingklang haben, ein wenig Schnörkelwerk um dieses unerträgliche, armselige Stückchen wirkliches Leben.
Wie sieht es aus, dieses Leben, wie ist es denn beschaffen? Es hastet ein Mensch die Kaiserstraße entlang, ein kleiner Mensch mit einem Vogelkopf, einem Schwalbenhütchen, einem gerupften Federkräuschen, ein winziger, verängstigter Mensch mit ewig zitternden Fingern, die lange, endlose Kaiserstraße dahin. Das Hütchen sitzt schief, es ist immer in Gefahr herunterzufallen, die schwarzen Vogelaugen wandern unstet, es läuft ein wenig Schweiß die Schläfen herunter, der rechte Zeigefinger hält sich krampfhaft am rechten Daumen fest, denn dort hat der Zwirnhandschuh ein Loch, schon wieder, und das darf bei einer Dame von altem Adel nicht vorkommen. Lacht nicht, ihr Lieben. Zwei Familien hat das Fräulein, wo es Klavierunterricht erteilt, Klavierunterricht nach bewährter Methode, die Stunde zu sechzig Pfennig. Die eine Familie wohnt im Westen, es sind Konditor Manneckes in der Mollerstraße. Die andere Familie, Feldwebel Krönje, haust im Proviantamt, im Norden der Stadt, oder vielmehr dort wo der Norden aufhört, wo die Stadt aufhört, wo nur mehr Bauplätze sind, Fabrikschlote und ebenjenes Proviantamt, wo Krönjes hausen. Beide Familien aber sind versessen darauf, am Mittwochnachmittag Klavierstunde zu haben, denn da sind die Kinder schulfrei. Die ganze Woche sitzt das Fräulein untätig herum in ihrem grünen Zimmer über der Kohlenschlucht, weiß nicht, wie sie die leeren Altjungfernstunden hinbringen soll. Da ist zwar das Tierchen, ja, aber es wird alt und will viel Ruhe und Schlaf, und da sind die Memoiren zu schreiben; und dann ist neuerdings noch das Pianino in der ungeheizten guten Stube und der Willi, das Kind, der die Zeit verbringen hilft; trotzdem: Die Woche ist lang, und das Fräulein hat nichts zu tun. Aber Mittwoch und Samstag wollen beide Familien ihren Klavierunterricht, und auch womöglich zu gleicher Zeit.
»Gnädige Frau!«, fleht das Fräulein die Konditorin an – sie sagt zu den Müttern ihrer Klavierkinder immer gnädige Frau – »geht es denn nicht eine Stunde früher, eine halbe Stunde wenigstens? Ich habe nachher auf der Dänischen Gesandtschaft Unterricht zu geben, dort lässt es sich nicht verschieben, weil abends großer Empfang ist –«
Sie hat solche Angst, die Stunde zu verlieren, unwiederbringlich auf kostbare sechzig Pfennige verzichten zu müssen, dass ihr die Tränen in den Augen stehen; Frau Mannecke ist gerührt. »Gnädige Frau!«, beschwört das Fräulein Frau Krönje – »Eine halbe Stunde später, eine Viertelstunde nur, ich habe vorher Unterricht auf der Dänischen Gesandtschaft zu geben, es lässt sich nicht verschieben, weil dort nachmittags thé dansant ist –« Und auch Frau Krönje lässt sich erweichen.
Nun also, in dieser gewonnenen Dreiviertelstunde seht ihr das Fräulein durch die Kaiserstraße hasten, rennen, stolpern, atemlos, aufgeregt, mit rutschenden Strümpfen, denn die Strumpfbänder sind ausgedehnt, und auch Strumpfbänder kosten Geld, wenn man sie neu anschaffen soll. Ach nein, lacht nicht, ihr Lieben, wenn ihr Fräulein Gabrilowsky laufen seht …
Manneckes haben ein merkwürdiges Kind, was das Klavierspielen betrifft; es ist ein kleines Mädchen mit steifem Wasserkopf, ehrgeizig, eifrig, voll Beflissenheit. Aber es kann immer nur mit einer Hand spielen. »Nun mal mit der rechten Hand allein«, sagte das Fräulein und gibt mit Augen, Fingern und Fußspitzen den Takt. Es geht ausgezeichnet. »Nun mal mit der linken Hand allein«, sagt das Fräulein und taktiert. Die linke Hand spielt didel dudel, didel dudel. Es geht. »Nun versuche es doch mal mit beiden Händen zusammen«, sagt das Fräulein. »Das kann ich doch nicht«, sagt das kleine Mannecke. »Nun, versuche es doch nur einmal«, beschwört das Fräulein. »Ich kann es aber doch nicht!« – »Ich spiele mit, so, nun versuche es doch nur, also los, didel dudel –«
Das kleine Mannecke nimmt alle Kräfte zusammen, es krümmt sich vor Eifer, es schiebt die Unterlippe vor, auch das Fräulein beißt die Zähne zusammen vor Anspannung. Es geht nicht.
»Mit zwei Händen zugleich kann ich eben nicht spielen«, sagt das kleine Mannecke und fängt zu weinen an. Gegen Schluss der Stunde erscheint Frau Mannecke im Zimmer, sie riecht von Berufs wegen immer nach Zimt und Hefe. Fräulein Gabrilowsky, die im vegetarischen Restaurant »Thalia« speist, spürt plötzlich ihren Magen. »Nun spiele du mal die rechte Hand, ich mache die Begleitung«, sagt sie; »wir spielen ein wenig vierhändig, gnädige Frau –«
Frau Mannecke, die unmusikalisch ist wie eine Schildkröte, zeigt Befriedigung. »Wie hübsch das klingt, beinahe wie ein Walzer! Glauben Sie, könnte das Kind zu Weihnachten schon ›Stolzenfels am Rhein‹ spielen? Mein Mann schwärmt immer davon.«
»›Stolzenfels am Rhein?‹ Sicher, gnädige Frau, es ist ein reizendes Stück. Graf Benkendorf, bei dem ich die Kinder unterrichtete, hatte es auch so gern –«
»Was Sie sich für Mühe geben!«, sagte Frau Mannecke und betrachtete die beiden heißen Köpfe über der Klaviatur; »wirklich, viel Mühe. Na, kommen Sie dann mal durch den Laden, ich gebe Ihnen auch was mit für Ihr Tierchen, ein Eichhörnchen ist es, nicht?«
Im Laden ist es heiß, Fliegen summen über Himbeertörtchen, es riecht nach Schokolade, wieder spürt das Fräulein einen nervösen, zusammenziehenden Schmerz im Magen; sie nimmt die Tüte mit Keks- und Waffelabfall entgegen und hält dabei wieder das Loch im Handschuh zu. An einer Straßenecke, in einer Nische, fasst sie in die Tüte und schlingt ein wenig von dem Bröckelwerk hinunter, dann trabt sie los, um bei Krönjes zurechtzukommen.
Dies ist die Stunde bei Manneckes. Bei Krönjes ist es anders. Bei Krönjes sind Zwillinge, Buben, in jenem Altersstadium, da man die erste Zigarette raucht und erotische Zeichnungen anfertigt. Sie sind nicht gänzlich unbegabt, aber es fehlt ihnen an Zartgefühl und Ritterlichkeit. Sie arbeiten mit einem ganzen Arsenal von Knallerbsen, Niespulver und ähnlichen Requisiten gegen die Klavierstunde an; aber Frau Krönje will nun einmal, dass ihre Jungens Klavierspielen lernen, und sie ist eine energische Frau. Das Fräulein sagt »Sie« zu den Jungen; das Fräulein schwitzt innerlich und schluckt Tränen. Aber da die Jungen nicht gänzlich unbegabt sind und auch selten Augenblicke eines menschenwürdigen Betragens aufweisen, ist es nicht unmöglich, dass sie demnächst das Niederländische Dankgebet zu exekutieren vermögen werden. Nach der Stunde ist das Fräulein müde, als hätte sie eine Hochgebirgstour hinter sich. Frau Krönje betrachtet das aufgelöste Vogelwesen und sagt: »Es sind zwei fürchterliche Bengels, meine.«
»Die frische Jugend –«, murmelt das Fräulein.
Sie wird zu einem Kaffee und einer Schmalzstulle eingeladen – im Proviantamt wird beständig Schmalz gegessen –, es schmeckt herrlich, aber der vegetarisch zusammengeschrumpfte Magen rebelliert schmerzhaft.
»Schade, dass wir so weit heraußen wohnen«, sagt Frau Krönje. »Nun, Sie fahren ja mit der Straßenbahn.«
»Natürlich«, sagt das Fräulein.
Jetzt regnet es, erst schwach, nur versuchsweise, und dann immer mehr und mehr, in der Straßenbahn brennen die Lichter, es sieht gemütlich drin aus. Vielleicht ist diese Gemütlichkeit, das Licht, die Wärme, die schnelle Beförderung mit einem Groschen nicht zu teuer bezahlt. Aber es gibt Geschöpfe, die sich diesen Groschen nicht leisten können.
Das Fräulein rennt durch den Norden, es läuft schon wieder, denn das Tierchen zu Hause hat gewiss Hunger, es wird dann zornig, und wenn es zornig ist, riecht es, das können manche Vermieterinnen nicht vertragen und kündigen deshalb; und das Zimmer bei Frau Kreitlein ist so hübsch, es hat so etwas Interessantes mit dem Gitter und der Tapete, wahrscheinlich ist das Haus ein ehemaliges Palais, nur etwas verfallen, aber in den Mauern leben noch alte Geheimnisse. Das Fräulein läuft durch den Norden, stolpert über Bauplätze, in schnell gewachsene Pfützen, späht in Vorstadtgesichter, die unter regenverhüllten Laternen auftauchen. Das war vielleicht ein Mörder – denkt sie, wenn unter der Schirmkappe ein Seitenblick sie trifft. Es gibt Dinge, die einen eigenen Schauer über die Rückenhaut jagen, etwas aus Angst und Süßigkeit Gemischtes. Das Fräulein denkt an Lustmorde; an den Straßenecken stehen immer zwei Schutzmänner, so gefährlich ist die Gegend. Erst in der Kaiserstraße lösen sich die aufgeregten, zitternden Finger. Der Magen schmerzt …
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: