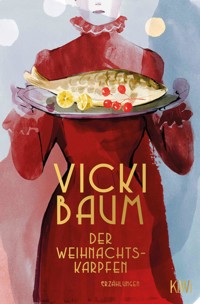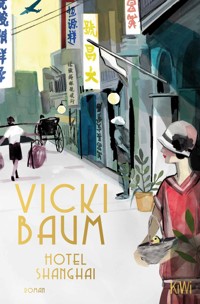9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vicki Baum wiederentdecken – mit ihren besten Romanen! Vicki Baum schrieb von den 20ern bis in die 50er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zahllose Bestseller und führte das Leben eines Weltstars. Ihr Verlag würdigt sie nun mit einer wegweisenden Biographie und der Neuausgabe ihrer bekanntesten Romane. Liebe und Tod auf Bali erschien im Jahr 1937 als Frucht eines mehrmonatigen Aufenthalts der reiselustigen Vicki Baum auf der damals völlig unerschlossenen Insel. Aus ihrer reichen Kenntnis dieser exotischen Kultur schildert sie das intakte, von Ritualen bestimmte Leben eines balinesischen Dorfes und seine Vernichtung durch die holländischen Kolonisatoren am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und sie fängt den Moment eines historischen »Weltuntergangs« ein, in dem sich die Poesie vom Leben und Sterben einer östlichen Tradition verdichtet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vicki Baum
Liebe und Tod auf Bali
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Vicki Baum
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Vicki Baum
Vicki Baum, geboren 1888 als Tochter einer jüdisch-bürgerlichen Familie in Wien, gestorben 1960 in Hollywood. Sie war ausgebildete Musikerin und arbeitete ab 1926 als Redakteurin in Berlin. 1932 wanderte sie nach Hollywood aus, wo ihr Roman Menschen im Hotel verfilmt wurde. In Deutschland wurden ihre Bücher von den Nazis als »Asphaltliteratur« verfemt und verbrannt. Ihre Romane sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und vielfach dramatisiert und verfilmt worden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Liebe und Tod auf Bali entstand 1936 nach einem ausgedehnten Aufenthalt Vicki Baums auf der damals für Reisende noch kaum erschlossenen Insel. Inspiriert von der balinesischen Kultur und Geschichte setzt sie in ihrem Roman dem alten Bali ein ergreifendes Denkmal: Im Jahr 1904 strandet ein niederländischer Schoner vor der Küste der Insel. Als Unbekannte das Schiff plündern, kommt es zur Auseinandersetzung zwischen den holländischen Kolonialherren und der balinesischen Bevölkerung – ein Konflikt, der immer weiter eskaliert und mit der endgültigen Machtübernahme durch die Kolonialherren endet. In ruhigem, fast märchenhaftem Ton zeichnet Vicki Baum die Geschichte dieses Konflikts nach, leuchtet menschliche Abgründe, aber auch Opferbereitschaft aus. Dabei besticht ihr präzise gezeichnetes Panorama der Insel durch eine noch immer beeindruckende Kenntnis der balinesischen Kultur, die Liebe und Tod auf Bali bis heute zu Recht zu einem ihrer bekanntesten Romane macht.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Einleitung
Die Strandung der »Sri Kumala«
Die Puri
Bulèlèng
Taman Sari
Der Geburtstag
Die schlimme Zeit
Raka
Der Srawah
Das Ende
Das Ende der Geburt ist Tod
Des Todes Ende ist Geburt
So ist’s verordnet
Aus der Bhagavad-Gita
Einleitung
Aus den Aufzeichnungen von Dr. Fabius, Arzt in Bali
Als ich von der kleinen Gouvernementsklinik heimkam, in der ich den ganzen Morgen lang etliche Arten Fieber, Wunden von scharfen Bambusschnitten und tropische Geschwüre behandelt hatte, fand ich ein Fahrrad an die Eingangspforte meiner Mauer gelehnt. Ich ging schnell durch den Hof, denn ich war neugierig, wer mich besuchen kam. Meine holländischen Freunde lächeln gern darüber, dass mein Hof im Stil der Eingeborenen gebaut ist. Das Haupthaus mit weiß getünchten Lehmwänden und einem Vorbau, umgeben von vielen kleineren Häusern oder Balés. Balés, das sind erhöhte Plattformen, von Dächern aus Alang-Alang-Gras beschattet, die auf Pfosten ruhen. Manche der Balés haben eine oder sogar zwei Wände aus Lehm, und gegen Sonne und Regen können Bambusmatten vorgehängt werden. Es lebt sich gut und luftig in diesen Balés, und nur das Haupthaus hat richtige Wände. Der ganze Grund ist von einer Mauer umschlossen, über die Palmen und Fruchtbäume so hoch hinaufragen wie ein Wald.
Auf dem Fußboden des offenen Vorbaues kauerte Ida Bagus Putuh, und eine Stufe tiefer hockte der Schnitzer Tamor. Beide sind aus dem Dorf Taman Sari, das nahe der Küste und mehrere Stunden weit vom Fuß des Gebirges entfernt liegt, wo ich wohne. Die beiden falteten die Hände und hoben sie zur Schulter, um mich zu begrüßen. Ida Bagus tat es mit erlesener Höflichkeit, und Tamor, der moderne Ideen hat, lachte dazu mit vielen ebenmäßig gefeilten weißen Zähnen, so, als nähme er die Zeremonie nicht ganz ernst. Tamor ist ein schöner und geschickter Bursche, der manchmal ganz erstaunliche Schnitzereien zuwege bringt. Er trägt gern bunte Sarongs und schöne Kopftücher, die mit besonderem Schwung um seinen schmalen ägyptischen Schädel gebunden sind. Hinter das Ohr hatte er sich eine rote Hibiskusblüte gesteckt, und er rauchte eine Maisblattzigarette, die süß nach Gewürz und Nelken roch. Seinen hübschen Oberkörper hatte er in einem schmutzigen, billigen japanischen Hemd begraben, denn so ist es gerade die flotte Mode unter den jungen Leuten. »Gegrüßt, Tuan«, sagte er vergnügt. Neben ihm lag ein Sack aus Kokosfasern, in dem – ich wusste es – eine neue Schnitzerei aufs Besehen wartete. »Gegrüßt, Tuan«, sagte auch Ida Bagus Putuh. »Gegrüßt, Freunde«, sagte ich und sah die beiden an.
Putuh, der weiß, dass ich ein wenig altmodisch bin, hatte sich im alten balinesischen Stil angezogen, so feierlich, als handelte es sich um einen Besuch beim Radja. Sein Oberkörper war nackt, mit schönen, langen Muskeln unter der hellbraunen Haut. Er trug ein golddurchwirktes Sapur über dem handgewebten seidenen Kain um Magen und Hüften geschlungen. Sogar seinen Kris hatte er rückwärts in den Gürtel gesteckt, sodass der schön geformte Holzgriff hinter seiner Schulter hervorragte. Auch Putuh trug eine Blume, mitten über der Stirn in seinem Kopftuch, aber es war keine Hibiskusblüte, sondern eine gelbe Tjempakablume. Ihr starker, süßer und herber Duft füllte den ganzen Vorbau, der Duft von Bali, und sie war schon im Welken begriffen. Im Mund hatte Ida Bagus Putuh einen Priem aus Sirih, Betel, Kalk und Tabak, was weniger schön war, und in Abständen spuckte er kunstvoll einen roten Saft über die Stufen in den Hof hinunter.
»Wie lange sind die Freunde schon hier?«, fragte ich der Höflichkeit halber. »Wir sind soeben gekommen«, wurde geantwortet, und auch dies war nur Zeremonie. Die beiden mochten gut und gern schon fünf Stunden auf den Stufen sitzen, kauend, rauchend, beschaulich und voll der unermesslichen Geduld ihres Volkes.
Ida Bagus ist der Titel für Leute der höchsten Kaste der Brahmanen. Ich habe Putuh im Verdacht, dass er, obwohl nicht halb so alt wie ich, doch ebenso altmodisch denkt wie ich. Seine Familie hat früher eine große Rolle in seinem Dorf und weit über dessen Grenzen gespielt. Aus ihr sind mehrere große Priester oder Pědandas gekommen, bis seinen Vater das große Unglück traf. Jetzt sind sie arm und leben still in Taman Sari, und Putuh arbeitet auf dem Reisfeld wie irgendein kastenloser Sudra. Aber er hat Würde, trotzdem er noch jung ist, und er ist, wie gesagt, ein konservativer Mann, der die guten Manieren der älteren Generation weiter beibehält. Balinesen haben meistens nur eine ungefähre Ahnung davon, wie alt sie sind. Ihren Müttern geraten nach sechs oder sieben Jahren die Daten durcheinander – kein Wunder bei dem komplizierten balinesischen Kalender –, und dann gibt man es auf zu zählen. Aber gewisse Ereignisse, von denen später noch die Rede sein wird, trafen ein, als Putuh zwei Jahre zählte, und da besagte Ereignisse als historische Fakten in die Geschichte der holländischen Kolonialpolitik übergingen, ist es einfach, daran Putuhs Alter nachzurechnen. Er ist jetzt zweiunddreißig Jahre alt nach unserer Rechnung, und fast doppelt so viel, wenn man das Jahr zu 210 Tagen rechnet wie die Balinesen. Obwohl Putuh ein bescheidener Mann und ein vertrauter Freund von Tamor ist, hatte er es doch so eingerichtet, dass er eine Stufe höher saß als dieser, wie es seiner Kaste zukommt.
Ich ließ Kaffee bringen und steckte meine Pfeife an, die noch immer das Erstaunen und die lächelnde Bewunderung der Balinesen erregt. Mit offenen Mündern starrten die beiden auf mich. Sie können wunderbar staunen, diese Leute; ihre immer schön geschwungene Oberlippe wandert ganz hinauf, ihre Nasenlöcher werden groß und rund, und ihre länglichen Augen, die noch im Gelächter schwermütig aussehen, füllen sich mit einem faszinierten Ausdruck. »Bèh!«, sagen sie voll Bewunderung.
Das Gespräch kam stockend in Gang, denn so gehörte es sich. Mit vielen verschlungenen Redensarten näherten wir uns dem Zweck ihres Besuches. Bei Tamor war es von vornherein klar, dass er etwas geschnitzt hatte, das er mir verkaufen wollte. Ob Putuh bloß mitgekommen war, weil er mich leiden mag, das konnte ich nicht so schnell herausfinden. Er saß und kaute und hielt den Mund lächelnd geöffnet dabei, was ein kompliziertes Schauspiel ist, und zuweilen kam ein ängstlicher und eifriger Ausdruck in seine Augen. Tamor berichtete, dass er Putuh auf seinem Fahrrad mitgebracht hatte, und Putuh warf ein, dass er eigentlich mit dem Motorbus kommen wollte, aber dass er Glück hatte, insofern, als Tamor auch etwas in meinem Haus bestellen wollte. Das Gouvernement hat gute Straßen angelegt, auf denen die wenigen Autos der holländischen Beamten und der eingeborenen Regenten überall hingelangen können und auf denen von Zeit zu Zeit auch ein voll beladener, vorsintflutlicher Autobus daherächzt. Die Eingeborenen aber lieben die japanischen Fahrräder, und man sieht sogar die Frauen in ihren bunten Kains und mit kleinen Lasten auf dem Kopf gefährlich daherbalancieren.
»Was hat mein Freund in seinem Sack?«, fragte ich schließlich Tamor, als mir der Höflichkeiten und Einleitungen Genüge geschehen zu sein schien.
»Es ist nichts«, sagte er bescheiden, »nur eine schlechte Figur.«
»Kann ich sie sehen?«, fragte ich.
Er öffnete langsam den Fasersack, wickelte eine Schnitzerei aus einem Fetzen und stellte sie auf die Stufe neben Putuhs nackte braune Füße. Es war ein einfaches, kühnes Stück Kunst. Eine Hirschkuh und ein Hirsch im Moment der Vereinigung. Ein Pfeil hatte das Manntier in den Rücken getroffen, und die beiden Hälse waren in einem Ausdruck von Schmerz und Todesangst aufwärtsgereckt. Ich schaute die Tiere betroffen an. Ich wusste plötzlich, dass ich etwas Ähnliches schon einmal gesehen hatte, vor vielen, vielen Jahren. Ich erinnerte mich. Es war Tamors Onkel gewesen, der sie zu schnitzen versucht hatte, ganz gegen den Stil seiner Zeit. Die Erinnerung kam mit großer Macht auf mich zu, während ich das glatte, wohl gearbeitete Satinholz in den Händen fühlte.
»Hat mein Freund schon einmal so eine Schnitzerei gesehen?«, fragte ich. Tamor lächelte verwundert. »Nein, Tuan«, erwiderte er, »ich muss deshalb um Verzeihung bitten.« Ich hatte mich sogleich in das Stück verliebt und wusste, dass ich es haben musste. Aber vorher waren viele Zeremonien zu erledigen. Ich lobte die Schnitzerei, und Tamor versicherte, dass sie schlecht und wertlos sei, unwürdig, in meinem Haus zu stehen, und dass er ein elender Anfänger und Nichtskönner wäre. Freude und Stolz über seine Arbeit leuchteten dabei aus seinen ehrlichen, unschuldigen Tieraugen. Ich fragte um den Preis, und er behauptete, dass er nehmen würde, was immer ich ihm gebe, und dass er glücklich sei, wenn er mir das Stück als Geschenk anbieten dürfe. Ich weiß, dass Tamor ein guter Verkäufer ist und dass er entsetzlich gerne Geld verdiente, wie alle Balinesen, Geld, um zu spielen und um bei den Hahnenkämpfen zu wetten. Er rechnete einfach darauf, dass ich ihm mehr anbieten würde, als er sich zu verlangen getraute – und so war es denn wohl auch.
Der Handel wurde abgeschlossen, und Tamor knotete das Geld in die Falten seines seidenen Gürtels.
Noch immer hatte Putuh nichts über den Zweck seines Besuches gesagt, und es wäre unhöflich gewesen, ihn direkt darum zu fragen. Vielleicht hatte er seine Steuern nicht bezahlen können und wollte mich um ein Darlehen bitten. Aber dann wäre er nicht mit Tamor gekommen, sondern allein und heimlich. Das Gespräch tröpfelte dahin. Die Regenzeit würde nun wohl bald kommen. Die Hitze war einige Tage lang groß gewesen, besonders wenn man auf den Sawahs, den Reisfeldern, zu pflügen hatte. In Sanur, dem Nachbardorf von Taman Sari, hatte es eine Leichenverbrennung gegeben, nichts Großes, nur einfache Leute, die sich die Kosten teilen, etwa dreißig Tote an der Zahl. Es gab viele Eichhörnchen in den Kokospalmen, und man hatte sich zusammengetan und sie ein paar Nächte lang mit Fackeln und Klappern verscheucht. Der Fürst von Badung hatte ein Mädchen aus Taman Sari zur Nebenfrau genommen, eine Gusti aus der niedrigeren Adelsklasse der Wésyas. Am nächsten Vollmond sollte ein dreitägiges Tempelfest in Kěsiman stattfinden. Die Reisfelder trugen nicht mehr so viel wie in alter Zeit. Die Regenzeit würde wohl bald kommen, und dann wäre es mit der Hitze vorbei.
Nachdem wir so im Kreis um die kleinen Ereignisse der Dörfer herumgeredet hatten, versiegte das Gespräch. Den Balinesen macht es nichts aus, eine Stunde oder zwei schweigsam dazukauern, und die Götter wissen, was dann hinter ihren ruhigen Stirnen vorgeht. Ich aber roch noch nach dem Jodoform und Karbol der Klinik und wünschte mir ein Bad. Ich bat um die Erlaubnis, mich empfehlen zu dürfen. Das war nur ein Scherz, denn von Rechts wegen war es an meinen Besuchern, die Erlaubnis zum Fortgehen zu erbitten. Sie falteten die Hände und hoben sie zu ihrer linken Schulter, und ich verzog mich nach meinem kleinen Badehaus.
Ich badete und trank meinen einheimischen Arrak. Meine Diener brachten mir das Essen zu einer anderen Balé. Gekochten Reis und gebratenes Spanferkel, das man auf dem Markt bekam. Gemüse, mit Kunjit gelb gefärbt und mit vielerlei scharfen Gewürzen geschmort, Papayas und Pisang. Nachher steckte ich mir meine Pfeife an und legte mich in einen tiefen Bambusstuhl, um die letzten Zeitschriften zu lesen. Seit Bali eine direkte Fluglinie nach Holland unterhält, sind wir nur zehn Tage hinter der Welt her mit unsern Neuigkeiten. Manchmal wird mir ein wenig schwindlig bei dem Gedanken, dass unsere kleine Insel, so alt, so einzigartig, so paradieshaft noch trotz aller Neuerungen, dass dieses unverdorbene Stück Erde durch Flugzeuge und große Dampfer und Touristenreklame so nah an all das Übrige herangezogen worden ist.
Über dem Lesen schlief ich ein und erwachte erst, als mein kleiner Affe Djoggi sich auf meine Schulter setzte und zärtlich in meinen Haaren zu jagen begann. Das Licht hatte sich inzwischen verändert, und die Palmen und Brotfruchtbäume in meinem Garten warfen Schatten, da die Sonne nicht mehr steil stand. Durch den Hof kam die Mutter meiner Köchin, mit Palmblattkörbchen, in denen Opfer lagen. Ich sah zu, wie ihre magere Gestalt mit den vertrockneten Brüsten sich bei meinem Hausaltar zu schaffen machte und den Göttern jene Reverenzen erwies, die ich, der weiße Mann, nicht darzubringen verstand. So war mein Haus sicher und beschützt. Die Luft war kühl geworden, und die Tauben girrten in den Käfigen, die vom Dachrand hingen.
Ein paar Stunden waren vergangen, als ich in das andere Haus zurückging. Es roch noch immer nach Tjempakablumen. Putuh saß noch immer auf dem Boden und kaute Sirih. Tamor schien verschwunden zu sein. Ich trat vor die Pforte und hielt nach dem Fahrrad Ausschau. Es war nicht mehr da. Jetzt war ich sicher, dass Putuh sich von mir Geld ausborgen wollte. Wer seine Steuern zwei Jahre nicht bezahlt hat, dessen Feld wird weggenommen und versteigert. Ich legte ihm die Hand auf die Schulter, um ihn zu beruhigen. »Wollte mein Freund mir etwas erzählen?«, fragte ich ihn. Er nahm seinen Sirihknäuel aus dem Mund und deponierte ihn auf meiner Stufe.
»Ich dürfte den Tuan nicht mit meinen uninteressanten Angelegenheiten belästigen«, sagte er manierlich. »Aber ich weiß, dass der Tuan eine gute Medizin gegen die Krankheit hat, und ich hoffe, der Tuan würde mir Medizin geben für das kranke Kind.«
»Welches deiner Kinder ist krank?«, fragte ich und vergaß, ihn mit jener Umständlichkeit anzureden, die seiner Kaste geziemt. Vielleicht auch nahm er das »Du« als die Vertraulichkeit, die zwischen Gleichgestellten erlaubt ist, denn sein Gesicht erhellte sich.
»Es ist Raka, Tuan«, sagte er. »Er hat die heiße Krankheit.«
»Warum hast du ihn nicht mitgebracht?«, fragte ich ärgerlich. »Du weißt, dass jeder zu mir ins Krankenhaus kommen kann, der krank ist.«
Putuh sah mich mit schwimmenden Augen an. Sein Lächeln vertiefte sich. Es war das traurigste Lächeln der Welt. »Das Kind ist sehr schwach, Tuan«, sagte er. »Es wäre auf dem Weg hierher gestorben.«
Putuh besaß drei Frauen, von denen eine ihm weggelaufen war. Von diesen drei Frauen sind ihm fünf Kinder geboren worden. Raka ist sein ältester Sohn. Ich kenne Raka gut. Er ist ein schmales Bürschchen von sechs Jahren und ein wunderbarer Tänzer. Die Tanzvereinigung seiner Dorfgemeinde bezahlt einen berühmten Lehrer in Badung dafür, dass er Raka im Tanz unterrichtet. Man ist in Taman Sari stolz auf dieses Kind und voll der Hoffnung, dass einmal ein großer Tänzer daraus werde, der seiner Vereinigung Ehre einbringen würde. Und nun hatte Raka Malaria und lag im Delirium, mit seiner kleinen Seele wandernd, und sein Vater hatte mindestens sieben Stunden gebraucht, um zu mir zu kommen und seine Nachricht loszuwerden. »Vater des Raka«, sagte ich streng, »warum bist du nicht früher zu mir gekommen? Werdet ihr denn nie lernen, zum Arzt zu gehen, wenn es noch Zeit ist?«
Putuh ließ den Kopf hängen, so ausdrucksvoll, wie nur ein Balinese es tun kann. »Rakas Mutter ist eine dumme Frau«, sagte er. »Sie hat nicht mehr Verstand als eine Büffelkuh. Sie hat den Balian geholt, und er gab dem Kind Medizin. Es ist gute Medizin, aber das Kind will zu den Vätern zurückkehren.« Die verbrämte Passivität in dieser Rede machte mich wütend. Ich brüllte nach meiner Tasche. Ich packte Putuh am Arm und zerrte ihn zu meinem Wagen, wobei ich ihm viele unfreundliche Sachen sagte. Ich hielt mich mit Mühe davon zurück, den Dorfarzt, den Hexendoktor, den Balian, einen dummen alten Büffel zu nennen. Die eingeborenen Doktoren mit ihren Beschwörungen und mit ihrer Kräuterkunde können viele Dinge heilen, und gegen noch mehr sind sie machtlos. Gegen die Malaria brauen sie einen Saft aus einer Rinde, die Chinin enthält – aber nicht genug Chinin, um zu wirken. Manche Balians kommen heimlich zu mir, um Chininpillen, die sie zerstampfen und in ihr Gebräu mischen. Aber der Arzt von Taman Sari ist kein so kluger Wundertäter. Während wir in meinem abgekämpften Ford dahinratterten, ging es mir durch den Kopf, dass Raka inzwischen gut und gern schon gestorben sein mochte, seine kleine kindliche Seele eines großen Tänzers umherirrend in irgendwelchen unbekannten Dunkelheiten. Ich hörte mich noch immer schimpfen, laut und unbeherrscht, als wir schon über die Brücke klapperten, die am Eingang meines Dorfes eine tiefe, scharf eingeschnittene Schlucht überquert. Putuh hörte mich ruhig an, und als ich fertig war, begann er wieder zu lächeln.
»Es geschieht doch, was die Götter wollen«, sagte er nur.
Für mich war Raka nicht nur ein Patient wie jeder andere. Ich hatte das Kind vor Kurzem bei einem Tempelfest den Kěbjar tanzen sehen. Der angespannte Ernst in dem kleinen Gesicht, die alte Weisheit in den Augen! Damals war mir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass er schon viele Leben gelebt haben musste, wie die Balinesen es glauben. Ich dachte plötzlich, erkennen zu können, welcher Ahne in dem kleinen Raka wiedergeboren war, sich noch einmal manifestiert hatte, um noch einmal auf die Insel zurückzukehren und noch einmal zu leben. Ein neues Leben mit den gleichen Süßigkeiten und Bitterkeiten wie das frühere, aber mit weniger Fehlern und Verirrungen und um einen Schritt näher der Vollkommenheit und dem balinesischen Himmel, aus dem man nicht mehr wiedergeboren werden muss. Momente lang während jenes Tanzes war es mir gewesen, als wäre die kleine Gestalt in den goldenen Gewändern nicht das Kind Raka, sondern der andere Raka, der Vorvater, der strahlende, glänzende Raka früherer Zeiten. Der Mensch, den alle liebten, der geirrt hatte und gestraft worden war, und der sich selbst gereinigt hatte, sodass er nicht als Wurm oder Skorpion zurückkehrte, sondern als ein Kind und ein Enkel und ein Tänzer, wie er selbst es gewesen war. Ich liebte den kleinen Raka, so wie ich damals den großen geliebt hatte.
Meine Gedanken mochten schön und hochfliegend sein, aber was ich zugleich Ida Bagus Putuh erzählte, das strotzte von Vulgarität und guten holländischen Flüchen. Ich sah nichts vom Weg und von der Landschaft, obwohl ich sonst, noch nach fünfunddreißig Jahren in Bali, nie müde werde, auf diese Reisterrassen und Schluchten und Palmenhorizonte zu schauen. Putuh hatte einen neuen Priem in den Mund geschoben und schwieg, beschämt über die Unbeherrschtheit des weißen Mannes.
Wir durchquerten die Stadt Badung, die auch Denpasar genannt wird, nach ihrer Verkaufsstraße, in der Chinesen, Inder, Japaner und Araber ihre komischen kleinen Läden haben. Wir fuhren am Hotel vorbei, aus dessen ebenerdiger Halle eines von den fünf Radios der Insel ertönte. Es klang wie Sonntag in einer holländischen Provinzstadt, und ich schloss ärgerlich die Augen. Putuh lachte und versuchte, die Töne nachzuahmen, die ihm komisch vorkamen. »Die Gamělans der weißen Leute sind nicht gut«, sagte er kritisch. Mich trugen meine Gedanken schon wieder in das Vergangene zurück, als wir die beiden großen Wairinginbäume am Eingang der Hauptstraße passierten. Sie standen noch so, wie sie vor vielen Jahren vor der Mauer der Puri, des Palastes der Fürsten von Badung, gestanden hatten. Hier war der Platz, wo Bali sich am stärksten verändert hatte. Wo die Fürstenhöfe sich mit ihrem Gewimmel von Häusern und Menschen ausgedehnt hatten, da spielten jetzt ein paar weiß gekleidete Damen Tennis, und weiter ab übten sich die mohammedanischen Verkäufer aus Denpasar im Fußball. Ein Auto mit Touristen kam um die Ecke.
Ich weiß nicht, ob die Balinesen noch daran denken, dass hier ihre Fürsten mit allen Angehörigen einen bitteren und stolzen Tod gestorben sind. Sie sind ein vergessliches Volk, und wahrscheinlich kann man nur so glücklich sein wie sie, wenn man ihre Fähigkeit hat zu vergessen. Die Holländer aber denken noch daran, wie die Fürsten von Badung und Pamětjutan, von Tabanan und von Klungkung den Tod aufsuchten. Sie denken daran mit Bewunderung, und vielleicht haben sie daran gelernt, was für eine Bewandtnis es mit der Seele der Balinesen hat und dass man sie vorsichtig anfassen muss, wenn man sie nicht zerstören will. Ich möchte gern glauben, dass die Fürsten mit ihrem Sterben dazu beigetragen haben, der Insel ihre Freiheit und ihre alten Gesetze und Götter zu erhalten.
Hundert Meter vom Hotel entfernt badeten die Frauen wieder nackt im Fluss, die Häuser verkrochen sich wieder hinter Mauern, über die Palmen ihre Wipfel streckten. Hühner, Schweine und Hunde liefen vor dem Auto her. Wir bogen in das nächste Dorf ein und erreichten die weit gestreckten Reisfelder, die dahinter lagen. Nördlich von Sanur hielt mein hustender Wagen an, und wir machten uns daran, quer über die Reisfelder nach Taman Sari zu gehen. Ich zog mir am Feldrand die Schuhe aus, denn auf den fußbreiten, lehmig-nassen Dämmen zwischen den Sawahs kann man barfüßig besser vorankommen. Vor mir glitten die schnellen, gelbgrünen Nattern in das Wasser der Sawahs, auf denen gerade erst gepflanzt worden war. Zwischen den grünen Spitzen der jungen Reispflanzen spiegelte sich der Himmel mit vielen Wolken im Wasser. Taman Sari liegt nicht an einer großen Straße, deshalb ist dort das Leben noch wie in alter Zeit. Putuh ging hinter mir, und der Tritt seiner nackten Füße war lautlos und sicher.
Vor der Pforte zu Putuhs Hof hing, aus Palmenblättern geflochten, das Zeichen, dass Krankheit im Hause war. In zwei Nischen zu den Seiten des Tores lagen Opfer an die bösen Geister, Sirih und Reis und Blumen, damit sie den Hof nicht betreten sollten. Wir traten ein, Putuh und ich, von meinem Diener gefolgt, der meine Tasche auf der Schulter trug, als wenn es sich um eine schwere Last gehandelt hätte.
Der Hof lag sauber und still mit seinen verschiedenen kleinen Häusern und Balés. Ein paar wohlerzogene schwarze Ferkelchen liefen vor meine Füße. Ich hatte mir noch nicht die Zeit genommen, meine Schuhe wieder anzuziehen, obwohl die Dorfleute mich auslachten, wenn ich barfuß wie ein Balinese daherkam. Aber ich war zu ungeduldig und hatte keine Zeit für Förmlichkeiten. Putuh, mit eiserner Höflichkeit, murmelte die üblichen Entschuldigungen. Dass sein Haus ärmlich, schmutzig und stinkend sei und dass er mich dafür um Verzeihung bäte. Ich war erleichtert, weil das Zeichen vor der Pforte nur auf Krankheit deutete und noch nicht auf Tod. Putuh rief über den Hof hin nach seinen Frauen. Eine, die jüngere, kam aus der Küche, einen Säugling rittlings auf ihrer Hüfte. Zwei kleine Mädchen, nackt, aber mit Pflöckchen in den Ohren, starrten mich an, die Finger im Mund. Hinten im Hof krähten die Kampfhähne in ihren Bambuskörben. Putuh geleitete mich zu einem Bambushaus, das auf einer steinernen Plattform stand, offensichtlich die Balé, in der seine zweite Frau mit ihren Kindern wohnte. Auf dem Lager aus Bambus kauerte eine sehr alte Frau, wahrscheinlich Rakas Großmutter, und hielt das kranke Kind auf dem Schoß. Daneben kniete die Mutter; sie war eine Frau mit einem etwas verblühten indischen Gesicht, wie sie manchmal bei den Brahmanen vorkommen, und mit jungen, straffen Brüsten. Beide Frauen lächelten ängstlich, als ich mich über den Knaben beugte.
Raka sah schlimm aus. Seine Lippen waren trocken und zerrissen vom Fieber, und er hielt die Augen zuckend geschlossen. Die Arme waren abgezehrt, und die kleinen schmutzigen Hände geballt, und doch schlaff. Er murmelte unaufhörlich, aber es bildeten sich keine verständlichen Worte. Auf der Stirn und an den Unterarmen hatte er eine gelbliche Paste verrieben, wahrscheinlich ein Mittel meines Kollegen, des Balian. Der Puls ging schnell und dünn, und der Atem war flach und angestrengt. Ich sah sofort, dass es nicht Malaria war, oder jedenfalls nicht bloß Malaria. Wie alle Kranken in Bali lag er nackt, nur mit seinem kleinen Kain flüchtig bedeckt. Die Großmutter sagte leise etwas zu Putuh, der es an mich weitergab, da es der Frau nicht ziemte, den weißen Tuan anzusprechen. »Das Kind hat noch nicht geschwitzt. Es ist kalt und heiß, aber es kann nicht schwitzen«, sagte Putuh lächelnd. Es hat Jahre gedauert, bevor ich dieses balinesische Lächeln verstehen lernte. Manchmal kommt es von hell erblassten Lippen, und dann bedeutet es großen Kummer und vielleicht auch Verzweiflung.
Ich fand bald, dass Raka eine beiderseitige Lungenentzündung hatte. »Seit wann ist das Kind krank?«, fragte ich. Die Frau und die Großmutter legten die Finger zusammen und rechneten angestrengt. Man einigte sich auf neun Tage. Die Krise musste bald erreicht sein. »Wie hat die Krankheit angefangen?«, fragte ich, um sicherzugehen. Putuh zögerte mit der Antwort. Was ich wissen wollte, das waren die ersten Symptome: Schüttelfrost, Erbrechen. Was Putuh antwortete, das hätte ich erwarten können. »Jemand hat einen bösen Zauber geübt«, sagte er nämlich leise. In Bali kennt man keine natürliche Ursache für Krankheiten. Man muss verhext sein, durch böse Geister geplagt, oder die Übeltat eines Ahnen wird im Nachkommen bestraft. Wieder zog die Erinnerung an den früheren Raka mir durch den Sinn, während ich dem Kind Medizin einzuflößen versuchte und die Frauen aufscheuchte, um heißes Wasser, um Kains zum Einwickeln und Zudecken des heißen kleinen Körpers, um eine Kapokmatratze für die Ruhebank.
»Wer sollte ein kleines Kind verhexen?«, fragte ich. »Raka ist ein schöner Tänzer. Alle lieben ihn.«
»Es gibt Hexen im Dorf«, flüsterte Putuh mir zu. »Ich will ihre Namen nicht nennen.«
Er starrte mich voll Angst an, als ich die Spritze präparierte, um dem Kind eine Injektion zu geben. »Wenn er behext ist, so werde ich den Zauber brechen, das weißt du«, sagte ich wütend.
»Jeder spricht davon, dass der Tuan die gute Kraft hat«, sagte die Großmutter ehrfürchtig; sie kam mit einem schweren Tongefäß voll heißen Wassers daher, das sie vorsichtig vor sich herschleppte. Die Sehnen ihrer mageren Arme waren wie gespannte Stricke. Die Mutter brachte Kains und Tücher, die bunt, aber nicht allzu sauber waren. Ich rieb die Füße Rakas mit Salz, machte ihm heiße Wickel und packte ihn ein in alles, was ich finden konnte. Dann legte ich ihn auf das Lager, und die alte Frau kauerte sich wieder dazu. Rechts vom Haus stand eine kleinere offene Balé, wie jeder Hof sie hat, um die täglichen Opfer zu bereiten. Rakas Mutter warf noch einen Blick auf das Kind, das zu murmeln aufgehört hatte, dann kauerte sie sich dort nieder und flocht Palmblätter zusammen. Es mochte notwendig sein, noch mehr Opfer zu bringen, als schon geschehen war. Große und wirksame Opfer an die Götter, um ihre Hilfe herbeizurufen. An die bösen Geister, um sie zu beschwichtigen. Hexen gibt es in jedem balinesischen Dorf. Es sind Frauen, meistens alte, manchmal auch junge, die sich mit bestimmten geheimnisvollen, altererbten Beschwörungsformeln den finsteren Mächten angeloben. Sie gehen den linken Pfad, wie es heißt. Sie bekommen die Macht, sich in Lèjaks zu verwandeln, in seltsame und bösartige Geschöpfe, die sich nachts herumtreiben, Unfug anstellen und Unglück verbreiten. Manchmal, während ihr Körper zu Hause schläft, treibt sich die böse und verzauberte Seele solcher Hexen als feurige Kugel in der Nacht herum. Fast jeder Balinese hat schon Lèjaks gesehen. Man kann darüber lächeln. Ich selbst aber bin mehrmals solchen Feuerkugeln nachts begegnet, seltsam atmenden, schwebenden Gebilden, und es gibt noch mehr Weiße auf der Insel, die solchen unerklärlichen Nachtspuk erlebt haben. Ich tat mein Bestes als Arzt, um dem kleinen Raka zu helfen. Aber ich war nicht ganz sicher, dass es nur eine Lungenentzündung war, gegen die ich zu kämpfen hatte.
Eine Stunde verging in Schweigen. Putuh hatte sich zu meinen Füßen auf die Stufe gekauert, und ich saß auf einer Matte neben dem improvisierten Krankenbett und wartete. Mich band irgendetwas Starkes und nicht Erklärliches an dieses Kind. Ich musste dableiben, bis die Krise vorbei war, zum Guten oder zum Schlechten. Die Zeit hörte auf, wie das manchmal geschieht. Mein Diener hatte sich hinten im Hof zu den Hahnenkörben gekauert und summte eine Melodie, die aus fünf Tönen bestand und traurig klang, obwohl sie lustig gemeint war. Mein Diener ist ein leidenschaftlicher Liebhaber der Hahnenkämpfe. Das Gouvernement erlaubt nur wenige offizielle, denn es will die Balinesen davor bewahren, dass sie ihr ganzes Vermögen verwetten und verspielen. Aber auf den kurzgrasigen Wiesen hinter den Dörfern, wo keine Straßen hinführen, finden noch viele heimliche, verstohlene Hahnenkämpfe statt. Ich schaute gedankenlos meinem Diener zu, wie er einen weißen Hahn aus seinem Korb nahm und liebkoste. Die Zeit hatte aufgehört, sich zu bewegen. Nach einer endlosen Weile hörte ich einen Laut aus dem Stoffbündel auf dem Bett kommen. Ich stand schnell auf und sah das Kind an. Raka hatte zu fantasieren aufgehört. Seine Augen waren geöffnet und fast klar. Schweiß strömte in kleinen Bächen über sein Gesicht und löste den Schmutz von der hellbraunen Haut. Mit seinen trockenen Lippen verlangte er zu trinken. Putuh selbst lief davon und kam mit einer halben Kokosnussschale an einem Stiel wieder. Er goss dem Kind das Wasser in den Mund, und es trank mit Heftigkeit. Putuh schaute mich fragend an. »Jetzt ist es gut«, sagte ich erleichtert. Die Großmutter hob die Hände und murmelte dankbar, dass der Tuan jeden Zauber brechen könne. Sie rief über den Hof hin, und die Mutter kam herbei. Sie stellte sich schüchtern neben das Bett, als wenn es sich nicht um ihr eigenes Kind handeln würde, und schaute den Knaben still an. Raka lächelte ihr zu. Putuh sprach nicht zu ihr, denn er konnte seiner Würde nicht so viel vergeben, um vor einem Besucher mit seiner Frau zu reden. »Mein kleiner Prinz, jetzt wirst du wieder gesund werden«, sagte er zu dem Kind. Die Großmutter stand auf und fasste mich mit beiden Armen um die Hüften, es war ein Zeichen von Ergebenheit, das sich nur eine alte Frau leisten konnte. »Bald wird Raka wieder den Kěbjar tanzen«, sagte ich zufrieden. Ich wickelte den mageren kleinen Körper aus seinen heißen Decken und frottierte ihn. Das Fieber war gebrochen. Die Großmutter half mir mit geschickten Händen, die Mutter stand nur dabei und sah schlaff aus wie nach zu großer Anstrengung. Als ich noch forschend auf das Kind hinuntersah, rührte die Großmutter sacht an meine Hand. »Der Tuan hat auch bemerkt, wem er ähnlich schaut?«, fragte sie mit einem schlauen Lächeln. Ja, sagte ich, ich hätte es bemerkt.
»Der Tuan hat den Vorvater noch gekannt. Der Tuan ist auch alt, er hat den Abend erreicht wie ich«, sagte die Großmutter. Ich wunderte mich. Ich hatte es nie bemerkt, dass ich alt war. Ich hatte auf gehört, die Jahre zu zählen, die vergangen waren, wie ein Balinese. Ja, ich war auch alt, und die Vergangenheit war mir lieber und näher und deutlicher als die Gegenwart. Ich legte der Alten die Hand auf die Schulter, was ein Zeichen großer Zuneigung ist, und sie kicherte wie ein junges Mädchen.
Es begann schon zu dämmern, als ich alles Nötige angeordnet hatte und den Hof verließ. Mein Diener trug, an eine Bambusstange gebunden, meine Zaubertasche und eine Flasche süßen Reisweines, die Putuh mir geschenkt hatte. Auf der Dorfstraße war jetzt viel Leben, denn in der Stunde vor Sonnenuntergang muss alles Mögliche getan werden. Männer trugen ihre Hähne nach Hause, die tagsüber außerhalb der Hofmauer an der Straße gestanden hatten, um sich am Anblick der Vorübergehenden zu erfreuen. Frauen kamen mit viereckigen Körben auf dem Kopf von irgendwoher nach Hause. Entenhirten mit langen Stangen, an denen ein Wimpel aus Federn flatterte, trieben ihre kleine schwänzelnde Herde von den Feldern. Mädchen füllten die Opfernischen vor den Toren. Alle wollten zu Hause und in Ordnung sein, bevor die Dunkelheit kam, in der die Dämonen und Geister frei werden. Männer mit Reisgarben an der Bambusstange, Männer mit riesigen Heubündeln, Männer mit hellbraunen, blanken Kühen, die vom Feld heimkehrten. Faule junge Männer mit Blumen hinterm Ohr und flott herausgeputzte. Fleißige alte Männer, dürr und weise. Alle kamen sie daher, einzeln aufgereiht, mit den aufrechten Nacken, den nackten Oberkörpern, dem unvergleichlichen Rhythmus ihres Ganges. Noch immer bin ich es nicht müde, diesen Menschen zuzusehen, wie sie sich bewegen. Hundegebell, der Rauch der offenen Küchenfeuer, der durch das Grasdach aufsteigt. Geruch von Zigaretten und Tjempakablumen. Die Mädchen kommen mit nassem, glattem Haar vom Bad und haben sich mit Blumen geschmückt. Da und dort brennt schon ein Öllämpchen hinter einem Verkaufsstand. Ein schwebender Klang, wie vom Geläute vieler zusammengestimmter Glocken; das ist der Gamělan, das balinesische Orchester mit seinem feinen Geflecht von Musik. Bei der großen Balé, dem Versammlungs- und Rastplatz des Dorfes, üben die Männer ihr Programm für das nächste Fest. Am Ausgang des Dorfes steht ein heiliger Baum, ein uralter Wairingin, groß wie ein Dom, mit einer dunklen Kuppel aus Laub und mit Tausenden überhängenden, eisengrauen, eisenstarken, greifenden Luftwurzeln. Unter dem riesigen Gewölbe steht einer der sechs Tempel von Taman Sari, eine gespaltene Pforte, voll mit Göttergestalten, von Dämonen bewacht, führt in den Ersten der drei Höfe. Tempel in Bali sind keine Gebäude, es sind freie Plätze an heiligen, von alters her ehrwürdigen Stellen. Dort stehen die großen steinernen und hölzernen Stühle und Throne, auf denen die unsichtbaren Götter sich niederlassen, wenn der Priester sie ruft. Ich blieb einen Augenblick am Tempeltor stehen, um ein paar Frauen mit großen Opferkörben auf den Köpfen vorbeizulassen. Die Gamělanmusik verklang, als ich das Dorf verließ und wieder über die Reisfelder ging. Jetzt sah ich den Großen Berg vor mir, mit ein paar waagrecht ziehenden Wolkenschleiern verhüllt. Die ersten Fledermäuse schwirrten schon, und die Zikaden machten einen heillosen Lärm. Ich freute mich auf mein Haus. Ich würde Tamors Hirsche vor mich hinstellen und mich darüber wundern, wieso im Nachkommen das Kunstwerk vollendet wurde, das der Vorfahr angefangen hatte und nicht zu Ende führen konnte. Es fiel mir ein, dass die alte Frau mich alt genannt hatte, und es machte mich lachen. Ja, ich habe lange gelebt auf dieser Insel und viel gesehen. Ich habe viele Leute gekannt, die gestorben sind, und ich habe es erlebt, wie manche von ihnen wiedergeboren wurden. Ich spürte mich eingespannt in den Kreislauf der Dinge und Teil von ihnen. Ich habe die Insel gekannt, als sie noch kämpfte, und ich war dabei, wie sie unterlag und wie sie neue Herren bekam statt der starken und grausamen Radjas der alten Zeit. Aber es hat sich wenig geändert. Es gibt jetzt Fahrräder und Autobusse und ein bisschen modernen Schund in ein paar komischen kleinen Läden. Es gibt ein paar Spitäler und Schulen, und es gibt sogar ein Hotel, in das man Touristen für drei Tage ablädt und wieder wegtransportiert, nachdem sie ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut und nicht begriffen haben. Doch Bali hat sich nicht geändert. Es lebt nach dem alten Gesetz, das unangetastet geblieben ist. Die Berge, die Schluchten, die Reisfelder, die Palmenhügel sind gleich geblieben. Die Menschen sind gleich geblieben. Es sind dieselben Menschen, die immer wiederkommen, die meisten sind froh und sanft und vergesslich, und wir werden sie nie ganz verstehen und nie ihre Stille und Gelassenheit erlernen können. Viele sind Künstler, und sie werden immer neue Gamělanmusik erfinden und neue Gestalten aus Holz und Stein schneiden und neue Theaterstücke dichten und neue Tänze tanzen. Aber die Götter ändern sich nicht, und solange sie noch in tausend Tempeln thronen, in jedem Fluss und Berg und Baum und Feld, so lange wird auch Bali sich nicht ändern. Ja, es ist wahr. Ich muss alt sein, um solche Gedanken zu denken. Ich stolpere bloßfüßig über die winzigen Raine zwischen den Sawahs und philosophiere. Mitten zwischen den Felsen liegt ein kleiner Tempel, den hat man damals neu aufgerichtet, als Unglück und Plagen über die Sawahs kamen. Vor der Pforte sitzt eine Gestalt mit einem großen, runden, selbst geflochtenen Hut, die mir bekannt vorkommt. Es ist ein alter Mann, er winkt mir mit der Hand. »Gegrüßt, Tuan«, ruft er aus in dem Singsang der altmodischen einfachen Leute. »Gegrüßt, Freund«, sage ich. »Gegrüßt, mein Bruder.«
Wahrhaftig, es ist Pak, der Vater des Schnitzers Tamor. Er ist so alt wie ich, er hat graues Haar und keine Zähne. Er muss den Sirih mit einer Klinge zerstampfen, weil er nicht mehr kauen kann.
»Wie geht es, Pak?« – »Ich bin zufrieden«, singt Pak. »Meine Füße und meine Hände sind zufrieden nach der Arbeit. Meine Augen sind froh, wenn sie auf die Sawahs schauen, und das Leben ist süß.«
Ich bleibe ein wenig bei ihm stehen, und wir plaudern dies und jenes. Mein Diener wartet daneben, ein ganz klein wenig ungeduldig, denn er will abends ins Dorf gehen und das Schattenspiel ansehen. Er ist in ein Mädchen verliebt, dem er bei dieser Gelegenheit Augen machen und vielleicht sogar ein Wort zuflüstern wird. Ich komme schon, nur noch einen Augenblick, mein Freund. Ich trete nur noch rasch durch die Pforte des kleinen Tempels und schaue über die Felder hinaus. Sie sehen jetzt heller als der Himmel selber aus, der sich in ihren Wasserflächen spiegelt. Schon quaken die ersten Frösche, und von Sanur hört man das dumpfe, gleichmäßige Schlagen des Kulkuls, der hölzernen Trommel, mit der die Männer zur Versammlung gerufen werden. Im letzten Glanz des Tages sehe ich den kleinen Schrein der Gottheit. In das Mauerwerk des Sockels eingelassen leuchten drei Teller; billiges Steingut mit einem ziemlich gräulichen Rosenmuster. Ja, sie sind noch da und wohl erhalten, diese drei Teller, die eine so große Rolle in Paks Leben gespielt haben. Ich stehe noch einen Augenblick mit dem Lärm der Zikaden und dem Schlagen des Kulkuls im Ohr, und der kühle, grüne Geruch der reifenden Felder kommt von weit her, Raka wird gesund werden, denke ich. Pak hebt die Hand und winkt mir zu, als ich gehe.
»Friede deinem Weg«, singt er.
»Friede deinem Schlaf«, antworte ich.
Mein Wagen wartet mit treuem und geduldigem Ausdruck an der Straße nördlich von Sanur. Zwanzig Neugierige stehen darum geschart, Augen, Münder und Nasenlöcher voll der freudigen Erwartung und des Staunens. Es sind die jungen Leute aus dem Dorf, und sie jubeln hinter mir her, wie mein alter Wagen mit heiserem Husten davonkeucht.
Der Mond kam schon hoch, als ich zu Hause anlangte. Da ist das Sternbild des Orions, das sie hier den Pflug nennen, und das Kreuz des Südens. Der Abend in meinem Garten vibriert vom Zirpen und Summen und vom Zickzack der Leuchtkäfer. Es ist sehr kühl, und auf den Palmblättern liegt ein Glanz, dass sie aussehen wie schmale Kreise. Mein kleiner Affe setzt sich auf meine Schulter und schläft. An der Wand schmatzen die kleinen Titjak-Eidechsen, und ein großer rot gefleckter Gecko stößt mit heiserem Bariton seinen Ruf aus. Ich zähle – elfmal, das bedeutet Glück. Nachher ist es ganz still, mit der lärmenden Stille der Tropennacht. Ich schließe die Augen, da sehe ich Rakas kleines Fiebergesicht vor mir. Dahinter taucht das Gesicht seines Ahnherrn auf. Putuh, Pak, die billigen Teller unzerbrochen in dem kleinen Reistempelchen. Die alten, alten Geschichten, rührend und komisch und stolz und blutig. Viele sind gestorben, aber Pak lebt noch, der alte Bauer am Rand seiner Sawah.
Ich zünde meine Pfeife an und nehme Papier zur Hand. Jetzt will ich alles erzählen, was ich noch von den alten Zeiten weiß.
Wer weise ist im Herzen,
der trauert nicht um die Lebendigen
noch um die Toten.
Alles, was lebt, lebt ewig.
Nur das Gehäuse, das Zerbrechliche, vergeht.
Der Geist ist ohne Ende, ewig ohne Tod.
Aus der Bhagavad-Gita
Die Strandung der »Sri Kumala«
Pak erwachte, als hinten im Hof die Hähne krähten. Er fröstelte unter dem blauen Kain, den er über sich gedeckt hatte, und seine Augen waren noch voll Schlaf. Es war finster in der Kammer, obwohl Puglug, die Frau, die Tür offen gelassen hatte, als sie hinausging. Pak seufzte tief. Er stand ungern auf und ging ungern zur Arbeit. Aber der Tag war günstig, um zu pflügen, so sagte der Kalender, und Pak machte sich von seiner Matte los, gerade als der Kulkul im Dorf die siebente Stunde der Nacht anschlug. Noch eine Stunde, und die Sonne würde aus ihrem Haus treten und den Tag mit sich aus dem Meer bringen.
Noch immer krähten die Hähne mit lautem Spektakel, und Pak lächelte, als er die Stimme seines Lieblings, des roten Hahns, heraushörte. Der war noch zu jung, um zu kämpfen, aber Pak konnte schon die Merkmale an ihm erkennen, die versprechen, dass er ein guter, starker Kampfhahn sein würde. Pak band seinen Kain um die Hüften und zog ihn zwischen den Beinen durch, sodass ein kurzes Lendentuch daraus wurde. Er griff im Finstern über sich nach dem Balken und nahm sein Messer und die Sirihtasche, die er an den Gürtel knüpfte. Der Kain war feucht und kühl vom schweren Nachttau. Pak erinnerte sich dumpf an einen unverständlichen Traum. Er tastete nach der andern Matte auf dem Bambusgestell, das seiner eigenen Ruhebank gegenüberlag. Die Kinder atmeten im Schlaf, Rantung, die Siebenjährige, Madé, die Zweitgeborene, und in der Ecke das Bündelchen mit dem Neugeborenen.
Pak und seine Frau waren sicher gewesen, diesmal einen Sohn zu bekommen. Sie hatten für elf Kèpèngs den Balian befragt, als das Kind sich im Leib der Frau zu bewegen begann, und er hatte ihnen einen Knaben versprochen. Pak hatte Luftschlösser zu bauen begonnen und sich einen schönen Namen für ihn ausgedacht. Er wollte ihn Siang nennen, das Licht und der Tag. Da aber Puglug enttäuschenderweise und ganz unerwartet wieder ein Mädchen geboren hatte, wusste man keinen Namen. Wahrscheinlich würde man sie einfach Klepon nennen, wie vor ihr mehrere Töchter der Familie geheißen hatten.
Noch einmal seufzte Pak, verließ die Kammer, zögerte einen Moment im offenen Vorbau und ging dann die Stufen hinunter in den Hof, mit seinem mageren Schatten vor sich her, und ging zur Mauer. An der Westseite des Grundstücks, wo der Onkel wohnte, war schon die zänkische Stimme von dessen erster Frau zu hören, die mit niemandem Frieden halten konnte. Puglug aber war für zweiundvierzig Tage nach der Geburt des kleinen Mädchens unrein und durfte Pak kein Essen bereiten. Er hatte allen Grund zu seufzen. Er war so satt und voll von Puglug, als wenn sie eine Speise gewesen wäre, von der er zu viel gegessen hatte. Drei Töchter hatte sie geboren und keinen Sohn. Unnütz war sie und gar nicht schön. Er kauerte sich auf die Stufen und schaute misslaunig auf die Frau hinunter, die mit einem Besen den Hof fegte. Der Himmel wurde schon etwas heller hinter den Wipfeln der Kokospalmen, und Pak konnte den schweren Umriss sehen, der sich emsig bückte und bewegte.
Sieh, da kam Lambon von der Küche her, seine junge Schwester, und trug ein Pisangblatt, auf das eine gute Ladung von gekochtem Reis für ihn gehäuft war. Pak griff danach, kauerte sich auf die Stufen und wurde vergnügter. Mit drei Fingern fasste er in den Reis und stopfte sich den Mund voll. Seine Laune besserte sich mit jedem Klumpen, den er schluckte. Puglug hielt einen Augenblick inne und schaute zu dem essenden Mann hin, dem sie kein Essen geben durfte, dann fegte sie weiter. Sie ist eine gute Frau, dachte Pak, den Magen zufrieden mit Reis. Sie ist stark und kann dreißig Kokosnüsse auf dem Kopf tragen. Sie ist fleißig, sie geht zum Markt und verkauft Sirih und Speisen und verdient Geld. Sie kann nichts dafür, dass sie keinen Sohn gebären kann. Die Vorväter haben es so beschlossen. Er wischte seine Finger an dem geleerten Pisangblatt ab, warf es auf die Erde und machte sich mit Sorgfalt daran, seinen Sirih in die Betelnuss zu wickeln und etwas Kalk darauf zu tun. Als er den scharfen Priem im Mund hatte, dass der Speichel aus den Backen gelaufen kam, schien die Welt gut und wohlbestellt. Pak erhob sich, um die Kuh aus dem Stall und den Pflug von der Balé zu holen, wo alles Gerät verstaut war. Lambon, die zu seinen Füßen gesessen und ihm zugesehen hatte, ging zurück zur Küche. Ihre kleine Gestalt sah zierlich aus im Licht der Fackel, und Pak schaute ihr einen Augenblick nach und war stolz auf sie.
Lambon war Tänzerin; bei den Festen tanzte sie mit zwei anderen Kindern den Légong, ganz in goldene Gewänder gekleidet und mit einer goldenen Blumenkrone im Haar. Sie war schön, das konnte selbst Pak sehen, obwohl sie nur seine Schwester war. Sie hatte das Fest der Reife noch nicht gefeiert, und trotzdem standen schon die Dorfburschen vor dem Haus und blähten die Nasenlöcher, wenn sie zierlich vorbeiging. Die ganze Familie hoffte, dass Lambon einen reichen Mann heiraten würde, sobald sie mannbar war.
Als Pak aber nun in der aufhellenden Dämmerung in den Hof trat, da blieb er mit offenem Mund stehen. Es sah aus, als wenn während der Nacht die Dämonen hier gehaust hätten. Von der Mauer war an vielen Stellen die Strohdecke weggerissen, die er nach der letzten Ernte mit viel Mühe darauf gebreitet hatte. Unweit der Pforte, der Straße zugewandt, gähnte ein Loch. Ein schwerer Ast war vom Brotfruchtbaum gebrochen und lag quer auf der Erde wie etwas Getötetes. Das Dach, unter dem die Kuh stand, war zur Hälfte abgetragen. Pak starrte all dies ohne Verständnis, aber mit Schrecken an. Er hatte so etwas noch nicht gesehen. Er lief schnell zu seinem Vater hinüber, der alt war und mehr wusste als er. »Wer hat das getan?«, fragte er außer Atem.
Der alte Mann war zahnlos und schwach, ausgesogen von einem Leben mit vielen Anfällen der heißen Krankheit. »Wer hat das getan?«, wiederholte er singend, wie es seine Gewohnheit war. Es gab ihm Zeit, nachzudenken und seine Antwort klug auszuwählen. Pak starrte ihn in ängstlicher Erwartung an. Er spürte ordentlich die bösen Geister über sich, die nachts mit seinem Hof gespielt hatten. »Heute Nacht ist ein Sturm von Westen gekommen«, sagte der Vater. »Der hat es getan. Ich habe die ganze Nacht wach gelegen, und es waren Blitze am Himmel und ein großes Getöse in der Luft.« Er begann ohne Zähne zu lächeln und setzte hinzu: »Der Schlaf alter Leute ist dünn, mein Sohn.«
Paks Angst ließ ein wenig nach. »Vielleicht müsste man Baju, dem Gott des Windes, besondere Opfer bringen?«, murmelte er und starrte das Loch in der Mauer an. Der alte Mann überlegte dies in Muße. »Vor vielen Jahren«, sagte er, »war auch ein solcher Sturm. Da befahl der Pědanda, dass jeder Hof ein Huhn schlachten solle, für Baju; es wurden große Opfer gebracht, und am nächsten Tag warf das Meer ein Schiff aus sich heraus, voll mit Reis und Kokosnüssen, die unter die Gemeinde verteilt wurden.« Pak hörte erstaunt zu. »Bèh!«, sagte er voll Hochachtung. Er prüfte das Loch in der Mauer. »Soll ich ein Huhn schlachten?«, fragte er. Es schien ihm, als wenn alle Dämonen und Geister der unteren Welt jetzt in den unbeschützten Hof eindringen könnten. Der alte Mann, der oft wusste, was man dachte, ohne dass man es aussprach, sagte: »Rufe deinen Bruder. Wir werden das Loch mit Stroh verstopfen, während du auf der Sawah bist. Wenn du heimkommst, kannst du es mit Erde ausfüllen. Es ist auch noch Kalk hier zum Weißen der Mauer. Ein Huhn sollst du schlachten, und wir werden es den Göttern anbieten. Dann aber gehe aufs Feld, denn heute ist ein guter Tag, um zu pflügen.«
Pak wandte sich gehorsam um und war etwas beruhigt durch den gleichmäßigen Singsang des Alten. »Die Frau ist noch unrein und darf nicht opfern«, murrte er nur. »Schlachte du das Huhn, deine Schwestern und meines Bruders Frauen werden die Opfer bringen, und ich werde den Pědanda fragen, wie es richtig ist.«
Paks Herz schlug leichter, denn der Pědanda, Ida Bagus Rai, war ungefähr der klügste Mensch der Welt und nahezu unfehlbar. Sogar der Fürst von Badung schickte nach ihm, wenn er einen Rat brauchte. Pak spuckte seinen Sirih aus und ging zur Küche. »Ihr müsst ein Geschenk für den Pědanda bereiten«, sagte er zu den Frauen. »Es braucht nichts zu Großartiges zu sein, denn Ida Bagus Rai weiß, dass wir arm sind. Lambon soll es hintragen. Und bringt ein weißes Huhn zum Schlachten.«
Puglug, die sehr lange Ohren hatte, war hereingekommen und hatte sich auf ihren Besen gestützt. Plötzlich, ohne dass jemand sie gefragt hatte, begann sie loszulegen. »Was braucht ihr dem Pědanda schwere Geschenke zu bringen, wenn der Balian für drei Papayas ebenso guten Rat gibt? Wenn ich gefragt würde, könnte ich vielleicht auch erzählen, was heute Nacht geschehen ist. Ich hätte es vorhersagen können, denn Babak war erst vorgestern hier und hat mir erzählt, was die Frauen am Markt gesagt haben. Die Schwester von Babaks Mutter hat einen Mann gesehen, der nur ein Bein und das Gesicht eines großen Schweines hatte, und jeder Mensch, der Verstand hat, weiß ja, was das zu bedeuten hat. Wenn man den Balian fragen würde, dann könnte er sagen, dass es am besten wäre, wenn jeder Mann der Gemeinde einen großen Stein nehmen würde und damit zu einem gewissen Haus gehen und eine gewisse Person totschlagen würde, die an allem schuld ist. Ein weißes Huhn schlachten! Dem Pědanda Geschenke bringen! Man könnte glauben, dass wir reiche Leute sind mit vierzig Sawahs. Oder hat mein Mann vielleicht fünfhundert Ringgits unter dem Haus vergraben, dass er zum Pědanda läuft, bloß weil ein kleines Loch in die Mauer gekommen ist. Selbstverständlich, Lambon geht gern in das Haus des Pědanda, denn dort kann sie vielleicht Raka sehen. Ich habe es selbst gesehen, dass sie dunkle Augen bekommt, wenn Raka nur vorbeigeht, und das ist eine Schande für ein Mädchen, dem die Brust noch nicht gewachsen ist …«
Der Rest von Puglugs Meinungen wurde im Geschrei des Huhnes ertränkt, das Lambon herbeibrachte. Pak nahm es an den Beinen und ging damit in die Südecke des Hofes. Er hätte gern seine unmanierliche Frau geschlagen, die ohne seine Erlaubnis redete, aber er tat es nicht. Die redete und redete. Wie eine Herde von Enten in der Sawah. Taktaktaktak. Ob man sie gefragt hatte oder nicht. Oh, wie voll war er von Puglug, und wie nötig war es für ihn geworden, eine zweite Frau zu nehmen.
Er holte das breite Messer aus der Holzscheide, die in seinem Gürtel steckte, und hob das Huhn hoch.
»Huhn«, so sprach er, »ich muss dich jetzt töten. Ich tue es nicht, weil ich dir übel will, sondern weil ich dich opfern muss. Verzeih mir, Huhn, und gib mir deine Erlaubnis.«
Nachdem dieser Form Genüge getan war, hielt er die Schneide des Messers waagrecht, schwang das Huhn so, dass sein Hals in das Eisen rannte, und warf das blutende Tier auf die Erde. Es schrie noch einmal und war tot. In der plötzlichen Stille hörte man, dass jetzt bei der Küche ein guter Streit im Gang war zwischen Puglug und der ersten Frau des Onkels. Die beiden gaben einander an Gesprächigkeit, Tratschsucht und Geläufigkeit der Zunge nicht nach, und Pak musste laut herauslachen, als er dem unverständlichen Geschnatter zuhörte, das plötzlich in lautes, gutmütiges Gelächter überging. Beinahe hatte er schon seinen Schrecken vergessen. Er rüttelte im Vorbeigehen seine beiden jüngeren Brüder wach, die in einer offenen Balé zusammen auf einer Matte schliefen. »Ihr müsst Erde ausschaufeln und Kalk mischen, damit ich heute Abend die Mauer ganz machen kann«, sagte er und fühlte sich obenauf sitzen, als Herr der Familie.
Meru war gleich ganz wach. »Zu Ihren Befehlen und Wünschen, mein Fürst«, sagte er in gewählter Sprache, als wenn er zu einem Radja redete. Pak gab ihm einen freundlichen Schlag auf die Schulter. Er hatte eine Schwäche für diesen hübschen, leichtsinnigen Bruder, immer schon seit den Tagen, da er ihm das Gehen beigebracht hatte. Inzwischen war Meru ihm in gewisser Beziehung über den Kopf gewachsen, weil er schnitzen konnte und sogar für den Palast des Fürsten von Dadung eine Pforte geliefert hatte. »Von wem wirst du heute Sirih verlangen, Nichtstuer?«, sagte er gutmütig und spielte damit auf die vielen Abenteuer an, die Meru mit Mädchen hatte. »Von einer, die schöner ist als deine Frau«, gab Meru zurück, und auch dies war freundlich gemeint. »Wir werden schon sehen, wer am Ende die schönere Frau heimbringt«, sagte Pak nicht ohne Großartigkeit. Und als er so sprach, da dachte er an ein ganz bestimmtes Mädchen, das ihm schon seit einer Weile im Sinn lag. In bester Laune begab er sich zu seinem verwüsteten Stall, nahm die Kuh am Zaum, lud sich den Pflug über die Schulter und machte sich auf den Weg. Der alte Mann war schon dabei, mit eingeknickten Knien große Strohbündel zur Mauer zu schaffen. Es war spät geworden, die Sonne kam schon herauf. »Wird mein Vater daran denken, die Hähne zu füttern?«, rief Pak höflich zu dem Alten hinüber. Der antwortete nur mit einer beschwichtigenden Handbewegung und mit einem Hinaufziehen der Stirn bei geschlossenen Augen, einem Ausdruck der freundlichen Bejahung. Und somit ließ Pak beruhigten Herzens die komplizierten Angelegenheiten dieses besonderen Morgens hinter sich und verließ den Hof durch die schmale Pforte, friedlich geführt von seiner Kuh.
Auf der Dorfstraße, wo die Hofmauern sich in langer Linie aneinanderreihten, nur unterbrochen von den hohen Pforten, war das Leben schon in vollem Gang. Zwischen die Wipfel der Palmen und der schweren Fruchtbäume legten sich die Sonnenstrahlen wie silberne Balken durch die dampfende Morgenluft. Tausend Vögel sangen auf einmal. Die großen gerippten Blätter des Pisang wurden mit dem Aufsteigen der Sonne zu leuchtenden transparentenen Scheiben aus Grün. Hinter jeder Mauer blühten rote Hibiskusblüten um die Hausaltäre. Frauen kamen mit Körben und Matten auf den Köpfen, immer eine hinter der andern; ihre langen, gestreckten Schatten gingen vor ihnen her, und die Erste sprach halblaut, ohne zu achten, ob die Nächste sie verstand. Unter dem Wairinginbaum hielten sie an, halfen einander die Lasten von den Köpfen zu heben, sie breiteten ihre Matten auf den Boden und richteten ihre Ware zierlich darauf an. Sirih, gekochten Reis, Enteneier, Knoblauch und Gewürz. An anderen Tagen ging auch Puglug zum Markt, aber jetzt musste sie die Zeit ihrer Unreinheit abwarten, bevor sie wieder arbeiten durfte. Pak, friedlich dahinziehend, schüttelte den Gedanken an Puglug ab wie eine Ameise. Vor dem Haus des reichen Mannes Wayan verzögerte er sich ein wenig, und die Kuh blieb sogar ganz stehen und begann an dem kurzen Gras des Straßenrandes zu rupfen. Sie hatte sich schon daran gewöhnt, hier auf Pak warten zu müssen. Er blieb stehen, als hätte er umständliche Dinge an dem großen, runden Hut zu ordnen, der auf seinem Kopftuch saß. Ein Junge war gerade dabei, Wayans Hähne in ihren Körben herauszubringen und aufs Gras zu stellen, damit ihre Füße kühl bleiben sollten. Wayan hatte achtzehn Hähne, und Pak hatte nur vier; auch dies war schon mehr, als einem Mann seines Standes und seiner Arbeit zukam, und Puglug machte viele grämliche Andeutungen darüber. Da außer den Hähnen nichts zu sehen war, zog Pak seine Kuh am Zaum, sagte freundlich: »Wir müssen auf die Sawah, Schwester«, und ging seines Weges.
Paks Vater hatte zwei Sawahs vom alten Fürsten von Pamětjutan geschenkt bekommen, und er selbst hatte zwei weitere von dem jungen Fürsten Alit von Badung erhalten. Die seinen lagen im Nordosten des Dorfes und die des alten Mannes im Nordwesten. Seit der Vater zu schwach geworden war für die schwere Feldarbeit, musste Pak alle vier Sawahs selbst bestellen; er hatte nur eine Kuh, und seine Verwandten konnten ihm nur ungenügende Hilfe geben. Das Geschenk des Fürsten hatte Pak gewissermaßen zum Leibeigenen gemacht, insofern, als er den halben Ertrag an die Feldaufseher der Fürsten abzuliefern hatte. Auch musste er jede andere Arbeit verrichten, die der Fürstenhaushalt in den Puris von Badung von ihm fordern mochte. Dafür aber hatte er vier Sawahs, gute fette Erde und Wasser, dicke Garben bei den Ernten, grüne duftende Seide, bevor die Ähren ansetzten. Wenn er sorgfältig arbeitete, dann konnten die vier Sawahs zweihundert Garben bringen und zweimal in fünfzehn Monaten geerntet werden. Das gab auf seinen Teil genug Essen für die Familie, genug Reis für die Feste und Abgaben und Opfer, genug, um da und dort die Hilfe von Fremden zu bezahlen. Und es ließ in guten Jahren noch einen kleinen Überschuss, den man an chinesische Händler verkaufen mochte, deren Segelschiffe in Sanur anlegten, um Waren aufzunehmen. Dass die Ernte gut sein möge, die Erde freundlich und die Ähren voll, darum hatte Pak die Göttin Sri gebeten. Drei Tage zuvor hatte er das Wasser in die östlichen Sawahs einlaufen lassen, und deshalb musste er heute mit dem Pflügen beginnen, so war die Vorschrift. Inzwischen waren die westlichen Felder bald der Reife nahe, man hatte ihnen das Wasser schon entzogen, und so wechselte Pflügen und Pflanzen auf einem Grundstück mit Schneiden und Binden auf dem andern ab. Überall auf den schmalen Rainen traf Pak andere Männer aus dem Dorf, die zum Bestellen ihrer Felder kamen. Ohne stehen zu bleiben, riefen sie einander ein paar kurze Worte zu. Über den Sturm der Nacht und über das Woher und Wohin. Die östlichen Felder lagen ziemlich weit vom Dorf entfernt, und Pak musste Kuh und Pflug die steile, tiefe Böschung eines Flusses hinuntertransportieren und die Furt überqueren. Es leitete nur ein glitschiger, von bloßen Füßen ausgetretener Pfad da hinunter, und die Kuh machte Schwierigkeiten. Pak nannte sie Schwester und Mutter, er entschuldigte sich bei ihr und versuchte ihr zu erklären, dass dieser Abstieg nötig sei. Plötzlich hörte er vom Fluss her die Stimmen von Mädchen und erstarrte mit offenem Mund. Er hatte vergessen, dass er heute später dran war als an andern Tagen, sodass er die Frauen dabei traf, wie sie vom Bad zurückkamen. Eine hinter der anderen schritten sie den Abhang herauf, lachend und zwitschernd wie Morgenvögel. Paks Herz setzte aus. Er hatte Sarna zwischen ihnen entdeckt.
Er warf ihr einen schnellen Blick zu, als sie an ihm vorbeiging, aber er sah nicht, ob sie diesen Blick erwiderte. Sie hatte gelächelt, er wusste nicht, ob für ihn oder über ihn. Ich hätte mir eine rote Hibiskusblüte hinters Ohr stecken sollen, dachte er. Nein, dachte er gleich darauf, das hätte alles verdorben. Man muss den Mädchen nicht zu viel Liebe zeigen. Er stand im Gras, und Heuschrecken sprangen über seinen Rücken, und er starrte hinter Sarna her. Sie war jung und stark und schön. Alles war an ihr rund. Das Gesicht, die Brüste, die Hüften. Rund, aber zart und lieblich. Seine Leber und sein Herz waren groß und voll Süße, wenn er Sarna ansah. Ihr Haar war nass gewesen und ihr Sarong auch. Sie hatte eine nasse, schwere Haarfranse aus dem Kopftuch heraushängen gehabt, zum Zeichen ihrer Jungfernschaft. In den Ohren trug sie große Ohrpflöcke aus Lontarblättern gedreht, wie die Reisgöttin Sri. Wenn Pak der Sri Opfer hinlegte und sie um gute Ernte bat, dann sah sie in seinem Sinn eigentlich immer so aus wie Sarna, des reichen Wayan Tochter.
Er hatte mit seiner widerspenstigen Kuh die Talsohle erreicht, als die Mädchen oben am Rand der Böschung angelangt waren. Bunt und zart standen sie dort aufgereiht und riefen Scherze zu ihm hinunter, die er nicht verstehen konnte. Er sah ihnen nach, bis sie in den Reisfeldern verschwanden. Im Schatten seines großen Hutes zog er weiter. Seine Füße freuten sich des kühlen Wassers, als er den Fluss durchschritt, und er war zufrieden.