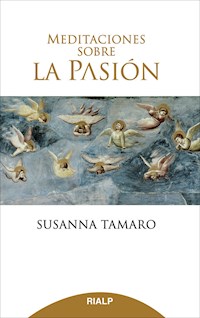16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der beeindruckende neue Roman einer Weltbestseller-Autorin
Seit sechs Jahren leben Chiara und ihre Familie in einem Haus in den Hügeln von Parma, Emilia Romagna. Der Ort entspricht dem neuen, friedlichen Lebensabschnitt, der auf ein schweres Trauma folgte. Zum ersten Mal hat die Familie beschlossen, dass nach dem gemeinsamen Weihnachtsfest jeder die Feiertage so verbringen wird, wie er es für richtig hält. Die älteste Tochter Alisha, die adoptiert wurde, verreist mit ihrem Verlobten, die zweitgeborene Ginevra fährt mit ihren Freundinnen in ein Skigebiet, der Jüngste, Elia, ist zu Gast bei einem Freund und Chiaras Ehemann Davide, ein Arzt, macht mit seinen alten Freunden eine Wanderung in den Bergen. Chiara, Ende sechzig, hat beschlossen, zu Hause zu bleiben. Sie spürt, wie die Zeit vergeht, und fühlt, dass der Moment gekommen ist, mit sich selbst ins Reine zu kommen, indem sie drei lange Briefe an Alisha, Ginevra und Davide schreibt. Eine Art geistiges Testament.
In ihrem neuen Roman kehrt Susanna Tamaro zur Erfolgsformel ihres Weltbestsellers »Geh, wohin dein Herz dich trägt« zurück und lässt ihre Protagonistin Briefe schreiben. Sie verhandelt darin grundlegende Themen wie die Liebe, den Glauben und den Rückhalt einer Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem TitelIl vento soffia dove vuole bei Solferino, Mailand.
© 2023 Susanna Tamaro
Deutsche Erstausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
NAGEL UND KIMCHE
in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch, Zürich
Coverabbildung von DarioX, nednapa / Shutterstock
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783312013746
www.nagel-kimche.de
Zitat
Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist.
Ludwig Wittgenstein
Was ist Wissen? Die Bedeutung des unsterblichen Lebens. Und was ist unsterbliches Leben? Alles in Gott zu fühlen. Denn die Liebe kommt aus der Begegnung.
Isaak von Ninive
Der Wind weht, wohin er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist.
Johannes 3,8
Für Alisha
Liebe Alisha,
es ist der 26. Dezember, und ich sitze in der Küche.
Ich könnte im Wohnzimmer bleiben, vor dem flackernden Kamin, aber um das Feuer zu genießen, braucht man Gesellschaft. Wenn man es allein betrachtet, kann man auf merkwürdige Gedanken kommen: Die Holzscheite verbrennen wie unsere von der Zeit verzehrten Leben, bis sie zu Asche zerfallen wie eines Tages unsere Körper. Die Küche hingegen ist der Ort des Lebens, hier essen wir im Kreis unserer Familie zu Mittag und zu Abend. Hier haben unsere kleinen Streitereien stattgefunden, unsere Diskussionen, hier haben wir glücklicherweise auch gemeinsam gelacht, und hier haben wir zusammen Entscheidungen getroffen.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie ich Anfang Dezember meine Idee von »Freie Weihnachten für alle« präsentiert habe? Hast du bemerkt, wie anschließend einen Augenblick lang ungläubige Stille herrschte?
»Soll das ein Witz sein?«, fragte Ginevra.
»Nein, ein ernsthafter Vorschlag.«
»Dann reicht es, die üblichen Regeln umzukehren«, hast du lächelnd bemerkt. »Ostern mit der Familie, Weihnachten mit wem du willst.«
»Und dann schaut man eben, wen man zu sehen bekommt«, lautete die abschließende Feststellung deiner Schwester. Der Einzige, der verzweifelt dreinschaute, war der kleine Elia.
»Was? Kein Weihnachtsbaum, keine Krippe, keine Geschenke?«
Ich musste ihn beruhigen. »Keine Angst. Wir werden alles ganz ordnungsgemäß machen, mit Geschenken unter dem Baum; aber am 26. kann jeder machen, was er will!«
Wer zuerst abgereist ist, noch vor Weihnachten, warst du, weil du einen fernen Ort erreichen wolltest, während Ginevra sich eine Einladung von ihrer Freundin Diamante beschafft hatte, die ein Haus in Cortina besitzt, und Elia schien am Ende zufrieden damit, die Feiertage mit der Familie seines besten Freundes zu verbringen. Weißt du noch, wie Ginevra gelacht hat, als dein Vater verkündete, dass er zusammen mit seinen Freunden vom Alpenverein einen Kurs besuchen würde, um das Eisfallklettern zu lernen?
»Aber Papa, dafür bist du doch zu alt!«
»Der Körper altert nicht, wenn der Geist nicht altert«, erwiderte Davide mit größter Gelassenheit, während Elia ihn mit weit aufgerissenen Augen anstarrte.
»Ist das nicht gefährlich, Papa?«
Am 25. haben wir jedenfalls Weihnachten noch wie üblich gefeiert, mit den Großeltern, den Onkeln und deinen Cousins, die aus Molise angereist waren, wie jedes Jahr mit traditionellen Speisen und Geschenken im Gepäck. Sie waren enttäuscht, dich nicht anzutreffen, und lassen dir herzliche Grüße ausrichten.
Am Nachmittag des Heiligen Abends brach vorübergehend Panik aus, weil wir das Jesuskind nicht finden konnten. Ich war mir sicher, dass ich es zu den anderen Krippenfiguren gelegt hatte, aber es war nicht in der Schachtel. Alle anderen befanden sich dort: die Hirten, die Schafe, die Enten mit ihrem Teich, der Engel für das Strohdach; keine Figur fehlte, außer dem Jesuskind. Je länger wir es suchten, umso unruhiger wurde Elia. »Heute sind doch die Läden geschlossen«, wiederholte er immer wieder. »Geschlossen, geschlossen! Man kann nichts kaufen! Was sollen wir tun?«
»Wo ist das Problem?«, erwiderte ihm Ginevra genervt. »Wir nehmen einfach eine Walnuss, malen darauf Augen und Mund und legen sie dann in die Wiege. Das ist doch nur eine Konvention, oder etwa nicht?«
Aber Elia gab sich damit nicht zufrieden.
Daraufhin bemühte sich dein Vater um Abhilfe, indem er versuchte, aus Knetmasse etwas zu formen, das wie ein Baby aussah. Ich wartete schon auf einen abfälligen Kommentar von Ginevra, etwas wie »Merkst du nicht, dass es wie ein Ferkel aussieht?«, was angesichts des grellen Rosas der Knete nicht ganz falsch gewesen wäre, als zum Glück unser treuer Felix das Jesuskind mit einem raschen Schlag seiner Pfote unter dem Sofa hervorholte, bedeckt mit Katzenhaaren statt mit Stroh, aber immerhin unbeschädigt. Wer weiß, vielleicht lag es das ganze Jahr lang dort unten! Wie auch immer, nachdem wir es gefunden hatten, kehrte wieder Frieden im Haus ein, und um Mitternacht konnte Elia den Heiland gemäß der Tradition in die Wiege gleiten lassen.
Im ersten Stock waren alle Koffer bereits gepackt. Als ich an ihnen vorbeiging, kam ich mir vor wie bei einer Weihnachtsfeier auf einem Bahnhof: Alle waren da, dachten aber schon an ihre Abreise am folgenden Morgen. Ginevra war in Gedanken bereits im glitzernden Luxuskaufhaus »Cooperativa di Cortina«, Elia bei den Spielen mit seiner Freundesschar und Davide bei den Steigeisen, die er ins Eis rammen würde.
»Bist du sicher, dass du allein hierbleiben willst?«, flüsterte mir dein Vater gestern Abend im Bett zu.
»Hast du Angst vor einem Hexenschuss?«, scherzte ich.
»Nein, dass dir etwas zustoßen könnte.«
»Was soll mir denn zustoßen? Ich bin nur ein bisschen müde.«
Er schien nicht überzeugt. »Du willst wirklich nicht, dass ich bei dir bleibe?«
»Nein, dir tut ein kleiner Ausflug in die Berge sicher gut, und ich weiß, dass du dich freuen wirst, mit deinen Freunden zusammen zu sein.«
»Und du?«
»Ich werde es genießen, ein wenig allein zu sein.«
Heute früh klingelte der Wecker im Morgengrauen, und um elf Uhr war das Haus bereits leer. Nachdem alle abgereist waren, räumte ich erst mal auf; dann aß ich ein paar Reste vom abendlichen Weihnachtsschmaus und legte mich anschließend mit einer warmen Wolldecke über den Beinen auf das Sofa, um ein wenig auszuruhen.
Wir leben jetzt seit sechs Jahren in diesem Haus auf dem Hügel, und in dieser ganzen Zeit habe ich noch nie einen Tag oder eine Nacht allein darin verbracht. Natürlich habe ich diese Erfahrung früher gemacht, als ich jünger war und wir noch in der Stadt wohnten, als euer Vater beruflich viel unterwegs war und ihr noch nicht Teil unserer Existenz wart. Aber die Einsamkeit in einem Mehrfamilienhaus ist etwas ganz anderes als in einem allein stehenden Gebäude, das von Wäldern umgeben ist, wo Geräusche unbekannten Ursprungs beunruhigend wirken und wo die Stille echte Stille ist.
Erinnerst du dich an deine Freundin aus Bologna, die eigentlich eine Woche bei uns bleiben wollte, aber nach der ersten Nacht mit einer offensichtlich erfundenen Ausrede in die Stadt zurückgefahren ist? Vielleicht wusste sie selbst nicht genau, weshalb, aber ich habe gespürt, dass der wahre Grund die Nacht hier auf dem Land war: Wenn es wirklich stockdunkel ist, ohne Straßenlaternen, ohne Leuchtreklamen, ohne die Lichter in den Fenstern des Mietshauses gegenüber, dann löst das in uns eine atavistische Furcht aus. Denn im Lauf der Menschheitsgeschichte haben uns im Dunkeln stets wilde Tiere aufgelauert: Bären, Wölfe und Säbelzahntiger, außerdem menschliche Feinde, bewaffnet mit Keulen. Das Fehlen von Licht erweckt diese Gespenster in den Nächten der Gegenwart erneut zum Leben.
Genau darüber haben sich deine Geschwister am Tag vor Heiligabend beim Essen unterhalten.
Elia machte sich Sorgen um mich. »Willst du wirklich ganz allein im Haus bleiben? Wirst du keine Angst haben?«
»Aber was redest du denn da? Sie wird doch nicht allein sein«, erwiderte ihm Ginevra lachend. »Die Geister werden ihr Gesellschaft leisten.«
»Geister?« Dein Bruder starrte sie ungläubig an.
»Natürlich. Alle alten Häuser sind voller Gespenster. Hast du in der Nacht noch nie gespürt, wie sie dich kitzeln?«
»Nein, noch nie. Wer sind diese Gespenster?«
»Das sind die Toten, die vor uns hier gelebt haben.«
»Und sind sie nett zu uns?«
»Das kommt darauf an.« Ginevra hatte ihm einen bedrohlich wirkenden Blick zugeworfen, als wüsste sie noch mehr darüber. Davide hatte sie unterbrochen, um das Thema zu wechseln. Aber am nächsten Morgen, während des Frühstücks, hatte Elia den Faden wieder aufgegriffen.
»Du irrst dich«, sagte er zu Ginevra, »in diesem Haus gibt es keine Gespenster, sondern Engel«, und als Beweis für diese Behauptung hatte er eine weiße Feder aus seiner Tasche gezogen. »Die habe ich heute Morgen am Fußende meines Bettes gefunden.«
»Du bist ein echter Dummkopf!«, fauchte ihn eure Schwester an. »Siehst du denn nicht, dass das eine Schwanzfeder von den Hühnern ist?«
»Wenn sie von einem Hühnerpopo stammen würde, dann wäre sie voller Kacke, aber sie ist sauber. Schau doch mal genau hin: Es ist wirklich eine Engelsfeder«, wiederholte Elia und wedelte damit vor ihrer Nase herum. »Du bist diejenige, die sie nicht erkennen kann.«
Wenn ich jetzt aus dem Fenster blicke, stelle ich fest, dass die Tage angefangen haben, länger zu werden. Der Baum mit den Kakipflaumen ganz hinten auf der Wiese, der vor zehn Tagen um diese Zeit schon von der Dunkelheit verschluckt wurde, leuchtet jetzt in der Dämmerung mit dem Orange seiner reifen Früchte. Die Himmelsumlaufbahnen geben uns die Wiederholung von Zyklen vor, aber solange wir im künstlichen Wirrwarr der Stadt leben, sind wir uns dessen nicht bewusst. Wir hetzen rund um die Uhr durch das Leben, ohne zu merken, dass wir dabei unsere Verbindung zum Kosmos verlieren oder verlieren müssen. Und ohne uns Fragen zu dieser Verbindung zu stellen, wird es immer schwieriger, den wahren Kern des menschlichen Daseins zu verstehen.
Um mich herum schwindet das Licht im Raum, aber ich habe es nicht eilig, eine Lampe anzumachen. An der gegenüberliegenden Wand kann ich immer noch das erste kleine Bild, das du im Kindergarten gemalt hast, sehen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, es beim Umzug wegzuwerfen.
»Aber es ist doch ein schreckliches Bild, Mama!«, hast du mich gescholten, nachdem ich es hier aufgehängt hatte. »Warum hast du es nicht einfach in Parma gelassen?«
»Weil darin schon dein ganzer Charakter zum Vorschein kommt«, habe ich dir geantwortet, und weil du zu jung warst, um das zu verstehen, hast du nur den Kopf geschüttelt.
Gestern erhielt ich per WhatsApp das Foto von dir und Luca, wie ihr euch umarmt, beide mit einer lappländischen Kopfbedeckung, das Ganze verziert mit einem Schneemann-Emoji. Ihr seht wirklich glücklich aus. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest da oben in Finnland.
Hier bei mir hat die Dunkelheit nun die Oberhand gewonnen, die Dinge um mich herum sind verschwunden, der einzige helle Fleck ist der Smartphone-Bildschirm auf dem Tisch. Ich habe das Gerät umgedreht, sodass die Rückseite nach oben zeigt, bin aufgestanden und zu der Schublade gegangen, in der wir die Lichtquellen für die hier auf dem Land häufigen Stromausfälle aufbewahren: die Stirnlampe, um die Hühner im Winter in den Stall zu sperren; die große Campinglampe, um sie mitten auf den Tisch zu stellen; die kleineren Taschenlampen für die Schlafzimmer und außerdem einige gute alte Kerzen. Ich nahm eine von ihnen, steckte sie in den verbeulten Kerzenhalter aus Zinn, zündete sie mit einem Streichholz an und kehrte zum Tisch zurück.
Das Licht war schummrig, aber ausreichend zum Schreiben. Als ich mit dem Stift das Papier berührte, wurde mir klar, dass die ganze von unserer Menschheit im Lauf der Zeit geschaffene Zivilisation diesen Ursprung hat, das flackernde Licht einer Flamme. Ein kleines warmes Herz und um es herum die große Dunkelheit. Eine schwache Flamme trotzt der Finsternis der Nacht, aber deren Dunkelheit mit ihren Schatten und Geräuschen bleibt bestehen, und in ihr tanzen die Gespenster. Alles, was existieren könnte und nicht existiert, wie auch alles, was existiert und nicht existieren könnte, taucht auf und verschwindet wieder.
Jetzt bin ich müde, ich würde dir gerne noch viel mehr erzählen, aber zum Glück habe ich noch eine Woche Zeit.
Als ich heute Morgen aufgewacht bin, war das Haus umgeben von Nebel. Früher, sagen die Einheimischen, drang der Nebel nicht bis hier hinauf, aber nach dem Bau des großen Damms hat sich das Gleichgewicht des Klimas verändert. Ich weiß, dass es heute ein schöner, sonniger Tag wird, aber ich muss geduldig warten, bis das tatsächlich zu sehen ist. Ich wurde im November in Ferrara geboren, weshalb ich von mir sagen kann, dass mir der Nebel sozusagen in die Wiege gelegt wurde, zusammen mit der Gefahr, sich darin zu verirren. Im eigenen Zuhause ist es anders: Wenn man sich darin bewegt, kennt man den Abstand zwischen den Einrichtungsgegenständen; man ist davor geschützt, Schritte ins Ungewisse zu machen. Doch irgendwie legt der Nebel uns nahe, vorsichtig zu sein, sich nicht auf oberflächliche Gewissheiten zu verlassen.
Wann hast du deine kindliche Leichtigkeit verloren, wann hast du uns zum ersten Mal die Frage gestellt, die dein Vater und ich immer gefürchtet hatten?
Auch damals war es ein nebliger Tag. Wir wohnten noch in Parma, und du gingst in die Oberschule. Es hatte ein paar kleine Alarmzeichen gegeben. Du warst immer unruhig, hast uns patzige Antworten gegeben und bist nachmittags rausgegangen, ohne uns zu sagen, wohin. Weil dein Vater sich Sorgen machte, war er dir eines Tages gefolgt und hatte dich in Gesellschaft von jungen Leuten gesehen, die ihm nicht vertrauenswürdig erschienen. Er hatte keinen Augenblick gezögert, dich an der Hand zu nehmen und nach Hause zu bringen, ohne Rücksicht auf die Proteste der Gruppe. »Verkaufe deinen Vater nicht für dumm«, hatte er mit seiner kräftigen Stimme auf dem Rückweg zu dir gesagt. Dass er sich auf diese Weise in dein Leben einmischte, hat dich verstört und geärgert. Anschließend hast du dich zum ersten Mal uns gegenüber in die Schmollecke zurückgezogen.
Eines Tages bist du wütend aus der Schule gekommen und hast deine Büchertasche zornig auf den Boden geworfen.
»Da ich also nicht tun kann, was ich will, will ich wenigstens wissen, wer ich bin!«
»Eine tolle Idee«, lautete der ungerührte Kommentar deines Vaters. »Wir alle möchten wissen, wer wir sind.«
Vor deiner Ankunft hatten wir darüber diskutiert, wo wir die Sommerferien verbringen wollten. Wir hatten uns für die Insel Vulcano entschieden, da keiner von uns bisher einen Vulkan aus der Nähe gesehen hatte. Am folgenden Samstag hast du deinen Vater in die Bibliothek begleitet und kamst mit einem Stapel Bücher zurück, die du mit ans Meer nehmen wolltest.
Die Abreise sollte im Juni stattfinden, nach dem Ende des Schuljahres. Ginevra füllte eine ganze Tasche mit verschiedenen Sonnenschutzmitteln, denn sie wollte im Urlaub nichts anderes tun, als sich wie eine Eidechse in der Sonne zu aalen, wie sie uns verkündete. Du hingegen wolltest das nicht unerhebliche Gewicht mehrerer Bücher über die Kultur Indiens in deinem Rucksack tragen.
Das Haus, das wir gemietet hatten, stand abgelegen inmitten der Natur, umgeben von üppiger Vegetation; von den Fenstern aus konnte man den Vulkan sehen. Dein Vater und ich waren auf die Insel auch von den berühmten heißen Schlammbecken gelockt worden, von denen es hieß, ein Bad darin könne jeden Schmerz verschwinden lassen. Ginevra hatte sofort betont, dass sie niemals einen Fuß in diesen ekligen Morast setzen würde, während du innerlich abwesend zu sein schienst, gleichgültig gegenüber dem Urlaubsprogramm. Es war, als wäre dein Blick plötzlich in eine andere Dimension gerichtet gewesen; das Funkeln deiner leuchtenden Augen war verschwunden. Ich fragte mich, ob es wohl zurückkehren würde. Oder würde sich ein weiterer Schleier auf deinen Blick legen, und dann noch einer, bis du so entrückt sein würdest, dass du für uns kaum noch erreichbar wärest?
Doch wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, hat ein unvorhergesehenes Unwetter all unsere Träume hinweggefegt. Gleich zu Beginn unseres Aufenthalts ist die Insel von stürmischen Winden heimgesucht worden, gefolgt von heftigen Regengüssen, und eine dicke Nebeldecke hat sich über den Gipfel des Vulkans gelegt und ihn unsichtbar gemacht.
Den ersten Tag haben wir noch gut gelaunt überstanden, weil wir glaubten, das würde bald vorbei sein, aber am dritten Tag waren wir alle depressiv geworden. Ginevra zeigte sich immer missmutiger: »Ihr hättet mich warnen sollen, dass wir nach Norwegen fahren!«
Es war sehr kalt. Als dein Vater und ich zur Touristeninformation gingen, um etwas über die Wetteraussichten zu erfahren, empfing man uns dort mit einer trostlosen Geste der Hilflosigkeit. Nebel im Juni und nur 14 Grad! Das hatte es noch nie gegeben! Man bat uns auch, es nicht weiterzuerzählen. »Wenn sich herumspricht, dass es auf der Insel Vulcano nicht wärmer ist als in Schweden, können wir die Saison vergessen.«
Die Einzigen, die das alles nicht besonders zu stören schien, waren du und dein Vater. Davide zog jeden Morgen los und lief den ganzen Tag auf der Insel herum, als wäre er im Wanderurlaub in den Dolomiten und nicht im Süden des Tyrrhenischen Meeres. Du hingegen verbrachtest eingehüllt in Strandtücher wie eine Tuareg, um dich vor der Kälte zu schützen, die ganze Zeit in der Küche, wo du die von dir mitgebrachten Bücher gelesen hast. Ginevra hatte sich in ihr Zimmer zurückgezogen, wo sie unter der Bettdecke mit ihren Freundinnen chattete und sich über das Unglück beklagte, das sie getroffen hatte.
Du hast abwechselnd still und mit lauter Stimme gelesen; die Abschnitte, die du nicht verstehen konntest – und das waren fast alle –, hast du mehrmals wiederholt, in der Hoffnung, dass sie sich dir früher oder später erschließen würden, wenn du sie dir akustisch einprägen würdest.
Du warst besonders beeindruckt vom Sanskrit-Begriff Samdhya und wolltest mir die Stelle vorlesen, wo er erklärt wird.
Samdhya bezieht sich auf den Zwischenzustand zwischen dieser Welt und der anderen, auf den Zustand des Schlafes, die Begegnung zwischen dem Licht des Morgens und dem des Abends.
»Das ist eigentlich ganz ähnlich wie unsere Redewendung zur Dämmerung, ›tra il lusco e il brusco‹«, hatte ich dir erklärt. Woraufhin du deinen Kopf vom Buch emporgehoben und gelächelt hast.
»Zwischen Finsternis und Helligkeit. Was genau soll das denn bedeuten?«
»Dass manche Dinge verschwinden und andere auftauchen, beispielsweise wenn ich in der Dämmerung in der Küche zu lange warte, bis ich das Licht anmache.«
Aber du warst bereits wieder in der Lektüre versunken, die Fäuste an den Schläfen, und hast mit lauter Stimme weiter vorgelesen:
Es geht nicht nur um die Auswirkungen von zwei unterschiedlichen Augenblicken im Verlauf der Zeit – dem des Lichts und dem der Dunkelheit –, sondern um all die Gegensatzpaare, aus denen die einzigartige kosmische Wirklichkeit besteht: Mann und Frau, Alter und Jugend, Sonne und Mond, Tag und Nacht, Gut und Böse, Gott und Geschöpf, Helligkeit und Finsternis.
»Das ist etwas besser zu verstehen, oder?«, hast du hinzugefügt.
»Ja, das finde ich auch klarer.«
»Soll ich weiterlesen?«
»Gern.«
Samdhya bezieht sich auf den Sonnenaufgang, wenn alles im Werden ist, oder auf den Sonnenuntergang, wenn alles bereits geschehen ist; und so, wie der Mensch bei der Morgenröte voller Hoffnung auf die Dinge sein kann, die er tun will, so kann er beim Abendrot nichts anderes tun, als zu beten, denn die Zeit und der Spielraum des Handelns sind vorbei. Samdhya ist wie eine Sphäre, die unser Leben, unser Schicksal und die Existenz des gesamten Universums umschließen kann.
In diesem Moment war Ginevra hereingeplatzt.
»Gibt es denn in diesem Haus nie eine Mahlzeit?« Als sie sah, dass du dein Buch zuklapptest, fragte sie dich: »Warst du schon dabei, etwas für die Schule zu tun?«, und nach kurzem Zögern hast du dies mit einem Nicken bejaht.
»Wenn ich gewusst hätte, dass hier alles so schrecklich sein würde, hätte ich auch meine Schulbücher mitgenommen. Dann hätte ich diese lästige Pflicht bereits erfüllen können, statt alles bis Anfang September aufzuschieben«, sagte Ginevra.
Da Lügen nicht zu deinem Charakter passten, brachte mich diese kleine Unaufrichtigkeit zum Nachdenken. Angesichts der unangenehmen Aufdringlichkeit deiner Schwester hattest du Angst, über die Suche nach deiner Identität zu sprechen und über das, was du aufgrund dieses Bestrebens gerade dabei warst zu entdecken.
Erst am nächsten Morgen wurde mir klar, dass diese harmlose Unwahrheit der schamhafte Schleier war, mit dem du das kleine, erst vor Kurzem entzündete Flämmlein deines Innenlebens schützen wolltest. Ginevra besaß weder das richtige Alter noch das passende Temperament, um Verständnis für die Nuancen des Unsichtbaren zu haben. Wenn du ihr gegenüber offen gewesen wärst, hätte sie sich über jedes deiner Worte lustig gemacht, und an der Schwelle zum Samdhya musstest du dies mehr fürchten als alles andere.
Was für ein großes Mysterium diesen Vorgängen doch innewohnt. Einige Kinder scheinen von Geburt an zu wissen, dass es eine geheime Dimension gibt, aus der sie stammen, während andere ihre ganze Existenz verbringen, ohne dass ihnen der Verdacht kommen würde, dass es mehr und etwas anderes gibt als die feste Materie, die wir vor Augen haben.
Du wolltest also dein Innenleben nicht mit Ginevra teilen. Und umgekehrt? Willst du wirklich in ihre Welt eindringen oder tust du es, wenn du es wieder einmal versuchst, nur aus einer Art verschämter Freundlichkeit heraus? Du kannst dich nicht wirklich für ihre Kleidung, ihre Marotten oder ihre Freunde begeistern, aber um sie nicht zu verletzen – und um nicht verletzt zu werden –, tust du immer so, als würdest du dich sehr für sie interessieren, und diese Verstellung ist meines Erachtens keine Lüge, sondern eher ein Zeichen von Feingefühl.
Jener für uns unerfreuliche Aufenthalt auf der Insel Vulcano war für dich eine zukunftsweisende Etappe. Wie ein Samenkorn, das unter der Erde liegt, aber dennoch weiß, in welche Richtung es keimen muss, um das Licht zu finden, hast du dich durch die Versenkung in die schwer greifbare Komplexität der Veden deinem Ursprung genähert, der stets in deinem Inneren präsent war, aber den du bis dahin nicht zu benennen vermochtest.
Vielleicht besteht der Reichtum der Welt in der Vielfalt der Samen. Manche wissen sofort und ohne Zweifel, dass sie dazu bestimmt sind, in entgegengesetzte Richtungen zu wachsen – in die Erde hinunter und zum Himmel empor, mit der Wurzel und mit dem Stiel –, während anderen dieser Impetus zu fehlen scheint, als ob in ihnen die geistige Entsprechung zum Auxin, dem Wachstumshormon der Pflanzen, fehlen würde, sodass sie ihr Dasein in der Finsternis des Bodens verbringen, ohne sich nach oben oder unten zu orientieren, ohne jemals Leben zu zeugen, überzeugt davon, dass diese dunkle Einförmigkeit das ganze Universum verkörpert.
Am Tag vor unserer Abreise von der Insel kam natürlich die Sonne heraus.
»Es wäre schön, einen Schneidetisch für die eigenen Erlebnisse zu haben«, bemerkte euer Vater, »einfach auf einen Knopf drücken und alles zurückspulen!«
Du schienst wehmütig dreinzublicken, vielleicht, weil es dir leidtat, den Ort zu verlassen, an dem du begonnen hattest, einen Teil deiner Identität zu entdecken, während Ginevra es kaum erwarten konnte, in ihre gewohnte soziale Umgebung zurückzukehren. Die Geselligkeit war immer ihr Lebenselixier, und das hat sie bestimmt nicht von mir geerbt. Auch wenn meine Herkunft eine ganz andere ist als die deine, bin ich überzeugt davon, ebenfalls schon im Mädchenalter die Existenz des Samdhya gespürt zu haben, und dieses Bewusstsein hat bei mir für ein ständiges Gefühl des Unbehagens gesorgt. Was andere Menschen für perfekt oder sogar beneidenswert hielten, war es für mich keineswegs; in den meisten Situationen verspürte ich Beunruhigung oder Furcht, und dieses Unwohlsein konnte ich nicht in Worte fassen.
Von diesem ungemütlichen Urlaub ist mir noch eine weitere Szene in Erinnerung geblieben. Bei der Rückfahrt mit der Fähre hatten wir unter Deck Schutz vor den nunmehr stechenden Sonnenstrahlen gesucht, während du zusammen mit Ginevra draußen an der Reling geblieben warst, wo der Wind eure Haare zerzauste. Ihr habt euch angeregt unterhalten und seid dabei häufig in Lachen ausgebrochen. Ihr wart so strahlend schön, wie Mädchen es am Anfang ihres Lebens sein können.
Als ich euch so sah, spürte ich einen Augenblick lang eine plötzliche innere Gelassenheit. Eure ständigen Wortgefechte, Streitereien, Launen und Verstimmungen würden vielleicht eines Tages enden, weil ihr erwachsen geworden sein würdet und endlich entdeckt haben würdet, wie schön und wichtig es ist, gut miteinander auszukommen.
In jenem Jahr bekam Ginevra die einzige Ohrfeige, die ich ihr jemals gegeben habe. Ich hatte nie geglaubt, zu solch einer Geste fähig zu sein. Ich erinnere mich noch genau an ihren verblüfften Gesichtsausdruck und die Mauer des Schweigens, die auf einmal zwischen uns stand. Ich weiß nicht, ob deine Schwester dir jemals von diesem Vorfall erzählt hat; auch ich hatte ja nie den Mut dazu.
Warum ich es getan habe? Weil die Worte, die unvermittelt aus ihrem Mund kamen, den Pfeilen ähnelten, die ein treffsicherer Bogenschütze abschießt: schnell, schneidend und in der Lage, ein Herz zu brechen. Der Auslöser dafür war eine Lappalie. Wie so häufig war sie der Auffassung, wieder einmal zu kurz gekommen zu sein, weil du angeblich mehr oder etwas Besseres erhalten hattest als sie.
»Es ist nur deine Schuld, dass wir von ihr genervt werden. Du und deine Manie, jeden retten zu wollen! Mussten wir sie wirklich zu uns nach Hause holen?«
Es gibt bestimmte Parasiten, die durch die Haut in den menschlichen Körper eindringen und lange Zeit im Inneren des Gastgewebes im Stillen aktiv sind. Wenn sie sich schließlich bemerkbar machen, ist die Zerstörung bereits weit fortgeschritten. Auf dieselbe Weise steckt jener vergiftete Pfeil noch immer in meinem Herzen, auch wenn der Muskel seine Aufgabe weiterhin mit rührender Regelmäßigkeit erfüllt hat.
Alles schien normal zu sein, aber nichts war es mehr.
Während des Zweiten Weltkriegs war eine Bäuerin, die Tante eines alten Freundes von mir, von einer verirrten Kugel getroffen worden und hatte ihr ganzes Leben mit diesem Geschoss in ihrem Körper verbracht. Als ein Arzt es viele Jahre nach der ursprünglichen Verletzung entdeckte, war er klug genug einzusehen, dass es besser war, es dort zu lassen, wo es war. Dieses kleine Metallobjekt hatte sich mittlerweile perfekt in den Organismus integriert; eine Operation durchzuführen, um es zu entfernen, hätte das erreichte Gleichgewicht gefährdet. Also trug die Frau ganz gelassen die Kugel bis ins Grab mit sich herum. Als ich meinen Freund fragte, ob sie dabei Schmerzen gehabt habe, sagte er: »Sehr wahrscheinlich, aber damals maßen die Menschen dem Schmerz keine große Bedeutung bei.«
Entstehen denn nicht auch Perlen durch die Präsenz eines Fremdkörpers, der sich in eine winzig kleine Kugel voller Licht verwandelt? Und entstehen denn nicht viele der Krankheiten, die uns mit zunehmender Heftigkeit heimsuchen, durch denselben Vorgang? Etwas verwundet uns, aber wir ziehen es vor, dieser Wunde keine Aufmerksamkeit zu schenken. Da sie weder blutet noch sich infiziert, vergessen wir sie bald und leben weiter, als wäre nichts geschehen, während im Lauf der Zeit weitere Wunden hinzukommen. Erst wenn uns der Körper in seiner unendlichen Weisheit zuruft, dass es nun zu viel wird, bekommen wir es mit der Angst zu tun, aber in diesem Stadium ist es schwierig, etwas rückgängig zu machen und einen Knoten aufzulösen, der sich vor langer Zeit in uns gebildet hat. Wo ist das Ende des Knäuels? Wir sind zu Gefangenen eines chaotischen Gewirrs geworden und haben immer weniger Zeit, es zu entflechten.
Ich glaube, dass es keinen Menschen gibt, der diesen Prozess nicht durchläuft; der einzige Unterschied besteht darin, dass nicht alle sich dessen bewusst sind. Natürlich kann man sein Scheitern immer anderen zuschreiben, aber nur, wenn wir uns selbst ins Auge fassen, können wir den genauen Zeitpunkt identifizieren, an dem das Sandkörnchen, das den Mechanismus blockiert hat, in unsere Organe gelangte.
Um noch einmal auf jene Ohrfeige zurückzukommen, muss ich zurückblicken in das Jahr 1976, in mein achtzehntes Lebensjahr, aber bevor ich mich in diese Dunkelheit wage, benötige ich die Anrufung des Shivasankalpa.
Kannst du dich noch an diesen Begriff erinnern? Du hattest ihn während deiner im Zeichen des Hinduismus stehenden Woche auf der Insel Vulcano entdeckt. Am Nachmittag vor unserer Abreise hatte der Himmel begonnen, sich zu öffnen, und die Sonnenstrahlen waren wie Lichtschwerter durch die dicken schwarzen Wolken gedrungen, bis sie diese in die Flucht geschlagen hatten. Bei Sonnenuntergang saßen wir in unserem kleinen Garten, während auf dem Hausdach ein einsamer Spatz aus voller Kehle sang; du fandest es lustig, als ich zu dir sagte, es müsse derselbe Vogel wie in dem Gedicht sein, das du in der Mittelstufe gegen deinen Willen auswendig lernen musstest.
»Ich dachte, er sei braun …«, hattest du bemerkt, während du ihn betrachtetest.
»Und dass er vielleicht nur in Recanati zu finden sei, wo der Dichter ihn bestaunt hat?«
Du hattest gelächelt.
Als das trübe Grau des Regens verschwunden war, leuchtete in der umliegenden Landschaft wieder das Gold des Ginsters zusammen mit dem Rot der üppigen Bougainvillea, die an den Häusern emporrankten, während unser Garten aufgeheitert wurde durch die reiche Blüte des Hibiskus, um den die Hautflügler summten, die sich nun wieder von dessen Pollen und Nektar ernähren konnten. Der Vulkan ragte endlich in seiner ganzen unheimlichen Majestät vor uns auf, beleuchtet von der untergehenden Sonne, die bereits halb im Meer versunken war.
»Samdhya«, flüsterte ich und ließ das Gefühl dieses Augenblicks von der Stille tragen. Ein paar Grillen hatten angefangen zu zirpen.
»Alles ist jetzt so schön«, hattest du gesagt, »das Licht, die Blumen, das Meer. Schönheit macht glücklich, nicht wahr?«
»Ja, sehr glücklich.«
Zum ersten Mal seit unserer Ankunft hatten wir im Garten zu Abend essen können. Um uns herum war eine wahre Symphonie nächtlicher Insekten zu hören, nur hin und wieder kurz übertönt vom Lärm des knatternden Auspuffs eines Mopeds. Es gab keinerlei Spannungen zwischen uns. Elia hatte die Anwesenheit der Geckos entdeckt und beobachtete fasziniert ihre schnellen Bewegungen, mit denen sie die unvorsichtigen Nachtfalter fingen, die um die Lichtquellen herumflatterten.
Als ich nach dem Essen das Geschirr spülte, bist du mit deinem Buch der Veden in der Küche aufgetaucht; mit dem Finger zwischen den Seiten hattest du eine Stelle markiert. »Hier ist ein weiteres Wort, das ich dir sagen wollte: Shivansa … kalpa … nein, Shivasankalpa.«
»Shivakalampaka?«, lautete mein unbeholfener Versuch, dies zu wiederholen.
Du bist in Lachen ausgebrochen und hast für mich die Silben extra langsam und deutlich ausgesprochen: »Shi-va-san-kal-pa! SHI-VA-SAN-KAL-PA!«
Ich habe gleich aufgegeben. »Ich glaube nicht, dass ich es jemals schaffen werde, dieses Wort zu erlernen. Was bedeutet es?«
Woraufhin du mir wieder etwas vorgelesen hast:
Gewährung der Gnade. Wendet euch an einen unsichtbaren Führer, damit er euch die geistliche Gnade spendet, denn ohne diese Gnade kann man weder richtig denken, handeln, wirken noch beten.
Zu allem, was im großen Maßstab existiert, gibt es eine Entsprechung im Kleinen. So wie sich in den Galaxien schwarze Löcher bilden, die alles schlucken, was sich ihren Umlaufbahnen nähert, tun sich auch in unseren kleinen Leben manchmal Abgründe auf, die uns verschlingen können. Wenn wir jung sind, sind wir nicht in der Lage, das zu bemerken, aber wenn die Zeit vergeht und wir zurückblicken, erkennen wir, dass die dunkle Macht der Antimaterie uns in ihre unsichtbaren Strudel hineingezogen hat. Und ist diese Kraft denn nicht jene, die völlig ohne unser Wissen in einem bestimmten Augenblick die Kontrolle über unser Leben übernommen hat und es in Richtung immer unwegsamerer Straßen gedrängt hat? Es fällt uns nicht auf, dass der Pfad immer schmaler wird, dass sich um uns herum immer mehr furchterregende Schluchten auftun, weil unsere Gedanken und unser Blick ganz woanders sind; erst wenn wir aus dem erwachen, was nur ein Traum gewesen zu sein scheint, merken wir, dass wir ganz allein am Rande eines Abgrunds stehen. Wir können nicht umkehren, weil wir den von uns zurückgelegten Weg aus dem Gedächtnis verloren haben; wir können nicht um Hilfe rufen, weil niemand uns hören würde: Absolute Einsamkeit ist die Chiffre eines jeden Schlunds.
Gibt es Leben, die dem Sog des schwarzen Lochs entkommen können?
Leben, die durch Schicksalsfügung, durch Gnade oder Glück von dieser unheilvollen Anziehungskraft verschont bleiben?
Wer kann diese Frage beantworten?
Wahrscheinlich niemand.
Aber vielleicht lässt sich das, was sich zusammenbraut, schon aus der Herkunft erahnen, aus dem, was vorher geschehen ist und was, selbst wenn wir es nicht wissen, den Grad der Stabilität in unserem Leben bestimmt.
Warum ich dir das alles erzähle, Ali?
Weil du das älteste meiner Kinder bist, weil du auf eine gewisse Weise dank deiner Beziehung zu Luca – »Er ist genau der Richtige«, sagtest du eines Tages mit strahlenden Augen zu mir – bereits in die Lebensphase einer erwachsenen Frau eingetreten bist, mit all der Verantwortung, den Lasten und den Risiken, die das mit sich bringt. Und außerdem, weil deine Abstammung, die Welt, die dir vorausging, das völlige Gegenteil meiner eigenen Vergangenheit darstellt. Niemand weiß, wo du geboren wurdest, niemand weiß, wann, niemand weiß, wer deine Eltern waren. Von Anfang an war dein Leben von Entbehrungen geprägt. Als du deine Augen geöffnet hast, lag vor dir nur ein Feld aus Steinen, das du barfuß überqueren musstest.
Als ich auf die Welt kam, lag vor mir ein prächtiger englischer Rasen, weich und angenehm wie der feinste aller Teppiche, während auf meinen Schultern viele Generationen bekannter Gesichter lasteten, von denen einige mich finster von großen Gemälden an den Wänden aus beobachteten. Sobald ich jedoch loslief, wurde mir klar, dass dieser wunderbare Rasen nichts weiter war als ein schlichtes grünes Tuch, das auf den Boden gelegt worden war, um die scharfe Schroffheit eines Karstgeländes zu verbergen.
Du wurdest also mit einer Leere im Rücken geboren und hattest vor dir die Strapaze eines Weges ohne Umarmung, ohne Zärtlichkeit, ohne alles, was ein Kind glücklich macht. Ich wurde mit dem Ballast eines über Jahrhunderte nachverfolgbaren Stammbaums geboren. Ich bin das Ergebnis einer naturgegebenen Routine: Die Familie sah einen Erben vor, und ich war die Erbin; es gab ein leeres Feld, und meine Pflicht war, es zu besetzen.
Im ersten Teil meines Lebens musste ich begreifen, dass jener englische Rasen eine bloße Fiktion war; es war ein langer und schmerzhafter Lernprozess, durch den ich die Fähigkeit erwerben musste, zu unterscheiden zwischen dem Wahren und dem Falschen, dem Wichtigen und dem Unwichtigen, während deine Aufgabe darin bestand, dir alles von Anfang an zu erkämpfen.
Nach herkömmlichen Maßstäben hättest du, ein ausgesetztes Kind, das im erbarmungslosen Umfeld der Straße aufwuchs, unglücklich sein und zahlreiche Probleme haben müssen, wohingegen ich, ein Kind, dem alles in die Wiege gelegt wurde, immer unbeschwert und erfolgreich hätte sein müssen.
Stattdessen lief es genau umgekehrt.
Du besitzt ein völlig heiteres Gemüt, ich jedoch habe einen großen Teil meines Lebens unter düsteren Qualen gelitten.