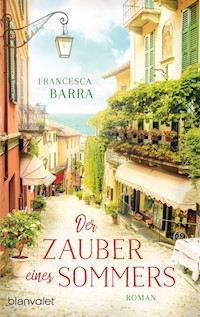
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Wilde Landschaft, wunderschöne Küsten und ein folgenreiches Wiedersehen ...
Sommer, das ist die Zeit der Freiheit und des schwerelosen Glücks. Nicht so für Giulia und Lorenzo, denn die beiden müssen zwei lange Monate in Maratea verbringen, der Heimat ihrer Mutter, zu der sie keinerlei Bezug haben. Doch selbst sie bleiben nicht unberührt vom Zauber des Südens und der traumschönen Landschaft, wo wilde Lakritze wuchert und das tiefe Purpur des Oleanders leuchtet. Aber auch hier, mitten im Paradies, warten dunkle Erinnerungen, die von einer Liebe erzählen, die vor vielen Jahren drei Schwestern entzweit hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Ähnliche
Buch
Sommer, das ist die Zeit der Freiheit und des schwerelosen Glücks. Nicht so für Giulia und Lorenzo, denn die beiden müssen zwei lange Monate in Maratea verbringen, der Heimat ihrer Mutter, zu der sie keinerlei Bezug haben. Doch selbst sie bleiben nicht unberührt vom Zauber des Südens und der traumschönen Landschaft, wo wilde Lakritze wuchert und das tiefe Purpur des Oleanders leuchtet. Aber auch hier, mitten im Paradies, warten dunkle Erinnerungen, die von einer Liebe erzählen, die vor vielen Jahren drei Schwestern entzweit hat …
Autorin
Francesca Barra, geboren in Policoro, einem Ort in der Provinz Matera, ist ihrer Heimat sehr verbunden und macht sie regelmäßig zum Schauplatz ihrer Romane. In Italien ist sie eine bekannte Journalistin für Film, Fernsehen und Radio und arbeitet außerdem als Drehbuchautorin. Nach ihrem Debüt »Ein italienischer Sommer« erscheint 2019 ihr neues Buch »Der Zauber eines Sommers« bei Blanvalet.
Von Francesca Barra bereits erschienen
Ein italienischer Sommer
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Francesca Barra
Der Zauber eines Sommers
Roman
Deutsch von Ingrid Ickler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »L’estate più bella della nostra vita« bei Garzanti S.r.l., Milano. Gruppo editoriale Mauri Spagnol.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2017 by Francesca Barra
Published by Arrangement with S & P Literary – Agenzia Letteraria Sosia & Pistoia
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Hanne Hammer
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
KW Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-22250-5V002
www.blanvalet.de
Für Emma Angelina und Greta, meine kleinen Frauen.
Für Renatos Sommer. Für alles Schöne, was noch bevorsteht.
Für Darinka, meine Vertraute.
Ein Dorf braucht man, und sei es nur für die Genugtuung, wieder von dort fortzugehen. Ein Dorf bedeutet, nicht allein zu sein, zu wissen, dass in den Menschen, in den Pflanzen und in der Erde ein Stück von dir ist, das, auch wenn du nicht da bist, verweilt und auf dich wartet.
CESARE PAVESE
Anna, eine von vielen
Anna die Verletzbare
Anna mit dem schönen Blick
ein Blick der jeden Tag etwas verliert
Wenn sie die Augen schließt, weiß sie
Stern der Vorstadt
Anna mit ihren Freundinnen
Anna, die gerne fortgehen würde
Marco mit den großen Schuhen und sonst ist nichts an ihm dran
Marco mit dem aufgeregten Herz
Mit seiner Mutter und einer Schwester
wenig Leben, immer dasselbe
Wenn er die Augen schließt, weiß er
Wolf der Vorstadt
Marco mit dem Rudel
Marco, der gerne fortgehen würde.
LUCIO DALLA
Prolog
Ida, Beatrice und Rossella werden die drei Timpone-Schwestern von den Leuten in Borgo Felice genannt, die am Abend vor ihren Häusern sitzen und warten. Auf irgendetwas oder auf nichts. Auf irgendjemanden oder auf niemanden. Einfach so, ohne jeden ersichtlichen Grund.
In diesem lukanischen Dorf in der Basilikata, weit im Süden Italiens, drängen sich die bunten Dächer der Häuser und Häuschen aneinander, von hier aus weht der Duft der Geschichten, die sich mit Lichtgeschwindigkeit in dem kleinen Ort verbreiten, weit ins Land hinaus, bevor sie wie eine frische Brise zurückkehren und durch die Fenster wieder in die Häuser dringen.
Von hier kann niemand entfliehen. Nicht einmal der, der wirklich geht.
Weder die, die heimlich ohne Gepäck verschwinden, noch die Pärchen, die das Dorf hinter sich lassen wollen, um ihrer Liebe eine Chance fernab aller neugierigen Blicke zu geben, oder die Jungen, die woanders ihr Glück zu finden hoffen, im reichen Norden vielleicht, in einem Ort, wo man auf sie wartet. Das denken sie, aber durch irgendeinen unerklärlichen Sog wird jeder, der wegzugehen versucht, irgendwann ins Dorf zurückgezogen.
Und jeden Abend, wenn die Dämmerung kommt, treffen sich die drei Frauen an dem Ort, der Mittelpunkt ihres Lebens war und ist: auf den Stufen des Hauses mit der Nummer acht. Ihrem Elternhaus.
Ihre Hüften sind nicht mehr so schmal wie damals in ihren Jugendtagen, und ihre Hinterteile beanspruchen inzwischen mehr Platz auf den alten Stühlen mit den geflochtenen Sitzflächen aus Reisstroh. Hier und da steht ein Halm heraus, vom langen Gebrauch ist das Geflecht durchgesessen, brüchig geworden, zerschlissen, doch sie gehören zur Geschichte der drei Frauen, und keine von ihnen würde je auf die Idee kommen, sie durch neue, bequemere Modelle zu ersetzen. Schon gar nicht durch welche aus Plastik.
Die Stühle, die sie abends vor die Tür stellen, sind unverzichtbarer Teil der Familientradition, seit den Tagen ihrer Kindheit wurde das so gehalten, sie kennen es nicht anders. Es ist Teil eines vertrauten, alltäglichen Rituals. Die Schwestern sitzen dort und schauen auf die Straße, beobachten die Passanten, die vorbeikommen, meist Freunde oder Bekannte, gelegentlich, wenngleich auch selten, Fremde.
Die drei bilden eine Art magischen Zirkel, der sie gegen die Außenwelt abschottet. Den man betrachtet, aber nicht betritt. Dabei sind sie sich eigentlich nicht einmal ähnlich. Sagt man ihnen das, erklären sie einem, dass genau das ein großes Glück und der Grund für ihre enge Verbundenheit sei.
Ida erkennt man daran, dass sie sich im Sommer mit einem venezianischen Papierfächer ständig Luft zuwedelt und dennoch nie genug zu bekommen scheint. Ihre Stimme ist rau, immer wieder stöhnt und jammert sie über die Hitzewallungen der Menopause, jeden einzelnen Abend aufs Neue.
Von Beatrice weiß man, dass sie versucht hat zu fliehen, nach vielen Jahren zurückkam und blieb, um ihren Platz im Kreis der Schwestern wieder einzunehmen. Sie sitzt immer rechts von Ida, mit lässig übereinandergeschlagenen Beinen. Sie trägt keine Strümpfe, egal ob Hochsommer oder der Beginn der kälteren Jahreszeit ist. Man sieht ihr an, dass sie einmal im Norden gelebt hat, denn sie ist anders, kleidet sich auffällig und schert sich nicht um die Meinung der anderen.
Rossella wirkt gegen sie sehr bodenständig, fast altmodisch. Lediglich auf ihre Frisur legt sie großen Wert und ist unentwegt bemüht, ihre krause Mähne irgendwie zu bändigen. Um das zu erreichen, setzt sie sich sogar mit Lockenwicklern auf die Straße. Eitelkeit hat eben ihren Preis.
Wenn man sie so sieht auf ihren Stühlen, die einen Halbkreis bilden, ist sie diejenige, die etwas im Schatten der anderen zu stehen scheint. Sie redet am wenigsten, lächelt meist nur, wenn ihr etwas gefällt, oder schüttelt den Kopf, wenn sie mit etwas nicht einverstanden ist. Stets hat sie ein Buch dabei, entweder sie hält es in den Händen oder sie hat es unter ihr Hinterteil geklemmt, lesen sieht man sie nie, denn die Geschichten, die man abends auf der Straße austauscht, sind viel interessanter als jedes Buch.
»Erinnerst du dich noch, cum’è stat ’u fatt’?«
»Woran?«
»An die Zeit davor.«
»Vor was?«
»Na, vor diesem Sommer, dem schönsten Sommer unseres Lebens.«
»Aber natürlich. Mo’ t’ u dic’.«
»Könntet ihr euch bitte wie zivilisierte Leute auf Italienisch unterhalten?«, pflegt Beatrice dann zu sagen. »Ich habe euch noch nie verstanden und werde euch nie verstehen.«
Auch das ist Routine. Kleine Streitigkeiten, die die Schwestern jedoch nicht daran hindern, sich zu erinnern.
TEIL I
Rossella
1
Wann wir aufgehört haben, glücklich zu sein, weiß ich nicht mehr, aber ich erinnere mich genau, dass die Zeit des Glücks unsere Kindheit war.
Damals riefen die Mütter die Namen ihrer Kinder bei jeder Gelegenheit, wenn sie etwas von ihnen wollten, laut aus den Fenstern oder zur Haustür hinaus. Meist klangen ihre Stimmen nicht gerade liebevoll, sie hörten sich eher nach einem Alarm der Feuerwehrsirenen an. Man fasste den Nachwuchs nicht mit Samthandschuhen an wie heute üblich.
Bereits am Tonfall hörte man, was sie von einem wollten. Sollte man so langsam nach Hause kommen, wurde der letzte Vokal unendlich lang gezogen: »Rossellaaaaaaaaaa.« Wurde hingegen jede Silbe knapp und kurz betont, als ob jemand einem auf die Schulter klopfte wie bei »Ros-se-lla«, dann war es ernst. Das war unumstößlich, da galt es keine Zeit mehr zu verlieren, und es war zwecklos, um Aufschub zu bitten. Musste man hingegen rasch zwischendurch etwas erledigen und durfte anschließend wieder zum Spielen zurück, lag der Akzent auf dem zweiten Vokal: »Rossè.«
Im letzten Fall wollte unsere Mutter Anna meist, dass wir in den Kurzwarenladen liefen, um einen Knopf zu besorgen, der ihr gerade fehlte, oder Garn, denn Mama war Schneiderin, die einzige Maßschneiderin in der Gegend. Manchmal schickte sie uns auch irgendwelche Lebensmittel kaufen. Solche Gänge erledigten wir besonders gerne, denn als Lohn winkten uns drei Bonbons. Eins für mich, eins für Beatrice und eins für Ida. Wir wickelten sie gleichzeitig aus, erfreuten uns an dem knisternden Geräusch des Papiers, das an das Plätschern des Regens erinnerte.
Allerdings waren wir weitgehend Selbstversorger. Wir hatten außerhalb des Dorfes ein Feld, das früher zum Bauernhof unserer Großeltern gehört hatte und das meine Eltern nach dem Tod des Großvaters behalten hatten. Dort standen jede Menge Obstbäume und -sträucher, dort wurde Gemüse angebaut, und dort hielten wir Hühner. Das Brot buken wir zu Hause, die Pasta machte unsere Mutter selbst. So war es damals üblich.
Eine besondere Attraktion war für uns Kinder der Markt, der alle zwei Wochen sonntags stattfand und auf dem man allerlei Trödel kaufen und verkaufen konnte. Wir taten Letzteres.
Auf einer kleinen wackeligen, weil dreibeinigen Kommode, die wir auf die Straße vors Haus schleppten, ordneten wir unsere Schätze an. Gerne hätten wir einen ordentlichen Tisch gehabt, aber Sachen, die noch im Gebrauch waren, durften wir nicht benutzen. Zu sehr fürchtete unsere Mutter, dass wir etwas kaputt machten.
Nicht einmal in der Wohnung war es uns erlaubt, etwas anzufassen. »Vorsicht, bleibt da weg«, hieß es ständig, außer wir mussten Staub wischen. Dann war das Verbot aufgehoben.
Dabei gab es so viele interessante Dinge zu bestaunen. Auf unseren Möbeln türmte sich Nippes aller Art: Bonbonnieren von Taufen und Kommunionfeiern, verschiedene Engel und Glöckchen, die auf Spitzen- und Klöppeldeckchen standen und vieles andere mehr. Die Aussteuer der Bräute aus mehreren Generationen schien dort versammelt, bewacht von streng blickenden Menschen auf alten Familienfotos, an deren Namen sich kaum jemand erinnerte, vor allem wir Kinder nicht.
Signora Maria, die Lehrerin, die ein paar Häuser weiter die Straße hinauf wohnte, war da ganz anders, viel lockerer und großzügiger als unsere Mutter. Sie erlaubte ihrer Tochter Antonella sogar, an den Markttagen einen ordentlichen Tisch mit einer schönen weiß lackierten Holzbank davor aufzubauen. Mit dem Resultat, dass ihr Verhalten sofort von den Dorffrauen kritisiert wurde.
»Hoffentlich macht sie die Bank wenigstens sauber, bevor sie sie wieder ins Haus zurückstellt.«
»Was willst du eigentlich? Sie ist eine aus der Stadt und wird andere Gewohnheiten haben.«
»Sauberkeit bleibt Sauberkeit, das ist auf der ganzen Welt so.«
»Warst du schon mal bei ihr zu Hause? Sie hat immer die Rollläden offen – wie viel Staub da reinkommt.«
»Nein, ich war noch nie bei ihr, mir fällt bloß auf, dass sie keine Gardinen an den Fenstern hat. Nicht einen einzigen Vorhang, stell dir das vor. Angeblich hat sie es gerne hell.«
»Licht bringt Hitze und Staub mit sich. Himmel Herrgott, das weiß schließlich jeder. Außer ihr anscheinend.«
»Vielleicht macht sie das ja, weil sie die Hausaufgaben lesen und korrigieren und viel schreiben muss«, fügte eine andere Nachbarin hinzu, die etwas toleranter war.
»Ach, die Glückliche, sie hat Zeit zum Lesen! Kein Wunder, sie muss sich ja nur um ein Kind kümmern.«
Ich fand es immer gemein, dass alle so abfällig über eine Frau sprachen, die ich insgeheim sehr bewunderte, und ihre Verachtung auch Antonella spüren ließen.
»Los. Nimm das!«, sagte meine Schwester und riss mich aus meinen Gedanken.
Sie drückte mir ein paar Umlegekragen und diverse Haarreifen in die Hand, die mit Satin überzogen und mit Perlen besetzt waren und die ich nicht trug, weil sie mir hinter den Ohren zwickten. Zu meinem Ärger bestand Mama hartnäckig darauf, dass ich sie trotzdem aufsetzte, damit ich einigermaßen ordentlich aussah. Deshalb tat ich alles, um mich ihrer zu entledigen, indem ich sie verbog, zerbrach oder sie, wie jetzt, zu verkaufen suchte. So viel zum Thema Haarreifen.
Bei den Kragen handelte es sich um eine Erfindung unserer Mutter. Sie waren Teil der Schuluniform und wurden ausgetauscht, sobald sie verschwitzt oder verkleckert waren. Auf diese Weise brauchte man die Kittelschürzen nicht so häufig zu waschen wie die mit fest angenähtem Kragen. Inzwischen hatte sich daraus ein kleines Geschäft entwickelt. Die einfachen weißen Modelle verkaufte Mama für zweitausend Lire, die mit Blumen oder Bienen bestickten kosteten fünfhundert Lire mehr. Wenn sie entdeckt hätte, dass Ida sie auf dem Markt unter der Hand für tausend Lire verscherbelte, hätte sie meine Schwester mit einem Pantoffel auf den Kirchturm gejagt und anschließend verprügelt.
»Du bist verrückt … Wenn Mama das merkt, blüht dir was«, mahnte ich sie oft.
Ida zuckte die Schulter. »Vielleicht kapiert sie dann endlich, wie peinlich es ist, dass wir keinen richtigen Tisch haben. Mit irgendwas müssen wir ja von diesem ärmlichen Stand ablenken.«
Und tatsächlich wurden uns die Kragen beinahe aus der Hand gerissen.
»Weiß eure Mutter eigentlich, dass ihr die hier verkauft?«, fragte uns hin und wieder eine Nachbarin, die ahnte, dass dieses Sonderangebot nicht in Signora Annas Sinn war.
»Natürlich«, pflegten wir lächelnd in der Gewissheit zu antworten, dass unsere Mutter viel zu sehr mit ihrer Näherei beschäftigt war, um sich um unsere Verkäufe zu kümmern. Erst wenn das Rattern der Maschine verstummte und ein Kontrollgang drohte, versteckten wir die Kragen rasch.
Ein weiterer Verkaufsschlager war die selbst gemachte Limonade unserer Großmutter, die wir in Plastikbechern ausschenkten. Zwar wurde sie schnell wässrig, weil wir immer neues Eis zugeben mussten, aber in der feuchten Sommerhitze, die in unserem nach Süden gerichteten Bergdorf herrschte, störte das niemanden, zumal die Bar des Ortes ein gutes Stück bergauf lag. Und das war es niemandem in der Sonnenglut wert.
Übrigens war meine Großmutter ein fester Bestandteil unserer Markttage. Unbeweglich saß sie, mit einem Taschentuch über dem Kopf, vor dem Haus in ihrem Korbstuhl und wirkte mehr tot als lebendig.
Nach dem Tod des Großvaters hatte sie ihre Kleider mit Tinte in Töpfen über dem Herdfeuer schwarz gefärbt, um fortan Trauer zu tragen. Allen anderen Farben hatte sie auf ewig abgeschworen, desgleichen jedem Lächeln in der Öffentlichkeit. Selbst die Schürzen über den knöchellangen Tuchröcken, die sie sommers wie winters trug, waren schwarz wie die Nacht. In der großen, rechteckigen Tasche hatte sie früher, als sie noch mit ihrem Mann auf dem eigenen Bauernhof lebte, den schweren Schlüsselbund für Haus und Stall verwahrt, der jetzt wie eine Reliquie in ihrem Zimmer neben dem kleinen Bild der Madonna della Stella sowie dem Foto ihres Heimatorts San Costantino Albanese und einigen Pappmascheepuppen hing, einer Erinnerung an das Nusazit-Fest, das man in ihrem Dorf gefeiert hatte. Inzwischen befanden sich in der Schürzentasche lediglich ein großes Stofftaschentuch und ein Kartenspiel.
Traditionen wurden in unserer Familie hochgehalten. Von allen außer von Beatrice, die sich nicht dafür interessierte. Genauso wenig wie für die Geschichten, die Großmutter uns wieder und wieder erzählte. Meine mittlere Schwester lebte nämlich von Kindheit an in der ständigen Erwartung, endlich aus der Enge unseres Dorfes befreit zu werden. Deshalb kam ihr alles, was mit der Vergangenheit und mit Erinnerungen zu tun hatte, verstaubt und überholt vor, war nichts als lästiger, überflüssiger Ballast für sie.
»Du kritisierst alles und jeden, schaust zu viel fern und träumst von einem besseren Leben in einer großen Stadt. Das ist es, was dir im Kopf herumspukt«, hielt ich ihr manchmal vor.
Darüber hinaus war Beatrice die einzige von uns Schwestern, der es peinlich war, auf dem Markt zu verkaufen. Im Grunde schämte sie sich für alles: für die schäbige Kommode, die uns als Stand diente, für die altmodische Großmutter, die wie ein Relikt aus einer vergangenen Zeit wirkte, und sogar für unsere Mutter, weil sie als Schneiderin für andere arbeitete, statt sich selbst und uns auszustaffieren. Ein steter Stein des Anstoßes war für Bea überdies, dass sie die abgelegten Kleider ihrer älteren Schwester tragen musste. Nicht unbedingt weil sie hässlich gewesen wären, sondern weil sie ihr nicht wirklich passten, denn sie war ein ganz anderer Typ und hatte einen völlig anderen Körperbau.
Ida, die Älteste von uns dreien, wies mit ihren fast zwölf Jahren bereits weibliche Formen auf und war insgesamt etwas rundlich. Beatrice dagegen war dürr und groß mit einem Schwanenhals und Beinen wie eine Gazelle. Ich, das Schlusslicht, lag irgendwo dazwischen. Hatte weder Kurven noch Kanten, war nicht groß und nicht klein, nicht dürr und nicht rundlich, und obwohl ich keineswegs besonders hübsch war, sahen an mir selbst abgelegte Kleidungsstücke noch immer gut aus. Ich war ein Kind aus Wachs, formbar, wie man es brauchte, und hätte gut eines der Mädchen aus dem Versandhauskatalog sein können, der gerade bei uns der Hit war.
Denn selbst wenn man keine neuen Sachen bestellte, war der Katalog von Postal Market eine Bereicherung für den dörflichen Modegeschmack, eine Quelle der Inspiration. Dort holten sich die Frauen Anregungen aller Art, ob sie sich nun ein neues Kleid schneidern ließen oder eine neue Frisur ausprobieren wollten. Ich erinnere mich, dass die Friseurin, die von Zeit zu Zeit zu Mama ins Haus kam und ihr die Haare machte, immer einen Katalog dabeihatte, den meine Mutter dann ausgiebig studierte. Vermutlich war sie darin auch auf das kupferfarbene Haarspray gestoßen, dessen Geruch ich besonders liebte.
Überhaupt die Haare.
Ich selbst hatte ungebärdige Naturlocken, die immer ziemlich wild aussahen, und träumte deshalb von glatten Haaren mit einem Pony. Genauso glatt wie die der Models oder wie die von Antonella. Trotzdem ging meine Eitelkeit nicht so weit, dass ich meine Haare wie Bea mit einem heißen Eisen glättete, um meiner Wunschfrisur näher zu kommen. Ein Grund mehr für sie, ständig an mir und Ida herumzunörgeln, weil wir ihrer Meinung nach zu wenig auf unser Äußeres achteten.
»Ihr solltet euch mehr pflegen«, gehörte zu ihren Lieblingssätzen.
Sie selbst war extrem auf ihr Äußeres bedacht, trug auf dem Markt stets ihr bestes Sonntagskleid und spazierte stolz wie ein Pfau durch die Menge, als wäre sie eine Kundin und hätte mit unserem armseligen Stand nichts zu tun. Und wahrscheinlich schämte sie sich neben allem anderen auch für uns.
Dass wir überhaupt etwas verkauften, verdankten wir in erster Linie dem Erfindungsreichtum meiner Schwester Ida. Sie hatte sich das mit den Kragen zu Dumpingpreisen ausgedacht, und desgleichen war sie auf die Idee gekommen, Spitzendeckchen oder Ohrringe in Form von Fischen zu fertigen, wie Mama es ihr beigebracht hatte. Seitdem sie es beherrschte, produzierte sie Dutzende davon, die reißenden Absatz fanden.
Vielleicht war es Bea nicht bewusst, aber sie war die geborene Händlerin und besaß einen ausgeprägten Geschäftssinn, der ihr vermutlich bereits in die Wiege gelegt worden war. Sie pries jedes Stück an, als wäre es einzigartig und ein absolutes Muss. Eine Strategie, die sie damit noch verstärkte, dass sie augenzwinkernd einen Preisnachlass gewährte, den sie von vornherein einkalkuliert hatte. Oder dass sie Kindern Bonbons anbot, um die Mütter zum Kaufen zu verleiten. Oder sie verteilte Plastikfußballer aus den Mulino-Bianco-Packungen, die besonders bei kleinen Jungs gut ankamen.
Währenddessen saß ich neben der Großmutter auf einem wackeligen Strohstuhl und langweilte mich. Saß da wie eine Geisel, die nicht wusste, was das Schicksal für sie bereithielt. Oft hatte ich ein Comicheft oder ein Buch dabei und klapperte mit den Absätzen meiner Holzclogs, sodass es sich anhörte wie spanische Kastagnetten.
Meine Schwestern fühlten sich prompt gestört und gaben mir einen Klaps: »Du nervst, Rossè.«
Trotz Idas Bemühungen verkauften wir immer noch weniger als Antonella, obwohl deren Auswahl gar nicht so groß war. Vermutlich lag es daran, dass ihre Sachen hochwertiger waren und sie mehr Geld dafür verlangen konnte wie etwa für Taschen und Klamotten von Best Company oder für Barbieschuhe. Die Micky-Mouse-Hefte hingegen waren nicht teuer, jedoch ein Selbstläufer.
»Vielleicht sollten wir uns mit ihr zusammentun«, schlug Bea vor. »Ihr Stand ist nicht so ärmlich wie unserer, dafür können wir Idas Kreationen als Bereicherung anbieten. Gemeinsam würden wir bestimmt mehr Kunden anlocken und mehr verkaufen.«
»Und was soll ich dabei machen?«, fragte ich.
»Du bist unser Aushängeschild. Es sei denn, du entscheidest dich, mal was anderes zu tun, als einfach mit der Kasse in der Hand dazusitzen.«
»Antonella verkauft bloß deshalb besser, weil ihr Stand näher an der Ortsmitte liegt«, maulte ich. »Außerdem finde ich sie irgendwie komisch.«
Aber Beatrice ließ nicht locker und versuchte fortan, den Markttag dazu zu nutzen, sich mit Antonella anzufreunden. Sie tat das nicht allein deshalb, weil sie die Mission »Gemeinsam sind wir stark« verfolgte, sondern weil sie hoffte, dass sie, indem sie sich weiter nach oben, näher zum Kirchturm, näher zur Tochter der Lehrerin hin bewegte, selbst mehr im Mittelpunkt stehen und mehr auffallen würde.
Beas Streben nach Ansehen und Anerkennung war trotz ihres noch kindlichen Alters schon stark ausgeprägt, ihre hochfliegenden Träume entfernten sie von allen anderen. Man spürte, dass sie ihre Umgebung verachtete, dass sie aus dem Familiennest ausbrechen wollte. Und aus diesem Grund versuchte sie auch so hartnäckig, sich unserer Nachbarin, die etwas Besseres war, anzunähern.
Signora Maria war völlig anders als unsere Mutter oder die anderen Dorffrauen. Sie sprach keinen Dialekt und unterrichtete Englisch, was uns vermuten ließ, dass sie weitgereist war, etwas von der Welt gesehen hatte, vielleicht Paris oder London. Außerdem kleidete sie sich völlig anders, modischer, eleganter, und ihre Röcke endeten am Knie. Selbst die Einrichtung ihrer Wohnung fiel, dem allgemeinen Gerede nach, aus dem üblichen Rahmen. Bestimmt lagen dort keine Spitzendeckchen auf den Möbeln, da war ich mir sicher.
Zwar stammte die Lehrerin ebenfalls aus dem Süden, jedoch vom Meer und aus einer großen Stadt. Aus Bari, wo es eine Universität gab und jede Menge schöne Geschäfte, in denen man für jede Figur und für jeden Anlass passende Kleider kaufen konnte. Nie würde die Signora bei einer Provinzschneiderin wie meiner Mutter nähen lassen. Für uns war sie wie ein Wesen aus einer anderen Welt, wo das Leben aufregender und offener war.
Ein paar Schritte unterhalb unseres Hauses ließen sich an den Markttagen die Kinder des Schreiners nieder, die Holzreste sowie einige von ihrem Vater hergestellte Gegenstände verkauften. Sie breiteten alles einfach auf dem Bürgersteig aus und saßen wartend daneben.
»Ich würde nie etwas kaufen, das auf dem Boden gelegen hat«, mokierte sich Bea, was sie aber nicht hinderte, ihre Blicke immer wieder dorthin schweifen zu lassen.
Die beiden Brüder gefielen uns, und zwar sehr. Ivan, genannt der Schreckliche, war platinblond und sah aus wie ein Serienkiller. Er ging mit mir in eine Klasse und war der schlechteste Schüler von allen, was aus irgendwelchen, mir unbekannten Gründen, toleriert wurde. Wahrscheinlich war der Lehrer ein entfernter Verwandter der Familie. Während ich jedes Jahr Angst hatte, das Klassenziel nicht zu erreichen, obgleich unter meinen Tests und Hausaufgaben fast immer in roter Tinte »gut« und »sehr gut« stand, schien er es fast darauf anzulegen, nicht versetzt zu werden. Ohne Erfolg. Er wurde mitgezogen. Jahr für Jahr. Erstaunlicherweise war er sehr sauber und gepflegt, was selbst der Schularzt hervorhob, wenn er uns untersuchte, und das nahm mich für ihn ein.
Eigentlich weiß ich nicht, warum ich mich so von ihm angezogen fühlte – mit Sicherheit spielten noch keine sexuellen Regungen mit hinein, jedenfalls keine bewussten. Doch je mehr ich mich davon zu überzeugen versuchte, dass jemand wie ich sich nicht mit einem solchen Deppen abgeben sollte, machte ihn die Tatsache, dass er in meinen Augen ein gepflegter Rebell gegen schulische Zwänge war, immer attraktiver. Es gab Mädchen, die von einem Prinzen auf einem weißen Pferd träumten, wir hingegen hatten Edelschurken wie Ivan als Modelle für geballte Männlichkeit.
Sein Bruder Walter war ein Jahr jünger und schüchterner. Er saß meist mit gesenktem Blick auf dem Bürgersteig und wischte die schiefen Holzteller seines Vaters oder die Flöten in Vogelform sauber.
Im Gegensatz zu Bea und mir würdigte Ida, die inzwischen die erste Klasse der weiterführenden Schule besuchte, die beiden Brüder mit keinem Blick. Dazu fühlte sie sich zu erwachsen, zu abgeklärt und war es wohl auch. Immerhin brachte sie mittlerweile so viel Toleranz auf, Beatrice zu erlauben, sich für uns zu schämen, oder es zu dulden, dass ich in einer Glasblase lebte und mir Geschichten ausdachte, die ich mit meinem angefressenen Bleistift heimlich zu Papier brachte.
Der Markt, und damit die Qual des Verkaufens, endete gegen sechs Uhr nachmittags, wenn die Sonne hinter den Dächern unterging und es rasch feucht wurde. Unsere halbwilde Katze Lakritze kam um diese Zeit immer an die Tür und bettelte um ein wenig Milch und Essen. Die Mütter schoben die Vorhänge vor der Haustür beiseite oder steckten die Köpfe aus dem Fenster und riefen die Kinder ins Haus. Einige halfen, die Stände abzubauen wie etwa die Mama von Antonella. Sie winkte uns freundlich zu, fragte uns, wie der Verkauf gewesen sei, und sagte jedes Mal: »Kommt bei Gelegenheit mal vorbei.«
Ich bin sicher, dass wir alle drei uns wenigstens einmal gewünscht haben, sie wäre unsere Mama, wenngleich wir es uns niemals eingestanden hätten. Einfach so, um zu wissen, wie es wäre, eine moderne Mutter zu haben. Eine, die nicht zu Hause arbeitete, sich nicht immer duckte, sondern aufrecht durchs Leben ging. Die einen anschaute, die einem dabei half, erwachsen zu werden und das Beste aus sich herauszuholen.
Unsere Mutter dagegen trat höchstens wortlos auf die Türschwelle und blieb zwischen den Plastikbändern des Vorhangs stehen wie ein Polyp in seinem Netz. Immer war sie abgelenkt. Entweder musste sie einen Faden einfädeln oder einen Knopf annähen oder im Abendlicht einen Saum kontrollieren.
»Ich sehe nicht mehr so gut wie früher«, pflegte sie sich meist zu beklagen.
Dann, ohne den Blick von ihrem wertvollsten Gut, ihrer Arbeit, abzuwenden, befahl sie uns: »Trasite. Folgt mir.«
2
Unsere Tage wurden von streng verteilten Aufgaben bestimmt, die wir zu erledigen hatten, vor allem abends, wenn alle zu Hause waren. Ida half in der Küche, Beatrice deckte den Tisch, und ich kümmerte mich um Papa und Nonna Pasqualina. Normalerweise zog sie sich vor dem Abendessen in ihr Zimmer zurück und schaute ihre Lieblingstelenovela.
Sie beanspruchte nicht viel Zeit, und ich musste gar nicht viel tun, wenn ich bei ihr war. Ich schaltete den Fernseher aus und hörte mir an, was in Topazio passiert war, jener Serie, in der Grecia Colmenares, seinerzeit ein gefeierter Star, die Hauptrolle spielte.
Großmutter beschrieb mir neu hinzugekommene Figuren, wiederholte ganze Dialoge und Geschichten, als ob die Personen aus der Serie gute Freunde wären.
»Weiß man, wessen Sohn es ist?«
»Ist sie immer noch blind?«
Die Antwort lautete stets: »Morgen.«
»Wie, morgen?«
»Morgen finden wir es ganz sicher heraus.«
Es klang, als würde sie erwarten, dass ich mir die nächste Folge mit ihr zusammen ansah. Ich begriff nicht, dass sie sich nach Gesellschaft sehnte, dabei hätte es mich so wenig gekostet.
Pasqualina Fortunata, genannt Lina, war die Mutter meiner Mama und lebte seit dem Tod von Großvater Mario bei uns im Haus. Sie fiel kaum auf, von der Tatsache, dass sie ausschließlich schwarz trug, einmal abgesehen. Wenn es nicht allzu heiß war, verbrachte sie viel Zeit draußen, saß auf einem Stuhl und starrte auf die Straße, selbst wenn sie menschenleer war. Ich hätte mich niemals getraut, sie zu fragen, an was sie dachte.
Die Leute im Dorf mochten sie, weil sie warmherzig und freundlich war. Und wie allen, die alt waren, begegnete man ihr mit Ehrfurcht, denn die Alten, die immer einen verborgenen Schmerz in sich trugen, verdienten Respekt. So sah man das. Meine Großmutter selbst fand, dass der Name Fortunata nicht gerade ein gutes Vorzeichen gewesen war, zu viel Trauriges hatte sie erlebt.
»Falls du mal eine Tochter hast, gib ihr keinen Namen wie meinen, der ihr Glück bringen soll«, erklärte sie mir. »Oder der für ein Gefühl steht, zum Beispiel Allegra, Heiterkeit, oder den Namen einer Blume oder einer Farbe.«
»Warum nicht, Großmutter? Ich mag Bianca.«
»Dann bekommst du schwarz.«
»Was redest du da?«
»Schau mich an. Ich heiße Fortuna, aber habe ich Glück gehabt? Nein, schließlich habe ich viel zu früh meine Eltern, meinen Bruder und meinen Mann verloren.«
»Dafür hast du uns.«
»Ach«, seufzte sie, »das ist nicht das Gleiche. Das wirst du noch verstehen, wenn du älter wirst.«
Ihre Worte stimmten mich ein wenig traurig, obwohl ich sie irgendwie verstehen konnte.
Sie hatte mir Kartenspiele in allen Varianten beigebracht sowie alle Tricks, die man kennen musste, um zu gewinnen. Eine Passion, die sie mit meinem Großvater geteilt hatte, ihr ganzes gemeinsames Leben lang hatten die beiden miteinander Karten gespielt.
Jetzt war der Fernseher das Wichtigste für sie. Das Einzige, was sie sich in unserem Haus gewünscht hatte, war ein eigenes kleines Gerät gewesen, damit sie in Ruhe ihre Telenovelas schauen konnte. Sie hatte ihn neben die Bilder ihrer verstorbenen Lieben gestellt. Da war der Bruder, der als Kind starb. Ihr Mann, auf einem altmodischen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er fast hinter einem Baumstamm in ihrem Garten verschwand. Da waren ihre Eltern, auf einem zeitlosen Foto, die den Betrachter distanziert und ernst anblickten. Und irgendwelche entfernten Verwandten, die sie in ihre Gebete einschloss und denen sie die ewige Ruhe wünschte.
Ich wartete, bis die Telenovela zu Ende und die Abspannmelodie verklungen war, dann verließ ich sie und schlüpfte ins Zimmer meiner Eltern, wo mein Vater, der in diesem Sommer einen Arbeitsunfall gehabt hatte, geduldig darauf wartete, dass ich ihm beim Ankleiden fürs Abendessen half.
Irgendwie gehörte Papa immer mehr zu mir als zu meinen Schwestern. Ich war diejenige, der er Geschichten erzählte, die er angeblich bei der Arbeit aufgeschnappt hatte, was ich ihm nicht glaubte. Vielmehr war ich überzeugt, dass er sie erfand. Für mich. Jedenfalls beflügelte er meine Fantasie, ließ sich immer neue Schauergeschichten einfallen. Und nie kam er auf die Idee, dass er mir damit Angst einjagen könnte, so viele grässliche Details er auch hinzufügen mochte. Im Grunde waren es Jungengeschichten, und vielleicht war ich für ihn der Ersatz für den Sohn, den er sich gewünscht hatte.
Ihm verdankte ich auch den Stoff für die erste Geschichte, die ich selbst schrieb: das Geheimnis des spukenden Wirtshauses. Ich brachte sie in diesen gemeinsamen Momenten während der Rekonvaleszenz meines Vaters zu Papier. Außerdem gewann ich in diesem Sommer den ersten Preis im Schreibwettbewerb der Schule, woran mein Vater ebenfalls einen gewissen Anteil hatte. Der erste und letzte Preis übrigens, den ich je in meinem Leben bekommen sollte.
Dann kam der Juni, und die langen Sommerferien begannen.
Wie immer verbrachten wir sie zu Hause, weil uns zum Wegfahren das Geld fehlte. Wir kannten es nicht anders, und so träumten wir trotzdem davon, dass es der schönste Sommer unseres Lebens würde, wie wir das immer taten.
Unser Lieblingsspiel war damals die Manga-Serie Ein Supertrio, für drei Schwestern geradezu ideal. Natürlich war ich Love, die Jüngste. Wir schlichen durchs Haus wie Diebe, in Bodys und Leggings gezwängt, damit wir möglichst echt aussahen. Mama schüttelte nur den Kopf, sie verstand nicht, was wir da nachspielten, und ermahnte uns, ihrem Arbeitstisch nicht zu nahe zu kommen, damit ja keine Näharbeiten zu Boden fielen und schmutzig wurden.
»So verrückt, wie ihr herumrennt, wäre das ja kein Wunder«, orakelte sie besorgt.
Im Gegensatz zu ihr, die weder Mangas noch das Supertrio kannte, war Signora Maria voll im Bild. Eines Tages, als sie uns auf dem Bürgersteig entlangsausen sah, sagte sie zu mir: »Du erinnerst mich mehr an Hitomi als an Love.«
Anstatt ihre Worte als Kompliment aufzufassen – immerhin war diese Schwester im Film die schönste –, stimmten sie mich traurig. Weil mir durch diese Äußerung endgültig klar wurde, dass diese Mutter mit ihrer Tochter japanische Animationsfilme anschaute, dass sie sich für ihr Kind interessierte, für seine Spiele und seine Vorlieben.
Und deshalb gab ich nach. Im Juni dieses Sommers wurde Antonella, wenngleich ich nicht viel mit ihr anzufangen wusste, die Vierte in unserem Bund. Leider hatte sie nichts von der Lebendigkeit ihrer Mutter und deren Ausstrahlung. Sie erzählte keine lustigen Geschichten, war nie frech, sie ließ sich bei allem, was wir machten oder spielten, einfach mitziehen. Aber auf diese Weise erhielt ich immerhin Zutritt zu ihrem Zuhause und konnte mir eine Weile vorstellen, die Tochter von Signora Maria zu sein.
Am Ende des Monats, als unser Tagesablauf längst zu einem festen Ritual geworden war, öffnete mir die Lehrerin eines Tages die schwere grüne Holztür, lächelte mich freundlich an und erklärte mir, Antonella sei bereits weg. Sie sah aus, als wüsste sie, dass mich ihre Worte enttäuschen würden.
»Mit wem denn?«
»Mit Ivan und seinem Bruder. Ich glaube, sie spielen Verstecken.«
Diese undankbare, nichtsnutzige Antonella, die einzig und allein das Glück hatte, in der richtigen Familie geboren worden zu sein, hatte genug von uns? Oder hatte sie womöglich verstanden, dass es uns gar nicht um sie ging, nie um sie gegangen war?
Während ich mich auf den Rückweg machte, um meinen Schwestern die Hiobsbotschaft zu überbringen, rief mir Signora Maria nach: »Ihr seid Kinder, da wechseln die Freundschaften schnell. Es ist nicht deine Schuld.«
Später saßen Ida, Bea und ich auf der Treppe unseres Elternhauses, hörten Antonella und die Brüder lachen und versuchten, nicht zu sehr darauf zu achten.
»Was hat sie damit gemeint, dass es nicht deine Schuld ist? Was hast du gesagt oder getan?«
»Nichts, sie hat selbst gesagt, dass ich nichts dafür kann.«
»Trotzdem: Wenn jemand so was sagt, dann steckt etwas dahinter«, belehrte mich Ida.
Wir machten uns gegenseitig Vorwürfe, da wir einfach nicht begriffen, warum Antonella, die es sich am allerwenigsten leisten konnte, Freunde so mir nichts, dir nichts aufzugeben, uns plötzlich den Laufpass gegeben hatte. Dabei hatten wir gedacht, sie komme ohne uns nicht aus, und sie großherzig in unseren Kreis aufgenommen. Jetzt war es genau umgekehrt: Sie hatte genug von uns.
Irgendwann dämmerte es uns, dass sie uns offenbar langweiliger fand als Ivan und Walter, mit denen sie ungezwungen spielen konnte. Wir hingegen waren so damit beschäftigt gewesen, Antonella über ihr Leben und das ihrer Mutter auszufragen, dass wir das Spielen darüber ganz vergessen hatten. Und deshalb hatte sie sich gegen uns entschieden, wollte kein Mittel zum Zweck sein. Dennoch hörten wir kein böses Wort von ihr, und sie grüßte uns weiterhin freundlich. Wer weiß, vielleicht hatte sie das sogar mit ihrer Mutter besprochen.
Wir schämten uns schrecklich, als wir uns ausmalten, wie ein solches Gespräch abgelaufen sein könnte.
»Mama, ich langweile mich mit ihnen. Sie fragen mich immer nur nach dir, nach unserem Urlaub und unserer Wohnung. Wie es bei uns zu Hause aussieht und wie Bari so ist. Und dann wollen sie mir immer ihre blöden Sachen verkaufen, ich habe überhaupt keinen Spaß mit ihnen.«
»Versuch sie zu verstehen, mein Schatz. Sie haben nicht das Glück, das du hast.«
Wie falsch hatten wir die Situation eingeschätzt!
Vor allem ich. Weil ich nicht akzeptieren konnte, dass ich eine Familie hatte, und zwar meine.





























