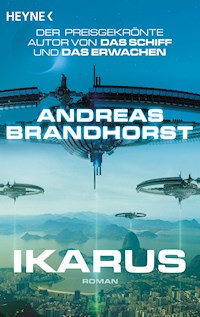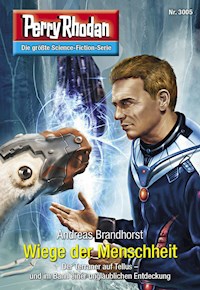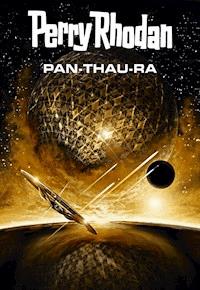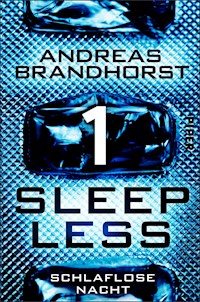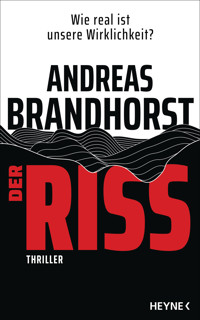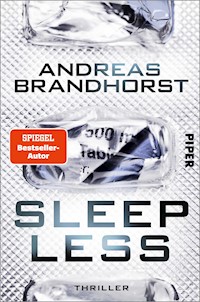9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Band 3 der erfolgreichen Kantaki-Saga! Ein gewaltiger Krieg bedroht die Galaxis – entfesselt von einer uralten feindlichen Spezies, die unwissentlich von Rungard Avar Valdorian aus ihrem Gefängnis befreit wurde. Doch der ehemalige Herrscher über das Konsortium ist nicht länger bereit, den Feinden wie ein Sklave zu dienen – und entschließt sich zur Flucht. Wird es ihm und den Kantaki, den einzigen, die dem Gegner überhaupt noch etwas entgegenzusetzen haben, gelingen, die Temporalen zurückzuschlagen? »Eine Space Opera, die ihresgleichen sucht!« Phantastik-Couch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Prolog
Alle Farben
Transraum, 23. November 499 SN
Ist dies der Tod?, fragte sich Diamant, ohne eine Erinnerung ans Sterben.
Eben hatte sie noch im Pilotensessel von Vater Grars Schiff gesessen, die Hände in den Sensormulden, das Bewusstsein verbunden mit den Bordsystemen des riesigen Kantaki-Schiffes, das sich wie eine Erweiterung ihres Körpers anfühlte. Und nun schwebte sie plötzlich in einem grauen Nichts, umgeben von einer Leere, die mehr darstellte als die Abwesenheit von Dingen.
In dieser Leere, so fühlte Diamant, fehlten Raum und Zeit. Wie sie trotzdem darin existieren konnte, blieb ein Rätsel, aber wichtiger erschien ihr die Frage, ob sie noch lebte.
Etwas veränderte sich um sie herum. Das Grau kontrahierte, zeigte dabei hier und dort erste Farben. Bilder entstanden, und Diamant sah ihr Leben – jeder Moment ein einzelnes Bild, zum Greifen nahe und doch weit entfernt, Szenen einer inzwischen zweihundertdreiundzwanzig Jahre dauernden Existenz.
Sie sah sich selbst als Lidia DiKastro, Studentin der Xenoarchäologie auf Tintiran. Sie sah sich in Begleitung des Magnatensohns Valdorian, der glaubte, Entscheidungen für sie treffen zu können, der sie besitzen wollte. Sie sah, wie sie im Jahr 301 Seit Neubeginn zur Kantaki-Pilotin Diamant wurde und damit relative Unsterblichkeit genoss. Sie sah die Begegnung mit der siebenhundert Jahre alten und doch so jung wirkenden Esmeralda, die ebenfalls Kantaki-Schiffe flog.
Und sie sah Szenen, die nicht Teil ihres Lebens waren, zumindest nicht des Lebens, das sie geführt hatte. Die Bilder zeigten ihr nicht das eine Leben von Lidia DiKastro und Diamant, sondern hunderte, tausende, und jedes von ihnen war nicht weniger real als das, an das sie sich erinnerte. Sie schwebte im Zentrum, von dem Lebensbänder wie die Speichen eines Rades ausgingen, beobachtete zahllose Alternativen von sich selbst, wie lebendige, mit Leib und Seele ausgestattete Spiegelbilder, jedes von ihnen ebenso existenzberechtigt wie alle anderen.
Eine Schere kam.
Tausend Scheren kamen, und noch viel, viel mehr, so viele Scheren wie Bilder, und alle schnappten gleichzeitig zu, zerschnitten die Lebensbänder in ihre einzelnen Szenen, mit einem Geräusch, das wie das Zischen eines herabsausenden Fallbeils klang.
Wind wehte durch das Nichts, ein Sturm, der sich nicht um die Abwesenheit von Zeit und Raum scherte. Seine Böen packten die einzelnen Bilder, wirbelten sie wie welkes Laub auf und vermischten tausend und mehr Leben, verwandelten sie in einen bunten tanzenden Reigen.
Diamant streckte die Hand nach ihnen aus, aber der Wind trug die vielen Bilder fort, fauchte nun auch in den Gewölben ihres Geistes, zerrte dort an Gedanken und Gefühlen.
Die Farben wogten durcheinander, und Diamant spürte, wie sie sich in ihnen aufzulösen begann. Wenn dies nicht der Tod ist, so kommt nur noch Wahnsinn infrage, dachte sie mit einem letzten Rest von klarem Bewusstsein. Die Farben saugten ihr Selbst an, aber der Sog war nicht überall gleich, und er betraf auch nicht ihr ganzes Ich.
Sie kam sich vor wie ein Mosaik, an dem hundert Hände zerrten, jede von ihnen bestrebt, bestimmte Teile zu erlangen. Die Farben … Sie fühlten sich unterschiedlich an; manche von ihnen schienen wirklicher zu sein als andere.
Der Sturm inmitten des Nichts zerfetzte ihr Ich, und sie fiel zurück in tausend Welten.
1 Doppelter Tod und ein Leben
Gelb: Abalgard, 12. Juli 5431
»Das hätte gefährlich werden können«, sagte Lidia DiKastro, seit dreißig Jahren Xenoarchäologin, spezialisiert auf die Hinterlassenschaften der legendären Xurr. Sie trat in den Windschatten eines Felsens und beobachtete die gewaltige Eismasse, die sich vom Gletscher gelöst hatte – sie lag geborsten und gesplittert weiter unten im Tal.
»Ach, das glaube ich nicht.« Lidias Assistent kam näher, wie sie selbst in einen Thermoanzug gekleidet. Sein Gesicht verbarg sich halb hinter einer Atemmaske aus Synthomasse, und die Stimme kam aus einem kleinen integrierten Lautsprecher. »Wir haben das Lager ganz bewusst abseits des Gletschers errichtet, und selbst wenn die abgebrochenen Massen in unsere Richtung gerutscht wären: Die Kontrollservi hätten rechtzeitig den Sicherheitsschild aktiviert; uns wäre nichts passiert.«
Trotz der Atemmaske glaubte Lidia, das Lächeln auf den Lippen ihres Assistenten zu sehen. Der junge Paulus – so lautete sein Vorname; der Nachname bestand aus sechzehn Silben, und sie hatte nie versucht, sich ihn zu merken – war unerschütterlicher Optimist und sah immer alles von der besten Seite. Lidia wusste nicht recht, ob sie ihn deshalb beneiden oder bemitleiden sollte.
Sie beugte sich am Felsen vorbei, in den beißend kalten Wind, der über die eisverkrusteten Grate und schneebedeckten Gipfel des nördlichen Polargebirges von Abalgard fauchte, und blickte über den Hang zum Lager weiter unten, das nur als ein dunkler Fleck auf dem Weiß des Schnees erkennbar war. Winzige Punkte bewegten sich dort: Mitglieder des archäologischen Teams, das hier im hohen Norden nach weiteren Fundstellen von Xurr-Artefakten suchte.
»Sehen Sie sich das an.«
Lidia kehrte in den Windschatten des Felsens zurück und stellte fest, dass Paulus inzwischen weitergegangen war. Er stand zwischen zwei bizarren, wie exotische Gewächse aussehenden Eisformationen und deutete zum Gletscher empor. »Die Abbruchstelle …«
Lidia folgte ihm, trat vorsichtig an scharfkantigen Felsen vorbei und wich Spalten aus. Der Wind pfiff über sie hinweg und wehte lange, rauchartige Schneefahnen von den Graten. Kurze Zeit später verharrte sie neben Paulus, sah wie er nach oben und wusste sofort, was er meinte. Die Abbruchstelle war nicht schartig und ausgefranst, sondern so glatt wie mit einem Strahlbohrer geschnitten. Eine mehr als zweihundert Meter hohe Eiswand ragte vor ihnen auf, und sie war völlig glatt.
Lidia sah noch weiter nach oben, zum fernen Dreigestirn, das blass am grauen Himmel hing. Abalgard beschrieb eine sehr komplexe Bahn um den Tristern, und hinzu kamen nicht minder komplizierte Orbitalmuster der drei eng beieinander stehenden Sonnen. Nach den letzten Berechnungen ging auf dem vierten Planeten dieses ungewöhnlichen Sonnensystems eine Eiszeit zu Ende, die vor mehr als zehntausend Jahren begonnen hatte, zu jener Zeit, als die Xurr verschwunden waren.
»Ich habe schon viele Gletscher gesehen, aber so etwas noch nie«, sagte Paulus. »Man könnte meinen, dass wir hier eine Art Sollbruchstelle vor uns haben.«
Lidia schaltete ihren Individualschild ein, kletterte an Eis- und Felsbrocken vorbei und näherte sich der Eiswand, die allein durch ihre Ausmaße beeindruckte. Das letzte Stück des Weges war recht steil, und Lidia DiKastro, inzwischen fünfundfünfzig Jahre alt, atmete schwer, obwohl die Maske vor ihrem Gesicht die kalte, dünne Luft wärmte und mit Sauerstoff anreicherte.
Als sie dicht vor dem Ende des Gletschers stand, sah sie etwas in seinem eisigen Leib, vage Konturen, wie ein eingefangener Schatten. Erste Aufregung kribbelte in ihr, aber Lidia hielt sie unter Kontrolle. Aus Erfahrung wusste sie, wie leicht Vorfreude zu Enttäuschung führte.
»Ich glaube, da steckt etwas drin«, sagte sie.
»Vielleicht ein eingefrorener Xurr?«, fragte Paulus scherzhaft und kam ebenfalls nach oben.
»Wir wissen, dass die Eiszeit vor mehr als zehntausend Jahren innerhalb kurzer Zeit den ganzen Planeten erfasste – wir sprechen hier von Monaten, nicht von Jahren oder gar Jahrzehnten. Vielleicht wurde die damalige Kolonie der Xurr überrascht. Mit ein wenig Glück …«
Weit oben bildete sich eine Lücke im Grau der dünnen Wolken, und das Licht der Trisonne wurde heller, fiel ungefiltert auf den Gletscher, durchdrang das Eis …
Die Konturen ließen plötzlich eine Struktur erkennen, eine Art Ballon, oben dick und unten dünn, bestehend aus einer fleischartigen Masse, die Lidia von anderen Fundorten kannte: von den Xurr gezüchtetes Gewebe.
»Ist es wirklich das, wonach es aussieht?«, fragte Lidia voller Ehrfurcht.
Der neben ihr stehende Paulus rieb sich die Augen. »Wir kennen die organischen Raumschiffe der Xurr nur von plastischen Darstellungen, aber …« Er schnaufte. »Meine Güte. Vielleicht war es eine Sollbruchstelle. Vielleicht haben die Xurr damals eines oder einige ihrer Schiffe einfrieren lassen, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht nutzten sie die Eiszeit von Abalgard, um sich zu verbergen, vor der Gefahr, die die anderen zur Flucht veranlasste.«
»Die Xurr«, sagte Lidia langsam. »Abgesehen von den Horgh die einzige andere Spezies, die zur überlichtschnellen Raumfahrt fähig war.« Sie lauschte dem Klang der eigenen Worte und stellte verwundert fest, dass sie … seltsam klangen. Etwas schien zu fehlen, eine wichtige Information.
Sie trat noch einen Schritt vor, so dicht an die gewaltige Eiswand heran, dass sie sie mit der ausgestreckten Hand berühren konnte, und dabei gewann sie den verwirrenden Eindruck, ihre Umgebung wie durch eine dünne transparente Membran wahrzunehmen.
»Wenn das Objekt dort drin wirklich ein konserviertes Raumschiff der Xurr ist …«, sagte Paulus leise. »Das wäre eine ungeheure Sensation und … He, was ist das denn?«
Lidia drehte sich um.
Zwischen ihr und Paulus zeigte sich ein schwarzer vertikaler Streifen in der Luft, etwa zwei Meter lang und so dünn wie ein Haar. Er zitterte, schwankte, senkte sich dann dem Boden entgegen. Als er ihn berührte, wuchs der Streifen zu einem Spalt, zu einem Riss in der Luft, und aus seiner Schwärze trat eine Gestalt, in einen schwarzen Kampfanzug gekleidet, das Gesicht hinter dem dunklen Helmvisier verborgen. Sie hob die rechte Hand, richtete eine Waffe auf Lidia und schoss.
Die energetische Entladung traf den Kopf der Xenoarchäologin und tötete sie auf der Stelle.
Orange: Tintiran, 29. März 5416
Levitatoren summten auf der großen Terrasse vor der Villa, und Lidia DiKastro trat neugierig ans Fenster des Blauen Salons, der während der letzten Jahre zu ihrem Zimmer geworden war. Weitere Vehikel näherten sich, zivile Levitatorwagen und Patrouilleneinheiten des Konsortiums. Männer und Frauen stiegen aus, manche von ihnen in Uniformen gekleidet. Als Lidia den Blick hob, sah sie ein großes Sprungschiff der Horgh, das aus den Wolken über dem Scharlachroten Meer kam und dem Raumhafen von Tintiran entgegensank. Sie glaubte zu verstehen.
Mit einem entschlossenen Ruck wandte sich Lidia vom Fenster ab, verließ den Blauen Salon – seit einiger Zeit immer mehr ein Ort der Trauer für sie – und eilte nach draußen. Jonathan versuchte, sie aufzuhalten, aber sie schenkte ihm keine Beachtung, ging einfach an ihm vorbei.
Valdorian wollte gerade in einen Levitatorwagen steigen, als Lidia die Terrasse erreichte. Er sah sie und zögerte.
»Ich möchte mitkommen«, sagte sie.
Valdorian wechselte einen kurzen Blick mit den Männern und Frauen in seiner Nähe. »Dies geht Sie nichts an.«
»Ich bin Ihre Frau«, sagte Lidia. »Was Sie betrifft, geht mich sehr wohl etwas an.« Sie wusste nicht genau, warum sie ausgerechnet diesen Zeitpunkt und diesen Ort wählte. Vielleicht war ein kritischer Punkt erreicht, denn sie ahnte, was Valdorian plante. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte … Die Worte mussten einfach aus ihr heraus. Und es waren nur die ersten. Andere lauerten in ihr, hatten sich während der letzten Jahre in ihr aufgestaut, durch Kummer und Zorn.
»Lidia …« Valdorian kam auf sie zu, gut vierzig Jahre alt, groß und schlank, das Haar ebenso grau wie die kühl blickenden Augen. Sein Gesicht war wie eine Maske, und manchmal fragte sich Lidia noch immer, was sich dahinter verbarg, nach fünfzehn Jahren Ehe. »Dies ist eine Angelegenheit des Konsortiums.«
Sie hatte es satt, von ihm behandelt zu werden wie eine Subalterne, wie ein Objekt, das man ganz nach Belieben benutzen oder zur Seite stellen konnte. Aber diesmal ging es um mehr: Valdorian schickte sich an, Tintiran und die anderen Welten des Mirlur-Systems in Gefahr zu bringen, darunter auch den vierten Planeten Xandor, auf dem ihre Eltern lebten, der Schriftsteller Roald DiKastro und die Pianistin Carmellina Diaz.
Lidia trat ganz dicht an Valdorian heran und sprach so leise, dass nur er sie verstehen konnte. Dennoch mangelte es ihrer Stimme nicht an Schärfe. »Ich habe Ihre Vorbereitungen während der letzten Tage beobachtet. Sie haben mehrere Einsatzgruppen gebildet, und jetzt das Horgh-Schiff … Es geht Ihnen um Viktor, nicht wahr? Oder um einen seiner Gesandten. Die Blassen sind mit den Horgh liiert. Wenn Sie einen von Viktors Leuten umbringen, ziehen Sie sich die Feindschaft der Horgh zu. Dadurch könnte das ganze Mirlur-System in Gefahr geraten.«
Valdorian presste kurz die Lippen zusammen. »Es ist Viktor höchstpersönlich, und er wird Tintiran nicht wieder verlassen. Wir haben unsere eigenen Blassen; von jetzt an werden wir keine Steuern mehr an die Parasiten abführen. Das Konsortium ist stark genug. Wir erklären unsere Unabhängigkeit von der Erde und den Dreizehn Hohen Welten unter der Regentschaft von Viktors Blassen.«
»Und wenn es zum Krieg kommt?«
»Wir gewinnen ihn.«
»Das ist Wahnsinn.«
»Das ist Politik.«
Valdorian drehte sich um und kehrte zum Levitatorwagen zurück. Lidia sah ihm nach, fassungslos und tieftraurig angesichts der bitteren Erkenntnis, dass sie seit anderthalb Jahrzehnten mit einem Mann verheiratet war, den sie überhaupt nicht kannte. Einmal mehr fragte sie sich, was sie damals dazu bewogen hatte, einer Ehe mit Valdorian zuzustimmen. Die Aussicht, an seiner Seite zur Magnatin zu werden und ein Leben »ohne Kompromisse« zu führen, mit der Möglichkeit, sich alle – materiellen – Wünsche zu erfüllen? Vielleicht. Aber sicher hatte es noch mehr gegeben, das wollte sie glauben, selbst aus einem Abstand von fünfzehn Jahren. Doch nichts war davon geblieben, bis auf den … Diamanten, den Valdorian ihr damals geschenkt hatte. Seit langer Zeit hatte sie ihn nicht mehr betrachtet, sein Funkeln nicht mehr bewundert. Er lag jetzt im Sicherheitsfach ihres Schlafzimmers, hinter energetischen Barrieren, ebenso gefangen wie sie selbst.
Lidia blinzelte und stellte fest, dass sich die Terrasse leer vor ihr erstreckte. Die Levitatorwagen und Patrouillenfahrzeuge des Konsortiums waren gestartet, ohne dass sie es bewusst zur Kenntnis genommen hatte.
»Magnatin?« Jonathan stand neben ihr, Valdorians Sekretär, ein unscheinbarer Mann, der zu verschwinden schien, wenn man sich nicht auf ihn konzentrierte.
Lidia drehte sich um. »Bringen Sie mich in die Stadt. Ich … brauche Bewegung.«
Dichte Wolken zogen übers Scharlachrote Meer und brachten einen frühen Abend. Tausende von Lichtern glühten und funkelten in Bellavista; Lidia dachte dabei an eine Ballerina, die ihr Kleid wechselte. An der Grenze von Tag und Nacht gefiel ihr die Stadt besonders, denn sie zeigte sich gleichzeitig von beiden Seiten, die eine ebenso schön wie die andere.
»Haben Sie ein bestimmtes Ziel?«, fragte Jonathan neben ihr.
Lidia bedachte ihn mit einem erstaunten Blick – sie hatte fast vergessen, dass er sie begleitete. Zahllose Gedanken gingen ihr durch den Kopf, wie eigenständige Wesen, die sich ihrer Kontrolle entzogen, und es gelang ihr nicht, sie zu ordnen. Wie verwundert musterte sie den Sekretär ihres Mannes, der zwanzig Jahre jünger als sie war, und aus irgendeinem Grund schien das nicht richtig zu sein. Sie sah kurzes, aschblondes Haar und graugrüne Augen, eine weder zu krumme noch zu gerade Nase, weder zu dünne noch zu dicke Lippen. Irgendetwas in Lidia glaubte, dass dieser so unscheinbare Mann älter sein sollte.
Sie sah sich um und bemerkte das zivile Personal, das sie auf Valdorians Veranlassung hin immer begleitete: bewaffnete Leibwächter, die Passanten daran hinderten, ihr zu nahe zu kommen; medizinische Subalterne, um – falls nötig – Erste Hilfe zu leisten; persönliche Bedienstete, die nur darauf warteten, dass sie einen Wunsch äußerte – das Gefolge einer Dynastin. Lidia hatte längst den Versuch aufgegeben, diese ganz besonderen Fesseln abzustreifen.
»Nein«, beantwortete sie Jonathans Frage, ging weiter und fühlte sich wie in einem Traum, der sie nicht freigab. Dieses sonderbare Empfinden stellte sich seit einigen Wochen immer wieder ein, und Lidia vermutete, dass es auf ihren inneren Konflikt zurückging, der sich verschärfte. Ein Teil von ihr wollte endgültig resignieren und sich mit allem abfinden, auch damit, dass Valdorian sein eigenes Leben lebte, ohne ihr Platz darin einzuräumen. Ein anderer Teil klammerte sich an der Hoffnung fest, dass es eine Möglichkeit gab auszubrechen, den goldenen Käfig des Magnatenlebens an der Seite eines kalten, egozentrischen Mannes zu verlassen und in die Freiheit zurückzukehren, endlich aufzuatmen.
Vor dem halbdunklen Präsentationsfenster eines Geschäfts blieb Lidia stehen und betrachtete die ausgestellten Kunstwerke aus Muscheln und Tintiran-Korallen. Kleine pseudoreale Sonnen umkreisten sie, bildeten dabei schnell wechselnde Muster aus Licht und Schatten, die mehr Tiefe schufen, als tatsächlich existierte. Doch schon nach wenigen Sekunden erregte etwas anderes Lidias Aufmerksamkeit: das eigene Spiegelbild. Sie sah das Gesicht einer Frau in mittleren Jahren, mit großen Augen, eine Mischung aus Smaragd und Lapislazuli, das schwarze Haar lockig und schulterlang – das Gesicht einer Frau, die sich die Schönheit der Jugend bewahrt hatte, ohne eine einzige Resurrektion. Aber es war auch das Gesicht einer Frau, die seit vielen Jahren unglücklich war.
Es donnerte in der Ferne, und als Lidia zum Raumhafen sah, blitzte es dort mehrmals auf.
»Er hat es wirklich getan«, murmelte sie.
Jonathan trat einen Schritt näher. »Magnatin?«
»Valdorian. Er hat Viktor umgebracht.«
Lidia drehte sich um und sah … einen Blassen.
Der Mann stand nur zwei Meter entfernt und hatte es irgendwie geschafft, an den Leibwächtern vorbeizugelangen. Schlank und groß war er, ein ganzes Stück größer als Lidia, und er trug die beigefarbene uniformartige Kleidung eines Sippenbruders der Horgh. Sein Gesicht wirkte völlig blutleer und die geröteten Augen lagen tief in den Höhlen. Wie Viktor und die anderen Blassen zählte er zu den Neuen Menschen: Nur sie waren in der Lage, die geistigen Schockwellen bei den Überlichtsprüngen der Horgh-Schiffe zu ertragen. Alle anderen Passagiere – normale Menschen ebenso wie Taruf, Ganngan, Grekki, Quinqu, Kariha, Mantai und so weiter – mussten die Überlichtphasen der Sprungschiffe im Transitstupor verbringen, und selbst das blieb nicht ohne Risiko. Immer wieder kam es vor, dass trotz des schützenden Stupors jemand den Schockwellen erlag und nie wieder erwachte.
Zwei muskulöse Leibwächter wollten den Blassen zurückdrängen, aber Lidia winkte ab. Neugierig trat sie näher und richtete einen fragenden Blick auf den Mann.
»Sie gehören nicht hierher«, sagte er mit seltsam rauer Stimme, ging ohne ein weiteres Wort an ihr vorbei und schritt am Rand des breiten, mehrstufigen Verkehrskorridors entlang, der wie eine Schlagader den urbanen Leib von Bellavista durchzog. Er verschwand zwischen den anderen Passanten.
Lidia sah ihm nach und glaubte zu beobachten, wie die Konturen ihrer Umgebung verschwammen, als sähe sie alles durch eine dünne transparente Membran. Sirenen heulten in der Ferne, und Levitatorwagen des Konsortiums sausten in den hohen Flugkorridoren zum Raumhafen. Unruhe breitete sich aus.
Etwas veranlasste Lidia, sich in Bewegung zu setzen und immer schneller zu gehen, bis sie fast lief, vorbei an Dutzenden von schwebenden Lampen, an Präsentationsflächen und kleinen Restaurants. Der Himmel war dunkel geworden, und in der Ferne über dem Scharlachroten Meer flackerten die Blitze eines Unwetters.
»Vielleicht sollten wir zur Villa zurückkehren«, sagte Jonathan, der nach wie vor an ihrer Seite blieb.
»Nein«, erwiderte Lidia nur und eilte weiter, durch eine Stadt, die ihr plötzlich immer fremder wurde. Sie sah Verwirrung und Sorge in den Gesichtern der Leibwächter und Bediensteten, achtete aber nicht darauf, während sie weiterhin entschlossen einen Fuß vor den anderen setzte, als ginge es darum, schnell ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen.
»Etwas stimmt nicht«, sagte sie plötzlich. »Warum fliegen Menschen mit den Horgh?«
»Mit wem sollten sie sonst fliegen?«, erwiderte Jonathan sanft. »Die Xurr verschwanden vor vielen Jahrtausenden, und abgesehen von ihnen beherrschen nur die Horgh die überlichtschnelle interstellare Raumfahrt.«
»Was ist mit den …« Lidia suchte nach dem richtigen Wort und schüttelte hilflos den Kopf. Nach einigen weiteren Metern blieb sie stehen und sah sich um. Die Gebäude hinter ihr und zu beiden Seiten entsprachen genau Lidias Erinnerung, aber das Bauwerk vor ihr … Es bestand aus mehreren Kugeln und bot verschiedene Anderswelten an. »Wo ist die Pagode?«
»Die Pagode?«
Lidia zeigte auf das Gebäude, während Leibwächter und Bedienstete sie mit einem lebenden Schild umgeben. »An diesem Ort hat einmal eine … Sakrale Pagode gestanden.«
»Das Andersweltenzentrum existiert seit fünf Jahren«, sagte Jonathan. »Vorher gab es hier einen Gebäudekomplex mit kulturellen Einrichtungen der Taruf, Quinqu und Mantai.« Der Sekretär zögerte kurz. »Geht es Ihnen nicht gut, Magnatin?«
»Eine Sakrale Pagode«, wiederholte Lidia. »Ich bin in ihr gewesen und habe dort …«
Zwei der Leibwächter, die sie umringten, entfernten sich, ohne dass sich ihre Beine bewegten. Der Raum zwischen ihnen und Lidia schien sich zu dehnen, und eine vertikale schwarze Linie entstand in der Luft, etwa zwei Meter lang und haardünn. Verblüfft beobachtete Lidia, wie sie den Boden berührte und breiter wurde, zu einem Spalt in Raum Zeit. Eine Gestalt trat hindurch, gekleidet in einen dunklen Kampfanzug, hob die rechte Hand mit der Waffe …
Ein Leibwächter reagierte und schoss mit einem kleinen Hefok, doch der Strahl zerstob an einem Schirmfeld, das den Unbekannten umgab.
Die Gestalt im Kampfanzug zielte auf Lidia und schoss. Feuer sprang ihr entgegen und verbrannte sie.
Blau: Kantaki-Nexus, 2. Februar 571 SN
»Ist das nicht großartig?«, fragte Esmeralda und lächelte mit der Unbefangenheit eines jungen Mädchens, obwohl sie inzwischen fast tausend Jahre alt war – Kantaki-Piloten alterten nicht, während sie die riesigen schwarzen Raumschiffe durch den Transraum steuerten.
Diamant, inzwischen selbst fast dreihundert Jahre alt und nach ihrem äußeren Erscheinungsbild noch immer eine junge Frau, lehnte sich zurück, und der Sessel drehte sie langsam. Die transparente Kuppel des Observatoriums gewährte ungehinderten Blick ins All – auf der einen Seite hing das Feuerrad der Milchstraße in der Leere, auf der anderen die Andromeda-Galaxis. Der Kantaki-Nexus, in dem sich die beiden Pilotinnen befanden – eine mehrere Kilometer lange, zylinderförmige Raumstation, die den Kantaki als Wartungsbasis für ihre Schiffe und als Kommunikationsknoten diente –, schwebte mitten zwischen den beiden Galaxien im All.
»Ja«, sagte Diamant und lächelte. »Wir sehen in die Vergangenheit. Das Licht, das uns hier von der Milchstraße und dem Andromeda-Galaxie erreicht, ist jeweils mehr als eine Million Jahre alt.«
»Ganz gleich, wo man sich aufhält und in welche Richtung man sieht: Das All ist immer ein Fenster in die Vergangenheit.« Esmeralda lächelte verschmitzt. »Wenn uns ausreichend leistungsstarke Beobachtungsgeräte zur Verfügung stünden, könnten wir vielleicht uns selbst sehen, vor hundert, zweihundert oder mehr Jahren. Würde dir gefallen, was du dann sähest?«
»Ich bereue nichts, wenn du das meinst«, erwiderte Diamant, deren Blick noch immer zwischen Milchstraße und Andromeda-Galaxis hin und her wechselte. »Das mit Valdorian gewiss nicht.«
»Valdorian?«
»Wir haben vor vielen, vielen Jahren zum letzten Mal über ihn gesprochen. Der spätere Primus inter Pares des Konsortiums, der mir damals auf Tintiran einen Ehekontrakt angeboten hat. Er wollte, dass ich seine Frau werde, aber ich habe mich für das Leben als Kantaki-Pilotin entschieden.«
Es raschelte, als Esmeralda aufstand, und wenige Sekunden später erschien sie in Diamants Blickfeld: eine junge Frau, trotz ihrer tausend Jahre, fast noch ein Mädchen. Das glatte blonde Haar reichte ihr bis über die Schultern. »Du hast mir nie von einem Valdorian erzählt«, sagte sie und lächelte nicht mehr.
»Vielleicht hast du es vergessen. Wie gesagt, es ist lange her.«
»Solche Dinge vergesse ich nie. Ich …«
Ein seltsames Geräusch erklang, wie von einer Polymerfolie, die ganz langsam zerriss. Das Bild vor Diamants Augen verschwamm kurz, und neben der ernst blickenden Esmeralda entstand eine dünne vertikale Linie in der Luft, schwarz wie das All. Sie berührte den Boden, wurde breiter …
Eine dunkle Gestalt trat aus dem Riss in der Luft, richtete eine Waffe auf Esmeralda und schoss. Der fauchende Strahl hinterließ ein faustgroßes Loch in der Brust, und Esmeralda war bereits tot, als sie fiel und auf den Boden prallte.
Entsetzen packte Diamant, als die Waffe herumschwang und auf sie zielte.
Eine zweite Gestalt kam aus dem Riss, kleiner und agiler als die erste, ebenfalls in einen Kampfanzug gekleidet, stieß den Waffenarm des ersten Fremden nach oben und richtete etwas auf ihn, das nicht nach einem Hefok aussah. Die erste, größere Gestalt schrumpfte plötzlich und wuchs dabei gleichzeitig in die Länge. Der schwarze Riss saugte sie an, verschlang sie und verschwand.
Der zweite, kleinere Fremde griff nach Diamants Hand. »Dieser Zeitriss ist jetzt wieder geschlossen, aber es können jederzeit andere entstehen, und ich weiß nicht, ob ich den nächsten Eliminator rechtzeitig neutralisieren kann. Komm, wir müssen fort von hier.«
2 Bunte Spiele
Braun: Omnivor
Ich … lebe … noch … Valdorians Gedanken krochen wie durch zähflüssige geistige Melasse und bemühten sich, die Türen und Fenster des Gedächtnisses zu öffnen – sie suchten nach Erinnerungen und Verstehen.
»Es wird Zeit, das Spiel zu spielen«, erklang eine näselnde, schrecklich vertraute Stimme, und ein Gesicht erschien über Valdorian, voller Runzeln und mit einer weit vorspringenden spitzen Nase. In den großen grünbraunen Augen glühte ein Licht, das aus großer Tiefe zu kommen schien. Eine Name fiel ihm ein: Olkin.
»Ja, der bin ich«, bestätigte der gnomartige Hominide. »Du wirst gebraucht. Komm.«
Das letzte Wort enthielt eine besondere Schärfe, auf die Valdorian sofort reagierte. Er kletterte aus dem Kokon, in dem er geruht hatte, weder tot noch lebendig, vielleicht viele Jahre lang oder auch nur wenige Minuten – es gab keine Möglichkeit für ihn, eine Vorstellung von der verstrichenen Zeit zu gewinnen. Er trat neben Olkin auf einen gummiartigen Steg und sah erneut die vielen anderen Kokons in dem großen, höhlenartigen Raum, der langsam pulsierte, größer wurde und dann wieder schrumpfte, wie ein schlagendes Herz. Es waren tausende, vielleicht sogar zehntausende, und in ihnen allen ruhten intelligente Geschöpfe aus zahlreichen Galaxien. Das Schicksal vereinte sie: Der Omnivor hatte sie aufgenommen und lieh sich ihre Intelligenz für etwas, das Valdorian noch immer nicht verstand.
Wir sind alle Sklaven, dachte ein letzter freier Rest seines Bewusstseins, als er Olkin folgte. Die große Kaverne blieb hinter ihnen zurück, und sie schritten durch einen Gang, der, wie Valdorian wusste, durch den schwarzen Zapfen führte, ein Bauwerk, das unten fünfzig Meter breit war und sich nach oben hin verjüngte. Und wie bei den Kantaki-Schiffen blieben die inneren Dimensionen des Zapfens, der so etwas wie ein Kontrollzentrum des Omnivors zu sein schien, nicht auf sein Volumen beschränkt, sondern konnten weit darüber hinausreichen.
Türen befanden sich in den Wänden rechts und links, manche schmal und niedrig, andere breit und hoch. Eine von ihnen war so schwarz wie der Omnivor selbst. Valdorian ging ein wenig langsamer, trotz seiner erzwungenen Servilität von Neugier erfasst. Als der Abstand zu Olkin auf einige Meter wuchs, wandte er sich einer schwarzen Tür zu, streckte die Hand nach dem Knauf aus …
Er ließ sich drehen, aber die Tür blieb geschlossen.
Olkin erschien an seiner Seite, ohne dass die Beine ihn zu Valdorian getragen hatten. »Das ist mein Zimmer«, sagte er leise, und dabei klang seine Stimme ganz anders als sonst. »Dort habe nur ich Zutritt.«
Sie brachten eine Treppe hinter sich und erreichten das runde Zimmer mit dem ebenso runden Spieltisch, an dem die Spieler saßen: Valdorians Sekretär Jonathan; Lukert Turannen, Koordinator des Konsortiums; Konstantin Alexander Stokkart, Autokrat von Kerberos; Valdorians Sohn Benjamin. Und Enbert Dokkar, sein Erzfeind aus der Allianz. Einige der Personen hatten ihm früher etwas bedeutet, auf die eine oder andere Weise, aber in seiner neuen Existenz stand er ihnen völlig gleichgültig gegenüber. Das galt sogar für Benjamin und Dokkar, die versucht hatten, ihn umzubringen. Es regte sich nur dann eine emotionale Reaktion in ihm, wenn er an Lidia dachte, die Kantaki-Pilotin Diamant. Ihr hatte er dies alles zu verdanken! Sie hatte sich geweigert, ihm zu helfen, ihm ein neues Leben zu geben, und allein dadurch war er in diese schreckliche Situation geraten.
Er hasste sie.
Aber selbst der Hass blieb matt, denn Valdorian war nicht Herr seines Denken und Fühlens. Etwas unsagbar Fremdes steckte in ihm, nutzte seine Intelligenz, dachte mit seinen Gedanken und fühlte mit seinen Gefühlen: die Präsenz des Omnivors.
Die Spieler am Tisch rührten sich nicht, als Olkin und Valdorian näher kamen. Sie blieben reglos sitzen, erstarrt in Zeit und Raum, in einem sich endlos dehnenden Moment, der nur aufhörte, wenn erneut das Spiel begann.
Die Vorrichtung auf dem runden Tisch erschien Valdorian noch komplexer und unübersichtlicher – vielleicht war sie gewachsen, seit er sie zum letzten Mal gesehen und sich in ihr befunden hatte. Sein Blick fiel auf hunderte von Röhren, auf eine Weise ineinander verschlungen, die das Auge des Betrachters zu verspotten schien, auf netzartige Geflechte, mal klar, mal halb verschwommen, die sich zwischen Quadern und Kugeln spannten, zwischen Gebilden, die wie kleine, verschnörkelte Minarette aussahen. An einigen Stellen ragten Bündel aus spitzen Zacken und Dornen auf, wie die Stacheln von Geschöpfen, die sich irgendwo in dem Durcheinander verbargen. Über dem Spiel, so wusste Valdorian, spannte sich eine dünne Membran, die den Mikro- vom Makrokosmos trennte und nur dann sichtbar wurde, wenn man sie berührte.
»Du sollst erneut der Wegfinder sein, Dorian«, sagte Olkin.
Das viel zu intime Du störte Valdorian, doch der verkürzte Name war noch viel schlimmer. Nur zwei Personen hatten ihn jemals »Dorian« genannt: sein Leibarzt Reginald Connor, gestorben auf Orinja im Takhal-System. Und Lidia.
Der kleine Hominide hob die Hand, und in seinen großen Augen blitzte es …
Finsternis umgab Valdorian, und er wusste nicht, ob er noch einen Körper hatte oder als materieloser Geist an einem Ort weilte, der sich tief im Inneren des Spiels befand, vielleicht in seinem Zentrum. Er hatte sich schon einmal hier befunden, als der Keim des Omnivors Kerberos verlassen hatte und in die Vergangenheit gesprungen war, zum Null, um die Temporalen – beziehungsweise die Eternen, wie sie sich selbst nannten – aus ihrem Zeitkerker zu befreien. Agoron, der Temporale, der ihn zwar verjüngt, aber auch benutzt hatte, von Anfang an … Der freie Rest Valdorians hasste ihn fast ebenso sehr wie Lidia.
Erste Formen bildeten sich in der Dunkelheit: Stangen, Quadrate, Rechtecke, Pyramiden, Polyeder … Ihre unterschiedlichen Farben drängten die Finsternis zurück und wiesen wie zuvor auf Kompatibilitäten und Unvereinbarkeiten hin. Anschlusspunkte glühten und blinkten wie Positionslichter, warteten darauf, miteinander verbunden zu werden.
Ein neues Spiel beginnt. Olkins leise Stimme kam aus einer anderen Sphäre, aus dem Makrokosmos jenseits des Spiels. Mit Händen, die Valdorian nicht sehen konnte, stellte er erste Verbindungen her. Die einzelnen Komponenten setzten sich zu einem Navigationsgerüst zusammen, das die Bewegungen bestimmte, nicht nur die des Omnivors – der jetzt viel größer zu sein schien als während der letzten wachen Phase Valdorians –, sondern auch die Bewegungsmuster der anderen Spieler. Valdorian wusste nicht, wie viele es waren. Jeder von ihnen kam einem Zahnrad im großen Mechanismus des Omnivors gleich, der ihm Mobilität verlieh.
Valdorians Aufmerksamkeit blieb auf die bunten Formen beschränkt, und während er sie immer schneller zusammensetzte, bemerkte er einen Unterschied. Wie zuvor gaben die Farben über Realitätsdichte Auskunft, aber seine Aufgabe als Wegfinder, als Pilot für den Omnivor, galt nicht mehr einem Ort in Raum und Zeit, sondern unterschiedlichen … Wirklichkeitsschichten. Etwas schien durcheinander geraten zu sein. Wo er auf dem Weg zum Null Zeitschächte und Kapillaren gesehen hatte, erstreckten sich jetzt zerfetzte Gespinste, deren bunte Vielfalt dem Chaos eine zusätzliche Dimension gab.
»Was ist geschehen?«
Finde das Zentrum des Widerstands, wies Olkin ihn an.
»Welchen Widerstands?«
Das fremde Etwas in Valdorian dehnte sich aus, gewann dabei die falsche Vertrautheit eigener Gedanken und Gefühle. Es teilte sein Ich: Die eine Hälfte blieb im Navigationsgerüst und erweiterte es; die andere schwebte inmitten der Gespinste, außerhalb des Omnivors.
Die zweite Hälfte von Valdorians Selbst enthielt jenes Fragment, das sich bisher der geistigen Versklavung entzogen hatte. Es schöpfte neue Hoffnung und begann damit, Kraft aufzunehmen, ganz vorsichtig, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Valdorian bekam keine Antwort auf seine Frage. Er wusste noch immer nicht, was es mit dem »Zentrum des Widerstands« auf sich hatte, aber etwas in ihm wurde trotzdem aktiv und berührte die Fäden der Gespinste, nahm Aroma und Textur der Farben auf. Raue Bitterkeit an einer Stelle, glatte Süße an einer anderen … Die Sinneseindrücke vermischten sich zu einem sensorischen Amalgam, das trotz seiner Absurdität Sinn ergab: Irgendwie verstand er es, die auf ihn einströmenden Informationen zu deuten, und er lernte schnell, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Um braune Fäden kümmerte er sich nicht mehr, denn sie waren für seine Suche irrelevant. Gelben und orangefarbenen schenkte er nach einigen ersten Kontakten ebenfalls keine Beachtung mehr, denn sie erwiesen sich als verändert … Ein lavendelfarbener Strang weckte sein Interesse, und Valdorian befühlte ihn mit geistigen Fingern. Zwar war er dünn, doch lichtjahrtief in seinem Inneren steckte etwas Unverändertes …
Verschiedene Welten. Die Fäden der vielen Gespinste enthielten Realitäten, die sich durch ihr Ausmaß an Manipulation unterschieden, und die Farben boten einen Hinweis darauf. Wer hatte die Wirklichkeiten manipuliert?, fragte sich Valdorian. Und wo entstanden die Gespinste? Sie hatten vorher nicht existiert.
Vorher …
In Valdorians freiem Selbst reifte eine intuitive Erkenntnis heran. Der Zeitkrieg, dachte er. Der zweite Zeitkrieg … Er ist verloren. Er hat stattgefunden und die Temporalen haben ihn gewonnen.
Was sind das für Gedanken?, flüsterte Olkin, und in seiner Stimme hörte Valdorian die Gehorsam verlangende Schärfe. Woher kommen sie?
Die immateriellen Hände des Suchenden berührten einen blauen Strang und fühlten … korrigierte Veränderung. Der Sieg war nicht vollständig. Es gab jemanden, der den Zeitmanipulationen trotzte und nach wie vor Widerstand leistete.
Valdorian spürte noch etwas anderes. Von manchen Stellen bestimmter Fäden ging ein Sog aus, wie von einem Magnetfeld, das Eisen anzog, und nach einigen seltsam langen Momenten begriff er: Er fühlte eine Art mentale Gravitation, erzeugt vom Selbst der Valdorian-Äquivalente in den zahllosen Realitäten der Gespinste. Vertraute Gedankenmuster, die sich gegenseitig anzogen …
Ich brauche mehr Kraft für die Suche, sagte er.
Was sind das für Gedanken?, fragte Olkin erneut, während ein Teil der Omnivor-Energie Valdorian entgegenfloss und dessen Vermutungen bestätigte: Hier draußen – wo auch immer hier draußen war – hatte Olkin nicht den gleichen dominierenden Einfluss auf ihn wie innerhalb des Omnivors.
Als der servile Valdorian die Kraft empfing, die er für die Suche nach dem »Zentrum des Widerstands« verwenden sollte, hielt der freie Rest den richtigen Zeitpunkt für gekommen und zögerte nicht länger: Er nutzte diese Energie, um sein Selbst in eines der Gespinste zu schleudern, so weit wie möglich fort von der dunklen Präsenz des Omnivors. Etwas versuchte ihn zurückzuziehen, aber er hielt sich an dem ersten blau schimmernden Faden fest, den er finden konnte, suchte nach einer Öffnung, um hineinzukriechen …
Indigo
Der Wechsel erfolgte abrupt, ohne eine Phase des Übergangs. Plötzlich befand er sich im Inneren des Fadens, im Weltraum zwischen Sternen, umgeben von Vakuum und Kälte. Valdorian riss die Augen auf, die zu gefrieren begannen, spürte, wie sich sein Körper aufblähte …
Fort von hier!, dachte er, und die Raum-Zeit-Koordinaten seines Aufenthaltsortes änderten sich. Er stand auf dem eisverkrusteten Gipfel eines Berges, blickte auf eine namenlose Welt hinab, und wieder war es kalt, wenn auch nicht annähernd so kalt wie vorher.
Falsch, falsch!
Dutzende von Welten huschten an ihm vorbei, als ein unkontrollierter Transfer auf den anderen folgte. Valdorian befürchtete, im Inneren einer Sonne zu erscheinen und sofort zu verbrennen, oder am Grund eines Ozeans, dessen Wassermassen ihn innerhalb eines Sekundenbruchteils zerquetschten. Er versuchte, die Sprünge durch dieses Universum zu kontrollieren, und dabei spürte er wieder jene sonderbare geistige Anziehungskraft, die er im Gespinst gefühlt hatte und die von einem anderen Valdorian in dieser Realität ausging. Er konzentrierte sich auf sie, um sich von ihr den Weg weisen zu lassen …
Die Omnivor-Energie, die ihn in den Faden getragen hatte, verflüchtigte sich bei einem letzten Transfer, der Valdorian in ein stilles, halbdunkles Zimmer brachte. Völlig nackt stand er vor einem Spiegel und sah sich im matten Schein einiger Orientierungslichter. Der Spiegel zeigte ihm keinen hundertsiebenundvierzig Jahre alten Greis, den nur noch wenige Sekunden vom Tod getrennt hatten, sondern einen um mindestens hundert Jahre jüngeren Valdorian, schlank, voller Kraft und Vitalität. In dem Gesicht dieses Mannes deutete nichts auf das Entsetzen hin, das ihn im Inneren des Omnivors begleitet hatte, und die Schatten dunkler Erinnerungen wichen von seinen Zügen, als er lächelte.
»Ich bin frei«, hauchte er. Sein Blick huschte durch die dunklen Ecken des Zimmers, auf der Suche nach einem kleinen, buckligen Hominiden, dessen Stimme Macht über ihn hatte, aber nirgends glitzerten große grünbraune Augen.
Erst dann stellte er fest, dass er das Zimmer kannte. Der Spiegel, die aus echtem Holz bestehende Vitrine an der einen Wand, daneben ein schlichter Schreibtisch mit einem kleinen Datenservo, mit den größeren Datenservi im Arbeitsbereich der Villa verbunden, das Fenster …
Valdorian trat näher und sah hinaus in die Nacht. Die Lichter von Bellavista leuchteten unten am Fuß des Hügels, und jenseits davon erstreckte sich das Scharlachrote Meer. Tintiran, die Levitatorvilla am Hügelhang … Er wandte sich dem Datenservo zu, bemerkte das Glühen des Bereitschaftsindikators und sagte: »Aktivierung.«
Über dem kleinen Gerät öffnete sich ein pseudoreales Informationsfenster. »Nennen Sie Ihren Berechtigungskode.«
Valdorian holte tief Luft. Jetzt würde sich gleich herausstellen, wie sehr diese Welt jener in seiner Erinnerung ähnelte. Er nannte den Kode, mit dem er damals, in einem anderen Leben, seine Daten geschützt hatte.
»Bereitschaft«, erklang unmittelbar darauf die artifizielle Stimme des Datenservos, der damit die Validität des Kodes bestätigte.
Valdorian seufzte innerlich. »Nenn mir Zeit und Datum.«
»Es ist zwei Uhr vierzehn, siebzehnter Oktober fünftausendfünfhunderteinundzwanzig.«
Die Jahresangabe verblüffte Valdorian. Er hatte sich zum letzten Mal im Jahr 421 Seit Neubeginn in seiner Welt befunden.
Hinter ihm raschelte etwas, und er erstarrte. Einige schreckliche Sekunden lang befürchtete er, dass es Olkin gelungen war, ihm hierher zu folgen, trotz der vielen Sprünge, doch die näselnde Stimme des Hominiden erklang nicht. Langsam drehte sich Valdorian um und bemerkte, dass die Tür zum anderen Zimmer offen stand. Dort ging plötzlich Licht an, und elektronische Systeme summten.
Valdorian trug keinen Fetzen Kleidung am Leib und stand mit leeren Händen da, völlig hilflos. Der Datenservo hatte seinen Berechtigungskode akzeptiert, aber die Jahresangabe deutete darauf hin, dass sich diese Realität nicht unerheblich von der unterschied, aus der er kam.
»Ich … habe etwas gehört«, ertönte eine schwache, brüchige Stimme.
»Beruhigen Sie sich«, antwortete ein Servo.
»Jemand … ist hier.«
»Sie sind hier.«
Die Sicherheitssysteme, dachte Valdorian. Sind sie aktiv? Haben sie mich bereits als Eindringling identifiziert? Andererseits: Er war Valdorian. Und die schwache, kraftlose Stimme …
Langsam und leise ging er zur halb offenen Tür und spähte vorsichtig um die Ecke. Ein großes Bett stand in dem Schlafzimmer, an das sich Valdorian ebenfalls erinnerte, obwohl ihm sofort Unterschiede auffielen. Die Tapisserien an den Wänden und die zugezogenen Vorhänge zeigten fremde Muster, hinzu kamen mehrere medizinische Servi, die das Bett umgaben. Darin lag …
Valdorian riss die Augen auf und glaubte, in einen Spiegel der Zeit zu sehen, der ihn mit einem schrecklichen Zerrbild von sich selbst verhöhnte. Die Gestalt im Bett, die sich halb aufgesetzt hatte und ebenfalls die Augen aufriss, war er selbst am Ende seines Lebens, der sterbende Greis, den er bei der letzten Begegnung mit Lidia in den lebenden Kristallen von Mirror gesehen hatte: das hohlwangige Gesicht eine zerklüftete Landschaft aus Falten und Runzeln, die Haut halb transparent, die Augen trüb und wässrig.
Der junge Valdorian betrat das Schlafzimmer und näherte sich, setzte wie in Trance einen Fuß vor den anderen, während sein altes Selbst eine zitternde Hand hob und auf ihn zeigte.
»Sie sind …«, brachte er mühsam hervor. »Du bist …«
Einer der medizinischen Servi richtete einen Sensor auf den jungen Valdorian, sondierte kurz und wandte seine elektronische Aufmerksamkeit dann wieder dem Greis zu. Der Medo-Servo identifizierte den Neuankömmling offenbar als Valdorian, aber seine Künstliche Intelligenz war nicht hoch genug entwickelt, um zu erkennen, wie absurd die Präsenz verschiedener Valdorians war, der eine ein schwacher Greis, der andere kräftig und in seinen besten Jahren.
Neben dem Bett blieb der junge Valdorian stehen und sah, dass mehrere dünne Kabel und Schläuche die medizinischen Servi mit dem Alten verbanden. Die zitternde Hand sank aufs Laken zurück, und Jung und Alt sahen sich an.
»Wie ist das möglich?«, hauchte der Greis.
»Wenn Sie sich nicht beruhigen, müssen wir Ihnen ein Sedativ verabreichen«, sagte einer der Servi.
Der junge Valdorian gab ihm einen Tritt, und der Geräteblock stürzte um. Noch bevor er begriff, was er eigentlich tat, riss er die Kabel und Schläuche los und stieß den zweiten Medo-Servo gegen den dritten. Die Servi landeten krachend auf dem Boden, und dann herrschte gespenstische Stille. Der Greis sah stumm zu ihm auf, die Augen groß, der Mund geöffnet.
Er verkörperte all das, was Valdorian hasste: Schwäche, das Ende, der Verlust all der Dinge, die ihm etwas bedeuteten. Sein altes Selbst symbolisierte die vielen Niederlagen, die er seit der Entscheidung erlitten hatte, Lidia zu suchen und sie um Hilfe zu bitten, um mehr Leben. Er war wie ein Finger des Spotts, der sich auf ihn richtete, begleitet von den Worten: Was auch immer du versuchst, wie sehr auch immer du dich bemühst, eines Tages wirst du auf diese Weise enden; du wirst so aussehen und sterben, dich im Nichts verlieren.
Valdorians Hände schlossen sich um den Hals des Greises und drückten zu, während die geisterhafte Stille andauerte. Die Augen des alten Valdorian quollen aus den Höhlen, aber kein Laut kam über seine Lippen.
Er tötete sich selbst, löschte die eigene Vergänglichkeit aus, seine Gebrechlichkeit, sein Versagen, triumphierte auf diese Weise über das Alter, das am Ende jedes Lebenswegs lauerte und dem er schon einmal entkommen war. Nach all den Niederlagen endlich ein Sieg …
Schließlich löste er die Hände vom Hals des Greises, der sich nicht mehr rührte, und richtete sich auf. Der Sturm in seinem Inneren ließ nach, und plötzlich zitterte er wie zuvor die Hand des Alten.
Hinter ihm erklang das Geräusch eiliger Schritte, aber er starrte weiterhin auf den Toten hinab und bebte dabei am ganzen Leib. Er hatte sich selbst umgebracht …
»Drehen Sie sich langsam um«, ertönte eine kühle Stimme.
Valdorian kam der Aufforderung nach und sah nicht nur einen auf ihn gerichteten Hefok, sondern auch ein vertrautes Gesicht.
»Cordoban«, sagte er.
3 Ozean der Zeit
Blau: Kantaki-Nexus, 2. Februar 571 SN
Das rasende Klicken des Kantaki-Alarms hallte durch die Säle, Räume und Korridore der kilometerlangen Station zwischen den Galaxien, als Diamant aus dem Observatorium wankte. Die kleine, in einen Kampfanzug gekleidete Gestalt zog an ihrem Arm.
»Schnell, schnell!«, drängte sie. »Es können jederzeit weitere Eliminatoren erscheinen.«
Die Stimme klang seltsam verzerrt aus einem in den Helm integrierten Lautsprecher, gab nicht zu erkennen, ob es sich um die einer Frau oder eines Mann handelte. Diamant versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Sie sah noch immer Esmeraldas Gesicht, die Verblüffung in ihren Augen, als sich das Feuer in ihre Brust fraß und sie tötete. Dass ein tausendjähriges Leben auf diese Weise zu Ende ging …
In dem Kantaki-Nexus, der mehr als eine Million Lichtjahre von der nächsten Galaxis entfernt war, hielten sich nur wenige Personen auf. Diamant hatte bei ihrer Ankunft außer Esmeralda zwei andere Piloten gesehen. Hinzu kamen einige Akuhaschi, die sich als Verwalter und Techniker um die große Station kümmerten, und natürlich die Eigner der insgesamt vier Kantaki-Schiffe, die an den Verbindungsflanschen neue Energie aufnahmen. Alle übrigen Bewohner des Nexus waren automatische Mechanismen, K-Servi, die alle Einrichtungen der Station warteten. Einer von ihnen näherte sich ihnen durch den Gang, der den Bereich der Pilotenquartiere mit dem Observatorium verband.
Es klickte, und Diamants Linguator übersetzte sofort. »Leben ist ausgelöscht worden«, sagte der K-Servo. »Wir …«
»Dafür haben wir keine Zeit«, sagte die Gestalt im Kampfanzug, nahm ein kleines Gerät vom Gürtel und richtete es auf den Servo.
Die Maschine erstarrte und gab keinen Ton mehr von sich.
»Komm«, fügte der Fremde hinzu. »Wir müssen weiter.«
Diamant versuchte, die Benommenheit des Schocks abzuschütteln und nahm nur am Rande zur Kenntnis, dass die unbekannte Person ihr gegenüber das intime Du verwendete.
Das Klicken des Kantaki-Alarms verklang, und Stille dehnte sich in der Station aus. Der Fremde zerrte so heftig an Diamants Arm, dass sie einen Fuß vor den anderen setzen musste, um nicht zu fallen. Sie eilten durch den Korridor, auf der Flucht vor etwas, das die Kantaki-Pilotin nicht verstand, erreichten den Quartierbereich … und fanden dort die Leichen der beiden anderen Piloten, halb verbrannt. Diamant starrte erschrocken und bestürzt auf sie herab, während der Fremde an ihrer Seite auf die Anzeigen eines handtellergroßen Instruments sah.
»Es sind zwei«, tönte es aus dem Helmlautsprecher. »Im ersten Segment. Zwei Eliminatoren. Sie nähern sich dem Köder, den ich dort untergebracht habe, verwechseln seine Emissionen mit deiner tatsächlichen Realitätssignatur. Trotzdem dürfen wir keine Zeit verlieren.« Die Gestalt lachte leise. »Keine Zeit verlieren …«
Wieder gab Diamant dem Zerren an ihrem Arm nach und folgte dem Fremden durchs labyrinthähnliche, düstere Innere des Nexus. Sie hatten gerade die Lunge der Station passiert – einen mehrere hundert Meter durchmessenden Saal, in dem ein riesiges Geschöpf wuchs, halb Pilz und halb Pflanze, Kohlendioxid aufnahm und Sauerstoff sowie Nährstoffe für die Kantaki produzierte –, als eine heftige Erschütterung nicht nur Diamant von den Beinen riss, sondern auch den Fremden. Doch die Gestalt im Kampfanzug, der gelegentlich auf subtile Weise die Farbe wechselte, sprang sofort wieder auf, in beiden Händen kleine Geräte, vielleicht Waffen.
»Ein Kantaki-Schiff ist zerstört«, sagte sie, und der drängende Tonfall kehrte in ihre Stimme zurück. »Es greifen nicht nur Eliminatoren an. Dies ist eine größere Aktion. Du sollst auf keinen Fall entkommen.«
»Was hat dies alles zu bedeuten?«, brachte Diamant hervor. Hinter ihrer Stirn herrschte noch immer ein wildes Durcheinander, und vor dem inneren Auge sah sie wieder Esmeralda und die beiden anderen Piloten, von einem unbekannten Feind getötet.
»Für Erklärungen haben wir jetzt keine Zeit«, erwiderte der Fremde. »Wir müssen den Nexus verlassen.«
Diesmal folgte Diamant der Gestalt aus eigenem Antrieb. »Und wohin wollen Sie dann? Wir befinden uns hier zwischen der Milchstraße und Andromeda. Das nächste Sonnensystem ist nur mit einem Kantaki-Schiff zu erreichen …«
»Mir geht es nicht um ein Sonnensystem, sondern um einen sicheren Punkt in der Zeit.« Der Fremde lief jetzt und wählte einen Gang, der ins Zentrum des Nexus führte, zu den Aggregaten, die bis in die Hyperdimension der Kantaki reichten.
»Das ist der falsche Weg«, sagte Diamant. Ihre Gedanken lösten sich allmählich aus der Benommenheit. »Wenn Sie den Nexus verlassen wollen …«
»Ich kenne den Weg, glaub mir.«
Sie erreichten den Lamellenzugang des ersten Maschinensaals, und als sich die fünf gewölbten Segmente beiseite geschoben hatten, führte der nächste Schritt tief in die Hyperdimension der Kantaki. Die perspektivischen Verzerrungen in den peripheren Bereichen des Nexus hatte Diamant kaum mehr zur Kenntnis genommen, denn daran war sie vom Pilotendom ihres Schiffes gewöhnt. Hier aber, an dem Ort, wo der Nexus aus anderen Dimensionen Energie bezog, ohne das interkosmische energetische Gleichgewicht zu stören, konnten gewöhnliche menschliche Sinne die auf sie einströmenden Informationen nicht mehr richtig verarbeiten. Jemand schien die Richtungen genommen, zerknüllt, zerrissen und sie dann fortgeworfen zu haben. Selbst Diamant, die den größten Teil ihres Lebens in einem Kantaki-Ambiente verbracht hatte, lief Gefahr, die Orientierung zu verlieren. Sie schluckte mehrmals und kämpfte gegen Übelkeit an, während sie der Gestalt im Kampfanzug folgte, die den Weg tatsächlich genau zu kennen schien, trotz des sensorischen Chaos. Während sie durch den halbdunklen Maschinensaal hasteten, schienen manche Aggregate aufzustehen, zu einem anderen Ort zu wanken und sich dort wieder niederzulassen.
Der Boden unter Diamant erzitterte, und sie hielt sich an einer Strebe fest, die unmittelbar neben ihr aus dem Boden gewachsen war und in der kleine Käfer aus Licht krabbelten. Die letzten Nebelschwaden der Benommenheit lösten sich auf, und es brach ein innerer Damm, hinter dem sich Erkenntnisse angestaut hatten, begleitet von einer wahren Flut aus Emotionen. Plötzlich strömte alles auf sie ein, und ihr stockte der Atem.
»Esmeralda ist tot!«, stieß sie hervor. »Und auch die beiden anderen Piloten. Und Sie haben gesagt, dass ein Schiff der Kantaki zerstört wurde, vielleicht mit dem Vater oder der Mutter an Bord. Der Nexus wird angegriffen, mitten zwischen zwei Galaxien …«
»Das ist die bittere Wahrheit.« Der Fremde tauchte plötzlich vor ihr auf und zog erneut an Diamants Arm.
»Aber es ist …« Die Pilotin suchte nach einem geeigneten Wort, während sich das Zittern des Bodens wiederholte und stärker wurde.
»Unglaublich?«
»Mehr als nur das! Es ist unerhört und …«
Vor ihnen bewegte sich etwas und kam ihnen aus den Schatten zwischen den großen, veränderlichen Aggregaten entgegen. Diamant erkannte den viele Großzyklen alten Vater Mjoh, den Eigner des Nexus. Der greise Kantaki streckte den dünnen, ledrigen Hals nach unten, brachte seinen dreieckigen Kopf näher an Diamant und den Fremden heran. Die beiden großen multiplen Augen waren trüb.
»Dass ich so etwas erleben muss«, klickte Vater Mjoh. »Ein Angriff auf den Nexus! Der Sakrale Kodex wird verletzt …«
Die Gestalt im Kampfanzug richtete einen Gegenstand auf den alten Kantaki, und Diamant erschrak zutiefst. Doch der Fremde hielt keine Waffe in der Hand, sondern einen speziellen Kom-Servo, aus dem klickende Geräusche kamen, so schnell, dass Diamants Linguator sie nicht übersetzen konnte.
Vater Mjoh hob die vorderen Gliedmaßen, an denen einige schmückende bunte Bänder hingen, vollführte eine komplexe Geste mit ihnen und wich beiseite. »Ich verstehe«, sagte er nur.
Einmal mehr wurde Diamant weitergezerrt, doch diesmal war es für sie einmal zu viel. Sie stieß die Hand des Fremden beiseite. »Aber ich verstehe nicht. Ich will endlich wissen, was dies alles bedeutet!«
Dumpfes Donnern hallte durch den Nexus, und die wuchtigen Aggregate im Maschinensaal schienen sich zu ducken.
»Wir haben keine Zeit für Erklärungen«, wiederholte der Fremde, dessen Gesicht hinter dem dunklen Helmvisier verborgen blieb. »Wir müssen fort sein, wenn die Eliminatoren hier eintreffen. Komm, Lidia.«
Komm, Lidia … Woher kannte der Fremde den Namen, den sie in einem anderen Leben getragen hatte?
»Wer sind Sie?«, fragte Diamant.
Die Gestalt zögerte kurz, griff dann nach den Siegeln am Hals, löste sie und nahm den Helm ab. Zum Vorschein kam eine junge Frau, ihr schwarzes Haar ebenso lockig wie das von Diamant, die Augen ebenso groß. Die Ähnlichkeit war unverkennbar.
»Sie sind … du bist …«
»Ja, ich bin deine Schwester Aida.«
Diamant starrte die junge Frau groß an. Ihre Schwester Aida war als Kind gestorben, als Siebenjährige am Ufer des Sees auf Xandor von einem Felsen gestürzt. Sie erinnerte sich daran, an ihrem Grab gestanden zu haben, zum letzten Mal an einem kalten Tag vor fast zweihundertfünfzig Jahren, in Begleitung einer ihr fremden Frau, die damals mit ihrer Familie dort zu Hause gewesen war, wo Diamant als Lidia DiKastro einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht hatte. Ganz deutlich erinnerte sie sich an den Schnee, der nicht nur ein Grab bedeckte, sondern drei: das ihrer Schwester Aida und auch die beiden anderen, in denen ihre Eltern ruhten, Roald DiKastro und Carmellina Diaz.
»Das ist unmöglich«, sagte Diamant und hatte das schreckliche Gefühl, den Verstand zu verlieren. »Du bist als Kind gestorben. Du …«
Aidas Blick huschte an ihr vorbei in die »Richtung«, aus der sie gekommen waren. Ihr Gesicht zeigte Sorge. »Ich kann deine Verwirrung verstehen, und glaub mir, ich würde dir gern alles erklären, jetzt sofort, aber wir müssen fort von hier! Bitte hab Vertrauen. Wenn du gestattest … Den Helm brauche ich, um das Rettungsboot zu finden.« Sie setzte ihn auf und eilte erneut durch das Chaos einer Umgebung, die sich bei jeder einzelnen Bewegung grundlegend zu verändern schien.
Diamant folgte ihr aus einem Reflex heraus und sah über die Schulter, als sie ein sonderbares Geräusch hörte. Der greise Vater Mjoh war viel weiter entfernt, als es eigentlich der Fall sein sollte, hockte weit oben auf der Spitze eines bergartigen Aggregats, das unter ihm immer breiter wurde. Neben ihm hatte sich in der leeren Luft ein … Loch gebildet, und eine metallene Schlange kroch daraus hervor, mit einem Leib, der aus zahlreichen einzelnen Segmenten bestand.
»Ein Wurm!«, rief Aida. »Ein automatischer Mechanismus, der auf die Signaturen der Kantaki und der K-Technik reagiert. Vermutlich ist er auf das Rettungsboot angesetzt, aber … Vater Mjoh ist ihm zu nahe.«
Die Gestalt im Kampfanzug, der erneut eine andere Farbe gewann, blieb stehen und hob eine Hand zum Helm. »Vater Mjoh, meiden Sie den Wurm!« Gleichzeitig mit diesen Worten tönte ein lautes Klicken durch den Maschinensaal.
Der alte Kantaki hob den dreieckigen Kopf und wollte sich abwenden, aber das metallene Schlangenwesen war viel schneller. Es sprang aus dem Loch, das Diamant an die Öffnung erinnerte, aus der Esmeraldas Mörder getreten war, und schoss auf den Kantaki zu.
Aida riss einen eiförmigen Gegenstand vom Gürtel und warf ihn.
Das kleine Ei entwickelte ein sonderbares Eigenleben, schien sich zu orientieren, beschleunigte und raste zur metallenen Schlange, die sich vom greisen Kantaki abwandte – offenbar erkannte sie die ihr drohende Gefahr. Das Ei dehnte sich, wurde etwas länger und bekam eine Spitze, bohrte sich damit in den Wurm.
Es blitzte, das Donnern einer Explosion grollte durch den Maschinensaal, und die Schlange platzte auseinander. Diamant beobachtete, wie Vater Mjoh von einigen Splittern getroffen wurde, doch mehr sah sie nicht, denn Aida riss sie mit sich. »Sie wissen jetzt, wo wir sind!«, kam es aus dem Helmlautsprecher.
»Wohin willst du?«, fragte Diamant. »Hier gibt es nur die Maschinen des Nexus.«
»Und einen Kausalitätspunkt, an dem das Boot auf uns wartet. Das Helmvisier ist mit ihm synchronisiert.«
Ein Lichtpunkt tanzte an Diamant vorbei, und zunächst dachte sie, dass es sich um ein weiteres visuelles Phänomen der Hyperdimension handelte, aber plötzlich gab Aida ihr einen Stoß, der sie zur Seite taumeln ließ – dadurch entging sie knapp einem Kontakt mit einem weiteren Lichtpunkt, der wie aus dem Nichts gekommen war und in einem dunklen Aggregat verschwand. Einen Sekundenbruchteil später erzitterte nicht nur der Boden, sondern alles um sie herum.
»Die Dinger sehen harmlos aus, aber wenn noch mehr davon hier drin freigesetzt werden, ist es bald um die strukturelle Integrität des Nexus geschehen«, sagte Aida während sie liefen. »Es sind hyperdimensionale Singularitäten, vor allem für den Einsatz gegen K-Technik bestimmt. Du solltest dich besser nicht von einem der Lichter treffen lassen.«
Aus den Augenwinkeln sah Diamant ein Aufblitzen, gefolgt von einer lautlosen Explosion, als eine riesige Kantaki-Maschine auseinander brach, als bestünde sie aus Myriaden von sandkorngroßen Partikeln. Mehrere Gestalten kamen aus der Wolke, in dunkle Kampfanzüge gekleidet, Waffen in den Händen – Eliminatoren.
Diamant lief schneller.
»Da ist es!« Aida berührte etwas an ihrem Gürtel, und weiter vorn, zwischen zwei kleineren Aggregaten, erschien ein tropfenförmiges Gebilde aus bläulich schimmerndem Metall. Ähnlich wie ein Kantaki-Schiff erweckte es den Eindruck, aus vielen einzelnen Teilen, die nicht unbedingt zueinander passten, zusammengesetzt zu sein. Eine Luke schwang auf, und Aida riss sich den Helm vom Kopf, stieg ein. Als Diamant ihr folgte, drückte sie sich an die Seite einer kleinen Luftschleuse und warf einen weiteren eiförmigen Gegenstand. Dann schloss sich die Luke.
Das Innere des Rettungsbootes bot mehr Platz, als seine äußeren Maße versprachen, und auch dieser Eindruck war Diamant vertraut. Aida nahm in einem fensterlosen Raum vor einer breiten Konsole Platz, deutete auf einen zweiten Sessel und aktivierte einen energetischen Sicherheitsharnisch. Während Diamant sich ebenfalls setzte, huschten Aidas Hände über die Kontrollen. Bordsysteme summten, und ein großes pseudoreales Informationsfenster öffnete sich, gewährte Blick in den düsteren Maschinensaal des Nexus.
»Wir sitzen hier fest«, sagte Diamant. »Es gibt keinen Weg hinaus ins All.«
»Wir wollen auch gar nicht ins All.« Die Eliminatoren erschienen in einem separaten Darstellungsbereich und hoben ihre Waffen. »Die Reise beginnt.«
Eine kurze Vibration erfasste das tropfenförmige Gebilde, als es aufstieg. Durch das pseudoreale Fenster sah Diamant, wie die Eliminatoren, die Aggregate und der dunkle Maschinensaal verschwanden. Für eine halbe Sekunde oder weniger glaubte Diamant zu schweben, und etwas berührte sie tief in ihrem Inneren, zupfte wie zärtlich an Gedanken und Gefühlen.
Die pseudoreale Darstellung zeigte jetzt ein buntes Wogen.
»Was ist das?«, fragte Diamant.
»Das ist der Ozean der Zeit«, antwortete Aida, und das Rettungsboot fiel in ein Meer aus Farben.
4 Rückkehr
Indigo: Tintiran, 17. Oktober 5521
»Wer sind Sie?«
»Ich habe es schon einmal gesagt: Ich bin Rungard Avar Valdorian.«
»Sie haben Valdorian umgebracht.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!