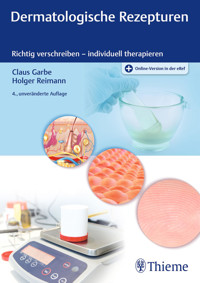
69,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Verordnen Sie Rezepturen? Dann finden Sie hier alle relevanten Wirkstoffe, Indikationen und Inkompatibilitäten. Ihre Patienten profitieren von einer individualisierten Therapie, bei standardisierter Sicherheit!
Für einen optimalen Behandlungserfolg
- Die wichtigsten pharmazeutische Grundlagen
- Vorstellung der Wirkstoffe und Hilfsstoffe
- Bewertung obsoleter Stoffe
- Darstellung der Rezeptur nach medizinischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
- Kommentare, Warnhinweise, Haltbarkeit und Kosten
- Alle Rezepturen geprüft vom Pharmazeutischen Laboratorium des Neuen Rezeptur-Formulariums (NRF).
- Rezepturpreise auf Basis des neuen AM-VSG
Jederzeit zugreifen: Der Inhalt des Buches steht Ihnen ohne weitere Kosten digital in der Wissensplattform eRef zur Verfügung (Zugangscode im Buch). Mit der kostenlosen eRef App haben Sie zahlreiche Inhalte auch offline immer griffbereit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dermatologische Rezepturen
Richtig verschreiben – individuell therapieren
Claus Garbe, Holger Reimann
4., unveränderte Auflage
9 Abbildungen
Vorwort zur dritten Auflage
Diese Monografie ist ein Schatz für die Dermatologen, und auch unentbehrlich für den Apotheker, der Magistralrezepturen herstellt. Die topische Therapie unter Einbeziehung von Magistralrezepturen gehört zu den Kernkompetenzen des Dermatologen. Sie ist die am häufigsten genutzte Therapieform der Behandlung von Hautkrankheiten. Für den Apotheker gehört die Herstellung von Magistralrezepturen ebenfalls zu seinen Kernkompetenzen, hier ist profundes pharmazeutisches Wissen erforderlich. Im vorliegenden Band werden die medizinischen Einsatzmöglichkeiten der besprochenen Magistralrezepturen ausführlich diskutiert und damit wird auch die Beratungskompetenz des Apothekers verbessert.
Die Verschreibung von Rezepturen bietet in vielen Fällen deutliche Vorteile im Vergleich zur Verwendung von Fertigarzneimitteln. Die Wirkstoffe können in die für die Haut des Patienten geeignete Dermatika-Grundlagen eingearbeitet werden, hier ist eine große Variabilität möglich. Für verschiedene Lokalisationen wie Capillitium oder Genitoanalbereich können spezielle Emulsionen („Hydrolotios“) oder Gele verwendet werden, die angenehmer anzuwenden sind. Größere Mengen können ohne erhebliche Steigerung der Kosten verschrieben werden. Schließlich demonstriert der Arzt seinem Patienten, dass er eine „individualisierte“ Therapie erhält. Dieses wird von Patienten sehr geschätzt. Wenn diese beim 1. Mal nicht als optimal empfunden wird, sind Variationen leicht möglich.
Das Kernstück dieses Bandes ist die Rezeptursammlung, die 135 Dermatika-Grundlagen und Rezepturen umfasst. 20 davon stellen Dermatika-Grundlagen nach DAB und DAC dar, 105 sind Rezepturen des Neuen Rezeptur-Formulariums (NRF) und 10 sind freie Rezepturformeln, die plausibel und kompatibel sind. Auf diese Rezepturen können sich der Arzt und der Apotheker verlassen! Die Galenik stimmt, sie sind haltbar und ihre Wirkung ist beschrieben. Die NRF-Rezepturen wurden im pharmazeutischen Laboratorium in Eschborn auf Herstellbarkeit, Kompatibilität und Haltbarkeit geprüft. Ihre Verschreibung ist mit der NRF-Nummer besonders einfach.
Für den Dermatologen kann die vorliegende Rezeptursammlung eine Fundgrube sein. Sie enthält gängige Rezepturen zur Behandlung entzündlicher Dermatosen mit Kortikosteroiden, Desinfizientien und Antibiotika. Ein breites Spektrum Harnstoff-haltiger und Salicylsäure-haltiger Rezepturen wird beschrieben. Daneben finden sich aber auch seltenere Anwendungen wie Albendazol-Creme für die Behandlung der Larva migrans, Aminolevulinsäurehydrochlorid-Thermogel 10% für die photodynamische Therapie, Minoxidil-Haarspiritus 2% oder 5% als Alternative zu Fertigpräparaten oder hydrophile Permethrin-Creme 2,5% mit der reduzierten Konzentration für Kinder als Alternative zu anderen Scabies-Therapeutika.
Aktuelle Informationen erhält der Leser auch zu den Kosten von Rezepturen. Diese werden – ohne Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die Apotheke – zum einen in Beispielkapiteln im Einzelnen kalkuliert und zum anderen mit den Kosten von Fertigarzneimitteln verglichen. Insbesondere bei der Verschreibung größerer Mengen eines topischen Therapeutikums gibt es deutliche Kostenersparnisse für die Magistralrezeptur. In der Beschreibung der Rezepturen werden die Preise für jede Rezeptur in verschiedenen Mengen angegeben. Abweichungen von diesen centgenauen, gleichwohl nur orientierenden Angaben treten in der Praxis besonders bei nicht „vereinbarten“ Rezepturbestandteilen auf. Die Kostenberechnungen sind auf dem Stand vom Januar 2017 unter Berücksichtigung des Arzneimittel-Versorgungsstärkungsgesetzes (AM-VSG). Sie unterscheiden sich aufgrund der Preisanpassungen des AM-VSG erheblich von den Kostenberechnungen aus dem Jahr 2005.
In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern und Nutzern des vorliegenden Bandes viel Freude und praktischen Nutzen.
Tübingen, im Januar 2017 Prof. Dr. med. Claus Garbe
Eschborn, im Januar 2017 Dr. rer. nat. Holger Reimann
Vorwort zur zweiten Auflage
Nachdem die gesamte 1. Auflage von 6000 Exemplaren vergriffen ist, haben wir diese 2., vollständig überarbeitete Auflage fertiggestellt. Dieses Buch hat erstmalig die Dermatologen wie auch andere rezeptierende Ärzte in breitem Umfang mit dem Neuen Rezeptur-Formularium (NRF) bekannt gemacht. Dadurch wurden die Rezepturen im Vergleich zu früheren Jahren ebenfalls in breitem Umfang auf eine rationellere Grundlage gestellt. Die im NRF enthaltenen Rezepturen stellen die Basis dieser Rezeptursammlung dar. Sie wurden alle galenisch optimiert und auf ihre Haltbarkeit überprüft. In diesem Sinne können sie sich durchaus mit Fertigarzneimitteln messen.
Dennoch empfehlen wir vorzugsweise die Verschreibung von Fertigarzneimitteln, soweit geeignete Präparate zur Verfügung stehen und durch die Rezeptur keine deutlichen Preisvorteile erreicht werden. Um diese Frage beurteilen zu können, enthält der vorliegende Band durchgängig Preiskalkulationen zu den gesammelten Rezepturbeispielen sowie ein eigenes Kapitel zur Preiskalkulation von Rezepturen in der Apotheke.
Die Kapitel über die offizinellen Grundlagen und über die Wirkstoffe wurden vollständig überarbeitet. Für die offizinellen Grundlagen wurde eine neue Systematik aufgenommen, die dem aktuellen Verständnis über dieses Gebiet gerecht wird. Bei den Wirkstoffen wurden einige obsolete, weggelassen und neuere Wirkstoffe eingefügt. Neu ist weiterhin, dass sowohl bei den offizinellen Grundlagen als auch bei den Wirkstoffen Rezepturbeispiele aufgeführt werden, die später in der Rezeptursammlung ausführlich kommentiert sind. So kann der Arzt die Auswahl der Rezeptur entweder ausgehend vom Wirkstoff oder von der offizinellen Grundlage gezielt vornehmen.
In den seit der 1. Auflage vergangenen 8 Jahren hat das Pharmazeutische Laboratorium des Neuen Rezeptur-Formulariums fleißig weitere galenische Zubereitungen und Rezepturen von Wirkstoffen erprobt und das NRF wurde um mehr als 50 neue topische Rezepturen erweitert. Diese wurden alle in den vorliegenden Band neu aufgenommen sowie auch einige freie Rezepturformeln. Dagegen wurden einige obsolete oder kaum noch in der Praxis gebrauchte Rezepturen nicht wieder aufgeführt. Im Vergleich zur 1. Auflage wurde die Zahl der Rezepturen von 108 auf 137 erhöht.
Die große Zahl der genau dargestellten offizinellen Grundlagen als auch die eingehende Beschreibung der Wirkstoffe erleichtern es dem Arzt, auch individuelle freie Rezepturen zu verschreiben. Für den mit dem Rezeptieren vertrauten Arzt eröffnet sich so die Möglichkeit einer individualisierten topischen Therapie des Patienten, die dem jeweiligen Krankheitsbild, der Akuität und dem Hauttyp des Patienten Rechnung trägt. So kann der Behandlungserfolg für unsere Patienten verbessert werden und darin liegt das Hauptziel des vorliegenden Bandes.
Tübingen, im April 2005 Prof. Dr. med. Claus Garbe
Eschborn, im April 2005 Dr. rer. nat. Holger Reimann
Vorwort zur ersten Auflage
In der dermatologischen Literatur existieren eine Vielzahl von Rezeptursammlungen, die oftmals einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Die Rezepturen enthalten z.T. obsolete Wirkstoffe, sind galenisch nicht verträglich, weisen eine unzureichende physikalische oder chemische Stabilität auf, oder sind aus therapeutischen Gesichtspunkten nicht rationell kombiniert. Mit dem vorliegenden Band beabsichtigen wir, therapeutisch sinnvolle Rezepturen zusammenzustellen, die galenisch verträgliche Komponenten enthalten und eine hinreichende Stabilität besitzen. Diese Aufgabe wurde in einer arbeitsintensiven Kooperation zwischen Dermatologen und Apothekern in Angriff genommen.
Im vorliegenden Band werden die theoretischen und pharmazeutischen Grundlagen der dermatologischen Rezeptur ausführlich behandelt. Dazu gehören die Eigenschaften und die Indikationsgebiete der offizinellen Grundlagen, die Besprechung von 70 Wirkstoffen und von mehr als 120 Hilfsstoffen sowie von möglichen Inkompatibilitäten. Der aktuelle Stand der Bewertung obsoleter Stoffe wird dargestellt. In die Rezeptursammlung wurden 108 Rezepturen aufgenommen, die mit einem pharmazeutischen Kommentar, dermatologischen Indikationen, Anwendungshinweisen und Preiskalkulationen versehen wurden. Die vielen Preisbeispiele machen auch die wirtschaftliche Bewertung der Rezeptur möglich. Dieser Band stellt erst einen wichtigen Schritt in Richtung auf wissenschaftlich begründete Rezepturempfehlungen dar, der weiterer Ergänzung bedarf. Für Hinweise und Vorschläge sind wir dankbar.
Das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker in Eschborn prüft Rezepturen auf ihre galenischen Eigenschaften und ihre Haltbarkeit, und unter der Leitung von Herrn Dr. rer. nat. H. Reimann wurden Standardvorschriften für die Herstellung in der Apotheke ausgearbeitet, die im Neuen Rezeptur-Formularium (NRF) enthalten sind. Diese Rezepturen wurden im vorliegenden Band berücksichtigt. Frau Dr. rer. nat. C. Sander-Bähr hat darüber hinaus in das vorliegende Werk ihre Erfahrungen als Krankenhausapothekerin mit der Herstellung und dem Einsatz dermatologischer Rezepturen eingebracht. An einer 1. Bearbeitung der Rezepturen haben sich aktiv die Ärzte der Poliklinik in der Universitäts-Hautklinik im Klinikum Benjamin Franklin in Berlin beteiligt, unser Dank gilt Frau Dr. U. Blume-Petavi, Herrn Dr. U. Hettmannsberger, Herrn Dr. E. Hilbert, Herrn Dr. K. Krasagakis, Herrn Dr. M. Owsianowski, Frau Dr. K. Schröder und Herrn Dr. G. Wahl.
Schließlich wurden auch Rezepturempfehlungen der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie berücksichtigt. Die Angaben über die Kompatibilität und über die Stabilität dieser Empfehlungen stammen von den Herstellern und wurden von uns nicht überprüft. Schließlich sind wir Herrn Dr. rer. nat. H. W. Reinhardt aus Offenbach für seine kritische Durchsicht des Manuskriptes und für seinen Kommentar zu Rezepturempfehlungen der pharmazeutischen Industrie zu Dank verpflichtet.
Tübingen, im März 1996 Prof. Dr. med. Claus Garbe
Inhaltsverzeichnis
Titelei
Vorwort zur dritten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
1 Warum rezeptieren?
1.1 Qualitätsanforderungen an dermatologische Rezepturarzneimittel
1.2 Individualisierung der topischen dermatologischen Behandlung
1.2.1 Vorteile
1.2.2 Ziele
1.3 Überholte Traditionen des dermatologischen Rezeptierens
1.3.1 Traditionalistisches Konzept
1.3.2 Verwendung obsoleter Substanzen
1.3.3 Verdünnung wirkstoffhaltiger Fertigarzneimittel mit verschiedenen Grundlagen
1.3.4 Wirkstoffzusatz zu Dermatika der Basispflege
2 Qualitätssicherung bei Verschreibung und Zubereitung
2.1 Nutzen-Risiko-Beurteilung durch Arzt und Apotheker
2.2 Sicherung der pharmazeutischen Qualität
2.3 Plausibilitätsprüfung nach Apothekenbetriebsordnung
2.3.1 Ungenaue Wirkstoff-Verordnung
2.3.2 Unverträglichkeiten
2.3.3 Fehlende Gebrauchsanweisung
2.3.4 Problematische Wirkstoffe
2.3.5 Fehlender Qualitätsnachweis
2.4 Dermatologen-Qualifikation „Magistralrezepturen“
3 Wie rezeptieren?
3.1 Rezeptformalität
3.2 Verschreibung
3.3 Rezeptursammlung in der Apotheke – gesetzliche Grundlagen
3.3.1 Arzneibuch
3.3.2 Deutscher Arzneimittel-Codex
3.3.3 Neues Rezeptur-Formularium
3.3.4 Standardrezepturen
3.3.5 Sonstige Formelsammlungen
4 Kosten
4.1 Fertigarzneimittel
4.2 Rezepturarzneimittel
4.2.1 Vorgefertigt erhältliche Dermatikagrundlagen
4.2.2 Verpackungen und Applikationshilfen
4.2.3 Zusätzliche Bestandteile
4.2.4 Beispiele
5 Offizinelle Grundlagen mit Indikationen und Rezepturbeispielen
5.1 Salben
5.1.1 Hydrophobe Salben (lipophile Salben)
5.1.2 Wasser aufnehmende Salben
5.2 Cremes
5.2.1 Lipophile Cremes
5.2.2 Hydrophile Cremes
5.2.3 Ambiphile Cremes
5.2.4 Hautemulsionen (O/W)
5.3 Gele
5.3.1 Lipophile Gele
5.3.2 Hydrophile Gele
5.4 Schüttelmixturen (hydrophile Suspensionen)
5.5 Pasten
5.5.1 Harte Pasten
5.5.2 Weiche Pasten
5.5.3 Flüssige Pasten (lipophile Suspensionen)
5.6 Lösungen
5.6.1 Wässrige und alkoholische Lösungen
5.6.2 Bäder
5.6.3 Feuchter Verband (Umschlag)
5.6.4 Fettfeuchter Verband
5.6.5 Okklusivverband
5.6.6 Lacke
5.6.7 Sprays
5.7 Puder
6 Rezeptierbare Wirkstoffe
6.1 Albendazol
6.2 Aluminiumchlorid-Hexahydrat
6.3 Aminolevulinsäurehydrochlorid
6.4 Ammoniumbituminosulfonat, hell und dunkel (Leukichthol, Ichthyol)
6.5 Antibiotika
6.6 Antimykotika
6.7 Benzydaminhydrochlorid
6.8 Capsaicinoide
6.9 Chinolinolderivate
6.10 Chlorhexidin-Salze
6.11 Dexpanthenol
6.12 Diltiazemhydrochlorid
6.13 Dimeticon
6.14 Dithranol (Cignolin)
6.15 Eosin
6.16 Estrogenderivate
6.17 Ethacridinlactat (Rivanol)
6.18 Glyceroltrinitrat
6.19 Harnstoff
6.20 Hydrochinon
6.21 Kaliumpermanganat
6.22 Kortikosteroide
6.23 Lauromacrogol 400 (Polidocanol 600, Thesit)
6.24 Methoxsalen
6.25 Methylrosaniliniumchlorid
6.26 Metronidazol
6.27 Milchsäure
6.28 Minoxidil
6.29 Octenidindihydrochlorid
6.30 Permethrin
6.31 Phenol
6.32 Polihexanid
6.33 Povidon-Iod
6.34 Propranololhydrochlorid
6.35 Salicylsäure
6.36 Silbernitrat
6.37 Steinkohlenteer
6.38 Tretinoin (Vitamin-A-Säure)
6.39 Trichloressigsäure
6.40 Triclosan
6.41 Zinkoxid
6.42 Zinksulfat
7 Hilfsstoffe
7.1 Hydrophobe Stoffe als Lipidbestandteile und Konsistenzgeber
7.2 Hydrophile Komponenten und Lösevermittler
7.3 Emulgatoren und Tenside
7.4 Pigmente und Pudergrundstoffe
7.5 Verdickungsmittel
7.6 pH-Regulanzien
7.7 Konservierungsmittel
7.8 Antioxidantien
7.9 Wechselwirkungen und Unverträglichkeiten
7.9.1 Physikalisch-chemische Unverträglichkeiten
7.9.2 Wechselwirkung über Wasserstoffbrücken
7.9.3 Ionische Wechselwirkung
7.9.4 Grenzflächeneffekte
7.9.5 Beeinflussung der Wirkung
8 Haltbarkeit von Dermatikarezepturen
8.1 Haltbarkeit von Grundstoffen
8.2 Laufzeit von Fertigarzneimitteln
8.3 Aufbrauchfrist von Rezepturarzneimitteln
9 Obsolete, bedenkliche und problematische Stoffe
9.1 Obsolete Wirkstoffe
9.2 Aufbereitungsmonografien für die Nachzulassung
9.3 Obsolete Hilfsstoffe
9.4 Empfehlungen für den Umgang mit Problemstoffen
10 Kommentierte Rezeptursammlung einschließlich NRF-Rezepturen
10.1 Wasserfreie Salbengrundlagen
10.1.1 Weißes Vaselin Ph. Eur. (Vaselinum album)
10.1.2 Halbfestes Hartfett (Neutralfett; Softisan 378)
10.1.3 Wollwachsalkoholsalbe DAB
10.1.4 Wollwachsalkoholsalbe SR mit Gelbem Vaselin DAC undWollwachsalkoholsalbe SR mit Weißem Vaselin DAC
10.1.5 Hydrophile Salbe DAB (Unguentum emulsificans)
10.1.6 Hydrophobes Basisgel DAC (Mucilago basalis hydrophobica, Polyethylen-Oleogel)
10.1.7 Hypromellose-Haftpaste 40% (NRF-Stammzubereitung S.42.)
10.2 Cremes und Emulsionsgrundlagen (geordnet nach Emulsionstyp und steigendem Wassergehalt)
10.2.1 Weiche Creme DAC (ehemals: Weiche Salbe DAC; Unguentum molle)
10.2.2 Kühlcreme DAB (Unguentum leniens; ehemals: Kühlsalbe DAB)
10.2.3 Wollwachsalkoholcreme DAB (Lanae alcoholum unguentum aquosum, Eucerinum cum aqua; ehemals: Wasserhaltige Wollwachsalkoholsalbe DAB)
10.2.4 Hydrophobe Basiscreme DAC
10.2.5 Basiscreme DAC (Cremor basalis, ambiphile Creme)
10.2.6 Nichtionische hydrophile Creme DAB (Unguentum emulsificans nonionicum aquosum)
10.2.7 Nichtionische hydrophile Creme SR DAC
10.2.8 Anionische hydrophile Creme SR DAC
10.2.9 Anionische hydrophile Creme DAB (Unguentum emulsificans aquosum)
10.2.10 Nichtionisches wasserhaltiges Liniment DAC
10.2.11 Wasserhaltiges Liniment SR DAC
10.2.12 Hydrophile Basisemulsion DAC (NRF-Stammzubereitung S.25.)
10.3 Fettfreie Dermatika-Grundlagen
10.3.1 Macrogolsalbe DAC
10.3.2 Hydroxyethylcellulosegel DAB (Hydroxyethylcellulosi mucilago)
10.3.3 Carbomergel pH 6,5 (NRF Stammzubereitung S.43.)
10.4 Zinkoxidhaltige Grundlagen und Zubereitungen
10.4.1 Zinkoxid-Talkum-Puder 50%, weiß oder hautfarben (NRF 11.60.; Zink-Puder, weiß oder hautfarben)
10.4.2 Zinkoxidschüttelmixtur DAC (weiß) oder hautfarben (NRF 11.22.; Zinci oxidi lotio/Zinci oxidi lotio rubra, Lotio alba aquosa/Lotio rubra aquosa)
10.4.3 Ethanolhaltige Zinkoxidschüttelmixtur, weiß oder hautfarben (NRF 11.3.)
10.4.4 Ethanolhaltige hydrophile Zinkoxid-Paste 18% (NRF 11.49; 18er-Lotio)
10.4.5 Zinkpaste DAB (Zinci pasta, Pasta zinci)
10.4.6 Weiche Zinkpaste DAB (NRF 11.21.; Pasta zinci mollis DAB)
10.4.7 Zinkoxidöl DAC (NRF 11.20.; Zinci oleum, Oleum zinci)
10.5 Salicylsäurehaltige Rezepturen
10.5.1 Salicylsäure-Salbe 1% / 2% / 3% / 5% / 10% / 20% (NRF 11.43.)
10.5.2 Salicylsäure-Öl 2% / 5% / 10% (NRF 11.44.)
10.5.3 Abwaschbares Salicylsäure-Öl 2% / 5% / 10% (NRF 11.85.)
10.5.4 Hydrophile Salicylsäure-Creme 5% (NRF 11.106.)
10.5.5 Ethanolhaltiges Salicylsäure-Gel 6% (NRF 11.54.)
10.5.6 Fettender Salicylsäure-Hautspiritus 1% / 2% / 3% / 5% (NRF 11.45.)
10.5.7 2-Propanolhaltiger Salicylsäure-Hautspiritus 1% / 2% / 3% / 5% / 10% (NRF 11.55.)
10.6 Harnstoffhaltige Rezepturen
10.6.1 Lipophile Harnstoff-Creme 5% / 10% (NRF 11.129.)
10.6.2 Hydrophile Harnstoff-Creme 5% / 10% (NRF 11.71.)
10.6.3 Hydrophile Harnstoff-Emulsion 5% / 10% (NRF 11.72.)
10.6.4 Harnstoff-Cetomacrogolcreme 10% (NRF 11.73.)
10.6.5 Harnstoff-Wollwachsalkoholcreme 5% / 10% (NRF 11.74.)
10.6.6 Lipophile Harnstoff-Natriumchlorid-Creme (NRF 11.75.)
10.7 Kortikosteroidhaltige Externa
10.7.1 Hydrophile Hydrocortisonacetat-Creme 0,25% / 0,5% / 1% (NRF 11.15.)
10.7.2 Hydrophile Hydrocortison-Creme 0,25% / 0,5% / 1% (NRF 11.36.)
10.7.3 Lipophile Hydrocortisonacetat-Creme 0,25% / 0,5% / 1% (freie Rezepturformel)
10.7.4 Hydrophile Prednisolonacetat-Creme 0,25% / 0,5% (NRF 11.35.)
10.7.5 Hydrophile Prednicarbat-Creme 0,08% / 0,15% / 0,25% (NRF 11.144.)
10.7.6 Hydrophile Prednicarbat-Creme 0,08% / 0,15% / 0,25% mit Octenidindihydrochlorid 0,1% (NRF 11.145.)
10.7.7 Hydrophile Triamcinolonacetonid-Creme 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.38.)
10.7.8 Hydrophile Triamcinolonacetonid-Emulsion 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.90.)
10.7.9 Triamcinolonacetonid-Hautspiritus 0,1% / 0,2% mit Salicylsäure 2% (NRF 11.39.)
10.7.10 Triamcinolonacetonid-Haftpaste 0,1% (NRF 7.10.)
10.7.11 Abwaschbares Salicylsäure-Öl 2% / 5% / 10% mit Triamcinolonacetonid 0,1% (NRF 11.140.)
10.7.12 Hydrophile Betamethasonvalerat-Creme 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.37.)
10.7.13 Hydrophile Betamethasonvalerat-Emulsion 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.47.)
10.7.14 Betamethasonvalerat-Haftpaste 0,1% (NRF 7.11.)
10.7.15 Hydrophile Mometasonfuroat-Creme 0,1% (freie Rezepturformel)
10.7.16 Hydrophile Mometasonfuroat-Creme 0,1% mit Ciclopirox-Olamin 1% (freie Rezepturformel)
10.7.17 Lipophile Mometasonfuroat-Creme 0,1% mit Octenidindihydrochlorid-Creme 0,1% (freie Rezepturformel)
10.7.18 Hydrophile Clobetasolpropionat-Creme 0,05% (NRF 11.76.)
10.8 Antipruriginosa
10.8.1 Hydrophile Capsaicinoid-Creme 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.125.)
10.8.2 Hydrophile Polidocanol-Creme 5% / 10% (NRF 11.118.)
10.8.3 Hydrophiles Polidocanol-Gel 5% (NRF 11.117.)
10.8.4 Lipophile Polidocanol-Creme 5% / 10% (NRF 11.119.)
10.8.5 Lipophile Polidocanol-Creme 5% mit Harnstoff 5% (NRF 11.120.)
10.8.6 Polidocanol-Zinkoxidschüttelmixtur 3% / 5% / 10% (NRF 11.66.; Thesit in Lotio alba)
10.9 Antipsoriatika
10.9.1 Dithranol-Vaselin 0,05% / 0,1% / 0,25% / 0,5%/ 1% / 2% mit Salicylsäure 2% (NRF 11.51.)
10.9.2 Dithranol-Macrogolsalbe 0,5% / 1% / 2% / 3% (NRF 11.53.)
10.9.3 Methoxsalen-Badekonzentrat 5 mg/ml (NRF 11.83.)
10.9.4 Hydrophile Methoxsalen-Creme 0,0006% (NRF 11.96.)
10.10 Kortisonfreie Antiekzematosa
10.10.1 Ammoniumbituminosulfonat-Zinkoxidschüttelmixtur 2,5% / 5% / 10% (NRF 11.2.)
10.10.2 Lipophile Ammoniumbituminosulfonat-Creme 5% / 10% / 20% / 50% (NRF 11.12.)
10.10.3 Lipophile Steinkohlenteer-Salbe 2% / 5% / 10% / 20% (NRF 11.46.)
10.10.4 Hydrophile LCD-Creme 5% / 10% / 20% (NRF 11.86.)
10.10.5 LCD-Vaselin 5% / 10% / 20% (NRF 11.87.)
10.10.6 Hydrophile Salicylsäure-Creme 5% mit Steinkohlenteerspiritus 10% (NRF 11.107.)
10.11 Desinfizienzien
10.11.1 Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat-Lösung 0,14% (NRF 11.127.)
10.11.2 Hydrophile Chlorhexidindigluconat-Creme 0,5% / 1% (NRF 11.116.)
10.11.3 Ethanolhaltige Chlorhexidindigluconat-Lösung 0,5% / 1% (NRF 11.126.)
10.11.4 Ethanolhaltige Eosin-Dinatrium-Lösung 0,5% / 1% / 2% (NRF 11.94.)
10.11.5 Wässrige Eosin-Dinatrium-Lösung 0,5% / 1% / 2% (NRF 11.95.)
10.11.6 Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung 0,05% / 0,1% / 0,5% / 1% (NRF 11.61.; Rivanol-haltige Lösung)
10.11.7 Ethanolhaltige Ethacridinlactat-Monohydrat-Lösung 0,05% / 0,1% (NRF 11.8.; alkoholische Rivanol-Lösung)
10.11.8 Kaliumpermanganat-Lösungskonzentrat 1% (NRF 11.82.)
10.11.9 Methylrosaniliniumchlorid-Lösung 0,1% / 0,5% (NRF 11.69.; Gentianaviolett-Lösung)
10.11.10 Lipophile Octenidindihydrochlorid-Creme 0,1% (freie Rezepturformel)
10.11.11 Silbernitrat-Lösung 0,5% / 1% (NRF 11.98.)
10.11.12 Silbernitrat-Lösung 10% (NRF 11.99.)
10.11.13 Hydrophile Triclosan-Creme 1% / 2% (NRF 11.135.)
10.11.14 Lipophile Triclosan-Creme 1% / 2% (NRF 11.122.)
10.12 Antiinfektiosa
10.12.1 Hydrophile Albendazol-Creme 10% (freie Rezepturformel)
10.12.2 Hydrophile Ciclopirox-Olamin-Creme 1% mit Salicylsäure 5% (freie Rezepturformel)
10.12.3 Hydrophile Clotrimazol-Lösung 1% (NRF 11.40.)
10.12.4 Harnstoff-Paste 40% mit Clotrimazol 1% (NRF 11.57.)
10.12.5 Hydrophile Miconazolnitrat-Creme 2% (NRF 11.79.)
10.12.6 Hydrophiles Metronidazol-Gel 0,75% (NRF 11.65.)
10.12.7 Hydrophile Metronidazol-Creme 1% / 2% (NRF 11.91.)
10.12.8 Hydrophile Permethrin-Creme 2,5% / 5% (freie Rezepturformel)
10.13 Wundbehandlungsmittel
10.13.1 Hydrophile Dexpanthenol-Creme 5% (NRF 11.28.)
10.13.2 Lipophile Dexpanthenol-Creme 5% (NRF 11.29.)
10.13.3 Povidon-Iod-Zuckersalbe 2,5% (NRF 11.42.)
10.13.4 Polihexanid-Lösung 0,02% / 0,04% (NRF 11.128.)
10.13.5 Hydrophiles Polihexanid-Gel 0,04% / 0,1% (NRF 11.131.)
10.13.6 Polihexanid-Macrogolsalbe 0,04% / 0,1% (NRF 11.137.)
10.14 Antihidrotika
10.14.1 Hydrophiles Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Gel 15% / 20% (NRF 11.24.)
10.14.2 2-Propanolhaltige Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 15% / 20% (NRF 11.1.)
10.14.3 Viskose Aluminiumchlorid-Hexahydrat-Lösung 15% / 20% (NRF 11.132.)
10.15 Akne-Therapeutika
10.15.1 Salicylsäure-Aknespiritus 5% / 10% (NRF 11.23.)
10.15.2 Ethanolhaltige Erythromycin-Lösung 0,5% / 1% / 2% / 4% (NRF 11.78.)
10.15.3 Hydrophile Erythromycin-Creme 1% / 2% / 4% (NRF 11.77.)
10.15.4 Ethanolhaltiges Erythromycin-Gel 0,5% / 1% / 2% / 4% (NRF 11.84.)
10.15.5 Lipophile Tretinoin-Creme 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.123.)
10.15.6 Hydrophile Tretinoin-Creme 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.100.)
10.15.7 Hydrophiles Tretinoin-Gel 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.124.)
10.15.8 Ethanolhaltige Tretinoin-Lösung 0,025% / 0,05% / 0,1% (NRF 11.102.)
10.16 Warzentherapeutika und Schälmittel (Peeling)
10.16.1 Harnstoff-Paste 40% (NRF 11.30.)
10.16.2 Warzensalbe (NRF 11.31.)
10.16.3 Milchsäurehaltiges Salicylsäure-Collodium 10% (NRF 11.18.)
10.16.4 Trichloressigsäure-Lösung 10% / 20% / 35% / 50% / 65% (NRF 11.133.)
10.17 Proktologika
10.17.1 Hydrophile Diltiazemhydrochlorid-Rektalcreme 2% (NRF 5.7.)
10.17.2 Hydrophiles Diltiazemhydrochlorid-Rektalgel 2% (NRF 5.6.)
10.17.3 Hydrophile Glyceroltrinitrat-Rektalcreme 0,2% (NRF 5.10.)
10.17.4 Phenol-Erdnussöl-Injektionslösung 5% (NRF 5.3.)
10.17.5 Ethanolhaltige Zinkchlorid-Sklerosierungslösung (NRF 5.5.)
10.18 Stomatologika
10.18.1 Viskose Benzydaminhydrochlorid 1,5 mg/ml mit Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol (NRF 7.15.)
10.18.2 Chlorhexidindigluconat-Mundspüllösung 0,1% / 0,2% (NRF 7.2.)
10.18.3 Citronensäure-Glycerol 0,5% / 1% / 2% (NRF 7.4.)
10.18.4 Dexpanthenol-Lösung 5% (NRF 7.3.)
10.18.5 Hydrocortisonacetat-Suspension 0,5% mit Lidocainhydrochlorid und Dexpanthenol (NRF 7.14.)
10.18.6 Lidocainhydrochlorid-Lösung 1% mit Dexpanthenol (NRF 7.13.)
10.18.7 Tretinoin-Haftpaste 0,05% / 0,1% (NRF 7.9.)
10.19 Sonstiges
10.19.1 Aminolevulinsäurehydrochlorid-Thermogel 10% (freie Rezepturformel)
10.19.2 Depigmentierende Kligman-Creme 2% / 3% Hydrochinon (freie Rezepturformel)
10.19.3 Minoxidil-Haarspiritus 2% / 5% (NRF 11.121.)
10.19.4 Propranololhydrochlorid-Lösung 5 mg/ml (NRF 11.142.)
11 Weiterführende Literatur
11.1 Stellungnahmen und Leitlinien
11.2 Historische und aktuelle Formularien
11.3 Rezepturbücher
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum/Access Code
1 Warum rezeptieren?
Für topische Behandlungen steht dem dermatologisch behandelnden Arzt eine breite Palette von Fertigarzneimitteln zur Verfügung. Der Dermatologe kann in seiner Behandlung heute weitgehend ohne selbst verfasste Rezepturen auskommen. Die pharmazeutische Industrie hat fast alle modernen gebräuchlichen dermatologischen Rezepturen in Fertigarzneimittel umgesetzt. Dennoch und trotz der 2012 mit der Novelle der Apothekenbetriebsordnung erzwungenen Plausibilitätsprüfung jeder Verordnung erfreut sich die Rezeptur insbesondere bei Dermatologen großer Beliebtheit. Hierfür gibt es verschiedene Gründe, die unter den Zielen des Rezeptierens ausführlich dargestellt werden. Ausschlaggebend sind vor allem 3 Vorteile der Rezeptur:
Sie erweitert in einigen Fällen die Behandlungsoptionen, wenn sonst (noch) nicht erhältliche Wirkstoffe verschrieben werden.
Die Rezeptur kann individuell auf die Erfordernisse des Patienten abgestimmt werden; so können beispielsweise Allergie auslösende Substanzen, wie Konservanzien, Duftstoffe oder Emulgatoren, gezielt vermieden werden, und die Grundlage der Rezeptur kann auf den Hauttyp des Patienten abgestimmt werden.
Rezepturarzneimittel können – besonders bei größeren Verschreibungsmengen von Salben – erheblich billiger als Fertigarzneimittel sein. Dies gilt insbesondere für die in der dermatologischen Behandlung häufig verwendeten topischen Kortikosteroide.
1.1 Qualitätsanforderungen an dermatologische Rezepturarzneimittel
Mit der Verlagerung der Herstellung von den Apotheken auf die pharmazeutische Industrie haben sich die Qualitätsanforderungen an Arzneimittel grundlegend geändert. Die Entwicklung eines Arzneimittels setzt heute umfangreiche Testungen in vitro und in vivo voraus, die Aufschlüsse über die Unbedenklichkeit des Wirkstoffes, seine Pharmakokinetik und seine Wirkung geben müssen. Bei Zulassung von Fertigarzneimitteln müssen die pharmazeutische Qualität, einschließlich der Haltbarkeit, sowie die Unbedenklichkeit und die Wirksamkeit der Präparate in wissenschaftlich anerkannten Prüfungen nachgewiesen werden. Zusätzlich wird die Produktion der Arzneimittel weltweit strengen Kontrollen entsprechend den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) unterzogen.
Insofern hat die Verbreitung von Fertigarzneimittelpräparaten in der Dermatologie zweifellos zu einer wesentlichen Verbesserung der therapeutischen Optionen geführt und dazu beigetragen, dass Therapieerfolge durch Anwendung gleich bleibend qualitativ hochwertiger Arzneimittel besser reproduzierbar wurden. Von diesem Standard sind einige in der Dermatologie gebräuchliche Rezepturarzneimittel zurzeit noch deutlich entfernt.
Die dermatologische Rezeptur muss deshalb sowohl hinsichtlich Verschreibung als auch Zubereitung einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Rezepturarzneimittel sollten sich dem Standard annähern, der von Fertigarzneimitteln der pharmazeutischen Industrie vorgegeben wird (Kap. ▶ 2.2). Hierzu müssen folgende Mindestvoraussetzungen erfüllt sein:
Die rezeptierten Wirkstoffe und Hilfsstoffe sind nach bestem Ermessen unbedenklich.
Die verordneten Stoffe sind gegen das zu behandelnde Krankheitsbild wirksam.
Die Galenik des rezeptierten Arzneimittels stimmt; chemische und physikalische Stabilität sind gegeben.
Der Patient wird ausreichend informiert.
Mit diesem Anspruch wurden dermatologische Rezepturvorschriften im Pharmazeutischen Laboratorium des Neuen Rezeptur-Formulariums (NRF) überprüft, von der Kommission Deutscher Arzneimittel-Codex und Neues Rezeptur-Formularium (DAC/NRF-Kommission) wissenschaftlich beurteilt und im Neuen Rezeptur-Formularium (NRF) zusammengefasst. Das NRF ist eine von der Dachorganisation der deutschen Apotheker herausgegebene pharmazeutische Vorschriftensammlung, die neben etwa 130 Dermatikarezepturen etwa gleich viele Vorschriften aus anderen Indikationsgebieten enthält. Sie ist in jeder Apotheke vorhanden, bei Dermatologen und Allgemeinärzten aber noch nicht allgemein bekannt. Die Rezepturformeln des NRF stellen den Grundstock dieses Buches dar (Kap. ▶ 10). Darüber hinaus wurden zusätzlich Vorschriften aufgenommen, die aus Sicht der Verfasser eine sinnvolle Ergänzung darstellen.
Mithilfe dieser rationalen und rationell zu verschreibenden Rezepturen sollten Fehlschläge vermieden werden. Die Voraussetzung dazu ist eine Kooperation zwischen Arzt und Apotheker. Die ärztliche Ausbildung umfasst weder im Studium noch während der Spezialisierung eine eingehende Beschäftigung mit der Galenik, die aber Voraussetzung für die Herstellung von funktionierenden Rezepturen ist. Um das Wissen der rezeptierenden Ärzte über die Funktion der verschiedenen in den Rezepturen vorhandenen Wirk- und Hilfsstoffe zu verbessern, wird in diesem Buch bei jeder Rezeptur im Kommentar auf diese Punkte im Einzelnen eingegangen.
1.2 Individualisierung der topischen dermatologischen Behandlung
Individuelle Rezepturarzneimittel werden heute in größerem Maßstab nahezu nur noch für die topische Behandlung von Hautkrankheiten verordnet, neben dem spezifischen Bedarf für die HNO-Medizin, Ophthalmologie und Pädiatrie sowie für die Substitutionsbehandlung Opiatabhängiger.
1.2.1 Vorteile
Folgende Gründe sprechen dafür, dass die dermatologische Rezeptur auch langfristig eine sinnvolle Ergänzung zu Fertigarzneimitteln bleiben wird:
Wirkstoffe werden in Kombination mit Vehikeln (Grundlagen) therapeutisch angewandt, wobei die Wahl der richtigen Grundlage entscheidend für den Behandlungserfolg sein kann. Dafür können je nach Hauttyp und Krankheitsstadium unterschiedliche Erfordernisse vorliegen.
Bei der topischen Behandlung der Haut sind Allergien im Vergleich zur systemischen Anwendung von Wirkstoffen stark erhöht. Entsprechend häufiger muss dem Vorliegen von Allergien Rechnung getragen werden. Beim Rezeptieren können besonders einfach zusammengesetzte pharmazeutische Grundlagen verwendet werden, deren Sensibilisierungspotenzial gering ist. Je nach Fläche der Hauterscheinungen kann die erforderliche Menge des jeweiligen Externums außerordentlich stark variieren. Eine Ganzkörperbehandlung bei einer akuten Dermatitis kann 100–200 g Salbe täglich erfordern, während für eine kleinflächige Dermatitis (z.B. Herpes simplex) die Behandlung mit 5 g pro Woche genügen kann. Die Mengenstandardisierung ist deshalb für die topische Behandlung der Haut viel schwieriger als für die systemische Behandlung.
Eine Modifikation der Arzneiwirkung ist in der externen Therapie selten allein über die Dosierung ausreichend möglich, sodass sich Bedarf für unterschiedliche Konzentrationsstufen ergibt. Die erwünschten Konzentrationsunterschiede der verwendeten Wirkstoffe können dabei bis zu 2 Zehnerpotenzen umfassen. Fertigarzneimittel können aus wirtschaftlichen Gründen meist nur die wichtigsten Konzentrationsstufen berücksichtigen.
Lokaltherapeutika können in Fällen sinnvoller Wirkstoffkombination in der Regel nicht wie systemisch verabreichte Medikamente gleichzeitig gegeben werden, sondern müssen die Wirkstoffe in einer Rezepturzubereitung vereinigen. Entsprechende individuelle Kombinationen kann die Industrie ebenfalls nur schwer in Fertigarzneimitteln verwirklichen.
Die Haltbarkeit ist bei vielen wasserhaltigen Externa ein größeres Problem als bei den wasserfreien, festen Medikamenten zur oralen Verabreichung. So entsteht ein besonderer Bedarf für nur kurzfristig stabile Rezepturarzneimitteln bei dem Wunsch nach Vermeidung von Konservanzien wegen der Gefahr von Unverträglichkeitsreaktionen. Für die Behandlung sind dann passende Mengen zu rezeptieren.
1.2.2 Ziele
Folgende Ziele werden mit einer rationellen dermatologischen Rezeptur verbunden:
Sie ermöglicht die individuelle Auswahl, Dosierung und Kombination von Wirkstoffen. In seltenen Fällen können Wirkstoffe gewählt werden, die in Fertigarzneimitteln bisher nicht oder nicht als Monopräparate zur Verfügung stehen (z.B. Trichloressigsäure, Diphencypron, Octenidindihydrochlorid, Albendazol, Polihexanid, Triclosan). Häufig dient die Rezeptur der Wahl einer niedrigeren Wirkstoffkonzentration, als sie in Fertigarzneimitteln vorliegt (dies trifft etwa auf Permethrin und insbesondere auf Kortikosteroide zu). Auch die kombinierte Einarbeitung von Wirkstoffen, die in der topischen dermatologischen Therapie zur Anwendung kommt, kann individuell gestaltet werden.
Die Auswahl des Vehikels (der Grundlage) kann dem Akuitätsstadium der Erkrankung und dem jeweiligen Hauttyp individuell angepasst werden. Das gilt sowohl für den prinzipiellen Typ des Vehikels (Salbe, Creme, Lösung, Lotio, Gel) als auch für den gewünschten Fettgehalt bei Cremes und Salben. Zwar bieten auch Fertigarzneimittel eine gewisse Wahlmöglichkeit, die aber den Wunsch des Dermatologen nach der gesamten Klaviatur bei weitem nicht befriedigen kann.
In Bezug auf Wirkstoffe und Grundlagen können abgestufte Therapiestrategien verfolgt werden. So kann beispielsweise mit dem Abklingen einer akuten Dermatose die Konzentration des Wirkstoffes (z.B. bei Kortikosteroiden) gesenkt und der Fettgehalt der Grundlage stufenweise erhöht werden. Derartig abgestufte Therapiekonzepte werden mittels der Rezeptur optimiert.
Die individuelle Rezeptur stellt ein Mittel zur Verbesserung der Behandlungscompliance des Patienten dar. Die maßgeschneiderte Rezeptur zeigt dem Patienten, dass er keine Behandlung „von der Stange“ bekommt. Im Laufe längerfristiger Behandlungen lassen sich so die Rezepturarzneimittel sogar entsprechend der Rückmeldung und der Empfindlichkeit des Patienten modifizieren. Sie erlaubt auch, gegebenenfalls nach bisher erfolgloser Behandlung oder nach Arztwechsel, eine für den Patienten erkennbare Abgrenzung der Medikation.
Individuelle Rezepturarzneimittel sind zum Teil deutlich preisgünstiger als vergleichbare Fertigarzneimittel. Das trifft insbesondere dann zu, wenn größere Mengen eines Externums verordnet werden müssen. So kann beispielsweise bei kortikosteroidhaltigen Externa oft eine gleichwertige Rezeptur unter dem Preis verordnet werden, der sich bei Fertigarzneimitteln durch den Bedarf für mehr als eine 50-g-Tube ergibt. Damit kann der Arzt besser auf die Erfordernisse einer großflächigen Behandlung reagieren.
Dieses Buch soll helfen, die Vorteile der individuellen Rezeptur optimal auszuschöpfen. Die Rezepturformeln wurden nicht einfach aus anderen Kompendien abgeschrieben. Sie sind zum größten Teil im Pharmazeutischen Laboratorium des NRF standardisiert worden und haben sich in der Praxis bewährt. Auch wenn es paradox klingt, so liegt doch in dieser Standardisierung der Schlüssel zur praktikablen Individualisierung. Die ausführliche Kommentierung der pharmazeutischen Konzeption der aufgeführten Vorschriften und ihr Beispielcharakter sollen es weiterhin ermöglichen, in Anlehnung ähnliche Rezepturarzneimittel zu verschreiben.
1.3 Überholte Traditionen des dermatologischen Rezeptierens
Eine rationale dermatologische Rezeptur muss gegen verschiedene Traditionen des dermatologischen Rezeptierens durchgesetzt werden, die zum Teil noch die Praxis bestimmen.
1.3.1 Traditionalistisches Konzept
Viele Rezepturen entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zu einem Zeitpunkt, als erst wenige Wirkstoffe zur Lokalbehandlung zur Verfügung standen und Fertigarzneimittel noch nicht auf dem Markt waren. Die dermatologische Therapie war zu dieser Zeit fast ausschließlich topisch, und der behandelnde Dermatologe hatte keine Alternative zum Rezeptieren. Das Konzept des Rezeptierens war damals weitgehend verschieden vom heutigen Verständnis moderner Therapeutika. Während man heute als ein geeignetes Arzneimittel insbesondere Monosubstanzen in einer geeigneten Grundlage ansieht, wurden damals Rezepturen eher wie Kochrezepte gedacht. Das Zusammenmischen verschiedener Substanzen mit ähnlichen Effekten schien den bestmöglichen Erfolg zu versprechen, der damals noch kaum exakt messbar war.
Die bekanntesten Beispiele für diese Rezepturphilosophie sind die Solutio Castellani ( ▶ Tab. 1.1 ) und die Tinctura Arning. Beide Rezepturen sind in diesem Buch sowie im Neuen Rezeptur-Formularium nicht mehr enthalten, da sie aus obsoleten Wirkstoffen bestehen. Daneben finden sich aber in dermatologischen Rezeptursammlungen ärztlicher Praxen und Kliniken noch viele Beispiele, die diesem Konzept folgen und heute sicher als obsolet angesehen werden müssen. Dazu gehören etwa die Schälpasten nach Unna und nach Lassar, die heute in der Aknebehandlung besser durch Vitamin-A-Säure-Präparate oder andere ersetzt werden. Derartige Rezepturen wurden in die vorliegende Sammlung bewusst nicht mehr aufgenommen.
Tab. 1.1
Traditionelle Rezepturen der obsoleten Solutio Castellani im Vergleich der Deutschen Rezeptformeln und Ersatzrezepturen im Neuen Rezeptur-Formularium bis zur Streichung.
Deutsche Rezeptformeln
(DRF)
NRF 11.26. von 1983, 1996 entfallen)
NRF 11.26. von 1996, 2014 entfallen
NRF 11.26. von 2014, 2016 gestrichen
Sol. Fuchsini spirit. 10%
7,94
Solut. Fuchsini spirit. 4%
10,0
Solut. Fuchsini spirit. 5%
10,0
Fuchsin N
0,5
Phenol. liquefac.
3,97
Chlorocresol
0,1
-
-
Acidi Borici
0,79
Natriumedetat
0,02
-
-
Aceton
3,97
Aceton
5,0
Ethanol 96%
5,0
-
Resorcin
7,94
Resorcin
10,0
-
-
Aqua purif.
zu 100,0
Aqua purif.
zu 100,0
Aqua purif.
zu 100,0
Ger. Wasser
zu 100,0
1.3.2 Verwendung obsoleter Substanzen
Eine Reihe von Substanzen, die in klassischen Rezepturen enthalten sind, werden heute als obsolet angesehen (siehe Kap. ▶ 9). So liegen beispielsweise negative Monografien zur Nutzen-Risiko-Beurteilung für die inzwischen praktisch abgeschlossene Fertigarzneimittel-Nachzulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für folgende Stoffe vor: Resorcin, Phenol, Schwefel, topische Sulfonamide, Guajazulen, Cadmiumsulfid. Bei Verschreibung solcher Substanzen, wird sich der Arzt im Schadensfalle die Frage stellen lassen müssen, ob nicht unbedenklichere Alternativen zur Behandlung zur Verfügung standen.
Wegen ihrer Toxizität gelten seit langem Quecksilbersalze, Bleisalze und Borsäure in der topischen Behandlung als obsolet. Dieser Situation wurde im NRF bei der Zusammenstellung traditioneller Rezepturen zum Teil dadurch Rechnung getragen, dass obsolete Substanzen substituiert wurden, die Rezeptur aber für eine gewisse Zeit unter dem traditionellen Namen aufgeführt blieb (vergleiche dazu Solutio Castellani, ▶ Tab. 1.1 ). Wegen sämtlicher enthaltener Wirkstoffe und teilweise der Lösemittel wird die Castellani-Lösung in der vorliegenden Rezeptursammlung negativ kommentiert. Nachdem Fuchsin als der prägende Wirkstoff durch das unbedenkliche Fuchsin N ersetzt werden musste und das bald nicht mehr erhältlich war, ist die zusammengesetzte Farbstofflösung seit 2016 endgültig Medizingeschichte.
1.3.3 Verdünnung wirkstoffhaltiger Fertigarzneimittel mit verschiedenen Grundlagen
Diese heute noch verbreitete Praxis sollte bis auf wenige begründete Ausnahmen (Benzoylperoxid-Creme für einen Säugling) aufgegeben werden. Insbesondere das Zusammenmischen unterschiedlicher Fertigarzneipräparate, um verschiedene Wirkstoffe zu kombinieren, sollte unbedingt unterlassen werden. Hier werden unterschiedliche Grundlagen und Hilfsstoffe zusammengeführt, deren Kompatibilität infrage steht. Darüber hinaus summieren sich in der Endrezeptur die Hilfsstoffe, einschließlich Konservanzien und Duftstoffe, die das Sensibilisierungsrisiko zusätzlich erhöhen.
Zudem führt das Zusammenmischen verschiedener Fertigarzneimittel auch zu unnötig hohen Kosten, da zum Teil angebrochene Tuben voll berechnet werden müssen und zusätzlich die Preisbildung nach der Hilfstaxe für Apothekentaxe vorgenommen wird. Allenfalls ist es sinnvoll, ein wirkstoffhaltiges Fertigarzneipräparat mit der identischen Basiscreme zu verdünnen. In seltenen Fällen steht der Wirkstoff, wie bei Tacrolimus oder Ecrolimus, nicht als Rezeptursubstanz zur Verfügung (z.B. bei Patentschutz), sodass er bei Bedarf nur in Form des Fertigarzneimittels als Rezepturbestandteil verschrieben werden kann.
1.3.4 Wirkstoffzusatz zu Dermatika der Basispflege
Nur wenige der zur Körperpflege allgemein oder bei einem Krankheitsbild, wie der Akne vulgaris oder der Atopie, bewährten kosmetischen Mittel oder Medizinprodukte eignen sich für den Wirkstoffzusatz. Ablehnungsgrund ist meist weder die zu befürchtende Wirkungslosigkeit noch galenische Unverträglichkeiten, sondern ganz formal die Unmöglichkeit der pharmazeutischen Qualitätssicherung in der Apotheke. Im Übrigen können solche Produkte deutlich teurer sein als die für Rezepturzwecke bestimmten und vorgefertigt erhältlichen Grundlagen.
2 Qualitätssicherung bei Verschreibung und Zubereitung
Europäische und deutsche Gesetze respektieren die Notwendigkeit der Rezepturverordnung:
Gemäß der EU-Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel sind Rezepturarzneimittel („formula magistralis“) von der Zulassungspflicht der Fertigarzneimittel befreit (Artikel 3 Satz 1 Nr. 1).
Gemäß Patentgesetz sind Rezepturarzneimittel von Einschränkungen durch den Patentschutz ausgenommen (§ 11 Satz 1 Nr. 3 PatG).
Das Europäische Arzneibuch (Ph. Eur.) enthält mit der Monografie „Pharmazeutische Zubereitungen“ seit 2013 eine gemeinsame Vorschrift sowohl für die zulassungspflichtigen Fertigarzneimittel als auch ausdrücklich für die Rezepturarzneimittel. Die Forderungen an die Qualität sind grundsätzlich gleich, die Qualitätsnachweise sind jedoch angemessen und differenziert.
Im Spannungsverhältnis zwischen Fertigarzneimitteln und individueller Rezeptur geht es heute darum, den Qualitätsstandard der Rezepturen anzuheben. Dazu gehören die kritische Prüfung der verwendeten Inhaltsstoffe und damit der Verzicht auf einige traditionelle Substanzen, die heute als bedenklich eingestuft werden müssen. Die galenische Verträglichkeit der verwendeten Substanzen ist unbedingt zu fordern. Weiterhin sollen Arzt und Patient über die chemische und physikalische Haltbarkeit des rezeptierten Arzneimittels informiert sein. Schließlich sollte der verschreibende Arzt einen Preisvergleich zur Verordnung von Fertigarzneimitteln vornehmen können, unabhängig davon, ob mit den Kosten die gesetzlichen Krankenkassen, andere Träger oder die Patienten selbst belastet werden. Da die Berechnung des Preises rezeptierter Arzneimittel kompliziert ist (Kap. ▶ 4), ist die Angabe von Kosten für verschiedene Mengen der Rezeptur dazu erforderlich. Dieses Buch bietet dem rezeptierenden Arzt entsprechende Hilfestellungen, um rationelle Entscheidungen zu ermöglichen.
2.1 Nutzen-Risiko-Beurteilung durch Arzt und Apotheker
2011 hat das Ministerkomitee beim Europarat die von einer Arbeitsgruppe des Europäischen Direktorats für die Qualität der Arzneimittel und Medizinprodukte (EDQM) vorbereitete Entschließung über die Qualität und Sicherheit der in Apotheken hergestellten Arzneimittel veröffentlicht. Ein zentrales Element darin ist die gemeinsame Nutzen-Risiko-Beurteilung verschriebener Rezepturarzneimittel durch Arzt und Apotheker hinsichtlich
Wirksamkeit,
Unbedenklichkeit,
pharmazeutischer Qualität und
Patienteninformation.
In die Risikobeurteilung ist die Überlegung einzubeziehen, ob das Behandlungsziel sich nicht auch mit verfügbaren industriellen Fertigarzneimitteln erreichen lässt. Die Entschließung des Europarats (nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Gemeinschaft) hat jedoch allenfalls empfehlenden Charakter und keine unmittelbaren Auswirkungen auf die europäische oder nationale Gesetzgebung. Insofern ist die Priorisierung geeigneter Fertigarzneimittel gegenüber Rezepturarzneimitteln zwar in einigen europäischen Staaten vorgeschrieben und in Deutschland auch für Tierarzneimittel national umgesetzt. Für Humanarzneimittel gibt es eine solche gesetzliche Einschränkung aber u.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht: Dermatologische Rezepturverschreibungen stehen im Ermessen des Arztes auch dann, wenn ein vergleichbares Fertigarzneimittel zugelassen ist.
Die individuelle Nutzen-Risiko-Beurteilung bei Rezepturarzneimitteln als Gegenstück zum Zulassungsverfahren der industriellen Fertigarzneimittel ist jedoch 2012 ausdrücklich im Europäischen Arzneibuch und in der deutschen Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) als „Plausibilitätsprüfung“ aufgegriffen worden.
2.2 Sicherung der pharmazeutischen Qualität
Das Arzneimittelgesetz stellt die zentrale Forderung, dass alle Arzneimittel aus Ausgangsstoffen (Wirkstoffen und Hilfsstoffen) sowie Packmitteln von angemessener und geprüfter Qualität herzustellen sind. Hierbei gelten die Vorschriften des Arzneibuchs über die Prüfung und die Arzneibuchmonografien über Darreichungsformen für die Herstellung.
Nähere, zum GMP (Good Manufacturing Practice) der Pharmaindustrie ähnliche Regeln für Rezepturarzneimittel gibt die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO), die mit der Novelle 2012 wesentlich präzisiert wurde. Neu sind die Verbindlichkeit eines pharmazeutischen Qualitätsmanagements (QMS) in den Apotheken, die schriftlichen, vom Apotheker vor der Herstellung abzuzeichnenden Herstellungs- und Prüfanweisungen, die Dokumentationspflicht durch Herstellungs- und Prüfprotokolle zu jeder Herstellung einschließlich der formalen Freigabe. Die als „Plausibilitätsprüfung“ bezeichnete Risikobeurteilung geht von der ärztlichen Verschreibung als Quelle der Rezepturenherstellung aus und erfordert manchmal die Abstimmung zwischen Arzt und Apotheker.
Die Überwachungspraxis der Bundesländer hat in Deutschland Grenzwerte für Abweichungen von der Qualität herausgebildet, die zu Beanstandungen, Ordnungsgeldern und Strafen für den Apotheker führen. Bestimmte Interpretationshilfen zur Qualitätssicherung werden ebenfalls durch die Arbeitsgemeinschaft der Gesundheitsbehörden der Bundesländer publiziert.
2.3 Plausibilitätsprüfung nach Apothekenbetriebsordnung
Nach dermatologischen Gesichtspunkten auf den 1. Blick nachvollziehbare, spontane Rezepturverordnungen können in der Umsetzung unpraktikabel oder galenisch inkompatibel sein. Solche Ad-hoc-Verschreibungen haben ein hohes Risiko, dass es zu Verzögerungen kommt, weil der Apotheker ohne Rücksprache nur begrenzt Veränderungen an der Zusammensetzung vornehmen darf. Das Arzneimittelrecht verlangt von einem dermatologischen Rezepturarzneimittel einerseits ordnungsgemäße Qualität und die Herstellung nach den gesetzlichen Regeln, andererseits muss es nach ApBetrO auch der ärztlichen Verschreibung entsprechen und Informationen zur sicheren Anwendung geben. Idealerweise ist dies kein Gegensatz. In der Praxis werfen jedoch Rezepturverordnungen im Zusammenhang mit der „Plausibilitätsprüfung“ oft Fragen auf, die als „Unklarheiten“ ausgeräumt werden müssen, bevor das Arzneimittel hergestellt werden darf. Die mit der ApBetrO-Novelle 2012 eingeführte Dokumentationspflicht hat dies wegen häufiger und nachdrücklicher Rückfragen aus Apotheken plötzlich ins Bewusstsein der Dermatologen gerückt und zunächst erhebliche Verunsicherung hervorgerufen. Effekte sind neben einem möglichen Rückgang der Rezepturverschreibungen seit 2012 die verstärkte Bereinigung um obsolete Rezepturen, die erkannte Notwendigkeit zur stärkeren und besseren Kommunikation zwischen Arzt und Apotheker bei Rezepturunklarheiten sowie die stärkere Berücksichtigung standardisierter Rezepturvorschriften als solche oder als Ausgangspunkt individueller Modifikation.
Selbst offensichtliche Nichtpraktikabilität oder mikrobiologische Instabilität eines verschriebenen Rezepturarzneimittels brauchen nicht zwingend zur Rückfrage beim Verordner zu führen, wenn es lediglich um Variationen bei Hilfsstoffen geht und das tatsächlich hergestellte Arzneimittel im Grundsatz noch der Verordnung entspricht. Dagegen erfordern Unklarheiten bei Wirkstoffen praktisch immer das ärztliche Einverständnis für notwendige Änderungen. Die schriftliche Kommunikation ist meist vorteilhaft, hierzu bietet DAC/NRF den Apotheken verschiedene Schreibvorlagen für häufige Fälle an. Mit unterschiedlichen Anlässen und Zielen soll die Rücksprache u.a.
offensichtliche formale Rezeptierfehler korrigieren,
bei Bedenklichkeit einer Verschreibung Alternativen feststellen,
bei Verschreibung nicht allgemein bekannter oder umstrittener Wirkstoffe die positive individuelle Nutzen-Risiko-Beurteilung dokumentieren,
Unklarheiten oder Zweifel an einer Rezepturvorschrift ausräumen,
bei pharmazeutischen Qualitätsmängeln weitergehende Korrekturen oder Alternativen feststellen,
auch grundsätzlich praktikabel erscheinende Individualrezepturen durch standardisierte Alternativen ersetzen, um die Rezepturherstellung sicherer zu machen.
Die Plausibilitätsprüfung bei Verordnung der NRF-Vorschriften und anderer standardisierten Formeln ist sehr viel einfacher als bei Ad-hoc-Verschreibungen und wird selten zu Rückfragen führen. Jedoch ist dies vor allem bei fehlender Gebrauchsanweisung anzunehmen.
2.3.1 Ungenaue Wirkstoff-Verordnung
Der Apotheker ist nicht befugt, ohne Zustimmung des verschreibenden Arztes Art oder Menge des verordneten Wirkstoffes abzuändern, selbst wenn er die eigentliche Absicht vermutet. So werden bei topischen Kortikosteroiden auf das Rezept häufig ungenau die alkoholischen Muttersubstanzen geschrieben, die bei kutaner Anwendung oft kaum wirksam sind, wie Triamcinolon, Betamethason oder Clobetasol. Gemeint sind dann in der Regel die topisch wirksamen Acetonide oder Ester, wie Triamcinolonacetonid, Betamethasonvalerat bzw. Betamethasondipropionat und Clobetasolpropionat. Da es sich um Derivate mit kovalenter chemischer Bindung handelt, muss der Apotheker die förmliche ärztliche Zustimmung einholen. Nicht ganz so klar ist dies bei Verschreibung von Wirkstoff-Basen, -Säuren oder -Salzen, da sich diese unter Verantwortung des Apothekers durch pH-Änderung ineinander überführen lassen und häufig nur in einer bestimmten Form erhältlich sind. So wird der Apotheker zur Not die äquivalente (nicht die aufgeschriebene) Masse der zur Verfügung stehenden Rezeptursubstanz wählen, also Aminolevulinsäurehydrochlorid bei „Aminolevulinsäure“, Gentamicinsulfat bei „Gentamicin“, Eosin-Natrium bei „Eosin“ und Chinolinolsulfat-Kaliumsulfat bei „Chinolinolsulfat-Monohydrat“. Die zumindest nachträgliche Information aus der Apotheke ist in solchen Fällen empfehlenswert, um den Sachverhalt auch im Hinblick auf eventuelle Folgeverordnungen klarzustellen.





























