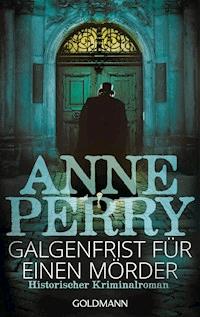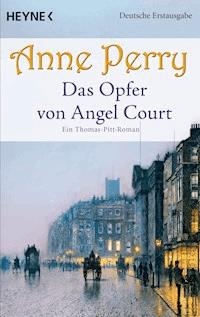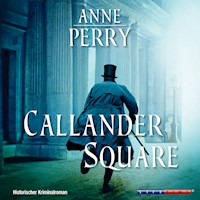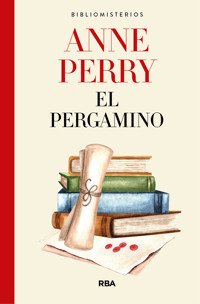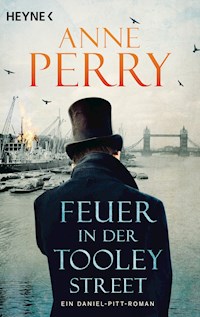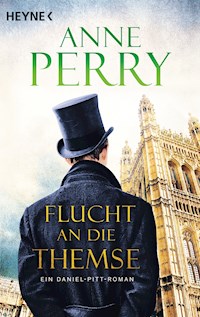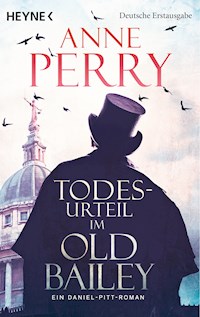8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: William Monk
- Sprache: Deutsch
Eine Mordserie erschüttert London. In dem Viertel Shadwell werden ungarische Einwanderer auf furchtbare Weise umgebracht. Um die Leichen herum sind stets siebzehn in Blut getauchte Kerzen angeordnet. Die Tat eines Wahnsinnigen? Die mit dem Fall beauftragte Polizei unter der Führung von Commander Monk tappt zunächst im Dunkeln. Doch dann kommt Bewegung in die Ermittlungen, denn der Arzt Fitzherbert taucht in der Stadt auf. Nach seinem Einsatz im Krimkrieg ist er schwer traumatisiert, und leidet unter Albträumen, die ihn bisweilen vergessen lassen, wer er ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Eine Mordserie erschüttert London. Im Abstand von jeweils wenigen Tagen werden in dem Viertel Shadwell ungarische Einwanderer auf furchtbare Weise hingerichtet aufgefunden. Stets bietet sich am Tatort des gleiche Bild: Dem Opfer ist ein Bajonett, eine Schere oder ein altes Schwert mit voller Wucht in die Brust gerammt worden. Um die Leiche herum sind siebzehn in Blut getauchte Kerzen angeordnet. Die Tat eines Wahnsinnigen? Eine ganze Weile tappt die mit dem Fall beauftragte Wasserpolizei unter der Führung von Commander Monk im Dunkeln. Der Finder des ersten Opfers, ein Ungar namens Antal Dobokai, hat ein hieb- und stichfestes Alibi. Bewegung kommt erst in die Ermittlungen, als der Arzt Fitzherbert ausgerechnet jetzt wieder in London auftaucht. Durch Erfahrungen im Krimkrieg ist er schwer traumatisiert und leidet unter Albträumen, die ihn bisweilen vergessen lassen, wer er ist …
Weitere Informationen zu Anne Perry
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
ANNE PERRY
Des anderen Feind
Roman
Aus dem Englischen
von Peter Pfaffinger
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»An Echo of Murder« bei Headline Publishing, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Zitat auf S. 105 aus: George Byron, Ritter Harold’s Pilgerfahrt, Übers. Adolf Seubert (gemeinfrei)
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung März 2018
Copyright © der Originalausgabe 2017 Anne Perry
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by Arrangement with Anne Perry Ltd.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © arcangel/Roy Bishop
Redaktion: Ilse Wagner
em · Herstellung: kw
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-21547-7V002
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Ken Sherman
für Jahre der Freundschaft
und die vielen guten Ratschläge
Personen
William Monk
Kommandant der Thames River Police
Hester Monk
seine Frau, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Klinik in der Portpool Lane
Hooper
Monks Stellvertreter und rechte Hand
Scuff
Monks und Hesters Adoptivsohn; jetzt auch Will genannt; wird von Crow zum Arzt ausgebildet
Crow
Arzt für die Armen
Dr. Hyde
Gerichtsmediziner
Imrus Fodor
Mordopfer
Antal Dobokai
Apotheker
Mrs Harris
Nachbarin von Imrus Fodor
Mrs Durridge
Fodors Haushälterin
Ferenc Ember
ungarischer Arzt
Lorand Gazda
Mann mittleren Alters, der nach der ungarischen Revolution nach England ausgewandert ist
Roger Haldane
Geschäftsmann
Adel Haldane
seine Frau
Tibor Havas
einer von Crows Patienten
Herbert Fitzherbert
Arzt, der im Krimkrieg bei der Armee diente
Sir Oliver Rathbone
Anwalt und langjähriger Freund der Monks
Claudine Burroughs
ehrenamtliche Helferin in Hesters Klinik
Squeaky Robinson
ehemaliger Bordellbetreiber; jetzt Buchhalter von Hesters Klinik
Agoston Bartos
junger Ungar
Bland
Inhaber eines Eisenwarenladens
Ruby Bland
arbeitet im Laden ihres Vaters mit
Stillman
junger Constable bei der Wasserpolizei
Mr Drury
Antiquitätenhändler
Worm
Gassenjunge, der jetzt in Hesters Klinik lebt
Viktor Rosza
ungarischer Bankier
Holloway
junger Polizist
Kalman Pataki
Ungar
Mrs Wynter
freundliche begüterte Frau
Charles Latterly
Hesters Bruder
Candace Finbar
Charles’ Mündel
Mr Justice Aldridge
Vorsitzender Richter am Old Bailey
Elijah Burnside
Rechtsanwalt
1
»Schlimme Sache, Sir«, murmelte der Constable von der städtischen Polizei kopfschüttelnd und trat zur Seite, damit Monk, der Kommandant der Thames River Police, die letzte der Steinstufen zum Kai erklimmen konnte. Hinter ihm hastete sein Stellvertreter Hooper die Stufen herauf, der erst noch das Ruderboot hatte vertäuen müssen.
Im Hafen, dem Pool of London, herrschte bereits reger Betrieb. Riesige Kräne hoben gewaltige Ballen aus den Laderäumen von Schiffen, um sie auf den Docks abzusetzen. Die Wasserstraßen waren verstopft mit den vor Anker liegenden Booten, mit Lastkähnen, die eifrig beladen wurden, und mit Fähren, die von einem Ufer zum anderen pendelten. Vor der Silhouette der Stadt ragte ein wirres Geflecht aus schwarzen Masten empor.
»Was ist so ungewöhnlich schlimm daran?«, erkundigte sich Monk. »Wer ist der Mann überhaupt?«
»Einer von diesen Ungarn.«
»Ungarn?« Monks Neugier war geweckt.
»Richtig, Sir. Wir haben hier in der Gegend ein paar davon. Nicht gerade Tausende, aber trotzdem genug.«
Der Mann von der städtischen Polizei führte sie vorbei an Stapeln von Nutzholz zu einer Lagerhalle und öffnete ihnen die Tür.
Monk trat als Erster ein; Hooper folgte ihm.
Im Inneren sah es aus wie in jedem anderen Warenlager auch – mächtige Stapel von Nutzholz, versiegelte Kisten und zu Bündeln geschnürte Waren –, nur dass hier in diesem Moment niemand arbeitete.
»Wir haben alle heimgeschickt«, erklärte der Constable, als er Monks Blick bemerkte. »Es ist besser, wenn sie nichts von alldem sehen.«
»War es einer von ihnen, der den Toten entdeckt hat?«, fragte Monk.
»Nein, Sir. Sie wussten gar nicht, dass er hier war. Jeder dachte, er wäre zu Hause – wo er auch hätte bleiben sollen.«
Der Polizist setzte sich wieder in Bewegung. An seiner Seite durchquerte Monk die Halle bis zu einer Treppe, die zu den Büros führte.
»Wer hat ihn dann entdeckt?«
»Ein gewisser Mister Dob… und noch irgendwas. Ich kann diese Namen einfach nicht aussprechen.«
»Gehen Sie voran«, wies Monk ihn an. »Sie haben sicher schon nach dem Gerichtsmediziner schicken lassen?«
»O ja, Sir! Und ich habe nichts angefasst! Das können Sie mir glauben.«
Monk befiel eine dunkle Vorahnung, doch er gab dem Mann keine Antwort.
Am Treppenabsatz angekommen, folgten sie einem kurzen Durchgang zu einer Tür. Dahinter war Gemurmel zu vernehmen. Der Polizist klopfte kurz an, dann öffnete er sie und ließ Monk den Vortritt.
Der Raum war hell und für ein Büro ziemlich groß. Natürlich wurde Monk nicht zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert. Im Gegenteil, die Beschäftigung mit Leichen machte einen großen Teil seines Berufs aus. Doch was sich ihm hier darbot, das waren Spuren übelster Gewalt, wie er sie kaum je erlebt hatte. Der durchdringende Geruch von Blut hing nicht einfach in der Luft, er schien vielmehr von jedem Gegenstand auszuströmen, als wäre der arme Mann gegen die Stühle, den Tisch und sogar die Wände getorkelt. Jetzt lag er rücklings auf dem Boden. Das schief und krumm wie ein geborstener Mast aus seiner Brust ragende Armeegewehr mitsamt dem daran befestigten Bajonett erweckte den Eindruck, als würde es jeden Moment aus der Wunde kippen.
Monk blinzelte.
Ein vor der Leiche kniender Herr mittleren Alters unterbrach seine Untersuchung, um sich zu Monk umzudrehen. »Dachte mir schon, dass sie Sie holen würden«, bemerkte er trocken. »Das ist keine Aufgabe, die man freiwillig auf sich nimmt, wenn die Möglichkeit besteht, sie jemand anderem aufzuhalsen. Und weil die Lagerhalle am Fluss liegt, trifft es wohl Sie.«
»Guten Morgen, Mr Hyde«, sagte Monk düster. Er kannte und schätzte den Gerichtsmediziner schon seit Langem. »Was können Sie mir berichten?«
»Der Mann ist seit etwa zwei Stunden tot, würde ich sagen. Medizinisch lässt sich das aber nicht genau begründen. Könnte auch schon länger her sein, allerdings war das Lager bis sechs Uhr morgens abgeschlossen, und die ganze Nacht hat er hier bestimmt nicht verbracht. Er muss also später gekommen sein. Einen zweiten Eingang gibt es nicht.«
»Aber mindestens seit eineinhalb Stunden?«, vergewisserte sich Monk. Das war ein enger Zeitrahmen – immerhin etwas.
»Ist noch warm«, erwiderte Hyde. »Und die ersten Arbeiter sind vor ungefähr einer Stunde eingetroffen. Ihr Freund« – er deutete auf den Polizisten – »wird Ihnen bestätigen, dass die Männer im Lager unten zu tun hatten und keiner hier heraufgekommen ist. Wenn es tatsächlich einer von ihnen war, der ihn ermordet hat, müssten sie alle unter einer Decke stecken und lügen, dass sich die Balken biegen.« Er senkte den Blick wieder auf das Opfer. »Die Sache scheint klar zu sein. Bajonett durch die Brust. Der Mann ist binnen Minuten verblutet.«
Monk schaute sich in dem mit Blut besudelten Raum um.
»Ich habe nicht ›sofort‹ gesagt!«, blaffte Hyde ungeduldig. »Außerdem hat er an Händen und Armen Schnittwunden. Mehr noch: An der rechten Hand wurden ihm sämtliche Finger gebrochen.«
»Ein Kampf?«, fragte Monk hoffnungsvoll. Der Tote war groß und schwer. Wer immer auf ihn losgegangen war, hatte mindestens den einen oder anderen Bluterguss abbekommen und womöglich noch mehr.
»Wohl eher nicht.« Hyde schnitt angewidert eine Grimasse. »Der eine Mann mit Bajonett und der andere offenbar völlig unbewaffnet!«
»Aber seine Faust ist verletzt«, wandte Monk ein. »Demnach hat er mindestens einen kräftigen Hieb angebracht.«
»Sie hören mir nicht zu! Ich habe gesagt, seine Finger sind gebrochen! Alle! Es sieht ganz nach Vorsatz aus. Das sind keine glatten Brüche wie bei Schlägen mit einem Gegenstand. Sie sind vielmehr einer nach dem anderen ausgerenkt worden wie bei einer geplanten Verstümmelung.«
Monk schwieg. Hier lag also vorsätzliche Brutalität vor, systematische Folter, keine Folge einer Affekthandlung.
Mit einem Grunzen wandte sich Hyde wieder dem Toten zu. »Sie bekommen das Gewehr und das Bajonett, sobald ich beides im Leichenkeller aus ihm herausgezogen habe. Hier geht es um mehr. Worum genau, ist mir schleierhaft – damit dürfen Sie sich befassen. Wenn es nur diese eine Wunde ist, dann weiß Gott allein, was passiert ist. All die Kerzen dort drüben – voller Blut.« Er deutete auf mehrere Tische und Simse. »Und dann die Papierfetzen dort. Nur an seinen Händen ist nichts. Aber das haben Sie schon selbst bemerkt, wie ich annehme?«
Das hatte Monk nicht. Doch immerhin war ihm aufgefallen, dass der Mund des Opfers grässlich entstellt und mit Blut beschmiert war.
»Ist das eventuell mehr als ein Bluterguss?«, fragte er. »Ein Fausthieb auf die Zähne?«
Hyde beugte sich über die Leiche. Für einen langen Augenblick schwieg er. »Nein«, antwortete er schließlich und schluckte, »als er tot war, sind ihm die Lippen abgeschnitten und in den Mund gestopft worden. Zumindest glaube ich, dass sie sich darin befinden. Gott helfe uns.«
Monk holte tief Luft. »Wissen wir schon, wer er ist?«
Nun trat ein Mann vor, der sich seit Monks Eintreffen im Hintergrund gehalten hatte. Er war von durchschnittlicher Größe und Gestalt. Eigentlich wirkte er in allem völlig unauffällig – bis er mit lauter Stimme zu sprechen anfing. »Sein Name war Imrus Fodor, Sir.« Seine Augen waren von einem ungewöhnlich klaren Blau. »Ich kannte ihn nicht gut, aber wir sind in diesem Teil von London nicht so viele Ungarn, als dass wir einander fremd wären.« Sein Englisch verriet kaum eine Spur von einem Akzent.
»Danke.« Monk musterte den Mann eindringlich. »Wie kommt es, dass Sie sich hier aufhalten, Mister …?«
»Dobokai, Sir, Antal Dobokai. Ich bin Apotheker und betreibe eine Pharmazie in der Mercer Street. Ich wollte dem armen Fodor nur sein Elixier liefern. Für seine Füße.« Er zeigte Monk eine braune Papiertüte.
»Tragen Sie Ihre Waren immer selbst aus?«, erkundigte sich Monk neugierig. »Zu dieser frühen Morgenstunde?«
»Wenn ich nicht viel zu tun habe, ja. Das ist nur ein kleiner Dienst. Und er wird einem mit Treue vergolten. Außerdem bin ich einem Spaziergang nicht abgeneigt, vor allem in dieser Jahreszeit.« Kein einziges Mal verrieten Dobokais Augen eine Unsicherheit. Stattdessen glomm darin eine seltsame Aufgewühltheit, die Monks Blick bannte. Aber war das ein Wunder? Der Mann war gekommen, jemandem eine kleine Gefälligkeit zu erweisen, nur um auf das verstümmelte Opfer eines Gemetzels zu stoßen. Da mussten seine Gefühle ja bloßliegen! Ein solcher Anblick hätte jeden geistig Gesunden verstört.
»Es tut mir leid, dass Sie diese Entdeckung machen mussten«, murmelte Monk. Wenn sogar er entsetzt war, was musste dann ein einfacher Apotheker empfinden, zumal jemand abgeschlachtet worden war, den er kannte? Aber es war besser, die nötigen Fragen jetzt zu stellen, da der Mann noch unter dem Eindruck des Geschehenen stand, als ihn später über seine Erinnerungen berichten zu lassen. »Können Sie mir schildern, was seit dem Moment geschehen ist, als Sie Ihr Haus verließen?«
Dobokai blinzelte. Ihm war anzusehen, dass er sich enorm konzentrierte. Selbst dann noch, als Hydes Assistenten hereinkamen, den Toten auf eine Bahre legten und ihn beim Hinaustragen sorgfältig hin und her manövrierten, um nirgends anzustoßen. Hyde folgte ihnen auf dem Fuß, sodass Monk mit Dobokai und dem Polizisten allein zurückblieb. Monk wusste, dass der Constable in Gedanken bereits eine Skizze des Hauses erstellte, anhand derer sich erkennen lassen würde, wer auf welchem Weg hätte kommen und gehen können.
»Ich bin früh aufgewacht«, erklärte Dobokai leise. »Gegen sechs habe ich beschlossen, bestimmte Medikamente zu holen, die heute ausgetragen werden müssen. Dasjenige für Fodor habe ich in ein Säckchen gegeben.« Er öffnete eine Tasche und zeigte Monk mehrere Tütchen mit weißem Pulver.
»Und dann?«
»Ich weiß, dass Mrs Stanley auch immer früh aufsteht. Sie kann nicht schlafen, die Arme. Ihr Opium habe ich ihr um etwa halb sieben gebra…«
»Wo wohnt sie?«, unterbrach Monk ihn.
»In der Farling Street, ganz in der Nähe der Kreuzung.«
»Wohin ging es dann?«
»Als Nächstes habe ich Mr Dawkins sein Laudanum geliefert. Er lebt etwas weiter unten in der Martha Street. Danach bin ich in dem ungarischen Café an der Ecke zur High Street eingekehrt und habe mir eine Tasse Kaffee und Gebäck gegönnt. Ich weiß, dass es nicht vor acht Uhr aufmacht. Darum kann ich so genau sagen, wann ich dort eintraf.«
Monk wandte sich an den Polizisten. »Ist einer der Angestellten hier besonders früh angekommen?«
»Nein, Sir. Ich habe sie gefragt, aber laut ihrer Aussage waren sie alle gleichzeitig hier, um Punkt acht Uhr. Der Mann, der jetzt tot ist, achtete streng auf Pünktlichkeit. War in dieser Hinsicht ein richtiger Leuteschinder. Bei Verspätung wurde der Lohn gekürzt. Aber eine Prämie dafür, dass man früher kam und draußen warten musste, gab’s nie.«
Dobokai widersprach. »Aber er hat sie nie Überstunden machen lassen. Und wenn das doch mal geschah, hat er gut dafür gezahlt.«
»Und alle Männer sind gleichzeitig aufgetaucht?«, fragte Monk nach.
»Ja, Sir«, bestätigte der Constable. »Alle zusammen, das haben sie behauptet. Sieht so aus, als wäre er ermordet worden, bevor irgendjemand hier eintraf. Passt zu dem, was der Weißkittel … Entschuldigung, Sir, der Gerichtsmediziner gesagt hat.«
»Aber Sie sind ins Haus gegangen und die Treppe hinaufgestiegen?« Monk blickte den Ungarn fragend an. »Kurz nach acht, richtig? Waren die Arbeiter zu der Zeit alle da?«
»Ja. Ich bin nach oben gegangen, um ihm sein Elixier zu verabreichen, und habe das hier vorgefunden …« Sein Blick irrte durch den Raum, ehe sich seine Augen wieder auf Monk richteten. Er hatte offenbar von Natur aus einen fahlen Teint, doch jetzt wirkte er regelrecht krank.
»Haben Sie die Männer zufällig im Vorübergehen bemerkt? War jemand dabei, den Sie kennen?« Das war vielleicht eine törichte Frage, aber Monk wusste, dass die Leute sich manchmal an mehr erinnerten, als sie glaubten, sogar an Details, die sie für überflüssig hielten.
»Ja, Sir«, antwortete Dobokai, in dessen Gesicht langsam wieder ein wenig Farbe zurückkehrte. »Es waren sieben Männer. Ich kenne sie vom Sehen, aber das ist auch schon alles.«
Monk bedachte ihn mit einem überraschten und etwas skeptischen Blick. Sogar die exakte Zahl konnte der Mann angeben! »Wo genau haben Sie sie gesehen? Möchten Sie vielleicht eine Skizze anfertigen und dem Constable ihre Namen nennen?«
»Zwei saßen auf der großen Bank, gleich hinter der Tür«, erklärte Dobokai, ohne zu zögern. »Einer stand im Flur, und vier saßen auf der Bank an der hinteren Wand. Diese vier hatten schon ihr Werkzeug ausgepackt. Drei Holzsägen, und der Letzte hielt eine Zange in der … linken Hand.«
»Sie sind außerordentlich aufmerksam. Danke.«
»Das ist keiner von den Tagen, die ich je vergessen werde«, erwiderte Dobokai leise. »Armer Fodor. Und bevor Sie mich fragen: Mir ist schleierhaft, wer ihm das angetan haben könnte. Auf mich wirkte er immer völlig unauffällig. Lebte allein. Seine Frau ist tot. Arbeitete hart, um sein Geschäft aufzubauen, und es gedieh. Deshalb glaube ich, dass Sie es hier mit einem Wahnsinnigen zu tun haben. Das Zimmer ist …« Er drehte sich langsam um und ließ den Blick über die Szene schweifen: das Blut, die zerbrochenen Kerzen, allesamt mit dunkelrotem Docht, als wären sie in die Wunden des Toten getaucht worden. Es mochten sechzehn oder siebzehn sein, alle von verschiedener Form und Größe. »Welcher zurechnungsfähige Mensch wäre zu so etwas in der Lage?«, stieß er hilflos hervor. »Ich werde Ihnen helfen, diesen Fall zu klären. Schließlich kenne ich die Leute. Ich werde für Sie übersetzen, zumindest bei denjenigen, deren Englisch nicht so gut ist. Was immer …«
Monk fiel ihm ins Wort. »Danke. Wenn ich Ihre Hilfe benötige, komme ich auf Sie zu und werde Ihnen dann sehr verbunden sein.« Er verstand Dobokais Angst und sein Bedürfnis danach, etwas zu tun und nicht bloß herumzustehen. »Als Erstes sprechen wir mit den Arbeitern. Ich werde jemanden damit beauftragen, die Rechnungsbücher zu sichten, die Verbindlichkeiten, die Forderungen und so weiter. Das könnte uns vielleicht schon etwas verraten …«
Dobokai zog eine skeptische Miene. »Treiben Sie überfällige Schulden hier in England etwa auf diese Weise ein? Ich lebe ja schon seit Langem in Ihrem Land. Bevor ich nach London kam, war ich in Yorkshire. Ein gutes Land, wo guter Stahl gekocht wird. Tüchtige Menschen. Alles Engländer. Und Engländer tun solche Dinge nicht, die Sie da unterstellen.«
Monk blickte Dobokai in die klaren blauen Augen, und mit einem Schlag erkannte er seinen Fehler. Er hatte diesen Mann unterschätzt. »Nein, natürlich nicht«, stimmte er ihm zu. »Aber wir müssen einfach alles in Erwägung ziehen, und sei es auch nur, um diese eine Möglichkeit ausschließen zu können. Dennoch haben Sie recht. Hier steckt Hass dahinter, eine schreckliche, unkontrollierte Zerstörungswut. Sehen Sie, ich möchte die Leute nicht verschrecken, wenn ich es vermeiden kann. Und wir müssen so viel wie nur möglich über die Hintergründe in Erfahrung bringen. Und da bietet es sich an, dieses Unternehmen genauer unter die Lupe zu nehmen.«
»Jetzt verstehe ich«, versicherte Dobokai ihm. »Ein Einstieg. Natürlich. Das hätte ich gleich begreifen müssen. Man kann den Leuten unmöglich sagen, dass ein Ungeheuer unterwegs ist. Dann geraten sie in Panik. Ich werde niemandem verraten, wie es hier … welches Gräuel wir vorgefunden haben. Sie werden die Leute fragen, was sie gesehen haben, und das Bild nach und nach zusammensetzen.« Erneut blickte er sich im Zimmer um. »Welcher Hass«, flüsterte er, nicht an Monk gerichtet.
Monk beschlich das starke Gefühl, dass in diesem Moment etwas Dobokais Aufmerksamkeit erregte, das er bisher noch nicht bemerkt hatte – zumindest nicht in dem Ausmaß. Zu gegebener Zeit würde er, Monk, es vielleicht herausfinden.
Sein Ton wurde sanfter. »Danke, Mr Dobokai. Wir werden noch bleiben, mit den Arbeitern und Nachbarn sprechen und ermitteln, ob jemandem etwas aufgefallen ist, das anders war als sonst. Bitte hinterlassen Sie bei Mr Hooper draußen Ihre Adresse. Es kann durchaus sein, dass wir Sie noch benötigen. Und falls Sie sich später noch an etwas erinnern, lassen Sie uns das bitte wissen.«
»Ja.« Dobokai nickte. »Selbstverständlich.« Auf einmal wirkte er geradezu erleichtert darüber, sich entschuldigen und diesen grässlichen Raum in Begleitung des Constables verlassen zu dürfen.
Sobald er allein war, blickte Monk sich noch einmal um. Was er auch sah – die Blutspritzer, die in Blut getauchten Kerzen, zwei davon dunkellila, das zerfetzte Papier –, alles zeugte von völlig außer Kontrolle geratener Wut, ja, von Wahnsinn. Welcher Mensch konnte denn einem anderen so etwas antun?
Und wie sollte das unbemerkt geblieben sein? Nun, vielleicht hatte doch jemand etwas mitbekommen. Wenn er an den richtigen Stellen nachschaute, würde er womöglich einen Hinweis darauf entdecken, dass Fodor selbst etwas geahnt hatte. Und gewiss gab es noch andere, Kollegen von Fodor, Freunde, die ihn gut kannten. Solcher Hass entstand nicht aus dem Nichts, sondern wurde aus tiefliegenden Quellen gespeist.
Hooper, der in der Zwischenzeit die Angestellten vernommen und das Haus nach Spuren gewaltsamen Eindringens oder überstürzter Flucht abgesucht hatte, kehrte nun zu Monk zurück. Er und Monk arbeiteten mittlerweile seit fast drei Jahren zusammen. Hooper war ein großer, kräftiger Mann mit ruhigem Auftreten. Bei aller Zurückhaltung zeichnete er sich durch hohe Intelligenz aus, und unter seiner selbstbeherrschten Art hatte Monk schon bald tiefe Gefühle und außergewöhnliche Loyalität erkannt. Als einmal nahezu alle anderen Monk die Schuld an einem verheerenden Irrtum – und Schlimmerem – gegeben hatten, hatte Hooper ihn nicht nur unter Einsatz seines Lebens gerettet, sondern auch seine berufliche Laufbahn riskiert, um ihn zu verteidigen.
Hooper räusperte sich. »Sir?«
Monk wirbelte zu ihm herum. »Ach ja … etwas in Erfahrung gebracht?«
»Nichts Brauchbares. Es wurde nicht eingebrochen. Vom Wasser her kann man ohnehin nicht hochklettern. Und der Hintereingang ist von innen verriegelt.«
»Das heißt, uns stehen alle Mitglieder der ungarischen Gemeinde zur Auswahl«, schlussfolgerte Monk.
»Dobokai …«
»Richtig. Wir müssen überprüfen, ob er tatsächlich eine Salbe für die Füße des Opfers gemischt hat.« Monk ließ den Blick durch den Raum schweifen. »Man sollte meinen, dass uns jemand, der von derartigem Hass gegen diesen Mann zerfressen war, auf den ersten Blick auffallen müsste! Na ja, wohl eher nicht. Vielmehr wird er aussehen wie jeder andere auch … so wie meistens.«
Hooper nickte. Er teilte Monks Meinung. Gerade diejenigen, die deutlich als Exzentriker zu erkennen waren, bewiesen bisweilen mehr Vernunft als alle anderen, während scheinbar brave, schüchterne Zeitgenossen ungeahnte Abgründe in sich verbergen konnten.
»Wir müssen Erkundigungen über diesen armen Teufel Fodor einziehen«, sagte Monk laut. »Ich kann wohl annehmen, dass die meisten seiner Nachbarn und Kunden unsere Sprache sprechen?«
Von außen betrachtet wirkte Fodors Haus wie die meisten Gebäude in seiner Straße hübsch, wenn auch durchschnittlich. Innen dagegen war es überaus gemütlich eingerichtet und hatte seinen eigenen Charakter. Da sie die Schlüssel in einem Büro im Warenlager gefunden hatten, war es nicht nötig, bei ihm einzubrechen. Die Polizisten standen im Flur und staunten.
»Eindeutig kein Engländer«, murmelte Hooper, doch seine Stimme verriet Interesse, ja, Respekt.
Monk betrachtete die Gemälde an den Wänden. Einige davon stellten Reiter in einer ihm völlig unbekannten Tracht dar. Eines zeigte eine Stadt, an der ihm ebenfalls nichts vertraut war. Die Gebäude sahen sehr altmodisch aus. Obschon er in England nie dergleichen gesehen hatte, fand er sie überaus hübsch – wie Phantasiegebilde. Des Weiteren stach ihm ein wunderschönes, zartes Bild von einer Mutter mit Kind ins Auge, beide von Gold umgeben.
»Ein armer Mann war er nicht«, bemerkte Hooper, den Blick auf die Möbel gerichtet. »Die Vitrine dort würde einen hohen Betrag einbringen. Und der Spiegel darüber ebenso. Edles Glas, und der Rahmen ist perfekt geschnitzt.«
Monk begann mit der Durchsuchung der übrigen Räume. Auch wenn er kaum etwas berührte, gewann er tiefe Einblicke in den Geschmack des ermordeten Mannes und dessen beträchtliche Ausgaben für sein Zuhause. Mit Qualität und Stil kannte Monk sich aus, und dieser Mann hatte eindeutig die Mittel gehabt, beidem zu frönen. Gleichwohl zeugte nichts von Verschwendung oder dem Bemühen, lediglich Eindruck zu schinden. Interessanterweise war auch nichts neu. Hatte Fodor das alles aus Ungarn mitgebracht? Oder waren diese Gegenstände womöglich mit unschönen Machenschaften verbunden? Hatte er sie durch Erpressung in seinen Besitz gebracht? Die Art und Weise seiner Ermordung wies auf jemanden hin, über den der Tote Macht gehabt hatte. War es darum gegangen, zu verletzen, zu rauben, zu zerstören? Wenn ja, warum genau jetzt? Das war immer die zentrale Frage bei solchen mit äußerster Gewalt begangenen Verbrechen: Warum jetzt?
»Wir müssen seine letzten paar Tage sorgfältig studieren«, erklärte Monk. »Die letzten ein, zwei Wochen. Was ist geschehen, dass ein Mann, der unbescholten in seinem Haus lebte, plötzlich auf diese Weise und mit solchem Hass überfallen wurde?«
Doch eine penible Durchsuchung aller übrigen Räume brachte nichts ans Tageslicht, was von irgendeinem außergewöhnlichen Vorfall gezeugt hätte. Es gab kein Tagebuch, keine Einträge in den Kalender an der Küchenwand, keinerlei Notizen, Briefe oder Einladungen.
Sie traten ins Freie. Mit zusammengekniffenen Augen spähte Monk nach links und rechts. »Fangen wir mit dem Nachbarhaus an«, bestimmte er. »Sieht gut gepflegt aus, als wohnte dort jemand, der viel daheim ist.«
Hooper grinste. »Ja, Sir. Und gerade eben haben sich die Vorhänge bewegt.«
»Richtig«, bestätigte Monk. »Ich erledige das selbst. Sie nehmen sich die andere Richtung vor. Wir sehen uns dann auf der Wache wieder.«
Hooper salutierte knapp und lief los.
Sie stellten den Nachbarn alle möglichen scheinbar belanglosen Fragen, in der Hoffnung, über diesem Umweg auf etwas Ungewöhnliches zu stoßen oder zumindest zu erfahren, was die Leute von Imrus Fodor hielten.
»Ein recht netter Mann«, meinte Mrs Harris, die in dem Haus rechts nebenan lebte. Sie mochte an die fünfzig und damit geringfügig älter sein als das Opfer. »Nicht, dass ich mit ihm verkehrte; schließlich war er Ungar«, fügte sie eilig hinzu, als wäre damit alles erklärt.
»Sprach er gut Englisch?«, erkundigte sich Monk.
»Äh … wahrscheinlich schon. Aber er war nun mal nicht so wie wir. Er gehörte nicht dazu. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, oder?«
Manchmal zog Monk es bei Befragungen vor, sein Gegenüber mit einer unerwarteten Reaktion aus dem Konzept zu bringen, es zu einer unbedachten Erwiderung zu provozieren. Jetzt hielt er diese Strategie wieder einmal für angebracht.
»Das weiß ich nicht«, erwiderte er. »Ich glaube nicht, dass ich es jemals mit Ungarn zu tun hatte. Was sind das für Menschen?« Nur mit Mühe wahrte er eine freundliche Miene.
»Was für Menschen?«, fragte die Frau zurück. »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«
»Sie haben gerade gesagt, er sei nicht so gewesen wie wir«, erinnerte er sie.
»Na ja, er war eben kein Engländer!«, blaffte sie.
»Vermutlich nicht.«
Mrs Harris runzelte die Stirn. »Ist Ihnen jemals ein Engländer namens Fodor über den Weg gelaufen?«
»Nein. Aber war dieser Mann grob zu Ihnen? War er schmutzig? Respektlos? Laut? Haben Sie ihn je volltrunken erlebt. Sind Frauen bei ihm ein- und ausgegangen?«
Sie starrte Monk perplex an. »Äh … nein. Außer Mrs Durridge natürlich. Sie hat für ihn geputzt. Und könnte vielleicht auch gekocht haben.«
Sehr viel mehr war ihr nicht zu entlocken – und auch den anderen Nachbarn nicht, die er noch befragte. Erst der Mann hinter der Theke des Tabakgeschäfts an der Ecke erwies sich als auskunftsfreudiger.
»Es gibt ja hier in der Gegend nicht einmal für uns genug Arbeit, ganz zu schweigen von all den Ausländern, die ins Land kommen«, knurrte der Mann. »Nicht, dass er ein schlechter Mensch war; er hat sogar ein paar Arbeiter angestellt, aber meistens waren es Landsleute von ihm. Noch mehr Ausländer. Aber was kann man schon erwarten? Die haben sogar ihre eigenen Zeitungen. Drucken sie hier bei uns. Ich hab keine Ahnung, was sie über uns schreiben. Kann kein Wort davon verstehen. Könnte alles Mögliche sein!«
»Nachrichten aus Ungarn vielleicht?«, regte Monk an.
Der Mann schnaubte. »Sie sind eben anders, das ist alles. Und sehen Sie nur, was passiert ist! Jetzt ist er ermordet worden. Wir wollen nicht, dass so etwas zu uns kommt.«
»Noch mehr Tote brauchen wir bestimmt nicht«, bestätigte Monk. »Wir haben auch ohne fremde Hilfe schon genug.«
Der Mann musterte ihn mit kritischer Miene. »Was geht das eigentlich Sie an?«
»Polizei«, erwiderte Monk. »Ich will ermitteln, wer das getan hat, und den Kerl so schnell wie möglich wegsperren.«
»Schön. Tun Sie das!«
»Dafür brauche ich Ihre Hilfe. Ich kenne diese Gegend nicht.«
»Wo wohnen Sie denn? Sind Sie etwa auch Ausländer?«
»Auf der anderen Seite des Flusses. Ziemlich genau gegenüber dieser Straße. Etwas oberhalb der Greenwich Stairs.«
»Na gut, was wollen Sie denn wissen?«
Zu seiner eigenen Überraschung kam Monk direkt zur Sache. »Was wissen Sie über Antal Dobokai?«
»Interessanter Bursche«, erwiderte der Tabakhändler nach einigem Überlegen. »Stilles Wasser. Aber tief. Denkt ständig nach. Hat studiert. Allerdings in Ungarn, von wo er kommt. Kann schneller im Kopf rechnen als die meisten von uns mit Stift und Papier und verzählt sich nie! Laut den Gerüchten war er früher Architekt. Hier ist es schwerer, Arbeit zu finden. Wir haben schließlich unsere eigenen Leute. Aber anscheinend laufen seine Geschäfte ganz gut. Wieso fragen Sie? Glauben Sie, dass er das getan hat?« Sein Gesicht verriet Skepsis und Belustigung zugleich.
»Nein«, antwortete Monk, »so wie es im Moment aussieht, ist er der Einzige, der dazu nicht in der Lage war.«
»Wieso das?«
»Zeit. Man kann nicht an zwei Orten zugleich sein.«
»Schlimme Sache.« Der Mann schüttelte den Kopf, dann beugte er sich vor. »Sie sind ja von der Polizei: War es wirklich so übel, wie die Leute sagen?«
»Ziemlich übel. Der Täter muss Mr Fodor gehasst haben – oder aber er war übergeschnappt. Wissen Sie von irgendeiner Sache, die die ungarische Gemeinde aufwühlt? Rivalitäten? Fehden?«
Die Frage schien den Mann zu überraschen. »Die Ungarn sind eben anders, denke ich. Aber eigentlich sind sie nett, wenn man zu ihnen nett ist. Mich stören sie nicht. Natürlich gibt es die ewig Gestrigen, die niemanden mögen, der irgendwie anders ist, andere Sachen trägt und sich anders verhält. Leute wie der alte Sallis um die Ecke. Der sagt immer: ›Was gut genug für meinen Vater und meinen Opa war, ist auch gut genug für mich.‹ Als ob Wandel eine Beleidigung wäre.«
»Kannten Sie Fodor?«
»Ein bisschen. Angenehmer Kerl. Hatte immer ein freundliches Wort für einen übrig. Ging nie grußlos an einem vorbei. Nicht alle sind so wie er. Aber es gibt eben solche und solche … wie bei uns.«
Wir und sie. Das sollte Monk danach immer wieder zu hören bekommen. Er blieb noch eine Weile, ehe er in die nächste Seitenstraße wechselte, wo er sein Glück erst bei einem Gemüsehändler und dann bei einem Schuster versuchte. Es war Spätnachmittag, und er hatte immer noch nichts Bemerkenswertes erfahren, als er sich wieder mit Hooper traf.
»Nicht viel«, seufzte sein Stellvertreter. »Der Mann war im Viertel bekannt, vor allem bei seinen Landsleuten. Und das sind gar nicht mal so wenige. Die strömen alle in dieselbe Gegend. Ich schätze, ich würde es genauso machen, wenn ich in einem anderen Land leben müsste. Nicht dass ich das tun wollte! Warum sind sie überhaupt hergekommen, frage ich mich. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, hatten es daheim eigentlich ganz gut. Warum nicht in der Heimat bleiben, wo man so ist wie alle anderen auch?«
»Haben Sie sie danach gefragt?«
Hooper bedachte ihn mit einem schiefen Grinsen. »Nein. Stattdessen habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die mich genau das gefragt haben. Als ob die Fremden kein Recht darauf hätten auszuwandern. Die ganzen Vernehmungen haben nichts Brauchbares ergeben. Jeder hat das gesagt, was man von vornherein erwartet. Der Ermordete war ja ganz nett, aber trotzdem ein Ausländer.« Er schüttelte betrübt den Kopf. »Der Mörder hat ihn entweder gut gekannt und auf den Tod gehasst, oder er ist ein Verrückter.«
Zur selben Schlussfolgerung war auch Monk gekommen, obschon widerstrebend. Einerseits wünschte er, Hooper hätte ihm widersprochen, doch er wusste genau, dass er dann umso weniger von seinem Untergebenen gehalten hätte. Es war zu einfach, einer unbequemen Wahrheit auszuweichen.
»Oder jemand, der Einwanderer hasst«, ergänzte Hooper. »Manche empfinden Veränderungen als bedrohlich.«
»Dann hätte er eben aufs Land ziehen sollen«, knurrte Monk. »In der Stadt ändert sich alles – ständig! Das ist das Gute und zugleich das Schlechte an ihr.« Er seufzte. »Ich habe das Gleiche zu hören bekommen wie Sie, nichts als Genörgel, so wie andere übers Wetter jammern.«
Sie setzten sich wieder in Bewegung. Die Sonne versank allmählich am Horizont. Die Bürgersteige lagen bereits im Schatten, sofern sie nicht nach Westen zeigten.
Hooper blickte Monk nachdenklich an. »Vielleicht sollten wir uns von Dobokai helfen lassen. Er könnte Feinheiten entdecken, die wir gar nicht bemerken würden. Schließlich kennt er die Leute und spricht ihre Sprache. Die meisten von ihnen scheinen unsere Sprache ja ziemlich gut zu beherrschen, aber miteinander reden sie immer noch Ungarisch. Uns könnte da etwas entgehen.«
»Ich finde sogar, mir entgeht so ziemlich alles«, erklärte Monk mit einem Anflug von Bitterkeit, »denn ich glaube nicht, dass es sich um irgendeinen Wahnsinnigen handelt, der blind zugeschlagen hat. In dem Raum war Hass zu spüren; tiefer, irrationaler, persönlicher Hass. Der Täter hat dem Opfer ein Bajonett durch das Herz gerammt, die Kerzen mit seinem Blut gelöscht, ihm die Zähne eingeschlagen und die Finger an der rechten Hand gebrochen. Und ihm die Lippe weggeschnitten! Hooper, wir haben es mit etwas wahrhaft Abscheulichem zu tun, egal, ob eine englische oder eine ungarische Angelegenheit dahintersteckt – oder etwas, das wir noch nicht in Betracht gezogen haben. Ich frage mich immer wieder, was die Kerzen zu bedeuten haben. Niemand zündet siebzehn Kerzen an, nur weil er Licht braucht. Ist Ihnen aufgefallen, dass zwei dunkel waren, lila und blau mit einem Stich purpur? Hat das etwas zu bedeuten, oder waren diese Kerzen gerade zur Hand? Noch herrscht keine Panik, aber das wird sich schnell ändern, wenn wir den Fall nicht bald aufklären. Die Nachricht wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten und bestimmt immer schauriger werden, je öfter sie erzählt wird.«
»Ja, Sir, ich weiß«, sagte Hooper leise. »Morgen werden Sie sicher mehr Männer darauf ansetzen.« Das war keine Frage.
»Unbedingt. Alle, die wir zur Verfügung haben.«
Monk kam spät nach Hause, auch wenn es noch hell war. Es brannten noch keine Lampen, als er die Fähre verließ und den Hügel hinaufging, hinter dem er in der Paradise Place lebte. Bevor er den Park verließ, blickte er noch einmal zurück. Die Sonne hatte das ruhige Wasser der Themse in einen glitzernden Schild verwandelt, hier und dort gesprenkelt mit den schwarzen Rümpfen und den fast reglos in den Himmel über der Stadt ragenden Masten der vor Anker liegenden Schiffe. Die Luft war warm. Keine noch so leichte Brise brachte die Blätter der Bäume im Southwark Park zum Rascheln. Nichts schien ferner zu sein als Gedanken an Gewalt.
Dann waren es nur noch wenige Schritte zu seinem Haus, und er trat durch die Vordertür ein.
Hester, die ihn kommen hören hatte, eilte ihm aus der Küche entgegen. Eine schöne Frau nach traditionellen Maßstäben war sie eigentlich nicht. Dafür war sie eine Spur zu dünn, und ganz gewiss sprach viel zu viel Mut aus ihren Zügen, viel zu viel Intelligenz aus ihrem Gebaren, als dass Durchschnittsmänner sich in ihrer Gegenwart behaglich fühlten. Selbst in Monks Leben hatte es eine – wenn auch lange zurückliegende – Zeit gegeben, als er sie wegen dieser Eigenschaften für streitsüchtig gehalten hatte. Jetzt war es das, was er am meisten an ihr liebte.
Monk erreichte sie mit wenigen Schritten und drückte sie derart fest an sich, dass ihr die Luft wegblieb.
Nach einem Moment löste sie sich von ihm und blickte ihn besorgt an.
Monk war auf Anhieb klar, dass sie nichts von dem Mord in Shadwell gehört hatte. »Du warst heute nicht in der Klinik?«, fragte er.
Hesters Augen verschatteten sich. Die Klinik, von der die Rede war, lag in der Portpool Lane nördlich der Themse. Sie selbst hatte sie vor etlichen Jahren als Spital für verletzte oder erkrankte Straßenmädchen gegründet. Diese Klinik bildete den Abschluss ihrer Laufbahn als Krankenschwester, die im Krimkrieg unter Florence Nightingale begonnen hatte. Inzwischen hatte sie die Leitung abgegeben, beteiligte sich aber immer noch an der Arbeit dort.
»Verzeih mir«, entschuldigte sich Monk, »ich wollte nur sagen, dass du offensichtlich den ganzen Tag im Haus geblieben bist, sonst wären dir die Schlagzeilen aufgefallen. Es hat einen ziemlich üblen Mord in Shadwell gegeben, nur einen Katzensprung von unserer Wache entfernt.«
»Am Fluss?« Hester wandte sich um und ging voran in die Küche. Der Wasserkessel stand bereits auf dem Herd – wie immer am frühen Abend.
»Nicht direkt, aber praktisch am Shadwell New Basin. Die Kollegen von der städtischen Polizei waren nur zu froh, den Fall loszuwerden. Das Opfer hatte beruflich mit Booten zu tun. Ein Ungar. Dort gibt es eine richtige Gemeinde. Na ja, nicht mehr als ein paar hundert Leute, höchstens.«
Hester schob den Wasserkessel auf den heißesten Teil der Herdplatte, unter der sie nur einschürten, wenn sie Wasser oder Essen kochten – der Grund dafür, dass derzeit überhaupt geheizt wurde, denn im Haus war es noch angenehm warm. Das Einzige, was Monk jetzt sofort brauchte, war frischer Tee. Und das wusste Hester, ohne fragen zu müssen.
»Kalten Braten und Blubber und Zisch zum Abendessen?«, fragte sie. »Und dann habe ich noch einen Apfelkuchen.«
Das war genau das, was Monk wollte, vor allem der Kuchen.
2
Früh am nächsten Morgen setzte Monk seine Ermittlungen mit einem Besuch bei Dr. Hyde in dessen Büro neben dem Leichenkeller fort.
»Kann Ihnen nichts Hilfreiches sagen«, brummte der Gerichtsmediziner sofort bei Monks Eintreten. »Sie werden sich ja inzwischen Ihr eigenes Bild gemacht haben, und dem gibt es nichts hinzuzufügen. Der Tod ist auf Blutverlust zurückzuführen. Wie zu erwarten, wenn man jemandem ein Bajonett durchs Herz rammt. Sehr schmutzig, sehr melodramatisch, aber ein schneller Tod.«
»Nicht gerade ein gnadenvoller«, erwiderte Monk säuerlich. »Sie wollen mir doch nicht etwa sagen, dass da kein Hass im Spiel war?«
»Im Gegenteil!« Hyde blickte ihn scharf an. »Die reinste Raserei! Es erfordert viel Kraft, jemanden auf diese Weise aufzuspießen. Auf dem Schlachtfeld muss man schon in vollem Lauf heranstürmen, um mit solcher Wucht zustoßen zu können. Wer immer das getan hat, war von rasender Wut erfüllt – oder von fürchterlicher Angst. Und da er das Bajonett vermutlich mitgebracht hat, sieht es für mich eher nach rasender Wut aus. Rache käme natürlich auch infrage, aber dann müsste Fodor schon etwas verdammt Übles getan haben. Nein, ich denke, Sie haben es hier mit etwas wirklich Schrecklichem zu tun.« Er zuckte mit den Schultern. »Oder mit einem verdammten Wahnsinnigen.«
»Sie können mir also nichts Hilfreiches anbieten, außer dass entweder tiefer Hass als Folge von etwas sehr Einschneidendem in der Vergangenheit des Täters dahintersteckt oder dass wir einen gemeingefährlichen Wahnsinnigen suchen, der bisher unsichtbar war? Jemand, der aus dem Nichts kam und allem Anschein nach wieder dorthin verschwunden ist?«
Hyde hob die Augenbrauen, als wäre er überrascht. »Ich habe diese Situation nicht geschaffen, Mr Monk. Ginge es Ihnen um eine friedliche, vorhersehbare Tätigkeit, hätten Sie Buchhalter werden sollen. Oder Krämer.« Er trat hinter sein mit Dokumenten übersätes Pult. »Ich kann Ihnen sagen, dass der Mörder das Opfer offenbar vollkommen überrascht hat. Der Mann hatte nicht den Hauch einer Chance. Er war groß, bei guter Gesundheit, und dennoch machte er keinerlei Anstalten, sich zu verteidigen.«
»Er hatte also keine Angst«, schloss Monk. »Er glaubte nicht, dass er dazu einen Grund hatte.«
»Sieht ganz danach aus. Wenn es sich um einen alten Streit handelte, war die Sache einseitig. Sie täten gut daran, sich über diesen Fodor kundig zu machen. Meiner Meinung nach wird sich der Fall nicht von selbst entwirren, wenn man nur kurz hier oder dort zupft. Wie auch immer, falls Ihnen nach einer Tasse Tee ist: Der Wasserkessel steht auf dem Regal, und Sie wissen ja, wo der Herd ist. Wenn nicht, gehen Sie dort hinaus, wo der Handwerker das Loch gelassen hat, damit ich mit meinem Tagwerk anfangen kann. Es hat einen Unfall unten bei den Surrey Docks gegeben. Auf mich warten noch zwei weitere Leichen, die begutachtet werden wollen.«
»Danke«, murmelte Monk mit einem matten Lächeln. »Ich habe drei Männer zusätzlich auf den Fall angesetzt. Ich sehe mir gleich mal an, wie sie sich schlagen.«
»Recht anständige Leute, die Ungarn hier bei uns«, meinte Hyde noch, als Monk bereits an der Tür war. »Alles andere als Abschaum. Es könnten auch ein paar politische Flüchtlinge darunter sein. Das sollten Sie mal untersuchen. Die Ungarn haben unter den Österreichern schwere Zeiten erlebt. Wurden immer benachteiligt. Aber ich glaube, in den letzten Jahren haben sie mehr Freiheiten erlangt.«
Monk hatte sich schon vorgenommen, genau das zu tun, was Hyde gerade anregte, bedankte sich aber trotzdem und verließ zügig den Leichenkeller. Dort war es ihm seit jeher zu kalt, sogar im Sommer, und die Gerüche nach Kalilauge und Karbol erinnerten ihn stets aufs Neue an all die schlimmen Dinge, die sie überdeckten.
Rasch marschierte er zurück nach Shadwell – es war nur ein kurzer Weg –, und als er den Kai erreichte, traf er dort Hooper an.
»Morgen, Sir«, begrüßte ihn dieser mit düsterer Miene. »Ich habe mich in den Straßen hier umgehört. Die Leute, die ich befragt habe, sind allesamt ziemlich aufgeregt. Ein paar darunter leben hier schon seit mehreren Jahren und sprechen ganz ordentlich unsere Sprache, aber die meisten haben noch Probleme damit. Gerade bei Kleinigkeiten kommt es leicht zu Missverständnissen. Der Bursche von gestern, dieser Dobokai, ist gern bereit zu helfen, und bisher scheint er der Einzige zu sein, der Fodor nicht ermordet haben kann; dafür war er zur fraglichen Zeit zu weit vom Tatort entfernt.«
Monk wäre es lieber gewesen, Dobokai nicht hinzuziehen zu müssen, doch offenbar blieb ihm keine Wahl. Mit knappen Worten berichtete er Hooper, was ihm der Gerichtsmediziner gesagt hatte.
Sein Stellvertreter starrte gegen die Sonne auf das weite Hafenbecken. Aus der Ferne waren die Rufe von Hafenarbeitern und das Scheppern von Ketten zu hören, mit denen Schiffsladungen für die Beförderung mit Kränen festgemacht wurden. »Sieht nach einer Heidenarbeit aus, Sir. Für die Ungarn sind wir Außenseiter, obwohl sie in unserer Stadt leben. Sie werden höflich sein, aber zugeknöpft bleiben, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht, dass ich ihnen das verüble. Wenn ich von hier fortziehen und nach Ungarn umsiedeln müsste, würde ich mich dort wohl auch an eine englische Gemeinschaft halten, falls ich eine fände. Allerdings würde ich erst gar nicht ins Ausland gehen, es sei denn, ich hätte keine Wahl.«
Monk hatte nur mit einem Ohr hingehört. »Wir müssen möglichst viel über die letzten zwei, drei Monate in Fodors Leben in Erfahrung bringen. Solcher Hass kommt nicht aus dem Nichts, es sei denn, es war doch ein Wahnsinniger.«
»Ich habe zwei Männer beauftragt, sich danach zu erkundigen, ob hier in letzter Zeit Fremde aufgetaucht sind«, erwiderte Hooper. »Über die meisten Leute in diesem Viertel weiß man Bescheid: Sie führen ein Geschäft, arbeiten hier, kaufen oder verkaufen bestimmte Dinge, haben Verwandte. Dieser Mord hat die Leute zutiefst verstört. Je klarer ihnen die Sache wird, desto größer wird die Sorge. Inzwischen haben es alle erfahren.«
Monk nickte. »Dann fangen wir am besten gleich an. Befassen wir uns mit Fodors Vergangenheit. Was wissen wir bislang über ihn?«
»Ehrlich in Geschäftsangelegenheiten«, begann Hooper. »Gute Manieren, guter Arbeitgeber, schuldet niemandem etwas, nüchtern und angenehm, ruhig, gepflegt, großzügig …« Er hielt inne.
»Ich verstehe, worauf Sie hinauswollen.« Monk nickte. »Es gibt keinerlei Grund, ihm den Tod zu wünschen. Darum sind alle Mitglieder der Gemeinde unschuldig, und wir sollten den Blick auf irgendeinen wild gewordenen Verrückten außerhalb der Gemeinschaft richten. Ich fürchte, wir müssen uns auf harte Arbeit gefasst machen.«
»Ja, Sir. In gewisser Hinsicht kann man es ihnen aber nicht verdenken. Wenn man in einem fremden Land lebt, wo die Einheimischen einen nicht in ihre Gemeinschaft aufnehmen, muss man ja seine eigene Gemeinschaft bilden.«
Monk blieb die Antwort darauf schuldig.
Sie entdeckten Antal Dobokai auf der Terrasse eines von einer ungarischen Familie betriebenen Cafés. In der Auslage wurde Feingebäck zur Schau gestellt, und durch die offene Tür wehte der intensive Duft von Gewürzen. Dobokai schien sie beinahe erwartet zu haben.
Er begrüßte sie mit kaum verhohlener Zufriedenheit. »Guten Morgen. Haben Sie schon etwas Hilfreiches herausgefunden?«
»Nicht viel«, gab Monk zu. Es hatte keinen Sinn, sich zu verstellen. »Entweder war das ein willkürlicher Mord, was angesichts der Umstände wenig wahrscheinlich ist, oder es handelt sich um eine tief in die Vergangenheit reichende, alte Feindschaft, von der kaum jemand gewusst haben dürfte.«
Dobokai schien zu überlegen. Und er antwortete erst nach deutlich erkennbarem Zögern: »Es gibt noch eine andere Möglichkeit«, sagte er stockend. Plötzlich rang er um Worte, als hätte ihn seine Vertrautheit mit der englischen Sprache auf einen Schlag verlassen. »Der arme Fodor war das Opfer einer … geradezu gebündelten Abneigung, die sich … in manchen Menschen aufstaut und gegen Personen richtet, die anders sind.«
»In London wimmelt es von Personen, die anders sind«, wandte Monk ein. »Vor allem in den Hafenvierteln. So gut wie jedes Land der Welt ist hier vertreten, und viele dieser Menschen sehen ganz anders aus als Sie. Bei Ihnen würde ich erst dann erkennen, dass Sie kein Engländer sind, wenn Sie etwas sagen.«
Kurz flackerte ein Lächeln über Dobokais Gesicht. »Dann sind Sie kein so guter Polizist, wie Ihr Rang vermuten lässt«, erwiderte er.
Hooper schaute zur Seite, und Monk ahnte, dass er grinste.
Wie um seinen Worten die Schärfe zu nehmen, fuhr Dobokai eilig fort: »Unsere Frauen kleiden sich etwas anders, wenn ich das so sagen darf, mit mehr … Gespür. Und unser Knochenbau ist ein anderer … ein kleines bisschen.« Er berührte seine hohen Wangenknochen. »Etwas breiter. Wir versuchen zwar, uns Ihre Gepflogenheiten anzueignen, aber wir werden nie vergessen, wer wir sind.«
»Wenn das so wäre«, sagte Monk, jetzt sanfter, »warum dann Fodor? Warum nicht irgendwer? Dahinter muss doch ein bestimmter Grund stecken, ein Umstand, der den Täter darauf brachte, ausgerechnet ihn auszuwählen. Und dass er sich von allen Tagen für den gestrigen entschieden hat … Darin könnte unsere eigentliche Möglichkeit liegen, den Mörder aufzuspüren. Wir wären Ihnen für Ihre Hilfe sehr dankbar, Mr Dobokai.«
»Selbstverständlich«, antwortete der Ungar mit einem bedächtigen Nicken. »Und Sie haben recht. Wie abstoßend die Tat auch ist – oder wie schwer auch immer mit den Maßstäben der Vernunft zu vereinbaren –, es gibt stets einen Grund. Ich werde Ihnen helfen, ihn zu finden, bevor … bevor die Leute das, was sie gesehen oder gehört haben, vergessen und die Spur kalt wird.« Über sein gepflegtes Gesicht huschte ein flüchtiges Lächeln, das sofort wieder verflog, doch die auffälligen blauen Augen leuchteten weiter.
»Was wissen Sie über Fodor, Mr Dobokai?«, fragte Monk. »Können Sie mir sagen, von wo genau in Ungarn er kam und wann?«
»Ja, natürlich. Soll ich es für Sie buchstabieren? Bei uns werden die Worte … anders ausgesprochen als bei Ihnen.«
Monk nickte. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Und vielleicht könnten Sie mir bei dieser Gelegenheit erzählen, was Ihnen über diejenigen Mitglieder der Gemeinde bekannt ist, die in den letzten Jahren hierhergezogen sind.«
»Fodor lebt seit über zwanzig Jahren hier«, erklärte Dobokai. »Aber natürlich werde ich Sie auch über diejenigen informieren, die erst kürzlich eingetroffen sind.«
Gemeinsam gingen sie zu Monks Büro in der Polizeiwache von Wapping. Es wurde ein langer, arbeitsamer Vormittag, doch am Schluss hatte Monk eine Liste mit den Namen all der wichtigen Familien in der Gemeinde mitsamt den jeweiligen Berufen und dem geschätzten Zeitpunkt ihrer Ankunft in England. In den meisten Fällen konnte Dobokai den Polizisten sogar den Herkunftsort nennen.
»Überrascht Sie das?«, fragte er mit ironisch gekräuselten Lippen. »Wenn Sie gezwungen wären, in einem fremden Land noch einmal von vorn anzufangen, in einem Land ohne Verbindungen mit ihrem eigenen, wo niemand Ihre Sprache spricht, würden Sie sich da nicht auch Leute suchen, die Ihnen einen Rat geben und dabei helfen können, nicht nur eine Unterkunft zu finden, sondern auch eine Arbeit, die es Ihnen erlaubt, Ihre Miete und Ihr Essen zu bezahlen? Würden Sie nicht auch danach fragen, wo es die Speisen gibt, die Sie mögen? Wo es ordentliche Gebrauchtmöbel zu kaufen gibt? Wo man am besten Zimmer mieten kann? Wer aufrichtig ist? Wo man hin und wieder Nachrichten aus der Heimat erfahren kann?«
Als sie alles besprochen und erschöpfend die etwa fünfzig Familien erörtert hatten, die den Kern der ungarischen Gemeinde von Shadwell bildeten, gingen Monk und Hooper mit Dobokai auf dessen Vorschlag hin in eine kleine ungarische Gaststätte zum Mittagessen.
Die Speisekarte war nicht besonders umfangreich, doch Monk folgte Dobokais Rat und bestellte einen Schmortopf mit Schweine- und Rindfleisch, verfeinert mit Lorbeerblättern, Knoblauch und Monk völlig unbekannten, scharfen Gewürzen. Dobokai erklärte ihm mit einem gewissen Stolz, dass die Ungarn oft verschiedene Fleischsorten mischten und sich hervorragend mit Dutzenden von Gewürzen auskannten.
Zum Nachtisch gab es eine Dobos-Torte, einen Kuchen aus Schichten von Butter- und Schokoladencreme sowie Biskuitteig, gekrönt von einer dünnen Karamelldecke. Monk redete sich ein, dass das ein Zeichen von Höflichkeit war, und akzeptierte gern den angebotenen Nachschlag.
Nach dem Essen stellte Dobokai sie Ferenc Ember vor, dem Arzt fast aller Mitglieder der ungarischen Gemeinde. Als sie im Wartezimmer Platz genommen hatten – sie mussten sich noch gut eine halbe Stunde gedulden, malte Monk sich aus, wie schrecklich es sein musste, in einem fremden Land krank zu werden. Schließlich musste man versuchen, die Symptome einem Menschen zu erklären, der immer ungeduldiger wurde, während man in dessen Sprache radebrechend von persönlichen Dingen berichtete, die nur wenige vor anderen Menschen erörterten und schon gar nicht vor Fremden. Schmerzen, Angst oder schlichtweg Verlegenheit konnten einem die Zunge lähmen. Wenn man dann jemanden hatte, der mit der fremden Sprache vertraut war und einem half, war das ein Geschenk des Himmels.
Ember war ein recht junger Mann von höchstens Ende dreißig, wirkte aber bereits abgespannt. Sein hellhäutiges Gesicht war bleich, und er wischte sich immer wieder die Haare aus der Stirn.
»Antal!«, rief er erleichtert, als er sah, dass Monk und Hooper von Dobokai begleitet wurden. »Was kann ich für die Herren tun?«
Dobokai stellte die Männer einander vor. Danach unterhielt er sich mit Ember leise auf Ungarisch. Monk hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, worüber. Nicht ein Wort fiel, das ihm irgendwie bekannt vorkam, keines, das lateinische oder romanische Wurzeln haben mochte.
Schließlich reichte Ember Monk die Hand. »Ich werde versuchen, mein Bestes für Sie zu tun. Aber ich fürchte, das wird sehr wenig sein. Ich darf Ihnen nichts über die Krankheiten Dritter erzählen – das ist streng vertraulich.« Er blickte Monk mit nervös flackernden Augen an. »Bei Ihnen ist es sicher genauso, ja?«
»Aber Sie sind doch vermutlich in der Lage, die Möglichkeiten etwas zu begrenzen?«, regte Monk an.
»Ich … ich werde es versuchen. Ich weiß nicht, was …«
Dobokai schüttelte den Kopf. Ohne auf Monk zu achten, den er einfach ignorierte, begann er, Ember auf Englisch Fragen über chronische Krankheiten zu stellen, die ganz offenbar nichts mit dem Fall zu tun hatten. Danach erkundigte er sich über einige Kinder im Viertel und wollte wissen, welche Medikamente Ember für eine erfolgreiche Behandlung benötigte.
Hooper trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
Monk erging es genauso. Das war reine Zeitverschwendung und völlig sinnlos, außer Dobokai erneut eine Gelegenheit zu bieten, mit seinen Kenntnissen der ungarischen Gemeinde zu glänzen. Schon setzte Monk dazu an, das ausschweifende Gerede zu unterbrechen, doch Dobokai gebot ihm mit erhobener Hand Einhalt. Welch eine arrogante Geste! Monk spürte, wie in ihm der Zorn anschwoll, hielt sich aber noch zurück, während Ember irgendetwas auf Ungarisch erklärte. Gleichwohl ärgerte er sich maßlos über Dobokai. Der Kerl wollte doch nur seine Bedeutung in der kleinen Gemeinde ins rechte Licht rücken und hatte für die Ermittlungen nicht den geringsten Nutzen.
Als spürte er die Anspannung der Polizisten, unterbrach Ember jäh seinen Redefluss und blickte Monk an.
»Mr Monk wird dies wissen wollen«, versicherte Dobokai dem Arzt und wandte sich an den Kommandanten der Wasserpolizei. »Dr. Ember hat mir gerade von einem wirklich hässlichen Zwischenfall berichtet, der sich vor ein paar Wochen ereignet hat, als eine junge Frau, Eva Galambos, von einem Kerl ihres Alters belästigt wurde. Sie wurde nicht wirklich verletzt, stand aber schreckliche Ängste aus. Daraufhin besuchten ihre Brüder diesen Mann und machten ihm klar, dass er womöglich großes Ungemach erleiden würde, wenn sich dieser Vorfall wiederholte. Doch das half nichts – im Gegenteil! Seitdem hat sich die Situation rapide verschlechtert. Andere haben die Sache ebenfalls aufgegriffen, und jetzt mischen sich immer mehr Leute ein. Sie fühlen sich an zurückliegende Geschichten erinnert, ältere Streitereien werden wieder ausgegraben … Sie wissen, was ich meine?«
»Ja«, versicherte Hooper ihm eilig und wandte sich an Ember. »Ich könnte mir vorstellen, dass Sie wissen, welche Mitglieder Ihrer Gemeinde verletzt wurden.«
Der Arzt nickte. »So etwas geschieht überall. Wir sind hier Fremde – Gäste, wenn Sie so wollen. Es ist besser, wenn wir keinen Ärger machen. Damit können wir nicht gewinnen. Trotzdem sind es nur Kleinigkeiten, Dummheiten von jungen Männern. Balgereien. Das gibt es immer wieder. Das, was Fodor geschehen ist, war etwas ganz anderes. Alte Wunden. Sehr, sehr tief.«
»Wissen Sie von solchen Wunden?«, bohrte Monk nach, obwohl er nicht mehr erwartete als das, was er bereits in den Augen des anderen Mannes lesen konnte.
»Ich werde in meiner Praxis nur mit Fragmenten konfrontiert«, antwortete Ember. »Und die setze ich nicht notwendigerweise zusammen. Ich will helfen und heilen, aber diese Leute weigern sich, mir zu vertrauen. Und dann kann ich nichts für sie tun, nichts Gutes. Ich muss einen Fall immer von allen Seiten betrachten können.«
»Sagt ihnen die Zahl siebzehn irgendetwas?«, fragte Monk. »Könnte sie vielleicht mit einer Art Ritual zu tun haben?«
Ember starrte ihn mit leerer Miene an. »Nein. Warum?«
»In dem Zimmer, wo Mr Fodors Leiche entdeckt wurde, befanden sich siebzehn Kerzen.«
Ember schüttelte schweigend den Kopf.
Plötzlich stieß Dobokai einen merkwürdigen Laut aus, als bekäme er keine Luft mehr. Als Monk zu ihm herumfuhr, war sein Gesicht kreidebleich. »Siebzehn?«, keuchte er. »Haben Sie gesagt, dass siebzehn Kerzen in dem Zimmer waren?«
»Gewiss. Sie haben sie doch gesehen.«
»Ich …« Dobokai holte tief Luft. »Ich habe sie nicht gezählt.«
Monks Ton wurde scharf. »Was bedeutet die Zahl siebzehn?«
»Es gibt … oder vielmehr: Ich habe gehört, dass es eine Geheimgesellschaft gibt, und ›siebzehn‹ soll ihr Losungswort sein … ihr Kennwort, wenn Ihnen das lieber ist. Ich weiß sehr wenig über sie und will auch gar nichts damit zu tun haben. Ihre Mitglieder glauben an Okkultismus. Waren eine oder mehrere Kerzen von einer anderen Farbe als die übrigen?« Seine blauen Augen glühten beinahe.
»Ja«, sagte Monk langsam, der versuchte, sich möglichst genau zu erinnern, »zwei waren dunkel, glaube ich, von einer blauen oder violetten Schattierung. Warum?«
»Violett«, murmelte Dobokai, als wäre das bloße Wort mit einer besonderen Bedeutung beladen. »Violett für Macht über Menschen … dunkle Macht. Mehr weiß ich nicht darüber und will es auch nicht wissen. Es gibt Dinge, bei denen es besser ist, ahnungslos zu bleiben.« Er begann, sehr langsam den Kopf zu schütteln.
»Ungarisch oder englisch?«, drängte Monk.
»Das weiß ich nicht. Vielleicht ist diese Geheimgesellschaft überall.«
»Haben Sie in England davon gehört oder in Ihrem Heimatland?«
»Hier, in London, wenn auch von einem Ungarn. Aber … vielleicht pervertiert diese Gruppe hier die ursprüngliche Gesellschaft. Und bevor Sie mich fragen: Der Mann, von dem ich das gehört habe, hat London inzwischen verlassen. Und ich könnte Ihnen beim besten Willen nicht sagen, mit welchem Ziel.«
»Danke. Bitte setzen Sie mich in Kenntnis, wenn Ihnen noch etwas dazu einfällt.«
»Ich will tun, was in meinen Kräften steht, um Ihnen zu helfen«, versicherte Dobokai, blickte dabei aber nicht Monk an, sondern starrte vor sich hin. »Es geht schließlich um meine Landsleute. Es ist mir wichtig, dass Sie sie verstehen, so weit Ihnen das möglich ist. Was Fodor geschehen ist, ist schrecklich, aber vergessen Sie bitte, was ich über die Zahl siebzehn gesagt habe. Einer von uns Ungarn ist ein Teufel – oder einer von Ihren eigenen Teufeln ist unter uns. Vielleicht ist es irgendein Geistesgestörter, der meint, er hätte durch einen von uns schreckliches Unrecht erlitten, und der jetzt auf Rache sinnt.«
Monk ließ sich diese Möglichkeiten mehrere Minuten lang durch den Kopf gehen, ohne zu antworten. Schließlich wiederholte er lediglich seine Zusage, dass er Dobokais Hilfe gern annahm, und bedankte sich noch einmal bei Ember.
»Was halten Sie von dieser Sache mit der Siebzehn?«, erkundigte sich Hooper, als sie sich entfernten.
Monk war bedrückt. Er hasste Geheimgesellschaften jeder Art. Sie verliehen bestimmten Menschen eine Macht, die diese fast immer missbrauchten. Selbst Dobokai, der ansonsten so ausgeglichen wirkte, schien der Gedanke daran zu ängstigen.
»Entweder es ist tatsächlich etwas dran, oder er ist nur zufällig draufgekommen. Halten wir uns fürs Erste besser an das Übliche: Geldgier, Eifersucht und Rache.«
An den nächsten Tagen, als sie – auf Englisch und Ungarisch – mit den meisten Familien der Gemeinde sprachen, fielen Monk noch viel mehr mögliche Motive auf. Allmählich entstand ein sehr viel deutlicheres Bild von ihren Beziehungen untereinander. Zunächst bestand eine natürliche Nähe zwischen denjenigen, die die gleichen Wurzeln und Erinnerungen hatten und vor allem die Hoffnung auf ein neues Leben in einem neuen Land teilten. Außer der offensichtlichen Unterschiede war London in jeder Hinsicht völlig anders als ihre jeweiligen Heimatorte. Als Erstes machte sich der Verlust der früheren Gewissheiten bemerkbar: Die Vertrautheit des alltäglichen Lebens und die Geschichten, die sie einst miteinander verbunden hatten. Zugleich erkannte nicht jeder von ihnen neben all dem Schlechten in ihrem neuen Dasein auch das Gute.
Es war Dobokai, der, beabsichtigt oder nicht, seinen Landsleuten all diese Informationen für Monk entlockte. Er hatte eine seltsame Art, Personen zu befragen, und Monk rätselte die ganzen zwei Tage, die sie miteinander verbrachten, bis er Dobokais Methode – eine indirekte Befragung, die oft geradezu unsinnig erschien – endlich verstand.
»Wie geht es dir heute?«, fragte Dobokai beispielsweise einen Mann mittleren Alters, einen gewissen Lorand Gazda, der am Themse-Ufer auf einer Parkbank saß und mit kurzsichtigen Augen aufs Wasser hinausschaute.
Gazda schüttelte bedächtig den Kopf. Er hatte eine lange Nase und eine Glatze, umgeben von einem grauen Haarkranz. »Schön von dir, dass du fragst«, erwiderte er langsam.
»Schwere Zeiten«, murmelte Dobokai teilnahmsvoll, dann wandte er sich an Monk. »Lorand war einmal ein wohlhabender Mann, bis er durch die Revolution von ’48 all seine Ländereien verloren hat. Er stand auf der Seite der Freiheitskämpfer.« Kurz legte er dem Mann die Hand auf die Schulter. »Wie so viele andere auch. Jetzt haben die Österreicher uns ja mehr Freiheiten eingeräumt, aber einigen hat das zu lange gedauert.«
Monk hatte sich inzwischen genügend historische Kenntnisse angelesen, um zu wissen, dass die meisten europäischen Länder sich in der einen oder anderen Form gegen Unterdrückung erhoben hatten. Teilweise wäre ihnen der Aufstand sogar fast gelungen. Für einen kurzen Augenblick hatte man tatsächlich an den Beginn eines goldenen Zeitalters geglaubt. Doch dann hatten die altbekannten Mächtigen die Rebellionen eine nach der anderen niedergeschlagen. Paris, Rom, Berlin, Budapest, Wien – überall wurden die Menschen einer neuen Unterdrückung ausgesetzt, meist noch schlimmer als zuvor. Nur England schien ungeschoren davongekommen zu sein. So war es zum Land der Hoffnung so vieler Flüchtlinge geworden. Doch dieses Wissen verdankte Monk ausschließlich Geschichtsbüchern und mündlichen Berichten. Das Revolutionsjahr selbst lag genau in der Zeit, die infolge seines Gedächtnisverlusts in seinem Bewusstsein ausgelöscht worden war. Später hatte sich herausgestellt, dass er während des Höhepunkts der europäischen Unruhen in Kalifornien gewesen war und sich am Goldrausch des Jahres 1849 beteiligt hatte.
Mittlerweile hatte das freilich nichts mehr zu bedeuten. Niemand hatte ihn gezwungen, das Land seiner Jugend zu verlassen. Diese Heimat existierte immer noch. Nur konnte er sich schlicht nicht daran erinnern.
Dobokai sprach Gazda erneut sein Bedauern aus, ohne dass das zu irgendetwas zu führen schien.
»Aber du setzt dich trotzdem gern ans Ufer und schaust auf den Fluss hinaus«, meinte er nun in einem leichten Plauderton.
Gazdas Augen leuchteten auf. »Ein guter Fluss. Ein großartiger Hafen.« Er sprach zwar Englisch, aber ausschließlich an seinen Landsmann gewandt, als wäre Monk für ihn nicht anwesend.
Dobokai nickte. »Shadwell Dock.«
Auf einmal presste Gazda die Zähne aufeinander.
Das ließ Monk aufmerken.
»Ich nehme an, es hat dich zutiefst getroffen, als du vom Tod des armen Fodor erfuhrst«, fuhr Dobokai mit teilnahmsvoll gesenkter Stimme fort.
Gazda zuckte zusammen und wandte sich abrupt ab, um in die Ferne zu starren. Wie weit er tatsächlich sehen konnte, war nicht klar. Monk bezweifelte, dass er als Augenzeuge von irgendwelchem Nutzen sein würde, selbst wenn er zur richtigen Zeit zugegen gewesen wäre.
Dobokai wurde noch leiser und flüsterte fast. »Wir müssen etwas unternehmen, Lorand. Wir dürfen nicht zulassen, dass etwas derart Schreckliches noch einmal passiert. Was meinst du?«
Monk wurde unruhig. Völlig ohne Grund jagte Dobokai seinem Landsmann jetzt Angst ein. Sie hatten es doch lediglich mit einem einzelnen Gewaltverbrechen zu tun. Davor war nichts Vergleichbares geschehen, und es gab keinen Grund zu der Annahme, dass eine Tat dieser Art ein zweites Mal verübt werden würde. Er wollte schon in das Gespräch eingreifen, als Gazda sein Schweigen brach.
»Fodor war ein guter Mann, wirklich. Hatte natürlich auch seine Fehler. Die hat ja jeder. Aber er war großzügig und sagte nie ein böses Wort über andere. Wir nehmen niemandem seine Stelle weg, Dobokai. Das musst du den Einheimischen verständlich machen. Wir kümmern uns doch nur um uns selbst so wie alle anderen auch. Und dazu haben wir ein Recht. Engländer sind doch auch in allen möglichen Teilen der Welt gewesen, wo sie nichts zu suchen hatten. Können sie uns dann nicht hier ein bisschen Platz lassen?« Er erschauerte, obwohl er in der prallen Sonne saß. »Das begreife ich nicht. Warum Fodor? Und warum auf so … bestialische Weise? Sind das hier Barbaren?«